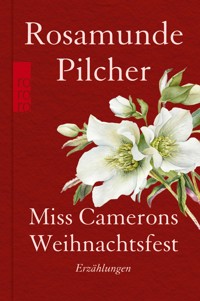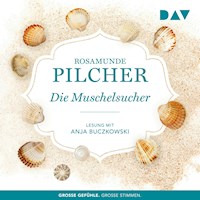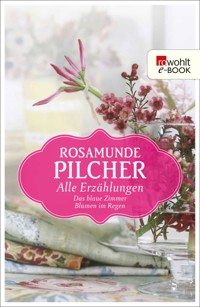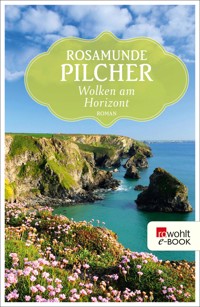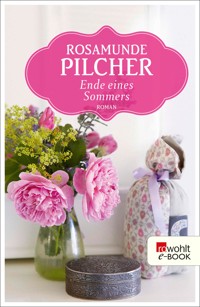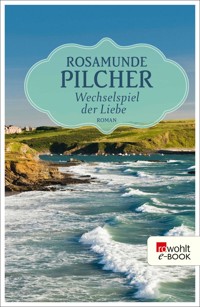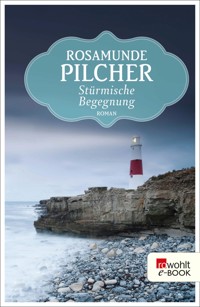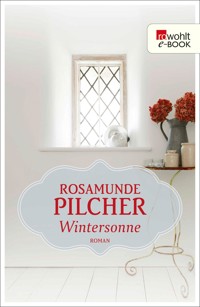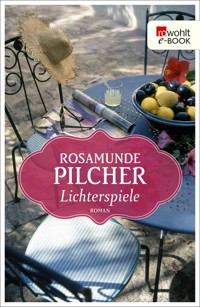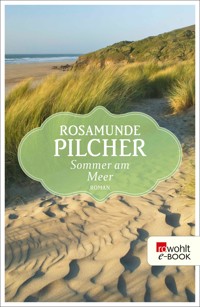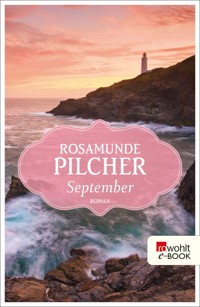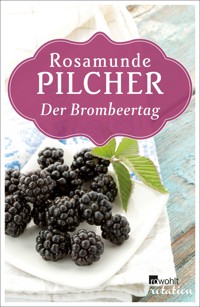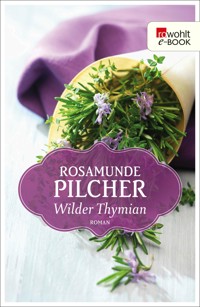Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Es wird allmählich Zeit, dass du heiratest.» Prue Shackleton, jung, schön und eigenwillig, kann die Ermahnungen ihrer Mutter nicht mehr hören. Statt sich um einen vielversprechenden Heiratskandidaten zu kümmern, fährt sie kurz entschlossen zu ihrer exzentrischen Tante ans Meer. In der einsamen Landschaft Cornwalls findet Prue Ruhe und Abstand. Doch damit ist es vorbei, als sie dem jungen Künstler Daniel begegnet ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Karussell des Lebens
Roman
Aus dem Englischen von Jürgen Abel
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
1
Meine Mutter stand in ihrem hübsch eingerichteten, von der Septembersonne durchfluteten Wohnzimmer und sagte: «Prue, du musst von Sinnen sein!»
Sie sah aus, als würde sie gleich in Tränen der Enttäuschung ausbrechen, aber ich wusste, sie würde es nicht tun, denn Tränen würden ihr makelloses Make-up verderben, ihr Gesicht anschwellen lassen, ihre Mundwinkel nach unten ziehen und verräterische Furchen vertiefen. So aufgebracht sie sein mochte, sie würde nicht weinen. Ihr Aussehen war ihr wichtiger als fast alles andere, und jetzt stand sie da, auf der anderen Seite des Kaminvorlegers, in einem untadeligen himbeerroten Wollkostüm und einer weißen Seidenbluse, mit ihren goldenen Ohrringen und ihrem Armband mit den Glücksbringern, ihrem silbrigen Haar, das perfekt gewellt und frisiert war.
Sie gab sich jedoch sichtlich Mühe, einen Konflikt widerstreitender Emotionen zu unterdrücken – Zorn, mütterliche Sorge, vor allem aber Enttäuschung. Sie tat mir sehr leid.
«Ach, hör schon auf, Ma, es ist nicht das Ende der Welt.» Schon während ich das sagte, klang es ziemlich lasch.
«Zum ersten Mal in deinem Leben hast du einen wirklich gutsituierten Mann an deiner Seite …»
«Ma, ‹gutsituiert› ist ein schrecklich altmodisches Wort.»
«Er ist charmant, er ist solide, er hat eine gute Stellung, und er kommt aus einer guten Familie. Du bist dreiundzwanzig, und es wird allmählich Zeit, dass du sesshaft wirst, heiratest, Kinder bekommst und ein richtiges Heim gründest.»
«Ma, er hat mir nicht mal einen Antrag gemacht.»
«Natürlich nicht. Er will es eben gleich richtig anfangen … dich mit nach Haus nehmen und seiner Mutter vorstellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es entspricht seiner ganzen Art. Man braucht euch ja nur zusammen zu sehen, um zu erkennen, dass er rasend in dich verliebt ist.»
«Nigel ist zur Raserei, in welcher Form auch immer, nicht fähig.»
«Ehrlich, Prue, ich weiß nicht, was du suchst.»
Wir hatten dieses Gespräch so oft geführt, dass ich meinen Text Wort für Wort kannte, als ob ich mich hingesetzt und ihn auswendig gelernt hätte. «Ich habe alles, was ich will. Eine Arbeit, die mir gefällt, eine kleine eigene Wohnung …»
«Man kann dieses Kellerzimmer kaum als Wohnung bezeichnen.»
«Und mir ist absolut nicht danach, sesshaft zu werden, wie du es nennst.»
«Du bist dreiundzwanzig. Ich war neunzehn, als ich heiratete.»
Um ein Haar hätte ich gesagt: Und sechs Jahre später warst du geschieden, aber ich tat es nicht. Sosehr sie mir auch auf die Nerven ging. So etwas konnte man nicht zu meiner Mutter sagen. Ich wusste, dass sie einen eisernen Willen und einen stahlharten Kern hatte, eine Garantie dafür, dass sie fast immer bekam, was sie wollte, aber sie hatte auch etwas Verwundbares – ihre zarte Gestalt, ihre großen blauen Augen, ihre augenfällige Weiblichkeit –, das grausame Worte verbot.
Also machte ich den Mund auf, schloss ihn wieder und sah sie verzagt an. Sie erwiderte meinen Blick vorwurfsvoll, aber nicht tadelnd, und ich begriff zum vielleicht tausendsten Mal, warum mein Vater von dem Moment an, als sie sich zum ersten Mal ansahen, verloren gewesen war. Sie hatten geheiratet, weil sie absolut unwiderstehlich war, und er verkörperte genau das, was sie gesucht hatte, seit ihr klargeworden war, dass es so etwas wie das andere Geschlecht gab.
Mein Vater heißt Hugh Shackleton. In jener Zeit arbeitete er in London, in einer Handelsbank in der City, führte ein solides Leben und hatte eine glänzende Zukunft vor sich. Aber im Grunde fühlte er sich wie ein Fisch, den man seinem Element entrissen hat. Die Shackletons waren eine Familie aus Northumberland, und mein Vater war dort auf einer Farm namens Windyedge aufgewachsen, einem Ort, wo die Weiden sich bis zur Nordsee hinunter erstreckten und Winterstürme tosten, die direkt vom Ural kamen. Mein Vater hatte seine Liebe zu jenem Land nie verloren und nie aufgehört, sich danach zu sehnen. Als er meine Mutter heiratete, wurde die Farm von seinem älteren Bruder bewirtschaftet, doch als ich ungefähr fünf war, kam dieser Bruder auf tragische Weise ums Leben, bei einem Jagdunfall. Mein Vater fuhr zur Beerdigung nach Northumberland. Er blieb fünf Tage fort und als er zu uns zurückkehrte, stand sein Entschluss fest. Er sagte meiner Mutter, er wolle bei der Bank kündigen, das Haus in London verkaufen und nach Windyedge zurückgehen.
Er wolle Farmer werden.
Die Szenen und Auseinandersetzungen, die Tränen und Vorwürfe, die auf diese Mitteilung folgten, gehören zu meinen ersten wirklich unglücklichen Erinnerungen. Meine Mutter versuchte alles, um ihn von seinem Entschluss abzubringen, aber mein Vater blieb hart. Schließlich spielte sie ihren letzten Trumpf aus. Wenn er nach Northumberland zurückgehen wolle, müsse er allein gehen. Sie war einigermaßen überrascht, als er ebendies tat. Vielleicht dachte er, sie würde ihm folgen, aber sie konnte genauso dickköpfig sein.
Binnen eines Jahres waren sie geschieden. Das Haus am Paulton Square wurde verkauft, und meine Mutter zog in ein anderes, kleineres, bei Parson’s Green. Ich blieb natürlich bei ihr, aber jedes Jahr fuhr ich für ein paar Wochen nach Northumberland, schon um den Kontakt zu meinem Vater nicht zu verlieren. Nach einer Weile heiratete er wieder, ein schüchternes, stämmiges Mädchen, dessen Tweedröcke immer ein bisschen fadenscheinig aussahen, dessen rosiges und sommersprossiges Gesicht nie auch nur die flüchtigste Bekanntschaft mit einer Puderquaste gemacht hatte. Sie waren sehr glücklich. Sie sind immer noch sehr glücklich. Und das freut mich.
Doch für meine Mutter war es nicht so leicht. Sie hatte meinen Vater geheiratet, weil er dem Bild eines Mannes zu entsprechen schien, das sie verstehen und bewundern konnte. Sie überlegte nie, was sich hinter den Requisiten von Nadelstreifenanzug und Aktenmappe befand. Sie hatte kein Verlangen, verborgene Tiefen auszuloten. Aber die Shackletons steckten voller Überraschungen, und zum Entsetzen meiner Mutter erbte ich die meisten davon. Mein verstorbener Onkel war nicht nur Farmer gewesen, sondern auch ein hervorragender Amateurmusiker. Mein Vater knüpfte in seiner Freizeit die wundervollsten Wandteppiche. Aber die wahre Rebellin war seine Schwester Phoebe. Sie war Künstlerin, eine begabte Malerin, und darüber hinaus war sie eine so originelle Persönlichkeit mit so wenig Achtung vor Konventionen, dass meine Mutter die größte Mühe hatte, sich an diese fremdartige Schwägerin zu gewöhnen.
Phoebe hatte sich als junge Frau in London niedergelassen, doch als sie älter wurde, streifte sie irgendwann einfach den Staub der Großstadt von ihren Schuhen und zog nach Cornwall, wo sie mit einem charmanten Mann, einem Bildhauer namens Chips Armitage, zusammenlebte. Sie heirateten nicht – ich glaube, weil seine Frau sich nicht von ihm scheiden lassen wollte. Als er starb, erbte sie sein kleines verwunschenes viktorianisches Haus in Penmarron, wo sie immer noch lebt.
Trotz des gesellschaftlichen Makels konnte meine Mutter Phoebe nicht komplett abschreiben, denn Phoebe war meine Patentante. Dann und wann lud sie meine Mutter und mich zu sich ein. Aus ihren Briefen ging jedes Mal deutlich hervor, dass sie ganz froh wäre, wenn ich allein käme. Aber meine Mutter fürchtete den schlechten Einfluss, den Phoebes halbseidener Lebensstil auf mich ausüben könnte, und getreu dem Prinzip, dass man einen Feind entweder besiegen oder sich mit ihm gutstellen sollte, begleitete sie mich immer bei diesen Besuchen, jedenfalls solange ich klein war.
Als wir das erste Mal nach Cornwall fuhren, hatte ich furchtbare Angst. Ich war noch ein Kind, aber ich wusste sehr wohl, dass meine Mutter und Phoebe nichts gemeinsam hatten, und fürchtete mich vor zwei endlosen Wochen voller Unstimmigkeiten und beredtem Schweigen. Aber ich unterschätzte Phoebes Weitsicht. Sie meisterte die Situation, indem sie meine Mutter mit Mrs. Tolliver bekannt machte. Mrs. Tolliver wohnte in Penmarron in White Lodge und hatte ständig einen absolut konventionellen kleinen Kreis von Freundinnen um sich, die nichts lieber taten, als meine Mutter an ihren Bridgenachmittagen und kleinen Dinnerpartys teilnehmen zu lassen.
Mit ihnen konnte sie an den schönen Tagen unbeschwert Karten spielen, während Phoebe und ich stundenlang am Strand spazieren gingen, unsere Staffeleien an der alten Kaimauer aufstellten, mit dem klapprigen Käfer, den Phoebe als Ateliermobil benutzte, landeinwärts fuhren oder ins Hochmoor kletterten und uns in Landschaften verloren, die von einem weißen, schimmernden Licht übergossen waren, dessen Quelle das Meer selbst zu sein schien.
Ungeachtet der Abneigung meiner Mutter übte Phoebe enormen Einfluss auf mich und mein Leben aus. Einen unbewussten Einfluss, weil sie mein ererbtes Zeichentalent zutage förderte und entwickelte. Und einen anderen, praktischeren Einfluss – vielleicht war es sogar ein gewisser Druck –, der mich in meinem Entschluss bestärkte, in Florenz zu studieren, eine Kunstakademie zu besuchen, und der schließlich darin gipfelte, dass Phoebe mir meinen gegenwärtigen Job in der Marcus Bernstein Gallery in der Cork Street verschaffte.
Und nun zankten wir uns wegen Phoebe. Nigel Gordon war vor einigen Monaten in mein Leben getreten. Er war der erste uneingeschränkt konventionelle Mensch, den ich jemals ein bisschen gemocht hatte, und als ich ihn mit nach Haus brachte, damit er meine Mutter kennenlernte, konnte sie ihr Entzücken nicht verhehlen. Er war sehr charmant zu ihr, flirtete ein wenig mit ihr und brachte ihr Blumen, und als sie erfuhr, dass er mich zu seiner Familie nach Schottland eingeladen hatte, um seine Mutter kennenzulernen, kannte ihre freudige Aufregung keine Grenzen. Sie hatte mir bereits Knickerbockerhosen aus Tweed «für das Hochmoor» gekauft, und ich wusste, dass ihre Phantasie schon zur Verlobungsanzeige in der Times vorauseilte, zu gedruckten Einladungen und einer Londoner Hochzeit mit mir in einer weißen Kreation, in der ich auch von hinten gut aussah.
Aber im letzten Augenblick hatte Phoebe all diesen schönen Träumen ein Ende gesetzt. Sie hatte sich den Arm gebrochen und als sie mit dem Arm in Gips aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Holly Cottage – so hieß ihr kleines Haus – zurückkam, rief sie mich an und bat mich inständig, zu kommen und ihr Gesellschaft zu leisten. Zwar meisterte sie das tägliche Leben schon wieder ganz gut allein, aber sie konnte nicht Auto fahren, und so lange unbeweglich zu bleiben, bis der Gips abgenommen wurde, war für sie eine unerträgliche Aussicht.
Während ich ihr am Telefon zuhörte, überkam mich ein ungewöhnliches Gefühl der Erleichterung, und erst jetzt gestand ich mir ein, dass ich nicht nach Norden fahren und bei den Gordons zu Gast sein wollte. So weit wollte ich mich einfach nicht mit Nigel einlassen. Unbewusst hatte ich mich nach einem Vorwand gesehnt, der mir erlaubte, mich aus der Beziehung hinauszustehlen. Und da wurde er mir sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Ohne eine Sekunde zu zögern, sagte ich Phoebe zu. Dann sagte ich Nigel, ich könne leider nicht mit ihm nach Schottland fahren. Und nun sagte ich es meiner Mutter.
Sie war, wie vorauszusehen, am Boden zerstört.
«Cornwall. Zu Phoebe.» Aus ihrem Mund klang es wie die schlimmste aller Sackgassen.
«Ich muss hin, Ma.» Ich versuchte, sie zu einem Lächeln zu bewegen. «Du weißt doch, was für eine Katastrophe es ist, wenn sie ihre alte Kiste fährt, selbst mit zwei Armen.»
Aber sie war über den Punkt hinaus, an dem man ihr noch ein Lächeln abringen konnte. «Wie unhöflich, im letzten Moment abzusagen. Was wird Nigels Mutter denken?»
«Ich werde ihr schreiben. Ich bin sicher, dass sie es verstehen wird.»
«Und bei Phoebe … Bei Phoebe wirst du niemanden kennenlernen als ungewaschene Studenten und schlampig gekleidete Frauen mit Holzketten und selbstgewebten Ponchos.»
«Vielleicht wird Mrs. Tolliver mit einem passablen Mann für mich ankommen.»
«Darüber scherzt man nicht.»
«Es ist mein Leben», sagte ich sanft.
«Das hast du immer gesagt. Auch, als du ausgezogen bist, um in diesem grauenhaften Keller in Islington zu wohnen. Ausgerechnet Islington.»
«Islington ist ausgesprochen in.»
«Und als du dich an dieser schrecklichen Kunstschule eingeschrieben hast …»
«Ich habe wenigstens eine sehr gute Stelle bekommen. Das musst du zugeben.»
«Du solltest verheiratet sein. Dann müsstest du nicht arbeiten.»
«Ich würde die Stelle auch dann nicht aufgeben, wenn ich verheiratet wäre.»
«Aber das ist keine Zukunft, Prue. Ich möchte, dass du ein anständiges Leben führst.»
«Ich finde, es ist ein anständiges Leben.»
Wir sahen uns einen Moment lang an. Dann seufzte meine Mutter, resigniert und offenbar schwer getroffen. Und ich wusste, dass die Auseinandersetzung vorerst beendet war.
«Ich werde dich nie verstehen», sagte sie hilflos.
Ich trat zu ihr und umarmte sie. «Versuch es gar nicht erst», sagte ich. «Lächle einfach und hab mich weiter lieb. Ich schreibe dir eine Karte aus Cornwall.»
Ich hatte beschlossen, nicht mit dem Auto nach Penmarron zu fahren, sondern mit der Eisenbahn. Am nächsten Morgen nahm ich ein Taxi zum Bahnhof Paddington und suchte den richtigen Bahnsteig und den richtigen Wagen. Ich hatte einen Platz reserviert, aber der Zug war halb leer; um diese Jahreszeit, Mitte September, war der Strom der Urlauber so gut wie versiegt. Gerade hatte ich mein Gepäck verstaut und mich hingesetzt, als es ans Fenster klopfte. Ich sah auf und erblickte draußen einen Mann, der in einer Hand eine Aktentasche und in der anderen einen Blumenstrauß hielt.
Es war Nigel. Was für eine Überraschung.
Ich stand auf, ging zurück zur Tür und stieg wieder aus. Er kam verlegen lächelnd auf mich zu.
«Prue. Ich dachte schon, ich würde dich nicht finden.»
«Was um alles in der Welt tust du hier?»
«Ich wollte dir auf Wiedersehen sagen. Dir gute Reise wünschen.» Er streckte die Hand mit dem Strauß aus, es waren kleine struppige gelbe Chrysanthemen. «Und dir das hier geben.»
Wider Willen war ich sehr gerührt. Mir war klar, dass sein Erscheinen hier auf dem Bahnhof eine großherzige Geste des Verzeihens war, mit der er zugleich sagen wollte, er habe verstanden, warum ich ihm den Laufpass gab. Die Folge war, dass ich mir gemeiner denn je vorkam. Ich nahm die in einer steifen weißen Papierkrause steckenden Blumen und roch daran. Sie dufteten herrlich. Ich sah Nigel an und lächelte.
«Es ist zehn Uhr. Müsstest du nicht am Schreibtisch sitzen?»
Er schüttelte den Kopf. «Keine Eile.»
«Ich hab gar nicht gewusst, dass du ein so hohes Tier in der Bankwelt bist.»
Nigel grinste. «Bin ich auch nicht, aber ich brauche die Zeit nicht zu stechen. Ich hab allerdings angerufen. Und gesagt, es sei etwas dazwischengekommen.» Er hatte ein markantes Gesicht und blonde Haare, die schon ein bisschen schütter wurden, aber wenn er so grinste, sah er richtig jungenhaft aus. Langsam fragte ich mich doch, ob ich verrückt geworden sei. Diesen liebenswerten Mann sitzenzulassen, um meine unberechenbare Tante Phoebe zu pflegen. Vielleicht hatte meine Mutter trotz allem recht gehabt.
Ich sagte: «Entschuldige, dass ich abgesagt habe. Ich hab gestern Abend deiner Mutter geschrieben.»
«Vielleicht ein andermal», sagte Nigel großmütig. «Lass auf jeden Fall von dir hören. Sag mir Bescheid, wann du zurückkommst.»
Ich wusste, er würde auf mich warten, wenn ich ihn darum bäte. Er würde mich vom Bahnhof abholen, mich nach Islington bringen, und wir würden unsere Beziehung wieder aufnehmen, als ob ich nie fort gewesen wäre.
«Das werde ich.»
«Ich hoffe, deine Tante erholt sich schnell.»
«Sie hat sich nur den Arm gebrochen. Sie ist nicht richtig krank.»
Eine kurze, unbehagliche Pause entstand. Dann räusperte er sich, trat vor und gab mir einen Kuss auf die Wange, allerdings mehr in die Luft als auf die Wange gehaucht. «Auf Wiedersehen, und gute Reise.»
«Danke, dass du gekommen bist. Und danke für die Blumen.»
Er machte eine vage Geste, als wolle er winken, drehte sich um und ging. Ich sah ihm nach, während er sich einen Weg zwischen den Trägern, Karren und Familien mit Koffern suchte. An der Sperre drehte er sich noch einmal um. Wir winkten uns zu. Dann war er fort. Ich stieg wieder in den Zug, legte die Blumen ins Gepäcknetz und setzte mich hin. Ich wünschte, er wäre nicht gekommen.
Ich war durch und durch eine Shackleton, aber dann und wann brachen bei mir Emotionen durch, die fraglos unmittelbar auf meine Mutter zurückgingen. Dies war eine solche Phase. Ich musste verrückt sein, nicht mit Nigel zusammen sein zu wollen, mich nicht enger an ihn zu binden, nicht sogar den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen. Normalerweise scheute ich schon beim Gedanken daran, sesshaft zu werden, wie ein junger Gaul, aber als ich da im Zug saß und auf den Bahnsteig hinaussah, kam es mir auf einmal enorm verlockend vor. Sicherheit. Das war es, was dieser zuverlässige Mann mir geben würde. Ich stellte mir vor, in seiner gepflegten Londoner Wohnung zu leben, in den Ferien nach Schottland zu fahren, nur dann zu arbeiten, wenn ich wollte, und nicht, weil ich Geld brauchte. Ich dachte daran, wie es wäre, Kinder zu haben …
Jemand sagte: «Entschuldigung, ist dieser Platz frei?»
«Was …?» Ich blickte auf und sah einen Mann vor mir stehen. Er trug einen kleinen Koffer und hatte ein Kind an der Hand, ein kleines dünnes Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt, mit dunklen Haaren und einer hässlichen runden Brille.
«Ja.»
«Gut», sagte er und legte den Koffer ins Gepäcknetz. Er sah nicht so aus, als ob ihm danach sei, freundliche Belanglosigkeiten auszutauschen. Ich wollte ihn bitten, auf meinen Blumenstrauß achtzugeben, aber eine gewisse Fahrigkeit in seinen Gesten hielt mich davon ab. Er war, wie Nigel, für irgendein Büro in der City gekleidet. Aber sein marineblauer Nadelstreifenanzug saß zu eng, als hätte er in letzter Zeit kräftig zugenommen (ich dachte an gewaltige Arbeitsessen auf Spesen), und als er den Koffer hochstemmte, hatte ich einen guten Blick auf sein teures, fast aus den Nähten platzendes Hemd. Er war dunkelhaarig und hatte vermutlich früher mal ganz gut ausgesehen, aber jetzt hatte er ein ziemliches Doppelkinn, eine kränkliche Gesichtsfarbe und grau werdendes Haar, das hinten auffallend lang war, wohl um von der kahlen Stelle auf dem Kopf abzulenken.
«So», sagte er zu dem kleinen Mädchen. «Und nun setz dich hin.»
Folgsam setzte sie sich auf den vorderen Rand des Sitzes. Sie hatte ein Comic-Heft in der Hand und trug eine kleine rote Umhängetasche. Ihr Haar war sehr kurz geschnitten, sodass der dünne Hals noch länger wirkte. Das blasse Gesicht, die Brille und ihre resigniert-unglückliche Miene ließen mich unwillkürlich an kleine Jungen in steifen neuen Schuluniformen denken, die auf Bahnsteigen mit den Tränen kämpften und unbewegt zuhörten, wie dicke Väter behaupteten, es würde ganz sicher einen Mordsspaß machen, aufs Internat zu gehen.
«Hast du auch bestimmt deine Fahrkarte?»
Sie nickte.
«Großmutter wird dich in St. Abbatt’s Junction am Bahnhof abholen.»
Sie nickte wieder.
«Hm …» Der Mann fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Er konnte es offensichtlich kaum abwarten zu gehen. «Das wär’s also. Du wirst dich bei ihr bestimmt wohl fühlen.»
Sie nickte abermals. Sie sahen sich an, ohne zu lächeln. Er hatte sich schon umgedreht, als ihm noch etwas einfiel.
«Da …» Er griff in seine Brusttasche, nahm eine Krokobrieftasche heraus und zog eine Zehnpfundnote daraus hervor. «Du wirst etwas zu essen brauchen. Geh bitte in den Speisewagen, wenn du Hunger hast, und bestell dir etwas.»
Sie nahm den Geldschein und starrte ihn unglücklich an.
«Dann auf Wiedersehen.»
«Auf Wiedersehen.»
Er ging. Am Fenster blieb er kurz stehen, winkte und lächelte flüchtig. Dann verschwand er, eilte wahrscheinlich zu einem teuren protzigen Auto, das ihn in die sichere Männerwelt seiner Arbeit zurückbrachte.
Wie ich eben festgestellt hatte, dass Nigel sehr nett sei, stellte ich nun fest, dass dieser Mann schrecklich war, und fragte mich, wie um alles in der Welt ein so unangenehmer Zeitgenosse die Aufgabe bekommen hatte, das kleine Mädchen in den Zug zu setzen. Sie saß mucksmäuschenstill neben mir. Nach einer Weile langte sie nach ihrer Handtasche, öffnete den Reißverschluss, steckte die Zehnpfundnote hinein und zog den Reißverschluss wieder zu. Ich erwog, irgendetwas Freundliches zu ihr zu sagen, aber hinter den Brillengläsern schimmerte es verdächtig, und deshalb beschloss ich, sie vorerst in Ruhe zu lassen. Einen Augenblick später setzte der Zug sich in Bewegung, und wir verließen den Bahnhof.
Ich schlug meine Times auf, las die Überschriften und all die deprimierenden Nachrichten und wandte mich dann mit einem angenehmen Gefühl der Erleichterung dem Feuilleton zu. Ich fand, was ich suchte, die Besprechung einer Ausstellung, die einige Tage vorher in der Peter Chastal Gallery, nur ein paar Häuser weit von Marcus Bernstein, wo ich arbeitete, eröffnet worden war.
Der Maler war ein junger Mann namens Daniel Cassens. Ich hatte mich schon lange für seine Karriere interessiert, weil er mit ungefähr zwanzig ein Jahr lang bei Phoebe in Cornwall gewohnt und bei Chips Bildhauerei studiert hatte. Ich hatte ihn nie kennengelernt, aber Phoebe und Chips hatten ihn liebgewonnen, und als er ging, um seine Arbeit in Amerika fortzusetzen, hatte Phoebe seine Fortschritte so eifrig und begeistert verfolgt, als wäre er ihr eigener Sohn.
Er war gereist, hatte einige Jahre in Amerika verbracht und war dann nach Japan gegangen, wo er sich mit der unendlich komplizierten Schlichtheit der fernöstlichen Kunst beschäftigt hatte.
Seine neue Ausstellung war gewissermaßen das Ergebnis seiner Jahre in Japan, und die begeisterte Besprechung in der Times hob die Ruhe und die Formvollendung von Daniel Cassens’ Arbeiten hervor, die meisterhafte Pinselführung bei den Aquarellen, die feinfühlige Perfektion der kleinen Nuancen.
Es ist eine einzigartige Sammlung, schloss der Kritiker. Die Gemälde ergänzen einander, jedes ist gewissermaßen eine Facette einer vollkommenen und seltenen Erfahrung. Machen Sie sich eine oder anderthalb Stunden von Ihren täglichen Pflichten frei und besuchen Sie die Chastal Gallery. Sie werden gewiss nicht enttäuscht sein.
Phoebe würde überglücklich sein; ich freute mich für sie. Ich legte die Zeitung weg, schaute aus dem Fenster und sah, dass wir die Vororte hinter uns gelassen hatten und durch ländliche Gegenden fuhren. Es war ein feuchter Tag mit dicken grauen Wolken, die über den ganzen Himmel zogen und nur ab und zu einen klaren blauen Tupfen frei gaben. Die Bäume färbten sich langsam rot, die ersten Blätter fielen. Bauern pflügten ihre Felder, und die Gärten der vereinzelten Häuser wirkten von dem schnell dahinfahrenden Zug aus wie mit violetter Farbe übergossen: Das Heidekraut blühte.
Ich erinnerte mich an meine kleine Begleiterin und drehte mich zu ihr um. Sie hatte ihr Comic-Heft noch nicht aufgeschlagen, ihren Mantel noch nicht aufgeknöpft, aber in ihren Augen schimmerten keine Tränen mehr, und sie wirkte ein bisschen gefasster.
«Wohin fährst du?», fragte ich.
«Nach Cornwall.»
«Oh, da fahre ich auch hin. Wohin nach Cornwall?»
«Zu meiner Großmutter.»
«Das wird sicher sehr schön.» Ich dachte einen Moment nach. «Aber sind die Ferien nicht zu Ende? Müsstest du nicht zur Schule?»
«Ja. Ich gehe auf ein Internat. Wir waren alle schon wieder aus den Ferien zurück, aber dann ist der Heizungskessel geplatzt. Sie haben die Schule für eine Woche geschlossen, bis er repariert ist, und uns nach Haus geschickt.»
«Wie schrecklich. Hoffentlich ist niemandem etwas passiert.»
«Nein. Aber Miss Brownrigg, die Schulleiterin, musste sich einen Tag hinlegen. Die Lehrerin hat gesagt, es ist ein Schock für sie gewesen.»
«Das wundert mich nicht.»
«Deshalb bin ich nach Haus gefahren, aber da ist nur mein Vater. Meine Mutter ist auf Mallorca, sie macht Urlaub. Sie ist kurz vor dem Ende der Ferien hingefahren. Deshalb muss ich zu Granny.»
Nach dem Klang ihrer Stimme zu urteilen, schien sie diese Aussicht nicht sehr vielversprechend zu finden. Ich wollte ihr etwas Tröstliches sagen, um sie aufzumuntern, aber mir fiel auf Anhieb nichts ein, und so nahm sie ihr Comic-Heft, schlug es auf und fing an zu lesen. Ich kapierte. Lächelnd suchte ich mein Buch hervor und begann ebenfalls zu lesen. Wir setzten die Reise in unsere Lektüre vertieft fort, bis der Speisewagenkellner durch den Gang kam und mitteilte, der Lunch werde jetzt serviert.
Ich legte mein Buch hin. «Möchtest du jetzt was essen?», fragte ich, denn ich wusste ja von der Zehnpfundnote in ihrer Handtasche.
Sie sah mich gequält an. «Ich … Ich weiß nicht, wo es ist.»
«Ich gehe auch. Möchtest du mit mir kommen? Wir könnten zusammen essen.»
Sie wirkte dankbar und erleichtert. «Oh, darf ich? Ich hab genug Geld, aber ich bin noch nie allein Zug gefahren, und ich weiß nicht, was man da machen muss.»
«Ich weiß, es ist alles ziemlich verwirrend. Komm, gehen wir, ehe die Tische alle besetzt sind.»
Wir gingen hintereinander durch die schaukelnden Waggons, erreichten den Speisewagen und wurden an einen Tisch für zwei Personen geführt. Er war mit einem sauberen weißen Tuch gedeckt, und darauf stand eine Glasvase mit Blumen.
Sie sagte: «Mir ist ein bisschen heiß. Glauben Sie, ich kann meinen Mantel ausziehen?»
«Das wäre eine gute Idee.»
Der Kellner kam, um ihr zu helfen, faltete den Mantel der Länge nach zusammen und legte ihn über ihre Stuhllehne. Wir schlugen die Speisekarte auf.
«Hast du Hunger?», fragte ich.
«Ja. Das Frühstück ist eine Ewigkeit her.»
«Wo wohnst du denn?»
«In Sunningdale. Ich bin mit meinem Vater mit dem Auto nach London gefahren. Er fährt jeden Tag hoch.»
«Dein …? Der Herr, der dich zum Zug gebracht hat, war dein Vater?»
«Ja.» Er hatte ihr nicht einmal einen Abschiedskuss gegeben. «Er arbeitet in einem Büro in der City.» Unsere Blicke trafen sich, dann schaute sie rasch in eine andere Richtung. «Er kommt nicht gern zu spät.»
«Die meisten Männer mögen Verspätungen im Büro nicht gern», sagte ich beruhigend.
«Ist es seine Mutter, zu der du fährst?»
«Nein. Granny ist die Mutter von meiner Mutter.»
Geschwätzig fuhr ich fort: «Ich fahre zu einer Tante von mir. Sie hat sich den Arm gebrochen und kann nicht Auto fahren, und deshalb fahre ich hin und kümmere mich ein bisschen um sie. Sie wohnt ganz am Ende von Cornwall in einem Dorf, das Penmarron heißt.»
«Penmarron? Aber da fahre ich auch hin!»
Das war ein sonderbares Zusammentreffen. «Was für ein Zufall», sagte ich verwundert.
«Ich heiße Collis, Charlotte Collis. Ich bin die Enkelin von Mrs. Tolliver. Kennen Sie Mrs. Tolliver?»
«O ja. Nicht sehr gut, aber ich kenne sie. Meine Mutter hat oft Bridge mit ihr gespielt. Übrigens, meine Tante heißt Phoebe Shackleton.»
Jetzt leuchtete ihr Gesicht auf. Zum ersten Mal, seit sie im Zug saß, sah sie aus wie ein richtiges kleines Mädchen, das sich freute. Die Augen hinter den Brillengläsern wurden ganz groß. Sie öffnete überrascht den Mund, und die Zähne, die ich sah, waren entschieden zu groß für ihr schmales Gesichtchen.
«Phoebe! Phoebe ist meine beste Freundin. Ich gehe oft zu ihr, und wir trinken Tee und reden miteinander, jedes Mal, wenn ich bei Gran bin. Ich hab nicht gewusst, dass sie sich den Arm gebrochen hat.» Sie sah mir in die Augen. «Sie … Sie sind doch nicht Prue, oder?»
Ich lächelte. «Doch, genau die bin ich. Woher weißt du das?»
«Sie sind mir gleich irgendwie bekannt vorgekommen. Ich habe ein Foto von Ihnen in Phoebes Wohnzimmer gesehen. Ich fand schon immer, dass Sie wunderschön aussehen.»
«Oh. Vielen Dank.»
«Und Phoebe hat mir von Ihnen erzählt, wenn ich sie besucht habe. Es ist sehr schön, Tee mit ihr zu trinken, gar nicht, als wenn man bei einem Erwachsenen zu Besuch ist, und ich darf allein kommen. Und wir spielen immer mit dem Karussell, das früher ein Grammophon gewesen ist.»
«Das hat mir gehört. Chips hat es für mich gemacht.»
«Ich hab Chips nicht gekannt. Er war schon tot, als ich noch ganz klein war.»
«Und ich hab deine Mutter nie kennengelernt», entgegnete ich.
«Aber wir fahren fast jeden Sommer zu Gran.»
«Und ich bin meistens Ostern da, oder manchmal Weihnachten, und deshalb sind wir uns nie begegnet. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wie sie heißt.»
«Annabelle. Annabelle Tolliver. Jetzt heißt sie natürlich Mrs. Collis.»
«Und hast du Brüder und Schwestern?»
«Einen Bruder. Er heißt Michael. Er ist fünfzehn und geht in Wellington zur Schule.»
«Und in Wellington ist der Heizkessel nicht explodiert?»
Es war ein Versuch, das Gespräch etwas lustiger zu gestalten, aber Charlotte lächelte nicht. Sie sagte: «Nein.»
Ich studierte die Speisekarte und dachte an Mrs. Tolliver. In meiner Erinnerung war sie eine großgewachsene, elegante und ziemlich kühle Frau, immer makellos gekleidet, mit untadelig frisierten grauen Haaren, stets frisch gebügelten Plisseeröcken und langen, schmalen Schuhen, die wie Kastanien glänzten. Ich dachte an White Lodge, wo Charlotte wohnen würde, und fragte mich, was ein Kind wohl in diesem peinlich gepflegten Garten, diesem stillen und ordentlichen Haus anfangen würde.