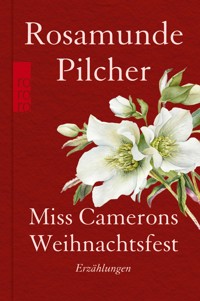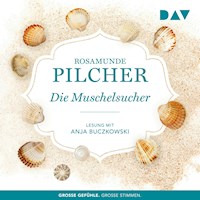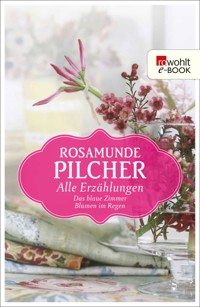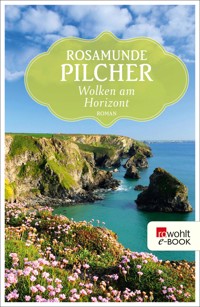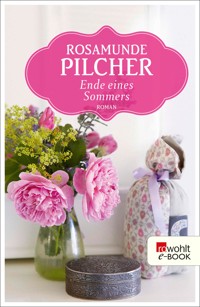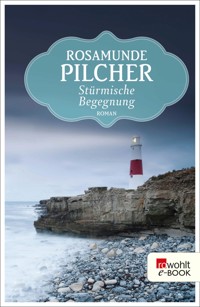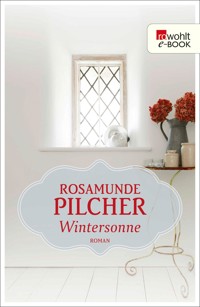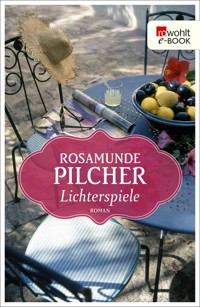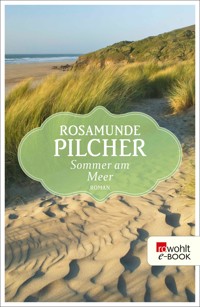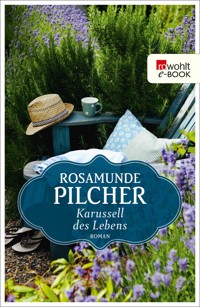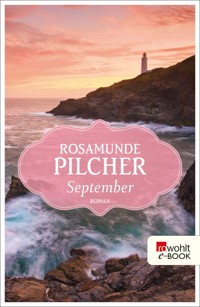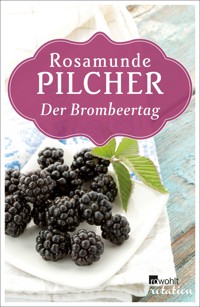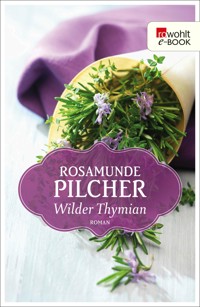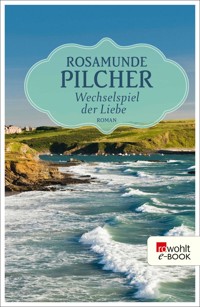
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ganz nah und doch ganz fern Fast jede Familie hat ein Geheimnis zu verbergen, aber die Wahrheit, der Flora Waring auf die Spur kommt, ist mehr als außergewöhnlich: Die junge Frau erfährt, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Sie entdeckt einen Menschen, der ihr äußerlich gleicht, aber viel leichtfertiger und unkonventioneller als sie lebt. Und Floras Welt steht kopf, als sie Tony Armstrong, den früheren Verlobten ihrer Schwester, kennenlernt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Wechselspiel der Liebe
Roman
Aus dem Englischen von Dietlind Kaiser
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Isobel
Er hatte ihr den Rücken zugewandt, stand am Fenster, eingerahmt von den verschossenen Vorhängen, die sie vor vierzig Jahren ausgesucht hatte. Die Sonne hatte die leuchtenden Rosen zu einem blassen Rosa ausgebleicht, und der Stoff war so fadenscheinig, dass man ihn nicht mehr reinigen lassen konnte, weil er sich sonst völlig aufgelöst hätte. Aber sie liebte die Vorhänge; sie waren ihr vertraut wie alte Freunde. Seit Jahren versuchte ihre Tochter Isobel, sie dazu zu überreden, dass sie neue kaufte, aber Tuppy hatte gesagt: «So lange wie ich werden sie noch halten», ohne sich viel dabei zu denken. «So lange wie ich werden sie noch halten.»
Und jetzt sah alles danach aus, dass es so kommen würde. Sie war siebenundsiebzig, und nachdem sie ein Leben lang immer kerngesund gewesen war, hatte sie zu spät und zu lange im Garten gearbeitet und sich eine Erkältung geholt, aus der eine Lungenentzündung geworden war. Sie erinnerte sich kaum an die Lungenentzündung – nur daran, dass der Arzt, als sie aus einem langen, dunklen Tunnel des Unbehagens wieder auftauchte, drei Mal täglich kam und dass eine Krankenschwester da war, um Tuppy zu pflegen. Die Schwester, eine Witwe aus Fort William, hieß Mrs. McLeod. Sie war groß und hager, mit einem Gesicht wie ein verlässliches Pferd, und trug eine marineblaue Tracht mit einem gesteiften Schürzenlatz, unter dem ihre flache Brust wie ein Brett aussah, und Schuhe, die kein Ende nahmen. Trotz ihres wenig gewinnenden Äußeren war sie herzensgut.
Die Sache mit dem Tod war jetzt also keine ferne Möglichkeit mehr, über die man nicht nachdachte, sondern eine unbarmherzig näher rückende Tatsache.
Sie hatte nicht die geringste Angst davor, aber es kam ungelegen. Ihre Gedanken glitten so mühelos wie immer in letzter Zeit in die Vergangenheit zurück, und sie dachte an sich als junge Ehefrau, zwanzig Jahre alt, der zum ersten Mal bewusst wurde, dass sie schwanger war. Sie war verärgert und enttäuscht gewesen, weil das hieß, dass sie im Dezember so rund und riesig sein würde wie die Albert Hall und zu keinem der Weihnachtsbälle gehen könnte. Ihre Schwiegermutter hatte sie munter getröstet, indem sie sagte: «Ein Kind kommt nie zum gelegenen Zeitpunkt.» Vielleicht war es mit dem Sterben auch so. Man musste es einfach hinnehmen, wenn es kam.
Es war ein strahlender Morgen gewesen, aber jetzt war die Sonne verschwunden, und ein kaltes Licht füllte das Fenster neben der Gestalt des Arztes. «Kommt Regen?», fragte Tuppy.
«Eher Nebel vom Meer», sagte er. «Man kann die Inseln nicht sehen. Eigg ist vor etwa einer halben Stunde verschwunden.»
Sie schaute ihn an, einen großen Mann, kräftig wie ein Felsen, ein tröstlicher Anblick in abgetragenem Tweed, der mit den Händen in den Taschen dastand, als habe er nichts Dringenderes zu tun. Er war ein guter Arzt, so gut, wie sein Vater gewesen war. Dennoch war es ihr anfangs etwas seltsam vorgekommen, dass jemand nach ihr sah und ihr Anweisungen gab, den sie als stämmigen kleinen Jungen in Shorts gekannt hatte, mit zerschrammten Knien und Sand im Haar.
Jetzt, als er im Licht stand, fiel ihr auf, dass dieses Haar an den Schläfen grau wurde. Plötzlich fühlte sie sich älter als je zuvor, älter noch als bei dem Gedanken an ihren bevorstehenden Tod.
«Du wirst grau», sagte sie mit einer gewissen Schärfe, als habe er nicht das Recht, sich solche Freiheiten herauszunehmen.
Er drehte sich um, lächelte schuldbewusst, fuhr sich mit der Hand an den Kopf.
«Ich weiß. Der Friseur hat es mir neulich gesagt.»
«Wie alt bist du?»
«Sechsunddreißig.»
«Noch ein Junge. Du dürftest noch nicht grau werden.»
«Vielleicht liegt es daran, dass es so anstrengend war, mich um Sie zu kümmern.»
Unter der Tweedjacke trug er einen gestrickten Pullover. Er löste sich am Kragen auf und hatte vorn ein Loch, das gestopft werden musste. Tuppy blutete das Herz. Er wurde nicht versorgt, nicht geliebt. Und er hätte überhaupt nicht hier sein sollen, vergraben in den West Highlands, wo er sich um die Alltagswehwehchen einer Gemeinde aus Heringsfischern und vereinzelten Pachtbauern kümmern musste. Er hätte in London oder Edinburgh sein sollen, mit einem großen, eindrucksvollen Haus, einem Bentley vor der Tür und einem Messingschild am Eingang. Er hätte lehren oder in der Forschung arbeiten sollen – Aufsätze verfassen, Medizingeschichte schreiben.
Er war ein glänzender Student gewesen, wunderbar begeisterungsfähig und ehrgeizig; alle hatten eine glorreiche Karriere von ihm erwartet. Aber dann hatte er in London dieses törichte Mädchen kennengelernt; Tuppy konnte sich kaum noch an ihren Namen erinnern. Diana. Er hatte sie nach Tarbole mitgebracht, und niemand hatte sie leiden können, aber alle Einwände seines Vaters hatten ihn in seiner Entschlossenheit, sie zu heiraten, nur noch bestärkt. (Das lag in seinem Charakter. Hugh war von jeher stur wie ein Maulesel gewesen, und Widerspruch machte das noch schlimmer. Sein Vater hätte das wissen müssen. Er hatte es ganz falsch angepackt, und wenn der alte Dr. Kyle noch am Leben gewesen wäre, hätte sie ihm das auch gesagt und kein Blatt vor den Mund genommen.)
Die Mesalliance war tragisch ausgegangen, und als alles vorbei war, sammelte er die Scherben seines Lebens auf und kehrte zurück nach Tarbole, um die Praxis seines Vaters zu übernehmen.
Jetzt lebte er allein, fristete das freudlose Dasein eines alternden Junggesellen. Er arbeitete zu schwer, und Tuppy wusste, dass er auf sich viel weniger achtete als auf seine Patienten und sein Abendessen meist aus einem Glas Whisky und einem Stück Pastete aus dem Pub bestand.
«Warum hat Jessie McKenzie denn deinen Pullover nicht gestopft?», fragte sie.
«Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich vergessen, sie darum zu bitten.»
«Du solltest wieder heiraten.»
Er ging darauf nicht ein, sondern kam an ihr Bett zurück. Sofort löste sich das zusammengerollte Fellknäuel am Fußende von Tuppys Bett zu einem ältlichen Yorkshireterrier auf, fuhr von der Daunendecke hoch wie eine Kobra, knurrte wild und fletschte die vom Alter gelichteten Zähne.
«Sukey!», schimpfte Tuppy, aber der Arzt war unbeeindruckt.
«Sie wäre nicht mehr Sukey, wenn sie nicht damit drohen würde, mir an die Kehle zu gehen, sobald ich in Ihre Nähe komme.» Er streckte freundlich die Hand aus, und das Knurren schwoll zu einem grollenden Crescendo an. Er bückte sich nach seiner Tasche. «Ich muss gehen.»
«Wen besuchst du denn jetzt?»
«Mrs. Cooper. Und dann Anna Stoddart.»
«Anna? Was fehlt denn Anna?»
«Anna fehlt gar nichts. Im Gegenteil, es geht ihr bestens. Es verstößt zwar gegen meine Schweigepflicht, aber sie bekommt ein Kind.»
«Anna? Nach so langer Zeit?» Tuppy war hocherfreut.
«Ich habe mir gedacht, dass Sie das aufheitert. Aber sagen Sie nichts darüber. Sie möchte es noch geheim halten, jedenfalls vorerst.»
«Ich sage keinen Mucks. Wie geht es ihr?»
«Bis jetzt ausgezeichnet. Nicht mal Übelkeit am Morgen.»
«Ich drücke ihr die Daumen. Dieses Kind muss sie behalten. Du betreust sie gut, nicht wahr? Was für eine dumme Frage, selbstverständlich tust du das. Oh, wie mich das freut.»
«Kann ich noch etwas für Sie tun?»
Sie musterte ihn und das Loch in seinem Pullover. Ihre Gedanken wanderten von Babys zu Hochzeiten und dann unausweichlich zu ihrem Enkel Antony. «Ja», sagte sie, «du kannst etwas für mich tun. Ich möchte, dass Antony mich mit Rose besucht.»
«Gibt es irgendeinen Grund, aus dem er das nicht tun sollte?»
Er hatte mit seiner Antwort kaum merklich gezögert – oder bildete sie sich das nur ein? Sie warf ihm einen scharfen Blick zu, doch er beschäftigte sich angelegentlich mit dem klemmenden Verschluss seiner Tasche.
«Es ist jetzt einen Monat her, seit sie sich verlobt haben», fuhr sie fort. «Und ich möchte Rose wiedersehen. Es ist fünf Jahre her, dass sie und ihre Mutter im Strandhaus gewohnt haben. Ich erinnere mich kaum noch, wie sie aussieht.»
«Ich habe gedacht, sie ist in Amerika.»
«Oh, das war sie auch. Sie ist nach der Verlobung abgereist. Aber nach dem, was Antony gesagt hat, muss sie jetzt wieder im Land sein. Er hat versprochen, sie mit nach Schottland zu bringen, aber weiter ist das noch nicht gediehen. Und ich möchte wissen, wann und wo sie heiraten wollen. Da gibt es so viel zu besprechen und zu erledigen, doch jedes Mal, wenn ich Antony anrufe, sitzt er bloß in Edinburgh und murmelt Beschwichtigungen. Ich hasse es, wenn man mir mit Beschwichtigungen kommt. Es macht mich ausgesprochen gereizt.»
Er lächelte. «Ich spreche mit Isobel darüber», versprach er.
«Sie soll dir ein Glas Sherry geben.»
«Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich zu Mrs. Cooper muss.» Mrs. Cooper war die Posthalterin von Tarbole und eine strikte Abstinenzlerin. «Sie hat sowieso schon eine schlechte Meinung von mir, auch ohne dass ich ihr Alkoholdunst ins Gesicht blase.»
«Alberne Person», sagte Tuppy. Sie lächelten sich in vollkommener Übereinstimmung an; er ging und schloss die Tür hinter sich. Sukey schlich sich nach oben und kuschelte sich in Tuppys Armbeuge. Der Fensterrahmen knarrte leicht, als draußen Wind aufkam. Sie schaute aus dem Fenster und sah, dass Regendunst die Scheibe beschlug. Bald war Zeit zum Mittagessen. Sie legte sich auf die Kissen zurück und ließ sich, wie so oft in letzter Zeit, zurück in die Vergangenheit treiben.
Siebenundsiebzig. Wo waren die Jahre geblieben? Das Alter schien unmerklich zu ihr gekommen zu sein, und sie war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Tuppy Armstrong war nicht alt. Andere Leute waren alt, wie die eigene Großmutter oder Gestalten in Büchern. Sie dachte an Lucilla Eliot in The Herb of Grace. Der Inbegriff der vollkommenen Matriarchin, sollte man meinen.
Aber Tuppy hatte Lucilla nie gemocht. Sie hielt sie für besitzergreifend und herrschsüchtig. Und sie verabscheute den Snobismus, der sich in Lucillas tadellos geschnittenen schwarzen Kleidern ausdrückte. Tuppy hatte ihr Leben lang nie ein tadellos geschnittenes schwarzes Kleid besessen. Sicher, eine Menge hübsche Sachen, aber nie ein tadellos geschnittenes schwarzes Kleid. Meistens begnügte sie sich mit alten Tweedröcken und Strickjacken mit Ellbogenflicken; robuste, unverwüstliche Kleidung, die nichts gegen das Stutzen von Rosen oder einen jähen Regenguss hatte.
Und doch, bei der richtigen Gelegenheit ging nichts über das alte Abendkleid aus blauem Samt, damit sie sich festlich und feminin fühlte. Vor allem, wenn sie etwas Eau de Cologne verspritzte und die altmodischen Brillantringe über die arthritischen Fingerglieder schob. Vielleicht würde sie ein Abendessen geben, wenn Antony mit Rose kam. Nichts Aufwendiges. Nur ein paar Freunde. Sie stellte sich die Platzgedecke aus weißem Leinen vor, die Silberleuchter und die Tischdekoration aus cremefarbenen Rosen.
Ganz leidenschaftliche Gastgeberin, fing sie mit der Planung an. Und falls Antony und Rose eine traditionelle Hochzeit wollten, musste eine Gästeliste vom Armstrong’schen Zweig der Familie gemacht werden. Vielleicht sollte Tuppy das jetzt tun und die Liste Isobel geben, damit sie wusste, wer eingeladen werden sollte. Nur für den Fall …
Plötzlich ertrug sie es nicht mehr, daran zu denken. Sie zog Sukeys kleinen Körper eng an den ihren und küsste den zerzausten, leicht stinkenden Kopf. Sukey leckte flüchtig in ihre Richtung und schlief weiter. Tuppy schloss die Augen.
Dr. Hugh Kyle blieb auf der Treppe stehen, die Hand am Geländer. Er machte sich Sorgen. Nicht nur um Tuppy, sondern auch wegen des Gesprächs, das er eben mit ihr geführt hatte. Dort stand er, eine geistesabwesende, einsame Gestalt mit besorgter Miene, weder oben noch unten.
Die große Halle unter ihm war leer. Auf der gegenüberliegenden Seite führte eine Glastür auf die Terrasse, in den Garten und zum Meer hinunter, das jetzt ganz im Nebel untergegangen war. Er sah die gebohnerten Böden, die abgetretenen Teppiche, die alte Truhe mit der Kupfervase mit Dahlien darin und die langsam tickende alte Standuhr. Es gab auch andere, weniger pittoreske Gegenstände, die das Familienleben der Armstrongs dokumentierten: Jasons ramponiertes Dreirad, aus dem Regen hereingeholt; die Körbe und Trinknäpfe der Hunde; ein Paar verschlammte Gummistiefel, liegengelassen, bis ihr Besitzer daran dachte, sie in die Garderobe zu räumen. Hugh war das alles seit eh und je vertraut, denn er hatte Fernrigg sein Leben lang gekannt. Aber jetzt war es, als warte und lausche das ganze Haus auf Neuigkeiten über Tuppy.
Es schien niemand da zu sein, was allerdings nicht überraschte. Jason war in der Schule; Mrs. Watty war bestimmt in der Küche, mit dem Mittagessen beschäftigt. Isobel – er fragte sich, wo er sie finden könne.
Während ihm die Frage durch den Kopf ging, hörte er ihre Schritte im Wohnzimmer und das Kratzen von Plummers Pfoten auf den Parkettstreifen zwischen den Teppichen. Im nächsten Augenblick kam sie durch die offene Tür, den fetten alten Spaniel im Schlepptau.
Sie sah Hugh sofort, blieb reglos stehen und schaute zu ihm hinauf. Sie sahen sich an, und dann, weil er merkte, dass sich seine Sorgen in ihren Augen widerspiegelten, riss er sich hastig zusammen und setzte einen Ausdruck unerschütterlicher Munterkeit auf.
«Isobel, ich habe mich gefragt, wo ich dich finde.»
Sie sagte, nicht lauter als ein Flüstern: «Tuppy?»
«Nicht allzu schlimm.» Er schwenkte die Tasche, steckte die andere Hand in die Hosentasche und kam herunter.
«Als ich dich da stehen sah … Ich habe gedacht …»
«Tut mir leid, ich war mit den Gedanken woanders. Ich wollte dich nicht erschrecken …»
Er hatte sie nicht ganz überzeugt, doch sie versuchte zu lächeln. Sie war vierundfünfzig, die ein wenig linkische Tochter, die nie geheiratet hatte, stattdessen mit ihrer Zärtlichkeit ihre Mutter überschüttete, das Haus, den Garten, ihre Freunde, ihren Hund, ihre Neffen und jetzt Jason, der in Fernrigg House wohnte, während seine Eltern im Ausland waren. Ihr Haar, das während ihrer Kindheit feuerrot geleuchtet hatte, war jetzt rotblond mit weißen Strähnen darin, aber die Frisur hatte sich nicht verändert, so lange Hugh sich erinnern konnte. Auch ihr Gesichtsausdruck hatte sich nicht verändert, war immer noch kindlich und unschuldig, vielleicht, weil sie ein so behütetes Leben geführt hatte. Ihre Augen waren so blau wie die eines Kindes und so empfindlich wie der Himmel an einem stürmischen Tag, zeigten jede Gefühlsbewegung wie ein Spiegel: Sie glänzten vor Freude oder liefen über von den Tränen, die sie nie hatte zurückhalten können.
Als sie jetzt zu ihm aufschaute, waren sie voller Angst, und es war deutlich, dass Hughs Munterkeit sie nicht hatte beruhigen können.
«Ist sie … Wird sie …?» Ihre Lippen konnten, wollten das gefürchtete Wort nicht formen. Er legte ihr die Hand unter den Ellbogen, führte sie energisch ins Wohnzimmer zurück und schloss die Tür hinter ihnen.
«Sie könnte sterben, ja», sagte er. «Sie ist keine junge Frau mehr, und es hatte sie schlimm erwischt. Aber sie ist zäh. Wie altes Heidekraut. Sie hat eine gute Chance durchzukommen.»
«Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie bettlägerig werden könnte – nicht mehr herumlaufen und tun könnte, was sie will. Das wäre ihr so zuwider.»
«Ja, ich weiß. Und ob ich das weiß.»
«Was können wir tun?»
Er räusperte sich, fuhr sich mit der Hand über den Nacken. «Ich glaube, es gibt etwas, was sie aufheitern könnte. Wenn Antony herkäme und vielleicht dieses Mädchen mitbringen könnte, mit dem er verlobt ist …»
Isobel warf ihm einen warnenden Blick zu. Auch sie konnte sich an ihn als kleinen Jungen erinnern, der manchmal eine rechte Plage gewesen war. «Hugh, nenn sie nicht auf diese abscheuliche Weise ‹dieses Mädchen›. Sie heißt Rose Schuster, und du kennst sie genauso gut wie wir alle. Nicht besonders gut, das gebe ich zu, aber du kennst sie.»
«Tut mir leid.» Isobel nahm stets jeden in Schutz, der auch nur entfernt mit der Familie zu tun hatte. «Also Rose. Ich glaube, Tuppy sehnt sich danach, sie wiederzusehen.»
«So geht es uns allen, aber sie war mit ihrer Mutter in Amerika. Die Reise war schon geplant, bevor sie und Antony sich verlobt haben.»
«Ja, ich weiß, aber vielleicht ist sie jetzt wieder da. Und Tuppy ist deshalb ganz unruhig. Vielleicht kannst du Antony einen kleinen Wink geben, ihn dazu überreden, dass er Rose herbringt, auch wenn es nur für ein Wochenende ist.»
«Er scheint immer so viel zu tun zu haben.»
«Ich bin mir sicher, wenn du ihm die Situation erklärst … Sag ihm, dass es vielleicht besser wäre, den Besuch nicht zu lange zu verschieben.»
Wie er befürchtet hatte, schimmerten sofort Tränen in Isobels Augen. «Du glaubst also, dass sie stirbt.» Sie tastete schon im Ärmel nach einem Taschentuch.
«Isobel, das habe ich nicht gesagt. Aber du weißt, wie Tuppy an Antony hängt. Er ist für sie eher ein Sohn als ein Enkel. Man kann sehen, wie viel ihr daran liegt.»
«Ja, ja, ich sehe es auch.» Isobel putzte sich tapfer die Nase und steckte das Taschentuch wieder weg. Auf der Suche nach einer Ablenkung fiel ihr Blick auf die Sherrykaraffe. «Trink einen Schluck.»
Er lachte; die Spannung löste sich. «Nein danke. Ich muss zu Mrs. Cooper. Sie hat wieder Herzrasen, und das wird bestimmt schlimmer, wenn sie meint, dass ich getrunken habe.»
Wider Willen lächelte Isobel auch. Die Familie hatte sich von jeher über Mrs. Cooper lustig gemacht. Gemeinsam gingen sie aus dem Zimmer und durch die Halle. Isobel öffnete die Tür und ließ die Kühle des feuchten, nebelverhangenen Morgens ein. Das Auto des Arztes, unten an der Treppe geparkt, war nass vom Regen.
Er wandte sich ihr zu. «Und versprich mir, dass du mich anrufst, sobald du dir auch nur eine Spur Sorgen machst.»
«Mach ich. Aber mit der Schwester im Haus brauche ich mir ja keine allzu großen Sorgen zu machen.»
Es war Hugh gewesen, der darauf bestanden hatte, dass sie eine Schwester einstellten. Sonst, hatte er gesagt, müsse Tuppy ins Krankenhaus. Isobel hatte sofort panisch reagiert. Tuppy musste schwer krank sein; und wo sollten sie eine Schwester finden? Ob Mrs. Watty etwas dagegen haben mochte? Würde sie Anstoß daran nehmen, würde es in der Küche böses Blut geben?
Aber Hugh hatte sich um alles gekümmert. Mrs. Watty und die Schwester hatten sich angefreundet, und Isobel konnte nachts ruhig schlafen. Hugh war wirklich ein Fels in der Brandung. Als sie sich von ihm verabschiedete, fragte sich Isobel, wohl zum hundertsten Mal, was sie alle ohne ihn täten. Sie schaute ihm nach, als er in sein Auto stieg und abfuhr, die kurze Einfahrt zwischen den triefenden Rhododendronbüschen entlang, vorbei an dem Pförtnerhaus, in dem die Wattys wohnten, und durch das weiße Tor, das nie geschlossen wurde. Sie wartete, bis das Motorengeräusch verklang. Es war Flut, und sie hörte, wie sich die grauen Wellen an den Felsen unterhalb des Gartens brachen.
Sie fröstelte und kehrte ins Haus zurück, um Antony anzurufen.
Das Telefon stand in der Halle des altmodischen Hauses. Isobel setzte sich auf die Truhe und schlug die Nummer von Antonys Büro in Edinburgh nach. Sie konnte sich Telefonnummern nie merken und musste die alltäglichsten Leute nachschlagen wie den Lebensmittelhändler und den Bahnhofsvorsteher. Mit einem Auge im Buch wählte sie sorgfältig und wartete, bis sich jemand meldete. Ihre ängstlichen Gedanken eilten in alle Richtungen: Die Dahlien würden morgen verwelkt sein, sie musste frische schneiden; war Antony schon beim Essen? Sie durfte nicht selbstsüchtig sein, was Tuppy anging. Für jeden Menschen kam die Zeit zum Sterben. Wenn sie nicht mehr in ihrem geliebten Garten arbeiten und keine kleinen Spaziergänge mit Sukey machen konnte, würde sie nicht mehr leben wollen. Aber was für eine unerträgliche Leere in ihrer aller Leben würde sie hinterlassen! Wider Willen betete Isobel heftig. Lass sie nicht sterben. Lass nicht zu, dass wir sie jetzt schon verlieren. O Gott, sei uns gnädig …
«McKinnon, Carstairs und Robb. Sie wünschen?»
Die muntere junge Stimme riss sie in die Realität zurück. Sie tastete wieder nach dem Taschentuch, wischte sich die Augen und fasste sich. «Oh, Entschuldigung, ich hätte gern Mr. Armstrong gesprochen. Mr. Antony Armstrong.»
«Wer spricht da, bitte?»
«Miss Armstrong. Seine Tante.»
«Augenblick.»
Es klickte zweimal, dann kam wunderbarerweise Antonys Stimme. «Tante Isobel?»
«Oh, Antony …»
Er war sofort auf das Schlimmste gefasst. «Ist etwas passiert?»
«Nein. Nein, es ist nichts passiert.» Sie durfte keinen falschen Eindruck erwecken. «Hugh Kyle war hier. Er ist eben gegangen.»
«Geht es Tuppy schlechter?», fragte Antony unverblümt.
«Er … er sagt, sie hält sich wunderbar. Er sagt, sie ist stark wie altes Heidekraut.» Sie versuchte, unbeschwert zu klingen, aber ihre Stimme versagte kläglich. Der todernste Ausdruck auf Hughs Gesicht ging ihr nicht aus dem Sinn. Hatte er ihr wirklich die Wahrheit gesagt? Hatte er sie nur schonen wollen? «Er … er hat sich jedenfalls kurz mit Tuppy unterhalten, und offenbar will sie dich unbedingt sehen, dich und Rose. Und ich habe mich gefragt, ob du etwas von Rose gehört hast – ob sie aus Amerika zurück ist?»
Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. Isobel sprach hektisch weiter.
«Ich weiß, wie viel du immer zu tun hast, und ich will nicht, dass du dir Sorgen machst …»
«Das geht schon in Ordnung.» Endlich sagte Antony etwas. «Ja. Ja, sie ist wieder in London. Ich habe heute Morgen einen Brief von ihr bekommen.»
«Es bedeutet Tuppy so viel.»
Wieder eine Pause, dann fragte Antony ruhig: «Wird sie sterben?»
Isobel konnte nichts tun. Sie brach in Tränen aus, wütend auf sich selbst, aber sie war machtlos. «Ich … ich weiß es nicht. Hugh hat versucht, mich zu beruhigen, aber ich habe ihn noch nie so besorgt gesehen. Und es wäre grauenhaft, geradezu undenkbar, wenn mit Tuppy etwas wäre und sie dich und Rose nie zusammen gesehen hätte. Es hat ihr so viel bedeutet, dass ihr euch verlobt habt. Wenn du Rose herbringst, könnte das den entscheidenden Ausschlag geben. Dann hätte sie einen Grund …»
Sie konnte nicht weitersprechen. Sie hatte nicht so viel sagen wollen, und sie konnte durch die Tränen nichts mehr sehen. Sie kam sich geschlagen vor, am Ende ihrer Kräfte, als wäre sie zu lange allein gewesen. Sie putzte sich wieder die Nase und schloss hilflos: «Bitte versuch es, Antony.»
Es war ein Aufschrei, der von Herzen kam. Als er sprach, klang er fast so erschüttert wie sie: «Mir war ja nicht klar …»
«Ich glaube, es ist mir auch eben erst richtig klargeworden.»
«Ich werde Rose schon erreichen. Irgendwie richte ich es ein. Wir kommen am nächsten Wochenende. Versprochen.»
«Oh, Antony.» Eine Welle der Erleichterung überflutete sie. Sie würden kommen. Wenn Antony etwas versprach, hielt er immer Wort, und wenn die Welt unterging.
«Und mach dir keine zu großen Sorgen um Tuppy. Wenn Hugh sagt, sie ist zäh wie Heidekraut, dann stimmt das vermutlich. Sie steckt uns allesamt in die Tasche, und wahrscheinlich wird sie uns alle überleben.»
Isobel lächelte unter Tränen. «Das ist kein Ding der Unmöglichkeit.»
«Nichts ist unmöglich», sagte Antony. «Alles kann geschehen. Bis zum nächsten Wochenende.»
«Du bist ein Schatz.»
«Gern geschehen. Und liebe Grüße an Tuppy.»
Marcia
Ronald Waring sagte, wohl zum fünften Mal: «Wir müssen nach Hause.»
Seine Tochter Flora, benommen von der Sonne und schläfrig vom Schwimmen, sagte, ebenfalls zum fünften Mal: «Ich weiß», und beide rührten sich nicht. Sie saß zusammengekauert auf einer abschüssigen Granitplatte und schaute hinunter in die juwelenblaue Tiefe der riesigen Felsenbucht, in der sie ihr abendliches Bad genommen hatten. Die Sonne glitt am Himmel abwärts und verströmte die letzte Wärme über Floras Gesicht. Ihre Wangen waren noch salzig vom Meer; das nasse Haar klebte ihr im Nacken. Sie saß mit den Armen um die Beine geschlungen da, das Kinn auf den Knien, und kniff gegen das blendende Meer die Augen zusammen.
Es war Mittwoch, der letzte Tag eines vollkommenen Sommers. Oder gehörte der September offiziell schon zum Herbst? Flora konnte sich nicht daran erinnern. Sie wusste nur, dass sich der Sommer in Cornwall über das Ende der Jahreszeit hinaus zauberhaft in die Länge zog. Hier unten, im Schutz der Klippen, wehte kein Hauch, und die Felsen, vollgesogen mit dem Sonnenschein eines Tages, fühlten sich noch warm an.
Die Flut kam. Zwischen zwei mit Napfschnecken überzogenen Felsen ergoss sich das erste Rinnsal in die Bucht. Bald würde das Rinnsal zum Strom anschwellen, und die Vorhut der atlantischen Brecher würde die spiegelglatte Wasseroberfläche zerschmettern. Schließlich würden die Felsen überflutet werden, die Bucht würde untertauchen und versunken bleiben, bis die Ebbe sie wieder befreite.
Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie oft sie genau wie jetzt hier nebeneinandergesessen hatten, hypnotisiert von der Faszination einer Septemberflut. Doch an diesem Abend fiel es noch schwerer, sich loszureißen, weil es der letzte war. Sie würden den Klippenweg hinaufgehen, von Zeit zu Zeit stehen bleiben, wie sie es immer taten, um auf den Ozean zurückzublicken. Sie würden den Weg über die Felder zum Seal Cottage einschlagen, wo Marcia sie erwartete, das Abendessen im Ofen und Blumen auf dem Tisch. Und nach dem Abendessen würde Flora sich das Haar waschen und ihren Koffer packen, weil sie morgen nach London zurückfuhr.
Es war alles von langer Hand geplant, und Flora musste zurück, aber in diesem Augenblick konnte sie den Gedanken daran kaum ertragen. Vor allem war es ihr immer zuwider, ihren Vater zu verlassen. Sie schaute ihn an, wie er ein Stück von ihr entfernt auf dem Felsen saß. Sie sah seine Hagerkeit, die tief gebräunte Haut, die langen, bloßen Beine. Er trug unansehnliche Shorts und ein uraltes Hemd, an vielen Stellen geflickt, die Ärmel hochgerollt. Sie sah sein schütter werdendes Haar, zerzaust vom Schwimmen, und das vorspringende Kinn, während er einen Kormoran beobachtete, der dicht über der Wasseroberfläche vorbeiflog.
«Ich will morgen nicht fort», sagte sie.
Er drehte sich um und lächelte sie an. «Dann bleib hier.»
«Ich muss fort. Das weißt du. Ich muss in die Welt hinaus und wieder selbständig werden. Ich war zu lange zu Hause.»
«Ich hätte es gern, wenn du immer hier wärst.»
Sie ignorierte den jähen Kloß im Hals. «So was sollst du nicht sagen. Du sollst schroff und unsentimental sein. Du sollst dein Küken aus dem Nest werfen.»
«Kannst du schwören, dass du nicht wegen Marcia gehst?»
Flora war aufrichtig. «Na ja, in bestimmter Hinsicht ist das natürlich auch ein Grund, aber nicht der ausschlaggebende. Jedenfalls mag ich sie furchtbar gern, das weißt du.» Als ihr Vater nicht lächelte, versuchte sie, einen Scherz daraus zu machen. «Schon gut, sie ist die typische böse Stiefmutter, wäre das ein ausreichender Grund? Und ich laufe weg, ehe sie mich zu den Ratten in den Keller sperrt.»
«Du kannst jederzeit zurückkommen. Versprich mir, dass du zurückkommst, wenn du keine Stelle findest oder es nicht so recht klappt.»
«Ich finde ohne jede Schwierigkeit Arbeit, und alles wird bestens klappen.»
«Das Versprechen will ich trotzdem.»
«Du hast es. Aber vermutlich wirst du es bereuen, wenn ich in einer Woche wieder bei euch vor der Tür stehe. Und jetzt» – sie griff nach dem Badetuch und einem Paar fadenscheiniger Espadrilles – «müssen wir nach Hause.»
Am Anfang hatte Marcia sich geweigert, Floras Vater zu heiraten. «Du kannst mich nicht heiraten. Du bist Altphilologe an einem angesehenen humanistischen Gymnasium. Du musst eine ruhige, respektable Frau mit einem Filzhut heiraten, die mit Jungen umgehen kann.»
«Ich kann ruhige, respektable Frauen nicht leiden», hatte er leicht gereizt gesagt. «Wenn ich sie leiden könnte, hätte ich schon vor Jahren die Hausdame geheiratet.»
«Ich sehe mich einfach nicht als Mrs. Ronald Waring. Irgendwie passt das nicht zu mir. ‹Und hier, Jungs, ist Mrs. Waring, die den Silberpokal im Hochsprung überreichen wird.› Und da bin ich, stolpere über meine Füße, vergesse, was ich sagen soll, lasse vermutlich den Pokal fallen oder überreiche ihn dem falschen Jungen.»
Aber Ronald Waring war immer ein Mann gewesen, der wusste, was er wollte. Er war hartnäckig geblieben, hatte sie umworben und schließlich überredet. Sie hatten zu Beginn des Sommers geheiratet, in der winzigen, uralten Steinkirche, die modrig roch wie eine Höhle. Marcia hatte ein bezauberndes smaragdgrünes Kleid und einen riesigen Strohhut mit geschwungener Krempe getragen wie Scarlett O’Hara. Und ausnahmsweise hatte an Ronald Warings Aufmachung alles gestimmt, die Socken hatten zueinander gepasst, die Krawatte war korrekt gebunden, nicht unter den obersten Kragenknopf gerutscht. Sie geben ein wunderbares Paar ab, dachte Flora, die Schnappschüsse von ihnen gemacht hatte, als sie strahlend aus der Kirche kamen. Auf den Fotos sah man, wie die steife Brise vom Meer an der Hutkrempe der Braut zerrte und das schütter werdende Haar des Bräutigams wie den Schopf eines Kakadus nach oben blies.
Marcia war in London geboren und aufgewachsen und irgendwie zweiundvierzig geworden, ohne je geheiratet zu haben – aller Wahrscheinlichkeit nach, meinte Flora, weil sie nie die Zeit dazu gefunden hatte. Sie hatte ihre berufliche Laufbahn als Schauspielschülerin begonnen, war dann zur Fundusverwalterin einer Provinztruppe aufgestiegen und hatte sich seit jenem nicht gerade vielversprechenden Anfang fröhlich durchs Leben geschlagen, offenbar von einer Gelegenheitsarbeit zur anderen. Zuletzt war sie Verkaufsleiterin in einem Laden in Brighton gewesen, der auf etwas spezialisiert war, was Marcia ‹arabischen Krempel› nannte.
Obwohl Flora Marcia sofort gemocht und die Verbindung mit ihrem Vater heftig unterstützt hatte, waren gewisse unvermeidliche Vorbehalte wegen Marcias hausfraulicher Fähigkeiten vorhanden gewesen. Schließlich möchte keine Tochter ihren Vater zu lebenslänglichen Fertigpasteten, Tiefkühlpizzen und Dosensuppen verurteilen.
Aber selbst in diesem Punkt war es Marcia gelungen, die beiden zu überraschen. Sie erwies sich als ausgezeichnete Köchin und begeisterte Hausfrau und war dabei, im Garten alle möglichen unerwarteten Begabungen zu entwickeln. Gemüse wuchs in sauberen, militärischen Reihen; Blumen blühten, wenn Marcia sie nur anschaute, und auf dem tiefen Fenstersims über der Küchenspüle standen zwei Reihen Tontöpfe mit Geranien und Fleißigen Lieschen, die sie selbst gezogen hatte.
Als sie an jenem Abend die Klippen hinauf und über die kühlen Felder gingen, kam Marcia, die aus dem Küchenfenster Ausschau gehalten hatte, ihnen entgegen. Sie trug grüne Hosen und einen Baumwollkittel, von knorrigen Bäuerinnenhänden üppig bestickt, und die letzten Sonnenstrahlen entflammten das leuchtende Haar.
Ronald Waring sah sie, lächelte glücklich und ging schneller. Flora trödelte hinter ihm her und dachte daran, dass zwei Menschen in mittleren Jahren, die sich nicht nur zärtlich, sondern leidenschaftlich verbunden waren, etwas ganz Besonderes seien. Als sie sich mitten auf der Wiese trafen und ohne Zurückhaltung oder Verlegenheit umarmten, war es, als ob sie sich nach einer monatelangen Trennung wiederfänden. Vielleicht empfanden sie das auch wirklich so. Der Himmel wusste, dass sie lange genug aufeinander gewartet hatten.
Marcia brachte Flora am nächsten Morgen an den Zug nach London. Die Tatsache, dass sie Flora zum Bahnhof fahren konnte, war für Marcia eine Quelle großen Stolzes und tiefer Befriedigung. Denn in ihrem reifen Alter hatte sie nicht nur den Ehestand versäumt, sondern auch nie Auto fahren gelernt.
Als sie danach gefragt wurde, zählte sie eine Reihe von Gründen auf, die diese Unterlassung erklärten. Sie sei technisch unbegabt, sie habe nie ein Auto besessen, und meistens sei jemand zur Hand gewesen, der sie gefahren habe. Aber als sie Ronald Waring geheiratet hatte und in einem kleinen Cottage im Niemandsland von Cornwall festsaß, lag auf der Hand, dass die Zeit gekommen war.
Jetzt oder nie, sagte Marcia und nahm Fahrstunden. Dann die Prüfungen. Drei. Bei der ersten fiel sie durch, weil sie mit dem Vorderrad über die bestiefelten Zehen eines Polizisten gefahren war. Bei der zweiten, weil sie, während sie versuchte, rückwärts einzuparken, unabsichtlich einen Kinderwagen streifte, in dem zum Glück kein Baby gelegen hatte. Weder Flora noch ihr Vater konnten sich vorstellen, dass sie den Mumm hätte, es noch einmal zu versuchen, doch sie unterschätzten Marcia. Sie versuchte es und bestand schließlich. Als ihr Mann bedauerte, er könne seine Tochter nicht zum Bahnhof bringen, weil er zu einer Lehrerkonferenz müsse, konnte Marcia also mit einigem Stolz sagen: «Das macht nichts. Ich fahre sie.»
In gewisser Weise war Flora erleichtert. Sie hasste Abschiede, die beim Klang einer Pfeife unvermeidlich sentimental wurden. Wenn ihr Vater dabei gewesen wäre, hätte sie ihm vermutlich die Ohren vollgeheult, was den Abschied für beide noch schlimmer gemacht hätte.
Es war wieder ein warmer und wolkenloser Tag, der Himmel so blau, wie er es das ganze Jahr gewesen war, der Adlerfarn golden. Außerdem lag ein Funkeln in der Luft, in dem sich die alltäglichsten Dinge kristallklar abzeichneten. Marcia stimmte in ihrem rauchigen Alt an: «Wunderschön ist dieser Morgen, wenn sich die Sonne erhebt …», hielt dann inne und bückte sich nach ihrer Handtasche, was hieß, dass sie eine Zigarette wollte. Das Auto schlingerte gefährlich über den Mittelstreifen und auf die falsche Straßenseite; deshalb sagte Flora schnell: «Lass nur, ich geb dir eine.» Als Marcia das Auto wieder auf den richtigen Kurs gebracht hatte, steckte Flora ihr die Zigarette in den Mund und gab ihr Feuer, damit Marcia nicht die Hände vom Lenkrad nehmen musste.
Als die Zigarette brannte, sang Marcia weiter: «Wunderschön ist dieser Morgen, alles ist glücklich …» Sie hielt inne und runzelte die Stirn. «Liebes, schwörst du mir, dass du nicht meinetwegen in das scheußliche London zurückgehst?»
Diese Frage war in der letzten Woche allabendlich in regelmäßigen Abständen gestellt worden. Flora holte tief Luft. «Nein. Ich habe es dir doch gesagt, nein. Ich nehme einfach die Fäden meines Lebens wieder auf und mache dort weiter, wo ich vor einem Jahr aufgehört habe.»
«Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dich aus deinem Zuhause vertreibe.»
«Aber das tust du nicht. Und sieh doch die Situation aus meiner Perspektive. Weil ich weiß, dass mein Vater eine wunderbare Frau gefunden hat, die sich um ihn kümmert, kann ich gehen und ihn mit reinem Gewissen verlassen.»
«Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, was für ein Leben dich erwartet. Ich habe grausige Bilder vor Augen, wie du in einem möblierten Zimmer sitzt und kalte Bohnen aus der Büchse isst.»
«Ich habe es dir doch gesagt», sagte Flora energisch, «ich finde schon eine Wohnung, und während ich mich umschaue, wohne ich bei meiner Freundin Jane Porter. Es ist alles abgemacht. Das Mädchen, das bei ihr wohnt, ist mit ihrem Freund verreist, ich kann also ihr Bett haben. Und wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, habe ich schon eine eigene Wohnung gefunden und eine tolle Stelle, und alles ist in Butter.»
Marcia machte weiterhin ein finsteres Gesicht.
«Schau mal, ich bin zweiundzwanzig, keine zwölf. Und eine wahnsinnig, wahnsinnig tüchtige Stenotypistin. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge.»
«Aber versprich mir, dass du mich anrufst, wenn es nicht so recht klappt, dann komme ich und bemuttere dich.»
«Ich bin mein Leben lang nicht bemuttert worden und komme auch so zurecht.» Flora seufzte. «Tut mir leid. Das sollte nicht ganz so schroff klingen.»
«Überhaupt nicht schroff, Liebes, schließlich ist es eine schlichte Tatsache. Aber weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto unglaublicher wird es.»
«Ich kann dir nicht recht folgen.»
«Das mit deiner Mutter. Dass sie dich und deinen Vater im Stich gelassen hat, als du noch ein kleines Kind warst. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass eine Frau ihren Mann verlässt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie jemand einen solchen Schatz wie Ronald verlässt – aber bei einem Baby begreife ich das überhaupt nicht mehr. Es wirkt so unmenschlich. Man sollte doch meinen, wenn man sich die ganze Mühe gemacht hat, ein Kind zu bekommen, dann will man es auch behalten.»
«Ich bin froh, dass sie mich nicht behalten hat. Ich hätte nichts anderes gewollt. Ich weiß nicht, wie Pa es geschafft hat, aber eine schönere Kindheit hätte ich nicht haben können.»
«Du weißt, was wir sind, nicht wahr? Die Gründungsmitglieder des Fanclubs von Ronald Waring. Ich frage mich, warum sie gegangen ist. Deine Mutter, meine ich. Gab es da einen anderen Mann? Ich hab mich immer gescheut, danach zu fragen.»
«Nein, das glaube ich nicht. Sie haben einfach nicht zueinandergepasst. Das hat Pa mir immer gesagt. Ihr gefiel es nicht, dass er ein Schulmeister ohne Ehrgeiz war, und er machte sich nichts aus Cocktailpartys und der großen Welt. Ihr gefiel auch nicht, dass er ewig mit seiner Arbeit beschäftigt war und immer aussah, als ob man ihn aus einem Kleidersack gekippt hätte. Und es war klar, dass er nie genügend Geld verdienen würde, um ihr den Lebensstil zu bieten, den sie sich vorstellte. Ich habe einmal ein Foto von ihr gefunden, hinten in einer Schublade. Sehr schick und elegant; in einem teuren Kostüm. Überhaupt nicht Pas Kragenweite.»
«Sie muss knallhart gewesen sein. Ich frage mich, warum sie überhaupt geheiratet haben.»
«Ich glaube, sie haben sich bei einem Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Pa ist ein hervorragender Skiläufer – vielleicht hast du das nicht gewusst. Ich kann mir vorstellen, dass die Sonne beide geblendet hat oder dass die Alpenluft ihnen zu Kopf gestiegen ist. Vielleicht hat sie auch die sportliche Eleganz umgehauen, mit der er den Abhang hinunterfegte. Ich weiß nur, dass es passierte, dass ich auf die Welt kam, und dass es dann vorbei war.»
Sie waren jetzt auf der Hauptstraße, näherten sich dem kleinen Bahnhof, auf dem Flora in den Zug nach London steigen sollte. «Ich hoffe», sagte Marcia, «dass er nicht mit mir zum Skilaufen fahren will.»
«Warum denn nicht?»
«Ich kann nicht Ski laufen.»
«Das würde für Pa keine Rolle spielen. Er vergöttert dich, so wie du bist. Das weißt du doch?»
«Ja», sagte Marcia, «und bin ich nicht die glücklichste Frau unter der Sonne? Aber du wirst auch Glück haben. Du bist im Zeichen der Zwillinge geboren, und ich habe heute Morgen für dich nachgeschaut – alle Planeten bewegen sich in die richtige Richtung; du musst dir die Möglichkeiten nur zunutze machen.» Marcia glaubte felsenfest an Horoskope. «Das heißt, dass du innerhalb einer Woche eine sagenhafte Stelle und eine sagenhafte Wohnung findest und vermutlich auch einen sagenhaften großen, dunkelhaarigen Mann mit einem Maserati. Sozusagen ein Pauschalpaket.»
«Innerhalb einer Woche? Das lässt mir ja nicht viel Zeit.»
«Es muss aber alles innerhalb einer Woche passieren, denn am nächsten Freitag kommt ein neues Horoskop.»
«Ich will mal sehen, was ich tun kann.»
Es war kein langer Abschied. Der D-Zug hielt nur einen Augenblick auf dem kleinen Bahnhof, und kaum waren Flora und ihr umfangreiches Gepäck an Bord, ging der Bahnhofsvorsteher den Bahnsteig entlang, warf die Türen zu und hob die Pfeife zum Mund. Flora lehnte sich aus dem Fenster, um Marcia einen Abschiedskuss zu geben. Marcia hatte Tränen in den Augen, und ihre Wimperntusche war zerlaufen.
«Ruf an, sag uns, was los ist.»
«Mach ich. Versprochen.»
«Und schreib!»
Für mehr blieb keine Zeit. Der Zug setzte sich in Bewegung, wurde schneller; der Bahnsteig verschwand in der Biegung. Flora winkte, der kleine Bahnhof und Marcias Gestalt in blauen Hosen wurden kleiner und glitten aus dem Blickfeld. Flora strich sich das zerzauste Haar aus dem Gesicht, schloss das Fenster und ließ sich auf den Ecksitz im leeren Abteil fallen.
Sie schaute aus dem Fenster. Es war eine liebgewordene Gewohnheit zuzuschauen, wie alles davonglitt, genau wie sie sich, wenn sie in die entgegengesetzte Richtung fuhr, immer ab Fourbourne aus dem Fenster lehnte, um den ersten Blick auf die vertraute Landschaft zu werfen.
Jetzt war Ebbe, der Sand in der Mündung ein perlmuttern glänzendes Braun, blau gemustert, wo Tümpel trägen Wassers den Himmel widerspiegelten. In der Ferne lag ein Dorf mit weißen Häusern, die durch die Bäume schimmerten, dahinter kamen die Dünen, und einen Augenblick lang konnte man den Ozean hinter den fernen weißen Wellenbrechern sehen.
Die Schienen führten landeinwärts, und eine grasbewachsene Ebene kam in Sicht, während der Ozean hinter Strandbungalows verschwand. Der Zug holperte über ein Viadukt und durch die nächste Kleinstadt, und dann folgten kleine grüne Täler und weiße Cottages und Gärten, in denen sich Wäsche auf der Leine in der steifen Morgenbrise blähte. Der Zug donnerte an einem Bahnübergang vorbei. An der geschlossenen Schranke wartete ein Mann mit einem roten Traktor und einem Anhänger voller Strohballen.
Sie wohnten in Cornwall, seit Flora fünf Jahre alt war. Davor hatte ihr Vater in einem exklusiven und teuren Internat in Sussex Latein und Französisch unterrichtet. Die Arbeit war zwar angenehm, jedoch keine große Herausforderung, und ihm war der Gesprächsstoff mit den nerzbemäntelten Müttern seiner betuchten Schützlinge ausgegangen.
Er hatte sich immer danach gesehnt, am Meer zu wohnen, seit er als Junge die Ferien in Cornwall verbracht hatte. Deshalb bewarb er sich sofort, als die Stelle eines Altphilologen am humanistischen Gymnasium von Fourbourne vakant wurde, sehr zum Kummer des Internatsrektors, der das Gefühl hatte, der intelligente junge Mann sei zu Höherem berufen, als den Söhnen von Bauern, Ladenbesitzern und Bergbauingenieuren klassische Bildung einzutrichtern.
Aber Ronald Waring war hartnäckig. Anfangs hatten er und Flora in möblierten Zimmern in Fourbourne gewohnt, und ihre erste Erinnerung an Cornwall war diese kleine Industriestadt, umgeben von einer öden Landschaft, gespickt mit alten Zechen, die wie abgebrochene Zähne vor dem Horizont aufragten.
Aber als sie erst einmal heimisch geworden waren und ihr Vater in der neuen Stelle Fuß gefasst hatte, kaufte er ein altes Auto, und an den Wochenenden machten Vater und Tochter sich auf die Suche nach einem anderen Ort zum Wohnen.
Schließlich waren sie der Wegbeschreibung des Immobilienmaklers in Penzance gefolgt, hatten die Straßen von St. Ives hinaus nach Lands End genommen, und nachdem sie zweimal falsch abgebogen waren, holperten sie einen steilen, dornenüberwucherten Weg entlang, der zum Meer führte. Sie bogen um eine letzte Kurve, überfuhren einen Bach, der ständig die Straße überflutete, und kamen zum Seal Cottage.
Es war ein bitterkalter Wintertag. Das Haus war baufällig, verfügte weder über fließendes Wasser noch über sanitäre Anlagen, und als sie schließlich die verzogene alte Tür aufgestemmt hatten, wimmelte es von Mäusen. Aber Flora hatte keine Angst vor Mäusen, und Ronald Waring verliebte sich nicht nur in das Haus, sondern auch in die Aussicht. Er kaufte es am selben Tag, und seither war es ihr Zuhause gewesen.
Anfangs hatten sie ein jämmerlich primitives Leben geführt. Man musste darum kämpfen, sich warm und sauber zu halten und Essen auf den Tisch zu bekommen. Aber Ronald Waring war nicht nur Altphilologe, sondern auch ein geselliger Mann mit viel Charme. Wenn er in einen Pub ging, wo er niemanden kannte, hatte er sich, wenn er ging, mit mindestens einem halben Dutzend Leuten angefreundet.
So fand er den Maurer, der die Gartenmauer reparierte und den eingesackten Kamin wieder aufbaute. So lernte er Mr. Pincher kennen, den Schreiner, und Tom Roberts, dessen Neffe Klempner war und an den Wochenenden Zeit hatte. So machte er die Bekanntschaft von Arthur Pyper und dadurch die von Mrs. Pyper, die jeden Tag würdevoll aus dem Nachbardorf herüberradelte, um Geschirr zu spülen, die Betten zu machen und ein mütterliches Auge auf Flora zu werfen.
Als sie zehn war, wurde Flora, sehr zu ihrem Verdruss, auf ein Internat in Kent geschickt, wo sie blieb, bis sie sechzehn war. Danach lernte sie Steno und Maschineschreiben, und danach machte sie einen Kochkurs für die feine Küche.
Als Köchin nahm sie Jobs in der Schweiz an (im Winter) und in Griechenland (im Sommer). Nach ihrer Rückkehr nach London arbeitete sie als Sekretärin, teilte sich mit einer Freundin eine Wohnung, wartete an Bushaltestellen, kaufte in der Mittagspause ein. Sie ging mit verarmten jungen Männern aus, die sich zu staatlich geprüften Bilanzbuchhaltern ausbilden ließen, und mit etwas weniger verarmten jungen Männern, die im Begriff waren, Boutiquen aufzumachen. Und dazwischen fuhr sie im Urlaub mit dem Zug nach Cornwall und zurück, half beim Frühjahrsputz und beim Braten des Weihnachtstruthahns.
Aber Ende des letzten Jahres, nach einer Grippe und einer unbefriedigenden Liebesgeschichte, war sie die Großstadt leid geworden. Sie fuhr über Weihnachten nach Cornwall und musste nicht groß überredet werden, dort zu bleiben. Es war ein wunderbares, entspanntes Jahr gewesen. Als der Winter einem besonders schönen und zeitigen Frühling wich und der Frühling sich in den Sommer verwandelte, konnte sie bleiben und alles miterleben; keine Frist war ihr gesetzt, kein Tag im Kalender zeigte an, wann sie die Koffer packen und in die Tretmühle zurück musste.
Sie nahm Arbeit an – zum Zeitvertreib und um etwas Geld zu verdienen –, aber immer nur vorübergehend, anspruchslose und im allgemeinen ganz amüsante Arbeit: Narzissen pflücken für einen Gärtner, der den einheimischen Markt belieferte, kellnern in einer Kaffeebar, Kaftane an Sommertouristen verkaufen, die ihr Geld unbedingt loswerden wollten.
Im Kaftanladen hatte sie Marcia kennengelernt und auf einen Drink ins Seal Cottage mitgenommen. Sie hatte mit ungläubiger Freude beobachtet, wie es zwischen Marcia und ihrem Vater sofort funkte. Und das war, wie sich bald herausstellte, keine vorübergehende Laune.
Die Liebe brachte Marcia zum Erblühen wie eine Blume, und Floras Vater legte plötzlich so viel Wert auf sein Äußeres, dass er sich sogar aus freien Stücken eine neue Hose kaufte. Während die Beziehung stetig tiefer und stärker wurde, versuchte Flora, sich taktvoll zurückzuziehen, erfand Ausreden, sie nicht bei den Ausflügen in den Pub zu begleiten, und Gründe, abends auszugehen, damit sie Seal Cottage für sich hatten.
Als sie verheiratet waren, fing sie sofort damit an, über ihre Rückkehr nach London zu reden, aber Marcia hatte sie überredet, im Seal Cottage zu bleiben, wenigstens den Sommer über. Das hatte sie auch getan, doch ihre Zeit lief ab. Das war nicht mehr Floras Leben, ebenso wenig wie Seal Cottage noch ihr Zuhause war. Im September, das versprach sie sich, würde sie nach London zurückkehren. Im September, sagte sie zu Marcia, räume ich euch alten Turteltauben das Feld.
Jetzt war das alles vorbei. Es lag schon in der Vergangenheit. Und die Zukunft? Du wirst Glück haben, hatte Marcia gesagt. Du bist im Zeichen der Zwillinge geboren, und alle Planeten bewegen sich in die richtige Richtung.
Aber Flora war sich nicht so sicher. Sie nahm den Brief aus der Jackentasche, der am Morgen gekommen war, den sie geöffnet, gelesen und dann schnell weggesteckt hatte, ehe Marcia danach fragen konnte. Er war von Jane Porter.
Mansfield Mews 8, S.W. 10
Liebste Flora,
etwas ganz Übles ist passiert, und ich hoffe, der Brief erreicht Dich, ehe Du nach London fährst. Betsy, das Mädchen, mit dem ich zusammen wohne, hat einen grauenhaften Krach mit ihrem Freund gehabt und ist nach zwei Ferientagen in Spanien nach Hause gekommen. Sie ist jetzt hier in der Wohnung, heult die ganze Zeit und wartet offensichtlich darauf, dass das Telefon klingelt, was es nicht tut. Das Bett, das ich Dir versprochen habe, ist also nicht frei. Ich würde Dich liebend gern in einem Schlafsack in meinem Zimmer unterbringen, aber die ganze Atmosphäre ist so geladen und Betsy so total unmöglich, dass ich es meinem schlimmsten Feind nicht zumuten möchte. Ich hoffe, Du kommst irgendwie zurecht, bis Du eine eigene Bude findest. Tut mir schrecklich leid, dass ich Dich im Stich lassen muss, aber ich hoffe, Du verstehst es. Ruf mich auf alle Fälle an, damit wir uns zu einem ausgiebigen Schwatz treffen können. Freue mich so darauf, Dich wiederzusehen, und es tut mir furchtbar, furchtbar leid, aber ich kann nichts dafür.
Alles, alles Liebe
Jane
Flora seufzte, faltete den Brief zusammen und steckte ihn wieder in die Tasche. Sie hatte nichts zu Marcia gesagt, weil Marcia in ihrer neuen Rolle als Ehefrau und Mutter einen erschreckenden Hang entwickelt hatte, sich in alles einzumischen. Hätte sie gewusst, dass Flora ohne Aussicht auf einen Schlafplatz nach London fuhr, hätte sie sich vermutlich geweigert, sie fahren zu lassen. Und als sie sich erst einmal entschlossen hatte, wusste Flora, dass sie es nicht ertragen könnte, ihre Abreise auch nur um einen Tag zu verschieben.
Jetzt erhob sich allerdings die Frage, was zu tun war. Natürlich hatte sie Freunde, aber nach einem Jahr wusste sie nicht recht, was sie machten, wo sie wohnten, nicht einmal, mit wem sie zusammenlebten. Ihre frühere Wohnungsgenossin war inzwischen verheiratet und nach Northumberland gezogen, und sonst gab es niemanden, von dem Flora das Gefühl hatte, sie könne aus heiterem Himmel anrufen und darum bitten, vorübergehend aufgenommen zu werden.
Es war ein Teufelskreis. Sie wollte keine Wohnung mieten, ehe sie eine Stelle gefunden hatte; andererseits war es schwierig, ohne ein Basislager, wo sie ihre Sachen abstellen konnte, bei den Stellenvermittlern die Runde zu machen.
Schließlich fiel ihr das Shelbourne ein, das kleine, altmodische Hotel, in dem sie mit ihrem Vater übernachtet hatte, wenn sie unterwegs zu einem ihrer seltenen Auslandsurlaube waren – etwa zum Skilaufen in Österreich oder zwei Wochen bei einem exzentrischen Freund von Ronald Waring, dem eine baufällige Mühle in der Provence gehörte. Das Shelbourne war nicht elegant, und wenn ihr Vater dort abgestiegen war, ganz bestimmt nicht teuer. Sie würde dort übernachten und morgen mit der Arbeitssuche anfangen.
Es war keineswegs eine perfekte Lösung, sondern eher ein Kompromiss. Und wie Marcia gern sagte, während sie die Krempe von einem Hut abtrennte und an einen anderen nähte, bestand das Leben aus Kompromissen.
Das Shelbourne war ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Flora erinnerte es immer an einen alten Kahn, der in einem Staubecken vor Anker lag, während der Strom des Fortschritts vorbeifloss. Es lag an einer schmalen Straße am Ende von Knightsbridge, die früher elegant gewesen war, und wurde langsam erdrückt von neuen Nobelhotels, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Aber es behauptete grimmig seinen Platz, wie eine alternde Schauspielerin, die sich weigert abzutreten.
Draußen summte das London von heute: Verkehrsstaus, Autohupen, das Dröhnen der Flugzeuge, der Zeitungsverkäufer an der Ecke, die jungen Mädchen mit den schwarz umrandeten Augen und klappernden Absätzen.
Aber wenn man durch die langsame Drehtür des Shelbourne ging, tat man einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Nichts hatte sich verändert – nicht die Topfpalmen, nicht das Gesicht des Portiers; nicht einmal der Geruch, eine Mischung aus Desinfektionsmitteln, Bohnerwachs und Treibhausblumen, ein wenig wie in einem Krankenhaus.
Hinter dem Rezeptionstresen saß dieselbe traurige Frau in ihrem tristen schwarzen Kleid. War es möglich, dass es dasselbe Kleid war? Sie schaute zu Flora auf.
«Guten Abend, Madam.»
«Könnte ich ein Einzelzimmer bekommen, nur für heute Nacht?»
«Ich schaue nach …»
Eine Uhr tickte. Flora wartete, ihre Lebensgeister sanken von Augenblick zu Augenblick; sie hatte halb gehofft, das Hotel wäre ausgebucht.
«Ja, Sie können ein Zimmer haben, aber nach hinten hinaus, und ich fürchte …»
«In Ordnung, ich nehme es.»
«Wenn Sie sich bitte eintragen, ich rufe den Hausdiener, damit er Sie hinaufbringt.»
Aber der Gedanke an lange, stickige Flure und ein düsteres Einzelzimmer am äußersten Ende war zu viel für Flora.
«Jetzt noch nicht. Ich muss noch einmal weg. Zum Abendessen», improvisierte sie wild. «Ich komme gegen halb zehn zurück. Machen Sie sich keine Mühe mit dem Gepäck. Lassen Sie es einfach hier in der Halle stehen, bis ich wiederkomme. Ich bringe es dann hinauf.»
«Wie Sie wünschen, Madam. Aber wollen Sie denn Ihr Zimmer nicht sehen?»
«Nein. Es spielt keine Rolle. Es ist bestimmt sehr hübsch …» Sie fühlte sich, als müsste sie ersticken. Alles sah so grauenhaft alt aus. Sie griff nach ihrer Tasche und wich zurück, immer noch Entschuldigungen murmelnd. Fast hätte sie eine Topfpalme umgestoßen, konnte das gute Stück gerade noch retten und floh schließlich hinaus an die frische Luft.
Nach ein paar tiefen Atemzügen fühlte sie sich besser. Es war ein schöner Abend, kühl, aber klar, mit einem blauen Himmel, der sich über den Dächern spannte und über den vereinzelte rosige Wölkchen so träge trieben wie Ballons. Flora steckte die Hände in die Taschen und ging los.
Eine Stunde später war sie mitten in Chelsea, ging nach Süden in Richtung King’s Road. Die kleine Straße, gesäumt von hübschen Häusern mit kleinen Läden dazwischen, war ihr vertraut. Neu war dagegen das kleine italienische Restaurant. Vorher war dort ein Schuhmacher gewesen, in dessen verstaubter Auslage Hundeleinen, Koffergurte und äußerst seltsame Plastikhandtaschen herumgelegen hatten.
Das Restaurant hieß Seppi’s. Auf dem Kopfsteinpflaster davor standen Lorbeerbäumchen in Kübeln; es hatte eine fröhlich rot-weiß gestreifte Markise und frische, weiß getünchte Wände.
Als Flora näher kam, ging die Tür auf, und ein Mann schleppte einen Tisch heraus, den er auf das Pflaster stellte. Er ging wieder hinein und kam mit zwei kleinen schmiedeeisernen Stühlen, einer rot-weiß karierten Tischdecke und einer Chiantiflasche im Strohmantel zurück. Dann begann er den Tisch zu decken.
Die Brise verfing sich im Tischtuch und brachte es zum Flattern. Der Mann schaute auf und sah Flora. Die dunklen Augen blitzten sie mit einem mediterranen Lächeln an.
«Ciao, Signorina.»
Italiener sind wunderbar, dachte Flora. Das Lächeln, der Gruß gaben ihr das Gefühl, sie sei eine alte Freundin. Kein Wunder, dass sie so erfolgreiche Gastronomen waren.
Sie lächelte. «Hallo. Wie geht’s?»
«Phantastisch. Wer könnte sich nach einem solchen Tag anders fühlen? Es ist wie in Rom. Und Sie sehen aus wie eine Italienerin, die den Sommer am Meer verbracht hat. Braungebrannt.» Er machte eine anerkennende Geste, zu der ein Kuss in die Luft und ausgebreitete Fingerspitzen gehörten. «Wunderbar.»
«Danke.» Sie schwieg entwaffnet, aber durchaus willens, dieses erfreuliche Gespräch fortzusetzen. Durch die offene Restauranttür wehten appetitanregende Gerüche – ein Hauch Knoblauch, herrliche rote Tomaten, Olivenöl. Flora merkte, dass sie heißhungrig war. Sie hatte im Zug nicht zu Mittag gegessen, und es kam ihr vor, als sei sie kilometerweit gelaufen, seit sie das Shelbourne verlassen hatte. Die Füße taten ihr weh, sie war durstig.
Sie schaute auf die Uhr. Es war kurz nach sieben. «Haben Sie offen?»
«Für Sie haben wir immer offen.»
Sie akzeptierte das Kompliment und sagte: «Ich möchte nur ein Omelett oder so.»
«Sie, Signorina, bekommen alles, was Sie wollen …» Er trat beiseite und streckte einladend den Arm aus, und Flora folgte der charmanten Aufforderung und ging hinein. Innen war eine kleine Bar, und dahinter erstreckte sich das lange, schmale Restaurant. Gepolsterte Bänke, bezogen mit genopptem orangefarbenen Stoff, zogen sich an den Wänden entlang, davor standen gescheuerte Kiefernholztische mit frischen Blumen und bunten, karierten Servietten darauf. Die Wände waren verspiegelt, auf dem Boden lagen Strohmatten. Nach dem Geklapper, den Gerüchen und lauten italienischen Stimmen zu urteilen, die aus dieser Richtung kamen, befand sich die Küche ganz hinten. Alles war kühl und frisch, und Flora fühlte sich, als sei sie nach einem anstrengenden Tag endlich nach Hause gekommen. Sie bestellte ein Bier und machte sich dann auf die Suche nach der Damentoilette, wo sie sich Gesicht und Hände wusch und sich das Haar kämmte. Im Restaurant wartete der junge Italiener auf sie. Er hatte einen Tisch von der Wand zurückgezogen, sodass sie sich setzen konnte. Das Bier war kühl und sauber eingeschenkt, Schälchen mit Oliven und Nüssen zum Knabbern standen daneben.
«Sind Sie sicher, dass Sie nur ein Omelett wollen, Signorina?», erkundigte er sich, als sie sich setzte. «Wir haben heute Abend ausgezeichnetes Kalbfleisch. Meine Schwester Francesca wird es für Sie traumhaft zubereiten.»
«Nein, nur ein Omelett. Aber mit etwas Schinken darin. Und vielleicht einen grünen Salat.»
«Ich mache unsere ganz spezielle Salatsauce.»
Bislang war das Lokal völlig leer gewesen, aber nun öffnete sich die Tür von der Straße her, weitere Gäste kamen herein und setzten sich an die Bar. Der junge Kellner eilte zu ihnen, um die Bestellungen aufzunehmen. Flora nahm einen Schluck von dem eiskalten Bier und fragte sich, ob jede Laufkundin, die zufällig dieses bezaubernde Lokal betrat, derart herzlich begrüßt wurde. Alle sprachen davon, dass London immer unangenehmer werde, dass die Leute abweisend und wenig hilfsbereit seien. Es war herzerwärmend, wenigstens ein Gegenbeispiel zu dieser Entwicklung zu erleben.