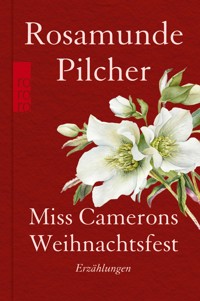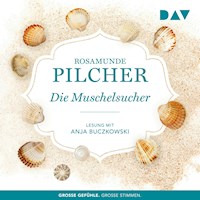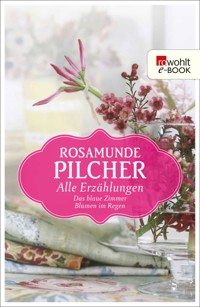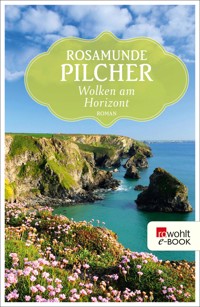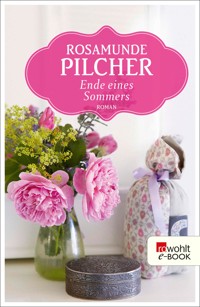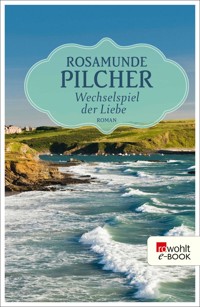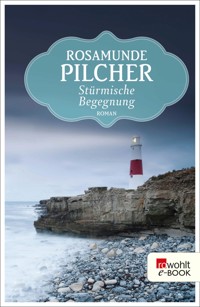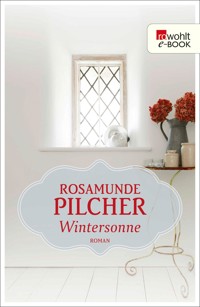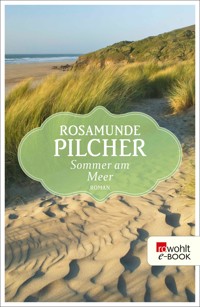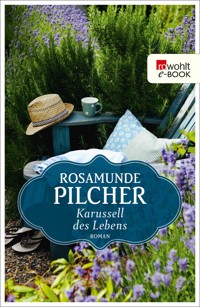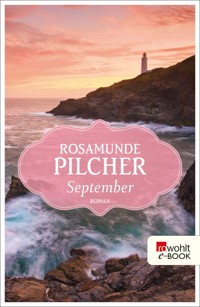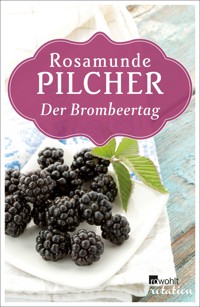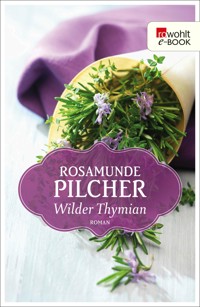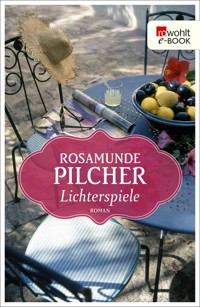
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis des Glücks Ihren Vater hat Emma Litton niemals richtig kennengelernt. Was für ein Mensch ist dieser weltberühmte Maler, den sie ein Leben lang immer nur aus der Ferne sehnsüchtig bewunderte? Emma ist sich sicher: Glücklich kann sie nur werden, wenn sie sich endlich einen Platz im Herzen ihres Vaters erobert. Also verlässt sie ihre Wahlheimat Paris und zieht zu ihm nach Cornwall. Doch dort muss Emma erkennen, dass es für das Glück kein Patentrezept gibt – sie muss ihren eigenen Weg finden. Und es gibt jemanden, der ihr dabei helfen könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Lichterspiele
Roman
Aus dem Englischen von Margarete Längsfeld
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
1
Paris im Februar, und die Sonne schien. Am Flughafen Le Bourget funkelte sie kalt am eisblauen Himmel, der sich glitzernd in den vom nächtlichen Regen noch nassen Rollbahnen spiegelte. Von drinnen sah der Tag verlockend aus, und sie hatten sich auf die Terrasse hinausgewagt, mussten jedoch feststellen, dass die strahlende Sonne nicht richtig wärmte und die muntere Brise, die die Windsäcke rechtwinklig zur Seite blies, schneidend war wie ein Messer. Entmutigt hatten sie sich ins Restaurant zurückgezogen, um den Aufruf von Emmas Flug abzuwarten. Jetzt saßen sie an einem kleinen Tisch, tranken schwarzen Kaffee und rauchten Christophers Gauloises.
Sie waren ganz ineinander versunken; dennoch erregten sie zwangsläufig eine gewisse Aufmerksamkeit; denn sie gaben ein faszinierendes Paar ab. Emma war groß und sehr dunkel. Ihre Haare, mit einem Schildpattreifen aus der Stirn gehalten, fielen ihr wie eine glatte schwarze Quaste über die Schultern. Ihr Gesicht war nicht schön; es war zu scharfknochig und streng, um als schön zu gelten, mit der geraden Nase und dem kantigen, entschlossenen Kinn. Doch diese Züge wurden gemildert durch den Zauber der großen, erstaunlich graublauen Augen und den breiten Mund, der sich manchmal missmutig verzog, wenn sie ihren Willen nicht bekam, der aber auch von einem Ohr zum anderen beinahe jungenhaft grinsen konnte, wenn sie glücklich war. Sie war jetzt glücklich. An diesem kalten, strahlenden Tag trug sie ein knallgrünes Kostüm und einen weißen Pullover, der die Bräune ihres Gesichts betonte, doch ihre elegante Erscheinung wurde beeinträchtigt durch die Gepäckstücke, die sie um sich herum aufgebaut hatte und die auf einen zufälligen Beobachter wirken mussten, als seien sie aus einem Taifun geborgen.
Es war tatsächlich alles, was sich während eines sechsjährigen Lebens im Ausland angesammelt hatte, doch das konnte niemand wissen. Drei Koffer hatte sie zu enormen Kosten schon aufgegeben. Aber da waren noch eine leinene Reisetasche, eine Prisunic-Papiertüte, der mehrere Baguettes entsprossen, ein Korb, prallvoll mit Büchern und Schallplatten, ein Regenmantel, ein Paar Skistiefel und ein riesengroßer Strohhut.
Christopher beäugte die zahllosen Utensilien und erwog beiläufig und ohne große Besorgnis, wie sie das alles ins Flugzeug befördern sollten.
«Du könntest den Hut, die Skistiefel und den Regenmantel anziehen. Dann hättest du drei Stücke weniger zu tragen.»
«Ich hab schon Schuhe an, und der Hut würde weggeweht. Der Regenmantel ist abscheulich. Ich seh darin wie eine Zwangsumsiedlerin aus. Ich weiß nicht, wieso ich ihn überhaupt mitgenommen habe.»
«Ich kann dir sagen, warum. Weil’s in London regnen wird.»
«Nicht unbedingt.»
«Da regnet’s immer.» Er zündete sich am Stummel der ersten Gauloise eine neue an. «Ein guter Grund mehr, bei mir in Paris zu bleiben.»
«Das haben wir schon hundertmal durchgesprochen. Und ich geh nach England zurück.»
Sein Grinsen zeigte keine Spur von Bitterkeit. Er hatte es nicht ernst gemeint. Wenn er lächelte, zogen sich seine gelb gefleckten Augen schräg nach oben, und in Verbindung mit seinem schlaksigen, trägen Körper verlieh ihm dies eine eigentümlich katzenhafte Erscheinung. Seine fröhlich bunte, lässige Kleidung hatte etwas Bohemehaftes. Weite Cordhose, abgetragene knöchelhohe Schnürstiefel, ein blaues Baumwollhemd über einem gelben Pullover und eine Wildlederjacke, sehr alt und an Ellbogen und Kragen stark glänzend. Er sah französisch aus, dabei war er tatsächlich so englisch wie Emma und so gut wie mit ihr verwandt, denn vor Jahren, als Emma sechs und Christopher zehn war, hatte ihr Vater, Ben Litton, Christophers Mutter, Hester Ferris, geheiratet. Die Ehe hatte knapp achtzehn Monate gehalten, und in Emmas Erinnerung war dies bis heute die einzige Phase ihres Lebens, die entfernte Ähnlichkeit mit einem normalen Familienleben hatte.
Es war Hester gewesen, die auf dem Kauf der Cottages in Porthkerris bestanden hatte. Ben besaß seit Jahren dort ein Atelier; er hatte es schon lange vor dem Krieg gekauft, aber es wies keine Spur von Komfort auf, und nach einem Blick auf die Verwahrlosung, in der zu leben ihr zugemutet wurde, erwarb Hester sogleich zwei Fischerhütten und machte sich daran, sie mit Geschmack und Charme umzugestalten. Ben interessierte sich nicht für derlei Tätigkeiten, und so wurde es vorwiegend Hesters Haus. Sie bestand auf einer praktischen Küche, einem Boiler, der Wasser erhitzte, und einem großen Kamin, in dem stets ein Treibholzfeuer loderte, das Herz ihres Heims, der Mittelpunkt, um den sich die Kinder versammeln konnten.
Hester hatte die besten Absichten, nur waren ihre Methoden bei der Verwirklichung wenig erfolgreich. Sie bemühte sich, Rücksicht auf Ben zu nehmen. Schließlich hatte sie ein Genie geheiratet; sie kannte seinen Ruf und war bereit, bei seinen Liebesaffären, seinen verrufenen Freunden und seinem Verhältnis zum Geld ein Auge zuzudrücken. Doch wie es so oft geschieht in ganz normalen Ehen, waren es am Ende die Kleinigkeiten, die sie zermürbten: die vergessenen, unverzehrten Mahlzeiten. Die läppischen, monatelang unbezahlten Rechnungen. Die Tatsache, dass Ben es vorzog, in der Kneipe zu trinken statt auf zivilisierte Art und Weise zu Hause, bei ihr. Seine Weigerung, ein Telefon anzuschaffen, sich ein Auto zuzulegen; der Strom offensichtlich gestrandeter Menschen, die er einlud, auf ihrem Sofa zu nächtigen, und zu guter Letzt seine völlige Unfähigkeit, zu irgendeiner Zeit irgendeine Form von Zuneigung zu zeigen.
Am Ende verließ sie ihn, nahm Christopher mit und reichte bald darauf die Scheidung ein. Ben war froh darüber. Er war auch froh, den kleinen Jungen los zu sein. Die beiden waren nicht gut miteinander ausgekommen. Ben wachte eifersüchtig über seine männliche Überlegenheit, er wollte der einzige Mann von Bedeutung in seinem Haus sein, und Christopher war schon mit zehn Jahren eine Persönlichkeit, die sich nicht übergehen ließ. Trotz Hesters Bemühungen hielt diese Feindschaft an. Sogar das gute Aussehen des Jungen, von dem Hester aufrichtig glaubte, dass es Bens Malerauge entzücken würde, hatte genau die umgekehrte Wirkung, und als Hester Ben zu überreden versuchte, ihn zu porträtieren, weigerte er sich.
Nach ihrer Abreise glitt das Leben in Porthkerris wie selbstverständlich in sein altes düsteres Einerlei zurück. Emma und Ben wurden von einer Reihe schlampiger junger Frauen versorgt, entweder Modelle oder Malereistudentinnen, die mit der monotonen Gleichmäßigkeit einer geordneten Kinoschlange in, durch und aus Ben Littons Leben traten. Das Einzige, was sie verband, waren die aufdringlich schmeichelnde Bewunderung für Ben und eine hochmütige Verachtung für Hausarbeiten. Von Emma nahmen sie so wenig Notiz wie möglich, dennoch vermisste sie Hester nicht so sehr, wie die Leute dachten. Es war ihr, ebenso wie Ben, lästig, ein geregeltes Leben zu führen und unaufhörlich in saubere Kleider gesteckt zu werden, doch die Trennung von Christopher hinterließ eine große Leere in ihrem Leben, die sich nicht füllen lassen wollte. Sie hatte eine kleine Weile um ihn getrauert, sie versuchte, ihm Briefe zu schreiben, traute sich aber nicht, Ben nach seiner Adresse zu fragen. Einmal war sie in verzweifelter Einsamkeit fortgelaufen, um ihn zu suchen. Das endete damit, dass sie zum Bahnhof ging und eine Fahrkarte nach London lösen wollte. Wenn sie Christopher suchen wollte, konnte sie dort so gut wie in jeder anderen Stadt beginnen. Aber ein Penny und ein Neunpencestück war alles, was sie besaß, und der Stationsvorsteher, der sie kannte, hatte sie mit in sein Büro genommen, das nach Petroleumlampen und der schwarzen Lokomotivkohle roch, mit der er seinen Kamin heizte, hatte ihr aus einer Emaillekanne eine Tasse Tee eingeschenkt und sie nach Hause gebracht. Ben arbeitete und hatte ihre Abwesenheit gar nicht bemerkt. Sie versuchte nie wieder, Christopher zu finden.
Als Emma dreizehn war, wurde Ben für zwei Jahre ein Lehrstuhl an der Universität von Texas angeboten, den er ohne einen einzigen Gedanken an Emma sofort annahm. In der kurzen Zwischenzeit wurde Emmas Zukunft erörtert. Vor die Frage nach seiner Tochter gestellt, verkündete er, er würde sie einfach mit nach Texas nehmen, aber irgendjemand – vermutlich Marcus Bernstein – überzeugte Ben, dass sie ohne ihn besser dran wäre, und sie wurde auf eine Schule in der Schweiz geschickt. Sie blieb drei Jahre in Lausanne, ohne auch nur einmal nach England zurückzukehren, und ging anschließend noch für ein Jahr nach Florenz, um die italienische Kunst der Renaissance zu studieren. Nach Ablauf dieser Zeit war Ben in Japan. Als sie den Vorschlag machte, zu ihm zu kommen, antwortete er mit einem Telegramm: Einziges Gästebett belegt von bezaubernder Geisha – versuch doch, in Paris zu leben.
Gleichmütig, denn sie war nun siebzehn, und das Leben bot keine Überraschungen mehr, befolgte Emma seinen Vorschlag. Sie fand eine Anstellung bei einer Familie namens Duprés, die in einem großen Haus in St. Germain lebte. Es war ein sehr akademischer Haushalt: Der Vater war Medizinprofessor, die Mutter Lehrerin. Emma versorgte die drei wohlerzogenen Kinder, unterrichtete sie in Englisch und Italienisch und fuhr im August mit ihnen in die bescheidene Villa in La Baule, die der Familie gehörte. Und die ganze Zeit wartete sie geduldig, bis Ben wieder nach England kam. Er blieb achtzehn Monate in Japan, und als er zurückkehrte, nahm er den Weg über die Vereinigten Staaten, wo er einen Monat in New York verbrachte. Marcus Bernstein flog dorthin, um sich mit ihm zu treffen, und es war typisch, dass Emma den Grund für dieses Wiedersehen nicht von Ben selbst erfuhr, auch nicht von Leo, der gewöhnlich ihre Informationsquelle war, sondern aus einem langen, reichlich bebilderten Artikel in der französischen Zeitschrift Réalités, der sich mit einem neuerbauten Museum in Queenstown, Virginia, befasste. Dieses Museum war zum Gedenken an einen reichen Virginier namens Kenneth Ryan von seiner Witwe eingerichtet worden, und die Kunstabteilung sollte mit einer Retrospektive der Gemälde von Ben Litton, angefangen bei seinen Vorkriegslandschaften bis hin zu seinen neuesten abstrakten Werken, eröffnet werden.
Eine derartige Ausstellung war sowohl eine Ehre als auch eine Huldigung und legte nahe, dass der Maler ein verehrter großer alter Mann der Kunst sei. Als Emma eine Fotografie von Ben betrachtete, voller Kanten und Kontraste, braungebranntes Gesicht, vorspringendes Kinn und schneeweiße Haare, da fragte sie sich, was er bei so viel Verehrung empfinden mochte. Er hatte sich sein Leben lang gegen Konventionen gesperrt, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass er sich folgsam darein schickte, ein großer alter Irgendwas zu sein.
«Was für ein Mann!», sagte Madame Duprés, als Emma ihr die Fotografie zeigte. «Er ist sehr attraktiv.»
«Ja», sagte Emma seufzend. Genau das war immer das Problem gewesen.
Er kehrte im Januar mit Marcus nach London zurück und begab sich schnurstracks nach Porthkerris, um zu malen. Das wurde durch einen Brief von Marcus bestätigt. An dem Tag, als der Brief kam, ging Emma zu Madame Duprés und kündigte. Die Familie versuchte, sie zu überreden, zu umschmeicheln, zu bestechen, um sie umzustimmen, aber sie war unerbittlich. Sie hatte ihren Vater seit sechs Jahren kaum gesehen. Es wurde Zeit, dass sie sich neu kennenlernten. Sie wollte zurück nach Porthkerris, um bei ihm zu leben.
Am Ende ließen die Duprés’ sie ziehen, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Ihr Flug wurde gebucht, und sie fing an zu packen. Einiges von dem, was sich in sechs Jahren angesammelt hatte, warf sie weg, den Rest stopfte sie in diverse ramponierte, weit gereiste Koffer. Doch die reichten leider nicht aus, und Emma sah sich am Ende gezwungen, einen Korb zu kaufen, einen riesigen französischen Marktkorb, der die zahlreichen bizarr geformten Gegenstände aufnehmen konnte, die nirgendwo sonst hineinpassen wollten.
Es war ein grauer, kalter Nachmittag, zwei Tage vor ihrem Heimflug. Madame Duprés war zu Hause, daher erklärte Emma ihr, was sie vorhatte, ließ die Kinder bei ihr und ging allein fort. Überrascht stellte sie fest, dass es regnete, ein leichtes, kaltes Nieseln. Das Kopfsteinpflaster der schmalen Straße glänzte vor Nässe, und die hohen Häuser mit ihren verblassten Farben standen still und verschlossen vor der Düsternis wie Gesichter, die nichts preisgaben. Auf dem Fluss tutete ein Schleppkahn, und eine einsame Möwe schwebte trübsinnig kreischend hoch oben im Nebel. Die Illusion von Porthkerris war plötzlich wirklicher als die Realität von Paris. Der Entschluss zur Rückkehr, den sie so lange mit sich herumgetragen hatte, verdichtete sich jetzt zu dem Eindruck, sie sei bereits dort.
Diese Straße führte – nein, nicht auf die belebte Rue St. Germain, sondern zum Hafen hin. Jetzt würde die Flut hereinkommen, das Hafenbecken war dann angefüllt mit grauer See und tanzenden Booten, das Wasser schwappte bis jenseits der Nordpier, weiße Schaumköpfe krönten den Atlantik. Und dann die vertrauten Gerüche – Fisch vom Markt und heiße, safrangelbe Brötchen vom Bäcker; die vielen kleinen Sommergeschäfte waren in dieser Jahreszeit geschlossen, die Rollläden heruntergelassen. Und hinten im Atelier würde Ben arbeiten, die Hände mit Wollhandschuhen vor der Kälte geschützt; die grellen Farben seiner leuchtenden Palette hoben sich von den vorbeifegenden grauen Wolken ab, die von dem hohen Nordfenster des Ateliers eingerahmt wurden.
Sie kehrte heim. In zwei Tagen würde sie zu Hause sein. Der Regen nässte ihr Gesicht, und auf einmal hatte sie das Gefühl, nicht warten zu können, und die Vorfreude durchströmte sie wie eine Welle von Energie, sodass sie rennen musste. Sie rannte den ganzen Weg zu der kleinen Épicerie in der Rue St. Germain, wo es große Einkaufskörbe gab.
Es war ein winziges Lädchen, duftend nach frischem Brot und mit Knoblauch gewürzten Würsten, nach Zwiebeln, die wie weiße Perlen aufgereiht von der Decke herabhingen, und nach Wein in Krügen, den die hiesigen Arbeiter literweise kauften. Die Körbe hingen an der Tür, zusammengebunden und an einem Stück Tau aufgehängt. Emma traute sich nicht, es aufzuknoten und sich einen Korb auszusuchen, aus Angst, der ganze Haufen könnte aufs Pflaster fallen; deshalb ging sie in den Laden, um sich nach Hilfe umzusehen. Drinnen stand nur die dicke Frau mit dem Leberfleck im Gesicht, und sie war mit einem Kunden beschäftigt. Emma wartete. Der Kunde war ein blonder junger Mann, sein Regenmantel hatte feuchte Streifen. Er kaufte eine Baguette und ein Stück Landbutter. Emma musterte ihn und fand ihn zumindest von hinten attraktiv.
«Combien?», fragte er.
Die dicke Frau addierte mit einem Bleistiftstummel und nannte ihm die Summe. Er griff in die Tasche und bezahlte, drehte sich um, lächelte Emma an und steuerte auf die Tür zu.
Und dort blieb er stehen. Die Hand an der Türkante drehte er sich langsam um, um genauer hinzusehen. Sie sah die bernsteinfarbenen Augen, das langsame, ungläubige Lächeln.
Das Gesicht war dasselbe, das bekannte Jungengesicht auf der unbekannten Männergestalt. Er schien einfach eine Fortsetzung der Illusion von Porthkerris zu sein, ein Produkt ihrer sehnsüchtigen Phantasie. Das war nicht er. Das konnte er nicht …
Sie hörte sich «Christo» sagen, und es war das Natürlichste auf der Welt, den Namen zu nennen, bei dem nur sie allein ihn genannt hatte. Er sagte ruhig: «Ich glaub’s einfach nicht», und dann ließ er seine Päckchen fallen und streckte die Arme aus. Emma warf sich hinein und drückte sich eng an die glänzende Nässe seines Regenmantels.
Ihnen blieben zwei gemeinsame Tage. Emma sagte zu Madame Duprés: «Mein Bruder ist in Paris», und Madame, die gutherzig war und sich ohnehin damit abgefunden hatte, auf Emma verzichten zu müssen, gab Emma frei, damit sie die Zeit mit Christopher verbringen konnte. Sie nutzten die zwei Tage für gemächliche Spaziergänge durch die Straßen der Stadt; sie beugten sich über die Brücken, um die Kähne zu beobachten, die unter ihnen dahinglitten, nach Süden und zur Sonne hin; sie saßen im spärlichen Sonnenschein und tranken Kaffee an kleinen runden Eisentischen, und wenn es regnete, suchten sie Schutz in Notre-Dame oder im Louvre, auf der Treppe unterhalb der Nike hockend, der geflügelten Siegesgöttin. Und sie redeten immerzu. Sie hatten so viel zu fragen und so viel zu erzählen. Emma erfuhr, dass Christopher nach einigen beruflichen Fehlschlägen beschlossen hatte, Schauspieler zu werden. Das verursachte einigen Widerstand von seiner Mutter – in achtzehn Monaten mit Ben Litton hatte sie ein lebenslanges Misstrauen gegen künstlerische Ambitionen entwickelt –, aber er war fest geblieben und hatte es sogar geschafft, ein Stipendium an der Royal Academy of Dramatic Arts zu bekommen. Er hatte zwei Jahre an einem Repertoiretheater in Schottland gespielt, war nach London gezogen und erfolglos geblieben, hatte ein bisschen fürs Fernsehen gearbeitet und war dann durch die Einladung eines Bekannten, dessen Mutter ein Haus in St. Tropez besaß, abgelenkt worden.
«St. Tropez im Winter?», fragte Emma prompt.
«Es hieß jetzt oder nie. Im Sommer hat man es uns nie angeboten.»
«Aber war es denn nicht kalt?»
«Eisig. Es hat ununterbrochen geregnet. Und wenn Wind aufkam, klapperten sämtliche Jalousien. Es war wie in einem Gruselfilm.»
Im Januar war er nach London zurückgekehrt, um seinen Agenten aufzusuchen, und man hatte ihm ein Zwölfmonats-Engagement an einem kleinen Repertoiretheater in Südengland angeboten. Es war nicht die Art Arbeit, die er sich wünschte, aber besser als nichts, denn ihm ging allmählich das Geld aus. Und es war nicht allzu weit von London. Die Arbeit begann jedoch erst Anfang März, deswegen war er nach Frankreich zurückgekehrt, in Paris gelandet und hatte schließlich Emma getroffen. Es begeisterte ihn keineswegs, dass sie so bald nach England heimkehrte, und er setzte alles daran, sie umzustimmen, damit sie ihren Flug verschob und bei ihm in Paris blieb. Doch Emma war unerbittlich.
«Du verstehst das nicht. Ich muss einfach hin.»
«Der alte Knabe hat dich ja nicht mal darum gebeten. Du wirst ihm bloß lästig sein und ihn bei seinen Liebesabenteuern stören.»
«Das hab ich nie gemacht – gestört, meine ich.» Sie lachte über seinen finsteren Gesichtsausdruck. «Außerdem hat es keinen Sinn, dass ich bleibe, wenn du nächsten Monat wieder nach England kommst.»
Er verzog das Gesicht. «Ich hab gar keine Lust. Dieses miese kleine Theater in Brookford. Ich werde mich im Dschungel des Vierzehntage-Repertoires verlieren. Außerdem muss ich erst in zwei Wochen dort sein. Wenn du doch nur in Paris bleiben könntest …»
«Nein, Christo.»
«Paris im Frühling … blauer Himmel, Blüten und das ganze Drum und Dran?»
«Es ist noch nicht Frühling. Es ist noch Winter.»
«Warum musst du immer so halsstarrig sein?»
Es half nichts, sie war nicht bereit zu bleiben, und am Ende gab er sich geschlagen. «Na gut, wenn ich dich nicht überreden kann, mir Gesellschaft zu leisten, werde ich mich einfach sehr wohlerzogen und britisch benehmen und dich zum Flugzeug bringen.»
«Das wäre großartig.»
«Es ist ein ziemliches Opfer. Ich hasse Abschiede.»
Hierin war Emma mit ihm einer Meinung. Manchmal hatte sie das Gefühl, als hätte sie ihr Leben lang von Menschen Abschied genommen, und das Geräusch eines Zuges, der aus dem Bahnhof fuhr und sein Tempo beschleunigte, genügte, um sie in Tränen ausbrechen zu lassen. «Aber dieser Abschied ist anders.»
«Wieso ist er anders?», wollte er wissen.
«Es ist kein richtiger Abschied. Es ist ein ‹Auf Wiedersehen›. Eine Brücke zwischen zwei Hallos.»
«Meiner Mutter und deinem Vater wird es nicht passen.»
«Es spielt keine Rolle, ob es ihnen passt oder nicht», sagte Emma. «Wir haben uns wiedergefunden. Das ist im Moment das Einzige, was zählt.»
Über ihnen knackten die Lautsprecher und begannen, mit weiblicher Stimme zu sprechen.
«Meine Damen und Herren, erster Aufruf für Air France Flug Nummer 402 nach London …»
«Das bin ich», sagte Emma.
Sie drückten ihre Zigaretten aus, standen auf, begannen, das Gepäck einzusammeln. Christopher nahm die Leinentasche, die Prisunic-Papiertüte und den großen bauchigen Korb. Emma warf sich den Regenmantel über die Schultern und ergriff ihre Handtasche, die Skistiefel und den Hut.
«Ich wünschte, du würdest den Hut aufsetzen», sagte Christopher. «Er würde deinem Auftritt den letzten Pfiff geben.»
«Er würde wegfliegen. Außerdem sähe es komisch aus.»
Sie gingen nach unten, überquerten den glänzenden Fußboden bis zur Sperre, wo sich schon eine kleine Passagierschlange bildete.
«Emma, fährst du heute noch bis Porthkerris?»
«Ja, ich nehme den ersten Zug, den ich kriegen kann.»
«Hast du überhaupt Geld? Ich meine Pfund, Schillinge und Pence?»
Daran hatte sie nicht gedacht. «Nein. Aber das macht nichts. Ich kann irgendwo einen Scheck einlösen.»
Sie stellten sich hinter einem englischen Geschäftsmann an, der nur seinen Pass und eine schmale Aktenmappe bei sich trug. Christopher beugte sich nach vorn.
«Oh, Sir, ob Sie uns wohl helfen können?»
Der Mann drehte sich um und sah zu seiner Verwunderung Christophers Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem entfernt. Christopher hatte eine beeindruckende Unschuldsmiene aufgesetzt. «Verzeihen Sie, aber wir haben ein kleines Problem. Meine Schwester fliegt nach London zurück, sie war sechs Jahre nicht zu Hause, sie hat so viel Handgepäck, und sie ist gerade erst von einer schweren Operation genesen …»
Emma erinnerte sich, dass Ben gesagt hatte, Christopher würde nie Zuflucht zu einer kleinen Lüge nehmen, wenn er mit einer größeren aufwarten könnte. Als sie ihn ansah, wie er dieses unerhörte Märchen vorbrachte, fand sie, dass er seinen Beruf klug gewählt hatte. Er war ein großartiger Schauspieler.
Der Geschäftsmann konnte denn auch so schnell keine Ausflucht finden.
«Hm, ja, ich denke …»
«Das ist furchtbar nett von Ihnen …» Die Leinentasche und die Tüte mit dem Brot wanderten unter einen Arm, der Korb kam zu der schmalen Aktenmappe in den anderen. Der Mann begann Emma leidzutun.
«Es ist bloß, bis wir in der Maschine sind … es ist so nett von Ihnen, und sehen Sie, mein Bruder kommt nicht mit …»
Die Schlange rückte vor, sie waren an der Sperre angelangt.
«Wiedersehen, liebste Emma», sagte Christo.
«Wiedersehen, Christo.» Sie gaben sich einen Kuss. Eine Hand entriss ihr den Pass, blätterte ihn durch, stempelte ihn.
«Auf Wiedersehen.»
Sie wurden getrennt durch die Sperre, durch die Formalitäten der französischen Behörde, durch andere Reisende, die vorwärts drängten.
«Auf Wiedersehen.»
Es hätte sie gefreut, wenn er gewartet hätte, bis sie heil im Flugzeug war, doch schon als sie den Sonnenhut in seine Richtung schwenken wollte, hatte er sich umgedreht und ging davon; das Licht schimmerte auf seinem Haar, und er hatte die Hände tief in den Taschen seiner Lederjacke vergraben.
2
London im Februar – es regnete. Es hatte um sieben Uhr morgens begonnen, und seitdem hatte es ohne Unterlass geregnet. Bis halb zwölf hatte nur eine Handvoll Leute die Ausstellung besucht, und diese Enthusiasten waren, wie jemand mutmaßte, nur gekommen, um dem Regen zu entgehen. Sie schüttelten nasse Regenmäntel und triefende Regenschirme, sie standen herum und klagten über das Wetter, bevor sie sich bequemten, einen Katalog zu kaufen.
Um halb zwölf kam der Mann herein, der ein Bild kaufen wollte. Er war Amerikaner, im Hilton abgestiegen, und fragte nach Mr. Bernstein. Peggy, die Empfangsdame, nahm die Karte, die er ihr reichte, erkundigte sich höflich, ob es ihm etwas ausmache, einen Moment zu warten, und kam dann nach hinten ins Büro, um mit Robert zu sprechen.
«Mr. Morrow, da draußen ist ein Amerikaner namens …» Sie warf einen Blick auf die Karte. «Lowell Cheeke. Er war vor einer Woche schon mal hier, und Mr. Bernstein hat ihm den Ben Litton mit den Hirschen gezeigt. Es sah ganz so aus, als würde er das Bild kaufen, aber dann konnte er sich wohl doch nicht entschließen. Er wollte es sich überlegen, sagte er.»
«Haben Sie ihm gesagt, dass Mr. Bernstein in Edinburgh ist?»
«Ja, aber er kann nicht warten. Er kehrt übermorgen in die Staaten zurück.»
«Dann spreche ich wohl am besten mit ihm», sagte Robert.
Er stand auf, und während Peggy die Tür aufhielt, um den Amerikaner hereinzubitten, erledigte er rasch den fälligen Frühjahrsputz auf seinem Schreibtisch, ordnete ein paar Briefe, leerte den Aschenbecher in den Papierkorb und schob den Korb mit der Schuhspitze unter den Schreibtisch.
«Mr. Cheeke.» Peggy meldete den Besucher wie ein gut geschultes Dienstmädchen.
Robert kam um den Schreibtisch herum, um ihm die Hand zu reichen.
«Guten Morgen, Mr. Cheeke. Ich bin Robert Morrow, Mr. Bernsteins Partner. Ich bedaure, er ist leider heute in Edinburgh, aber vielleicht kann ich Ihnen dienen …?»
Lowell Cheeke war ein kleiner, sehr selbstbewusster Mann, der einen Regenmantel und einen schmalkrempigen Hut trug. Beides war klatschnass, was darauf hindeutete, dass Mr. Cheeke nicht mit dem Taxi gekommen war. Mit Roberts Hilfe entledigte er sich der durchweichten Kleidungsstücke, und zum Vorschein kamen ein marineblauer Anzug aus garantiert knitterfreiem Material und ein nadelgestreiftes Nylonhemd. Er trug eine randlose Brille, die Augen dahinter waren kalt und grau. Es war schwer einzuschätzen, was er zu bieten hatte – sowohl in finanzieller wie in künstlerischer Hinsicht.
«Vielen Dank», sagte Mr. Cheeke. «Ein grässlicher Morgen …»
«Sieht auch nicht danach aus, dass es aufhört … Zigarette, Mr. Cheeke?»
«Nein, danke, ich rauche nicht mehr.» Er hustete verlegen. «Meine Frau hat es mir abgewöhnt.»
Sie schmunzelten über die weibliche Empfindsamkeit. Mr. Cheekes Augen schmunzelten nicht mit. Er griff sich einen Stuhl und setzte sich zurecht, indem er einen polierten schwarzen Schuh über das andere Knie legte. Es sah ganz so aus, als fühle er sich bereits zu Hause.
«Ich war vor einer Woche schon mal hier, Mr. Morrow, und Mr. Bernstein hat mir ein Bild von Ben Litton gezeigt – Ihre Empfangsdame hat Sie vermutlich informiert.»
«Ja. Das Hirschgemälde.»
«Ich möchte es mir gern noch einmal ansehen, wenn ich darf. Ich kehre übermorgen in die Staaten zurück und muss mich entscheiden.»
«Aber selbstverständlich …!»
Das Bild, das auf Mr. Cheekes Entscheidung wartete, lehnte immer noch an der Wand des Büros. Robert zog die Staffelei in die Mitte des Raumes, drehte sie zum Licht und hob den Ben Litton vorsichtig hinauf. Es war ein großes Bild, ein Ölgemälde, drei Hirsche in einem Wald. Licht sickerte durch die kaum angedeuteten Zweige, und der Künstler hatte viel Weiß verwendet, was dem Bild etwas Ätherisches verlieh. Doch das Interessanteste war, dass es nicht auf Leinwand, sondern auf Jute gemalt war. Die raue Struktur des Stoffes hatte den Pinselstrich des Malers verwischt wie die Konturen einer bei hoher Geschwindigkeit aufgenommenen Fotografie.
Der Amerikaner brachte seinen Stuhl mit einer Drehung in die richtige Position und richtete das kalte Funkeln seiner Brille auf das Gemälde. Robert zog sich diskret in den Hintergrund des Raumes zurück, um Mr. Cheekes Urteil in keiner Weise zu beeinträchtigen; ihm selbst war der Blick auf das Bild von dem runden Bürstenschnittkopf seines potenziellen Kunden verdeckt. Er persönlich mochte das Bild, obwohl er eigentlich kein Fan von Ben Litton war. Er fand seine Arbeiten gekünstelt und nicht immer leicht zu verstehen – möglicherweise eine Spiegelung der Persönlichkeit des Künstlers –, doch diese rasch hingeworfene Waldimpression konnte man immer wieder betrachten, ohne sie jemals leid zu werden.
Mr. Cheeke erhob sich von seinem Stuhl, trat vor das Gemälde, betrachtete es eingehend, trat wieder zurück und lehnte sich schließlich an Roberts Schreibtisch.
«Was, glauben Sie, Mr. Morrow», fragte er, ohne sich umzudrehen, «hat Litton veranlasst, es auf Sackleinen zu malen?»
Bei dem Wort Sackleinen hätte Robert beinahe gelacht. Am liebsten hätte er etwas Respektloses gesagt – vermutlich hatte er gerade einen alten Sack herumliegen –, aber Mr. Cheeke sah nicht so aus, als würde er Despektierlichkeiten dulden. Mr. Cheeke war hier, um Geld auszugeben – und das war stets ein ernsthaftes Geschäft. Robert wurde jetzt klar, dass er den Litton als Kapitalanlage kaufte, in der Hoffnung, es würde sich für ihn auszahlen.
Also sagte Robert: «Ich habe leider keine Ahnung, Mr. Cheeke, aber es verleiht der Arbeit einen höchst ungewöhnlichen Charakter.»
Mr. Cheeke wandte den Kopf und schenkte Robert ein kühles Lächeln.
«Sie sind über solche Aspekte nicht so gut informiert wie Mr. Bernstein.»
«Nein», sagte Robert, «leider.»
Mr. Cheeke versenkte sich noch einmal in die Betrachtung des Bildes. Stille breitete sich aus. Roberts Aufmerksamkeit begann abzuschweifen. Hintergrundgeräusche waren plötzlich deutlich zu hören: das Ticken seiner Armbanduhr. Stimmengemurmel jenseits der Tür. Donnerndes Grollen wie eine ferne Brandung: der Verkehr auf dem Piccadilly.
Der Amerikaner seufzte tief. Er kramte in seinen Taschen, einer nach der anderen, und suchte etwas. Ein Taschentuch vielleicht. Kleingeld für die Taxifahrt zurück zum Hilton. Robert hatte ihn nicht überzeugt, dass es sich lohnte, den Litton zu kaufen. Er würde eine Entschuldigung vorbringen und gehen.
Mr. Cheeke suchte jedoch nur nach seinem Stift. Als er sich umdrehte, sah Robert, dass er sein Scheckheft schon in der anderen Hand hielt.
Als das Geschäft schließlich abgeschlossen war, entspannte sich Mr. Cheeke. Er wurde richtig menschlich und setzte sogar seine Brille ab, die er in einem geprägten Lederetui verstaute. Er nahm das Angebot eines Drinks an, und so saßen sie bei einem Sherry eine Weile zusammen und sprachen über Marcus Bernstein und Ben Litton und über die zwei oder drei Gemälde, die Mr. Cheeke bei seinem letzten Besuch in London erstanden hatte. Zusammen mit seiner neuesten Erwerbung sollten sie den Grundstein einer kleinen Privatsammlung bilden. Robert erzählte ihm von der Ben-Litton-Retrospektive, die im April in Queenstown, Virginia, gezeigt werden sollte, und Mr. Cheeke notierte es in seinem Kalender; dann standen beide auf, Robert half Mr. Cheeke in den Regenmantel, reichte ihm den Hut, und sie verabschiedeten sich.
«Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mr. Morrow, und das Geschäft mit Ihnen zu machen.»
«Ich hoffe, wir werden Sie wiedersehen, wenn Sie das nächste Mal nach London kommen.»
«Ich werde Sie ganz bestimmt aufsuchen …»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: