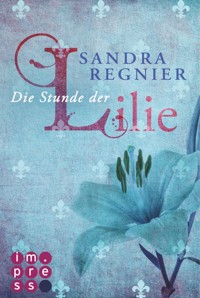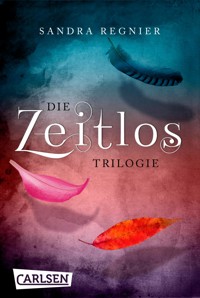8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Das Tor zur Elfenwelt in den Katakomben Edinburghs – endlich die gesamte Fortsetzung der »Pan«-Trilogie!** Nichts fürchtet die 16-jährige Internatsschülerin Allison mehr als dunkle Gänge, die scheinbar ins Nirgendwo führen. Doch genau durch solche muss sie bei einer Führung durch die Katakomben Edinburghs durch und richtet dabei auch prompt ein großes Chaos an. Dabei kommt es noch schlimmer: Der unglaublich gut aussehende und dabei nicht minder nervige Finn heftet sich an ihre Fersen und behauptet standhaft, er sei ein Elfenwächter und sie hätte die magische Pforte zur Anderwelt geöffnet. Und nun soll Allison, die nicht einmal an Elfen glaubt, dieses magische Reich vorm Sterben bewahren. Als dann auch noch ein dunkler Prinz für sie auftaucht, steht Allisons Welt endgültig Kopf … //Alle Bände der erfolgreichen Elfen-Reihe: -- Die Pan-Trilogie 1: Das geheime Vermächtnis des Pan -- Die Pan-Trilogie 2: Die dunkle Prophezeiung des Pan -- Die Pan-Trilogie 3: Die verborgenen Insignien des Pan -- Die Pan-Trilogie: Band 1-3 -- Die Pan-Trilogie: Die Pan-Trilogie. Band 1-3 im Schuber -- Die Pan-Trilogie: Die magische Pforte der Anderwelt (Pan-Spin-off 1) -- Die Pan-Trilogie: Das gestohlene Herz der Anderwelt (Pan-Spin-off 2) -- Die Pan-Trilogie: Der Sammelband der Anderwelt-Dilogie (E-Box des Pan-Spin-offs)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2020 Text © Sandra Regnier, 2017, 2019 Lektorat: Rebecca Wiltsch Coverbild: shutterstock.com / © Tutti Frutti / © Kanea / © Ilya Chalyuk / © maverick_infanta / © Roxana Bashyrova Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60583-9www.carlsen.de
Für Papa, Oma und Opa.
Ihr fehlt.
Und für alle Pan-Leser, denen die Elfenwelt gefehlt hat.
Teil 1
FINN
Die Anderwelt muss geschützt bleiben.
So lautet das wichtigste Gesetz Pans. Nur Elfen dürfen sie betreten. Allen anderen menschlichen oder menschendenkenden Wesen muss sie verschlossen bleiben. Die Mysterien müssen bewahrt werden.
Deswegen werden die Zugänge zur Elfenwelt streng bewacht. Es gibt mehrere in Großbritannien. Stonehenge ist einer davon, weitere findet man unter anderem in Cornwall, Wales, auf der Isle of Man und in London.
Ein Zugang ist in der unterirdischen Stadt von Edinburgh. Dort bin ich Wächter. Das war nicht immer so, ich wurde hierher abkommandiert. Oder besser gesagt: degradiert. Doch das ist eine andere Geschichte.
Dieser Einlass jedenfalls hat Pan, dem Gründer des Elfenreichs, stets am meisten Sorgen bereitet. Ganz in der Nähe des Zugangs befindet sich nämlich die magische Pforte.Sie ist nicht weiter auffallend oder bemerkenswert. Der Raum, in den sie führt, war typisch für Edinburghs Untergrund. Erbaut aus den üblichen Bruchsteinen, ohne Fenster und ohne zweiten Ausgang. Es gibt darin keine Möbel, nur den lehmgestampften Boden.
Die Pforte zu diesem Raum hat keine Tür. Sie ist ein einfacher Durchgang mit einer einzigen Besonderheit: Es regnet unter dem Sturz. Niemand, weder Elf noch Mensch, konnte bislang ergründen, woher das Wasser kommt. Die Menschen, die früher – und damit meine ich vor mehreren Hunderten von Jahren – hier vorbeikamen, vermuteten eine Grundwasserquelle.
Der verstorbene König Oberon glaubte nicht daran.Denn diese Regenpforte war bereits vorhanden, als sein Vater Pan alle Zugänge zur Anderwelt versiegelte. Das Ungewöhnlichste daran ist wohl, dass das Wasser keine Pfütze auf dem Boden hinterlässt. Ein untrügliches Zeichen für eine ganz besondere Art von Magie. Eine Magie, die uns Elfen nicht gegeben ist.
Ich bewache also zwei Türen. Niemand hatte die magische Pforte je trocken gesehen. Nicht einmal in den Jahren 1394 und 1652, als eine große Dürre Schottland heimsuchte.
Bis Allison Murray kam.
Ein Mädchen, das mir nicht einmal bis zum Kinn reichte, mit roten Locken und einer Nase voller Sommersprossen. Sie brachte das gesamte Elfenreich in höchste Gefahr. Mal davon abgesehen, dass sie mein Leben komplett auf den Kopf stellte.
Und das alles nur, weil sie sauber machen wollte.
ALLISON
Das neue Codewort
Ich hatte mich in der Mittagspause in den hintersten Winkel der Schulcafeteria zurückgezogen, um einen Brief meiner Eltern zu lesen. Im Nachhinein betrachtet wäre ich stattdessen besser in mein Zimmer gegangen und hätte die Tür abgeschlossen, um all dem zu entgehen, was nach diesem Tag auf mich hereinstürmte. Dann nämlich hätten mich meine Freundinnen nicht gefunden und ich hätte weiterhin das ruhige, beschauliche Leben einer normalen schottischen Schülerin des einundzwanzigsten Jahrhunderts geführt.
Hätte!
Ich hatte mich aber in die Mensa der St.-Pauls-Mädchenschule gesetzt, umringt von Mitschülerinnen, und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Die absonderlichen, seltsamen, völlig aus dem Ruder laufenden Ereignisse, die ich mir niemals in meinen Träumen hätte ausdenken können.
Der Brief war schon vor drei Tagen eingetroffen, doch ich hatte das Lesen aufgeschoben. Jeder Brief meiner Eltern beinhaltete so ziemlich das Gleiche. Zumindest fingen sie alle mit denselben Worten an, so auch dieser: »Liebste Allie, du wirst nicht glauben, was dein Vater und ich Aufregendes erlebt haben …«
Immer dieselbe Leier, die mich neugierig machen und gleichzeitig trösten sollte, weil sie mich in dieses Internat abgeschoben hatten.
Ich legte das Papier zur Seite und begann meinen Kartoffelbrei zu verdrücken. Wenigstens das Essen hier an der St. Pauls war gut, sogar die Rote Bete schmeckte ausgezeichnet. Ich aß noch ein paar Gabeln, ehe ich wieder nach dem Brief griff.
Doch bevor ich weiterlesen konnte, ließ sich jemand mit lautem Poltern auf den Stuhl neben mir fallen. Erschrocken knüllte ich das Papier zusammen.
»Wir brauchen ein neues Codewort!«
Camillas blonde Mähne hüpfte aufgebracht. Der Stuhl ächzte bedenklich unter ihr. Das lag nicht etwa daran, dass sie zu viel auf ihren Rippen hatte, sondern eher an ihrer hünenhaften Gestalt, die einer Brienne von Tarth nicht unähnlich war.
»Wozu? Reichen unsere Synonyme für genervt, langweilig, heißer Typ und stressige Eltern nicht aus?« Ich packte den Brief in meine Tasche. In dieser Mittagspause würde ich sowieso nicht mehr zum Lesen kommen, denn wenn Camilla auftauchte, war Emma meistens nicht weit. Und schon huschte unsere Freundin zwischen den schwatzenden und schmatzenden Mitschülern hindurch und kam auf unseren Tisch zu.
»Wir brauchen ein Codewort für nervige Austauschschülerin«, hauchte sie und ließ sich erschöpft auf den Stuhl mir gegenüber sinken.
»Aber du hattest dich doch so auf das Austauschprogramm gefreut«, sagte ich.
»Damals hatte ich die Hoffnung, ein schneidiger Franzose würde mein Partner werden. So ein Typ wie Alexander Skarsgård. Wer hätte gedacht, dass ich mich mit einer brünetten Fleur Delacour rumschlagen muss?«
Emma legte alles Elfenhafte ab und prustete laut hörbar Luft durch ihre Lippen. Camillas Wallach Lauredano hätte es nicht besser hinbekommen. Am Nachbartisch kicherten ein paar Mädchen.
»Du weißt schon, dass Alexander Skarsgård Schwede ist, ja?«, fragte ich amüsiert.
Emma sah betroffen aus. »Echt? Verdammt. Das hättest du mir ruhig vorher sagen können.«
Camilla rollte die Augen. »Und welches Codewort geben wir ihr jetzt?«
»Ist ›Jon Snow‹ für nervig nicht passend?«, fragte ich leise, damit die vom Nachbartisch nichts mitbekamen. Immerhin waren es unsere geheimen Codewörter.
Camilla schüttelte so heftig den Kopf, dass mir ihre Haare ins Gesicht peitschten. Sie musste dringend zum Friseur, ihr Bob wurde zu lang. »Nein, Jon Snow mit seiner ständigen Trauermiene trifft nicht im Entferntesten, was sie ist.«
Camilla entfuhr eine Beleidigung, die die Mädchen am Nachbartisch sich erschrocken zu uns umdrehen ließ.
»Nicht so laut! Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen«, zischte Emma unwirsch. »Vor allem will ich sie im Moment nicht hierhaben. Ich brauche eine Pause.«
Mit sie war Valérie de Mallet aus Montpellier gemeint, die bei Emma seit zwei Wochen wohnte und noch weitere zwei Wochen bleiben würde. Zugegeben, sie sah aus wie eine jüngere Ausgabe von Miranda Kerr, allerdings verhielt sie sich wie eine Diva. Seit sie angekommen war, meckerte und motzte sie ständig über alles. Das einzig wirklich Niedliche an ihr war ihre kleine Narbe an der Oberlippe, die ständig in Bewegung schien und von ihrer missbilligenden Miene ablenkte. Man konnte gar nicht anders, als ständig darauf zu starren, und es hatte etwas gedauert, bis ihre Worte zu uns durchdrangen.
Das Essen war ihr zu fad, die Landschaft zu trist, der Regen zu warm, die Sonne zu kalt, Camillas Pferd ein Ackergaul und ich das Ebenbild eines Hobbits – um nur ein paar Dinge zu nennen, über die sie hergezogen war. Wir konnten sie nicht leiden, seit sie den Mund aufgemacht hatte.
Emma strich ihre brünetten Haare zurück. Was völlig unnötig war, denn sie lagen wie immer perfekt: Glänzend, glatt und nicht eine Strähne stand jemals ab, so wie auch kein Fussel jemals ihre Erscheinung verunglimpfen würde. Ihre Model-Figur unterstrich sie mit ihrer eleganten Erscheinung – trotz Schuluniform, die an ihr saß wie ein Kostüm von Chanel. Ich hatte sie schon so oft gefragt, wie man diesen exakten Lidstrich mit Schwänzchen hinbekam oder das Make-up so verteilte, dass es aussah wie bei einem Filmstar. Emmas Antwort war jedes Mal frustrierend: »Das weiß ich nicht. Ich benutze nur Puder.«
Das bezweifelte ich zwar stark, aber sie war eine meiner beiden besten Freundinnen. Ich konnte ihr schlecht an den Kopf werfen, dass sie log.
Ich selbst war so ziemlich das Gegenteil von ihr und Camilla. Meine unzähligen Sommersprossen ließen sich weder mit Puder noch mit Make-up überdecken und meine roten Haare kringelten sich, egal wie viel Gel, Haarspray oder Glätteisen ich verwendete. Dadurch wurden sie höchstens stumpf.
Und niemand, der mir gegenüberstand, würde mich mit meinen eins achtundfünzig als elegant und grazil bezeichnen. Vor allem nicht, weil meine Taille eindeutig zeigte, wie sehr mir das schottische Shortbread schmeckte – neben dem Schulessen. Ich nahm noch eine Gabel.
»Was hat Valérie denn jetzt schon wieder angestellt?«, fragte ich, nachdem ich hinuntergeschluckt hatte.
»Sie flirtet mit unserer Banane«, antwortete Emma mit düsterer Stimme und deutete auf das andere Ende der Cafeteria.
Da stand sie, die bildhübsche Französin. Sie trug keine Schuluniform, sondern eine Rüschenbluse über einem Faltenröckchen mit Kniestrümpfen und verkörperte darin den perfekten Pariser Chic.
Und sie flirtete auf Teufel komm raus mit unserem sexy Hausmeister. Ich konnte es ihr nicht mal verübeln. Das Codewort Banane stand für »heißer Typ« und unser Hausmeister Mr Scott sah heute wieder sehr gut aus. Obwohl es draußen den ganzen Tag genieselt hatte und für Oktober schon empfindlich kalt war, stand er in einem eng anliegenden T-Shirt da, das die Muskeln seiner Oberarme zur Geltung brachte.
Er war erst Ende zwanzig und neben dem ältlichen Musiklehrer Mr Andrews und dem glatzköpfigen Sportlehrer Mr Abercrombie der einzige Mann an der Schule. Und das Beste für uns alle am St.-Pauls-Mädchen-College war: Er hätte den nächsten James Bond mimen können. Wir waren alle ein bisschen in ihn verliebt, denn er sah nicht nur gut aus, sondern war auch noch richtig nett und alberte mit allen Schülerinnen herum. Dabei wussten wir, dass er verheiratet war und zwei Kinder hatte.
Doch ich verstand Emma.
Mr Scott war unser Hausmeister, unsere Banane. Diese französische – in Gedanken wiederholte ich Camillas Wort für sie – konnte uns doch nicht einfach unseren Schwarm stehlen.
»Übrigens, ehe ich es vergesse, meine Mutter besorgt uns Eintrittskarten für das Mary Kings Close«, sagte Emma. »Ich möchte, dass ihr beiden mitkommt.«
Betroffen stieß ich meine Gabel in den Kartoffelbrei. »Was? Wieso das denn?«
Das Mary Kings Close war eine Touristenattraktion hier in Edinburgh. Leider lange nicht so unterhaltsam wie das Dungeon, und außerdem hatten wir es schon zweimal mit der Schule besichtigt. Das bedeutete, ich hatte es einmal zu viel gesehen.
»Mutter ist der Meinung, Valérie sollte alles erleben, was Edinburgh ausmacht.« Emma rollte mit den Augen. »Ich konnte sie nicht davon abbringen. Aber ihr kommt doch mit, ja? Mit euch ist es für mich erträglicher.«
»Muss das sein?« Ich mochte keine unterirdischen Gänge.
»Allie, bitte! Mum spendiert uns auch noch ein Eis. Falls du lieber Butterkekse möchtest, kauf ich dir die dazu.« Emma sah mich flehend an.
»Und du darfst mit auf den Reiterball!«, lockte Camilla. Sie pickte mit ihrer Gabel nach meiner Roten Bete. Dabei versprühte sie ein wenig Saft auf den Kragen ihrer weißen Bluse. Sie bemerkte es nicht und weder Emma noch ich machten sie darauf aufmerksam. Wir waren zu perplex.
»Welcher Reiterball?«, fragte Emma neugierig.
»Der von unserem Stallteam an Weihnachten«, erklärte Camilla ungeduldig. »Du weißt schon, der Tanzsaal in dem Herrenhaus vom Gestüt wird dann hergerichtet und nicht selten sind Prinzessin Anne und Zara Philips auch zugegen.«
Im Gegensatz zu mir waren Camilla und Emma keine Internats-, sondern Tagesschülerinnen. Wie die meisten Mädchen an der St. Pauls fuhren sie nach Schulschluss nach Hause und konnten somit ein ganz normales Familienleben führen und ihren Hobbys nachgehen. Bei Camilla war es ihr Pferd und das Reiten, Emma tanzte Ballett. Und dank der beiden bekam ich einen Eindruck davon, wie »normale Familien« lebten, denn ich durfte manchmal mit zu ihnen nach Hause. Normale Familie stimmte vielleicht nicht ganz, denn wer die St.-Pauls-Mädchenschule besuchte, kam aus einem wohlhabenden Elternhaus. Emmas Eltern waren angesehene Anwälte, Camillas von schottischem Adel, weshalb sie ihre Freizeit in diesem exklusiven Reitstall verbrachte. Wir alle wussten, dass dieser Reiterball einem von Downton Abbey gleichkäme. Da ich zu den fünfunddreißig Internatsschülern zählte und eine von nur sechs Schülerinnen war, die auch die Wochenenden und die meisten Ferien in der Schule verbrachte, war diese Einladung für mich ein Riesenereignis. Nicht nur für mich, wie sich zeigte.
»Und du nimmst Allie mit?«, hakte Emma ein wenig eingeschnappt nach.
»Doch nicht nur Allie«, winkte Camilla ab und es tropfte noch mehr Rote-Bete-Saft auf den Pulli über der Bluse. »Ich darf dieses Jahr Freunde mitbringen. Und ich nehme euch mit. Wir müssen uns noch Klamotten kaufen und einen Friseurtermin ausmachen.«
Der Reiterball war ein Riesenereignis und noch interessanter, seit Camilla alt genug war, um daran teilzunehmen. Was erst seit letztem Jahr der Fall war. Wochenlang hatte es bei ihr kein anderes Thema gegeben und dieses Jahr durften wir mit! Wahnsinn! Das wäre das absolute Jahreshighlight neben meinem Geburtstag. Doch der Reiterball war definitiv eine Nummer größer.
»Also, Allie? Was sagst du? Dafür wirst du doch zwei Stunden in den Katakomben durchstehen, oder?«
»Wir passen auch gut auf dich auf, ja? Camilla nimmt dich bei der Hand und ich verjage die Geister.«
»Haha«, machte ich trocken.
»Glaubst du ehrlich, dass es da unten spukt?«, fragte Camilla und begann eine Strähne über ihren Finger zu wickeln.
»Damit machen sie zumindest erfolgreich Werbung« war Emmas Antwort.
»Aber glaubst du, da war wirklich ein Mädchen, das wegen der Pest dort eingemauert wurde und jetzt nach Spielzeug verlangt?« Es gab dort einen Raum, in dem ein Berg von Spielsachen lag. Als Hilfe für den Geist des kleinen Mädchens, damit sie den ›Übergang‹ finde.
»Der Gedanke ist echt gruselig«, Emma schüttelte sich.
»Beim letzten Besuch lag da ein Tamagotchi. Ich bezweifle, dass der Geist eines pestkranken Mädchens aus dem achtzehnten Jahrhundert sich so was gewünscht hat«, erklärte ich.
»Wir könnten eine Wette abschließen«, schlug Camilla vor. »Jeder wettet um irgendein Spielzeug, das ein Tourist da wieder abgelegt hat, und wer recht behält, bekommt einen Kinobesuch geschenkt.«
»Einverstanden.« Emma hielt ihre Hand in die Mitte und wir schlugen ein.
»Ein Einhorn. Ich wette, da liegt jetzt ein rosafarbenes, flauschiges Einhorn auf dem Spielzeughaufen«, sagte ich.
Emma kicherte. »Okay. Dann nehme ich ein …«
»Drache!«, fiel ihr Camilla ins Wort.
»Ich wollte Auto sagen«, meinte Emma genervt.
»Ich sage Drache. Ich liebe Drachen.« Camilla stützte das Gesicht in beide Hände und lächelte verzückt.
»Seit wann?«, fragte ich sie. »Das sind Echsen. Die haben schuppige Haut, Warzen, ein Haifischgebiss und vermutlich auch noch Mundgeruch wegen der Fleischstücke zwischen den Zähnen.«
»Heißt das, du bist dabei?«, unterbrach Emma meine Aufzählung.
Ich seufzte. Ich wollte wirklich nicht dahin. Doch was blieb mir anderes übrig, wenn mich meine besten Freundinnen anbettelten?
»Ja, klar«, sagte ich lahm.
»Maria Stuart«, sagte Emma unvermittelt.
»Hä?«, machte Camilla.
»Das neue Codewort für Valérie: Maria Stuart«, erklärte Emma ungeduldig.
»Das ist zu offensichtlich«, winkte ich ab. »Lass uns ein Codewort für Zicke oder doofe Ziege suchen, dann ist es etwas allgemeiner. Und wenn sie in zwei Wochen weg ist, kann es auch noch für Lucy Grumper verwendet werden.« Ich deutete zu unserer erklärten Schulfeindin und meiner Ex-Zimmerpartnerin, die mit ihren Freundinnen an einem Tisch am Fenster saß. Sie beobachteten ebenfalls den Hausmeister und die flirtende Valérie.
»Schnucki«, schlug ich vor.
Beide sahen mich irritiert an. »Schnucki. So heißt die Ziege in Heidi.«
Dieses Mal prustete Camilla wie ein Pferd und schlug sich vor Lachen auf die Schenkel. Auch Emma kicherte ungehalten mit beiden Händen vorm Mund.
»Ach, Allie, wenn wir dich nicht hätten.« Camilla klopfte mir auf den Rücken. Ich hatte gerade eine weitere Gabel Kartoffelbrei zum Mund führen wollen, doch nun verfehlte er sein Ziel und klatschte auf meinen Rock.
»Ich geh dann mal aufs Klo«, sagte ich genervt und stand auf.
Valérie war so sehr mit Flirten beschäftigt, dass sie mich überhaupt nicht bemerkte, als ich an ihr vorbeiging. Oder sie wollte mich nicht sehen. Aber ich sah etwas.
Sie stopfte ihren BH aus! Und sie glaubte wohl, das merke niemand, vor allem nicht unser James Bond, denn sie machte ein Hohlkreuz, damit er auch ja richtig hinsah – umsonst, denn er blickte, genau wie jeder andere, auf die Narbe an ihrer Lippe.
Ich schrubbte den Fleck am Rock weg und erledigte, was man so auf dem Klo erledigte. Doch der Gedanke, dass sich diese aufgeblasene Nuss an Mr Scott ranmachte, nagte an mir.
Ich wusch meine Hände, schüttelte noch einmal meine Locken und ging dann zurück in die Cafeteria. Valérie und Mr Scott hatten sich keinen Zentimeter fortbewegt und sie erzählte irgendwas mit ausladenden Handbewegungen.
Nein, ich hatte mich nicht verguckt. Da sah man ganz deutlich den Zipfel eines weißen Papiertaschentuchs aus Valéries Bluse herausschauen.
Wie perfekt! Das war ja schon fast zu einfach.
»Hi, Mr Scott«, sagte ich fröhlich und wandte mich dann verschwörerisch Valérie zu. Die sah alles andere als begeistert über die Unterbrechung aus.
»Ist sie nicht zauberhaft?«, sagte ich wieder zu Mr Scott und legte einen Arm um Valéries Taille. »Wir sind so froh, dass hier mal frischer Wind reinkommt. Valérie erzählt uns ganz viel von Frankreich und über die Mode und gibt uns so tolle Tipps.«
Ich strahlte Valérie an, die mich aus zusammengekniffenen Augen betrachtete und versuchte sich unauffällig aus meiner Umarmung zu lösen. Sie wusste sehr wohl, dass ihre »Tipps« eher Ohrfeigen glichen. (»Ehrlisch? Flüssiges Kajal benutzt man ’ier noch? Das ’aben wir in den Neunzigern nicht mehr verwendet. Solche Unter’osen trug meine Oma. Die ’atte neunzig Jahre und ist seit drei Jahren mort.«)
Ich beugte mich dicht an ihr Ohr, damit es sonst niemand mitbekam. »Ich wollte ja auch mein Dekolleté etwas mehr betonen, aber das kratzt so furchtbar. Ich bewundere dich, dass du das aushältst. Doch wie sagt man noch gleich? Wer schön sein will, muss leiden. Du leidest wirklich sehr tapfer.«
»Isch verstehe nischt …«, wunderte sich Valérie und sah reflexartig auf ihr Dekolleté. Dann wurde sie so rot wie unsere Schuluniformjacken und verschwand, ohne Mr Scott eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Klo. Ups, obwohl ich leise gesprochen hatte, hatte man wohl doch kapiert, worum es ging.
Mr Scott schmunzelte, während um uns herum die Schüler in schallendes Gelächter ausbrachen.
Ich zwinkerte Mr Scott noch einmal zu und ging zurück zu unserem Tisch.
Das Gelächter begleitete mich. Ha, der hatte ich es gegeben, wenn es auch nicht so öffentlich hätte sein sollen. Doch dem Kichern um mich herum nach zu urteilen fanden alle anderen Schülerinnen, dass sie es verdient hatte. Sogar Lucy Grumper grinste ganz boshaft und zwinkerte ihren fünf Freundinnen verschwörerisch zu. Zufrieden wollte ich mich neben Camilla auf meinen Stuhl setzen, als sie mich zurückhielt.
»Keine Bange, es war nur ein kleines bisschen peinlich für sie. Ihr Busen war im Begriff, sich aufzulösen. Was hast du?«
Camilla hatte mich am Ellbogen gepackt und umgedreht. Ich folgte ihrem Blick und erbleichte.
Kein Wunder, dass alle so laut lachten. Das hatte überhaupt nichts mit Valérie zu tun.
Mein Rock hing in der Strumpfhose und alle hatten einen wunderbaren Einblick auf meine Unterhose erhalten.
Georges Erkenntnisse
Ich war bei der nächstbesten Gelegenheit geflüchtet und hatte mich auf unserem Schulgelände auf eine Bank gesetzt, obwohl der Wind unangenehm kühl war. Ich tat so, als würde ich den Brief lesen, doch eigentlich wollte ich die Schmach verdauen. Mir wurde noch immer ganz elend, wenn ich daran dachte, dass alle Schülerinnen von St. Pauls inklusive Mr Scott … Schnell lenkte ich mich ab, indem ich auf das Papier blickte.
»Hey, Allie!« George tauchte neben mir auf. Gott sei Dank. Darauf hatte ich gehofft, als ich mir diese Ecke des Schulgeländes ausgesucht hatte, um »ungestört« zu sein.
George ging auf das Jungencollege St. Barnabas direkt neben unserer Mädchenschule und nutzte das Loch in der Hecke, um mich immer mal wieder zu besuchen. Was in etwa zwei- bis dreimal die Woche und jedes Wochenende der Fall war. Er war erst elf, fast sechs Jahre jünger als ich, ebenfalls Internatskind und vor vier Jahren dort eingeschult worden. Ich war damals selber erst seit ein paar Wochen an der St. Pauls und hatte mich unter ebenjene Hecke zurückgezogen, um in Ruhe die Abschiebung meiner Eltern ausheulen zu können. Ich war nicht lange allein gewesen, als ein kleiner, rothaariger Junge mit verschmierter Brille und ebenso verheultem Gesicht in der Hecke auftauchte.
Ohne ein Wort zu sagen – es wäre durch unser Schluchzen sowieso nichts Verständliches rausgekommen – teilten wir uns die Packung Papiertaschentücher und den Rest meiner Kekse. Das war der Anfang unserer Freundschaft gewesen. Für mich war George der kleine Bruder, den ich nicht hatte und niemals haben würde. Er erinnerte mich ein wenig Hühnchen Junior aus dem Disneyfilm Himmel und Huhn. Das machte ihn so niedlich.
»Wie geht es dir?«, fragte George und betrachtete eingehend mein Gesicht.
»Mies«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Und dir?«
»Geht so«, lautete Georges übliche Antwort. Er hasste das Internatsleben. Das hatte sich auch nach vier Jahren nicht geändert. »Was ist so mies?«, wollte er wissen und ich erzählte ihm von meinem Missgeschick.
Bei George konnte ich mir sicher sein, dass er nicht auch noch lachte, sondern mitfühlte. Für einen Elfjährigen war er erstaunlich einfühlsam. ›Ein als Kind getarnter Erwachsener‹, sagte Emma dazu und traf damit so ziemlich ins Schwarze.
»Mach dir nichts draus, Allie. Kate Middletons Rock hatte sich auch vor einiger Zeit gelüftet und die ganze Presse konnte sehen, dass sie keine Unterwäsche trug. Du hattest doch eine Unterhose an, oder?«
Mein vernichtender Blick sagte alles. George zuckte die Schultern. »Na, dann ist es nicht mal halb so schlimm. Du wirst wohl kaum in den Nachrichten auftauchen. Und du musst keiner strengen Schwiegeroma Rede und Antwort stehen.«
Ich erstarrte. »Oh. Mein. Gott! Daran hab ich noch gar nicht gedacht.«
»Würde dich deine Oma deshalb zurechtweisen?«, fragte George erschrocken.
»Meine Oma ist dement und wohnt in einem kleinen Dorf am Loch Ness«, winkte ich ab. Doch ich konnte nicht verhindern, dass meine Hand ein wenig zitterte. »Nein, ich meine, dass jemand ein Foto geschossen haben könnte.«
»Sollte das der Fall sein, werde ich meinen Vater bitten es aus dem Netz zu nehmen. Du weißt, er kann das.« Natürlich konnte er das. Er arbeitete für das Königshaus und kannte sich mit solchen Geschichten aus. Eine Welle der Dankbarkeit überschwemmte mich.
»Danke, mir geht’s schon ein bisschen besser.« Ich sah George neugierig an. »Die Duchesse of Cambridge trägt echt keine Unterwäsche bei ihren Auftritten?«
»Soweit ich gehört habe, hat sich das geändert.« Er musste es ja wissen. »Was hast du da?«, fragte er mit Blick auf den noch immer gefalteten Brief in meiner Hand.
»Einen Brief meiner Eltern. Aber ich hab ihn noch nicht gelesen«, gestand ich.
»Warum?«
»Weil es immer das Gleiche ist. Sie erleben diese ach so tollen Abenteuer, sind ständig in Todesgefahr oder tun zumindest so.« Genervt warf ich den Brief neben mich.
George hob ihn auf und setzte sich neben mich. »Bist du neidisch?«, fragte er langsam.
»Nein«, sagte ich. »Ich will ihr Leben auf keinen Fall führen. Das ist doch das Letzte.«
George sagte nichts mehr. Meine Eltern waren Tierforscher und drehten Dokumentarfilme. Er wusste, dass ich sie in den ersten zwölf Jahren meines Lebens begleitet hatte und erst nach dem schlimmen Unfall ins Internat gesteckt worden war. Ich war bei einer Expedition meiner Eltern im Gebirge in eine Schlucht gestürzt und hatte mir mein Bein mehrfach gebrochen. Das war vor viereinhalb Jahren gewesen. Mein Bein war verheilt, die Narben waren geblieben.
George hatte die Narben an meinem Schienbein gesehen. Jeder konnte sie sehen, dank der knielangen Faltenröcke unserer Uniform.
Auch mein linker Zeige- und Mittelfinger waren vernarbt und etwas steif. Mrs Bell hatte mich für Highland-Dance und Kricket eingeteilt, weil ich mit diesen Fingern nie ein Instrument würde spielen können. Mein ganz persönliches und ewig währendes Andenken an das aufregende Leben mit meinen Eltern.
»Warum willst du dann nicht ihren Brief lesen, Allie?«, fragte er und hielt ihn mir hin.
Ich stieß ihn weg. »Lass es einfach, ja? Ich wollte eigentlich nur meine Wunden lecken. Das hat sich ja dank dir jetzt erledigt. Erzähl mir lieber von eurem neuen Geschichtsprojekt.«
Dieses Ablenkungsmanöver gelang immer.
»Wir sollen uns mit der Entstehung der unterirdischen Tunnel von Edinburgh befassen. Die Schotten hatten seit jeher – sparsam, wie sie waren – jeden Zentimeter Boden genutzt und sogar die Höhlungen aus den Strebebögen unter den Brücken zu Wohn- und Lagerräumen ausgebaut. Und du hast bestimmt schon mal gehört, dass die alle miteinander verbunden sind und von Schmugglern und Mördern genutzt wurden. Na, egal. Sämtliche Tunnel sind angeblich alle erst im achtzehnten oder neunzehnten Jahrhundert gebaut worden, als Edinburgh die dichtbevölkertste Stadt in Europa war. Aber das stimmt nicht! Stell dir vor, Allie, ein paar davon entstanden sogar schon vor der Römerzeit. Wir waren im Archiv der Universität und durften dort recherchieren. Mr Manson ist ja so was von cool! Kein anderer Lehrer wäre mit Jungen in unserem Alter auf die Idee gekommen, die Unibibliothek zu besuchen, um ein Projekt zu bearbeiten.«
Ich würde meine linke Hand darauf verwetten, dass er auch der Einzige aus seiner Klasse war, der einen Besuch in der Unibibliothek cool fand.
Georges leuchtende Augen zeigten deutlich, wie sehr er seinen Geschichtslehrer mochte. Er plapperte weiter. »Wie es aussieht, sind die ersten Tunnel aus der Bronzezeit oder noch älter. Ich konnte sie noch nicht genau lokalisieren, aber sobald ich weiß, wo einer dieser vermuteten Stollen ist, hält mich nichts mehr von einer Besichtigung ab. Magst du dann mitkommen?«
»Nein danke«, wehrte ich schnell ab. »Ich habe Emma versprochen sie und ihre Austauschschülerin ins Mary Kings Close zu begleiten. Valérie soll jeden Winkel in Edinburgh kennenlernen und deswegen müssen wir in die Katakomben, obwohl für Mittwoch Sonne gemeldet wurde. Das reicht mir erst mal. Du weißt, wie ich zu unterirdischen Räumen stehe.«
»O Allie, soll ich für dich gehen? Ich liebe das Mary Kings Close! Dort steckt alles voller Geschichten und Dramen.« Georges Augen leuchteten noch mehr. »Und außerdem ist diese Valérie echt hübsch.«
Ich musterte ihn von oben herab. Seine Brille war zwar sauber, aber seine roten Locken, den meinen nicht unähnlich, waren mal wieder zu lang. Außerdem wirkten die tiefen Grübchen in seinen Wangen noch immer wie Babyspeck. Er war definitiv zu jung, um Mädchen attraktiv zu finden.
»Hat sie schon mal mit dir geredet?«, fragte ich.
Er seufzte. »Nein.«
»Wird sie auch nicht, es sei denn, du zeigst ihr einen Kontoauszug deiner Eltern«, erklärte ich ihm.
»Das dürfte schwierig werden, denn vor Weihnachten komme ich nicht nach Hause.«
»George, das war ein Witz«, klärte ich ihn auf.
»Ich verstehe schon. Valérie beachtet nur Typen wie Chace Crawford.« George schien tatsächlich ein wenig deprimiert.
»Vielleicht macht sie aber eine Ausnahme für reiche Adlige, die aussehen wie Ed Sheerans jüngerer Bruder«, sagte ich und wollte ihm aufmunternd auf die Schulter klopfen. Dabei streifte ich irgendetwas Spitzes und zog schmerzhaft meine Hand zurück.
»Was ist? Was hast du?« George zog einen klitzekleinen Ansteckpin von seinem Blazer. »Tut mir leid. Das ist der Pin unseres Schachklubs. Welcher Idiot hat dafür die Farbe unserer Uniform ausgesucht?« Er ließ den winzigen Anstecker in seiner Tasche verschwinden.
Ich hatte mir einen Riss an meinen beiden verkrümmten Fingern zugezogen. Es begann sofort stark zu bluten.
»Mist. Hast du ein Taschentuch?«
Es war natürlich klar, dass er mir kein Papier-, sondern ein Stofftuch mit gesticktem Monogramm reichte. »Nobler ging es wohl nicht, oder?«
»Nein, die mit der Goldstickerei sind meinem Vater vorbehalten«, antwortete er trocken. Ich kicherte und presste das Taschentuch auf die Wunde, doch es dauerte eine Weile, bis die Blutung einigermaßen gestillt war. George nahm daraufhin meine Hand in seine und betrachtete die Finger genauer.
»Ich kann mir dieses seltsame Muttermal noch so oft ansehen, ich finde immer, es sieht aus wie eine Tätowierung.«
Das Muttermal hatte eine ungewöhnliche Form. Genau genommen waren es drei Punkte, die wie ein umgedrehtes Dreieck angeordnet waren.
»Meine Eltern haben mich nach dem Unfall komplett untersuchen lassen, weil ich neue Pigmentflecken bekommen hatte. Der Hautarzt meinte, Farbveränderungen treten bei verändertem Gewebe häufig auf. Aber es sei unauffällig«, erklärte ich ihm, doch ich wusste, was er meinte.
George hob die Hand ganz nah an seine kurzsichtigen Augen.
»Die Punkte sind so exakt. Meine Leberflecken sind immer asymmetrisch. Ich hab da einen auf dem Rücken, der …« George wollte doch tatsächlich sein Hemd aus der Hose ziehen. Das war aber jetzt genug.
»Okay, okay, ich glaub dir ja. Hey, hab ich dir schon erzählt, dass wir an meinem Geburtstag übers Wochenende bei Camilla zu Hause sind? Sie wohnt in diesem uralten Castle. Rate, was ich mir wünsche!«
Umständlich stopfte George sein Hemd zurück in die Hose. Es war zerknittert, aber lieber so als offen.
George starrte mich mit hochgezogenen Brauen an. Die blauen Augen hinter den dicken Brillengläsern wirkten vergrößert wie durch eine Lupe.
»Wenn es wieder mit diesem Schauspieler aus Beastly zu tun hat, will ich es gar nicht wissen«, sagte er. Ablenkung geglückt, dachte ich und sagte fröhlich:
»Okay, lassen wir das. Dann lesen wir jetzt den Brief meiner Eltern und jedes Mal, wenn die Worte spannend und abenteuerlich auftauchen, spendiere ich ein Pfund. Von dem Erlös gehen wir dann bei unserer nächsten gemeinsamen Ausgangserlaubnis einen Pfannkuchen essen.«
George kicherte. »Ich finde, deine Eltern sind an Begeisterung für ihren Beruf kaum zu übertreffen.«
»Und wenn man weiß, dass sie den lieben langen Tag nur Tiere beobachten, ist es nicht mal halb so spannend.«
»Findest du«, murmelte George. »Die Zuschauer sehen das wohl anders.«
Ich zuckte die Schultern. »Mag sein. Wird auf alle Fälle gut bezahlt, wenn ich an die Kosten für das Internat denke«, fügte ich hinzu. Seit meine Eltern einen Fernsehsender für ihre Dokumentationen gewinnen konnten, hatten sie mehr als genug Geld, um mich in diese teure Schule abzuschieben.
Und als sie letztes Jahr auch noch von der Queen einen Orden für ihr Engagement erhalten hatten, war das ebenfalls im Fernsehen übertragen worden. Meine Mitschülerin Lucy Grumper hatte es mir richtig übel genommen. Lucy und ich hatten uns vom ersten Tag an nicht ausstehen können. Ich war mir nicht sicher, ob es daran lag, dass meine Eltern berühmte Dokumentarfilmer waren oder sie einfach meine roten Haare nicht mochte. Lucy hatte seit jeher Wind gegen mich gemacht und hänselte mich, wann immer sie Gelegenheit dazu bekam. Dank Emma und Camilla, die Lucy auch nicht ausstehen konnten, waren sämtliche fiese Kommentare an mir abgeprallt. Tatsächlich fand ich es nervig, aber auch ein klein wenig amüsant.
»Die ist neidisch, weil ihre Eltern Immobilienmakler sind und sie mit ihnen höchstens die Stadtviertel von Edinburgh erkundet hat, während du schon um die ganze Welt gekommen bist«, hatten mir Emma und Camilla erklärt. Das mochte sein, aber ich fragte mich jedes Mal, was so toll daran sein sollte. Es war nicht besonders lustig, als Kind ständig im Flugzeug zu sitzen oder in Bussen in die abgelegensten Gegenden der Welt geschleift zu werden. Es war nicht schön, in gammeligen Betten oder eisigen Zelten zu schlafen, egal ob der Schlafsack angeblich minus zwanzig Grad aushalten sollte (das war glattweg gelogen) – mir war immer kalt gewesen. Und ich hatte es gehasst, stundenlang still sein zu müssen, weil irgendein seltenes Tier, das beobachtet wurde, nicht aus seinem Bau kam oder die Kamera nicht richtig eingestellt war oder Akku/Scheinwerfer/Linse nicht funktionierte. Aber ich war bei meinen Eltern gewesen.
George seufzte mitfühlend. »Ich verstehe dich schon. Ich hätte auch nicht stundenlang stillsitzen wollen, um auf ein komisches Tier zu warten. Einmal ja, aber dauernd?«
Ich warf ihm einen schiefen Blick zu. »Das könnte man von unterirdischen Gängen genauso behaupten.«
Er knuffte mich. »Lies vor. Ich will wissen, ob es ein Pfannkuchen mit Früchten und Nutella wird.«
Es sprangen zwölf Pfund heraus. Dafür würden wir uns noch eine Cola zum Pfannkuchen gönnen.
Die Stadt unter der Stadt
»Hallo, mein Name ist Francis Poole, ich bin Dichter aus Berufung und werde euch edlen Besuchern, die ihr Goldstücke oben am Eingang gelassen habt, nun einen Einblick in meine Welt geben: in eine Zeit, in der wir Poeten uns noch in den Kaffeestuben und Pubs gegenseitig unsere Werke vorlasen und versuchten dort neue Gönner für die einzigartige Schönheit der Worte und schottischen Sprache zu finden. Ladys und Gentlemen, bitte folgt mir nun in das Innere der Erde, in eine Zeit voller Abenteuer und Herzensangelegenheiten. Eine Ära, in der ein Blick einer Dame uns Dichter in literarische Höhen katapultierte, ein Taschentuch der Liebsten unsere Sehnsucht erwachen oder die Missachtung ebenjener den Freitod suchen ließ.
Wer weiß, vielleicht darf ich, Francis Poole, heute sogar bei der ein oder anderen holden Maid unter Euch auf eine Eingebung hoffen?«
Fast alle kicherten. Fast, weil Emma, Camilla und ich uns am liebsten übergeben hätten. Der adrette junge Mann in dem Kostüm aus dem achtzehnten Jahrhundert mit Dreispitz auf dem Kopf sah nämlich bei den letzten Worten Valérie tief in die Augen. Sein Spitzbärtchen zitterte ein wenig, als er sie anlächelte. Valérie lächelte zurück, sichtlich angetan von dem ersten männlichen Objekt, das nicht Ü30 und noch einigermaßen attraktiv war.
»O Mann. Das wird eine Seifenoper«, murmelte Camilla und nutzte unser Codewort für langweilig.
Ich gab ihr recht. Das würde ein sehr langer Besuch hier untertags werden. Ausgerechnet heute war es nach Wochen noch einmal sonnig und warm, ein goldener Oktobertag. Wir drei wären heute viel lieber an den Portobello Beach gefahren. Aber nein, wir mussten ins Mary Kings Close gehen.
Close nannte man hier in Edinburgh die überbauten Gassen, die zu der ehemaligen Hauptstraße, besser bekannt unter dem Namen High Street oder Royal Mile, hinführten. Jede Close besaß einen Namen, meistens nach den damals dort ansässigen Gilden. So gab es die Fleshmarket, Advocate’s und Writers Close. Oder sie wurden nach ehemals einflussreichen Edinburgher Persönlichkeiten benannt wie zum Beispiel der Dame Mary King.
Das Mary Kings Close war nicht einfach nur eine Gasse, es war Edinburghs berühmte ›Stadt unter der Stadt‹.
Zwei Stockwerke unter der Erdoberfläche befanden sich verwinkelte Gassen und unzählige Räume. Man hatte diesen Bereich wegen der Pest und anderer fieser ansteckender Krankheiten einfach zugemauert, um die Bewohner zu schützen. Um den Schandfleck zu vertuschen, wurde das Rathaus darübergebaut. Ein ganzes Stadtviertel aus dem siebzehnten Jahrhundert war somit in Verruf geraten und nicht mehr betreten worden.
Erst vor ein paar Jahren hatte man einige dieser Gassen und mehrere Räume für Besucher zugänglich gemacht. Dank der schauspielerischen Guides, die täglich unzählige Touristengruppen dort hindurchführten, bekam man einen Eindruck vom (armseligen) Leben einer längst vergangenen Zeit. Sofern man sich für so was interessierte – und keine Angst in düsteren, unterirdischen Gewölben hatte. Oder George Spencer hieß.
Für die meisten Menschen mochte es sehr spannend sein, einen über Jahrhunderte zugemauerten Stadtteil zu besichtigen.
Die sieben Touristen, die zu unserer Gruppe gehörten, sahen zumindest ganz angetan aus. Valérie ebenfalls. Sie stand in der ersten Reihe und schien richtig versessen auf das, was Francis Poole erzählte.
»Wollen wir raten, woher die anderen kommen, und darauf wetten?«, flüsterte Camilla uns zu. »Das ältere Pärchen da ist hundertprozentig aus Amerika. Ich nehme nachher einen Erdbeerbecher mit Früchten.«
»Pfff, kommt nicht infrage. Es gibt keine Erdbeeren zu dieser Jahreszeit. Und außerdem ist das viel zu einfach«, schnaubte Emma und ich gab ihr recht. Diese Touristen trugen Shorts, Socken in Sandalen und, was sie letztendlich verriet, eine Baseballcap mit dem Logo der Red Sox. Bei dem jüngeren Pärchen war es lange nicht so eindeutig.
»Na gut. Dann sag uns, woher die drei kommen.« Camilla deutete auf drei junge Frauen, die auffällig ungeschminkt den Bio-Trend auch in ihren Klamotten verkörperten. Das war schwierig zu erraten, solange niemand von ihnen sprach, aber immerhin besser als diese Seifenoper zu verfolgen, die sich vor unseren Augen abspielte. Francis hielt die Führung quasi für Valérie allein und die genoss seine Aufmerksamkeit sichtlich. Es war interessanter, sich auf die anderen Touristen zu konzentrieren. Auch nach vier Räumen hatten wir noch nicht die Herkunft der Frauen in Erfahrung gebracht.
»Die reden ja gar nicht«, murrte Camilla. »So krieg ich nie meinen Erdbeerbecher.«
»Konzentrieren wir uns auf die Wette mit den Spielsachen für das Geistermädchen«, erinnerte ich sie. Mir war mulmig zumute. Es war glücklicherweise nicht wirklich dunkel, sondern nur schummrig dank all der Lampen, aber die engen Wände und das Wissen, zwei Stockwerke tief unter der Erde zu sein, hatten eine sehr bedrückende Wirkung auf mich.
Meine Hand begann zu jucken, genau genommen die Stelle, wo ich mich vor ein paar Tagen an Georges Pin aufgeritzt hatte. Ich kratzte ganz vorsichtig daran.
»Als Poet ist man nicht nur auf das Geld seiner Gönner angewiesen. Hier kann man deutlich erkennen, wer wie viel für welche Wohnung zu zahlen hatte.« Francis deutete auf die Wand hinter ihm, wo in schnörkeliger Schrift die Mietzinsen mit Namen der Pächter an die Wand gekritzelt waren. »Nein, man ist auch immer auf der Suche nach Inspiration. Und welche Inspiration könnte größer sein als die Liebe? Die ewige Liebe, die uns alle erleuchtet, dem Leben einen Sinn gibt und uns nachts wach hält, weil wir die strahlend … äh, braunen Augen unserer Liebsten vor uns sehen wie funkelnde Sterne.«
Emma schubste mich an.
»Ist dir auch schlecht?«, fragte ich stöhnend.
»Ich hör dem gar nicht mehr zu. Hier, sieh mal!« Sie hatte eine Nachricht auf ihrem Handy erhalten. In diesen Gassen war ein striktes Fotografier-Verbot, was die Nutzung von Handys einschloss. Doch Francis war von Valérie so abgelenkt, dass Camilla und ich die eingegangene WhatsApp lesen konnten.
»Du hast hier unten Empfang? Zwei Stockwerke unter der Erde?«, fragte Camilla und zückte auch ihr Handy unauffällig, um den Empfang zu checken.
»Eine Nachricht von Callum?«, fragte ich baff und vergaß für einen Moment meine Umgebung.
»Wer war dieser Callum noch mal?«, fragte Camilla geistesabwesend. »Ich hab keinen Empfang. Welches Netz hast du?«
»Der hübsche Blonde von St. Barnabas«, erklärte ich ihr. »Du weißt schon, er hat seit diesem Jahr immer Fußballtraining, wenn wir Kricket spielen.« Er sah ein bisschen aus wie ein junger Prinz William – als der noch volles Haar gehabt hatte – und sein Interesse an Emma war offensichtlich. Immerhin hatte er schon zwei Bälle an den Kopf bekommen, nur weil er ihr beim Kricketspielen zusah, statt selbst zu trainieren.
»Woher hat er deine Telefonnummer?«, fragte Camilla.
Eine berechtigte Frage.
»Gardyloo!«, rief Francis lauthals und fing für einen Moment wieder unsere Aufmerksamkeit ein. Er tat, als schleudere er den Inhalt eines Eimers auf die Straße. Des angeblichen Fäkalieneimers wohlgemerkt.
»Hold your hand«, schallte es aus den Gassen zurück.
»Igitt«, machte Valérie. Damit hatte sich Francis wohl ein paar Punkte verspielt.
»Hätten wir ihm sagen sollen, dass Schnucki nichts von Kloeimern und schottischer Hygiene wissen will?«, raunte ich Emma zu. Die kicherte.
»Vor allem weil sie sich heute Morgen wieder großzügig mit Parfum besprüht hat. Ich schwöre, unser Gästezimmer riecht wie ein französisches Bordell.«
»Interessant«, murmelte ich.
»Findest du?«
»Dass du anscheinend weißt, wie ein französisches Bordell riecht? Ja, das ist interessant«, gab ich zurück.
Valérie hatte wohl etwas mitbekommen und warf uns einen herablassenden Blick zu.
»Tu saigne à la main«, sagte sie. »Isch wär vorsischtisch. Nischt, dass du dir einfängst eine Giftung des Bluts.«
»Blutvergiftung«, korrigierte Emma.
»Sag isch doch: Vergiftung des Bluts.« Schnell brachte sie ein paar Schritte Abstand zwischen uns.
Ich blutete? Verflixt, ich hatte die Wunde aufgekratzt. Emma reichte mir ein Taschentuch.
Wir verließen den Raum und folgten Francis, Valérie und den sieben anderen Touristen in die nächste Kammer. Ein Raum mehr dem Tageslicht entgegen.
»Unsere Wette!«, murmelte Camilla in singendem Tonfall und deutete auf den Berg Kuscheltiere. Die Geschichte des Geistermädchens wurde erzählt und natürlich erfolgte das mitleidseufzende »Hach« von sämtlichen Touristen. Ich überlegte, dass wir die Herkunft der drei Frauen dadurch noch immer nicht erfuhren, als Camilla laut »BINGO!« rief und den schaurigen Moment für alle damit zunichtemachte.
»Da liegt ein Drache! Ich bekomme den nächsten Kinoeintritt spendiert. Ätschbätsch.«
Emma und ich lachten laut. Francis räusperte sich ungehalten und scheuchte uns alle hinaus in den nächsten Raum.
Hier war der ehemalige Stall inklusive Schlachtplatz. Doch als wir ihn betraten, begann meine Hand noch mehr zu jucken. Ich musste mich ablenken, um die Wunde nicht noch weiter aufzukratzen.
»Das ist gruselig«, sagte ich.
»Angeblich ist diese Close das größte Spukhaus von ganz Schottland. Denk an das arme Pestmädchen. Natürlich ist es gruselig«, sagte Camilla.
»Das meine ich nicht«, sagte ich. »Ich finde es gruselig, dass dieser Callum an die Handynummer von Emma gekommen ist.«
»Ach so, ja, ein bisschen unheimlich ist das schon«, gestand sie.
Emma sah Camilla empört an. »Na toll. Jetzt freue ich mich gar nicht mehr über die Nachricht, sondern habe Schiss, sie zu öffnen.«
»Kommt darauf an, was er dir schickt.« Camilla blieb völlig ungerührt.
»Woher hast du denn seine Telefonnummer, wenn du ihn unter Callum eingespeichert hast?«, fragte ich.
Emma wurde rot. »George«, gestand sie mit glühenden Wangen.
»Du hast George nach seiner Nummer gefragt?«, hakte ich nach und trat einen Schritt zur Seite, um eine der Frauen durchzulassen.
»Er fragt, ob ich Lust hätte, mit ihm ein Eis essen zu gehen«, las Emma vor und unterbrach meine Gedanken.
»Ich habe auch Lust auf ein Eis«, verkündete ich.
»Ich will kein Eis mehr. Hier unten ist es bitterkalt«, sagte Camilla stirnrunzelnd. »Ach, ich hab vergessen, mit wem ich hier bin, Miss St.-Pauls-Dessert-Rekord-Meisterin.«
Ich grinste matt. »Hey, das Essen an unserer Schule ist gut. Und das Dessert ist am besten«, verteidigte ich mich.
Doch eigentlich hatte ich das nur gesagt, weil ich endlich aus diesen Gängen rauswollte. Lampen hin oder her, es war mir auch zu eng. Der Mann des jungen Pärchens rempelte mich an. Ich stolperte gegen eine Wand.
»Entschuldigung«, sagte er auf Deutsch. Eine Nationalität war damit geklärt.
»Nachher gibt’s für jeden ein Eis. Mum hat mir dafür extra Geld mitgegeben«, versprach Emma.
Mein Blick fiel auf die Wand. Huch! Da war Blut. Ich hatte blöderweise die weiß gekalkte Wand beschmiert. Ich rieb vorsichtig mit dem Finger darüber – und verteilte noch mehr Blut an der Stelle.
Ach herrje. Und das ausgerechnet unter ein paar komischen Schriftzeichen. Behutsam versuchte ich es mit dem Taschentuch abzuwischen. Doch das war mittlerweile auch durchgeblutet und erzeugte noch mehr Streifen. Ein letzter Versuch: Ich spuckte auf eine saubere Stelle des Tuches und schrubbte etwas fester. Endlich verblasste das Rot ein wenig. Ich wischte weiter, bis nur noch ein Hauch Rosa zu sehen war. Erst dann fiel mir auf, dass die Wand sauber war – die Schriftzeichen waren verschwunden.
Schäbige Malerarbeit, dachte ich, knüllte das Taschentuch zusammen und wollte mich von der Stelle entfernen.
»Was tun Sie da!«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Francis’ Stimme hatte ihr Säuseln verloren.
»Stecken Sie das sofort weg oder ich muss Sie bitten die Close zu verlassen.«
Eilig stopfte ich das Taschentuch in die Jackentasche und erst dann bemerkte ich, dass er nicht mich ansah. Auch nicht Emma, die mit bleichem Gesicht ihr Handy auf dem Rücken versteckt hielt.
Nein, Francis sprach mit dem Amerikaner. Der hielt eine winzige Digitalkamera in der Hand, die bislang keinem aufgefallen war. Jetzt ließ er sie grummelnd in seiner Hosentasche verschwinden.
Den Rest der Führung war Francis nicht mehr so schmeichelnd und blumig in seinen Erklärungen. Die letzten Räumlichkeiten schilderte er mit seiner normalen Stimme und in einfachen, kurzen Sätzen. Nur von Valérie verabschiedete er sich herzlich und mit einem Handkuss.
Meine Schmiererei hatte er zum Glück nicht bemerkt.
Die unvollkommene Entführung
»Kann es sein, dass dieser Francis dir seine Telefonnummer zugesteckt hat?«, fragte Emma und leckte an ihrem Himbeer- und Stracciatella-Eis.
»Er ’eißt wirklisch Daniel.« Bei Valérie klang das nach »Däniäll«. »Willst du?« Sie hielt Emma ein Zettelchen hin.
Emma stutzte. »Der Typ war auf dich scharf. Uns hat er überhaupt nicht beachtet.« Dann zwinkerte sie uns zu. »Zum Glück, sonst hätte ich Callum nicht antworten können.«
Wir saßen auf einer Bank oberhalb der Princes Street Gardens. Die unterirdischen Gassen speicherten Kälte wie ein Kühlschrank, doch nun genossen wir die warme Nachmittagssonne und das von Emmas Mum spendierte Eis.
»Dann eben niescht.« Valérie zerknüllte den Zettel und warf ihn in den Mülleimer neben der Bank.
»Valérie!«, rief Camilla empört. »Du hast den Typen doch angebaggert. Ich dachte, du stehst auf ihn.«
»Phfff«, machte Valérie und warf ihr Eis dem Zettel hinterher. Emma kniff die Augen zusammen und fixierte sie wütend.
»Ich will, wenn über’aupt, da so eine Mann.« Sie deutete auf den Weg, der direkt unterhalb vom Castle an unserer Bank vorbeiführte. Etliche Besucher waren unterwegs, doch wir wussten augenblicklich, wen sie unter all diesen Menschen meinte. Er hätte sogar herausgestochen, wenn noch einmal so viele Leute dort gewesen wären. So jemanden wie ihn sah man nicht oft. Höchstens auf der Leinwand im Kino.
Groß, durchtrainiert und die hellblonden Haare funkelten im Sonnenlicht wie eine Goldkrone. Unser Hausmeister konnte einpacken. Liam Hemsworth konnte einpacken. Alex Pettyfer … na, ein Alex Pettyfer konnte in meinen Augen nie einpacken, aber der hier konnte ihm allemal das Wasser reichen. Obwohl er jünger war, neunzehn oder zwanzig vielleicht?
Und dieser Typ, der aussah wie ein Model für Aftershave, kam auf uns zu.
Auf uns!
Wir starrten ihm alle mit offenem Mund entgegen. Und er blieb tatsächlich direkt vor uns stehen!
Vor uns!
Sogar Valérie war überwältigt.
»Wer von euch hat die Pforte geöffnet?«, fragte er, sobald er uns erreicht hatte. Seine Stimme war tief, tief und durchdringend. Ich hörte ihn zwar, aber ich konnte nicht reden. Ich war zu perplex.
»Wer hat die Pforte geöffnet?«, wiederholte er seine Frage, als niemand von uns sofort antwortete. »Die Pforte!«, sagte er ungeduldig und betonte dabei jede Silbe Unheil verkündend.
Wovon sprach er nur? Emma war die Erste, die wieder zu Sinnen kam. »Ich glaube, du verwechselst …«, begann sie, als Valérie ihr ins Wort fiel.
»Isch war es!«
Sofort richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf Valérie. Mir stellten sich alle Härchen an den Armen auf und in meinem Nacken kribbelte es kalt. Mit diesem Typen war nicht zu spaßen. Francis-Däniäll-Poole wirkte im Gegensatz zu ihm wie ein Hanswurst. Dieser hier war jemand, mit dem man nicht spielen sollte.
Valérie schien nichts davon zu spüren. Sie lächelte ihn betörend an. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie seine Telefonnummer nicht wegwerfen würde.
Kurzerhand umfasste er Valéries Arm und zerrte sie mit sich, den Weg zurück, den er gekommen war.
»Hey, Moment mal!«, rief Camilla und warf ihr Eis jetzt auch in den Mülleimer. Wir alle wollten hinterher, doch der Typ hatte eine Geschwindigkeit drauf, die schier … unnormal schien. In einem Moment sahen wir ihn noch auf das Castle zulaufen und im nächsten war er – schwups – in einer Close verschwunden. Er und Valérie – einfach weg, vom Erdboden verschollen. Alles in allem konnte das nicht mehr als ein paar Sekunden gedauert haben.
Eine Verfolgung war sinnlos. Camilla, die als Einzige reagiert und noch den Versuch unternommen hatte, hinterherzulaufen, kam zu uns zurück.
»Hab ich das gerade geträumt oder hat Chris Hemsworth Schnucki entführt?«, fragte Camilla völlig fassungslos.
»Du hast geträumt«, sagte ich. »Das war nicht Chris Hemsworth. Das war …«
»… mal eine Banane«, hauchte Emma. Camilla und ich drehten uns verblüfft zu ihr um.
»Emma?«
»Wenn es jemand verdient hat, so genannt zu werden, dann ja wohl dieser … dieser … So stelle ich mir einen Engel vor«, stotterte sie. »Ach verdammt, ich sollte nicht sabbern, ich sollte die Polizei rufen. Meine Austauschschülerin ist soeben entführt worden.«
Sie wühlte in ihrer Jackentasche nach dem Handy. Camilla und ich taten es ihr gleich. Engel passte ziemlich gut zu dieser blonden Erscheinung, dachte ich. Das Ganze hatte etwas Übersinnliches gehabt.
»Obwohl …« Camilla hörte auf zu tippen und sah uns an. »Wollen wir sie wirklich zurückhaben?«
»Camilla!«, rief Emma empört.
»Ja, ja, schon gut«, wehrte sie ab.
So langsam sickerte das Ereignis durch und erreichte mein Gehirn. Valérie war entführt worden. Meine Hände begannen zu zittern. Was, wenn dieser unheimliche Kerl ihr etwas antat? Mein Mobiltelefon rutschte mir aus den schwitzigen Händen und knallte auf den Boden.
»Herrje!«, rief ich aufgebracht, als ich sah, dass das Display zersplittert war.
»O Gott!«, rief auch Camilla.
»Und bei meinem ist der Akku leer!«, fluchte Emma aufgebracht. »Weil ich zu viel mit Callum …«
»Das meine ich nicht«, unterbrach Camilla sie. »Er kommt zurück!«
»WAS?!«
Wir starrten erneut in Richtung Castle, wo sie eben verschwunden waren, und tatsächlich: Da war er wieder. Mit Valérie im Schlepptau.
»Dieses Mal hat sie ihren Rekord gebrochen«, hörte ich Camilla sagen. »So schnell wollte sie noch keiner quitt werden.«
Mir war nicht zum Lachen zumute. Mir saß ein Kloß im Hals. Zum Glück sah Valérie gesund, wenn auch wütend und erschrocken aus. Der Blonde war noch gut einen halben Kilometer entfernt, und doch schien es, als brauche er nur zehn Schritte, um wieder bei uns zu sein. Ich ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Er durfte Valérie unter keinen Umständen in ein Auto zerren. Dann würde ich schreien und nach Möglichkeit den ganzen Park bis hinunter zum Waverley-Bahnhof aufmerksam machen.
Nein, er machte keinerlei Anstalten, Valérie in irgendein Auto zu zerren. Er brachte sie uns tatsächlich zurück.
Fünf Schritte. Drei. Und schon war er da. Wie machte er das nur?
»Uff!«, machte Valérie, als er sie recht unsanft auf die Bank schob.
»Sag mal, geht’s noch!«, schnaubte Emma. Mutig stellte sie sich ihm in den Weg.
»Wie kannst du es wagen, unsere Freundin einfach zu entführen? Was sollte das? War das ein schlechter Scherz?« Camilla stellte sich neben sie. Wenn sie sich zu ihrer vollen Größe aufrichtete, machte sie nicht wenig Eindruck. Zumindest mehr als die elfenhafte Emma.
Ich setzte mich zu Valérie, die bleich wie ein Käse war, und legte ihr tröstend einen Arm um die Schultern. Dass Valérie ihn nicht abschüttelte, zeigte deutlich, wie mitgenommen sie war.
»Das ist kein Scherz«, sagte er und musterte Camilla und Emma eindringlich. »Jemand von euch vieren hat die Pforte geöffnet. Darüber macht man keine Scherze.«
Schon wieder diese Pforte.
»Nein, das gerade war alles andere als lustig«, mischte ich mich ein. »Wir hatten heute Nachmittag eine Führung im Mary Kings Close und dort darf man nichts anfassen. Such dir einen anderen Türöffner.«
Jetzt fiel sein Blick auf mich und dann auf meine Hand auf Valéries Schultern. Meine verletzte Hand, wie mir zu spät einfiel, und ich hoffte, dass es nicht mehr blutete und ich sie bekleckert hatte.
Seine Augen verengten sich und sofort fühlte ich mich unwohl.
Oh, oh.
Diesen Blick kannte ich. Den hatte ich schon einmal gesehen. Nämlich als Mrs Bell mich dabei erwischte, wie ich heimlich eine Zigarette hinterm Internatsgebäude hatte probieren wollen. Sie hatte mich so taxiert, als könne sie den Qualm in meiner Lunge ausmachen. Dabei hatte ich noch keinen Zug genommen.
Der Typ vor uns sah mich jetzt genauso durchdringend an. Und nachdem er die Narben auf meinen Beinen registriert hatte, schien er sich sicher.
»Du«, sagte er leise, aber bestimmt. »Du bist es.«
Ehe ich mich’s versah, hatte er mich von Valérie gerissen, über seine Schulter geworfen und spurtete im Tempo eines Tour-de-France-Radfahrers dahin zurück, von wo er gerade hergekommen war.
»He! Lass mich runter!«, rief ich nach der ersten Überraschung. Ich trommelte auf seinen Rücken, strampelte mit den Beinen und versuchte mich mit aller Kraft loszuwinden.
Ich hatte keine Chance. Seine Schulter drückte sich unangenehm in meinen Magen, seine Hand umfasste meine Beine und hielt mich wie ein Brett in einem Schraubstock.
Er musste über herkulische Kräfte verfügen und einen Körper aus Stahl besitzen. Meine Faustschläge prallten an ihm ab. Er zuckte nicht einmal.
»HILFE!«, schrie ich und sofort wurde ich so herumgeschleudert, ohne dass er mich absetzen musste, und mein Mund wurde schmerzhaft zugehalten.
Ja, verdammt noch mal, wir befanden uns in Edinburgh! Nahezu eine halbe Million Einwohner und noch mal so viele Touristen waren hier unterwegs. Irgendjemand musste doch in der Nähe sein und das hier mitbekommen!
Ich wehrte mich, so gut es ging, doch seine Hand drückte mir die Luft ab. Mir wurde immer schummriger. Seine Hand lag fest über Nase und Mund.
Jetzt konnte ich nur noch auf Emma und Camilla hoffen – und dass sie sich bei meiner Rettung mehr anstrengen würden, als wir es bei Schnucki getan hatten. Bitte etwas schneller, ehe ich ersticke war das Letzte, das ich dachte, ehe es schwarz wurde.
Blackout
»Allison? Allie! Herrgott, sie ist hoffentlich nicht tot?«
Das war die Stimme von Emma. Und sie klang weinerlich.
»Wir müssen einen Arzt rufen!« Camilla schien sich ebenfalls zu sorgen.
»Laissez-misch.« Das klang nach der Ziege. Schnucki. Nein, sie hieß anders. Aber mir wollte ihr richtiger Name nicht einfallen. Wie verwirrend. Ich versuchte die Augen zu öffnen und konnte es nicht. Stattdessen sah ich unebenes Pflaster, die typische Wasserrinne, ein zugemauertes Fenster und die zunehmende Finsternis. Das war eine Close. Das Mary Kings Close? Aber … hatten wir das nicht bereits verlassen?
Klatsch, klatsch, klatsch. Entsetzt öffnete ich die Augen und setzte mich ruckartig auf.
»Sie ist nischt mort – tot«, stellte Valérie zufrieden fest.
»O Gott, Allie, du hast uns vielleicht einen Schrecken eingejagt.«
Camilla umarmte mich so stürmisch, dass ich den Halt verlor und wir beide unsanft hinterrücks auf den Boden plumpsten.
»Wenn sie nicht tot ist, bringst du sie um«, stellte Emma fest. Ich sah sie an. Sie war ganz bleich und schien unglaublich erleichtert.
Meine Wangen dagegen brannten.
»Hast du mich geohrfeigt?«, fragte ich Valérie. Mein Hals kratzte unangenehm.
Sie sah äußerst zufrieden aus. »Du bist gewacht, oder nischt?«
»Aufgewacht«, korrigierte Emma.
Valérie zuckte gleichmütig die Achseln.
Am liebsten hätte ich ihr ebenfalls eine runtergehauen. Doch meine Arme und Beine fühlten sich seltsam gummihaft an.
Ich sah mich um. Ich lag in den Princes Street Gardens, direkt unterhalb des Castles. Es roch nach Urin und feuchter Erde. Ziemlich typisch so dicht bei den Durchgängen zur Royal Mile. Hatten wir vorhin nicht weiter unten gesessen?
Ich bewegte alle zehn Finger. Sie kribbelten unangenehm, so als wären sie abgebunden gewesen. Meine Zehen ebenso. Ich streckte die Beine. Autsch. Mein linkes Bein tat weh. Vorsichtig massierte ich meine Wade. Sie fühlte sich an, als hätte sie jemand festgehalten. Bilder zuckten vor meinen Augen. Eine Ratte huschte über den Boden der Close, die viel älter und dreckiger aussah als die Touristenattraktion.
Und sie wurde immer dunkler. Ich wollte da nicht weiter hinein, ich …
»Allie, ist mit dir alles in Ordnung?«, fragte Camilla und legte stützend einen Arm um meine Schultern.
»Wie soll sie in Ordnung sein?«, fragte Emma. »Sie ist soeben entführt worden.«
Entführt? Nein, nicht ich, Schnucki … Doch dann erinnerte ich mich wieder an den unglaublich attraktiven Typen. Er hatte Valérie zurückgebracht und mich mitgenommen und etwas davon gefaselt, ich hätte eine Pforte geöffnet.
»Aber … warum?«, fragte ich und hörte, wie heiser meine Stimme klang. Ich hustete und fühlte einen Kloß im Hals, so als hätte ich Rauch eingeatmet.
»Was weißt du denn noch?«, fragte Emma vorsichtig.
»Da war dieser Junge …«, sagte ich langsam. »Er hat mich gepackt und mitgenommen. Auf einmal war es sehr dunkel, ich habe Panik bekommen. Dann hörte ich Schritte und dann war da…« Ich überlegte, doch ein Gesicht tauchte unvermittelt vor mir auf. »Beyoncé …?« Ich hielt irritiert inne. Was redete ich denn da?
»Sie ’at alle Teller im Regal«, sagte Valérie. Dieses Mal war sogar Emma ratlos, was sie damit meinte, und sah sie verwirrt an. Valérie drehte mit dem Zeigefinger Kreise vor ihrer Schläfe.
»Oh, ich weiß, was sie meint«, rief Camilla. »Sie wollte sagen, Allie hat nicht mehr alle Tassen im Schrank.«
»Du hast einen Fleck auf deiner Bluse«, sagte ich und deutete auf den Rest Eis. Wo war mein Eis? Ich musste es fallen gelassen haben, als der Typ mich gepackt hatte. Camillas Fleck war ganz eingetrocknet, als hätte sie ihn schon eine ganze Weile.
»Wie lange war ich weg?«, fragte ich und musste erneut husten.
Es kratzte noch immer unangenehm. Was hatte die Ohnmacht ausgelöst? Ich wandte mich zu den Häusern hinter uns um. Nein, es brannte nichts. Alles war normal. Zumindest dort.
Camilla griff in ihre Tasche und zog mein Handy hervor.
»Oje, was ist denn damit passiert?«, rief ich betroffen, als ich das zersplitterte Display sah.
»Das ist dir runtergefallen«, sagte sie und reichte es mir, um ihres dann hervorzuziehen. »Du warst eine halbe Stunde weg.«
»Ich war eine halbe Stunde lang ohnmächtig?«, fragte ich entsetzt.
»Was? Nein! Keine Ahnung, wie lange du ohnmächtig warst. Auf jeden Fall hast du wie ein nasser Sack über seiner Schulter gehangen«, erklärte Emma schnell.
»Wie konnte ich eine halbe Stunde verschwinden, ohne dass ihr mitbekommt, wohin?«, fragte ich Emma.
Camilla hob sofort abwehrend die Hände. »Wir sind dir hinterher, konnten aber die richtige Close nicht finden, und dann lagst du auf einmal hier.«
Meine Hand begann zu jucken und brennen. Ich hatte die Blutkruste an meinem Finger schon wieder aufgekratzt.
»Allison!« Camilla sah ganz erschrocken aus.
»Das hört gleich wieder auf«, beruhigte ich sie und lutschte an der Wunde.
»Vielleicht sollten wir sie ins Krankenhaus bringen«, flüsterte Camilla Emma zu, war dabei aber so laut, dass sie jeden Dudelsack übertönt hätte.
Der Dudelsack. Irgendetwas war mit dem Dudelsack gewesen …
»Ihre Kleidung ist völlig okay«, wisperte Emma Camilla zu. »Ich glaube nicht, dass sie … dass sie …«
Flugs checkte ich mein Aussehen. T-Shirt, Hose, Schuhe.
»Wo ist meine Schuluniform?«, fragte ich erschrocken.
»Wir haben unseren freien Nachmittag«, beruhigte mich Emma schnell. »Dann ziehen wir keine Schuluniform an.«
Natürlich.
Erleichtert und beschämt schloss ich die Augen.
»Allie, du bist doch nicht sauer auf uns, oder warum siehst du uns nicht an?«
Ich schlug die Augen wieder auf. »Wieso sollte ich auf euch sauer sein?«, fragte ich verwundert.
»Vielleicht weil du dachtest, wir würden dir nicht helfen. Wir haben direkt die Polizei gerufen, aber die meinte, du …«
»Die hat das ganz locker gesehen«, empörte sich Emma. »Die glaubten, du seist mit ihm durchgebrannt. Ich habe Camilla sofort gesagt, dass sie den Entführer nicht als heiße Banane beschreiben soll. Aber du weißt ja, wie gut sie hört.«
»Ja, meine Güte, mir ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen!«, rechtfertigte sich Camilla und sprang auf. »Hätte groß, blond, muskelbepackt und attraktiv denn besser geklungen?«
»Er war doch überhaupt nicht muskelbepackt! Er war drahtig-schlank und durchtrainiert.«
»Ja, klar, das hätte die Polizei direkt aufhorchen lassen! Wenn du nicht so viel mit Callums Nachrichten beschäftigt gewesen wärst, hättest du ja dein Handy holen können. Aber nein, der Akku war leer. Und ich finde, heiß beschrieb ihn nun mal am besten.«
»Umwerfend! Göttlich! Atemberaubend!«
Das Letzte kam von Valérie und sie klang dabei so unvalerisch, dass ich ein paarmal blinzelte, um sicherzugehen, ob dieser träumende Gesichtsausdruck zu ihr gehörte.
»Das war er«, bestätigte Emma und setzte zu meiner Überraschung den gleichen Ausdruck auf.
»Mal abgesehen von der Tatsache, dass er Mädchen entführt«, knurrte Camilla.
»Das Mädchen möchte nach Hause«, sagte ich beleidigt. Die Wunde an meiner Hand brannte und blutete stärker, meine Knochen fühlten sich extrem gummiartig an, und außerdem war mir leicht übel, so als hätte mir jemand in den Magen geboxt. Ich war entführt worden!
Die Erkenntnis begann erst jetzt zu sickern. Eine halbe Stunde lang war ich in der Gewalt eines fremden Mannes gewesen, an den ich mich nur schwach erinnerte. Eine halbe Stunde lang hatten mich meine Freundinnen aus den Augen verloren. Was hatte er in dieser Zeit mit mir gemacht? Meine Knie gaben endgültig nach.
Umständlich und mithilfe von Camilla und Emma rappelte ich mich auf und wir machten uns – ganz langsam, weil mein linkes Bein schmerzte – auf den Heimweg.
»Müssen wir es Mrs Bell sagen?«, fragte Camilla, als wir ein Stück gegangen waren. »Ich meine, Allison ist wohlbehalten zurück, der Entführer verschwunden, die Polizei hat nichts unternommen, und wie wir Mrs Bell kennen, macht die trotzdem ein Fass auf. Ich sehe schon den Innenminister und den Chef der Polizei antanzen. Tochter der berühmten Dokumentarfilmer wurde entführt.«
»Ich finde, den Anschiss hat sich der Polizeichef redlich verdient«, sagte Emma bestimmt.