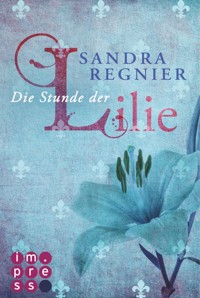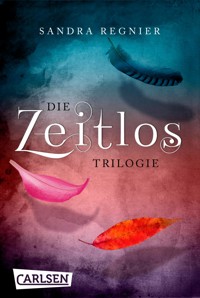9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Sternbild des Großen Hundes verheißt seit jeher nichts Gutes. Jetzt funkelt es über dem Steinkreis von Lansbury und das bedeutet höchste Gefahr. Die Erde dreht sich immer langsamer und ausgerechnet Meredith soll verhindern, dass sie gänzlich stehenbleibt. Eindeutig zu viel für eine normalsterbliche Schülerin. Zum Glück kann ihr der attraktive Brandon dabei helfen, Zeit und Raum wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wie es sich für einen ehemaligen Ritter gehört. Doch Meredith kann in seiner Gegenwart einfach keinen klaren Gedanken fassen … //Alle Bände der Reihe: -- Zeitlos 1: Das Flüstern der Zeit -- Zeitlos 2: Die Wellen der Zeit -- Zeitlos 3: Die Flammen der Zeit// Die Zeitlos-Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sandra Regnier
Die Wellen der Zeit
Das Sternbild des Großen Hundes verheißt seit jeher nichts Gutes. Jetzt funkelt es über dem Steinkreis von Lansbury und das bedeutet höchste Gefahr. Die Erde dreht sich immer langsamer und ausgerechnet Meredith soll verhindern, dass sie gänzlich stehenbleibt. Eindeutig zu viel für eine normalsterbliche Schülerin. Zum Glück kann ihr der attraktive Brandon dabei helfen, Zeit und Raum wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wie es sich für einen ehemaligen Ritter gehört. Doch Meredith kann in seiner Gegenwart einfach keinen klaren Gedanken fassen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Für meine Schwester Tina
In Erinnerung an unsere supergeniale Reise nach Wiltshire
– inklusive Traktor und Stonehenge (in dieser Reihenfolge)
Prolog
Die Steine im Kreis standen seit Jahrtausenden. Kein Unwetter, kein Krieg hatte ihnen etwas anhaben können. Nie waren sie gekippt, nie ins Wanken geraten. Im Gegensatz zu Stonehenge, wo schon jeder Stein hatte bewegt werden müssen, verharrten diese hier seit urewigen Zeiten stolz und aufrecht in ihrer Position.
Bis jetzt.
Noch war niemandem die kleine Neigung aufgefallen, die zwei der Steine seit dem Gewitter in der Mainacht acht Wochen zuvor aufwiesen. Mit bloßem Auge war sie kaum wahrnehmbar.
Doch das war erst der Anfang.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Steine kippten.
Und dann war es zu spät. Die Menschen von Lansbury würden den Steinkreis nicht mehr aufrichten können. Die alten Schriften, die ihnen verraten könnten, wie das drohende Unheil abzuwenden wäre, waren verschollen.
Der Mann in der Kapuze wandte den Blick zum Himmel. Das Sternbild des Großen Hundes war an diesem Abend ganz deutlich zu erkennen. Das Sternbild, das bei den alten Ägyptern den Untergang der Welt vorhergesagt hatte, strahlte heller als je zuvor. Er konnte in der Ferne die Menschen sehen, die zum Himmel emporschauten, um die funkelnden Sterne zu bewundern. Wenn sie wüssten, in welcher Gefahr sie sich befanden, würden sie panisch davonlaufen. Doch dann sah er eine Frau, die auf einen Punkt am Horizont deutete. Er folgte ihrem Blick und seine Augen weiteten sich überrascht. In den zwölfhundert Jahren, die er hier wachte, hatte er dieses Spektakel erst ein Mal gesehen.
Ein einzelner Stern war dort aufgetaucht.
Viel zu früh. Viel zu nah. Und er flackerte unsteter als jeder andere Stern am Firmament.
Der Mann in der Kapuze konnte nicht genau erkennen, ob er bereits am Erlöschen war. Doch er wusste genau, was es bedeutete: Der Untergang der Welt konnte nur von einem Menschen verhindert werden und es war ungewiss, ob dieser Mensch es schaffen würden.
Denn es handelte sich dabei um ein Mädchen von siebzehn Jahren.
1. Kapitel
Ich war keine Heldin. Diese Feststellung war so sicher wie das nächste Gewitter. Mein Kopf war hohl und ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und das bei einem erwiesenen IQ von 140, mit dem ich meine Mathe- und Physiklehrer immer verblüfft hatte. Sie wären erstaunt, wie unnütz mein Hirn in gewissen Situationen sein konnte. Colin würde vermutlich sagen: Kein Wunder, wenn du in den Lauf einer Pistole starrst, Meredith.
Wie hatte es so weit kommen können? Alles hatte doch relativ harmlos angefangen. Nun ja, mehr oder weniger. Mein bester Freund Colin, der für mich immer wie ein Bruder gewesen war, hatte mich geküsst. Colin, mit dem ich den Großteil meiner Zeit verbrachte und von dessen Geheimnis nur ich wusste. Er konnte allein mit der Kraft seiner Gedanken Sachen bewegen. Und er hatte Visionen. Bei der Berührung eines anderen Menschen sah er ebenjenen kurz vor seinem Tod. Zumindest war es über viele Jahre hinweg so gewesen. Seit der Gewitternacht – und dem Kuss – blieben die Schreckensbilder aus. Aber das war längst nicht alles.
Für meinen heimlichen Schwarm Brandon war ich mit einem Mal keine Unsichtbare mehr. Und dann war auch noch diese Elizabeth aufgetaucht mit ihren feuerroten Haaren und ihrem noch feurigeren Temperament. Sie hatte Colin angebaggert und mit ihrem außergewöhnlichen Talent, Flammen allein durch ihren Willen zu entfachen, Stuart Cromwell auf sich und uns aufmerksam gemacht. Den Stuart Cromwell, Multimillionär und einflussreicher Firmeninhaber. Viele würden sich geschmeichelt fühlen, so jemandem aufzufallen. Ich nicht. Brandon, der genau wie Elizabeth und Colin ein Element mit purer Willenskraft steuern konnte, hatte mir erklärt, wie gefährlich Stuart Cromwell war, denn er war einer von ihnen – ein Elementträger.
Bei Brandon war es Erde, bei Elizabeth Feuer (was sonst) und bei Colin aller Wahrscheinlichkeit nach Wasser. Und Cromwell befehligte die Luft. Damit waren keine Blähungen gemeint, sondern vielmehr seine Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken anderer zu manipulieren. Mit dieser Begabung hatte er zweifelsfrei sein Geschäftsimperium errichtet.
Und weil Cromwell überzeugt war, mehrere Platoniden am selben Ort stellten eine Gefahr dar, hatte er bislang jeden potenziellen Elementträger eliminiert. Das behauptete zumindest Brandon. Ich hatte ihm nicht geglaubt, bis ich mit eigenen Augen dabei zusehen musste, wie Cromwell Elizabeth ein Messer in den Bauch rammte. Sie hatte zwar überlebt und lag jetzt im Krankenhaus, aber ausgerechnet ich war ihm in die Hände gefallen. Ich, Meredith Wisdom, siebzehn Jahre alt, dunkle Haare, Brille, mit einer Vorliebe für dunkle Klamotten. Für die meisten Mitschüler am College langweiliger als ein Dr. Dr. Sheldon Cooper. Ich wurde nur interessant, wenn es auf irgendwelche Arbeiten in Physik oder Mathe zuging.
Und ausgerechnet jetzt war der Multimillionär Stuart Cromwell hinter mir her. Dafür gab es einen einfachen Grund: Er hielt mich für eine Platonidin. Er glaubte, ich beherrsche ein Element und könnte allein durch meinen Willen Gegenstände bewegen oder Wasser schneller fließen lassen.
Deshalb hatte er mich vor dem Krankenhaus, in das wir Elizabeth gebracht hatten, abgefangen. Jetzt saß ich in seiner Limousine ihm gegenüber und er zielte mit einer Pistole auf mich. Kein Wunder also, dass sich mein Hirn auf Stand-by geschaltet hatte.
»Ich habe ein wenig nachgeforscht, Meredith«, sagte er mit seiner einnehmenden Stimme, die jeden in seiner Nähe verzauberte. Obgleich sie im Moment ein wenig nasal klang. Mit Genugtuung sah ich seine geschwollene Nase. Er hatte Elizabeth zu töten versucht und mit Brandon gekämpft. Der hatte ihm dabei die Nase gebrochen. »Du bist erst vor wenigen Jahren hierhergezogen. Nach dem Tod deines Bruders, um genau zu sein. Du bist im ersten Jahr am College in Lansbury. Vor eurem Umzug habt ihr in Warwickshire gewohnt, wo dein Bruder laut den Unterlagen der Polizei während eines Gewitters von einem Megalithen erschlagen wurde.«
Ich schluckte und langsam begann mein Gehirn wieder zu arbeiten. Allerdings in die falsche Richtung. Denn es suchte nicht nach einem Ausweg oder Hilferuf, sondern wünschte sich einfach nur, ich möge mich in Luft auflösen.
Was nutzte mir mein hoher IQ, wenn ich in einer Gefahrensituation nicht kühl und überlegt denken konnte?
Cromwell machte eine Pause und ich hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen. »Toll. Fakten, die jeder in Lansbury weiß und die man in den Schulakten oder im Rathaus nachlesen kann«, log ich.
Natürlich wusste das nicht jeder in Lansbury. Genau genommen wusste es niemand hier. Mein Bruder war in unserer Familie seit jeher ein Tabuthema. Meine Eltern sprachen nie über ihn und es gab nur ein Foto. Das lag versteckt in Mums Nachttischschublade.
Einzig Mum hatte das Bedürfnis, alle paar Wochen sein Grab zu besuchen. Sogar als Elizabeth es betrunken in der Johannisnacht ausplauderte, hatte ihr niemand geglaubt, weil ich meinen Bruder noch nie erwähnt hatte.
»Dann kommen wir doch einfach zu den Fakten, die in keiner Schulakte stehen.« Cromwell lehnte nach wie vor lässig in dem Sitz mir gegenüber, die Pistole unverwandt und ohne auch nur zu wackeln auf mich gerichtet. »Dein Bruder Oliver beherrschte Telekinese, nicht wahr?«
Ich starrte ihn an.
»Nicht wahr?«, wiederholte er ungeduldig.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich.
»Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, die Zeit für Spielchen ist vorbei. Wir können die Karten offen auf den Tisch legen. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Also noch einmal: Dein Bruder konnte Gegenstände mit der Kraft seiner Gedanken bewegen.«
»Ich weiß es wirklich nicht«, antwortete ich, so fest ich konnte. »Ich war vier Jahre alt, als er starb. Ich weiß nichts mehr von dem, was vorher war.«
Das stimmte beinahe. Ich konnte mich weder an meinen Bruder Oliver erinnern noch an unser Haus in dem Ort, wo ich geboren wurde. Meine allererste Erinnerung war die an meine Mutter, wie sie auf der Couch (die auch jetzt noch im Wohnzimmer stand) zusammengekrümmt schluchzte. Ein Gedanke, den ich meistens entschieden beiseiteschob. Auch jetzt.
Dann erst kamen schwache Eindrücke von dem Umzug nach Lansbury – schemenhafte Bilder einer Autofahrt –, und vor allem von meinem ersten Schultag. Und damit auch an Colin.
Colin gehörte tatsächlich zu meinen ersten Erinnerungen. Er war eine, an die ich mich gern klammerte.
Meinen Bruder Oliver kannte ich nur von dem Foto aus Mums Nachttischschränkchen. Das zeigte einen vierzehnjährigen Jungen, mir sehr ähnlich, nur ohne Brille und etwas kräftiger, als ich es mit vierzehn gewesen war.
»Dann will ich dir mal ein wenig unter die Arme greifen«, sagte Stuart Cromwell gedehnt. »Dein Bruder Oliver war ein Platonid. Oder zumindest dachte ich das, als … Warum halten wir, Tom?«
Die blinde Verbindungsscheibe vor mir summte und ich hörte den Chauffeur sagen: »Da ist ein großes Loch in der Straße direkt vor uns.«
Der Satz war kaum beendet, da barsten die Fensterscheiben mit einem lauten Knall. Erschrocken riss ich meine Arme hoch, um mein Gesicht zu schützen.
Ich hörte ein Röcheln und Pfeifen und spürte einen scharfen Lufthauch neben mir. Die Tür wurde aufgerissen. Ich linste unter meinem Ellbogen hindurch und sah, wie ein langer Stab Cromwell mit voller Kraft ins Gesicht schlug.
Der schrie vor Schmerzen auf und seine noch immer geschwollene Nase begann augenblicklich zu bluten. Er hob erneut die Waffe. Aus Reflex riss ich das Bein hoch und trat gegen seinen Arm.
Keine Sekunde zu früh, denn ein weiteres Pfff zischte und Metall schlug auf Metall. In den Rahmen der offenen Tür hatte eine Kugel eingeschlagen und jetzt erkannte ich, wer dort vor dem Wagen stand. Brandon hielt einen Schrubber in der Hand.
»RAUS HIER!« Er knallte den Schrubberstiel ein weiteres Mal in Cromwells Visage. Der ließ endlich die Pistole fallen und hielt sich beide Hände vor sein ansonsten perfekt gemeißeltes Gesicht. Ich hatte genug gesehen, packte Brandons ausgestreckte Hand und sprang aus dem Wagen.
Mit festem Griff umfasste er meine Finger und rannte sofort los. Jetzt erst fiel mir auf, dass Swindon hinter uns lag und wir vor Badbury standen. Wir waren einen geteerten Feldweg entlanggefahren. Ich wollte gar nicht wissen, warum, aber ich ahnte es. Tatsächlich begann es zu piffen und die Blätter einer Hecke neben uns zerfetzten ohne ersichtlichen Grund. Das verlieh mir Flügel, zumindest bis wir die Autobahn erreichten.
»Bist du verrückt?«, schrie ich, als Brandon über die Leitplanke zur M3 kletterte und mich mitzog. Wenn ich nicht aufs Gesicht fallen wollte, musste ich hinterher. Es war, als hätte man mich mit Kabelbindern an ihn gebunden.
Er lief mit einem schnellen Blick nach rechts. Ich konnte meine Hand der seinen nicht entziehen und tat das Einzige, was mir übrig blieb: Ich rannte los.
Autos hupten und ich sah die ungläubigen Gesichter der Insassen. Doch wir überquerten die Autobahn, ohne eine Massenkarambolage auszulösen oder angefahren zu werden. Hinter der Leitplanke kämpften wir uns durch ein paar Hecken und dann lagen die üblichen Felder und Wiesen von Wiltshire vor uns. Meine Brille rutschte und ich schob sie hektisch zurück auf das Nasenbein. Zum ersten Mal in meinem Leben wünschte ich mir Kontaktlinsen, die ich bislang strikt verweigert hatte. Ich schwitzte und meine Gläser beschlugen, aber ich hatte keine Möglichkeit, sie sauber zu wischen.
Wir rannten querfeldein, sprangen über einen Zaun, über einen Bach – ich landete mit einem Fuß darin. Doch das war jetzt auch schon egal, denn ich bekam heftiges Seitenstechen, der Schweiß rann mir über die Stirn in die Augen und ich glaubte, meine Lunge würde jeden Moment platzen. Trotzdem hielt ich weiter mit Brandon Schritt. Er rannte nach rechts auf einen Wald zu. Aber erst als die Bäume richtig dicht standen, wurde Brandon langsamer und blieb endlich – ENDLICH – stehen.
Ich beugte mich vornüber, um besser Luft zu bekommen. Hatten wir Cromwell abgehängt?
»Der leckt erst einmal seine Wunden«, sagte Brandon abgehackt. Er ließ sich gegen einen Baum sinken.
»Wie … hast …« Weiter kam ich nicht. Ich hatte nicht genug Luft.
»Stockkampf war Teil meiner Ausbildung«, sagte Brandon ein wenig kurzatmig. »Cromwells gebrochene Nase muss wieder gerichtet werden. Deswegen konnte er mit Sicherheit nicht richtig zielen.«
Donnerwetter. Für so kaltblütig hätte ich den Barkeeper des Circlin’ Stone überhaupt nicht gehalten. Er wirkte immer so … so … freundlich. Aber jetzt sprach er mit großer Genugtuung von den Schmerzen, die er jemand anders zugefügt hatte.
Und er grinste auch so zufrieden.
»Was ist?«, fragte er mit einem Blick auf mich.
»Du machst mir Angst«, gestand ich, noch immer außer Puste. »Es sieht so aus, als würdest du gern anderen wehtun.«
»Ich bin zum Ritter ausgebildet worden«, gab er ganz unbescheiden zu. »Hast du etwa gedacht, wir sind mit Watte gefüttert, wenn wir üben?«
Ich hatte überhaupt nichts gedacht, musste ich mir eingestehen. »Eigentlich hatte ich wissen wollen, wie du mich gefunden hast«, sagte ich und fuhr mir über die Stirn. Mein Handrücken war nass vor Schweiß. Igitt. Ich wischte ihn an meiner Jeans ab.
»Ich hatte im Krankenhaus noch was vergessen und bin dir hinterher. Gerade rechtzeitig, um dich in den Bentley steigen zu sehen. O Mann, ich habe einen Bentley zerstört! Querfeldein konnte ich euch einholen. Schnelligkeit und Lauftraining gehören auch zur Ausbildung eines Ritters.«
Unser Barkeeper war ein Ritter. Ein waschechter Ritter aus dem sechzehnten Jahrhundert, den es in einer anderen Gewitternacht vor fünf Jahren in diese Zeit katapultiert hatte.
Und er war mein Retter. Welches Mädchen wollte nicht einmal von einem Ritter in schimmernder Rüstung auf einem weißen Pferd gerettet werden? Hatte ich auch irgendwann einmal davon geträumt? Oder erinnerte ich mich jetzt nur an die Fantasien meiner Freundin Rebecca, die noch immer leidenschaftlich gern reiten ging? Eher Letzteres, denn dieser Ritter hier hatte keine schimmernde Rüstung, sondern verwaschene Jeans und Schweißflecke an seinem Shirt.
»Und was hattest du vergessen? Mir den Schrubber zu geben? Ich hatte keinen Schrubber dabei, als wir ins Krankenhaus gefahren sind.« Ich wischte meine Brille mit dem Saum meines Tops etwas sauber. Die Sicht wurde ein wenig besser.
»Ich wollte dir nur sagen, dass du meine Handynummer nicht weitergeben sollst.«
Aha. Nun ja, ich war davon überzeugt, weniger Anrufe zu erhalten als er. Von daher …
Denn dank der sauberen Brillengläser musste ich mir eingestehen, dass Brandon auch verschwitzt verdammt gut aussah. Mal abgesehen von den dunklen Stellen an Brust und Achseln schien er nämlich nicht sonderlich außer Puste. Nur seine Haare waren noch verwuschelter als sonst. Gepaart mit dem breiten Lächeln, das seine weißen, wenn auch ein wenig schiefen Zähne zeigte, wirkte er wieder wie ein Hollywoodstar nach einer leichten Stuntübung.
»Und den Schrubber hat ein Ritter dann immer im Handgepäck?«
»Nee, den hatte die Putzfrau glücklicherweise direkt am Eingang stehenlassen, als ich dich einsteigen sah.« Brandons blaue Augen blitzten.
Ganz offensichtlich genoss er die Situation.
»Du genießt das«, warf ich ihm vor. Das war unglaublich. Wir wären beinahe erschossen worden und er strahlte übers ganze Gesicht, so als wäre Weihnachten früher gekommen.
»Endlich passiert noch mal etwas«, sagte er und grinste noch breiter.
»Wir sind in Lebensgefahr und es ist noch lange nicht vorüber. Cromwell weiß, wo wir wohnen, und kann die Polizei manipulieren. Toll, dass wenigstens du deinen Spaß hast.«
Ich lehnte mich an einen Baumstamm und atmete ein letztes Mal tief durch. Dann richtete ich mich wieder auf.
Brandons selbstgefälliges Grinsen hatte sich verflüchtigt.
»Du hast Recht. Wir müssen unbedingt zurück ins Krankenhaus und sehen, dass Elizabeth da rauskommt.«
Ich schluckte. Nur darum ging es ihm also: Elizabeth schützen.
Elizabeth hatte es vor wenigen Wochen in jener berüchtigten Gewitternacht im Mai hierher verschlagen. Sie stammte genau wie Brandon aus dem sechzehnten Jahrhundert. Ich hatte nur noch nicht herausgefunden, ob Brandon und sie sich schon vorher in ihrer Zeit gekannt hatten oder ob doch fünfzig Jahre dazwischenlagen. Denn er hatte noch so gut wie nichts darüber erzählt.
Brandon schien meinen offenen Mund überhaupt nicht zu registrieren, denn er sagte: »In der Zwischenzeit kannst du mir von deinem Bruder berichten.«
»Da gibt es nichts zu berichten.« Frustriert kickte ich einen Stein weg. Der Stein verpuffte noch im Flug zu Sand.
Und der Sand drehte sich im freien Flug und kam zu uns zurück!
Brandon war schneller auf den Beinen, als dass ich verstand, was hier vor sich ging.
»Ihr dachtet doch nicht, ihr könntet mir so leicht entkommen.«
Stuart Cromwell, Gesicht und Hals blutverschmiert, trat aus dem Unterholz und zielte mit seiner Pistole auf uns.
Ich sah bereits seinen Finger zucken, als Cromwell unerwartet stehen blieb. Er sah nicht länger uns an. Er sah an uns vorbei.
Ich folgte seinem Blick und krallte meine Hand in Brandons Arm. Wir waren nicht allein mit ihm. Unter den Bäumen stand der Kapuzenmann.
2. Kapitel
Der Kapuzenmann war mir in der letzten Zeit des Öfteren begegnet. Ich hatte ihn zuerst für einen Spinner gehalten, der sich zu früh fürs Sachsen-Festival eingefunden hatte. Er sah aus wie ein mittelalterlicher Mönch in einer einfachen Kutte, mit der typischen Tonsur auf dem Kopf, und war über den College-Campus gestromert. Doch dann hatte er mir aus einem Spiegel entgegengeblickt. Das war die unheimlichste Begegnung meines Lebens gewesen. Deswegen hatte ich auch gedacht, nur ich würde ihn sehen, als eine Art persönliche Nemesis. Augenscheinlich war das nicht der Fall, denn Stuart Cromwell starrte ebenso entgeistert in seine Richtung.
Ich konnte nicht glauben, was ich sah, und blickte abwechselnd zu Cromwell und dem Kapuzenmann. Cromwell, der vorgestern noch beim Premierminister zu Abend gegessen hatte und eine geladene Waffe in der Hand hielt, schien vor dem Kapuzenmann Angst zu haben.
Seine Hand zitterte, die Nase begann wieder stärker zu bluten.
»Wie kommst du hierher?«, fragte Cromwell, und mit einem Mal war seine Stimme überhaupt nicht mehr einschmeichelnd oder fest. Sie klang nur noch ängstlich und kleinlaut und dadurch etwas quietschig. »Ich habe dich beseitigt.«
Zu meiner Angst gesellte sich noch eine gehörige Portion Panik. Cromwell hatte gerade zugegeben, eine weitere Person getötet zu haben.
»Du kannst nicht beseitigen, was schon lange tot ist«, sagte der Kapuzenmann und ich hörte zum ersten Mal seine Stimme. Seine grünen Augen funkelten, um seinen Mund lag ein entschlossener Zug.
»Was geht hier vor?«, rief Brandon hinter mir erschrocken. »Was ist los? Ist da noch jemand?«
Ich sah erstaunt zu Brandon, der suchend in den Wald blickte.
Doch eine Bewegung lenkte meine Aufmerksamkeit wieder zurück zu Cromwell. Er hatte wieder die Pistole gezückt und richtete sie … Er würde doch nicht …
Doch Cromwell hatte die Fassung verloren.
»Ich habe mich genau an die Anweisungen in den Aufzeichnungen gehalten. Du bist tot. Ein für alle Mal tot!«, rief Cromwell aufgebracht und betätigte den Abzug der Pistole. Mehrmals.
Ich schrie auf und wurde zu Boden gerissen. Brandon lag auf mir und ich brauchte einen Moment, um unter seinem schützenden Arm hindurchsehen zu können.
Der Mönch stand noch und zuckte nicht mal mit der Wimper.
Das war unmöglich.
Cromwell hatte aus nur vier Metern Entfernung geschossen. Selbst ich hätte getroffen, wenn ich es versucht hätte. Sogar ohne Brille.
Und da wurde mir klar: Er war ein Geist! Der Kapuzenmann war ein Geist!
»Du kannst mich nicht töten und du darfst ihr nichts zu Leide tun. Sie ist der Schlüssel. Vergiss das nie.«
»Was geht hier vor?«, raunte Brandon wachsam in mein Ohr.
Er ließ Cromwell nicht aus den Augen.
»Der Schlüssel, wozu?«, fragte Cromwell zittrig. »Es ist zu gefährlich. Es sind zu viele Platoniden hier. Sie muss fort.«
Ich hörte die feste Stimme des Mönchs und konnte trotzdem noch nicht fassen, was sich hier gerade abspielte.
Er war ein Geist!
»Nur sie kann es jetzt noch abwenden. Du solltest sie schützen, statt sie zu bedrohen. Geht sie unter, gehst du unter.«
»Meredith, was ist hier los? Mit wem redet er?«
Brandon konnte ihn weder sehen noch hören, aber ich wollte kein einziges Wort verpassen.
»Pst. Gleich«, flüsterte ich zurück.
»Wir gehen alle unter«, rief Cromwell entschlossen. »Mit ihr sind drei Elementträger zur selben Zeit am selben Ort. Die Schwerkraft der Erde lässt bereits nach. Ich spüre es.«
»Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort«, korrigierte der Kapuzenmann streng. »Du musst in deine Zeit zurückkehren und deine Aufgabe dort vollenden.«
»Nein«, knurrte Cromwell. »Ich werde das hier nicht aufgeben. Niemals!« Entsetzt sah ich, wie Cromwell den Arm mit der Waffe hob und auf uns richtete, Brandon und mich.
Brandon reagierte blitzschnell, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Er rollte uns beide aus der Schusslinie. Ich spürte einen spitzen Stein an meinem Rückgrat, konnte aber nicht mal ein »Au« von mir geben, denn Brandon schien eine verdrehte Sprungfeder zu sein und rollte uns in einer Geschwindigkeit weiter, dass mir übel wurde. Ich hörte die Kugel über unsere Köpfe hinwegsurren.
Als er endlich anhielt, brauchte ich ein paar Sekunden, ehe ich die Augen öffnen konnte. Durch die verschmierten Gläser meiner Brille hindurch sah ich, dass sich der Kapuzenmann zwischen Cromwell und uns gestellt hatte.
»Tötest du die Gaianidin, ist der Magnetismus der Erde irreparabel gestört. Halte dich an den Kodex. Vollende deine Bestimmung«, sagte der Kapuzenmann eindringlich.
Cromwells irrer Blick glitt zu mir. »Sie? Sie ist die Gaianidin?«
Der Kapuzenmann nickte. »Ganz recht. Du weißt sehr wohl, was das bedeutet. Schütze sie. Notfalls mit deinem Leben. Du gehörst nicht hierher. Nur einer stammt aus dieser Zeit, drei Elementträger müssen wieder zurückkehren. Du musst zurückkehren.«
Cromwell sah noch immer mich an und ich war mir nicht sicher, ob er begriff, was der Mönch ihm gerade erklärt hatte. Ich hatte es ja selber nicht verstanden. Was war eine Gaianidin?
Es klang wie eine Pflanzensorte, aber ich hatte das ungute Gefühl, ich war mit Gaianidin gemeint. Schließlich war hier nur eine weibliche Person anwesend – sofern sich nicht ein Hase im Gebüsch versteckt hielt.
»Wirst du sie schützen, Stuart?«, fragte der Mönch und trat näher an Cromwell heran. Der wich zurück, so als müsse ein Blinder Hitze ausweichen. Interessant. Es gab etwas, vor dem Stuart Cromwell Angst hatte.
»Was ist da los, Meredith?«, fragte Brandon wieder leise, rückte allerdings keinen Zentimeter von mir ab. Ich konnte ihm nicht antworten, denn ein grelles Licht erstrahlte. Brandon schien noch immer nichts von diesem seltsamen Spektakel wahrzunehmen. Trotz der dreckigen Gläser erkannte ich: Der Mönch leuchtete. Der Kapuzenmann erstrahlte in einem gleißenden Licht wie ein Heiligenschein in den Apostelgemälden. Doch Cromwell blinzelte nicht einmal.
»Stuart?! Hast du verstanden?«, wiederholte er und seine Stimme hallte auf der Lichtung wider, als hielte er ein Megafon in der Hand.
Jetzt endlich wandte Cromwell den Blick von mir zu der Stelle, wo der Mönch zuerst gestanden hatte, und mir ging auf, dass auch er den Geist nicht wirklich sehen konnte. Im Gegensatz zu Brandon hörte er ihn klar und deutlich und er musste ihn fühlen. Wie sonst hätte er ihn wahrnehmen können, ehe der Geist gesprochen hatte? Auf alle Fälle schien er ihm zuzuhören und seine Worte ernst zu nehmen.
»Ich werde ihr nichts tun«, sagte er in Richtung des Mönchs. Er blickte definitiv an ihm vorbei.
In der Swindon Mall hatte ich mal mit einem Blinden gesprochen. Cromwell fixierte genau wie der Blinde keinen bestimmten Punkt, als er nun mit dem Geist sprach.
Der Mönch nickte noch einmal, und dann war er verschwunden.
Von jetzt auf gleich war da nur noch Luft.
Verdammt.
Er konnte uns doch nicht einfach im Stich lassen! Woher wusste er, dass Cromwell jetzt nicht die Pistole zückte und uns rücksichtslos abknallte?
Doch Cromwells Pistolenhand blieb unten. Er atmete heftig, Blut lief ihm noch immer als feines Rinnsal aus der Nase. Er starrte in die Richtung, in der er den Geist vermutete. Wie hatte er dessen Anwesenheit gespürt? Ob das auch mit seinem Element Luft zusammenhing?
So viele Fragen, keine Antworten. Es war frustrierend. Brandon jedenfalls fand, er habe lange genug auf mir gelegen. Er sprang auf und zog mich hoch. Ich taumelte ein wenig und fing damit Cromwells Blick ein.
»Vier Elementträger zur selben Zeit … Vier!«, wiederholte er fassungslos die Worte des Kapuzenmanns. Er schüttelte leicht den Kopf, und das schien ihn wieder zur Besinnung zu bringen.
Der Moment der Unsicherheit war gewichen und der eiskalte Firmenmagnat trat wieder zum Vorschein. »Ich werde nicht zurückkehren. Wenn die Gaianidin auch leben muss, um die Bestimmung zu erfüllen – die anderen drei Elementträger müssen es nicht.«
Ich wollte mich schon schützend vor Brandon stellen, aber er hielt mich zurück.
Cromwell kam näher und blieb einen Meter vor mir stehen. Ich rückte nervös meine Brille zurecht. Cromwell schob seinen Kopf vor, so als würde er ein seltenes Insekt betrachten. »Du bist die Gaianidin. Und ich dachte, dein Bruder sei ein Elementträger. Wie gut, dass ich mich getäuscht habe, denn hätte ich dich dafür gehalten, wäre alles umsonst gewesen.«
Was zum Teufel …?
»Wir sehen uns wieder, Gaianidin. Ich werde ab sofort immer in deiner Nähe sein.«
»Hoffentlich nicht«, rutschte es mir raus. Doch er ignorierte das.
»Du musst beschützt werden. Ich werde dich bald brauchen. Sobald die drei Platoniden gefunden und beseitigt sind.«
Ein sanfter Wind umwehte mich. Ein Gefühl der Geborgenheit, des Friedens und der Zuflucht schwang darin mit.
Cromwell meine Zuflucht?
Schlagartig ging mir auf, dass er gerade von seiner Fähigkeit Gebrauch machte und mich manipulierte.
Es bedurfte nur der Erinnerung an Cromwells Element, und schon verflog das Gefühl. Allerdings nicht für Brandon, denn er machte einen Schritt auf Cromwell zu. Sofort ergriff ich seine Hand und drückte sie. Brandon blieb stehen.
Cromwell allerdings war die Geste nicht entgangen.
»Auch wenn du meine Gabe übergehen kannst, werde ich ab sofort dein bester Freund sein. Deine Stärke ist gewaltig. Wer hätte gedacht, dass du ohne Übung so die Autoscheiben zerplatzen lassen kannst?«
Aber nicht ich hatte die Autoscheiben zerplatzen lassen! Das war Brandon gewesen …
Aber ich würde mich hüten und Cromwell jetzt auf die Nase binden, dass bereits ein Platonid direkt vor ihm stand. Sollte er ruhig glauben, ich wäre zu so was fähig.
Stuart Cromwell lächelte ein letztes Mal siegesgewiss. Unter all diesem Blut in seinem geschwollenen Gesicht wirkte es wie ein Zombiegrinsen. Dann wandte er sich um und verließ mit großen Schritten die Lichtung in Richtung Straße.
Mit ihm verschwand auch seine einnehmende Magie. Zurück blieben ein erstarrter Brandon und eine stocksteife Meredith, die ihm hinterherstarrten.
Vermutlich hatten wir beide Angst, Cromwell würde es sich bei der kleinsten Bewegung oder dem leisesten Geräusch von uns anders überlegen und seine Kugeln doch noch auf ein lebendiges Ziel abfeuern. Und wir stünden kerzengerade wie auf dem Übungsplatz aufgestellte Flaschen da.
Der Gedanke an Flaschen brachte mich zur Vernunft. Meine grauen Zellen konnten unter Druck also doch ein wenig arbeiten.
»Lass uns abhauen«, murmelte ich und steuerte in die entgegengesetzte Richtung.
»Wir müssen zu Elizabeth«, wiederholte Brandon drängend und überholte mich.
Natürlich, zu wem sonst.
»Du kapierst es nicht, richtig?«, fragte er und warf mir einen Blick über die Schulter zu.
»Doch«, antwortete ich mürrisch. Zu der elfenhaften Elizabeth, die alle mit ihrer Schönheit und ihrem dominanten Temperament bezauberte. Alle Jungs wollten in ihrer Nähe sein. Sogar Colin.
»Ja, das sehe ich«, sagte Brandon sarkastisch. »Cromwell wird so schnell wie möglich Elizabeth aus dem Weg räumen wollen, weil er weiß, dass sie eine Elementträgerin ist. Wir müssen sie aus dem Krankenhaus holen und in Sicherheit bringen.«
Unsicher sah ich ihn an – beziehungsweise, blickte ich ihm auf den Rücken, denn er hatte wieder die Siebenmeilenstiefel an. Stimmte ja, Cromwell wusste von Elizabeths Fähigkeiten. Sie hatte sie dämlicherweise ganz offen beim Sachsen-Festival gezeigt und sich ihm damit in die Hände gespielt.
»Was ist eine Gaianidin?«, fragte ich Brandon.
»Was?« Er war schon mehrere Meter vor mir, ohne darauf zu achten, ob ich ihm folgte oder nicht.
»Eine Gaianidin. Hast du schon mal davon gehört?«
»Nein«, lautete die knappe Antwort. Brandon zuckte mit den Schultern. Keine Frage, er wollte so schnell wie möglich zurück ins Krankenhaus.
»Was hast du vor, wenn wir bei ihr sind?«, fragte ich Brandon.
»Sie mitnehmen«, erwiderte er.
»Und wohin? Cromwell findet doch sofort raus, wo du wohnst. Das weiß jedes weibliche Wesen im Umkreis von vierzig Meilen.«
Er warf einen genervten Blick über die Schulter. »Entgegen deiner Vermutung nehme ich nicht jedes weibliche Wesen mit in meine Wohnung.«
»Aber die träumen alle davon und sind schon mal vorbereitet«, konterte ich und sah für einen Moment seine Mundwinkel zucken. »Brandon, sie kann nicht dahin zurück. Sie muss weg.«
»Das weiß ich auch. Wir werden beide gehen.«
»Und wohin?«, wiederholte ich meine Frage. »Nimm’s mir nicht übel, aber wie lange wird dein Geld reichen? Und außerdem reden wir hier von Cromwell, der vorgestern noch mit dem Premierminister an einem Tisch saß. Er hat nicht nur die besten Beziehungen zur Regierung, sondern kann auch noch die Polizei beeinflussen. Wir haben gesehen, was er mit den Sanitätern gemacht hat.« Die hatten die verblutende Elizabeth überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und sich ausschließlich auf Cromwells Nase konzentriert.
»Der MI5 schnappt euch innerhalb von einer halben Stunde.«
»Du siehst zu viele Krimiserien«, sagte er barsch. »Ich bin kaum so blöd und werde in England bleiben.«
Das war doch zum Verrücktwerden. »Womit wir wieder beim Thema sind: Wohin willst du mit deinem mageren Einkommen? Ich kann dir nichts leihen. Ich bin auf ein Stipendium fürs Studium angewiesen.«
Und damit hatte ich seinen wunden Punkt erwischt. »Verdammt noch mal, hast du etwa eine bessere Idee?«
»Tatsächlich«, sagte ich lächelnd, »habe ich eine.«
3. Kapitel
Chris? Ich bin’s, Meredith.«
»Hey, wie geht es dir, du Heldin?«, flötete die Stimme meines Mitschülers, guten Freundes und selbst ernannten Playboys. Im Hintergrund waren viel Musik, Trommeln und Menschenstimmen zu hören. Er war noch auf dem Sachsen-Festival, dem größten Altertumsfest von Wiltshire, und bei diesem herrlichen Wetter waren bestimmt an die achttausend Menschen ebenfalls dort. Ein Wunder, dass Chris überhaupt ein Wort von mir verstand.
Hier im stillen Krankenzimmer waren seine Stimme und die Hintergrundgeräusche überdeutlich zu hören. Wir waren vor zwei Minuten auf der Station angekommen, wo Elizabeth lag. Zum Glück war von Cromwell nichts zu sehen. Wir waren also noch rechtzeitig. Elizabeth allerdings lag matt und teilnahmslos im Bett. Die Augen fielen ihr andauernd zu und sie hatte noch kein Wort gesprochen. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es ihr wirklich mies ging.
»Heldin?«, fragte ich verblüfft.
»Ja, hier auf dem Festival wurde vorhin erzählt, Cromwell und du hättet Elizabeth vor sich selber gerettet«, sagte Chris und fügte ein wenig ernster hinzu: »Die Gute darf wirklich keinen Alkohol mehr trinken.«
Ich zog eine Grimasse. Wenn er wüsste …
Mir war die Idee gekommen, Elizabeth bei Chris unterzubringen, und ich fand sie genial. Die meiste Zeit lebte er allein, nur eine Haushälterin kam zweimal die Woche vorbei, um Wäsche zu waschen und zu putzen und Chris mit selbst gebackenem Kuchen zu versorgen. Mr Harris war ständig geschäftlich unterwegs. Er hatte auch nie etwas gegen Chris’ Freundinnen und deren Übernachtungsbesuche einzuwenden.
»So lala. Der Vorfall verlief nicht ganz so, wie du es gehört hast. Chris, ich brauche deine Hilfe. Oder besser gesagt, Elizabeth braucht deine Hilfe.«
»Aber immer doch!«, erwiderte er erfreut. »Wo brennt’s denn?«
»Kann sie ein paar Tage bei dir wohnen? Es muss aber geheim bleiben. Ich erklär dir gleich, wieso und warum.«
»Aber immer doch«, wiederholte er sich, noch eine Spur fröhlicher als zuvor. »Wir haben nur kein Zimmer mehr frei und sie müsste mit mir in einem Bett schlafen.«
»Chris!«, rief ich warnend, wohl wissend, dass in dem uralten Herrenhaus mehr als zwanzig Zimmer nie genutzt wurden. Er lachte nur.
»Ach, Meredith, du bist so durchschaubar. Sie wird das Königszimmer bekommen. Angeblich hat Queen Anne mal da drin übernachtet.«
»Ehrlich?«, fragte ich überrascht. »Das wusste ich gar nicht.«
»Ist auch nicht wahr. Es klingt aber immer gut, wenn Dad Geschäftspartner einlädt. Vor allem die Amerikaner stehen auf solche Storys.«
Ich rollte mit den Augen und Brandon begann ungeduldig auf und ab zu gehen.
»Noch eine Frage, Chris: Könnte Elizabeth noch in der nächsten Stunde kommen und wärst du so nett, uns alle im Krankenhaus von Swindon abzuholen?«
»Holla! Das sind zwei Fragen, meine Liebe. Und bei beiden lautet die Antwort Ja. Ich mach mich sofort auf den Weg.«
»Danke!« Ich atmete erleichtert aus. »Wir warten dann an der Eingangspforte. Und noch was: Du darfst niemandem davon erzählen, ja? Cromwell lügt.«
»Du kannst dich auf mich verlassen.« Er legte auf.
Ich nahm das Handy vom Ohr und sah Brandon verwundert an. »Er hat nicht mal gefragt, woher ich weiß, dass Cromwell nicht die Wahrheit sagt«, sagte ich.
Brandon machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Nimmt er sie?«
»Ja, Chris nimmt Elizabeth auf.«
Brandon nickte erleichtert. »Und wir können uns auf ihn verlassen?«
»Hundertprozentig. Ich würde ihm zwar nicht glauben, wenn er mir ewige Liebe schwört, aber mein Leben würde ich ihm anvertrauen.«
Wir hatten keine andere Wahl. Ich klingelte nach der Pflegerin, während Brandon die wenigen Kleider zusammenpackte.
»Was tut ihr da?«, hauchte Elizabeth. Sie war furchtbar schwach und ich hatte größte Bedenken, sie aus der medizinischen Obhut zu nehmen. Aber hier wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Cromwell sie in die Finger bekam, und das wäre ihr sicherer Tod. Er könnte sie umbringen und es so aussehen lassen, als hätte sie den Unfall nicht überlebt. Oder er konnte jemanden vom Pflegepersonal manipulieren, sie umzubringen. Oder er konnte … Lieber nicht weiter darüber nachdenken, sondern handeln.
»Wir bringen dich hier weg. Cromwell weiß, wo du bist, und wird wieder versuchen dich zu beseitigen«, erklärte ich ihr nervös. Sie war sogar zu schwach, um einen Strumpf zu halten. Ich hatte nicht gewusst, wie anstrengend es sein konnte, jemanden anzuziehen. Das war in etwa so, wie einen nassen Zentnersack in eine hautenge Plastiktüte zu quetschen. Dabei wog Elizabeth garantiert keinen Zentner. Nicht mit dieser beneidenswerten Taille. Sie hing kraftlos in meinen Armen und Brandon musste helfen, ihr das Shirt überzustreifen.
Die Krankenschwester kam nach ein paar Minuten und starrte uns fassungslos an.
»Was ist denn hier los? Sie dürfen noch nicht aufstehen.«
»Wir nehmen sie mit. Bitte entfernen Sie die Schläuche und machen Sie einen festen Verband«, sagte Brandon in einem Befehlston, den ich noch nie an ihm gehört hatte. Ich hätte strammgestanden.
»Ich muss den Doktor rufen.« Die Schwester verschwand und Brandon wollte bereits selber Hand an die Braunüle anlegen.
Ich hielt ihn entsetzt zurück. »Warte! Lass das den Arzt machen. Du könntest die Vene verletzen, und dann hat sie innere Blutungen. Oder es gelangen Bakterien in die Wunde und sie bekommt eine Blutvergiftung. Wir dürfen sie die nächste Zeit nicht mehr zum Arzt bringen und Dr. Adams wird uns aus wohlbekannten Gründen vorläufig auch keine Hilfe sein.«
»Meredith!«, unterbrach er meinen Redeschwall und ich stand stramm. »Redest du immer ohne Punkt und Komma, wenn du Angst hast?«
»Ja. Immer wenn ich nervös bin. Und du machst mich nervös«, sagte ich ehrlich. Brandons Erscheinung ließ jedes weibliche Wesen im Umkreis wie ein aufgeregtes Huhn umherflattern, aber ausnahmsweise hatte ich in diesem Fall seine nicht vorhandenen medizinischen Kenntnisse gemeint. »Also, nicht du … sondern die ganze Situation macht mich … Und dabei dachte ich immer, Lansbury wäre ein so ruhiges und beschauliches Städtchen und ich würde erst ein wenig Aufregung erleben, wenn ich studieren ginge, nach Bath oder Bristol oder …«
»Meredith!«
»Gut, ich bin schon ruhig. Aber ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass ich es besser fände, wenn ein Arzt …«
»Unsinn.« Er zog bereits die Nadel aus Elizabeths Arm. Sie zuckte nicht mal. Ihre Augen waren auch schon wieder geschlossen und ich fühlte besorgt nach ihrem Puls. Ich fand ihn nicht.
»Da ist kein Puls!«, rief ich leicht panisch. Brandon legte zwei Finger an Elizabeths Hals. Als er ihre Haut berührte, sah ich ein flüchtiges Lächeln über sein Gesicht huschen. Dann nickte er. »Doch. Aber er ist ziemlich schwach. Sie ist wieder ohnmächtig.«
Vielleicht hatte ich die Krimiserien gesehen. Er auf alle Fälle die Arztserien. Denn es sah richtig professionell aus.
»Grey’s Anatomy«, sagte er auch prompt mit einem halbherzigen Grinsen in meine Richtung. »Ich liebe eure moderne Medizin.«
»Yep. Und die Hauptdarstellerin ist blond«, seufzte ich matt.
Ich brachte den zuständigen Arzt dazu, die Entlassungspapiere auszustellen, und fälschte meine Unterschrift darauf mit dem zweitbesten Namen, der mir nach Colin einfiel: Shelby Miller.
Sie war eine Mitschülerin vom College und eine der dämlichsten Personen, die ich kannte. Sollte Cromwell doch bei ihr nach Elizabeth suchen. Das Gezeter würde ich dann allerdings gern mitbekommen.
ERINNERUNGEN
»Mal sehen, ob der auch schwebt.«
Der Junge hielt einen Fisch in die Höhe. Das Mädchen kicherte. Wenig später schwebte das Tier unter der Zimmerdecke. Dort befand es sich in bester Gesellschaft mit einem Modellflugzeug, einem Lego-Hubschrauber, dem Foto der verstorbenen Großeltern, einem Usambara-Veilchen samt Übertopf und weiteren Dingen, die hier im Wohnzimmer verstreut herumlagen. Das Mädchen wusste, dass ihr Bruder mit ihr spielte. Erst hatte er nur Gegenstände hochgehalten, die normalerweise fliegen konnten, dann die Blumen oder das gerahmte Foto.
»Ein Holzscheit kann nicht fliegen. Nie und nimmer«, neckte er sie. Das war sein Spiel: Dinge zum Schweben bringen, die nicht fliegen konnten.
Das Mädchen kicherte wieder und sah zum Kamin. Doch das Brennholz begann nicht durch die Luft zu schweben, sondern fing mit einem Mal Feuer. Der Junge sprang auf. Fast gleichzeitig begannen alle Kerzen auf dem Wohnzimmertisch zu brennen.
In diesem Moment kam die Mutter herein. Sie starrte auf die Kerzen und den Kamin. Und dann glitt ihr Blick zur Decke.
Erschrocken schrie sie auf.
Sogleich holte die Schwerkraft die Gegenstände wieder ein und alles landete auf dem Boden.
Das Glas des gerahmten Fotos zersprang.
4. Kapitel
Chris holte uns vom Krankenhaus ab. Er trug noch sein Sachsenkostüm und sah darin Chris Hemsworth in seiner Thorkleidung recht ähnlich. Leider wusste Chris das auch und hatte bewusst ein Hemd mit offenem Schnitt bis zum Bauchnabel gewählt. Seit er dreizehn war, versuchte er mit diesem Kostüm die Mädchen von Lansbury zu beeindrucken und seit zwei Jahren schleppte er immer wenigstens eine damit ab. Letztes Jahr hatte er jeden Abend eine andere im Arm gehabt.
Elizabeth mit ihren üppigen roten Locken, den hellgrünen Augen und ihren Rundungen an genau den richtigen Stellen entsprach voll und ganz seinem Beuteschema. Nicht dass Chris wählerisch war, was die Haarfarbe betraf (anders als Brandon, der Blondinen den Vorzug gab), aber die Mädchen mussten Klasse haben (oder angesagte It-Girls mit der Körbchengröße Doppel-D nachahmen). Elizabeth hatte Klasse. Vielleicht war sie im Moment zu schwach, aber wenn sie gesund war, konnte man das deutlich bis in den hintersten Winkel eines Raumes voller Menschen spüren. Ebenso wie ihr Temperament. Und davon besaß sie meiner Meinung nach viel zu viel. Aber sie würde Chris schon zeigen, wie weit er gehen durfte.
Und eines war auch gewiss: Chris war ein Gentleman. Er hatte sich noch nie einem Mädchen aufgedrängt, das ihn nicht auch wollte. (Zum Glück hatte er so viel Auswahl, dass das auch noch nie nötig gewesen war.)
Elizabeth war immer noch kreidebleich, als wir sie in dem Gästezimmer des jahrhundertealten Herrenhausees ins Bett bugsierten. Sie redete nicht und schlief sofort ein.
Brandon stellte ihr Schmerzmittel und Wasser griffbereit auf den Nachttisch.
»Meredith, kommst du mal bitte?«
Chris war erstaunlich energisch, als er mich am Arm aus dem Zimmer zog. Kaum dass die Tür zu war, deutete er darauf.
»Was ist mit ihr? Sie sieht furchtbar aus!«
»Ich weiß. Sie ist wirklich schwer verletzt und hat Schmerzen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass sie noch immer in Lebensgefahr schwebt, würdest du mir das glauben?«
»Ohne zu zögern«, antwortete Chris mit ungewohnter Ernsthaftigkeit.
»Vielleicht sollte ich mich klarer ausdrücken. Sie schwebt nicht physisch in Lebensgefahr. Jemand ist hinter ihr her. Deshalb darf niemand erfahren, dass sie bei dir ist«, sagte ich leise und sah mich um. Mein Blick fiel auf den Kronleuchter im offenen Treppenhaus und mir wurde bewusst, dass Cromwell nicht in der Nähe sein konnte. Also sprach ich in normalem Ton weiter.
»Cromwell hat nicht die Wahrheit gesagt. Er hat versucht Elizabeth umzubringen.«
Chris’ Augen brannten sich in meine. »Meredith, bist du dir sicher?«
Mir fiel sofort auf, dass er nicht direkt So einQuatsch, oder: Nie im Leben Everybodys-Darling-Cromwell sagte.
»Ich bin mir sicher«, antwortete ich, so fest ich konnte, und jetzt erzählte ich Chris den genauen Ablauf des Vorfalls – ließ dabei nur die Sache mit den Elementträgern und der Gianidin raus. Das klang sogar in meinen Ohren zu verrückt. Dabei glaubte ich das Ganze auch nur, weil ich es von Colin seit jeher kannte.
Chris’ zusammengezogene Augenbrauen konnten sich während meiner Erzählung nicht noch weiter hochziehen, sonst hätten sie den Haaransatz erreicht.
Er schluckte.
»Meredith, wenn das …« Er stockte und seine Stimme klang rau. Anscheinend hatte es ihm die Sprache verschlagen.
»… wahr ist? Natürlich ist es wahr«, vollendete ich den Satz für ihn.
»Nein, ich meine, wenn das rauskäme, wäre der Teufel los. Cromwell ist ja irre! Wir müssen zur Polizei!«
Und genau da war der Haken an der Geschichte.
»Nein!«, unterbrach ich Chris. »Bitte, bitte nicht. Keine Polizei, kein Wort zu irgendjemandem. Wir müssen Elizabeth nur so lange verstecken, bis es ihr wieder gut geht, und dann werden wir versuchen sie zu ihrer Familie zurückzuschmuggeln.«
Zu ihrer Familie ins sechzehnte Jahrhundert. Das würde eine knifflige Aufgabe werden, denn bislang hatten wir nicht einen einzigen Anhaltspunkt.
»Aber wir sprechen von Stuart Cromwell!«, wandte Chris ein und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. »Mein Vater hat einigen Einfluss, wie du weißt, aber im Gegensatz zu Cromwell ist er ein kleines Licht.«
Ich zögerte einen Moment, aber meine Neugier war einfach zu groß: »Wie kommt es, dass du mir glaubst? Jeder andere würde über eine solche Anschuldigung nur müde lächeln.«
Chris schnaubte. »Du vergisst, wessen Sohn ich bin. Mein Dad behauptet immer, man kann nicht so erfolgreich sein wie Cromwell, ohne ein paar Leichen im Keller zu haben. Ich frag Dad gar nicht, welche Leichen hier liegen, aber er hat sich schon immer über Cromwells kometenhaften Aufstieg gewundert. Taucht aus dem Nichts auf und schafft in wenigen Jahren etwas, für das Vater Jahrzehnte brauchte, und noch viel mehr.« Chris grinste boshaft. »Keine Sorge, Meredith, niemand wird was von Elizabeths Anwesenheit hier erfahren. Dad wäre überglücklich, Cromwell endlich eins auswischen zu können. Und sei es nur, jemanden zu verstecken, den er haben will.«
Doch dann sah er mich alarmiert an. »Was ist mit Shakti und Rebecca?«
»Die möchte ich auch nicht an ihn ausliefern«, versuchte ich zu scherzen. Chris’ Lächeln fiel sehr matt aus.
Ich zögerte. »Ich fände es besser, wenn sie erst mal nichts davon erfahren würden.«
Beide gehörten zu unserem engsten Freundeskreis. Rebecca war die Tochter von Vikar Hensley, der unter dem Beichtgeheimnis stand und das äußerst ernst nahm. Leider hatte sie diese Verschwiegenheit nicht von ihrem Vater geerbt. Ihr rutschte öfter mal etwas raus.
Shakti Narayan wollte zwar in die Fußstapfen ihrer indisch wurzelnden Eltern treten und Anwältin werden, aber die Grundvoraussetzung dazu fehlte ihr: Sie konnte partout nicht lügen.
Chris presste die Lippen aufeinander. Er mochte mit seinen Mädchen umgehen, wie es ihm gerade beliebte. Nicht selten schwor er einer, sie habe die schönsten Augen, die er je gesehen hätte, nur um in der nächsten Woche einer anderen den gleichen Schwur zu leisten. Aber uns – seinen Freunden – gegenüber war er immer aufrichtig, denn er hasste es Geheimnisse zu haben. Leider. Ich wollte nicht wirklich immer alles hören, was er manchmal berichtete. Doch in diesem Fall …
»Die beiden sind ab morgen für drei Wochen im Urlaub. Du brauchst sie also nicht anzulügen, du behältst Elizabeths Aufenthalt einfach nur für dich, wenn sie anrufen, um sich zu verabschieden«, sagte ich schnell. »Wer weiß, was sich bis zu ihrer Rückkehr ergeben hat. Einundzwanzig Tage … da sollten wir einen Schritt weiterkommen. Oder ist dir das zu lange?«
»Nein, nein. Sie kann auch länger bleiben, ich werde dieses Jahr nicht zu meiner Tante an die Côte d’Azur fahren«, wehrte er ab. Er stockte ein wenig und sah zähneknirschend zu Boden. »Nur heute ist es ungünstig.«
Ich sah ihn betroffen an. Ich hatte mich auf ihn verlassen. Meine Kopfschmerzen machten sich langsam wieder bemerkbar und außerdem war ich erschöpft. »Aber du hast doch gesagt, sie könnte hierbleiben.«
»Ja, schon«, gab er zerknirscht zu. »Aber da wusste ich auch noch nicht, dass sie einen Krankenpfleger braucht. Ich erwarte noch Besuch. Weiblichen Besuch, ehrlich gesagt. Da war diese blonde Kriegerin auf dem Sachsenfest. Die trug ein Fell so gekonnt drapiert über ihren …«
Chris machte eine eindeutige Geste.
Ich konnte nicht anders. Mir fiel die Kinnlade herunter.
»Aber du hast doch gerade gehört, dass niemand …«
»Bleib locker, Meredith«, unterbrach mich Chris, der wusste, wie weit ich ausholen konnte. »Ich hatte gedacht, Elizabeth könne hierbleiben und fernsehen oder Playstation spielen oder so was. Aber sie braucht jemanden, der sich rund um die Uhr um sie kümmert.«
Da hatte er nicht Unrecht. Er nahm sie schon auf und ich konnte schwerlich verlangen, dass er sie auch noch bemutterte. Sie konnte in diesem Zustand nicht mal alleine aufs Klo gehen. Ich würde hierbleiben müssen. Doch ich wusste, wenn ich bliebe, würde ich mich neben sie in dieses riesige Himmelbett legen und wie eine Tote schlafen. Ich würde nicht hören, wenn ein MI-5-Kommando ins Zimmer stürmte, geschweige denn eine Pistole mit Schalldämpfer benutzt wurde.
»Ich werde bei ihr bleiben«, sagte hinter mir Brandon. Wir drehten uns beide zu ihm um.
Er sah auch müde aus, aber entschlossen.
»Wir haben dir schon deine Gastfreundschaft zu verdanken, den Babysitter brauchst du nicht auch noch zu spielen«, fügte er hinzu.
Chris sah erleichtert aus. »Na dann … Soll ich dich heimfahren, Meredith? Im Moment siehst du nämlich fast genauso aus wie Elizabeth.«
»Du meinst damit bestimmt nicht ihre betörend grünen Augen und ihre Taille«, hauchte ich erschöpft.
»Klug wie immer, unser kleines Genie. Allerdings riechst du wesentlich strenger«, fügte er schnüffelnd hinzu. Er klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, ehe er nach dem Autoschlüssel in seiner Hosentasche fischte.
Erst als ich im Auto saß, fiel mir ein, dass ich mich bei Brandon noch gar nicht für die Rettung bedankt hatte.
Morgen. Morgen würde ich alles nachholen.
5. Kapitel
Als ich die Haustür aufschloss, wollte ich sofort nach oben gehen. Schlurfen würde es eher treffen.
In der Küche brannte Licht. Mum war also auch nicht mehr auf dem Sachsen-Festival.
»Ich habe Kopfschmerzen und geh ins Bett«, rief ich matt in Richtung Küche. Allerdings so leise, dass ich mir nicht sicher war, ob sie das gehört hatte.
Doch sie hatte.
»Meredith?«
Ich hielt mitten in der Bewegung inne. Mein Bein schwebte über der zweiten Stufe. Da stimmte etwas nicht. Mums Stimme klang zittrig. Ängstlich und erschüttert.
Ich verdrängte meine Kopfschmerzen und meine Müdigkeit und eilte in die Küche.
Mum saß am Küchentisch. Ihr Gesicht war tränenüberströmt.
»Mum, alles ist gut. Mir geht es gut«, sagte ich und wollte sie in den Arm nehmen, als ich eine Gestalt neben dem Kühlschrank wahrnahm.
Dad.
Er war in den vergangenen Jahren ein wenig fülliger um die Mitte geworden – was nicht zuletzt an dem vielen Alkohol lag, den er am Wochenende immer in sich hineinkippte, und an seinem Beruf als Lkw-Fernfahrer. Jetzt sah er mich mit einem leicht panischen Ausdruck in den Augen an.
»Hey, Dad!«, sagte ich verhalten.
Was wollte er jetzt hier? Er hätte schon Freitag hier sein sollen. Pünktlich zu meinem großen Auftritt mit der Brassband zur Eröffnung des Sachsen-Festivals. War das wirklich erst gestern gewesen? Aber egal.
In der letzten Zeit war er immer weniger zu Hause gewesen, aber an dem einen großen Konzert unserer Band hätte er da sein müssen. Denn die nächsten vier Wochen war Pause. Keine Proben, kein Auftritt. Das musste sich doch einrichten lassen! Ich wollte ihm das alles an den Kopf werfen und endlich ins Bett gehen. Doch Mums verzweifelter Gesichtsausdruck hielt mich davon ab.
Dad räusperte sich und deutete auf den Stuhl Mum gegenüber.
»Meredith, setz dich bitte. Deine Mutter und ich müssen mit dir reden.«
Durch meine verschmierte Brille sah ich, dass Dad ausnahmsweise einmal komplett nüchtern war. Seine Haare waren ordentlich gekämmt, weshalb seine Geheimratsecken nicht so extrem auffielen, und er war rasiert. Überhaupt wirkte er seit langem mal wieder gepflegt. In meinem Magen machte sich ein Loch breit. Noch breiter als das, das sich beim Anblick von Cromwells Pistole aufgetan hatte.
Langsam, zeitlupengleich, ließ ich mich nieder und schob die Brille an ihrem Steg hoch. Umsonst, sie saß schon oben.
»Du hast eine neue Frisur.«
Er hatte mich seit Wochen nicht mehr gesehen. Ob es ihm vorher aufgefallen wäre, war auch fraglich, denn in der Regel kam er freitagnachmittags nach Hause, um sich bis Sonntagmorgen zu betrinken und Sonntagabend oder Montagmorgen wieder loszufahren.
Bis vor vier Wochen hatte ich immer den gleichen schulterlangen Bob gehabt. Mit meinen glatten dunklen Haaren ließ sich nicht viel machen – hatte ich zumindest immer gedacht, bis Chris mich zu einem anderen Friseur geschleift hatte. Dort hatte man meine Haare, ohne zu fragen, bis zum Kinn durchgestuft und im Nacken sogar ein wenig rasiert. Das Ergebnis war für alle anderen »toll«, »modisch« und »chic«. Adjektive, die man mit mir bislang nicht wirklich verbinden konnte.
Mum hatte ein paar Tage gebraucht, um mich richtig ansehen zu können, und es wunderte mich nicht, dass es für Dad ein ebenso großer Schock war.
Wollte er mich jetzt bitten, mir wieder eine andere Frisur zuzulegen oder die Haare zu färben oder so was? Doch seine Worte gingen in eine ganz andere Richtung.
»Meredith, ich werde ausziehen«, sagte Dad. »Ich habe eine neue Arbeit in Manchester. Ich will nicht länger Lkw fahren. Der Rechtsverkehr auf dem Kontinent wird mir zu anstrengend. Ich habe einen Job bei einem Fernsehsender als Lagerarbeiter gefunden. Ich muss mich noch um eine Wohnung kümmern, deswegen fahre ich schon morgen da hoch.«
Die Erschöpfung und Ereignisse der letzten Stunden vernebelten ein wenig mein Gehirn. Hatte mein Dad gerade gesagt, wir würden nach Manchester ziehen? So spontan? Ich brauchte mir nicht die Haare zu färben?
»Dad, mein Kopf tut weh und ich habe ein paar wirklich anstrengende Tage hinter mir«, sagte ich endlich. »Also bitte, erklär mir genau, warum wir nach Manchester ziehen sollen. Und warum muss das jetzt so schnell gehen? Kann ich nicht noch wenigstens meine A-Levels fertig machen?«
Ich rieb mir die Schläfen. Das brachte nicht wirklich viel. Meine Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Ich nahm die Brille ab. Auch ohne konnte ich erkennen, dass Dads Gesicht noch genauso ernst aussah und Mums Tränen nicht weniger wurden.
»Meredith, mein Schatz …«
Alarmiert sah ich auf. So hatte Dad mich nicht mehr genannt, seit ich auf seinen Schoß geklettert war, um mir vorlesen zu lassen.
»Ich werde allein nach Manchester ziehen. Mum und du, ihr bleibt hier.«
Irgendwas in der Gleichung passte nicht, überlegte ich.
Denk nach, Meredith, denk nach. Mathe liegt dir doch. Die Quadratwurzel aus 387 ist 19,672315, und wenn ich ausrechne, dass Cromwells Pistolenkugel durch den Schalldämpfer mit einer verringerten Geschwindigkeit von etwa 350 Metern pro Sekunde abgeschossen wird mit einem Luftdruck von 2350 bar, erfolgt der Aufprall … Was tat ich hier?
Meredith, reiß dich zusammen! Diese Rechnung hat nichts mit Dad zu tun.
Ich sah zu Mum. Sie hatte ihr Gesicht mittlerweile hinter ihren Händen verborgen.
Und endlich kapierte ich.
»Ihr trennt euch …«, murmelte ich.
Ich hörte Dad nur noch Ja sagen, dann kippte ich vom Stuhl. Mein letzter Gedanke war, dass eine Pistolenkugel und Dad vielleicht doch ganz nett in einem Satz klangen.