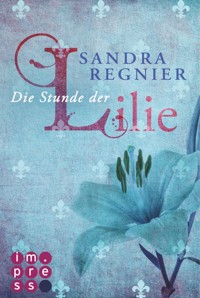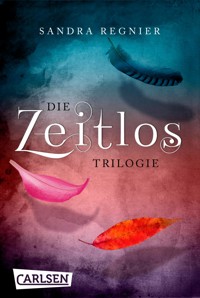
Die Zeitlos-Trilogie: Band 1-3 der romantischen paranormalen Fantasy-Buchreihe im Sammelband! E-Book
Sandra Regnier
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Alle drei Bände der spannenden, romantischen Zeitlos-Trilogie jetzt als E-Box: Das Flüstern der Zeit / Die Wellen der Zeit / Die Flammen der Zeit Platzregen und Sturmwinde gehören für die englische Kleinstadt Lansbury und damit für die 17-jährige Meredith zum Alltag. Doch diese Gewitternacht ist anders. Unheimliche Kornkreise tauchen am Ortsrand auf, unerwartete Gestalten suchen Lansburys Steinkreis heim und dann ist da noch Merediths bester Freund Colin, der sie genau in dieser Nacht küsst und mit dem nun nichts mehr so ist, wie es war. Irgendetwas ist in dieser Nacht passiert, irgendetwas, das Zeit und Raum kurzfristig aufgehoben hat. Und ausgerechnet Meredith ist der Schlüssel zum Ganzen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Außerdem von Sandra Regnier im Carlsen Verlag:Die Pan-Trilogie
Außerdem von Sandra Regnier bei Im.press als E-Book:Die Lilien-Reihe
www.bittersweet.deCarlsen-Newsletter: Tolle Lesetipps kostenlos per E-Mail!Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de.
Alle Rechte vorbehalten.Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Veröffentlicht im Carlsen VerlagCopyright © 2015, 2016, 2017 Carlsen Verlag GmbH, HamburgText © Sandra Regnier 2015 (Das Flüstern der Zeit) / 2015 (Die Wellen der Zeit) / 2016 (Die Flammen der Zeit)Covermotive: shutterstock.com © happykanppyIlona5555/pun/bawan/boonchob chuaynumCovergestaltung: formlaborSatz und E-Book-Umsetzung: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinISBN 978-3-646-92817-4
Für unsere MütterRita und Luise
Prolog
Auch nach all den Jahren, die er bereits in diesem Zeitalter lebte, erstaunte es ihn immer wieder, wie sorglos die Menschen hier doch waren.
Alles war anders, und obwohl er sich schon an vieles gewöhnt hatte, gab es immer noch mehr, das ihn aufs Neue beeindruckte. Die Gerüche zum Beispiel. Hier roch fast alles gut und blumig. Die Frauen, die Seifen, die Wäsche, sogar die Toiletten.
Die Musik war seltsam rhythmisch, hart und exotisch. Sein Gehör hatte sich daran gewöhnt, aber mit dem modernen Tanzstil konnte er sich immer noch nicht anfreunden. Ganz im Gegensatz zu dem angenehmen Licht und den Mädchen, die in dieser Zeit wesentlich schöner waren als in der, in die er hineingeboren worden war. Heute Abend war die Musik lauter als normal und das Licht blinkte irritierend bunt über die Wände, verstärkt durch eine Spiegelkugel an der Decke.
Ein Mädchen mit langen, blonden Haaren lächelte ihn an. Ihre Lippen waren blutrot geschminkt und glänzten vielversprechend. Ihre Augen musterten ihn interessiert. Das war nicht ungewöhnlich. Sowohl in dieser Zeit als auch in seiner. Er hatte immer die Blicke der Frauen auf sich gezogen. Nur war in seiner Zeit ziemlich schnell eine Anstandsdame zwischen diese Blicke getreten.
Ja, er mochte die Frauen in diesem Zeitalter. Sie waren herrlich unkompliziert und entsprachen genau seinem Geschmack. Nicht wie die aus seiner Heimat, wo er höchstens mit den verheirateten hatte flirten können. Deren Töchter waren für ihn, den Zweitgeborenen, tabu gewesen.
Er lächelte zurück und sie begann sich im Takt der Musik aufreizend zu bewegen.
In seinem Innern zog sich etwas zusammen.
Das Mädchen tanzte langsam auf ihn zu. Ihr Blick war auf ihn fixiert. Sie bewegte ihre Hüften, ließ sie kreisen, hob die Arme über den Kopf. Das Shirt spannte über ihrer Brust.
Er spürte Flüssigkeit auf seine Hände tropfen.
Das Glas auf der Theke neben ihm war zersprungen. Das Bier lief durch die Scherben direkt auf seine Hände hinunter.
Er atmete tief durch und versuchte sich zu sammeln, damit nicht noch mehr Gläser zu zerspringen begannen.
»Hallo!« Die Blondine hatte ihn erreicht. Im schummrigen Licht konnte er sehen, dass ihre Wimpern unnatürlich dunkel und dicht waren. Aufregend. Sie roch nach einem schweren Parfüm, und obwohl sie schwitzte, roch sie sauber. Blumig. Angenehm.
»Wartest du auf jemanden?«
Er lächelte. »Nur auf dich.«
Sie krallte eine Hand in sein Shirt und zog ihn mit sich zur Tanzfläche. Dort schmiegte sie sich eng an ihn, die Arme auf seine Schultern gelegt. Er versuchte wie immer den direkten Hautkontakt zu vermeiden und umfasste deshalb die von einem engen Top umhüllte Mitte. Er hatte schon festgestellt, dass die meisten diese Berührung noch mehr mochten als Händchenhalten. Davon abgesehen vermied er das Händchenhalten immer.
Er versuchte ihren langsamen Schritten zu folgen, hob sie hoch, wie bei einer … Er stockte. Beinahe ließ er das Mädchen fallen. Das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Hinter ihr, direkt ihm gegenüber schwebte eine Flasche über einer Musikbox.
»Wow, du bist ganz schön stark.«
Die Blondine umfasste seine von langen Ärmeln bedeckten Oberarme und drückte sie. Wenn sie wüsste, woher seine Muskeln stammten.
Er ließ das Mädchen in seinen Armen langsam zu Boden gleiten und zog sie dicht an seinen Körper. Im Schutz ihres langen, blonden Haares konnte er unter halb geschlossenen Lidern alles genau beobachten. Eine Hand griff nach der schwebenden Flasche. Eine zarte Hand. Sie gehörte dem Mädchen mit dunklem Pagenschnitt und einer dicken Brille. Er kannte sie. Er kannte sie seit seinem Eintreffen vor fünf Jahren, so wie er die meisten Menschen hier kannte. Sie war um einiges jünger als er und immer in Begleitung. Sie hatte nie besonders gewirkt. Bis jetzt. Er konnte sehen, wie sie sich besorgt umblickte und dann den Jungen an ihrer Seite in die Rippen knuffte.
Der Junge hatte ebenso dunkles, jedoch strubbeliges Haar und war einen Kopf größer als sie. Auch er war ihm bekannt. Das Mädchen, weit von der Schönheit entfernt, die sich eng an ihn schmiegte, aber doch irgendwie interessant, ließ die Flasche fallen. Doch anstatt dass sie am Boden zerbrach, blieb sie kurz vorher schon wieder in der Schwebe hängen. Abermals sah er das Mädchen den Jungen knuffen und jetzt schlug die Flasche auf den Boden auf. Wo sie vollkommen aufrecht stehen blieb. Das Mädchen bückte sich, wurde von jemandem angerempelt und verlor das Gleichgewicht. Die Flasche kippte um.
Er hätte gelacht, wenn die Situation nicht so brisant gewesen wäre.
Ihr Begleiter half ihr auf die Beine und er konnte genau erkennen, dass er dem Mädchen dabei nicht die Hand reichte, sondern sie über ihrem langärmligen Pulli am Ellbogen fasste und hochhob. Für jeden anderen musste es sehr behutsam wirken, aber für ihn, der etwas ahnte, schien es, als würde der Junge eine direkte Hautberührung vermeiden wollen. So wie er sie auch gern vermied. Er sah, wie der Junge sich zu dem Mädchen hinunterbeugte, als wolle er sie küssen.
Genau in diesem Moment ging das Licht aus, die Musik verstummte abrupt und in das Aufstöhnen der Anwesenden mischte sich ein Donnergrollen von außen. Auch das noch. Ein Stromausfall.
»Hast du Angst?«, fragte das Mädchen in seinen Armen, das er in der plötzlich eingetretenen Dunkelheit nicht mehr sehen konnte. Er spürte ihre Hand in seinem Haar und ihre Lippen an seinem Kinn. Bis jetzt waren es zum Glück nur die Lippen.
»Nein«, antwortete er nicht ganz ehrlich. Feuerzeuge flammten auf, aber deren spärliches Licht machte die Dunkelheit nur noch schwärzer. Dennoch nahm er wahr, dass das Mädchen mit der Brille und der dunkelhaarige Junge verschwunden waren.
Er schob die Blondine in seinen Armen zurück.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nur ein Gewitter«, sagte sie und versuchte ihn wieder an sich zu ziehen. Dabei rutschte ihre Hand in seinen Nacken und sie berührte seine Haut. Er schüttelte sie ab, als habe ihre Berührung ihn verbrannt. Er musste weg. Er musste hier raus. Er musste das dunkelhaarige Pärchen finden.
Ein Donnerschlag krachte und er fühlte, wie er seine Kontrolle verlor. Panisch drängte er sich durch die Menge. Dabei konnte er den einen oder anderen Hautkontakt nicht verhindern. Bilder blitzten vor seinen Augen auf. Bilder, die er gern vermieden hätte. Und dann ertasteten seine den Weg suchenden Finger eine Hand. Im selben Moment donnerte es wieder mit voller Kraft. Die Wände schienen unter dem Knall zu beben. Die Feuerzeuge gingen aus. Und dennoch hatte ihn die Angst verlassen.
Die Empfindung, die ihn mit einem Mal durchströmte, war … schier überwältigend. Sanftmut. Reinheit. Ehrlichkeit. Aber vor allem ein überschwängliches Gefühl von Liebe, das sein Herz schier zerplatzen ließ. Wenn er vorhin noch gedacht hatte, er würde diese leichtlebigen Mädchen mögen, die sich unkompliziert und ohne große Gefühle auf kleine Abenteuer einließen, so widerrief dies seine eigene Einstellung schlagartig. Er fühlte Wärme und Geborgenheit, mehr als je zuvor in seinem Leben. Warum konnte er nicht erkennen, wer es war? Er konnte doch sonst immer die Gesichter sehen, die hinter den Empfindungen standen.
Jetzt donnerte es erneut und ihm wurde klar, dass dieses Gewitter eine besondere Kraft besaß. Eine Kraft, die seine schwächte. Ein zweiter Donner krachte, aber der Strom setzte wieder ein. Mit ihm die Musik und das Licht.
Gespannt blickte er zur Seite, doch neben ihm befand sich niemand mehr. Nur die Tür nach außen war angelehnt. Und die leere Bierflasche rollte auf dem Boden daneben umher.
Mit einem mulmigen Gefühl sah er zur Tür hinaus. Mulmig war noch zu nett ausgedrückt. Er fühlte eher einen Magenhieb. Es gab noch jemanden wie ihn. Jemanden, der sich als gefährlich entpuppen konnte. Und leider ließ es sich nicht ganz deutlich sagen, ob es sich um das Mädchen oder den Jungen handelte. Und welche Konsequenzen es für sein Dasein in dieser Zeit hatte.
1. Kapitel
Ich starrte in den Spiegel.
Sah ich anders aus? Fahrig strich ich über die paar verwirrten Strähnen in meinen schulterlangen Haaren, bis sie alle glatt und gleichmäßig lagen. Um es genau überprüfen zu können, setzte ich meine Brille auf und kontrollierte mein Spiegelbild, indem ich den Kopf einmal nach links und dann nach rechts drehte. Fast gleichmäßig. Die Strähne links drehte sich stets nach außen, nie nach innen. Ansonsten sah ich aus wie immer. Eine dunkelhaarige, nicht sehr spektakuläre Siebzehnjährige. Genau so wie vorgestern auch.
Allerdings fühlte ich mich nicht so.
Hätte nicht irgendwas anders sein müssen? Ein Leuchten? Ein Strahlen? Hinter den Gläsern meiner Hornbrille sah ich die gleichen grünen Augen wie immer. Kein besonderes Strahlen. Kein Funkeln. Nein, nichts leuchtete.
Warum auch? Ein Kuss löste ja keine wirkliche biologische oder chemische Veränderung im Körper aus.
Oder ich hatte einfach den Falschen geküsst.
»Meredith! Ich muss zur Arbeit! Bis heute Mittag!«
Mums Stimme tönte von unten und riss mich aus meinen Gedanken. Ein Blick auf die Uhr besagte, dass ich jetzt ebenfalls lossollte.
Ich schaute in den Spiegel. Wenigstens die Lippen hätten doch anders sein können. Ein wenig voller, Angelina-Jolie-mäßiger statt meines Kirsten-Dunst-Schmalmunds.
Enttäuscht wandte ich mich ab, schnappte mir meinen Rucksack, den ich wegen der vielen Hefte und Bücher nie zubekam, und lief die Treppe hinunter. Unten musste ich gleich wieder eine Vollbremsung hinlegen, denn sonst wäre ich mit Mum zusammengestoßen, die bereits an der Haustür stand. Und natürlich flogen durch den abrupten Halt sämtliche Bücher aus meinem Rucksack.
»Verdammt.«
»Man flucht nicht. Das bringt Unglück«, tadelte mich Mum sanft, bückte sich, sammelte die Bücher ein und schob sie so ordentlich in meinen Rucksack, dass er sich zum ersten Mal seit Wochen wieder schließen ließ.
»Ich gehe nur den halben Tag arbeiten«, erklärte sie dann und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Mach’s gut.«
Kaum war sie aus der Tür, eilte ich in die Küche, schnappte mir das von Mum bereitgelegte Sandwich und die Trinkflasche und verließ ebenfalls das Haus. Jetzt war ich wirklich knapp dran. Mist.
Unterwegs ließ ich den Samstag noch einmal Revue passieren und stolperte prompt über eine Unebenheit im Bürgersteig. Meine Trinkflasche fiel zu Boden.
»Man hört schon, wer da geht«, sagte eine wohlbekannte Stimme hinter mir. Ein helles Lachen folgte.
Dann holte Shakti mich ein. Ihre tiefschwarzen Haare fielen ihr glatt und glänzend bis auf den Po hinunter und ihre indische Herkunft wurde wie immer durch die farbenfrohen Klamotten und großen Ohrringe unterstrichen. Shakti und ich kannten uns schon seit der Einschulung und waren seitdem gut befreundet. In der Secondary School waren wir sogar noch enger zusammengerückt. Ohne sie und den Rest unserer Clique wäre mein bisheriges Leben undenkbar langweilig gewesen.
»Meredith Wisdom, wann lernst du endlich beim Gehen auf den Boden zu schauen, statt mit dem Kopf in der nächsten Physikformel zu hängen?«
»Hab ich nicht«, antwortete ich und schob meine verrutschte Brille wieder zurück aufs Nasenbein.
»Bei jedem anderen Mädchen würde ich ja behaupten, sie denke an einen Jungen. Aber da du es bist, bleibt höchstens noch die Mathematik. Ehrlich, du entsprichst dem Prototyp des zerstreuten Professors. Ich möchte einmal einen Tag erleben, an dem du nichts umschmeißt oder stolperst.«
»Na, vielen Dank auch«, sagte ich und hoffte damit meine Verlegenheit überspielen zu können. Sie hatte ja keine Ahnung, wie sehr sie gerade mitten ins Schwarze getroffen hatte. Wenngleich der Junge, an den ich dachte, sie mit Sicherheit überrascht hätte.
»Nicht böse sein, Meredith.« Sie tätschelte mir jovial den Rücken. »Irgendwann kommt bestimmt auch für dich der Richtige. Der, der mit dir gemeinsam Einsteins Relativitätstheorie überarbeitet und mit dem du dann im Schweizer CERN atomare Teilchen beschleunigen kannst.«
»Eigentlich hatte ich vor, einen Engländer zu heiraten und drei Kinder in die Welt zu setzen, um denen dann bei den Hausaufgaben helfen zu können, die alle anderen nie hinbekommen.«
Ich hörte Shakti seufzen. »Das war ein Scherz, Meredith.«
Ich grinste. »Das weiß ich doch. Ich habe auch einen Witz gemacht.«
Sie sah mich an und grinste dann unsicher zurück. Obwohl sie nicht humorlos war, war jeglicher Sarkasmus in ihrer Gegenwart eine vollkommene Verschwendung.
»Trägt Michael dich noch auf Händen?«, wechselte ich das Thema. Auch wenn es etwas gemein war, es klappte jedes Mal, Shakti auf ihren aktuellen Freund anzusprechen, wenn man das Thema wechseln wollte. In jenen war sie nämlich immer schrecklich verliebt und nach ein paar Monaten ganz schrecklich unglücklich, nur um letztendlich einen neuen absolut wunderbaren Jungen kennenzulernen. Michael war zwei Jahre älter als wir und ihr Traumboy Nr. 5 – wenn ich richtig mitgezählt hatte. Als wir das College erreichten, hatte mir Shakti quasi in Echtzeit ihr letztes Telefongespräch mit ihm geschildert.
Im Schulgebäude herrschte viel Betrieb. Auch wenn manche Kurse erst später anfingen, meine A-Level-Kurse begannen – leider – alle pünktlich um halb neun. Genau wie an der Secondary School früher. Shakti konnte drei Mal die Woche länger schlafen, weil sie andere Kurse besuchte. Ich hätte mich vielleicht auch lieber in Richtung Rechtswissenschaften orientieren sollen. Aber andererseits … Mathe und Physik lagen mir. Dabei musste ich nicht lange nachdenken, es funktionierte einfach.
»Sag mal, Meredith, wir haben Frühjahr. Möchtest du nicht mal was Helles anziehen? Ich glaube, Orange würde dir gut stehen.« Jetzt, wo das Thema Liebe erst einmal wieder durch war, kam Shaktis Lieblingsthema Nummer zwei an die Reihe. Shakti war, obwohl extrem bunt, immer chic. Und würde mich am liebsten komplett neu einkleiden. Leider wäre ich mir in diesen Farben vorgekommen wie eine Banane unter lauter Äpfeln.
Auf unserer vorherigen Schule hatten wir alle hellblaue Blusen mit Krawatte auf dunkelblauen Faltenröcken tragen müssen. Und bei unseren Ausflügen nach London sogar quietschgelbe Sweatshirts auf lila Jeans. Das waren meine einzigen Ausflüge in die Welt bunter Klamotten gewesen. Zum Glück war die Zeit der Schuluniformen jetzt seit einem Dreivierteljahr vorbei und damit meine bunte Zeit, egal was Shakti mir auch riet.
Wir kannten uns nun schon seit über zwölf Jahren. Wir, das bedeutete nicht nur Shakti und ich, sondern auch der Rest unserer Clique: Rebecca, Chris und Colin.
Colin. Seit unserer Kindheit verbrachten wir beinahe jeden Tag zusammen. Niemand kannte mich besser als er. Von meinen vier Freunden stand er mir am nächsten.
Und jetzt war nichts mehr wie vorher.
»Alles klar, Meredith? Colin und du seid am Samstag so schnell von der Party verschwunden, dass wir uns kurzzeitig richtig Sorgen gemacht haben.« Rebecca holte zu mir auf. Sie hatte mir gerade noch gefehlt. Im Gegensatz zur verträumt-verliebten Shakti war Rebecca immer hellwach. Ihr entging nie etwas. Nie.
»Ich hatte Kopfschmerzen«, log ich. Prüfend blickte sie mir ins Gesicht, nickte dann aber verständnisvoll. Leider hatte ich oft Kopfschmerzen. Gut, dass sie mir zumindest mal als Ausrede dienen konnten.
Wo war Colin?
Sonst stand er jeden Morgen vor dem Collegegebäude, um auf mich zu warten. Na bitte. Nichts war mehr wie sonst. Nicht mal auf seinen besten Freund konnte man sich verlassen.
»Ich glaube, ein Superhirn zu haben ist nicht immer einfach. Meine These ist ja immer noch, dass die grauen Zellen, von denen du mehr hast als andere, dir zu viel Druck bereiten, daher die Kopfschmerzen. Apropos graue Zellen: Hast du die Mathehausaufgaben fertig? Gibst du sie mir mal?«
Ich sah mich wieder um. Nichts. »Machst du je deine Hausaufgaben?« Ich war zu angespannt, um diplomatisch zu sein.
»Ich habe sie ja gemacht. Ich wollte nur vergleichen. Aber okay, dann frage ich halt jemand anderen.«
Eingeschnappt rauschte sie davon. Rebecca war schnell eingeschnappt, auch wenn es zum Glück selten länger als einen Tag anhielt. Letzteres lag wahrscheinlich an ihrem Vater, Vikar Hensley, der jeden Sonntag alles zum Thema Vergebung predigte.
Doch wo war Colin? Wieder schaute ich mich um.
Er sah mich zuerst.
Ich spürte seinen Blick im Rücken.
Das war nicht ungewöhnlich. Er war mein bester Freund und wir kannten uns so gut, dass ich oftmals schon wusste, wo er sich befand, bevor ich ihn überhaupt sah. Er war für mich wie der Bruder, den ich mir stets gewünscht hatte. Und ich hatte gedacht, ich sei für ihn die Schwester, die er gern gehabt hätte, anstelle seines dämlichen Bruders Theodor.
Hatte. Das war das entscheidende Wort.
Anscheinend hatte ich falsch gedacht.
Ich atmete tief durch und konnte nicht verhindern, dass mein Herz plötzlich schneller schlug.
Es ist doch nur Colin, versuchte ich mir einzureden, während ich mich umdrehte und ihn auf mich zukommen sah. Der gute alte Colin. Dein Colin.
Ich sah sein schwarzes Haar, wie immer etwas zu lang und zerzaust, unter dem die ein klein wenig abstehenden Ohren herauslugten. Aber seine blauen Augen blickten heute ganz anders und um seinen Mund spielte ein keckeres Lächeln als sonst. Normalerweise hätte ich angenommen, er amüsiere sich über etwas, doch dann sah ich das leichte Zucken seiner linken Augenbraue. Er war eindeutig nervös.
»Hey, Colin«, rief Shakti und jetzt erst wurde mir klar, dass sie immer noch neben mir stand. O Gott. Sie durfte keinesfalls erfahren, was vorgestern Abend geschehen war.
Doch es gab keine Zeit mehr, mich irgendwie vorzubereiten oder mir ein paar Worte zurechtzulegen. Ich ergriff Colins Ärmel und zog ihn in Richtung Chemieraum. Das Labor daneben wurde im Moment nicht benutzt, weil es umgebaut werden sollte. Der ideale Ort, um in Ruhe zu reden.
Am Türgriff blieb ich mit meinem Rucksackträger hängen. Ich versuchte ihn zu lösen und verhedderte mich noch mehr. Colin war es, der den Träger losmachte. Kaum befreit rannte ich förmlich ins Labor, zog Colin hinein und schloss die Tür hinter uns.
Jemand hatte vergessen die Jalousien hochzufahren, der Raum war dunkel und es roch nach ungesunden Chemikalien. Doch das war jetzt nebensächlich. Ich wandte mich Colin zu.
»Okay, Colin William Adams, lass es uns hinter uns bringen. Das mit Samstagabend. Kannst du mir bitte mal erklären, was das sollte?«
Das Zucken um seine Mundwinkel war verschwunden, wie auch das Lächeln in seinen Augen. O Gott, das war eindeutig zu überfallartig gewesen. Warum konnte ich nicht ein einziges Mal meinen vorlauten Mund halten? Aber Colin kannte mich besser als jeder andere. Er musste sich doch denken, dass er mich völlig aus dem Konzept gebracht hatte. Spätestens seit gestern, dem ersten Tag, an dem wir, seit wir im Besitz von Handys waren, nicht eine einzige WhatsApp-Nachricht ausgetauscht hatten.
»Meredith, ich …«
»Ich weiß schon. Diese Cola-Bier-Mischungen sind stärker als gedacht«, plapperte ich los. »Das liegt an dem Zucker der Cola. Er transportiert den Alkohol schneller ins Blut.«
»Du …«
»Aber ich habe aufgehört, als ich merkte, dass mir das Zeug zu Kopf stieg.«
»Ich …«
»Du hattest genau sechs. Mindestens vier zu viel. Offensichtlich. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass es dich dermaßen umhaut. Weißt du überhaupt noch was vom Rest des Abends?« Einen Moment lang setzte mein Herz aus. Was, wenn nicht? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht machte ich mich hier völlig umsonst zum Affen?
Er starrte mich an. Ein seltsames Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Das war doch wohl keine Enttäuschung, oder? Ich horchte erst gar nicht in mich hinein. »Na ja, vielleicht vergessen wir den Abend einfach. Jeder trinkt mal ein bisschen zu viel. Du kannst nur froh sein, dass es schon so spät war und dein Vater dich nicht erwischt hat. Ich bezweifle, dass ich dir um ein Uhr nachts noch zu Hilfe hätte eilen können. Abgesehen davon, dass Dr. Adams mir bestimmt lebenslanges Hausverbot erteilt hätte.«
Colins Vater, der einzige Arzt im Umkreis von fünfzehn Meilen, war bekannt für seine Strenge. Nicht nur seinen Kindern, sondern auch seinen Patienten gegenüber. Was er verordnete, wurde folgsam eingehalten. Sogar überzeugte Kettenraucher hörten nach einer Sprechstunde bei ihm schlagartig mit dem Rauchen auf. Er war eine Person, der man uneingeschränkt Respekt entgegenbrachte und mit dem man sich nicht anlegen wollte. Schon gar nicht als Sohn, dem wochenlanger Hausarrest drohte.
»Auf alle Fälle hätte dir dein Vater ein paar Wochen Hausarrest verordnet, wenn er dich erwischt hätte. Auf diesen Partys wird einfach zu viel Alkohol ausgeschenkt. Ich für meinen Teil werde beim nächsten Mal nur noch Bionade trinken, dann ist wenigstens gewährleistet, dass man genau weiß, was man tut und …«
»Meredith Sybill Wisdom, hör endlich auf zu schnattern!«
Ich verstummte und sah Colin groß an.
»Gib mir deine Hand.«
Womöglich wurden meine Augen noch größer. Colin berührte nur ungern jemanden. Auch mich nicht. Immer achtete er darauf, dass sich zumindest ein Stück Stoff zwischen ihm und den anderen befand. Das lag daran, dass er ein Geheimnis hatte.
Ein Geheimnis, das nur ich kannte. Nicht seine Mutter, nicht sein Bruder und schon gar nicht sein Vater. Ich war die Einzige.
Das hatte angefangen, als er zehn war. Er war bei seinem Großvater zu Besuch gewesen und erzählte mir im Nachhinein, dass jedes Mal, wenn sein Großvater ihn bei der Hand genommen hatte, er ihn reglos im Garten unter den Apfelbäumen liegen sah. Jener hatte schnell gemerkt, dass Colin seine Berührung als unangenehm empfand. Zum Abschied hatte er ihm übers Haar gestreichelt und geäußert, der Junge werde wohl groß, weil er nicht mehr seine Hand halten wolle. Dabei hatte Colin bloß diese Vision vermeiden wollen. Ein halbes Jahr später fand Colins Mutter ihren Vater tatsächlich reglos unter den Apfelbäumen wieder. Er hatte einen Herzinfarkt gehabt und starb wenige Tage darauf im Krankenhaus.
Als Colin etwas später eine Vision von seiner Nachbarin hatte, die sich auch bewahrheitete, kurz bevor sie starb, konnten wir an keinen Zufall mehr glauben. Wenn Colin die Haut eines anderen Menschen berührte, sah er ihn so, wie er kurz vor seinem Tod aussehen würde.
Meistens sah er die Menschen ein paar Tage vor dem Sterben, wie sie im Altenheim oder im Bett lagen. Aber manchmal sah er auch Schlimmeres. Daher mied Colin die Berührung von Menschen, aber es klappte eben nicht immer.
Ich wusste, dass er auch mich so sehen konnte, aber er hatte mir darüber nur verraten, dass ich kurz vor meinem Tod weiße Haare haben würde. Mein einziger Kommentar dazu war, dass ich irgendwann dann wohl zu schwach oder zu doof zum Haarefärben wäre, und damit war das Thema erledigt gewesen.
Ich wollte es eigentlich gar nicht wissen. Aber die weißen Haare beruhigten mich schon irgendwie.
Dennoch berührte Colin mich selten. Er sagte, er wolle lieber miterleben, wie ich alt werde, und es nicht jetzt schon sehen. Und wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde sei.
»Bitte, Meredith, gib mir deine Hand«, sagte Colin noch einmal. Zaghaft legte ich meine Finger in seine. Er umfasste sie. Sein Griff war warm, fest und angenehm.
Ich konnte ihm ansehen, dass er in sich hineinhorchte. Und dann war da auf einmal wieder dieses Lächeln. Nicht nur in seinen Augen. Auch auf seinem Mund. Noch immer hielt er meine Hand, doch jetzt zog er mich näher an sich heran. Dicht. So dicht, dass ich sehen konnte, dass er sich heute Morgen rasiert hatte. Ich konnte es sogar riechen. Er benutzte seit neuestem ein Aftershave mit einer etwas herberen Note. Es war ein wenig ungewohnt.
Colins andere Hand legte sich um meine Taille. Jetzt fühlte ich auch seine Körperwärme und mit einem Mal begann mein Herz unkontrolliert schnell zu klopfen.
»Colin? Was hat das zu bedeuten?« Meine Stimme überschlug sich ein wenig, denn nun beugte er sich zu mir herunter und ich konnte deutlich die hellen Punkte auf seiner Iris ausmachen, die seine Augen so intensiv blau schimmern ließen.
»Ich war nicht betrunken und ich weiß noch ganz genau, was Samstagabend passiert ist, Meredith«, sagte er und seine Stimme klang mit einem Mal kehlig. »Ich brauchte nur ein wenig Mut, um endlich das zu tun, was ich schon lange hatte tun wollen.«
Und dann senkte er seinen Kopf und berührte mit seinen Lippen die meinen. O Gott, wir taten es schon wieder.
Das war jetzt bereits der zweite Kuss in drei Tagen, dabei war ich vorher noch nie geküsst worden. Ich war nicht der Typ Mädchen, den Jungs ansprachen. Vielleicht durch meinen eher praktischen Pagenkopf. Vielleicht weil ich ein bisschen schlauer war als die meisten anderen Schüler am College. Vielleicht aber auch, weil Colin ständig in meiner Nähe war.
Und wie schon am Samstag war dieser Kuss einfach … einfach …
Der Schulgong ertönte und ich erschrak so heftig, dass meine Stirn gegen seine knallte.
Wir torkelten auseinander, jeder rieb sich die Stirn.
»Entschuldige«, sagte Colin und lächelte schief.
»Schon okay«, murmelte ich und wusste nicht, wofür genau er sich entschuldigte.
»Ich denke, das sollten wir bald einmal wiederholen.«
Ich sah auf, direkt in sein lächelndes Gesicht, und schluckte. Genau das hatte ich vermeiden wollen und dennoch hatte ich nichts getan, um es zu verhindern. Was war nur los mit mir? In meinem Magen bildete sich ein Loch, ähnlich dem Gefühl, wenn man Hunger bekam. Allerdings war das kein Hungergefühl, das man mit Fish and Chips hätte bekämpfen können. Ich wusste nicht, ob es überhaupt etwas gab, das es füllen würde.
Er griff nach meiner Hand und verschränkte unsere Finger. »Wir haben eindeutig viel zu lange damit gewartet.«
Ich wollte etwas erwidern, aber meine sonstige Redegewandtheit hatte mich komplett im Stich gelassen. Colin schien jedoch keine Probleme damit zu haben. »Ich kann es immer noch nicht glauben«, sagte er. »Aber ich sehe dich völlig normal, wenn ich dich berühre. Das hat wohl der Kuss ausgelöst.« Er wirkte dabei so froh, wie ich ihn sonst nur erlebte, wenn wir mit seinem Hund im Wald unterwegs waren.
Unbefangen, erleichtert, heiter. Ich fühlte das Loch in meinem Magen noch größer werden.
»Du siehst es nicht mehr?«, fragte ich schließlich dumpf. Colins Geheimnis begleitete ihn nun schon seit nahezu acht Jahren. »Wieso nicht? Ist das nicht ungewöhnlich?«
»Du fragst mich allen Ernstes, ob es nicht ungewöhnlich ist, dass ich keine Zukunftsvisionen mehr habe?«
Colin sah mich mit hochgezogenen Brauen an.
»Ja. Für dich ist es ungewöhnlich …«
»Sagt die angehende Physikerin, die sonst immer alles wissenschaftlich erklärt haben muss«, unterbrach er mich noch immer grinsend.
»Du weißt genau, dass ich deine Visionen immer ernst genommen habe und das auch ohne wissenschaftlichen Beweis.«
Jetzt war ich beleidigt. Wieso musste nur jeder auf meiner Vorliebe für Erklärungen herumreiten?
»Ich würde gern wissen, wieso du auf einmal von jetzt auf gleich keine Visionen mehr hast. Wie kann das so plötzlich abhandenkommen? Setzen Lippen eine chemische Reaktion frei?«
Colin rollte mit den Augen und seufzte laut.
»Mere, hörst du dich reden? Du analysierst schon wieder. Ich genieße es einfach. Die Bilder sind ja auch nicht gänzlich verschwunden. Ich sehe sie nur anders. Ich habe gestern Morgen Mum umarmt und ihr einen Kuss gegeben. Das Bild, das ich dabei sah, zeigte sie ganz normal, wie ich sie täglich sehe. Zum ersten Mal seit acht Jahren hatte ich sie nicht mit eingefallenem Gesicht, fehlenden Zähnen und Schläuchen in den Armen vor Augen. Bei Theo das Gleiche. Ich berührte ihn und sein Bild zeigte mir nur sein unverändert süffisantes Grinsen. Zwar nicht am Esstisch, an dem er eigentlich saß, sondern im Garten und in anderen Klamotten, aber immerhin.«
Ich verdrehte die Augen. Was Colin freundlicherweise als »süffisant« bezeichnete, nannte ich »hämisches Frettchengesicht«. Seinen Bruder Theodor wollte ich auch, ohne Visionen von Sterbenden zu haben, nicht anfassen.
Doch Colins Aussage schockierte mich. Nicht, dass ich es mir für ihn nicht wünschte. Seine eigene Mutter altersschwach mit Schläuchen an den Armen auf dem Sterbebett liegen zu sehen kam sicherlich einem Albtraum gleich. Oder Theodor – egal wie wenig ich ihn mochte – als erwachsenen Mann mit entstelltem Gesicht und starrem Blick in einer fremden Umgebung vor sich zu haben. Das Fehlen der schrecklichen Zukunftsvisionen war ungewöhnlich für Colin und verursachte mir eine Gänsehaut.
»Aber sonst ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte ich besorgt.
»Es ging mir nie besser«, verkündete er, schulterte seinen Rucksack und griff mit der freien Hand nach meiner.
Ich entzog sie ihm. Colin sah mich stirnrunzelnd an.
Verlegen räusperte ich mich. »Lässt du mich bitte erst mal über die ganze Sache klar werden, Colin? Das war alles sehr … sehr plötzlich für mich.«
Ich sah ihn schlucken und konnte nicht sagen, ob er es wirklich verstand oder gar enttäuscht war. Das sollte er nicht sein. Ich wollte ihn nicht enttäuschen.
»Du hast mich damit überrascht«, versuchte ich mich zu verteidigen. Ich nahm meinen Rucksack an mich und wollte ihn gerade aufheben, doch er flutschte mir durch die Finger und der Inhalt verteilte sich über den Boden.
Typisch, dachte ich und bückte mich, um alles mit fahrigen Bewegungen zusammenzuraffen. Wieso passten die Hefte und Bücher schon wieder nicht hinein? Sie hatten doch vorher gepasst.
Colin kniete sich neben mich, griff nach den Büchern und sortierte sie akribisch in den Rucksack hinein. Bei ihm passte alles wunderbar – wie bei Mum. Ich würde es wohl nie lernen. Das nervte mich. Das und dass ich nicht wusste, was Colin dachte.
»Heißt das, du magst mich nicht?«, fragte er leise, während seine Hände ein paar Kaugummi- und Bonbonpapierchen aufsammelten, die ebenfalls herausgekullert waren.
Ich starrte auf seinen Rücken. Das war so … unfair! Er wusste genau, dass ich ihn mochte. Das musste er wissen. Ich würde doch nicht zwölf Jahre lang beinahe täglich jede freie Minute mit jemandem verbringen, den ich nicht leiden konnte. Im Gegenteil! Theodor mochte ich nicht und das konnte jeder, der mich auch nur ein wenig kannte, direkt erkennen.
Colin war so was wie mein Seelengefährte. Er war das, was bei den meisten Mädchen die beste Freundin verkörperte. Nur, dass wir uns nicht über Jungs, Make-up oder Klamotten unterhielten. Daran hatte mir nie etwas gelegen – wie Rebecca und Shakti nie müde wurden mir vorzuhalten.
Mit Colin hatte ich den Wald erobert, Geschichten gelesen und nachgespielt, Filme geschaut. Wir hatten Experimente durchgeführt und die Bibliotheken durchstöbert, als wir das mit seinen Visionen entdeckten – und die anderen Fähigkeiten, die parallel zu den Visionen aufgetreten waren. Er hatte mir immer alles anvertrauen können. Immer. Aber das, was er am Samstag von sich preisgegeben hatte – beziehungsweise vorhin – , darüber hatte er nie ein Wort verloren.
Colin und ich hatten immer alles geteilt, uns alles erzählt.
Und trotzdem hatte es da etwas gegeben, das ich nicht gewusst, ja nicht einmal geahnt hatte.
»Colin, du weißt genau, dass ich dich mag.« Das Aber musste ich nicht hinzufügen. Das hörte er heraus.
Colin richtete sich auf und sah mir direkt ins Gesicht. »Aber nicht so?«
»Nein«, sagte ich und korrigierte mich sofort. »Vielleicht. Ich bin … überrascht. Ich meine, du hattest genügend Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, und ich …«
»… und du hast mich immer nur als eine Art Bruder gesehen?« Colin richtete sich zu seiner vollen Größe auf.
Wie immer, wenn er das tat, fühlte ich mich richtig klein. Colin war groß. Größer als die meisten Schüler am College.
Ich war mit meinen 1,72 Meter ziemlicher Durchschnitt, Colin jedoch ragte mehr als einen ganzen Kopf über mich hinaus. Meistens machte er sich ein bisschen kleiner als er war, damit es nicht so extrem auffiel, aber wenn ihn etwas ärgerte, reckte er sich. Das war noch nicht oft vorgekommen. Genau genommen erinnerte ich mich an zwei Situationen. In unserem dritten Jahr in der Grundschule – schon damals hatte er alle überragt – hatten ein paar Jungs die kleine Sarah Atkins verprügelt. Colin hatte sich dazwischengeworfen, die Jungs auseinandergezogen und sich dann zu voller Größe aufgerichtet. Da war er zum ersten Mal mit Respekt behandelt worden, weil er sich bis dahin immer nur geduckt und so ruhig verhalten hatte.
Beim zweiten Mal hatte ein älterer Schüler Shakti beleidigt. Das war bereits in der Secondary School gewesen. Der Idiot hatte sie eine indische Schlampe genannt und ihr Sachen an den Kopf geworfen, die niemand von uns je wiederholt hätte. Nicht einmal Rebecca. Als sich Colin vollkommen aufrecht vor Shakti stellte, hatte sich der Schüler sofort verkrümelt und seither einen weiten Bogen um uns gemacht.
Das hier war die dritte Situation. Und sie zeigte mir, wie aufgewühlt er war.
Ich fühlte mich mit einem Mal furchtbar mies. Aber Moment, warum sollte ich mich mies fühlen? Ich hatte ihn doch nicht um diesen Kuss gebeten!
»Colin, du bist mein bester Freund«, sagte ich verzweifelt. »Du hast beschlossen, dass daraus mehr werden soll, und ich bin einfach überrumpelt worden. Ich habe Angst, dass du unsere Freundschaft dadurch aufs Spiel setzt.«
Hinter mir klirrte es. Erschrocken drehte ich mich um. Ein Reagenzglas lag in seiner Holzfassung zerbrochen am Boden. Die darin enthaltene Flüssigkeit verbreitete eine größere Pfütze, als man nach dem Glas zu urteilen hätte annehmen können. Hier trat Colins zweite Fähigkeit zu Tage. Er konnte manche Gegenstände bewegen, ohne sie zu berühren. Nicht alle, aber sehr viele. Warum einige nicht, hatten wir noch immer nicht herausgefunden.
»Lass uns lieber rausgehen«, sagte Colin und öffnete die Tür.
O ja. Colin war definitiv aufgewühlt. Es war wirklich besser, das Labor schnell zu verlassen. Im Regal neben der Tür befanden sich noch viel mehr gefüllte Reagenzgläser.
2. Kapitel
Ich stand den ganzen Vormittag über neben mir. Die Geschehnisse im Labor wollten nicht in meinen Verstand und aus meinen Gedanken heraus.
Ich konnte in Chemie nicht die Eigenschaften von Benzol benennen und bei der Integralrechnung in Mathe versiebte ich die Aufgabe. Dinge, die ich normalerweise im Schlaf beherrschte.
Der Gong zur Mittagspause war Fluch und Segen zugleich. Ich liebäugelte zum ersten Mal in meinem Leben damit, mich krank zu stellen und nach Hause zu gehen. Aber dann würde Colin darauf bestehen, mich zu begleiten. Und die Lehrer würden das unterstützen, weil er mich immer nach Hause brachte. Was es nicht besser machte. Also trottete ich brav zur Cafeteria und belud mein Tablett mit dem üblichen Sandwich und Salat.
»Mann, war das ein Gewitter am Samstag.« Rebecca schien unseren morgendlichen Zusammenstoß vergessen zu haben und setzte sich mit ihrem mitgebrachten veganen Essen an unseren Tisch. »Als ich nach Hause kam, lag mein CD-Regal am Boden. So sehr hat’s gescheppert.«
Wir starrten sie groß an.
»Ja, ihr könnt mich ruhig so anschauen. Mein signiertes Amy-Winehouse-Album ist hinüber. Dafür gibt’s keinen Ersatz mehr«, fügte sie düster hinzu. Das erklärte ihre schlechte Laune heute.
»Laut unserem Nachbarn Mr James entlud sich das Gewitter hauptsächlich über dem Steinkreis«, sagte Shakti. »Da soll sogar ein paarmal der Blitz eingeschlagen haben. Ob die Steine noch alle stehen?«
»Wenn nicht, bekommt Vikar Hensley die Krise.« Colin ließ sich an meiner Seite nieder. Mein Magen machte einen unvorhergesehenen Hüpfer und meine Hand stieß Shaktis Cola um.
Shakti und Rebecca sprangen hektisch auf. »O Mann, Meredith!«
Ich kramte in meiner Tasche nach Papiertaschentüchern. Doch als ich sie endlich gefunden hatte, war schon alles aufgewischt und Colin entsorgte gerade die nassen Lappen im Müll.
Er sah sehr zufrieden aus, als er sich wieder setzte.
Schnell wandte ich mich meinem Essen zu. Leider zitterte ich immer, wenn ich aufgeregt war. Deswegen bekam ich jetzt auch kaum etwas auf die Gabel. Ständig rutschte der Salat runter.
»Was ist mit dir los?«, fragte Rebecca irritiert.
»Ich glaub, ich bekomme die Grippe«, log ich.
Sofort legte Shakti mir eine Hand auf die Stirn. »Aber heiß fühlst du dich nicht an. Du machst dir doch wohl keine Gedanken um die A-Level-Prüfungen, oder?«
Natürlich nicht. Aber was sollte ich sagen? Ich zuckte einfach mit den Schultern und legte die Gabel beiseite.
Dabei spürte ich Colins durchdringenden Blick auf mir und sah aus den Augenwinkeln, dass sich Rebecca und Shakti einen ratlosen Blick zuwarfen.
»Seid ihr eigentlich noch in das Gewitter geraten? Ihr seid doch irgendwann um diese Zeit von der Party aufgebrochen«, fragte Shakti besorgt. »Stellt euch vor, euch hätte ein Blitz getroffen!«
Rebecca lachte. »Ach, dann würde unser Superhirn vielleicht endlich normal ticken.«
»Die wird nie normal«, höhnte hinter ihr eine leider allzu bekannte Stimme.
Shelby Miller. Heute mit grünem Lippenstift, Pandabäraugen und zur Lippenstiftfarbe passenden Strähnen im Haar. Ansonsten war sie komplett in Schwarz gekleidet. Sofern man eine überaus durchsichtige Netzstrumpfhose noch schwarz nennen konnte.
»Suchst du was?«, fragte ich frostig. »Deine Hose zum Beispiel?«
Shakti starrte mit großen Augen auf Shelbys Lederrock, der die Breite eines Tafellineals hatte.
»Du würdest Mode nicht mal erkennen, wenn sie dir auf einem Teller serviert würde. Sieh dir nur deine Brille an!«, fauchte Shelby gehässig.
»Mode?« Ich schob meine Brille, die wieder mal bis zur Spitze heruntergerutscht war, zurück auf die Nase und begutachtete Shelby von oben bis unten. »Das Wort ›Mode‹ bezeichnet eine zeitgemäße Geschmacksauffassung von Kleidung, Musik und Ansichten. Du trägst den Stil eines Punks. Das heißt, einen Kleidungsstil, der in den Siebzigern erfunden und vor allem in den Achtzigern gelebt wurde. Von einem zeitgemäßen modischen Verständnis kann bei dir absolut keine Rede sein. Also, lass uns doch bitte in Ruhe essen. Und bück dich besser nicht. Der Anblick deines Slips ist sicherlich nicht sonderlich appetitanregend.«
Um uns herum machte sich Gelächter breit. Shelbys Auftritte zogen immer viele Blicke auf sich. Das verdankte sie nicht nur ihrem Aussehen, sondern auch ihrem ordinären Wesen. Wenn sie nicht so herausragende Noten gehabt hätte, wäre sie schon lange geflogen.
»Ich trage keinen Slip, sondern einen String. Und deinem Freund scheint der Appetit gerade erst gekommen zu sein«, sagte sie süffisant, warf die Haare zurück und ging weiter wie ein Hollywoodstar auf dem roten Teppich.
»Ich hab nicht geguckt, ich schwör’s!« Colin hob beide Arme, als würde er mit einer Waffe bedroht werden.
Rebecca grinste. »Du fällst noch immer auf Shelbys Attacken rein. Wann merkst du endlich, dass sie auf dich steht?«
Colin errötete leicht.
»Ich glaube, mein Vater würde Krämpfe bekommen, wenn sie je bei uns zu Hause auftauchen sollte«, murmelte er, inzwischen knallrot.
»Sag mal, stehst du etwa auf sie?« Rebecca musterte ihn eingehend.
Ehe er es abstreiten konnte, meldeten sich aus unseren Jackentaschen und Rucksäcken unsere Handys. Wir hatten alle die gleiche WhatsApp-Nachricht bekommen.
Und zwar von Chris, dem Letzten aus unserer Runde. Er schrieb, er habe seine Fahrprüfung bestanden und würde uns nach der Schule abholen und nach Hause fahren, was ein großes Hallo auslöste.
Christopher Harris hatte sich heute vom Unterricht befreien lassen, weil er seine Führerscheinprüfung machte. Zum zweiten Mal, da er die erste Prüfung vor einem Jahr versiebt hatte. Seine Fahrerlaubnis und der Tag seiner Volljährigkeit sollten am nächsten Samstag groß gefeiert werden. Vor allem weil er zu diesem Anlass ein Auto geschenkt bekommen hatte.
In unserem Freundeskreis war er damit der Erste mit Fahruntersatz. Zwar hatten Rebecca und ich schon den Führerschein, aber leider kein Auto. Chris’ Wagen versprach uns allen eine lang ersehnte Freiheit.
»Was schenken wir Chris eigentlich zum Geburtstag samt bestandener Fahrprüfung?«, fragte Colin.
»Ob sein Dad dieses Mal da ist?«, fragte Shakti. »Ich habe ihn seit mindestens zwei Jahren nicht mehr gesehen.«
»Wenn er da ist, machen wir ein Bild von ihm, damit du ihn dir öfter ansehen kannst.« Rebecca zwinkerte Shakti zu. »Schlecht aussehen tut er ja nicht …«
»Wittere ich da Ehefrau Nummer fünf?«, fragte ich scheinheilig.
Shakti schüttelte sich. »Solange Chris mein Stiefsohn wäre, niemals!«
Wir kicherten alle.
»Noch mal zurückzukommen auf Chris’ Geschenk …«, brachte Colin wieder in Erinnerung.
»Ich bin für einen Tankgutschein«, schlug Rebecca vor. Ihre Dreadlocks waren wieder einmal kunstvoll aufgesteckt, passend zu dem grellbunten Outfit, das ich immer mit einer Mischung aus Bewunderung und Widerwillen betrachtete. Irgendwie ergab es bei Rebeccas Erscheinung einen Sinn. Aber die Klamotten allein waren extrem flippig.
»Wie langweilig«, sagte Shakti mit gerümpfter Nase. »Er hat endlich den Führerschein bestanden und wird achtzehn. Nicht dreißig.«
»Mach doch einen besseren Vorschlag. Etwa ein Buch?«, sagte Rebecca schnippisch. Sie war wie immer sofort auf hundertachtzig.
»Jetzt macht doch mal halblang«, sagte ich. »Es geht ja nur um ein Geschenk.«
»Dann sucht ihr halt eins aus. Meine Meinung ist ja anscheinend nicht gefragt.« Rebecca lehnte sich mit gekreuzten Armen im Stuhl zurück und starrte uns finster an. »Und davon abgesehen, Colin, wann lässt du dir die Haare schneiden? Die sind eindeutig zu lang und zu strubbelig. Sonst bekommst du an deinem Geburtstag einen Friseurbesuch geschenkt. Und wenn ich den Gutschein allein kaufe.«
Ich rollte mit den Augen. Rebecca war heute extrem mies gelaunt. Und der arme Colin war doch viel zu gutmütig, um sich zur Wehr zu setzen. Das konnte ich gar nicht vertragen.
»Hast du’s bald?«, fragte ich sie direkt. »Wenn du schon von strubbelig redest, sieh mal selber in den Spiegel.«
Rebecca sprang auf und stürmte aus der Cafeteria.
»Lass gut sein, Meredith«, sagte Colin ruhig. »Sie hat ja Recht. Meine Matte nervt sogar mich selbst.«
Zur Bestätigung blies er seinen zu langen Pony aus dem Gesicht. Colin hatte sehr dichtes Haar und es wuchs so üppig wie Unkraut im Garten. Leider war sein Vater ein Verfechter von Familienehre und Colin durfte sich die Haare nur im Friseursalon seiner Tante schneiden lassen. Die hatte vor gefühlten fünfzig Jahren eine Lehre beim Friseur gemacht, den Laden nach zwei Jahren von ihrem Meister übernommen und nie mehr Zeit gefunden, irgendeine Fortbildung zu besuchen.
Die älteren Semester aus Lansbury besuchten ihren Salon noch immer regelmäßig und gaben sich mit Dauerwellen und den Schnitten von anno dazumal zufrieden. Ich selber ging zugegebenermaßen auch dorthin. Weil ich Mrs Jones mochte und es einfach praktisch war. Sie wohnte nur zwei Straßen weiter und ich bekam noch immer einen Lutscher nach jedem Schnitt, genau wie bei meinem ersten Besuch bei ihr, mit fünf Jahren.
Shakti seufzte. »Zurück zu den Vorschlägen. Meredith, hast du eine Idee, was wir Chris schenken könnten?«
Ich lächelte. »Ich habe tatsächlich eine. Wie wär es mit einem CD-Wechsler? Oder sonstigem Schnickschnack fürs Auto?«
»Ich bin für einen Wackel-Dackel«, erklärte Colin und grinste.
»Ich weiß was noch Besseres! Ich habe letztens einen Wackel-Darth-Vader gesehen!«, rief Shakti entzückt.
Colin lachte. »Gute Idee. Den verpacken wir als Witzgeschenk und dazu dann noch … einen CD-Wechsler?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Chris hat bestimmt eine Dockingstation in seinem Auto. Sind die heutzutage nicht serienmäßig?«
Ich zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Da ich mir noch kein Auto leisten kann, habe ich mich nicht damit beschäftigt.«
»Das ist wohl eher ein Jungsding.« Shakti verdrehte die Augen und warf einen Blick auf ihre Uhr. »Pause vorbei.«
Wir erhoben uns seufzend.
Kurz bevor wir zurück in den Unterricht mussten, ging ich noch aufs Klo. Das war mehr eine Flucht, denn ich wollte mir in Ruhe über etwas klar werden.
Colin war in mich verliebt. Anscheinend schon lange. War ich es auch in ihn? Der erste Kuss hatte mich überrascht. Der heute Morgen im Labor nicht. Er hatte aber auch nichts in mir ausgelöst.
Ich nahm mir fest vor, mich den Rest des Schultages auf den Unterricht zu konzentrieren. Wenn mir das gelänge, wäre ich einen Schritt weiter und mir über meine Gefühle vielleicht sogar im Klaren. Nur hoffentlich war das kein Schritt mit Ende. Dem Ende meiner Freundschaft zu Colin.
Die letzten zwei Schulstunden zogen sich quälend langsam hin. Quälend für alle anderen, weil draußen endlich die Frühlingssonne schien und lockte. Die Wärme im Klassenraum machte uns ein wenig schläfrig, obwohl wir unsere Pullis und Westen ausgezogen hatten und nur noch im T-Shirt dasaßen. Die Zeiger der Uhr krochen langsamer als eine Schnecke in der Wüste.
Allerdings hatte ich mich wieder im Griff. In Mathe konnte ich problemlos verschiedene Aufgaben von Binomialverteilung aus George Udny Yules Theorien ausrechnen und in Naturwissenschaften die exogene Kraft von Salzsprengung verfolgen. Das brachte mich zu einer weiteren Erkenntnis. Zu zwei Erkenntnissen genau genommen. Erstens: Salzverwitterte Steine glichen einer Honigwabe. Zweitens: Ich konnte keinesfalls in Colin verliebt sein, wenn ich wieder so klar denken konnte. Zumal es da doch eigentlich jemand anderen gab, für den ich schwärmte. Von dem wusste aber nur ich. Wenn ich es jemanden erzählt hätte, wäre nur Colin in Frage gekommen. Doch der schied aus offensichtlichen Gründen jetzt endgültig aus.
Es war unkomplizierter, über Yule nachzudenken. Er hatte interessante Analysen und war tot.
Als es endlich zum Schulschluss klingelte, wünschte ich mir fast, nachsitzen zu müssen. Erst als Logan Cooper, der diesjährige Preisträger für den deofreisten Schüler am Stone Circle College, sich an mir vorbeidrängte und eine Schweißfahne hinterließ, die beinahe meine Brillengläser zum Beschlagen brachte, kam ich wieder zur Vernunft.
Was war nur los mit mir? Es war Colin. Der gute, alte Colin!
Und natürlich stand er bereits neben unserem gemeinsamen Tisch und wartete geduldig, bis ich meine Tasche umständlich zusammengepackt hatte.
3. Kapitel
Wir sahen Chris schon von weitem. Er lehnte lässig an einem blinkend schwarzen Sportwagen und schaute Miranda Hayes, einer Schülerin aus Colins Biologiekurs, tief in die Augen. Colin und ich wechselten einen Blick und grinsten gleichzeitig.
Neben Colin rollte Rebecca die Augen. Mit ihrem üblich stapfenden Schritt marschierte sie auf Chris zu.
»Glückwunsch zum Führerschein. Ich setz mich nach vorn. Hinten muss ich immer kotzen.«
Sie tätschelte seine Schulter und ließ sich auf den Beifahrersitz nieder.
Miranda schenkte Chris ein letztes, mageres Lächeln und suchte das Weite.
Chris charmantes Lächeln verflog schlagartig. »Rebecca, hättest du nicht ein wenig rücksichtsvoller sein können?« Er steckte den Kopf zur Fahrertür hinein.
»Nein. Ich habe ein weiteres Opfer vor dir gerettet. Aber das ist eine echt coole Karre. Können wir fahren? Ich will hören, welchen Sound der Motor hat.«
Chris drehte sich hilflos zu uns um.
Wir gratulierten ihm und bestaunten seinen neuen Vauxhall. Colins Augen glänzten, als der die Sportausstattung im Inneren sah.
Rebecca hatte bereits einen Fuß auf dem Armaturenbrett vor sich und kaute auf ihrem Kaugummi herum. Chris beugte sich durch die Fahrertür zu ihr.
»Wenn du nicht die nächsten zwei Wochen hinken willst, nimmst du den Fuß da runter, Sonnenschein.«
Rebecca setzte den Fuß ab.
»Tolles Auto, Chris«, sagte ich mit ehrlicher Bewunderung.
»Das ist ein VXR8GTS.« Colin umrundete fast ehrfürchtig den Wagen. »584PS und ein V8-Motor.«
»Was immer das auch heißen mag«, sagte ich grinsend. »Aber klasse sieht er aus. Richtig sportlich. Und 584PS? Wo kann man die fahren?«
Chris grinste. »Am besten nachts auf der A303, wenn kaum jemand unterwegs ist. Also zwischen drei und vier.«
Shakti und ich starrten Chris groß an.
»Du bist doch nicht …«, begann Shakti stockend.
»Klar. Dad war dabei. Na los, steigt ein, ich fahre uns nach Hause.«
Wir drei quetschten uns auf den Rücksitz, wobei Colin Probleme hatte, seine langen Beine unterzubekommen.
»Weißt du, Rebecca, sollte Chris bremsen müssen, verliere ich alle Zähne«, sagte ich.
»Wieso?«, fragte Rebecca gedankenverloren, weil sie den Bordcomputer inspizierte.
»Weil Colins Knie an meinem Kinn hängt und er vorne sitzen sollte«, erklärte ich säuerlich. Sie drehte sich nicht einmal zu uns um, sondern begutachtete die Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel.
»Ihr wollt nicht wirklich erleben, was passiert, wenn ich hinten sitze.« Rebecca strich neugierig über das verchromte Armaturenbrett und öffnete das Handschuhfach.
»Finger weg!«, rief Chris noch, doch: zu spät.
Es wippte auf und ein paar eingeschweißte, viereckige Plastiktütchen fielen zu Rebeccas Füßen. Wir drei vom Rücksitz beugten uns alle gleichzeitig vor, um eine bessere Sicht zu haben. Was nicht nötig war, denn Rebecca hielt ein Tütchen mit breitem Grinsen in die Höhe.
»Also dafür hast du das Auto bekommen«, sagte sie anzüglich. »Damit du die Mädchen nicht erst mit nach Hause nehmen musst …«
»Tu’s zurück, ja? Wer weiß, ob ich es nicht schon bald brauche.« Chris zuckte mit den Schultern.
»Träum weiter«, sagte ich und riss Rebecca das Päckchen aus der Hand.
»Das kannst du nicht wissen«, widersprach Chris. »Das Mädel vorhin …«
»Das meine ich nicht. Hier ist nicht genug Platz, um eine Liegesitz-Position hinzubekommen. Ich beweise es dir.« Ich riss die Verpackung des Kondoms auf und begann es wie einen Luftballon aufzublasen. Shakti neben mir zog entsetzt ihren Kopf zurück. Ihre Haare wurden bereits elektrisch.
»Wow, Chris, du alter Angeber«, rief Rebecca und betrachtete kichernd das schon bowlingkegelgroße Kondom. »Die XXL-Formate?« Rebecca zückte ihr Handy.
»Die haben Einheitsgrößen, du Anfängerin«, brummte Chris und sah argwöhnisch zu, wie ich das Kondom noch weiter aufblies.
»Was soll das werden, Meredith?«
Ich hörte auf und verknotete die Enden.
»Also, eine Theorie besagt, dass nur dort, wo ein aufgeblasenes Kondom fliegen kann, man auch Platz zum Sex hat.« Ich gab dem aufgepusteten Präservativ einen Klaps und es blieb an den Kopfstützen hängen. »Chris, du wirst dir in den Kofferraum eine Luftmatratze legen müssen«, sagte ich in einem mitleidigen Tonfall.
»Das hast du doch jetzt erfunden«, sagte Chris und zerrte an dem Ballon, der quer vor meiner Nase zwischen den Stützen hin und her schaukelte. Die Werbung hatte nicht zu viel versprochen. Es war extrem widerstandsfähig.
»Vielleicht. Vielleicht wollte ich auch nur deine neue Freundin auf dein Vorhaben hinweisen.«
Ich deutete aus dem Fenster, wo sich sämtliche Mitschüler des Colleges versammelt hatten und lachend ins Innere blickten.
Miranda stand auch dabei und man konnte ihr deutlich ansehen, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder verärgert sein sollte.
Rebecca schaffte es, den Ballon zu befreien, ließ die Scheibe an ihrer Tür herunter und rief dem Mädchen zu: »Das ist seines!« Dabei deutete sie mit dem Daumen rückwärts auf Colin. Das aufgeblasene Kondom bekam einen weiteren Klaps und flog zum Fenster raus, wo sich sofort ein paar Schüler darauf stürzten und es in die Menge schlugen.
Chris startete den Motor.
»Ehrlich, Leute, ihr seid peinlich.« Shakti war unter ihrer walnussbraunen Haut knallrot geworden.
Colin und ich grinsten uns an. So verliebt Shakti auch immer war, dank ihrer Erziehung war sie gleichzeitig auch erzkonservativ.
Allerdings hatte sich das tatsächliche Problem dadurch noch immer nicht gelöst. »Rebecca, würdest du mit Colin tauschen? Er hat hier hinten keinen Platz.«
»Wenn ich hinten sitze, muss ich immer kotzen«, wiederholte sie standhaft. »Und diese Tütchen im Handschuhfach können keinesfalls das auffangen, was dann rauskommt.«
»Sie bleibt vorn sitzen«, bestimmte Chris.
»Schon okay, Mere. Es geht doch«, sagte Colin leise, obwohl es nach dem Gegenteil aussah. Wir saßen dicht an dicht und ich wusste erst nicht, wohin mit meinen Händen, um Colin eine Berührung zu ersparen, bis er von sich aus einen Arm um meine Schultern legte und dabei seine Finger meinen Nacken streiften. Erst jetzt fiel mir wieder ein, dass diese düsteren Visionen von ihm der Vergangenheit angehörten. Das machte mir Mut.
»Tu die Beine hier rüber«, sagte ich und legte meine über seine. So konnte er sich wenigstens etwas strecken. Chris fuhr an und ich registrierte Colins Daumen, der an meiner Schulter ruhte – direkt auf meiner Haut, dort, wo der Saum des T-Shirts endete. Das war ungewohnt und wälzte wieder ein Problem in den Vordergrund, das ich so gern verdrängt hätte.
Ich wagte einen Blick zu ihm hin. Er betrachtete die verchromten Griffe der Innentür. Schnell schaute ich wieder nach vorn, was sich aber als Fehler herausstellte. Chris fuhr einen sehr rasanten Stil. Er beschleunigte das Auto und machte sich gleichzeitig am Radio zu schaffen.
»Chris!«, rief Shakti. Er war mit dem Wagen zu weit auf die rechte Fahrspur gekommen und ein Lkw-Fahrer hupte wütend. Colins Finger krallten sich in meinen Oberarm, als Chris mit einem energischen Schlenker den Wagen wieder nach links zog. Mein Magen machte einen kleinen Hüpfer.
Colin und ich tauschten einen Blick.
»Sorry, Leute«, rief Chris gut gelaunt. »Ich finde nur den Sender nicht. Ich wollte euch doch diese verdammt gute Anlage vorführen.«
»Du darfst Schlenker fahren, so viel du willst, solange du nur dabei auf die Straße schaust. Ich suche das passende Lied«, erklärte Rebecca und verscheuchte ihn vom Radio.
»Hoffentlich wird das kein Requiem«, murmelte ich. Colin lächelte matt. Wir drei auf der Rückbank waren alle blass.
Rebecca dagegen strahlte genauso breit wie Chris. »Das ist sooo toll, dass wir jetzt einen Wagen haben! Lasst uns am Wochenende nach Swindon ins The Vic fahren!«, schlug sie vor.
»Da spielt David Bowie!«, rief Shakti aufgeregt.
»David Bowie, ich bitte dich. Ich wollte doch nicht mit meinem Dad da hingehen«, schnaubte Chris. »Wir könnten auch nach London fahren.«
Auf einmal waren wir alle ganz aufgeregt. London! Nicht nur raus aus dem Kaff Lansbury, sondern raus aus Wiltshire! Das bot ungeahnte Möglichkeiten.
»Das darf ich meinem Dad dann allerdings nicht erzählen.« Colin zog die Augenbrauen zusammen.
»Keine Bange.« Chris grinste ihn im Rückspiegel an. »Wir sagen einfach alle, dass wir in Swindon waren. Die fünfzehn Meilen Entfernung werden dir doch erlaubt sein, oder? Und Rebecca vermeidet jeglichen Arztbesuch in den nächsten fünf Wochen, damit sie es nicht versehentlich ausplaudert.«
Ich sah in Colins zweifelndes Gesicht und wusste genau, was ihn beschäftigte. Dr. Adams war niemand, den man leichtfertig hinterging. Er konnte sehr unangenehm werden, sobald es nicht seiner Auffassung nach lief.
Chris fuhr im gleichen schnittigen Tempo um die letzten beiden Kurven und machte eine Vollbremsung vor meinem Zuhause. Vermutlich waren jetzt schwarze Bremsstreifen auf dem Asphalt.
Wir machten uns daran, aus dem Wagen zu steigen, aber weil Colins und meine Beine so ineinander verschlungen waren, brauchten wir ein paar Minuten. Und ich konnte nicht wirklich entscheiden, ob meine Beine sich so merkwürdig anfühlten, weil sie eingeschlafen waren, oder ob es einen anderen Grund gab, dass sie die Konsistenz von luftleeren Ballons angenommen hatten.
»Du brauchst nicht auszusteigen, Colin, ich fahr dich heim«, erklärte Chris, als Colin seine Tasche ebenfalls aus dem Kofferraum holte.
»Ich habe noch was mit Meredith zu klären.« Colin nickte ihm zu. »Ehrlich, ein tolles Auto!« Er schloss die Tür und winkte. Chris rauschte davon. Der Motor röhrte tief und ich spürte mein Rückenmark vibrieren. Keine Frage, ab heute waren wir mobil.
Sofort wurden meine Knie noch wackeliger.
»Wollen wir einen Kaffee trinken? Oder hast du jetzt Angst vor mir?«
Colin sah mich groß an. Wenn es nicht Colin gewesen wäre, hätte ich geschworen, er wolle mich damit beeinflussen. Aber ich kannte Colin schon so lange. Er manipulierte nicht, vermutlich wusste er nicht einmal, wie man das machte.
»Wieso sollte ich Angst vor dir haben? Ich glaube, wir haben schon mehr als einen Kaffee gemeinsam getrunken und wir werden wohl auch noch viele mehr zusammen trinken.« Ich schulterte meinen Rucksack. »Aber erst muss ich nach Hause. Und ich denke, du auch. Dein Vater kriegt sonst die Krise.«
Ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Ja, dann sagen wir in einer Stunde? Im Circlin’ Stone?«
Ich schüttelte den Kopf. Heute Nachmittag ging nicht. Da war etwas, was ich noch erledigen musste. Meine Mutter und ich schoben es nun schon seit Wochen vor uns her. »Mum hat ihren freien Nachmittag«, sagte ich. »Ich komme dich heute Abend abholen, okay?«
Colin nickte, streckte seine Hand aus und berührte kurz die meine. Dann lächelte er und ging.
Ich drehte mich um, aber die ungewohnte Berührung kribbelte, bis ich im Haus war.
4. Kapitel
»Bin in der Küche!«, schallte es mir entgegen, sobald ich die Tür geöffnet hatte.
Ich hängte meine Jacke auf und folgte dem Klang des Radios. Mum saß am Küchentisch und sah nicht auf, als ich eintrat. Ihr Blick war auf das Sammelsurium vor ihr konzentriert.
»Na, was sagen die Karten heute? Aber ich warne dich, Mum. Wenn du irgendwann mit Turban hier sitzen solltest, ziehe ich aus.«
Sie kicherte.
Ich warf meine Tasche in die Ecke und schaute in die Mikrowelle. Fisch und Kartoffelbrei. Annehmbar.
»Weißt du, Meredith, das Blatt heute macht mir Sorgen. Irgendwie kommen ständig die gleichen Karten zum Vorschein.«
Ich schaltete die Mikrowelle an, schenkte mir etwas Saft ein und setzte mich zu Mum an den Küchentisch, auf dem ihre Tarotkarten ausgelegt waren. Ich hatte sie seit jeher als gruselig empfunden. Nicht nur auf Grund ihres seltsam mittelalterlichen Aussehens, sondern auch wegen ihrer Namen: der Tod, der Gehängte, der Teufel.
»Siehst du das? Ich habe die Karten nur gefragt, was du wohl nächsten Sommer machen wirst. Dann hast du die A-Levels in der Tasche, und was dann? Für ein Studium reicht das Geld nicht.«
»Mum, wir hatten das doch schon oft. Ich werde ein Stipendium beantragen«, erklärte ich geduldig. Mit Dads Geld als Fernfahrer und Mums kleinem Gehalt als Verkäuferin im Drogeriemarkt konnten sie den Kredit für das Reihenhäuschen gerade eben so abbezahlen und leben. Manchmal legte Mum die Karten für jemand anderen und bekam dafür eine kleine Zuwendung. Nicht viel, aber sie legte es sparsam auf die Seite. Das war’s auch schon. Ein teures Schulgeld war da nicht drin. Ich hätte ja gern zum Unterhalt beigetragen, aber Dad und Mum wollten nicht, dass ich einen Nebenjob annahm. Sie waren sehr stolz auf meine schulischen Leistungen und hatten Angst, dass etwas weniger Freizeit meine Noten absacken lassen würde. Mum sah das Glas immer halb leer.
»Mag sein, aber die Karten zeigen was anderes. Die sind sich nicht sicher, ob das mit dem Studium etwas wird.«
Ich hob eine Augenbraue. »Können die Karten voraussehen, ob ich die A-Levels schaffe? Und wenn ja, kannst du sie auch nach den Prüfungsaufgaben befragen?«
Mum warf mir einen strengen Blick zu. »Mach keine Scherze. Die Karten lügen nicht.«
»Nein, aber sie sagen auch nicht ganz die Wahrheit.«
»Meredith, du weißt genau, dass es so nicht funktioniert. Ich kann nur ihre Signale deuten. Sieh mal, hier der Tod …«
»Steht für eine Änderung, etwas Neues, ich weiß.«
»Und die Sieben Schwerter stehen dafür, dass dich jemand über den Tisch ziehen will.«
Die Mikrowelle bingte. Ich stand auf und setzte mich mit dem dampfenden Teller wieder an den Tisch.
»Erklär den Karten, dass ich vorhabe in Bath Physik oder Naturwissenschaften zu studieren und das auch durchziehen werde.«
Mum mischte die Karten und legte sie akribisch genau vor sich hin. »Zieh sieben«, befahl sie mir. Ich griff halbherzig mit der rechten Hand zu, während ich mit der linken zu essen begann.
Von den sieben Karten, die wenig später offen auf dem Tisch lagen, erkannte ich nur den Tod. Obwohl meine Mutter seit Jahren Tarotkarten legte, hatte ich mir nie merken können, wofür welche Karte stand. Bis auf den Tod. Den hatte ich immer so schaurig gefunden.
Mum schüttelte den Kopf. »Siehst du? Schon wieder. Genau die gleichen Karten. Und das jetzt zum vierten Mal. Und du glaubst noch immer nicht daran?«
Ich zuckte mit den Schultern. Das war mir ein wenig zu abgedreht. Und unheimlich. Ich befasste mich lieber mit Fakten, Tatsachen und Dingen, die man logisch erklären konnte.
»Hast du es mal mit Hellsehen probiert? Denk dran, für die Prüfungsaufgaben in Mathe wäre ich sehr dankbar. Und wenn du so magnetische Felder aufbauen würdest, könnten wir Strom sparen«, schlug ich vor.
Mum kicherte. »Mit vollem Mund spricht man nicht«, sagte sie, aber dann verdunkelte sich ihr Blick sofort wieder. »Meredith, ich mach mir Sorgen. Es geschieht etwas in der nächsten Zeit. Pass auf dich auf, ja?«
»Mach ich doch immer.« Ich lächelte sie an. Meine Mutter arbeitete hart, ihre Schichten in der Drogerie waren anstrengend, und auch wenn sie mir manchmal mit ihren Karten auf die Nerven ging, hatte sie sich dieses harmlose Vergnügen wirklich verdient. Auch wenn ich mir für sie ein Hobby gewünscht hätte, das ihr nicht noch mehr Kummer bereitete.
»Wann kommt Dad nach Hause?«, fragte ich und räumte den leeren Teller in die Spüle. Mum beugte sich wieder über die Karten, als würden sich deren Bilder verändern, wenn man sie länger anstarrte oder hin und her schob.
»Wenn keine unvorhergesehenen Staus oder ein platter Reifen auftreten, ist er Freitag gegen fünf hier.«
Ich drehte mich zu ihr um und holte tief Luft. »Mum?«
»Ja?« Ihre Stimme war mit einem Mal zittrig.
»Ich treffe mich später noch mit Colin. Wir hätten jetzt drei Stunden Zeit. Sollen wir es hinter uns bringen?«
Mum hielt in ihrer Bewegung inne. Endlich nickte sie.
»Ja«, sagte sie tonlos, raffte das Blatt zusammen und erhob sich. »Lass uns fahren.«
5. Kapitel
D
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: