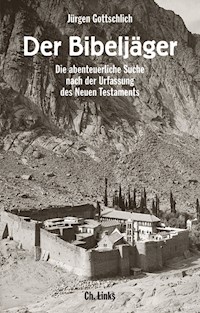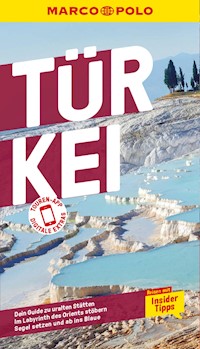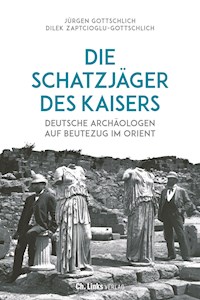
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Pergamonaltar, das Markttor von Milet, die Löwen von Babylon, die Büste der Nofretete - das alles sind Schätze, die wir heute in deutschen Museen bewundern. Woher stammen diese Werke? Wann und unter welchen Umständen sind sie nach Deutschland gekommen? Sind wir eigentlich die rechtmäßigen Besitzer dieser weltberühmten Kulturgüter? Jürgen Gottschlich und Dilek Zaptcioglu-Gottschlich unterziehen die Geschichte archäologischer Ausgrabungen und ihres Abtransports ins Deutsche Kaiserreich einer eingehenden Prüfung. Im Mittelpunkt stehen die Expeditionen berühmter Ausgräber wie Carl Humann, Theodor Wiegand und Robert Koldewey einerseits und die überwiegend nationalistischen Motive ihrer Beutezüge im Dienst des Kaisers andererseits. Ging es in der Raubkunst-Debatte bislang eher um Kunstwerke aus afrikanischen und asiatischen Kolonien, wird hier erstmals ein Buch zu archäologischen Funden im ehemaligen Osmanischen Reich vorgelegt. Genauso wichtig wie die Forderung nach Restitution ist dabei die Frage: Wie machen wir das Weltkulturerbe möglichst vielen Menschen zugänglich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jürgen Gottschlich, Dilek Zaptcioglu-GottschlichDie Schatzjäger des KaisersDeutsche Archäologen auf Beutezug im Orient
JÜRGEN GOTTSCHLICH
DILEK ZAPTCIOGLU-GOTTSCHLICH
DIE SCHATZJÄGER DES KAISERS
DEUTSCHE ARCHÄOLOGEN AUF BEUTEZUG IM ORIENT
Ch.LinksVERLAG
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
Entspricht der 1. Druckauflage von 2021
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2021
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung,Hamburg, Kamil Kuzin, unter Verwendung eines Fotos
der bpk-Bildagentur, Bild-Nr. 20032659, Carl Humann undRichard Bohn bei der Ausgrabung in Pergamon um 1880
Karten: Peter Palm, Berlin
Satz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-96289-126-8
eISBN 978-3-86284-501-9
INHALT
VORWORT
1 ANTIKE KUNST ALS SYMBOL DEUTSCHER MACHT
Der deutsche Bauingenieur Carl Humann findet den Pergamonaltar und will ihn im Deutschen Kaiserreich wieder aufbauen
2 »WIR MÜSSEN ALLE ZUM ALTAR GEHÖRIGEN DINGE BEKOMMEN.«
Die Fundteilung – Carl Humann und der Antikenchef der Berliner Museen Alexander Conze wollen alles
EXKURS: ANMERKUNGEN ZU HEINRICH SCHLIEMANN
Troja und der Schatz des Priamos
3 DAS LÄNGSTE JAHRHUNDERT DER OSMANEN
Wie das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert in die Abhängigkeit europäischer Großmächte geriet und antike Kunstwerke zur politischen Währung wurden
4 OSMAN HAMDI BEY – DER BEGRÜNDER DER TÜRKISCHEN ARCHÄOLOGIE
Ein türkischer Antikendirektor wird Partner und Gegenspieler der ausländischen Archäologen im Osmanischen Reich
5 THEODOR WIEGAND – DER ARCHÄOLOGE DES KAISERS
Der steile Aufstieg eines Praktikanten zum wichtigsten Organisator der deutschen Grabungen im Orient
6 VOM SCHLUCKEN GROSSER BROCKEN
Wie die Beute deutscher Archäologen nach Berlin geschleust wurde
7 DIE LÖWEN VON BABYLON
Robert Koldewey findet den Turm von Babel und die Prozessionsstraße von Babylon
8 DIE ASSUR-AKTE
Wie die Funde in Assur fast zum Bruch zwischen dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich führten
9 DER STREIT UM DIE KÖNIGIN NOFRETETE
Von Richard Lepsius bis Ludwig Borchardt – Die Deutschen auf Beutezug in Ägypten
10 ARCHÄOLOGEN IM ERSTEN WELTKRIEG
Wie Graf Ladislaus Eduard Almásy, Lawrence von Arabien, Baron von Oppenheim, Theodor Wiegand und andere Archäologen zu Spionen und Abenteurern wurden 229
11 DAS PERGAMONMUSEUM
Der Tempel der orientalischen Schätze und warum sie so selten gezeigt werden
12 VERANTWORTUNG FÜR DAS WELTKULTURERBE
Ein Fazit
ANHANG
Die wichtigsten Akteure
Zeittafel
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Dank
Personenregister
Karten
Die Autoren
VORWORT
B is heute gelten die Pioniere der Archäologie als Helden der Wissenschaft. Die Ausgräber des 19. Jahrhunderts, die Männer – es handelte sich fast ausschließlich um Männer –, die am Nil in Ägypten, in den Wüsten Mesopotamiens oder in der Wildnis rund um die Ägäis jahrtausendealte Kulturen wieder ans Licht brachten, gelten weithin als verwegene Aufklärer, die oft unter Einsatz ihres Lebens vergangene Kulturen freigelegt, entschlüsselt und tote Sprachen wieder zum Leben erweckt haben.
Fast alle rühmten sich damit, für die Wissenschaft und das menschliche Verständnis der eigenen Geschichte unersetzliche Artefakte ans Licht gebracht und damit oft genug vor den dort beheimateten Barbaren gerettet zu haben. Denn den Menschen, die im 19. Jahrhundert an den Stätten der antiken Hochkulturen lebten, also in Ägypten, Griechenland und der heutigen Türkei, wurde unterstellt, dass sie ignorant und unwissend seien und ausschließlich am materiellen Wert der antiken Vergangenheit Interesse hätten.
Doch diese Schwarz-Weiß-Erzählung muss historisch durchleuchtet und vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Tatsächlich haben die Großen der Archäologie Enormes geleistet, oft auch unter Einsatz von Leib und Leben. Doch ging es dabei nie nur um rein wissenschaftliche Erkenntnisse, diese waren eher ein Beiprodukt des eigentlichen Zieles, dem Erwerb von antiken Schätzen. Die Kunst und die Kulturgüter der alten Ägypter, der Babylonier und Assyrer, Perser und frühen Griechen waren Repräsentationsund Machtobjekte der europäischen Großmächte, zu denen sich am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts noch die US-Amerikaner hinzugesellten. Angefangen von Napoleons Feldzug nach Ägypten 1798 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges dienten die Suche und spätere Präsentation möglichst eindrucksvoller antiker Artefakte am eigenen Hof, später in extra geschaffenen kaiserlichen oder königlichen Museen, dem Ruhm der jeweiligen Dynastie und der um Macht und Einfluss wetteifernden europäischen Länder.
Vorweg der Pariser Louvre und das Britische Museum, später auch die Museumsinsel in Berlin waren und sind Schatzkammern, in denen symbolisch Macht und Reichtum der früheren europäischen Großmächte zur Schau gestellt wurden und die heute auf die einstige Größe dieser Länder verweisen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren die Pioniere der Archäologie immer auch Agenten ihrer Länder und Schatzjäger zum Ruhme ihrer Herrscher.
Der Mann, der 1801 die berühmten Marmorskulpturen vom Fries des Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen abschlagen ließ, die sogenannten Elgin Marbles – bis heute die berühmtesten Stücke im Britischen Museum – war der damalige britische Botschafter in Konstantinopel, Lord Thomas Bruce, 7. Earl of Elgin und 11. Earl of Kincardine. Lord Elgin war ein Kunsträuber par excellence. Er zerstörte nicht nur große Teile des Parthenon, er ließ auch andere Antiken aus Athen abtransportieren und in sein Schloss nach Schottland bringen. Später rechtfertigte er den Kunstraub mit einem Argument, das geradezu stereotyp von europäischen Schatzsuchern im Orient immer wieder verwendet werden sollte: Er habe die Kunstschätze »nur retten wollen«, da ihnen im griechisch-türkischen Befreiungskrieg »die Zerstörung« gedroht hätte.
Den Ferman des Sultans, die Erlaubnis, die ihn 1801 dazu ermächtigt haben soll, »alte Steine mit Inschriften zu erforschen«, suchen Historiker im Osmanischen Archiv in Istanbul bis heute vergeblich. Vom Mitnehmen war ohnehin nie die Rede (siehe Kapitel 12). Trotzdem lehnt das Britische Museum die Rückgabe der Parthenon-Skulpturen an das Athener Akropolis-Museum beharrlich ab. Man habe die Skulpturen 1814 schließlich für viel Geld von Lord Elgin legal erworben.
Diese von Lord Elgin begründete Tradition setzte sich im 19. Jahrhundert in Mesopotamien weiter fort. Die beiden berühmtesten frühen Ausgräber an Euphrat und Tigris, der Franzose Paul-Émil Botta, der 1840 die assyrische Metropole Nimrud entdeckte, und der Engländer Austen Henry Layard, der wenig später Ninive ausgraben ließ, waren entweder schon im diplomatischen Dienst ihres Landes (Botta) oder nutzten ihre archäologischen Erfolge, um später eine steile Karriere im Auswärtigen Dienst zu machen (Layard). Beide waren – bei allen sonstigen Unterschieden – vorrangig »Beutemacher«, wie C. W. Ceram in seinem Klassiker »Götter, Gräber und Gelehrte« schreibt, der eine für den Louvre, der andere für das Britische Museum. Sie trugen zwar auch zur wissenschaftlichen Erforschung des assyrischen Großreiches um 2000 v. u. Z. bei, doch das war eher eine Betätigung im Nachhinein, als sie ihre Grabungserlebnisse publizierten und dafür den historischen Rahmen benötigten (siehe Kapitel 7).
Um Grabungserlaubnisse von der osmanischen Regierung in Konstantinopel kümmerten sie sich wenig. Gab es Probleme wegen ihres unerlaubten Handelns, sorgten ihre Botschaften am Hofe des Sultans, der damals bereits in die ökonomische und militärische Abhängigkeit der europäischen Großmächte geraten war, durch politischen Druck für die gewünschten Anweisungen an die Gouverneure vor Ort.
Damit war auch der Boden bereitet für die deutsche Schatzsuche im Osmanischen Reich. Bereits der erste deutsche Held des Spatens, der dort nach Ruhm und Ehre grub, Heinrich Schliemann, sorgte für mächtigen Ärger. Allerdings war Schliemann damals noch nicht diplomatisch geschützt. Er kam als Selfmademan, der sich allein von Homer ermächtigen ließ, auf dem Hisarlik-Hügel an den Dardanellen nach dem sagenumwobenen Troja zu suchen. Schliemann, wiewohl in Mecklenburg geboren und seiner Heimat bis ans Lebensende verbunden, reiste als amerikanischer Staatsbürger, und wenn er überhaupt Kontakt zu einer Botschaft in Paris, Athen oder Konstantinopel aufnahm, dann zur amerikanischen.
Im Jahr 1868 betrat Schliemann erstmals die historische Landschaft der Troas, um mit der »Ilias« in der Hand nach dem Hügel zu suchen, unter dem die Trümmer des homerischen Troja begraben liegen sollten. Es dauerte drei Jahre, bis Schliemann in großem Stil auf dem Hisarlik-Hügel mit Blick auf die Dardanellen graben ließ. Seinen Weltruhm verdankte er einem Zufallsfund 1873, als er am Fuße einer mächtigen Wehrmauer den von ihm so genannten Goldschatz des Priamos entdeckte und schnurstracks illegal außer Landes brachte.
Der Skandal dazu war erheblich. Schliemann wurde auf Antrag der osmanischen Regierung in Athen, wohin er den Schatz gebracht hatte, von einem griechischen Gericht zu einer Geldzahlung verurteilt. Schliemann überwies das Fünffache der Summe und erkaufte sich so die völkerrechtlich gültige Eigentumsbestätigung für seinen Priamos-Schatz. Dass die Affäre nicht zum Aus für weitere Grabungen in Troja führte und im Gegenteil Troja bis zum Jahr 2010 eine überwiegend »deutsche Grabung« blieb, war dem Einsatz eines anderen deutschen Hobbyarchäologen, Carl Humann, zu verdanken, einem Straßenbauingenieur, der in Konstantinopel bestens vernetzt war und sich für Schliemann einsetzte.
Mit Carl Humann begann in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts die eigentliche deutsche Grabungstätigkeit im Osmanischen Reich. Zwar war der deutsche Altertumsforscher Richard Lepsius bereits 1842 /43 im Auftrag des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm für das deutsche Vaterland zu einer archäologischen Expedition an den Nil gereist, doch Ägypten war zu dieser Zeit de facto nicht mehr Teil des Osmanischen Reiches. Als Carl Humann im Auftrag der Berliner Museen dann 1879 seine Grabung auf dem Burgberg von Pergamon begann und schließlich den berühmten Zeusaltar in Gänze nach Berlin schaffte, legte er den Grundstein für die deutsche Schatzsuche im Orient. Er brachte dem erst wenige Jahre zuvor, 1871, gegründeten deutschen Kaiserreich nicht nur ein antikes Juwel, das in Berlin die Hoffnung begründete, eines Tages vielleicht doch noch mit dem Louvre oder dem Britischen Museum gleichziehen zu können, sondern bahnte den Berliner Museen und später dem Deutschen Archäologischen Institut und der Deutschen Orient-Gesellschaft auch den Weg für äußerst erfolgreiche Jahre im Osmanischen Reich.
Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges hatten deutsche Archäologen eine führende, wenn nicht die führende Rolle bei der Schatzsuche im Osmanischen Reich. Im Auftrag ihres Kaisers waren sie an den spektakulärsten Grabungsplätzen in Troja, in Pergamon, in Milet und in der hethitischen Hauptstadt Bogazköy der englischen, französischen, russischen, österreichischen und italienischen Konkurrenz immer eine Nase voraus. Selbst in Mesopotamien, dem ureigensten Revier britischer und französischer Archäologen, schafften die Deutschen es, Fuß zu fassen und in Babylon und Assur wichtige Grabungen durchzuführen.
Die größten Schätze der Berliner Museumsinsel stammen aus diesen Grabungen im Osmanischen Reich in der Zeit von 1871 bis 1914. Der Pergamonaltar im eigens für ihn gebauten gleichnamigen Museum, das Markttor von Milet und die Prozessionsstraße von Babylon, die Highlights antiker Kunst der deutschen Museumslandschaft, stammen alle aus dem damaligen Osmanischen Reich. Einzige Ausnahme ist die Büste der schönen Nofretete aus Ägypten.
Liest man die Erklärungen der Berliner Museen, haben alle diese antiken Kostbarkeiten mit kolonialem Kunstraub nichts zu tun, sondern sind moralisch einwandfrei und völlig legal außer Landes nach Berlin gebracht worden. Tatsächlich war das Osmanische Reich keine deutsche Kolonie, doch der damals regierende Sultan Abdülhamid II. wurde nicht umsonst der »kranke Mann« vom Bosporus genannt. Nicht wegen seiner körperlichen Gebrechen, sondern weil das 500 Jahre alte Reich der Osmanen spätestens seit Mitte der 19. Jahrhunderts ökonomisch so schwach war, dass es nur noch mithilfe von Krediten der europäischen Großmächte weiter existieren konnte. Der Sultan wurde zum Spielball europäischer Interessen, und er musste bei Strafe des Untergangs das Spiel mitspielen. Unter diesen politischen Rahmenbedingungen fanden die Grabungen der ausländischen Schatzsucher statt (siehe Kapitel 3).
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war an der Beschaffung antiker griechischer Kunst höchst interessiert. Schon sein Vater, der schwer erkrankte Kurzzeitkaiser Friedrich III., mit dem Wilhelm II. ansonsten eher verfeindet war, hatte diese philhellenische Begeisterung für das Berliner Spreeathen gepflegt und sah das deutsche Kaiserreich in der Nachfolge der griechischen Heroen der Antike. Wilhelm II. gab für die Grabungen im Orient nicht nur erhebliche Summen aus seiner Privatschatulle, er betätigte sich auch selbst als Hobbyarchäologe auf Korfu, und er hielt engen Kontakt zur Leitung der Berliner Museen und der Orient-Gesellschaft. Theodor Wiegand, Ausgräber, Archäologe, Schatzsucher und Bevollmächtigter der Berliner Museen an der deutschen Botschaft in Konstantinopel seit 1895, pflegte einen direkten Kontakt zum Kaiser und wurde von diesem persönlich protegiert.
Wiegand war der Nachfolger von Carl Humann, der zum Dank für seinen Einsatz bei der Beschaffung des Pergamonaltars eine bezahlte Außenstelle der Berliner Museen in Smyrna – dem heutigen Izmir – an der Ägäisküste einrichten durfte. Über Wiegand lief fortan die Koordination sämtlicher deutscher Grabungen im Osmanischen Reich (siehe Kapitel 5).
Schließlich wurde es immer schwieriger, die Schätze außer Landes zu bringen. Denn längst hatte sich auch im Osmanischen Reich ein Interesse an der Antike entwickelt, das weit über die islamische Zeit zurückreichte. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es ähnlich wie in Berlin erste Bemühungen, antike Artefakte sicherzustellen und zu sammeln. Was als Fundsammlung in der ehemaligen Kirche Hagia Irini begann, führte in den 1880er Jahren zur Gründung des Kaiserlichen Archäologischen Museums in den Gärten des Topkapi-Palastes. Der Gründervater des Museums und zentrale Figur für Archäologie und Kunst auf osmanischer Seite war Osman Hamdi Bey, Sohn aus einer Aristokratenfamilie, der in Paris studiert hatte und sich den Erhalt der antiken Überreste für das Osmanische Reich zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Bereits 1884 veranlasste Osman Hamdi Bey den Sultan, ein generelles Ausfuhrverbot für Antiken zu erlassen, das frühere, weniger klare Regelungen ersetzte. Die Aufgabe Wiegands als Diplomat war es danach, Wege zu finden, das Ausfuhrverbot zu umgehen (siehe Kapitel 4).
Schon Carl Humann und seinem Berliner Mentor Alexander Conze, dem damaligen Chef der Antikensammlung der Berliner Museen, war bereits 1878, noch vor Beginn der Grabung auf dem Burgberg in Pergamon, klar, dass es nicht so einfach sein würde, den Altar außer Landes zu schaffen. Beide investierten in die Ausfuhr der Altarplatten fast so viel Zeit, Energie und Geld wie in die Grabung selbst. Legal ist deshalb bei der Ausfuhr der Altarplatten ein dehnbarer Begriff, wenn es auch nicht ein so offensichtlicher Kunstraub war wie beim Gold des Priamos oder den Parthenon-Friesen (siehe Kapitel 2). Auch der Abtransport der anderen antiken Schätze aus dem Osmanischen Reich nach Berlin ist eine Geschichte für sich, die in diesem Buch aus deutscher und osmanischer Sicht erzählt wird.
Anders als bei den Sammlungen außereuropäischer Kunst für das Humboldt Forum ist die Restitutionsdebatte, mit der sich viele europäische Museen konfrontiert sehen, bis zur Museumsinsel noch nicht richtig vorgedrungen. Allerdings dringt auch die Türkei, ähnlich wie Ägypten und Griechenland, vermehrt auf eine Rückführung illegal / legal ausgeführter Antiken. Das betrifft bislang vor allem den privaten Kunstmarkt und die Auktionshäuser. Doch ähnlich wie mit dem Akropolis-Museum in Athen oder dem neuen Ägyptischen Museum in Kairo entstehen auch in der Türkei immer mehr Museen, die sich hinter den großen europäischen Museen nicht mehr zu verstecken brauchen. Letztes Beispiel ist das 2018 eröffnete Troja-Museum direkt an der Grabungsstätte an den Dardanellen. Schon der letzte große deutsche Troja-Ausgräber, Manfred Korfmann, fand, dass die trojanischen Kunstschätze zumindest zeitweilig am Ort ihres Entstehens gezeigt werden sollten.
Dabei ist die Frage, wem der Goldschatz des Priamos oder die Büste der Nofretete oder der Zeusaltar von Pergamon gehören, gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wo und wie möglichst viele Menschen diese einzigartigen Stücke des Weltkulturerbes am besten ansehen und bewundern können. Schließlich handelt es sich dabei um ein Menschheitserbe, das höher zu bewerten ist als der nationale Besitz einzelner Staaten.
Sicher gehört die Büste der Nofretete eher an den Nil als an die Spree, und die Skulpturen vom Parthenon sind in dem neuen Akropolis-Museum direkt in Sichtweite der historischen Stätte gewiss wirkungsvoller als in den Räumen des Britischen Museums in London. Und auch der Zeusaltar wäre auf dem Burgberg in Pergamon in seiner Bedeutung und Wirkung eher verständlich als in der nachgebauten Aufstellung in Berlin – deshalb würde es ja auch heute keinem Archäologen mehr einfallen, historische Artefakte von ihrem Fundort zu entfernen –, doch die Situation im 19. Jahrhundert war nun einmal eine andere.
Deshalb sollte heute diskutiert werden, wie mit dem Erbe dieser Epoche von nicht einmal 100 Jahren, in der die europäischen Großmächte den Kunstraub im Orient als offizielle Politik betrieben, am sinnvollsten umgegangen werden kann. Das Ziel dabei muss sein, die antiken Schätze und das Verständnis für die Frühgeschichte der Menschheit möglichst vielen Nachgeborenen von heute nahezubringen.
1 ANTIKE KUNST ALS SYMBOL DEUTSCHER MACHT
Der deutsche Bauingenieur Carl Humann findet den Pergamonaltar und will ihn im Deutschen Kaiserreich wieder aufbauen
Die türkische Ägäisküste, im 19. Jahrhundert nannte man sie noch die Westküste Kleinasiens, gleicht über 2000 Kilometer Küstenlinie einem Freilichtmuseum, das weltweit seinesgleichen sucht. »Wer die griechische Antike besichtigen will«, sagt der türkische Archäologe Rüstem Aslan, »findet hier eine weit dichtere Abfolge grandioser antiker Stätten als in Griechenland selbst.« Rüstem Aslan ist seit 2013 der Grabungsleiter an einem der legendärsten Plätze aus der Bronzezeit: in Troja. Mit Homers »Ilias« über den Krieg um Troja beginnt die abendländische Literatur. Der blinde Dichter schrieb sein Werk vermutlich 800 Jahre v. u. Z., und er lebte wahrscheinlich in Smyrna, der heutigen Millionenstadt Izmir. Mit dem »Krieg um Troja«, der Stadt ganz im Nordosten der Ägäis, etwa auf der Höhe von Thessaloniki, die die Meerenge der Dardanellen bewachte, begann, noch im Reich der Mythen und Legenden, der Zusammenprall griechischer Eroberer und einheimischer Bewohner.
Der Krieg, über den Homer schrieb, fand wohl um 1180 v. u. Z. statt und endete zwar mit der Zerstörung Trojas, doch zu einer griechischen Besiedlung der kleinasiatischen Küste reichte es damals noch nicht. Die fand erst gut 300 Jahre später statt, mit ersten Kolonisten weiter im Süden, bei Ephesos und Milet, etwa auf der Höhe von Athen. Viele andere Siedler aus den griechischen Stadtstaaten folgten. In der Phase von 800 bis 100 v.u.Z. wurden Hunderte griechische Siedlungen an der kleinasiatischen Küste gegründet, die wie Milet, Ephesus und Foca ihre Mutterstädte bald überstrahlten. Folgt man der Küste von Troja aus nach Süden, gelangt man, an mehreren kleineren griechischen Tempeln und Weihestätten vorbei, zunächst nach Assos, einer antiken Stadt gegenüber der griechischen Insel Lesbos, in der zeitweilig Aristoteles gelehrt haben soll. Etwas entfernt von der Küste folgt dann Pergamon, rund 100 Kilometer südlich kommt Izmir.
Ab Izmir stolpert man dann fast alle 20 oder 30 Kilometer über griechische antike Stätten. Nach Kolophon und Klaros kommt das berühmte Ephesus, dann Magnesia, Aphrodisias, Priene, Milet, Didyma, Euromos, Milas und Halikarnassos, um nur die wichtigsten zu nennen. Bevor die Küste dann nach Osten ins Mittelmeer abbiegt, findet sich noch das wunderschöne Knidos, ganz an der Spitze einer fast 200 Kilometer langen Halbinsel. Alle diese antiken Stätten sind im 18., 19. und 20. Jahrhundert von europäischen Forschungsreisenden »entdeckt«, teilweise ausgegraben und erforscht worden.
Das blieb nicht ohne Folgen. Diese Stätten wurden regelrecht geplündert. Viele der spektakulärsten Kunstwerke und Monumente, die griechische und später auch römische Architekten, Bildhauer und Maler geschaffen haben, finden sich heute in europäischen Museen. Nach Darstellung antiker Quellen rühmten sich die ehemaligen Zentren hellenistischer Kultur in Kleinasien mindestens dreier Weltwunder: des Zeusaltars auf dem Burgberg in Pergamon, des Artemis-Tempels in Ephesus und des Grabmals von König Mausollos in Halikarnassos.
Von diesen drei Weltwundern ist heute vor Ort praktisch nichts mehr zu sehen. Das Mausoleum von Mausollos, das zum Namensgeber für prächtige Begräbnisstätten überhaupt wurde, zerstörten im 15. Jahrhundert die Johanniter-Kreuzritter, um mit dem Material eine Burg zu bauen. Besonders gut erhaltene Marmorfriese, die die Ritter komplett in ihre Burgmauer eingesetzt hatten, ließ der englische Botschafter in Konstantinopel Sir Stratford Canning zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus der Mauer herausbrechen und nach London verschiffen. Die letzten Säulen des Artemis-Tempels verschwanden ebenfalls nach Europa, vor allem nach England, und der Zeusaltar von Pergamon ist heute die Hauptattraktion des Pergamonmuseums in Berlin.
Das griechische Pergamon
Der Eindruck, den Besucher heute von der antiken Stätte in Pergamon bekommen, wenn sie aus der Seilbahn steigen, die den 400 Meter hohen Burgberg hinauffährt, täuscht. Denn der eindrucksvolle Tempel, den sie als Erstes auf dem höchsten Plateau des Berges sehen, ist dem römischen Kaiser Trajan gewidmet; er hat mit dem hellenistischen Pergamon des Pergamonaltars nichts zu tun. Die in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von deutschen und türkischen Archäologen rekonstruierten Tempelfragmente stammen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeit, als Rom bereits die Macht in Kleinasien übernommen hatte.
Zeitlich näher kommt man dem berühmten griechischhellenistischen Pergamon erst, wenn man die Kellergewölbe des Trajan-Tempels durchquert hat und plötzlich vor einem steil abfallenden Theater am westlichen Hang des Burgberges steht. Die Grundkonstruktion des Theaters stammt aus der hellenistischen Blütezeit im dritten und zweiten Jahrhundert v. u. Z. Mit der Theaterbühne und dem Dionysos-Tempel am Ende der unteren Theaterterrasse ist man dann in der Zeit der Attaliden angekommen, dem griechischen Herrscherhaus, das den berühmten Altar, der heute das Kernstück des Pergamonmuseums in Berlin ist, in Auftrag gegeben hatte.
Sockel des Zeusaltars, wie er heute in Pergamon zu sehen ist
Von diesem antiken Weltwunder, dem Pergamon seinen Ruhm verdankt, ist dagegen für den Besucher der antiken Stätte kaum mehr als eine Andeutung zu erkennen. Etwa 50 Meter unterhalb der Akropolis, auf einer Bergterrasse, von der aus man weit ins Tal schauen kann, befindet sich ein rechteckiger Erdhügel, teilweise noch von ein paar Steinquadern eingefasst, der von einer großen schönen Pinie beschattet wird. Lediglich eine Infotafel macht den Besucher darauf aufmerksam, dass hier einmal der berühmte Zeusaltar gestanden hat.
Auf einer erhöhten Plattform, die von dem berühmten, über zwei Meter hohen Fries in einem Rechteck umgeben war, opferten die Bürger von Pergamon ihren Göttern. Von diesen Marmorfriesen, die den Kampf der Götter gegen die Giganten in so eindrucksvoller, vollendeter Form zeigen, dass Pergamon heute noch als ein Höhepunkt griechischer antiker Kunst gilt, ist vor Ort nichts geblieben, nicht einmal eine Kopie oder große Fotos.
Gebaut wurde der Altar in den Jahren zwischen 180 und 170 v. u. Z. im Auftrag des berühmtesten pergamenischen Königs Eumenes II. Der Altar, so der Pergamon-Ausgräber Wolfgang Radt, war eine Weihung an die siegverleihende Stadtgöttin Athena.1 Vermutlich hatte Eumenes II. die Kultstätte nach einem Sieg über die Galater errichten lassen, einer ursprünglich germanischen Volksgruppe, die aus dem Norden eingewandert war und die Gegend verunsicherte.
In der Spätantike, den letzten zwei Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung, war der Altar in der gesamten griechisch-römischen Welt bekannt als Kunstwerk, das nicht seinesgleichen hat. Doch als im vierten Jahrhundert u. Z. durch Kaiser Konstantin den Großen das Christentum zur vorherrschenden Religion im Römischen Reich wurde, geriet der Pergamonaltar wie viele andere Heiligtümer der alten Religionen in Verruf. Du sollst keinen Gott haben neben mir, dieser kategorische Imperativ aus dem Alten Testament führte vielerorts dazu, dass die heidnischen Tempel zerstört wurden. So auch in Pergamon. Unter der Herrschaft byzantinischer Kaiser wurde der Altar im 5. Jahrhundert u. Z. zerstört. Doch weil große Marmorplatten für andere, neue Bauten vorzüglich verwendet werden konnten, wurde ein großer Teil der kostbaren Friesplatten in eine Stützmauer integriert, mit deren Hilfe am Hang ein Plateau geschaffen wurde, auf dem die Byzantiner dann selbst neu bauen konnten.
Die Friesplatten, die nicht für den Mauerbau benutzt wurden, fanden sich später umgestoßen und teilweise zerbrochen im Gelände verstreut wieder. Zeus und Athena waren das Gesicht abgeschlagen worden. Im 19. Jahrhundert waren sie von meterhohen Erd- und Schuttschichten bedeckt.
»Mancher mag es bedauern, dass der Pergamonaltar heute nicht an seinem alten Ort wiederaufgestellt zu besichtigen ist, sondern, ohne die Beleuchtung durch das südliche Licht, ohne die erhabene Atmosphäre des Burgberges, in einem Museumssaal steht«, schreibt Wolfgang Radt, Grabungsleiter von 1972 bis 2005, unter dessen Ägide die Teilrekonstruktion des Trajan-Tempels stattfand. Er bedauert es wohl auch, hält aber noch in seinem 1988 erschienenen Buch an der Behauptung fest, dass nur durch den Abtransport das antike Monument »vor dem sicheren Untergang gerettet« werden konnte.2
Der erste Besuch des Schicksalsberges
Der deutsche Bauingenieur Carl Humann sah 1865, als er das erste Mal seinem Schicksalsberg begegnete, nur noch eine unter Schutt und Staub verborgene Trümmerlandschaft. Humann, der für die osmanische Regierung bereits mehrere Straßenbauprojekte vorbereitet hatte, war im Winter 1864 /65 im Auftrag von Großwesir Fuad Pascha auf einer topografischen Erkundungstour an der nördlichen Ägäisküste, gegenüber von Lesbos. Von Dikili aus, einem kleinen Fischerdorf, war es in den Worten von Humann »nur ein Ritt von fünf Stunden« bis zum antiken Pergamon. Humann, der während seines Studiums an der Bauakademie in Berlin viele Stunden mit »dem Zeichnen von Antiken« verbracht hatte, kannte die Geschichten über das sagenhafte pergamenische Reich der Attaliden, einem Herrschergeschlecht aus den Reihen der Diadochen, den Nachfolgern Alexanders des Großen.
Deshalb wollte er die Gelegenheit, Pergamon zu sehen, »trotz strömenden Regens« nicht verpassen. »Dikili, gegenüber von Mytilene [Lesbos] ist der gewöhnliche Landungsort, um nach Bergama [der Stadt am Fuße des Burgberges] zu reiten«, schrieb er später über seinen ersten Pergamon-Besuch. »Die vom Kaikosfluss durchströmte Ebene ist an die zwei Stunden breit. Ich fand sie aber damals fast unbebaut. Immer unmittelbar am südlichen Fuße des Gebirges ging es diese Ebene hinauf, bis endlich, an einer Wendung des Weges, eine Stunde bevor man die Stadt erreicht, plötzlich die hohe Akropolis von Pergamon in der Ferne breit und majestätisch vor mir lag.«3
Nachdem er die Stadt erreicht hatte, machte er sich gleich zu Fuß an den Aufstieg zur Burg. »Dem flüchtigen Besucher erschien sie als ein einziges Schuttfeld, von Rasen und niederem Buschwerk bedeckt, durchsetzt von Mauerzügen, die aus den verschiedensten Zeiten herrühren und deren Zusammenhang auf den ersten Blick nicht klar wird. Auch auf der obersten Fläche ragte nach allen Seiten hin massives Fundament, oft sich kreuzend aus dem Boden hervor. Namentlich aber stehen noch, im Osten wie im Westen den Abhang begrenzend, die hohen Stützmauern der Attalidenzeit. Keinen Quaderstein von ihnen haben die Jahrhunderte zu verschieben gemocht. Oberhalb der westlichen Stützmauern betrat ich den Trümmerhügel, den man den Tempel der Athena Polias hat nennen wollen [später als Trajan-Tempel identifiziert]. Traurig stand ich da und sah die herrlichen, fast mannshohen korinthischen Kapitelle, die reichen Basen und andere Bauglieder, alles um- und überwuchert von Gestrüpp und wilden Feigen. Daneben rauchte der Kalkofen, in den jeder Marmorblock, welcher dem schweren Hammer nachgab, zerkleinert wanderte. Einige tiefe, frisch gezogene Gräben zeigten, welche Fülle von Trümmern unter der öden Bodenfläche lagerte; je kleiner zersplittert, desto angenehmer waren sie den Arbeitern. Das also war übrig geblieben von dem stolzen, uneinnehmbaren Herrschersitz der Attaliden! Barg der Boden noch Reste von all den Kunstschätzen, welche diese Medicis der Diadochenzeit hier zusammengetragen und errichtet hatten? In weiten Zickzacklinien verließ ich, immer über Bauschutt hinabsteigend, die Burg; über tausend Rätseln sinnend gelangte ich mißmutig wieder zum Meere.«
Humann deutet in dieser allersten Begegnung mit Pergamon bereits an, was später als eine der Begründungen für die Plünderung der antiken Stätte herhalten musste. Die Kunstwerke mussten gerettet werden vor den Barbaren, die die Reste, die sie fanden, zu Kalk verbrannten. Humann ist nicht der einzige Europäer, der seine Schatzsuche später als Rettungsaktion verbrämte. Fast alle Ausgräber des 19. Jahrhunderts, die im Osmanischen Reich nach Kunstschätzen aus der Frühgeschichte und der Antike fahndeten, sahen sich als Retter und nicht als Räuber. Humann jedenfalls hat nach eigenen Angaben zunächst einmal seine Kontakte zum Großwesir genutzt, um die Kalkbrennerei auf dem Pergamonberg verbieten zu lassen.
Eine Karriere als Straßenbauingenieur
Der mehr oder weniger mittellos ins Osmanische Reich eingewanderte Carl Humann hatte dort in wenigen Jahren eine beachtliche Karriere hingelegt. Geboren worden war er am 4. Januar 1839 in Essen an der Ruhr als einer von vier Söhnen und zwei Töchtern des Gastwirtes Franz Wilhelm Humann. Vater Humann betrieb am Rande von Essen ein großes Gasthaus und Ausflugslokal und konnte es sich leisten, seinen Söhnen höhere Bildung zukommen zu lassen. Carl machte in Essen sein Abitur, bei dem er besonders in Mathematik, Latein und Griechisch brillierte, und ging dann zum Studium an die renommierte Bauakademie in Berlin. Seine Freizeit verbrachte er nach eigenen Angaben oft im 1830 eröffneten Alten Museum am Lustgarten, wo er antike Skulpturen und andere Objekte zeichnete. Doch ein schweres Lungenleiden unterbrach seine Ausbildung, und die Ärzte rieten ihm, sich für sein zukünftiges Leben ein milderes Klima als das kalte Berlin auszusuchen. Da traf es sich gut, dass sein älterer Bruder Franz, ebenfalls Ingenieur, bereits in den Orient ausgewandert war und auf der Ägäisinsel Samos, die damals zum Osmanischen Reich gehörte, eine gute Stellung im Dienste des türkischen Statthalters innehatte. Franz lud seinen Bruder ein, in Samos weiter die »Bauwerke der Alten« zu studieren, und machte Carl den Umzug unter anderem damit schmackhaft, dass er in Samos an der Erforschung des berühmten Hera-Tempels mitarbeiten könnte.
Im November 1861 traf Carl Humann im Orient ein, wo er dann auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Nach einer kurzen Zeit auf Samos ging er, nach einem Zwischenaufenthalt in Smyrna, weiter ins Zentrum des Reiches, nach Konstantinopel. Erneut durch Vermittlung seines Bruders lernte er den damaligen englischen Botschafter Sir Henry Bulwer kennen, der ihn damit betraute, ein Landhaus auf einer kleinen Insel im Marmarameer zu bauen. Da Bulwer mit seinem Sommerhaus zufrieden war, stellte er Carl Humann dem damaligen Großwesir Fuad Pascha vor, dem nach dem Sultan wichtigsten Mann im Reich. Diese Begegnung ebnete den weiteren Weg für Humanns Leben im Osmanischen Reich. Er bekam jetzt Aufträge vom Hof, vor allem als Vermessungsingenieur für Straßenbauprojekte. Für Fuad Pascha ging Humann nach Palästina, nach Ägypten und später nach Bulgarien. Er wurde auch beauftragt, topografische Karten der südlichen Marmaraküste und der nördlichen Ägäis zu erstellen. Im Verlauf dieser Tätigkeiten kam er mehrfach nach Pergamon.
Von der Pleite zu neuem Aufbruch
Bruder Franz hatte dann die Idee, ins Straßenbaugeschäft einzusteigen und sich dafür die Vorarbeiten des Bruders zunutzezumachen. Er beantragte eine Lizenz beim Sultan und erhielt tatsächlich im April 1867 einen Ferman, der die Brüder Humann berechtigte, mehrere Straßen im Gebiet zwischen Konstantinopel und Smyrna zu bauen und später in eigener Konzession zu betreiben. Der Straßenbau wurde zu einem Großunternehmen, in dem »schwindelerregende Summen« bewegt wurden, wie der Vater meinte, als er einmal auf Besuch in Konstantinopel war.4
Doch die schwindelerregenden Summen, die man in dem Geschäft verdienen konnte, brachten auch das Risiko eines schwindelerregenden Absturzes mit sich. Das seit Mitte des 19. Jahrhunderts permanent von einer Staatspleite bedrohte Osmanische Reich war 1873 wieder einmal zahlungsunfähig. Die Brüder Humann bekamen die vertraglich zugesicherten Gelder aus Konstantinopel nicht mehr und gingen mit ihrer Firma in die Insolvenz. Carl Humann hatte aber offenbar noch genug Geld beiseitegelegt, um sich in Smyrna, wohin er nun seinen Lebensmittelpunkt verlegte, ein Haus zu kaufen. In der Heimat suchte und fand er dann eine Frau, die ihn heiratete und ihm in den folgenden Jahren sein Haus in Smyrna führte. Das Ehepaar hatte zwei Söhne und zwei Töchter, doch zum großen Leid der Eltern starb eine Tochter bereits kurz nach der Geburt und der jüngere Sohn, als er sieben Jahre alt war. Die verbliebenen Kinder, Tochter Maria und Sohn Hans, spielten später wichtige Rollen in den deutschtürkischen Beziehungen vor und während des Ersten Weltkrieges. Mit mäßigem Erfolg stieg Carl Humann in das Import-Export-Geschäft mit Waren aus dem Landesinnern ein, die über den großen Hafen von Smyrna nach Europa verschifft wurden.
Nach seiner ersten Begegnung mit Pergamon ließ ihn diese antike Stätte nicht mehr los. Humann war fasziniert von dem Gedanken an die antiken Schätze, die sich unter dem Schutt der Jahrhunderte verbergen könnten. Noch während der Straßenbauarbeiten hatte er zeitweise sein Hauptquartier nach Pergamon verlegt und jede freie Stunde genutzt, um den Burgberg weiter zu erforschen. Dabei fand er einige interessante Antiken, darunter auch zwei große Marmorplatten, die Kampfszenen darstellten und von denen er bereits damals vermutete, dass sie zu einem größeren Ensemble gehören müssten.
Humann hoffte, für seine Funde Interesse bei den zuständigen Stellen in Berlin wecken zu können. Bei einem seiner regelmäßigen Aufenthalte in Konstantinopel machte er eine erste Bekanntschaft mit königlich-preußischen Vertretern, die in Griechenland und dem Osmanischen Reich nach Altertümern forschen wollten. Im Sommer 1871 traf er Professor Ernst Curtius, damals Direktor des Antiquariums der Königlichen Museen in Berlin. Curtius wollte eine Reise durch antike Stätten in Kleinasien unternehmen, woraufhin Humann ihn sogleich einlud, nach Pergamon zu kommen. Der damals 32-jährige Carl Humann hoffte, Curtius für eine offizielle Grabung in Pergamon begeistern zu können,
denn dieser war in Berlin bestens vernetzt. Er galt als wichtigster Vordenker einer hellenistischen Idee, nach der Berlin zum Vollstrecker und Vollender der griechischen Antike werden sollte. Er hatte gute Kontakte zum Preußischen König, dem späteren Kaiser Wilhelm I., und war zeitweilig auch Erzieher des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Curtius sagte zu Humanns Vorschlag einer Grabung in Pergamon zwar nicht nein, doch er hielt ihn hin.
Auf Curtius’ Vorschlag zeichnete Humann einen topografischen Plan von Pergamon, und er schickte auf eigene Kosten und ohne Genehmigung der osmanischen Behörden seine Marmorplatten mit den Kampfszenen an das Museum in Berlin, wo Curtius sie im Depot verstauben ließ. Denn der Berliner Museumschef hatte eigene, andere Pläne. Er wollte auf dem Olymp in Griechenland graben und setzte seine Beziehungen vornehmlich dafür ein, Geld für sein eigenes Olympia-Projekt aufzutreiben. Humanns Pergamon geriet in Berlin in Vergessenheit. Der Privatier Humann unternahm dann auf eigene Faust mehrere archäologische Forschungsreisen in Anatolien und Griechenland, doch es schien, als sollte sein Traum von der Wiederentdeckung des Herrschaftssitzes der Attaliden in Pergamon für immer unerfüllt bleiben.
Alexander Conze tritt auf den Plan
Doch es kam anders. Im September 1877 wurde Alexander Conze zum neuen Direktor der Skulpturengalerie und Antikensammlung der Kaiserlichen Berliner Museen berufen. Das sollte zum Wendepunkt im Leben Carl Humanns werden, denn Conze machte aus Humann den gefeierten Entdecker des Pergamonaltars. Alle Zeitzeugen, die Alexander Conze kennengelernt haben, beschreiben ihn als einen bemerkenswerten Mann: wissenschaftlich umfassend gebildet, dabei völlig uneitel und mehr an Forschungsergebnissen als an seiner Karriere interessiert.
Alexander Conze, 1831 als Sohn eines Offiziers in Hannover geboren und damit acht Jahre älter als Carl Humann, hatte nach seinem Abitur zunächst Jura studiert, dann aber bald auf Altertumswissenschaft umgesattelt. Nach Abschluss seines Studiums war er der Erste, der vom neu gegründeten Deutschen Archäologischen Institut ein zweijähriges Reisestipendium bekam, dass ihm einen ausgiebigen Aufenthalt in Griechenland ermöglichte. Nach seiner Rückkehr habilitierte er und wurde Dozent an der Universität Göttingen. Bald darauf erhielt er einen Ruf an die Uni in Wien und bekam eine Professur. Nach knapp zehn Jahren dort wurde er an die Berliner Museen berufen. Wiederum gut zehn Jahre später stieg er zum Chef des Deutschen Archäologischen Instituts auf.
In die Jahre als Antikendirektor der Berliner Museen fiel das Abenteuer der Ausgrabungen in Pergamon, das sowohl für ihn wie für Carl Humann zu dem wichtigsten Ereignis ihres Lebens wurde. Carl Schuchardt, damals ein junger Archäologe, war 1886, im letzten Jahr der Grabungskampagne in Pergamon, als Assistent von Humann auf dem Burgberg und lernte dabei sowohl Carl Humann als auch Alexander Conze gut kennen. Über deren schicksalhafte Begegnung schrieb er in einem Nachwort zu einem 1930 erschienenen Buch: »Der Entdecker und Wegbereiter Carl Humanns wurde Alexander Conze (…). Als er nun in Berlin sein Amt antrat, ging er durch alle seine Magazine und Keller und staunte vor den Pergamon-Platten. Aus den Akten stellte er fest, wer sie gesandt hatte, und schrieb sofort an Humann den ersten schicksalsvollen Brief. Humann antwortete, er habe stets lebhaft gewünscht, dass seiner Feststellung [in Pergamon] weiter nachgegangen würde, aber nie daran gedacht, das selber und allein zu tun; ob man nicht einen Archäologen schicken könne, der mit ihm zusammen die Sache mache. Aber Conze blieb dabei, er möge zunächst selbst, möglichst ohne Aufsehen, fortfahren; er werde es schon können. Diese erste Rolle, die Conze in der Sache gespielt hat: das rasche Erkennen der großen Kunstwerke, der Entschluß, sofort zu graben, das Vertrauen zu der Persönlichkeit des Entdeckers, hat den Mann Conze in den Augen Humanns für alle Zeit turmhoch gestellt über alle, die sich sonst um Pergamon bemüht haben. Welcher andere hätte die Selbstlosigkeit Conzes gehabt und wäre nicht sofort hingefahren, um selbst derjenige, welcher zu sein? Die Folge ist auch gewesen, dass im allgemeinen Urteil, und zwar bis heute, die Verdienste Conzes als viel zu gering eingeschätzt werden. Umso wertvoller ist es mir, dass ich trotz der Verschiedenheit der Naturen der beiden Männer und der gelegentlichen Reibungen, die sich daraus ergaben, aus Humanns Worten und Betragen immer die höchste Anerkennung Conzes entnehmen konnte.«5
Es ist zweifellos so, dass ohne Conze Carl Humann nie zum gefeierten Entdecker des Pergamonaltars geworden wäre. Denn Conze beauftragte Humann nicht nur dazu, auf dem Burgberg nach weiteren Marmorfriesen mit den eindrucksvollen Kampfszenen zu suchen, er fand auch den entscheidenden Hinweis, was es mit den Platten auf sich hatte.
Am 1. Juli 1878 schrieb Conze aus Berlin an Humann in Smyrna, der antike römische Schriftsteller Lucius Ampelius hätte in seinen »Liber memoralis« von einem sehr großen Marmoraltar in Pergamon, 40 Fuß hoch, mit sehr großen Marmorskulpturen, die einen Gigantenkampf darstellen – »er zählt ihn zu den 7 Weltwundern« – berichtet. Damit war die Spur für Humann gelegt.
Berlin wird London ebenbürtig
Bei allem wissenschaftlichen Interesse Alexander Conzes an der griechischen Antike und aller Leidenschaft Carl Humanns für die Hinterlassenschaft der antiken Herrscher in Pergamon, das »Projekt Pergamonaltar«, das die beiden 1878 begannen, diente nicht nur wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern vor allem dem Ruhme des kaiserlichen Deutschen Reiches. Der Hauptstadt des erst 1871 als Nachzügler im europäischen Mächtereigen gegründeten Deutschen Kaiserreiches mangelte es im Vergleich zu Paris und London an Kunstwerken von Weltgeltung. Diese Schwachstelle der Repräsentation sollte unter anderem durch den Pergamonaltar behoben werden.
Der Briefwechsel zwischen Humann und Conze in den Jahren 1877 bis 1879, zu Beginn und während der ersten Grabungskampagne in Pergamon, lässt keinen Zweifel daran, dass die allererste Sorge beider Männer war, wie der große Fund ohne Abstriche – das heißt, ohne das Land, wo er gefunden wurde, zu beteiligen – nach Berlin geschafft werden könnte.6
Die Tat, den »Schatz« weitgehend vollständig nach Berlin gebracht zu haben, stellte wie selbstverständlich auch der langjährige Generaldirektor der Berliner Museen Richard Schöne vor alle wissenschaftlichen Leistungen. In einer Würdigung Humanns nach dessen frühem Tod mit nur 57 Jahren im April 1896 schrieb er: »Die in Berlin und im Umgang mit deutschen Forschern gewonnenen Anregungen lehrten ihn, in den grandiosen Trümmern der Attalidenstadt einen verlockenden Schatz geschichtlicher Aufschlüsse zu erkennen, und sein in der Entfernung von der Heimat nur umso feuriger entbrennender Patriotismus ließ ihn immer von neuem auf den Wunsch zurückkommen, dass es gelingen möchte, diesen Schatz zugunsten seines Vaterlandes zu heben.«7
Wie sehr Humanns und Conzes Pergamon-Projekt dem dringenden Wunsch der Eliten des neuen Kaiserreiches nach angemessener Machtrepräsentation entsprach, schilderte nicht zuletzt Ernst Curtius, der Mann, der das Potenzial von Pergamon sträflich verkannt hatte, als im November 1879 die ersten, noch nicht einmal vollständigen Stücke des Pergamon-Frieses in Berlin öffentlich im Alten Museum ausgestellt wurden. »Pergamon«, schrieb er, »ist jetzt in aller Munde. Man schwelgt in der Masse der Originale und fühlt sich London ebenbürtig.«8
Nicht eine Sekunde haben Humann und Conze darüber nachgedacht, ob es vielleicht angemessener wäre, das Kunstwerk an Ort und Stelle der Nachwelt vorzustellen oder aber die Marmorplatten im Archäologischen Museum in Konstantinopel abzuliefern, wo sie, wenn schon nicht an ihrem exakten geschichtlichen Platz ausgestellt, eigentlich hingehört hätten. Stattdessen setzte von Beginn an ein zähes Ringen darum ein, wie man die Antikenbestimmungen des Osmanischen Reiches unterlaufen oder umgehen könne, um möglichst alle Teile des Kunstwerkes »dem deutschen Volke« zu sichern.
Die Vorbereitungen
In seinem ersten Brief an Carl Humann vom 7. Dezember 1877 stellte Alexander Conze sich als neuer Direktor der Skulpturenabteilung der Berliner Museen vor und nahm gleich Bezug auf eine Korrespondenz zwischen Humann und Curtius, in der Humann angeboten hatte, weitere pergamenische Reliefplatten nach Berlin zu schicken. Curtius, schrieb Conze, hätte vom Marineministerium jetzt die Zusage, »dass einer der Kommandanten eines in Smyrna stationierten Kriegsschiffes die Platten an Bord nehmen kann«.
Dabei handelte es sich um einige Marmorplatten, die Humann während seiner Straßenbauzeit auf dem Burgberg von Pergamon aufgedeckt und illegal abtransportiert hatte. Wie schon die ersten beiden Reliefs zeigten sie eindrucksvolle Kampfszenen. Noch hatte Humann keine Vorstellung, wozu die Marmorplatten gehört haben könnten, aber anders als zuvor Curtius war Conze sehr interessiert. Er möchte mit Humann in Kontakt bleiben und »erbitte nähere Auskünfte«, schrieb er.9
Humann war, wie er später in seinem ersten Grabungsbericht festhielt, begeistert, dass in Berlin endlich jemand Interesse zeigte. »Bei dieser Gelegenheit war es natürlich, dass ich Conze von meinem chronischen Pergamonleiden aufs Neue des weiteren erzählte; durch ihn fand ich endlich Erlösung.«10
Conze erwiderte bereits im Januar 1878, er freue sich über die Bereitschaft Humanns, in Pergamon weiterzumachen und eventuell den Fries zu komplettieren. Er ließ Humann über das Konsulat in Smyrna erst einmal 600 Reichsmark zukommen, um seine Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen.
Einen Monat später, im Februar 1878, bekräftigte Conze in einer Antwort an Humann, dass er bereit sei, sich für eine Pergamon-Grabung einzusetzen. Bereits kurz darauf, im März 1878, hatte Conze in Berlin durchgesetzt, dass der deutsche Botschafter in Konstantinopel, damals Prinz Heinrich Reuß, eine Grabungserlaubnis bei Hof beantragte. Prinz Reuß wurde allerdings schon im Sommer 1878 von Botschafter Paul Graf von Hatzfeldt-Wildenburg abgelöst, der in der entscheidenden Phase vor und nach Beginn der Grabung im September 1878 für Conze und Humann der Ansprechpartner zur Durchsetzung ihrer Wünsche gegenüber den osmanischen Entscheidungsträgern war. Angefangen vom Sultan selbst über den Großwesir bis zum Bildungs- und Unterrichtsminister, der formal für Grabungserlaubnisse zuständig war, musste Hatzfeldt die osmanischen Würdenträger bearbeiten. Dafür, dass er dies auch mit vollem Einsatz tat, hatte Conze gesorgt.
Conze wusste, wie man die preußische Bürokratie zum Laufen bekam. Er hatte sich die Protektion von allerhöchster Stelle besorgt. Bei den Königlichen Museen in Berlin war natürlich bekannt, dass sich vor allem Kronprinz Friedrich Wilhelm sehr für die griechische Antike interessierte und zu denjenigen am Hofe gehörte, denen der Imagegewinn durch außergewöhnliche Kunstwerke wichtig war. Friedrich Wilhelm, dessen Gemahlin aus dem britischen Königshaus stammte, lag sehr daran, auf diesem Gebiet mit London gleichzuziehen.
Conze gelang es, den Kronprinzen für die geplante Pergamon-Kampagne zu begeistern, und er konnte deshalb dem Auswärtigen Amt klarmachen, dass eine Grabungserlaubnis für Pergamon ein dringender Wunsch des zukünftigen Kaisers sei. Friedrich Wilhelm bot sich im Verlauf der Auseinandersetzung um die Fundteilung der pergamenischen Antiken sogar an, persönlich brieflich beim Sultan zu intervenieren.
Hatzfeldt war jedenfalls vorgewarnt, als er im Sommer 1878 sein Amt in Konstantinopel antrat, und auch Humann war sich sehr bewusst, in wessen Auftrag er in Pergamon den Spaten ansetzte. In seinem ersten Grabungsbericht schrieb er über den Beginn der Kampagne: »Am Montag, dem 9. September 1878 stieg ich mit 14 Arbeitern den Burgberg hinauf, nahm eine Hacke und sprach: ›Im Namen des Protektors der Königlichen Museen, des glücklichsten, allgeliebten Mannes, des nie besiegten Kriegers, des Erben des schönsten Thrones der Welt, im Namen unseres Kronprinzen: Möge dieses Werk zu Glück und Segen gedeihen.‹«11 »Meine Arbeiter haben geglaubt«, berichtet Humann weiter, »ich würde eine Zauberformel sprechen, und sie hatten damit nicht ganz unrecht.«
2 »WIR MÜSSEN ALLE ZUM ALTAR GEHÖRIGEN DINGE BEKOMMEN.«
Die Fundteilung – Carl Humann und der Antikenchef der Berliner Museen Alexander Conze wollen alles
Seit dem Abtransport des monumentalen Pergamonaltars im 19. Jahrhundert nach Berlin taucht immer wieder die Frage auf, ob diese Aktion legal war und die damalige deutsche Reichsregierung dabei rechtmäßig vorgegangen ist oder ob die Türkei, salopp gesagt, über den Tisch gezogen wurde. Anders als bei der Büste der ägyptischen Königin Nofretete, dem anderen Antikenstar auf der Berliner Museumsinsel, deren Rückgabe von der ägyptischen Regierung immer wieder gefordert wird, hat die Türkei bislang keinen solchen Antrag offiziell gestellt. Doch das heißt nicht, dass türkische Politiker in den letzten Jahrzehnten nicht gefordert haben, der Altar solle doch dort zu sehen sein, wo er eigentlich hingehört: auf dem Burgberg in Pergamon, unter der Sonne und in dem Licht der Ägäis, statt in einem dunklen Museum in Berlin.
Offiziell beharren die deutschen Verantwortlichen darauf, dass bei dem Abtransport des Altars alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Viele Türken bezweifeln das. Eine Antwort darauf, zumindest eine konkrete Annäherung an die Ereignisse von vor bald 150 Jahren, gibt der Briefwechsel zwischen dem Ausgräber in Pergamon Carl Humann und dem verantwortlichen Direktor der Berliner Museen Alexander Conze.
Bisher ist in der Literatur zur »Entdeckung« des Pergamonaltars vor allem die Rolle Humanns gewürdigt worden. Entsprechend werden immer wieder Briefe Humanns zitiert, in denen es hauptsächlich um seine Erfolgsmeldungen geht. Doch erst die Zusammenschau der vielen Briefe und Telegramme, die in den entscheidenden Jahren 1878 bis 1880 zwischen Humann und seinen Auftraggebern in Berlin ausgetauscht wurden, ergeben ein genaueres Bild der Ereignisse.
In den ersten Monaten des Jahres 1878 geht es in der Korrespondenz zwischen Conze und Humann zunächst um die Grabungserlaubnis für den Pergamon-Burgberg in Form einer Anordnung des Sultans, Ferman oder auch Irade genannt. Conze berichtet Humann, dass im März erstmals Botschafter Prinz Reuß deswegen kontaktiert wurde. Anfang Juni kann Conze dann mitteilen, dass der Antrag durch die Botschaft nun offiziell gestellt wurde. Am 26. Juni berichtet er, dass die von Humann im Februar verschifften zusätzlichen Reliefs in Berlin angekommen sind und genau zu den bereits vorhandenen Platten passen würden. Die Reliefplatten waren gänzlich ohne Erlaubnis ausgegraben und verschifft worden (siehe dazu auch Kapitel 12 zur Vorgeschichte der Grabung).
Conze recherchiert nun fieberhaft, zu welchem antiken Tempel in Pergamon die Gigantenplatten gehört haben könnten, und findet dann tatsächlich den entscheidenden Hinweis des römischen Schriftstellers Lucius Ampelius über den großen Marmoraltar. Im Juli 1878 teilt er Humann brieflich seinen Durchbruch mit und kündigt gleichzeitig an, der Konsul in Smyrna (Izmir) würde demnächst von Botschafter Reuß eine Mitteilung »wegen des Ferman« erhalten. Daraufhin schreibt Humann einen Brief an Conze, in dem er das erste Mal die Fundteilung diskutiert. Er weiß vom Konsul, dass das Bildungsministerium in Konstantinopel beim Generalgouverneur von Smyrna angefragt hat, wie es mit dem Bodeneigentum am Burgberg aussieht, und erfahren hat, dass die gesamte Akropolis »Krongut«, also Land des Sultans ist, was die Grabungsgenehmigung erleichtert. Gleichzeitig hat Humann aber auch gehört, dass das noch relativ neue Antikengesetz vom März 1874 (siehe dazu die Kapitel 3 und 4) zur Anwendung kommen soll, nach dem ein Drittel der Funde für den Ausgräber, ein Drittel für den Bodeneigentümer und ein Drittel für den Sultan, also den Staat vorgesehen sind.
Humann ärgert sich sehr darüber, war es in der Vergangenheit doch anders: »Wenn sonst fremde Regierungen nach Antiken gruben, erhielten sie gewöhnlich, wenn nicht das Ganze mit Ausschluß von Doubletten [also solchen Stücken, die es doppelt gab und die am Museum in Konstantinopel abgeliefert werden mussten], so doch wenigstens zwei Dritteile der Funde.«12 Conze antwortet ihm am 17. Juli: »Was die Teilung anbelangt, so liegt sicherlich freilich mehr an Ihnen, was Sie thun, als was geschrieben steht.« Gleichzeitig informiert Conze Humann über seine weiteren Recherchen und schreibt: »Es ist kein Tempel, sondern ein Altar unter freiem Himmel.«13 Am 24. Juli präzisiert Conze noch einmal den Befund aus antiken Quellen: »Es ist ein Zeusaltar, der auf einer großen Plattform gestanden hat, irgendwo in der Höhe des Burgberges.«
Am 6. August verfügte dann Unterrichtsminister Muni Effendi im Namen des Sultans, dass den Königlichen Berliner Museen für die Dauer eines Jahres das Graben nach Antiken auf der Burg von Pergamon gestattet werde. Conze schickt daraufhin am 15. August eine Postkarte an Humann: »Es geht los«.
Bis es dann wirklich losgeht, vergehen aber noch drei Wochen, in denen Humann beim Gouverneur in Smyrna anerkennen lassen muss, dass er der von den Museen autorisierte Ausgräber vor Ort ist. Der Gouverneur bestimmt daraufhin einen seiner Beamten als Aufseher bei der Grabung. Humann, der bereits Werkzeug und andere für die Grabung notwendige Utensilien bereitgestellt hat, lädt das Material auf ein Boot, das ihn zusammen mit seinem Aufseher Ali Riza Effendi erst nach Lesbos und dann nach Dikili bringt, der damals normale Weg von Smyrna nach Pergamon.
Am 9. September 1878 beginnt Humann mit seiner bereits zitierten Hymne an den Kronprinzen die eigentliche Grabung. Er konzentrierte sich zunächst auf die byzantinische Mauer, in der er die ersten Friesplatten gefunden hatte. Oberhalb der Mauer gab es zudem ein Plateau, das nach den Angaben von Conze der Platz gewesen sein könnte, auf dem der große Zeusaltar gestanden hat.
Bereits drei Tage später, am 12. September, kann Carl Humann per Telegramm einen ersten großen Durchbruch melden. Er ist ganz aus dem Häuschen und schreibt an drei aufeinanderfolgenden Abenden zwei Briefe an Conze, die dann zusammen nach Berlin gehen. Erschöpft, glücklich und geradezu atemlos verliert er sich zunächst in Details eines Giganten-Frieses, ruft sich dann aber selbst zur Ordnung und berichtet erst einmal über den Gesamtfund von elf bereits aus der byzantinischen Mauer herausgelösten Reliefs und 20 bis 30 weiteren, die noch in der Mauer feststecken. Auch das noch vorhandene Fundament des Altars hat er auf dem Plateau oberhalb der Mauer bereits ausmachen können. Humann jubelt: »Wir haben nicht nur ein Dutzend Reliefs, sondern eine ganze Kunstepoche, die begraben und vergessen war, aufgefunden.«
Doch bei allem Glück vergisst Humann nicht, worauf es jetzt ankommt: »Nun zur Hauptsache! Wie kommt alles nach Berlin! Meinem Ali Riza habe ich plausibel gemacht, daß wir noch viele hunderte solcher zerbrochener Steine finden werden, daß Berlin sehr weit ist und daß, wenn unsere Arbeiten, und was oben ansteht, sein Gehalt mit etwaigem Bakschisch weitergehen sollen – man in Berlin auch etwas sehen will. Es wäre also wohl das Schlaueste, diese ersten Stücke schnell nach Berlin zu senden. Er findet das außerordentlich richtig.