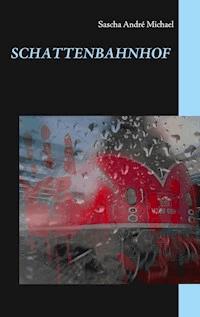Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Type:Writer-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Nicht alle Gleise führen ans Ziel ... Manche enden direkt in einer tödlichen Falle! Als ein Blizzard ihren Schnellzug zu einem ungeplanten Stopp in der abgelegenen Kleinstadt Nightfall Rapids zwingt, sind die Passagiere zunächst froh, eine Zuflucht vor den Schneemassen zu finden. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Nightfall Rapids ein Dorf der Alpträume ist. Ein Mädchen verschwindet. Dinge werden vertuscht. Eine Gruppe von Reisenden, die das Geheimnis der seltsamen Ortschaft zu ergründen versucht, gerät ins Visier einer mysteriösen Privatarmee, und eine erbarmungslose Jagd auf das ungleiche Quartett beginnt! Ausgerechnet ein harmloser Buchhalter aus dem fränkischen Land wird zur letzten Hoffnung der Flüchtenden. Um seine Freunde zu retten und Nightfall Rapids zu befreien, muss er über sich hinauswachsen und den Schritt in eine fremdes, gefährliches Universum wagen ... Sascha André Michael zieht in seinem actionreichen Roman alle Register und hält den Leser bis zum explosiven Finale in Atem. DIE SCHLAFENDE STADT (entstanden 1992-2003) ist ein Muss für alle Fans von Verschwörungs- und Mysterythrillern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für das Quadrati,
Fan und allround-gute-Seele vom Dienst.
Vielleicht könnte man sich
eine noch bessere Freundin, Kollegin,
Testleserin und Unterstützerin wünschen.
Aber nie eine bekommen.
Inhaltsverzeichnis
Xavier
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Die Stadt Erwachend
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Flüchtig
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Das Institut
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Brennende Erde
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
ACHTUNG! OBSZÖN! GRAUSAM! SEX! GEWALT!
(eine Art von Vorwort)
Da ich nun Ihre Aufmerksamkeit habe, folgt eine kleine Anmerkung zu diesem Buch und der Serie, in der es präsentiert wird.
DIE SCHLAFENDE STADT ist tatsächlich eine »alte Neuheit«; dieser bislang unveröffentlichte Thriller entstand schon zwischen 1991 und 2003 .
Im Laufe der letzten Jahre wurde ich von Freunden, Bekannten, Schülern und Lesern immer wieder gefragt, warum keine meiner »frühen« Arbeiten mehr lieferbar ist. Leider ist es das Schicksal vieler Bücher, die in Kleinserien bei Kleinverlagen erscheinen und beizeiten keinen Sprung auf eine nicht-Nischen-Plattform schaffen, irgendwann einfach vom Markt zu verschwinden. Da ich aber jemand bin, der sich kompatiblen Wünschen und Anregungen nur zu gerne beugt (Ironie!), habe ich mich nun in Absprache mit meinen damaligen Verlegern an eine Wiederauflage meiner bisherigen Arbeiten gewagt. Das Projekt bekam den Namen Type:Writer-Bibliothek (in Anlehnung an die Facebookseite meiner Kurse für kreatives Schreiben) und wird nicht nur bislang vergriffenen Titel einen neuen, schmucken Rahmen bieten, sondern es wird auch unbekannten Arbeiten wie DIE SCHLAFENDE STADT ermöglichen, sich erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren.
DIE SCHLAFENDE STADT war stets einer meiner Lieblinge unter den Schubladen-Romanen, vielleicht weil er tatsächlich eine interessante Vorstudie zu meinem späteren Roman DIE FREQUENZ DER ANGST ist. In beiden Arbeiten geht es um die Unterdrückung und Korruption der Massen durch Medien und eine außer Kontrolle geratene Technik. Und in beiden Büchern sind es einsame Antihelden, die über sich hinauswachsen und ungeahnte Leistungen vollbringen müssen, um zu überleben und die Situation zu retten.
In der Vorbereitung habe ich mich auf einige zeitgemäße Korrekturen beschränkt und zugleich bemüht, die Ursprünglichkeit des Romans zu bewahren, obschon ich heute ... muss ich es sagen? ... »einige Dinge anders gemacht hätte«. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Darum nennt man es ja »Fortschritt« und nicht »ach Schiet, stagnieren wir ein wenig.«
Sascha Andre Michael
Bukarest, Juli 2017
XAVIER
Durch Gottes Hauch entsteht das Eis,
liegt starr des Wassers Fläche.
Ijob 37,10
1
Xavier, der verheerendste Blizzard seit Jahren, fegte ohne Vorwarnung Mitte März über das Land hinweg, als die meisten Menschen schon auf ein Ende des Winters hofften. Das Tiefdruckgebiet, dem ein comicverrückter Meteorologe den Namen des Mentors der X-Men verpasst hatte, schlich heran wie eine Raubkatze, die sich geduckt und mit geschmeidiger Lautlosigkeit ihrem Beutetier am Wasserloch nähert. Dann schlug es zu und erwischte die nördlichen Gebiete von Minnesota, Montana und North Dakota im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt.
Insgesamt verloren während der sieben Tage andauernden Krise mehr als einhundert Menschen ihr Leben. Viele jener Unglücklichen blieben in abgelegenen ländlichen Gebieten in ihren Autos auf der Straße stecken und konnten nur noch erfroren geborgen werden; diejenigen Reisenden, die mehr Glück hatten, fanden irgendwo sicheren Unterschlupf, ehe Xavier richtig zu wüten begann und eine meterdicke Schneeschicht Straßen unpassierbar machte, Dächer zum Einsturz brachte und das Land in einen Irrgarten mit gleißend weißen Wänden verwandelte. Zahlreiche Betroffene mussten tagelang in ihren Häusern ohne Strom ausharren, bis man sie in Notunterkünfte evakuierte oder das Netz repariert war. In all der Zeit kämpften die Rettungskräfte (darunter sogar die rasch mobilisierte Nationalgarde) tapfer, wenn auch erfolglos gegen die lautlos fallende Invasion, bis sich die Lage schließlich normalisierte.
Inmitten des Chaos der ersten Stunden nach dem jähen Wintereinbruch kämpfte sich der Schnellzug von Fargo nach Minneapolis mit letzter Kraft über vereiste Schienen und durch unberechenbare Schneeverwehungen hindurch. Einige Zeit zuvor hatte er Wadena hinter sich gelassen; die nächsten planmäßigen Stopps würden Midnight Rapids und Little Cloud sein, beide Städte waren noch einige hundert Meilen vom Zielort Minneapolis entfernt. Aber die Meldungen, die der Lokführer per Zugfunk bekam, machten eines immer deutlicher: die Chancen, dass der Zug seinen Endbahnhof erreichen würde, schrumpften mit jedem Zentimeter Schnee, den Xavier über das einsame Land schleuderte. Die Eisenbahngesellschaft arbeitete bereits an Notfallplänen.
Davon ahnten die Passagiere, die sich in ihre beheizten Zugabteile eingekuschelt hatten und nur so rasch wie möglich nach Hause kommen wollten, nichts. Die meisten von ihnen konnten jedoch ein mulmiges Gefühl im Magen nicht mehr verdrängen, sobald sie nach draußen schauten und dort nichts als Schneemassen erblickten. Obschon sie zweifellos auf das Beste hofften, ahnten sie schon tief im Inneren, dass ihre Reise möglicherweise unterbrochen werden würde. Und sie sollten Recht behalten.
2
Der Mann auf Sitz 67 des dritten Großraumwaggons war nicht nur ein Orts-, sondern sogar ein Landesfremder. Er hieß Frederick Wendt, aber seine Bekannten und Kollegen nannten ihn einfach nur Fred; für seine guten Freunde (zumeist Bowlingkumpels) war er Freddie. Er wohnte in Zirndorf, einer kleinen Stadt im Fürther Land, mehr als neuntausend Kilometer und buchstäblich zahllose Welten entfernt von der Einöde in Minnesota, die der Zug gerade durchpflügte.
Wie alle anderen Reisenden hatte auch Fred seit der Abfahrt in Fargo nur die typischen Geräusche einer langen Zugfahrt im Ohr gehabt. Ohne Pause und Ablenkung hörte er nichts außer dem einlullend rhythmischen, beinahe hypnotischen Klicken der Räder des Wagens, unterlegt vom gleichmäßigen Summen der Achsen.
Irgendwann trieb ihn die Monotonie in ein Gähnen. Es ging viel zu schnell, als dass er seine rechte Hand (die so pummelig, rund und weich war wie der Rest seines Körpers) hätte hochreißen und damit den Mund verdecken können; statt dessen verzog er einfach sein rosiges, freundliches Mondgesicht und sperrte die Kiefer weit auf, ohne etwas dagegen tun zu können. Mit beschämtem Gesichtsausdruck blickte er sich hinterher um, stellte jedoch erleichtert fest, dass sich keiner der Handvoll anderer Zugpassagiere in diesem Waggon auch nur einen Deut um ihn kümmerte oder gar sein kleines Missgeschick bemerkt hatte.
Alle waren im Moment einfach nur mit sich selbst beschäftigt, zum Beispiel der Geschäftsmann zwei Sitzreihen vor ihm, der pausenlos über seinem Laptop brütete und dabei hin und wieder schimpfte, dass er keine Internet-Verbindung mehr hatte. Oder die alte Dame mit dem altmodisch hochtoupierten Haar, die seit Stunden in ihr Barbara-Cartland-Taschenbuch versunken war. Nicht zu vergessen die hübsche junge Frau in der gegenüberliegenden Sitzreihe, die in einem dicken Buch blätterte, wobei sie sich ab und zu Notizen machte. Und dann war da auch noch das junge Pärchen vier leere Bänke weiter, das sich eng aneinander geschmiegt hatte; das Mädchen schlief, ihr vielleicht zwei, drei Jahre älterer Freund versuchte, in der milchigen Dunkelheit hinter dem Zugfenster irgend etwas zu erkennen.
Doch genau so gut hätte er ein leeres Blatt Papier betrachten können, denn da draußen war nichts als weiß, weiß, weiß. Das heftige Schneetreiben, in das der Schnellzug mitten hinein zu fahren schien, hatte nochmals an Stärke zugelegt. Als Franke hatte sich Fred bislang zur Gruppe der Realisten gezählt; für ihn kam es meistens darauf an, was sich im Glas befand, und nicht ob es nun halbleer oder halbvoll war. Aber nun konnte auch er der Frage nicht mehr ausweichen, wie lange sie wohl noch vorankommen würden, bis die Schneemassen aus den urplötzlich weit geöffneten Himmelsschleusen die Trasse blockierten. Nicht, dass er sich darüber den Kopf zerbrechen wollte; nein, die Situation ließ es einfach nicht mehr anders zu. Dabei wagte er es eigentlich kaum, sich auszumalen, was passierte, wenn der Zug hier, wo die nächste Ortschaft wohl mindestens vierzig Meilen entfernt lag, zu einem Stopp gezwungen wurde. Immerhin durchquerten sie im Moment eine annähernd gottverlassene Gegend in den Tiefen von Minnesota, also wahrlich nicht der Platz, um stecken zu bleiben.
Es war sein eigenes, zutiefst sorgenvolles und fast wie eine Bitte um sicheres Geleit nach Hause klingendes Seufzen, welches ihm klarmachte, dass er sich dringend ablenken und zur Abwechslung an etwas schönes denken musste. Also strich er vorsichtig, fast zärtlich, mit der rechten Hand über die Kuckucksuhr, die einer kleinen Mumie gleich in dicke Lagen von Packpapier eingewickelt auf dem Sitz neben ihm lag. Und das war tatsächlich ein ungemein beruhigendes Gefühl, tröstlich und angenehm (ganz im Gegensatz zu der feindseligen nächtlichen Schneelandschaft voller tückischer Gaawindn auf der anderen Seite des Sicherheitsglases).
Fred konnte das stolze Besitzergrinsen eines fanatischen Sammlers, der nach langer Jagd ein neues Prunkstück für seine Kollektion ergattert hatte, nicht verbergen. Und dies war tatsächlich ein Prunkstück, eine authentische Bahnhäusleuhr von Kreuzer, Glatz und co aus dem Jahr 1852. Von diesem Modell waren weltweit nur noch vier Exemplare bekannt gewesen; eines davon war im Besitz von Akira Hideshi, einem bekannten und berüchtigten Sammler aus Tokio, eines hing im Uhrenmuseum in Furtwagen ... und ein weiteres krönte nun, nach jener Reihe schier unglaublicher Zufälle, die ihn in die Einöde von Montana geführt hatten, die Privatsammlung von Frederick Wendt am Achterplätzchen in Zirndorf.
Der Grundstein dieser Sammlung war vor mehr als zehn Jahren gelegt worden. Damals hatte die Versicherungsgesellschaft, für die Fred als Buchhalter und Kontoführer arbeitete, als Bonus und Ansporn unter allen besonders fleißigen Mitarbeitern eine jener Rundreisen verlost, die in Fachkreisen zynisch als 'Es-ist-Mittwoch-Nachmittag-also-sind-wir-in-Neuschwanstein'-Trips bekannt waren. Und Fred war nicht zuletzt dank seines unermüdlichen Fleißes und seiner nicht minder unermüdlichen Redlichkeit einer der fünfzig mehr oder weniger Glücklichen gewesen, die auf Kosten der altehrwürdigen Fürther Versicherungsgruppe (inzwischen übernommen von der US-amerikansichen Talisman-Gruppe und in ‚Securia’ umbenannt) an der Städtereise namens »Europas Perlen« teilnehmen durften.
Die Reise begann in Rom, der ewigen Stadt (die Fred jedoch eher wie die Stadt mit dem ewigen Verkehrsproblem vorgekommen war) und folgte dann einem minutiös gestrickten Zeitplan, der sie über Venedig, Bozen, Wien, Salzburg, die Alpen, München (natürlich mit unvermeidlichem Zwischenstopp im Hofbräuhaus), Ulm und Donaueschingen in den Schwarzwald führte, von wo aus es schließlich zurück in heimatliche, fränkische Gefilde ging.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die für Fred schicksalhafte Begegnung schon stattgefunden gehabt, und zwar im Schwarzwald, genauer gesagt in einem kitschigen Souvenirladen im Höllental. Ironischerweise war es sein Kollege Erwin Kleinlein aus der Verwaltung (ein hervorragender Kegler und notorischer Streichespieler) gewesen, der alles auslöste, als er Fred eine Paar Markstücke in die Pfote drückte und ihn bat, Ansichts-Postkarten für die ganze Gruppe zu organisieren. Fred hatte sich sowieso ein Eis am Stiel oder etwas Kaltes zu trinken holen wollen, also willigte er ein ... Nur um ein paar Atemzüge später zu vergessen, wieso er den Bretterverschlag voller Andenken eigentlich betreten hatte.
Denn da hing sie. Es war wie ein Zeichen des Himmels für ihn gewesen, als er sie sah: Ihr kunstvoll geschnitztes Gehäuse, der kleine Holzvogel, der immer wieder pünktlich aus seinem Türchen herauslugte und seinen unverwechselbaren Ruf ausstieß. Die Uhr transportierte ihn mit einem sanften Ruck dreißig Jahre in die Vergangenheit, wo er sich jählings im Gartenhäuschen seines Onkels Gustav wieder fand. In Freds Kindheit war kaum ein Wochenende zwischen Mai und September vergangen, in dem die Wendts nicht Sack und Pack in ihren Ford Taunus gestopft hätten, um dann nach Caldolzburg zu fahren, wo Onkel Gustav seinen geliebten, gehegten und gepflegten Garten hatte. Und dort, in der behaglichen Hütte, hing die erste Kuckucksuhr, die der kleine Freddie Wendt je gesehen und gehört hatte. Alleine der Anblick der Uhr in dem Souvenirladen brachte die angenehme, freudige Ferienstimmung zurück, die Fred damals immer so genossen hatte. Er konnte sogar den würzigen Geruch des Waldes und des nahen Badweihers wieder wahrnehmen und erinnerte sich schlagartig an laue Abende auf der Veranda, die er schon lange vergessen hatte.
Bei Gott, er musste diese Uhr haben.
Obwohl Kleinlein und die anderen auf ihn einredeten, sein Geld doch lieber in etwas Sinnvolles zu investieren, hatte er einen Großteil seiner Reisekasse in die völlig überteuerte, wahrscheinlich nicht einmal authentische Kuckucksuhr gesteckt. Und er war einfach restlos glücklich damit gewesen. Tatsächlich war er so happy gewesen, dass er in einem Anfall von jäh erwachtem Sammlerwahn in der nächsten Zeit nichts mehr anderes zu tun hatte, als weitere Uhren zu ergattern, wo auch immer er nur eine fand. Und so wurde seine Kollektion im Laufe der Zeit, nicht unähnlich seiner Taille, immer umfangreicher. Aber im Gegensatz zu seinem Bauchumfang wuchs seine Sammlung nicht nur in Quantität, sondern auch in Qualität. Je tiefgehender seine Kenntnisse über die Materie wurden, desto exquisiter und erlesener wurden auch die Uhren, die er suchte und kaufte.
Seine neuste und spektakulärste Errungenschaft verdankte er, wie auch den Beginn seiner Sammelleidenschaft, einem Ereignis in der Vergangenheit und einem Wink des Schicksals:
Im Jahre 1958 lernte Gerda, die jüngere Schwester seiner zukünftigen Mutter (seine Geburt lag zu diesem Zeitpunkt noch einige Jahre in der Zukunft), einen jungen G.I. namens Roy Granger kennen. Die beiden verliebten sich und heirateten, vielleicht ein wenig überstürzt, aber dennoch voller Zuversicht. Nachdem Grangers Dienstzeit in Good Ol’ Germany zu Ende gegangen war, folgte Gerda ihrem Mann in dessen Heimat, einer Stadt namens Fargo im amerikanischen Bundesstaat Minnesota. Dort lebten sie auf der Farm der Familie Granger, bis vor zehn Jahren »Onkel« Roy und zwei Jahre später auch Tante Gerda starb.
Anfang März hatte Fred nun die Nachricht bekommen, dass auch Gerdas einzige Tochter Lynette einem Krebsleiden erlegen war. Er hatte seine Tante Gerda und Cousine Lynette vielleicht zwei oder drei Mal in seinem Leben gesehen, dennoch schwang in der Nachricht seiner Nichte Georgia so viel Hoffnung mit, dass er an der Beerdigung teilnahm, dass er gar nicht anders konnte. Er nahm eine Woche bezahlten Urlaub (tatsächlich war sein Abteilungsleiter heilfroh gewesen, dass Fred sein fettes Urlaubskonto ein wenig ausdünnte) und bestieg in Nürnberg eine Maschine von Delta Airlines, die ihn nach Paris brachte, wo sein Transatlantikflug nach Minneapolis startete. Nach sieben Stunden Wartezeit in Minneapolis ging es dann weiter nach Fargo, wo er buchstäblich mit offenen Armen vom amerikanischen Teil der Familie in Empfang genommen wurde. Als Zirndorfer mit einem typisch bodenständigen Gemüt überwältigte ihn die Herzlichkeit der Amerikaner zunächst ein wenig, sie erschien ihm übertrieben und beinahe verdächtig. Aber er gewöhnte sich ebenso schnell daran, nachdem er erkannt hatte, dass diese Freude und Zugewandtheit ungekünstelt war.
Während Cousine Lynette’s Beerdigung war das Wetter noch vorzüglich gewesen: frisch, aber trocken und schneefrei. Doch das Tiefdruckgebiet, das später Blizzard Xavier genannt werden sollte, warf bereits seinen Schatten voraus. Einen Tag vor Freds geplanter Rückreise blockierte die erste Ladung Schnee (kaum mehr als eine Vorhut des Kommenden, aber das wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand) abrupt den Regionalflughafen von Fargo und sorgte für eine hektische Neuorganisation von Freds Rückreise nach Minneapolis. Als nicht nur beste, sondern auch einzige Möglichkeit der Fortbewegung erwies sich nun die Eisenbahn, was für Fred eine Zugfahrt von mehr als sechs Stunden durch extrem abgelegene und einsame Gegenden bedeutete, buchstäbliche weiße Flecken auf der Landkarte. Dennoch nahm er die Strapaze auf sich.
Kurz vor der Abfahrt erspähte er unverhofft einen vertraute Umriss in einer der Kisten mit Dingen, die Nichte Georgia aus der Wohnung von ihrer Mutter geholt hatte – es war eindeutig eine Kuckucksuhr. Das erschien nicht ungewöhnlich, da in Minnesota mehr als ein Drittel der Bevölkerung deutsche Wurzeln hatte und viele der Familien sich an Souvenirs ihrer früheren Heimat geklammert hatten. Aber dann erkannte Fred an der Form des Gehäuses und Details der Verzierungen, dass er es hier nicht mit einem einfachen Teil oder gar einer billigen Imitation aus dem Versandhauskatalog zu tun hatte.
Sein Herz schlug schneller. Zuerst wollte er es nicht wahr haben, aber dann gab es keinen Zweifel mehr, mit was er es hier zu tun hatte – eben jener Bahnhäusleuhr von Kreuzer, Glatz und co aus dem Jahr 1852, die nun dick und sicher eingepackt auf dem Sitz neben ihm ruhte. Mühsam hatte er sich im Laufe vieler Jahre ein grammatikalisch perfektes, wenn auch von einem stark teutonischen Akzent geprägtes Englisch antrainiert ... aber in diesem Augenblick, als seine Finger zum ersten Mal zitternd über die Kreuzer, Glatz und co strichen, bahnte sich der Franke unaufhaltsam einen Weg aus ihm heraus.
Fred stöhnte: »Allmädchdna, allmädchdna, ALLMÄDCHD-NA! I glaab’s net! ALLMÄDCHD!«
Sofort kam seine Nichte zu ihm und frage, was passiert sei, ob er sich verletzt habe. Er schüttelte nur den Kopf, die Bahnhäusleuhr von Kreuzer, Glatz und co wie den heiligen Gral in Brusthöhe an sich gepresst, auf den Lippen ein seliges Grinsen, und flüsterte: »Mir ging’s nie besser.«
»Gefällt dir dieses Ding?«, fragte Georgia mit Blick auf die Uhr. »Wenn ja, dann kannst du es gerne haben. Ich finde dieses Ungetüm schrecklich kitschig.«
»Ungetüm? Schrecklich?«, echote Fred fassungslos, ehe ihm bewusst wurde, dass auch er im Alter von 25 wenig Freude an einer Kuckucksuhr gehabt hätte. Er räusperte sich. »Aber ich kann doch nicht ... das ist ... Georgie, das ist ein sehr wertvolles Teil. Sehr. Wie viel willst du dafür haben?«
Sie wölbte die Augenbrauen und wirkte fast ein wenig beleidigt. »Geld? Vergiss’ es. Ich bin dir so unendlich dankbar, dass du hier warst ... wenn dich die Uhr freut, dann gehört sie dir, und ich bin happy für dich. Mama hätte das sicher auch gewollt.«
Abrupt ging in diesem Moment ein scharfer Ruck durch den Zug. Bremsen quietschten.
Aus der schönen Erinnerung wurde Fred abrupt in die eisig kalte Realität zurückgerissen.
Das hübsche Mädchen vier Reihen weiter in Fahrtrichtung blickte sich verschlafen blinzelnd um und fragte verwirrt, was los war, aber ihr Freund konnte nur mit den Schultern zucken, er hatte keine Ahnung.
Frederick Wendt aus Zirndorf jedoch hatte eine Ahnung. Es war das eingetreten, was er die ganze Zeit schon befürchtet hatte. Greitzkiesldunnerwedder!, dachte er, als der Zug ein paar Momente später merkbar verlangsamte. Jetzt war es soweit: Sie steckten im Schnee fest!
3
Das helle, statische Knacken, als die Sprechanlage des Zuges eingeschaltet wurde, war für die Reisenden eine Art Startschuss, dass es nun gerechtfertigt schien, Sorgen, Angst, sogar Panik und Wut zu verspüren und auch offen zu zeigen. Noch bevor der Zugbegleiter nur ein Wort gesagt hatte, füllte das beunruhigte Tuscheln der Passagiere die wärmegefüllte Röhre des Schnellzugs.
Dann verkündete die höfliche, aber ernste Stimme eines Schaffners: »Sehr geehrte Fahrgäste, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Strecke sowohl in als auch entgegen der Fahrtrichtung in unerwartet kurzer Zeit vollkommen zugeschneit worden ist.«
Das Tuscheln der Reisenden mündete an dieser Stelle in ein halb geschocktes, halb ärgerliches Raunen.
»Deshalb sind wir leider gezwungen«, fuhr der Zugbegleiter fort, »in der nächsten Ortschaft einen Notstopp einzulegen. Dort, in Nightfall Rapids, werden Sie in ein Hotel gebracht, in dem Sie bis zur Weiterfahrt verbleiben. Die Kosten dafür werden selbstverständlich von der Eisenbahngesellschaft übernommen und Ihnen nicht angerechnet. Sobald sich die Wettersituation bessert, werden wir die Fahrt fortsetzen. Wir bitten um Ruhe und hoffen auf Ihr Verständnis.«
Du liebe Güte, das kann doch nicht uns passieren, dachte Fred stöhnend, während der Zug seine Geschwindigkeit weiter reduzierte, bis er schließlich nur noch im Schritt-Tempo vor sich hin rollte.
Schnee wirbelte um die Wagen herum und wurde vom Wind gegen die Scheiben gepeitscht. Es sah aus wie ein seltsamer, lebendiger Nebel aus einer anderen Dimension, wie in einem Buch von diesem Horror-Schreiber Stephen Dingsda. Er las solche harten Sachen sowieso nicht. Für ihn waren die meisten Tatort-Krimis bereits der Gipfel an Nervenkitzel, den er noch ertragen konnte, ohne Alpträume zu bekommen.
Die Aussicht, die mollige Wärme des Zuges verlassen und durch den Schneesturm stapfen zu müssen, verursachte ihm ein schmerzhaftes Ziehen im Magen, als er seine Reisetasche von der Gepäckablage hievte und in seinen daunengefütterten Wintermantel schlüpfte. Danach wickelte er sich einen ellenlangen Wollschal um den Hals und warf einen weiteren Blick nach draußen. Am Zugfenster zogen jetzt die ersten verschwommenen Lichter von Häusern und Straßenlaternen vorbei.
Nun, das war ein schöner Anblick: eine Ortschaft.
Menschen. Gebäude. Wärme. Relative Sicherheit.
Erleichtert wollte Fred gerade durch den Mittelgang zum nächsten Ausgang schnaufen, als neben ihm etwas mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden landete. Dinge kullerten geräuschvoll durch die Gegend. Etwas zischte wie ein Torpedo direkt an seinem Fuß vorbei, und er hörte eine wütende Frauenstimme: »O Gott, verflucht, das kann doch nicht wahr sein!«
Fred wandte sich um und sah die junge Frau, die sich vorhin so eifrig Notizen aus einem dicken Buch gemacht hatte, neben ihrem aufgeplatzten Koffer auf den Boden knien.
Erst jetzt kam Fred dazu, sie näher zu betrachten: Sie war schlank und groß (wenn sie stand, überragte sie Fred um einige Zentimeter) und hatte ein apartes Gesicht mit hohen Wangenknochen, perfekt geschwungenen Brauen und großen Augen, deren äußere Winkel sich ein wenig nach oben zogen, was ihr ein geheimnisvolles, katzenhaftes Aussehen gab. Dennoch wirkte sie in ihren schlichten, unauffälligen Sachen und mit dem einfachen Pferdeschwanz, zu dem sie ihr langes, rotbraunes Haar zusammengebunden hatte, auf eine seltsam unprätentiöse, zurückhaltende Art hübsch (obwohl sie fraglos auch als hinreißende und aufwendig hergerichtete Königin der Nacht im sündhaft teuren Designerkleid nicht fehl am Platze gewesen wäre.)
Für ein paar Momente stand er wie eine schwitzende Salzsäule vor seinem Sitzplatz, während er beobachtete, wie die junge Frau so emsig wie ein Bagger ihre Sachen wieder in den Koffer schaufelte. Dann endlich schaffte er es, seine angeborene Lähmung in der Umgebung gutaussehender (streng genommen fast aller) Frauen zu überwinden. Er hockte sich hin und reichte ihr eine braune Kosmetiktasche, die bis unter seinen Sitz gekullert war.
»Das, ähm, das gehört, äh, Ihnen«, sagte er.
Die attraktive junge Frau sah überrascht auf.
»He, danke für Ihre Hilfe«, meinte sie mit einem dankbaren Lächeln. Ihre Augen schimmerten in einem unwahrscheinlichen Smaragdgrün, das Fred fast um den Verstand brachte. »Das ist so nett von Ihnen. Dieser dämliche Koffer ist einfach aufgesprungen. Mist. Aber typisch, nicht wahr?«
Fred überlegte kurz und krampfhaft nach einer möglichst witzigen und geistreichen Erwiderung, fand aber keine. Humor und Schlagfertigkeit waren nicht gerade seine Stärken, und ganz besonders nicht, wenn er sich mit Individuen des anderen Geschlechts unterhielt. Dafür sammelte er Kuckucksuhren und stellte Bilanzen auf, und das war wohl auch irgendetwas wert.
»Ja, äh, das kenn' ich - so was passiert immer, wenn man es nicht brauchen kann«, sagte er nach einer halben Ewigkeit und hängte sich den Trageriemen seiner Reisetasche um den Hals. So weit, so gut. Er klang wenigstens nicht, als würde sein Hirn noch im Gepäcknetz liegen. Das war schon mal ein Teilerfolg.
»Da drüben, ich meine ... hmmm, warten Sie, dort ist noch ... äh, etwas von Ihren Sachen.«
Er langte unter die Sitzbank, erfühlte etwas Weiches, Seidiges und erkannte zu spät, dass es sich um irgendwelche Unterwäsche oder so was handeln musste. Mit hochrotem Kopf räusperte er sich, gab er ihr dann verschämt das Höschen und wandte sich sofort wieder ab, um - Gott sei dank! - diesmal nur ein Buch der jungen Frau zu finden.
Nachdem die beiden den Koffer wieder gefüllt hatten (Fred war extra ein paar Meter hin und her auf Händen und Füßen durch den Mittelgang gekrochen, um sicherzugehen, dass sie alles fanden; zum Dank war ihm der Mann mit dem Laptop auf die linke Hand getreten), stellten sie sich hinter den anderen Reisenden vor dem Ausgang auf.
»Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben«, sagte die junge Frau und lächelte ihm zu, für Fred ein heller Sonnenstrahl in einer finsteren und immer finsterer werdenden Nacht. »Ich bin Andra ... Andra Merrick.«
»Wendt ... erfreut ... Frederick«, sagte er und schüttelte dabei ihre Hand. Ihre Haut war so warm, weich und zart, dass Fred das kribbelnde Gefühl hatte, durch seine Finger würde Strom fließen.
Erst, als ihn das Mädchen etwas ratlos anstarrte, fiel ihm auf, dass er sich ziemlich dämlich angehört haben musste.
»Ja ... das ist mein Name«, sagte er. »Ich bin Frederick Wendt. Und ich freu' mich, Sie, äh, kennen zu lernen, weil ... ich meine ... äh ... tja ... äh?!«
An dieser Stelle entschied er sich, lieber den Mund zu halten, bevor er noch mehr stammelte. Stattdessen langte er in einem unerwarteten Anfall von Kavalierhaftigkeit nach dem Griff von Andra Merricks Koffer.
»O Gott nein, das müssen Sie doch nicht«, sagte sie und legte ihre schlanke und wohlgeformte Hand auf seine im Vergleich dazu ungeschlachte Pranke.
»Ach, ist schon gut«, meinte er. »Das tu' ich, äh, gerne. Ehrlich. Und nennen Sie mich doch einfach Fred oder Freddie, so wie alle.« Dann stöhnte er ein lang gezogenes: »Unnngh!«, während er den Koffer durch den engen Gang zwischen den Sitzreihen schleifte. Fred war vielleicht einssiebzig groß und gelinde gesagt stämmig, aber von Kraft war bei ihm nicht allzu viel die Rede.
»Ist der Koffer zu schwer?«, fragte Andra.
Natürlich war der Koffer zu schwer, aber nun gab es kein Zurück mehr. Wenn ein Mann, selbst ein unkonventionelles Exemplar wie Fred, einer hübschen Frau einen Gefallen tat, war nichts zu schwer, selbst wenn einem Zunge und Gedärme vor Anstrengung meilenweit aus dem Körper quollen.
Fred schüttelte den Kopf. »Geht schon. Aber was in Gottes Namen haben Sie denn da drin?«
»Meine Gewichtheberausrüstung«, sagte Andra, die im Gegenzug Freds Kuckucksuhr und leichte Reisetasche trug. Als sie seinen verblüfften Blick sah, lachte sie: »Hey, das war nur Spaß. Das sind meine Bücher. Wissen Sie, Ich mache Abendkurse in Informatik und Betriebswirtschaft. Weiterbildung eben.«
»Ah ja«, sagte Fred, während er sich hinter der alten Dame, die das Cartland-Buch gelesen hatte, in die Traube der wartenden Zugpassagiere einreihte und nervös abwartete, was als nächstes geschehen würde.
4
Im letzten Passagierwagen des nur noch dahinrollenden Schnellzuges holte in diesem Moment ein großgewachsener, durchtrainierter Mann seine lederne Aktentasche aus dem Gepäcknetz.
Anthony Carpenter war zweiundfünfzig Jahre alt und hatte in seiner bisherigen Lebensspanne mehr erlebt als ganze Gruppen anderer Menschen: er absolvierte anderthalb Diensttouren in Vietnam, denen zwei Monate Gefangenschaft in einem Lager des Vietkong ein qualvolles Ende bereiteten; acht Jahre Malochen als Police Officer in New York City (in dieser Zeit zwei gescheiterte Ehen und einige weitere erfolglose Anläufe, um dauerhafte Beziehungen zu starten); und schließlich weitere acht Jahre als Special Agent beim FBI.
Inzwischen arbeitete er schon seit einiger Zeit nicht mehr für die Regierung. Sein neuer Arbeitgeber war eine weitaus besser bezahlende private Firma mit ähnlichen Aufgabenbereichen wie sein früherer Dienstherr. Daher konnte man immer noch an seiner rechten Hüfte, ein wenig hinter dem Hüftknochen, eine längliche Ausbeulung sehen, die ein Profi sofort als Gürtelholster mit Waffe darin identifiziert hätte.
Als er sich kurz darauf zu dem kleinen, gedrungenen Mann umwandte, der mit unwirschem, grimmigem Gesichtsausdruck auf einem der Abteilsitze kauerte, waren seine Bewegungen so gewandt und geschmeidig wie früher. Auch sein neuer Job zwang ihn dazu, sich in Form zu halten.
»Komm schon, Seppi«, sagte Carpenter. Sein schwarzes Haar glänzte im fahlen Licht der Leuchtstoffröhren am Waggondach.
»He, du kannst mich mal, du Wichser«, nölte der Mann, der die Hände hinter dem Rücken hielt. »Mir tut alles weh. Mach' endlich die Fesseln los. Sonst gehe ich keinen Schritt.«
»Du willst also wirklich bei diesem Blizzard hier im Zug übernachten?«, fragte Carpenter. »Könnte ungemütlich werden, nur so im T-Shirt, denkst du nicht?«
Wie ein Bauer, der sein Maultier mit einer Karotte voranzutreiben versucht, ließ der Ex-FBI-Agent ein warmes Kleidungsstück vor den Augen seines glatzköpfigen Begleiters hin- und herbaumeln.
Der tätowierte, stiernackige Mann funkelte Carpenter wütend an. »Du Bastard, ich will sofort meine Sachen wieder, hörst du?«
Mit einer leicht zynischen Geste, die als Antwort genügen musste, packte Carpenter den Mann, den er mit 'Seppi' angesprochen hatte, und schleifte ihn mit sich.
»Reine Vorsichtsmaßnahme«, sagte er. »Immerhin hab' ich die Verantwortung dafür, dich sicher nach L.A. zu bringen, damit du in acht Tagen brav vor Gericht gegen deinen Ex-Boss aussagen kannst. Und schon deshalb will ich nicht, dass du irgendwas Dummes versuchst ... was ich dir übrigens wirklich nicht rate. Selbst wenn du es schaffen solltest, mich zu überlisten und zu türmen - da draußen würdest du nicht einmal eine Stunde überleben. Und außerdem sind wir in dieser Stadt völlig eingeschneit, wie du gehört hast. Also würdest du sowieso nicht besonders weit kommen. Witzig, hm?«
»Fick dich ins Knie«, sagte Giuseppe Di Maria. »Und dann schaff' mich dahin, wo's warm ist.«
»Ersteres ist mir anatomisch unmöglich, aber letzteres wird sofort erledigt«, sagte Carpenter mit einem vordergründigen Grinsen, das Di Maria, wenn er belesener gewesen wäre, an den Gesichtsausdruck der Cheshire-Katze erinnert hätte. Barsch schubste er den gefesselten Mann in Richtung Waggontüre vor sich her.
Vor dem Ausgang verharrte bereits eine kleine Gruppe Reisender, die eingemummelt in ihre dicken Wintersachen wie gesichtslose Eskimos aussahen. Weniger als eine Minute später konnten Carpenter und seine Schutzperson den Zug verlassen.
Das erste, was der Ex-FBI-Mann in der schneidenden Kälte draußen sah, war der Vorhang der Schneeflocken, welcher durch die gleißende Helligkeit der Notbeleuchtung auf dem Bahnsteig schwärmte. Dann hörte er energische Anweisungen:
»Hier entlang ... hier entlang!«
Die Stimme gehörte einem Schaffner, der mit einer beleuchteten Kelle zur Seite winkte und die Reisenden in Richtung des Bahnhofsgebäudes dirigierte. Auf dem Weg kamen Carpenter und Di Maria an einem großen, breitschultrigen Bahnangestellten vorbei, der gerade die Koffer eines seltsamen Paares entgegennahm - sie war eine großgewachsene, reizvolle Schönheit, ihr Begleiter hatte ein feistes, aber freundliches John-Candy-Gesicht, sowie mehr als nur fünfzehn Kilo zuviel am Bauch und auf den Rippen. Zudem war er mehr als einen halben Kopf kleiner als sie.
Auch wenn sich später keiner an diese zufällige Begegnung auf dem kleinen Bahnhof erinnern sollte, war es dennoch das erste Mal, dass sich Tony Carpenter und Frederick Wendt während ihres Aufenthaltes in Nightfall Rapids über den Weg liefen.
5
»Beeilen Sie sich! Geben Sie mir Ihren Koffer!«, rief ein vermummter Bahnangestellter. »Seien Sie vorsichtig beim Aussteigen! Halten Sie sich fest!«
Frederick Wendt tat, wie ihm befohlen wurde. Der Blizzard, der durch die geöffneten Waggontüren fauchte, schnitt in seine Haut wie Rasierklingen. Reflexartig hielt er die Luft an und zupfte seinen Schal noch etwas höher. Danach klammerte er sich an die vereiste Haltestange und kletterte vorsichtig auf den verschneiten Bahnsteig hinab. Andra Merrick war direkt hinter ihm. Es schien, als suchte sie hinter ihm Deckung vor dem frostigen Orkan, der gnadenlos auf die Passagiere einpeitschte, während sie von Schaffnern und Männern mit Leuchtfackeln in Richtung eines großen, lang gezogenen Gebäudes visa-vis des Bahnhofes gelotst wurden. Auf der Vorderfont des Hauses waren in roten Buchstaben ein paar wahrhaft tröstliche, Wärme und Geborgenheit versprechende Worte zu lesen: Rapids Inn Hotel
Nachdem sich die etwa sechzig bis siebzig schlotternden Reisenden in der Eingangshalle des Hotels (sofern es nicht übertrieben war, den lang gezogenen Raum mit einer Theke und einem Schlüsselbrett dahinter so zu nennen) versammelt hatten, fragte sich Fred angesichts der doch imposanten Menschenmenge, ob alle Zugpassagiere hier Platz finden würden. Nochmals in diese Kälte hinaus zu müssen, um ein anderes Quartier zu suchen, war wirklich das letzte was er wollte; außerdem w-
Jemand hatte etwas gesagt. Fred sah auf.
»Meine Damen und Herren, kann ich kurz Ihre Aufmerksamkeit haben? Hallo?!«, sagte einer der Männer, die sie hergeführt hatte. Als er seinen dicken, grauen Parka öffnete, kam darunter eine Polizeiuniform zum Vorschein. »Ich bin Sheriff Ward Douglas und möchte Sie alle hier in Nightfall Rapids willkommen heißen. So, wie es aussieht, werden sie wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen Ihre Reise fortsetzen können, bis dahin machen Sie es sich hier gemütlich, alles klar? Sie werden hier alle ein Bett bekommen. Wir haben fünfzig Hotelzimmer, der Rest wird in den Stuben des Personals und anderen leerstehenden Räumen Unterkunft finden, wo wir bequeme Feldbetten aufgestellt haben.« Polizeichef Douglas sah sich um. »Okay, ich gebe zu, das hier ist nicht das Waldorf Astoria. Aber das hier ist auch keine Ferienfahrt, denn die Situation ist ernst - das ist Ihnen hoffentlich klar. Ich schätze, irgendwie werden wir das Beste aus der Geschichte machen. Okay? Okay!«
Fred nickte schniefend und sehnte sich nach einem Taschentuch und Hautcreme. Sein Gesicht stach und brannte und prickelte fast unerträglich.
Der bullige Sheriff schüttelte missmutig den Kopf, bevor er fortfuhr: »Leider hat der Sturm sämtliche Telefonleitungen aus der Stadt heraus lahm gelegt. Und wie Ihnen ein Blick auf Ihre Handys sagen wird, liegen wir hier in einem aussichtslosen Funkloch.«
Tatsächlich sprachen die enttäuschten Gesichter sämtlicher Mobiltelefon-Besitzer Bände. Kein Herumrütteln, kein Netzsuchlauf und auch kein Umhertigern von Zimmerecke zu Zimmerecke entlockte den wertlos gewordenen Hitech-Apparillos nur einen Hauch von Empfang.
»Aber ich kann Sie dennoch beruhigen«, fuhr der Sheriff fort. »Die Eisenbahngesellschaft hat mir versichert, dass man an Ihrem Zielbahnhof ein Informationstelefon einrichten wird, wo sich Ihre Angehörigen oder Freunde erkundigen können, dass es Ihnen hier gut geht und sie in wenigen Tagen sicher eintreffen werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen notgedrungenen, aber schönen Aufenthalt in Nightfall Rapids. Wir haben genug zu essen und trinken und warme Betten und Liegen für alle, glauben Sie mir.«
»Aber was ist mit Strom?«, fragte einer der Passagiere. »Was passiert, wenn hier der Strom ausfällt? Woher kriegen Sie hier Ihren Strom?«
Fred hatte sich schon dieselbe Frage gestellt, sie aber nicht aussprechen wollen, als ob er damit böse Geister fernhalten konnte.
»Sir, machen Sie sich keine Sorgen«, meinte Douglas. Seine Stimme war tief und etwas rau, aber freundlich. Er hatte viel von Freds Onkels Gustav. »Normalerweise bekommen wir einen Teil des Stroms per Hochspannungsleitung, den Rest erzeugen wir mit unserem kleinen Heizkraftwerk selbst«, sagte der Polizeichef. »Im Moment sind wir zu hundert Prozent auf unser Kraftwerk angewiesen, weil die Fernleitungen schon seit zwei Monaten außer Betrieb sind; aber das passiert jeden Winter, und auf unser Kraftwerk sind wir sehr stolz. Es hat noch nie damit Probleme gegeben. Alles klar? Noch Fragen? Nein? Gut. Na gut.«
Also bekamen die Passagiere ihre Zimmerschlüssel. Hinter dem Hoteltresen stand ein kleiner, weißhaariger Mann mit stechenden, fast schon schwarzen Augen. Er musterte die einzelnen Fahrgäste zuerst mit einer Mischung aus Misstrauen, Argwohn und seltsamem Interesse, bevor er ihnen wortlos die Schlüssel in die Hände drückte.
Als Fred und Andra an der Reihe waren, zögerte der kleine Mann sogar noch in wenig länger als zuvor. Mit einem unergründlichen Glimmen in den Augen stierte er die junge Frau an, so dass sie sich mehr als nur ein wenig unbehaglich zu fühlen begann. Sie war so hübsch, dass sie es gewöhnt sein musste, angesehen und vielleicht sogar unverhohlen angestarrt zu werden ... Aber nicht auf diese beklemmende Art und Weise. Darum drängte sich Fred instinktiv zwischen die beiden und unterbrach den Blickkontakt.
»Ähm, die Schlüssel«, sagte er und zeigte auf den Schlüsselbund mit der Nummer zwei-null-vier, den der Mann in seiner faltigen Hand hin- und herwiegte. »Wir wollen in unsere Zimmer …«
Immer noch schweigend und in seinem Gluutz gefangen drückte der Fremde Andra den ersten, Fred einen zweiten Schlüssel in die Hand. Danach verschwand er durch einen dunkelroten Vorhang in das Nebenzimmer der Empfangshalle.
»Was für aan Gläufl«, sagte Fred kopfschüttelnd, während er über eine schmale, u-förmige Treppe mit hohen Stufen die erste Etage erklomm.
Oben angekommen hievte er mit letzter Kraft ihren schweren Koffer in ihr Zimmer, nahm dann seine Kuckucksuhr und die leichte Reisetasche entgegen und verschwand schließlich in seinem eigenen Raum, der direkt neben dem von Andra lag. Es gab sogar eine abgeriegelte Verbindungstür zwischen den beiden Stuben.
Zuerst hängte Fred seine klamme Überkleidung - Mantel, Schal und Handschuhe - zum Trocknen an die Heizung. Dann sah er sich in dem kleinen, nicht ungemütlichen Zimmer um. An der linken Seitenwand der vielleicht drei mal fünf Meter messenden Kammer stand ein großes, mit rotbraun karierten Laken bezogenes Bett, in dessen Nachttisch ein Radio eingebaut war. Auf der anderen Seite befanden sich ein schmaler Kleiderschrank sowie der Eingang zu einem nur mit Toilette und Waschbecken bestückten Alkoven, der ähnlich wie die Nasszellen in Wohnmobilen oder Wohnwagen anmutete.
Kritisch musterte Fred anschließend die Zimmerecken und sämtliche Spalten, die sich zwischen Möbelstücken auftaten. Fred hasste Spinnweben und Spinnen. Sie widerten ihn an. Tief unten im Keller des Mittelklassehauses, wo Fred aufgewachsen war, hatten ganze Kolonien von Spinnen ihr Zuhause gehabt. Sie kauerten in den Ecken der fast drei Meter hohen, immer düsteren und kalten Vorratskammer in ihren Netzen und warteten geduldig auf Beute. Fred hatte sich mit der faszinierend dunklen Phantasie mancher Kinder immer wieder vorgestellt - fast schon vorstellen müssen -, wie die Spinnen dort lauerten, bis er endlich nach unten kam, um für seinen Vater ein Bier oder was auch immer zu holen, und sie über ihn herfallen konnten. So albern es war, er erschauderte jetzt noch, nur bei dem Gedanken.
Seine Sorgen waren jedoch unbegründet. Der Raum war sauber und proper, wie er es mochte.
Gähnend ließ er sich also auf das Bett plumpsen und stellte erleichtert fest, dass die Matratze nicht zu weich war. Wegen seines Übergewichtes quälte ihn ein gewisses Bandscheibenleiden, und sein Arzt hatte ihm geraten, weniger zu essen und abzunehmen (was er jedoch geflissentlich überhört hatte) oder wenigstens zum Wohle seines Rückens auf weiche Betten zu verzichten.
Mit einer erschöpften Handbewegung schaltete er das Radio im Nachttisch ein. Sofort knisterte statisches Rauschen aus dem Lautsprecher, gefolgt von ein paar Stimmfetzen, die noch im Äther hängen geblieben waren. Der Empfänger mochte nur wenige Jahre alt gewesen sein und wirkte, von der dünnen Staubschicht auf der Senderskala abgesehen, fast neuwertig, wie auch der Rest des Mobiliars. Alles wirkte ungebraucht und klinisch, wie eine Theaterkulisse.
In einer gemütlichen Pension am Stadtrand von Bremen, wo Fred einst einen Kurzurlaub verbracht hatte, war auch ein Radio im Nachttisch eingebaut gewesen. Doch im Gegensatz zu diesem modernen Empfänger hier war dies ein uraltes Gerät gewesen, durch das sich der Ton seltsam dumpf und gequetscht anhörte, als würde er aus einer vergangenen Zeit kommen. Jedes Mal, wenn Fred das betagte Radio eingeschaltet hatte, um sich vor dem Einschlafen mit Musik zu entspannen, hatte er erwartet, einen Ansager zu hören, der begeistert die ZDF-Hitparade mit Dieter-Thomas Heck, live aus West-Berlin! oder etwas ähnlich nostalgisch-vergangenes ankündigte. Es war dasselbe Gefühl, als würde man eine alte, vergilbte Fotografie betrachten - eine Mischung aus Erinnerungen und Wehmut, meistens verbunden mit einem Hauch Verklärung und Melancholie.
Dieses neue Radio hier in seiner sterilen Möbelhaus-Umgebung löste jedoch keine dieser Emotionen aus. Es war funktionell und modern und ließ einen völlig kalt.
Fred drehte an der Sendereinstellung und hörte das Pfeifen sich überlagernder Sendebänder, dann abgehackte Stimmen, keine davon verständlich. Es dauerte einige Zeit, bis er endlich auf Langwelle einen Sender gefunden hatte, der Informationen brachte. Die Stimme des Nachrichtensprechers war tief und unbewegt, als er seine Tirade schlechter Neuigkeiten begann:
»... der Norden des Landes und Kanada werden momentan von den heftigsten Schneefällen seit mehreren Jahren heimgesucht. Besonders betroffen sind die Staaten British Columbia, Alberta und Saskatchewan in Kanada, Washington, Montana, North und South Dakota, Minnesota und Wisconsin in den Vereinigten Staaten. Minnesota, Montana und North Dakota wurden zu nationalen Notstandsgebieten erklärt; viele Dörfer und Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Telefonverbindungen und Strom ...«
Allmächd, wenigstens haben wir hier noch Strom, is’ des garschtig! dachte Fred. Er spürte ein dumpfes Würgen in der wie zugeschnürten Kehle.
»... viele Straßen und Eisenbahnlinien sind zugeschneit, vor Reisen in die betroffenen Gebiete wird gewarnt«, fuhr der Sprecher eindringlich fort. »Die Flughäfen aller großen Städte in diesen Gebieten sind geschlossen, sämtliche Flüge in die Notstandsgebiete gestrichen worden. Die Nationalgarde ist bereits mobilisiert, erste Evakuierungszentren für die Menschen in den Notstandsgebieten sind im Aufbau. Nach Angaben führender Wissenschaftler sind die überraschend aufgetretenen und unerwartet heftigen Schneefälle wohl auf das alle sieben Jahre auftretende Wetterphänomen 'El Nino' zurückzuführen, und es könnte noch mindestens drei Tage anhalten, bevor eine Besserung in Sicht ist. Wir werden Sie laufend weiter informieren. Und nun zu weiteren Neuigkeiten aus aller Welt: In Helsinki trafen israelische und palästinensische Unterhändler zusammen, um über deine Waffenr-«
Fred knipste das Radio aus. Diese subtile, grummelnde Angst in seinem Magen wich nun offener Furcht. Was, wenn der Schnee noch höher stieg? Was, wenn sie hier ohne Strom sitzen bleiben würden, ohne Heizung und Wärme? Dann waren sie, davon war er überzeugt, »etz echd verrazzd«.
»He, Fred, sind Sie wach?«, rief Andra in diesem Moment und klopfte gegen die andere Seite der Verbindungstür.
Alleine die junge Frau zu hören, wie sie etwas sagte, das nur ihm galt, stimmte ihn wieder etwas positiver, zumal auch ihr Vorschlag sehr vernünftig klang.
»Ich gehe ins Restaurant ... also, wenn es hier so etwas gibt«, meinte sie. »Ich hab' einen Bärenhunger. Hoffentlich gibt es etwas zu futtern. Kommen Sie auch mit?«
Fred zögerte keine Sekunde.
6
Der Speisesaal grenzte direkt an die Empfangshalle des Hotels und wurde offensichtlich so selten benutzt wie der Rest des Hotels. Es war, als würden die Leute vom Hotel das Restaurant und die Küche nur dann öffnen, wenn Gäste hier abgestiegen waren; ansonsten blieben alle Möbel säuberlich mit Tüchern abgedeckt. Schließlich war es auch hier, wie im Zimmer, nicht schmutzig oder staubig, sondern wirkte einfach nur unbenutzt. Fred fühlte sich, als habe er einfach nur die Abteilung in dieser seltsamen Möbelpräsentation gewechselt, von anonymes, einfaches Hotelzimmer zu Speisesaal in einem Kleinstadthotel.