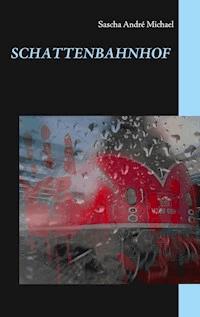Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Type:Writer-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ob in der luxuriösen Ferienvilla in den Bergen oder den Büros einer coolen Werbeagentur ... Ob auf einer Amerikareise oder an Bord eines mondänen Kreuzfahrtdampfers ... Ob in einer fremden Zeit oder in einem unbezahlbar teuren Frankfurter Penthouse ... Das Dunkel findet dich überall! Du denkst, im Licht bist du sicher? Es gibt keine Sicherheit. Es gibt kein Entkommen. 10 faszinierende Kurzgeschichten von Sascha André Michael. Der Ulmer Autor (Die Königin des Regens, Seelenfrost, Morgenmenschen) bietet dem Leser mit MITTERNACHTSDÄMMERUNG eine einzigartige Sammlung abgründiger Erzählungen zwischen Psychothriller und Horror, zwischen Mystery und Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rache (zugehöriges Verb rächen) ist eine Handlung, die den Ausgleich von zuvor angeblich oder tatsächlich erlittenem Unrecht bewirken soll. Von ihrer Intention her ist sie eine Zufügung von Schaden an einer oder mehreren Personen, die das Unrecht begangen haben sollen. Oft handelt es sich bei Rache um eine physische oder psychische Gewalttat. Vom Verbrechen wird sie im archaischen Recht durch die Rechtmäßigkeit unterschieden.
(Wikipedia)
Die Rache ist mein! Ich will vergelten, spricht der Herr!
(5. Mos. 32,35)
Die Rachegötter schaffen im Stillen.
(Schiller, Braut von Messina)
In the bottomless silence. without warning
a curtain slowly ascends revealing
a midnight dawn. A whisper of chill wind
and white sun eclipsed by pale yellow moon.
rumor of distant thunder trembles along the
edge of a galaxy
Cascading down infinite corridors of burning
mirrors reflecting and rereflecting
momentous oceans of stampeding
wild horses.
glass shatters, shrieks and spins away
becoming clusters of starfall that scatter
from hidden places. pulsating. relentless.
like a recurring nightmare.
centaurs throb within the blood crossing
atreries of storming cavalries the
crash though the top of your head.
recycle and recur
again and again.
reminding of white suns eclipsing oceans of
stars shrieking through the midnight dawn.
Never ending. Without warning.
(William Friedkin, The Sorcerer)
INHALT
S
CHWARZER
S
CHNEE
F
UTUR
I
MPERFEKT
E
INE
F
RAGE DER
B
ALANCE
N
ÄCHTLICHE
B
RÜCKE
D
AS
H
OCHZEITSTAGSGESCHENK
W
ASSERSCHÄDEN
W
ARTEN AUF
K
AROLA
S
TREIFLICHTER FÜR
T
OMMY
M
ITTERNACHTSDÄMMERUNG
K
OPFGEBURT
L
EBEN
S
IE NOCH
,
ODER RÄCHEN
S
IE SCHON
?
(
EINE
A
RT VON
N
ACHWORT
)
Schwarzer Schnee
Juli 2014. Gestern habe ich den Artikel gelesen, und nun platzt mir fast der Schädel. Darum versuche ich zumindest, alles aufzuschreiben, obwohl mir einerlei ist, wo und ob dies je veröffentlicht wird. Und ich sag auch vorweg, dass es mir ebenso egal ist, ob man mir das alles nun glaubt oder nicht. Ich weiß, dass es genau so passiert ist. Immerhin ist es mir passiert.
Zugegeben, beim Schreiben merke ich, dass sogar mir selbst meine Erinnerungen verrückt und unglaublich vorkommen. Aber dann muss ich nur meine Hände anschauen, und schon wird mir wieder klar, dass es keine Spinnerei, sondern schmerzhafte und völlig unbegreifliche Realität war, was damals auf dieser gottverdammten Straße vorging.
Irgendwie begann alles mit dem Kerl von der Tankstelle. Also, ich frage Sie: was erwartet man an einer Tankstelle, die Meilen von der nächsten Stadt entfernt wie ein nachträglicher Einfall an eine einsame Landstraße in South Dakota geklebt worden war? Vermutlich etwas wie einen zahnlosen, steinalten Kerl mit roter Baseballkappe und Latzhose; meinetwegen auch einen Psychokiller mit Kettensäge, der als Tankwart verkleidet auf neue Opfer lauert.
Doch wen fanden wir an jener Tankstelle tatsächlich?
Einen blonden Surfertypen mit breitem, fröhlichen Grinsen und schrecklich guter Laune. Sie wissen schon, einer von jenem seltenen Schlag Menschen, denen damals keine Nachgeburt, sondern eine Schwall Konfetti und Luftschlangen aus Mamas Schoß gefolgt waren. Prächtig.
Meine Laune war sowieso schon nicht gerade auf dem Höhepunkt gewesen. Die Reise, mit der Paula und ich versuchten, unsere brüchig gewordene Ehe wieder zu kitten, war bislang nicht unbedingt (wie es unser halbwüchsiger Sohn formulieren würde) »der Bringer« gewesen. Das ständige Nörgeln und Giften, das wir eigentlich zu Hause im guten, alten Fürth hatten lassen wollen, war wie so ein tropisches Insekt in einer Bananenkiste als blinder Passagier mit uns gereist. Spätestens nach der dämlichen Panne, als wir unseren Leihwagen abholen wollten und man uns auf den falschen Parkplatz schickte, waren Paula und ich wieder zur üblichen Hochform aufgelaufen, was Knatsch, Schuldzuweisungen und Uneinigkeit anging.
Inzwischen waren wir an einem Punkt angekommen, wo mir klar wurde, dass sich außer der Gegend, durch die wir uns bewegten, und der Sprache, die die Leute sprachen, eigentlich nichts gegenüber unserer Situation in Deutschland verändert hatte. Leider.
Aber noch wollte ich die Flinte nicht ins Korn werfen. Die Reise dauerte ja noch ein Weilchen, und so sehr dieses verdammte Zanken scheinbar zu unserem Alltag gehörte, wollte ich die Hoffnung auf ein gutes Ende unserer Autotour entlang der familiären Wurzeln meiner Frau nicht aufgeben. (Vielleicht hoffte dies jedoch auch nur der sparsame Schwabe in mir, der nicht eingestehen wollte, dass die Unsumme, die unsere Reise bislang gekostet hatte und noch kosten würde, tatsächlich mehr oder weniger in den Wind geschossen sein sollte.)
Tatsache blieb jedoch, dass etwas eindeutig schief lief, und zwar in jeder Beziehung.
Hier standen wir also an dieser Tankstelle irgendwo in der Pampa von South Dakota, und während ich den Zapfhahn bediente wie ein gefügiger Untertan, danach die Windschutzscheibe putzte und den Reifendruck checkte, plauderte und flirtete meine Frau mit Mister Superentspannt, dem blondmähnigen, unsagbar fitten Surfertyp. Ich bemerke dies absichtlich, denn glauben Sie nicht, mir wäre nicht aufgefallen, dass ihr sein gutes Aussehen zu sehr imponierte (während für mich meistens abfällige Bemerkungen etwa über meine wild wuchernden Augenbrauen auf dem Programm standen.)
Da sie diejenige mit dem amerikanischen Familienteil war, sprach sie fließend Englisch, während man die paar Brocken, die bei mir aus der Leinfelden-Echterdinger Schulzeit hängen geblieben waren, höchstens als rückständig bezeichnen konnte. Dass ich demnach von der Unterhaltung der beiden kaum etwas mitbekam, drückte meine Stimmung sogar noch weiter in den Keller. Nicht dass ich Paula Brüderle, geborene Regenauer, so etwas zugetraut hätte. Aber tatsächlich könnten die beiden da über mich lästern, dass kein Auge trocken blieb, während ich ein paar Meter daneben stand und nichts davon mitbekam. Kein schöner Gedanke.
Mister Ultracool sagte etwas zu ihr, und sie kicherte. In Momenten wie diesen sah sie fast wieder wie das Mädchen von siebzehn aus, in das ich mich damals verliebt hatte, und nicht wie die erwachsene Frau von neununddreißig, die immer deutlicher das Zankgehabe ihrer Mutter an den Tag legte. Wahrscheinlich denken Sie nun, das wäre eine billige Retourkutsche, aber es war einfach eine Beobachtung. Und ich muss ehrlicherweise hinzufügen, dass sich Paula in unseren achtzehn Ehejahren zumindest optisch wesentlich besser gehalten hatte als ich. Ich war ganz schön aus der Form gekommen, seit ich die aktive Rolle in meinem Klempnereibetrieb gegen ein Chefdasein am Schreibtisch eingetauscht hatte. Paula hingegen sah man die ganzen Jahre des Wohlstandes sicher nicht an, wohl aber ihre weibliche Lebenserfahrung, was ihr jene gewisse Anziehungskraft verlieh, die weit über ein normales Maß an Hausfrauen-Attraktivität hinausging.
»What?«, fragte sie und lachte laut auf.
Der Surfertyp nickte eifrig und machte eine Geste, die ich witzig fand: er zeichnete mit dem rechten Zeigefinger zwei kleine Kreuze auf seine linke Brust. Es sah wie ein Schwur aus, ein Ehrlichkeitsschwur unter Kindergartenkindern.
»Come ON, you must be kidding!«, sagte Paula und sah mit blitzenden Augen zu ihm auf. »You’re just trying to scare me, right?« - Du jagst mir Angst ein, das verstand ich noch, seine Antwort war schon wieder außerhalb meiner Kenntnisse.
Kurz darauf bezahlte ich den Sprit und ein paar Snacks, dann stiegen wir wieder in den Ford Taurus von der Hertz Autovermietung. Endlich ließen wir die verdammte Tankstelle hinter uns.
»Er studiert Tiermedizin, ist das nicht goldig?«, sagte Paula etwa vier Kilometer später in fröhlichstem Zwitscherton.
»Wer?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort schon kannte.
»Justin natürlich«, sagte sie. »Unser Tankwart von eben.«
»Paula, ein Tankwart ist jemand, der die Arbeit macht. Ich war unser Tankwart. Er hat nur kassiert«, sagte ich und wiederholte dann noch mal tonlos den Namen: Justin. »Was will Justin denn heilen? Surfende Chihuahuas? Oder will er Fitnesskurse für übergewichtige Pudel anbieten?«
»Das schlimme ist, Felix, dass du deine erbärmlichen Bemerkungen und Retourkutschen als einziger Mensch dieser Erde wirklich für witzig hältst«, meinte Paula. Sie sagte immer in diesem ganz speziellen Tonfall Felix zu mir, wenn sie damit zeigen wollte, dass sie auf dem Weg war, wütend zu werden, oder zumindest knatschig. »Obwohl du es ihm nicht zutraust, weil er auf sein Äußeres achtet ...« (Autsch! dachte ich.) »... hat dieser Junge viel mehr Grips als die meisten der Typen in deinem Betrieb, den du so vergötterst.«
»Klar, und er trägt gern Cargohosen, kämpft für den Weltfrieden und fährt im Winter Snowboard«, sagte ich.
Sie zog eine Schnute, die besagte, dass sie darauf nicht im Traum einzugehen gedachte.
»Etwas Seltsames hat er gesagt, als ich ihm erzählt habe, dass wir unterwegs in Richtung Wall sind, weil ich dort entfernte Verwandte habe«, fuhr sie fort. Diese Bemerkung ließ mich unwillkürlich wieder grübeln, was sie Justin noch alles erzählt hatte. »Er meinte, wenn wir in diese Gegend wollen, müssen wir unter allen Umständen auf den Hauptstraßen bleiben und diese keinesfalls verlassen, wenn uns ... er sagte ‚unsere Finger lieb sind’. Ist das nicht merkwürdig?«
»Klingt nach sehr viel hochkarätigem Grips«, meinte ich dumpf. Noch eine Anspielung, die sie ignorierte. Besser so.
»Vielleicht meinte er ja, dass wir uns verirren und die Finger durch Erfrierungen verlieren könnten«, sagte sie gedankenvoll. »Wahrscheinlich ist das nur eine typische Redensart hier. So wie ‚Pop’ oder ‚Corn hole’.«
»Oder eine unheimliche Bande von Fingerräubern treibt dort zwischen den Dörfern ihr Unwesen, so wie in diesem blöden Film, Signs hieß er doch, oder?!«
»Naaa«, sagte Paula in breitem Fränkisch. »Du meinst das Dorf. Selber Regisseur, anderer Film.«
»Was auch immer«, meinte ich. Auf Diskussionen über Gruselfilme hatte ich nun keine Lust. Sie mochte diese Art von Streifen, ich konnte nichts damit anfangen. Wenn ich mir einmal ein solches Machwerk antat, dann nur Paula zuliebe.
Die nächste Zeit schwiegen wir uns erst einmal an (noch eine Disziplin des Ehezwist-Zehnkampfes, in der wir inzwischen beide Profis waren.) Doch als wir uns schließlich jenem Ort näherten, in den Paula ihren 1871 nach Amerika ausgewanderten Urgroßvater Mütterlicherseits zurückverfolgt hatte, wurde unser Groll geringer, so als habe man ihn an einen Lichtdimmer angeschlossen.
Paula war nun eher mit wachsender Vorfreude und Aufregung beschäftigt, und ich freute mich für sie und mit ihr. Ich fühlte mich besser. Ich hatte beim Fahren entspannen und buchstäblich Abstand gewinnen können; einerseits dank des völlig unehrgeizigen Autoverkehrs auf dieser Landstraße (ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den verbissenen Freiluftpsychiatrien, die man ‚deutsche Straßen’ nannte) und nicht zuletzt auch dank des Autos selbst. Über Mietwagen gab es ja wahre Horrorstorys, aber dieser taubenblaue Ford war wirklich erste Sahne – ein fahrendes Sofa. Die strikte Geschwindigkeitsbegrenzung sorgte stets für einen angenehmen und geordneten Verkehrsfluss, immerhin machte sie amokartige Blindflüge wie in Deutschland fast unmöglich.
Als wir den Badlands Nationalpark durchquerten, wurden wir immer wieder von Hinweistafeln (Memorials, wie sie Paula nannte) daran erinnert, dass hier ganz in der Gegend das Massaker von Wounded Knee stattgefunden hatte. Dies war, wie ich inzwischen wusste, eines der schlimmsten Verbrechen an der indianischen Zivilbevölkerung: mindestens 200 Männer, Frauen und Kinder vom Stamm der Lakota-Indianer waren kurz nach Weihnachten 1890 vom 7. Kavallerieregiment der US-Armee niedergemetzelt worden. Paulas Urgroßvater hatte sich eine ziemlich berüchtigte Gegend zum Ansiedeln ausgesucht, dachte ich, während ein weiterer Memorial am Straßenrand vorübersauste.
Warum auch immer, aber ich erinnere mich noch glasklar an den Gedanken, der mir danach durch den Kopf ging: Ich hoffe, das ist kein böses Omen oder so was
Wenn ich es nur geahnt hätte.
Wenn, verdammt noch mal ...
Bei einer 900-Seelen-Gemeinde namens Wall wechselten wir die Straßen. Oder besser: wir verließen unsere gute, breite und gepflegte Landstraße für das wahre Abenteuer. Nun standen uns nämlich noch knappe zwanzig Meilen über vermutlich sehr obskure Nebenpfade bevor, bis wir nach endlich Franken Bridge gelangten, dem Ziel unserer Reise.
Das von Erlanger Auswanderern (darunter auch Paulas Urgroßvater) gegründete Franken Bridge lag südlich eines Ortes namens Faith, also Glaube, und hatte heute noch sage und schreibe 500 Einwohner, viele davon mit Nachnamen wie Schamberger, Goerner, Kleinlein oder eben Regenauer. Es war vielleicht nicht unbedingt ein weißer Fleck auf einer Landkarte, aber bestimmt auch kein schwarzer. Wer nicht wusste, dass sich das Dorf dort befand, würde sicherlich nie danach suchen. Genau deshalb hatte uns eine jener Verwandten, die heute noch hier lebten (eine Groß-Großcousine namens Sheila Regenauer-Edwinson) per Email einen Routenplan geschickt. Darauf beschrieb sie detailliert, wie wir fahren sollten, welche Straßen sicher waren und welche wir auf jeden Fall meiden sollten (wieso auch immer, vielleicht wegen der Fingerräuber, die auch Justin, der Tiermedizin studierende Surferboy und Halbtagstankwart so fürchtete.)
Die Straße, auf der wir die Route beginnen sollten, war schmal, aber wenigstens geteert. Sie zog sich ungefähr fünf Meilen schnurgerade dahin, dann beschrieb sie eine scharfe Rechtskurve. Nach einigen weiteren Kilometern durch eine malerische Ansammlung von Nichts, Gar Nichts und Überhaupt Nichts kamen wir an eine Wegkreuzung, die auch auf Sheilas Karte verzeichnet war. Hier sollten wir einfach geradeaus weiterfahren und auf dieser Straße bleiben, bis wir Franken Bridge erreichten. Ich bremste abrupt vor dieser Gabelung.
»Was ist?«, fragte Paula und sah von ihrem Reiseführer (Discover the real South Dakota) auf. Es war mir schleierhaft, wie sie das machen konnte – beim Autofahren größere Texte zu lesen war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Sofort wurde mir speiübel, wenn ich unterwegs ein Buch nur in die Hand nahm. Ich hatte mal gelesen, dies habe etwas mit dem Mittelohr zu tun; vielleicht täuschte ich mich aber auch.
»Die Qual der Wahl«, sagte ich und zeigte auf ein Schild vor der Kreuzung.
Unter einem nach links deutenden Pfeil konnte man in verblichenen Buchstaben lesen: FRANKEN BRIDGE 7 MILES. Unter der geradeaus zeigenden Wegmarke prangte eine neuer wirkende Beschriftung: MEYERS MILLS 5 MILES – NEW ESSEN 8 MILES – FRANKEN BRIDGE 20 MILES. Die linke Abzweigung führte uns offenbar auf viel direkterem Wege nach Franken Bridge; der von Sheila vorgeschlagene Weg mündete dagegen in eine fast dreimal so lange Herbstrundfahrt im Abenddunst.
»Was gibt es da zu wählen?«, sagte Paula. »Geradeaus.«
»Nee, ich plädiere ganz klar für den kürzeren Weg«, sagte ich und machte ein paar unterstreichende Handbewegungen. »Ich meine, es wird spät und ich bin froh über jeden Kilometer ... nee, ich meine natürlich über jede Meile, die ich auf diesen Straßen nicht zurücklegen muss.«
Paula verzog das Gesicht. »Aber Sheila hat ausdrücklich geschrieben, dass wir nicht links abbiegen sollen – schau her: don’t turn left!! Mit zwei Ausrufezeichen. Und Justin war der gleichen Meinung.«
Den surfenden Sunnyboy zu erwähnen, war sicher das falscheste, was Paula in dieser Situation hätte tun können.
»Im Gegensatz zu diesem Wegweiser interessiert mich die Meinung von Justin einem feuchten Dreck«, sagte ich scharf. »Ich wiederhole noch mal: es wird langsam dunkel, das Wetter ist nicht wirklich einladend, und ich möchte jetzt endlich irgendwo ankommen, verstehst du? Außerdem haben wir ja das Handy.«
Ich tippte mit den Fingern auf mein Mobiltelefon, das in einem Ablagefach hinter dem Wahlhebel des Automatikgetriebes lag und verkündete, dass wir selbst hier immerhin einen Balken Netzempfang von T-Mobile USA hatten.
»Ich fände es trotzdem sicherer, wenn wir auf dem Weg blieben, den uns Sheila genannt hat, Felix«, sagte Paula mit einem unbehaglichen Blick nach draußen. »Das hat sie sicher nicht ohne Grund geschrieben.«
»Du kannst sie ja fragen, wenn wir da sind. In sieben Meilen!«
Ohne ein weiteres Wort oder Paula auch nur die Chance zu einer Erwiderung zu geben, schaltete ich die Automatik auf D für drive, gab Gas und brachte den Ford ruckartig auf die linke Spur der Weggabelung.
Letztlich war es dies nicht der beste Entschluss, den ich je gefasst habe. Selbst ohne das, was uns bevorstand, blieb er ziemlich unklug. Aber ich hatte es beschlossen, und nun musste ich dazu stehen. Doch schon nach einer Meile hörte ich diese garstige kleine Stimme in meinem Kopf, die mich andauernd frage, ob ich ein Grasdackel sei und warum ich mir ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hatte, um mal wieder meinen schwäbischen Dickkopf durchzusetzen.
Und leider hatte die Stimme Recht. Eine unverantwortliche Dummheit war es, jetzt hier lang zu fahren. Das wurde mir immer deutlicher, was ich jedoch niemals einem anderem gegenüber eingestanden hätte. In mir jedoch brodelte es. Das Außenthermometer auf dem Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser zeigte an, dass kuschelige fünf Grad dort draußen herrschten, außerdem kroch die Abenddämmerung weiter über den Himmel. Der Nebel schien wie eine Kette von verschieden starken Blutergüssen mal dicker und mal durchsichtiger zu werden. Ich stellte die Heizung des Wagens zwar ein wenig höher, doch mir wurde nicht wärmer, denn das Frösteln der Nervosität saß zu tief in meinen Knochen.
Zwei Meilen hinter der Weggabelung rumpelten wir durch ein kratergroßes Schlagloch, und ich musste noch mehr Geschwindigkeit wegnehmen. Immer öfters kamen wir auf dem matschigen Untergrund ins Schlingern, und ich hörte die Antriebsräder durchdrehen.
Dann geschah etwas, das mich bis heute entsetzt: Ich konnte zusehen, wie die Außentemperatur absank. Wir fuhren in diese blendend weiße Nebelbank, und das Display zeigte zuerst +5 Grad Celsius. Eine Sekunde später waren es nur noch +4 ... dann +2 ... und als die Dichte des Dunstes endlich wieder etwas nachließ, herrschten um uns minus vier Grad. Die Temperatur war innerhalb von 20 Sekunden und vielleicht 250 Meter Wegstrecke um neun Grad gesunken.
Einen Moment später blieb mein Herz dann buchstäblich stehen, als wir auf ein von Schnee bedecktes Plateau hinausrollten. Wir waren unvermittelt in ein Weltall aus weiß getaucht, in der es kein Oben und Unten zu geben schien. An irgendeinem Punkt waren Dunst und Schnee einfach miteinander verschmolzen. Ich hatte schon gelesen, dass ähnliche Wetterverhältnisse sogar für Flugzeugabstürze verantwortlich sein konnten, und in diesem Moment wusste ich, wieso. Nach ein paar Sekunden hatte ich völlig die Orientierung verloren.
»Großer Gott, Felix?!« Paula ächzte auf.
»Sag nichts, bitte sag jetzt nichts«, meinte ich und kniff die Augen zusammen, um irgendwie zu erkennen, wo die Straße entlang führte. Zu guter Letzt fand ich etwas, nach dem ich mich orientieren konnte: es war eine dunkle Fläche, die sich zuerst verschwommen und dann deutlicher jenseits des Nebels abzuzeichnen begann. Dieser Schatten entpuppte sich nach ein paar Sekunden als breiter Streifen aus einer seltsamen dunklen Substanz. Anfänglich dachte ich noch, es würde sich um Asche oder Ruß handeln, der auf dem makellos gleißenden Schnee verstreut worden war. Aber das war es nicht.
»Felix, was ist das?«, fragte Paula.
»Das siehst du doch – Schwarzer Schnee«, antwortete ich und betete immer inbrünstiger, dass wir nicht stecken blieben würden. Nicht nur, weil dieser von Ruß bedeckte Schnee der Inbegriff von allem Seltsamen zu sein schien und bei mir einen namenlosen Schrecken auslöste. Es gab noch diverse andere unmittelbare und viel weniger mystische Gründe: Auf dieser Straße kam realistisch gesehen nur alle Schaltjahre ein anderes Auto vorbei.
Und was noch schlimmer war: was, wenn ich tatsächlich in meiner Orientierungslosigkeit von der Straße abgekommen war, ohne es zu merken? Zumal auch das Handy keine Hilfe mehr sein würde, immerhin hatte es schon seit der vorletzten Nebelbank selbst den letzten Balken an Netzempfang eingebüßt. Dieses Detail hielt mir die Gefahr unserer momentanen Situation wohl am deutlichsten vor Augen.
Wenn wir jetzt stecken blieben, dachte ich, konnte man uns im nächsten Februar als Klempnermeister-und-Frau-am-Stiel ausbuddeln. (Ich gönnte mir diesen Galgenhumor in der Hoffnung, dass es sich um jene Art von Sarkasmus handeln würde, von der man anderen Menschen später erzählen konnte.)
Aber dann verlor ich schlagartig allen Mut. Ich gab zu viel Gas. Verdammt, es war nur ein Hauch, aber es genügte, um den Ford außer Kontrolle geraten zu lassen. Der Wagen glitschte zuerst seitwärts, wie durch Aquaplaning, dann gab es einen Ruck ... und nichts bewegte sich mehr. So hart oder so vorsichtig ich nun auch Gas gab, der Ford steckte fest.
Wir waren gestrandet. Und ich hatte Schuld daran.
Die folgende Stille hielt nur für ein paar Atemzüge, und mir war klar, dass sie enden würde und musste, sogar wie sie das tun würde: »O Gott, Felix!«, flüsterte Paula. »Sag, dass wir nicht feststecken ... bitte sag dass wir nicht feststecken!«
»Okay«, sagte ich. »Wir stecken nicht fest.«
»Und lüg mich nicht an!«
»Du wolltest es doch«, rief ich. »Denn wir stecken fest!«
»O Gott, Felix, du solltest es doch nicht ...«
Trotz der drohenden Gefährlichkeit unserer Situation fühlte ich den Drang, Paula ein bisschen zu würgen.
»Keine Panik, ja?!«, sagte ich, nachdem ich mich etwas beruhigt hatte. Dann löste ich meinen Gurt. »Ich schaue mir das mal an.«
»Na prima, jetzt fühle ich mich schon viel sicherer.«
Ich schluckte allen Zorn und Ärger herab wie eine Aspirintablette ohne Wasser und verließ dann das sichere und mollig warme Auto. Mit knirschenden Schritten ging ich um den Mietwagen herum. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem, was sich mir hier draußen bot. Es war keine Asche- oder Rußschicht, wie ich gedacht hatte. Der Schnee selbst war tatsächlich schwarz; schwer, pappig und pechschwarz. Ich verrieb ein wenig davon in meinen Fingern und erwartete einen passend finsteren Rückstand, doch das Schmelzwasser in meiner Hand hatte stattdessen eine seifige Konsistenz ... und war so rostrot wie angetrocknetes Blut.
»Das ist doch alles nicht wahr«, brummte ich.
Doch, das ist es, und zwar nur, weil du deinen verdammten schwäbischen Dickkopf durchsetzen und weder von deiner Frau noch von Justin, dem surfenden Veterinär-in-spe, einen Rat annehmen wolltest!, sagte eine zynische Stimme in meinem Kopf. Aber zumindest eins muss man dir lassen - wenn du dich und deine Frau in Schwierigkeiten bringst, dann aber richtig.
Das stimmte, obgleich ich immer noch hoffte, dass sich dieses Missgeschick rasch wieder einrenken lassen würde. Ich stapfte nochmals um den Wagen herum, fast als würde ich irgendeinen indianischen Beschwörungstanz aufführen, und ging vor dem Kühler in die Knie. Selbst im trüben, schwindenden Abendlicht sah ich, dass die Antriebsräder tatsächlich vom Weg und in eine Kuhle gerutscht waren. Das Heck des Autos befand sich aber noch auf der Trasse, das war zumindest eine halbwegs gute Nachricht. Uns trennten höchstens zwanzig Zentimeter von der Weiterfahrt.
»Paula?!«, rief ich. »Setz dich hinter das Lenkrad und lass den Motor an, okay? Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir brauchen nur ein wenig Schwung, dann greifen die Reifen wieder.«
Sie nickte. Gott sei Dank gab sie keine schnippische Antwort oder giftige Retourkutsche (obwohl sie angesichts der Tatsache, dass unsere Situation deutlich meine Schuld war, durchaus das Recht dazu gehabt hätte). Nein, sie glitt hinüber auf den Fahrersitz und startete den Motor, wobei die Scheinwerfer einen Moment flackerten. Dann legte sie den Rückwärtsgang ein, und ich stemmte mich mit aller Kraft gegen den Wagen, während Paula Gas gab. Wir erreichten jedoch nichts. Der Wagen war immer noch ungefähr zwanzig Zentimeter hinter der Vorderachse auf dem Erdwall aufgebockt. Nichts rührte sich, egal ob ich nun wie verrückt drückte oder stemmte oder auch versuchte, das Auto zum schaukeln zu bringen. Die verdammten Antriebsräder griffen nicht. Und hier draußen hatte es rein gar nichts, das ich benutzen konnte, um den Grund nur ein wenig zu stabilisieren, so dass die Räder nur für einen Augenblick Traktion bekamen. Ich spürte wachsende Panik in mir und wusste, dass ich mich erst beruhigen musste, bevor ich irgendeine vernünftige Lösung finden konnte. Tief durchatmen. Tief!
In dieser Sekunde hörte ich die Stimme.
Ich stieß vor Schreck einen Schrei aus und fuhr herum, wobei ich fast das Gleichgewicht verlor, aber ich blieb auf den Füßen. In den Lichtkegeln der Scheinwerfer sah ich drei Männer, die vielleicht zehn oder fünfzehn Meter entfernt aus dem Nebel aufgetaucht waren und nun langsam auf unseren gestrandeten Mietwagen zuschritten. Die Fremden trugen Lederhüte, lange Mäntel und schwere Stiefel von fast derselben Farbe wie der schwarze Schnee. Das einzige, was aus dieser sich bewegenden Finsternis wirklich herausstach, waren ihre fahlen Gesichter.
»Hey there?! Don’t be afraid, okay?! Looks like you’re stuck, doesn’t it!«, sagte einer der Männer. Er hatte eine ruhige, dunkle Stimme und klang lässig, jedoch nicht gefährlich.
»Ja, ähm, sorry.« Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, ein entschuldigendes Lächeln zustande zu bekommen, weil ich nicht in der Lage war, zu antworten. Was nun? Auf der einen Seite war das letzte, was ich wollte, dass Paula aus dem Wagen kam; aber andererseits war sie die einzige von uns, die fließend englisch sprach.
Sie stieg aus, blieb aber direkt neben der geöffneten Fahrertüre stehen, nur einen Hechtsprung vom Wagen entfernt, was mich ein wenig beruhigte. Den Gedanken, dass ein gestrandeter Mietwagen leider keine hundertprozentige Trutzburg gegen irgendwelche Angreifer war, verdrängten wir beide.
»Yeah«, antwortete Paula, und ich hörte keine Spur Nervosität in ihrer Stimme, was mich beeindruckte. Es war seltsam und traurig zugleich, dass mir erst in diesem Moment wieder bewusst wurde, was für eine tolle Frau sie doch war. »We’re on our way to Franken Bridge. Our friends there are surely totally worried what might have happened to us. We just got into this fog and seemed to have run off the road.«
»Franken Bridge, eh?« Der Fremde begann zu lächeln und tippte sich in einer seltsam altmodischen Geste gegen die Hutkrempe. »Can we help you get you car going again?«
Paula lächelte jetzt auch, allerdings eher unverbindlich. Sie sagte: »Well ... that would be really nice, but we don’t wanna bother you.«
»Don’t worry, we’re glad to help«, sagte der Fremde, der aus der Nähe noch viel größer und dunkler wirkte als aus der Entfernung. »Get in the car, li’l lady, and we’ll have you goin’ in no time.«
Die drei Männer stellten sich direkt vor den Wagen und hielten sich an der Schnauze des Ford Taurus fest, während Paula wieder in den Wagen stieg. Nickend gab der lächelnde Fremde ihr ein Zeichen, und sie trat aufs Gaspedal.
»One ... two ... three!«, rief einer der Neuankömmlinge, und dann legten sich die drei mächtig ins Zeug. Sie taten dasselbe, was ich vorher getan hatte, nämlich den Wagen zurück zu wuchten, jedoch mit erheblich mehr Kraft und Effizienz, als ich allein je hätte zustande bringen können. Nach wenigen Momenten griffen die Vorderräder bereits wieder, und Paula brachte den Wagen auf der verschneiten Trasse schlitternd zum stehen. Wir waren erlöst!
Unbändige Freude brandete in mir auf. Ja, ich war so froh, dass ich die drei Fremden in ihren schwarzen Mänteln und mit ihren seltsamen Lederhüten umarmen wollte ... zumindest bis zu jenem Moment, in dem ich erkannte, dass keiner der drei Fremden Schuhabdrücke auf dem schwarzen Schnee hinterlassen hatte.
Mir wurde schlagartig so schwindelig, dass ich fast zusammengeklappt wäre wie ein hilfloses Frauchen in einem Historienschinken. Mit äußerster Willenskraft hielt ich mich aufrecht, obwohl alles in mir herabzusinken schien, als hätten sich meine Organe schlagartig verflüssigt und würden nun durch einen Abfluss davon flutschen, einen Abfluss jener Art, wie ich sie in meiner Zeit als Klempner zehntausende von Malen eingebaut, gereinigt oder repariert haben musste. Nun hatte ich einen solchen Abfluss in mir.
Okay, ich täuschte mich. Ich konnte mich nur getäuscht haben, dort mussten Stiefelspuren sein. Aber auch der zweite, dritte und vierte Blick zeigten mir dieselbe Unmöglichkeit: keiner der drei Fremden hatte auch nur eine Schneeflocke verschoben, während sie aus der Nebelbank zu uns herüber gekommen waren. Und nun standen ... schwebten? ... sie direkt neben dem Ford und plauderten mit meiner Frau.
Von hier ab schien alles, was sich zutrug, einem seltsamen Fiebertraum entsprungen zu sein.
Ich legte meinen Arm um Paula (wobei ich mich nicht an meinen Weg zu ihr und dem Wagen erinnern konnte, immerhin war ich kurz zuvor noch einige Schritte entfernt gewesen), dann beugte ich mich vor und flüsterte ihr ins Ohr, dass sie sich bereit machen sollte, sofort zu verschwinden und unsere frei fremden Helfer einfach stehen zu lassen. Sie warf mir einen kurzen Blick zu, der besagte, dass sie mich entweder für komplett bescheuert hielt, oder dass diese Situation auch ihr Unbehagen bereitete und sie bereit war.
Zuerst plauderte sie noch freundlich mit den drei Fremden, die uns aus dieser Klemme geholfen hatten. Doch dann sagte der stets lächelnde Neuankömmling etwas, und ich spürte, wie sich alle Muskeln in Paulas Körper jäh anspannten.
»I ... I don’t understand«, sagte sie.
»You don’t have to«, sagte der Unbekannte. »We’re not going to rape you or anything, don’t worry. But we still need something from you. It’s just a little thing we’re asking for, and it will be all over in a second.«
Erfüllt von missionarischer Ernsthaftigkeit fügte er noch etwas hinzu. Dann kamen ... oder schwebten?! Es war unmöglich, dies auszumachen ... die drei abrupt und wie auf ein geheimes Kommando hin näher. Einer der Fremden stand plötzlich direkt neben der halb geöffneten Fahrertüre, obwohl er sich einen Augenblick zuvor noch am vorderen Kotflügel befunden hatte.
Ohne nachzudenken gab ich der Fahrertüre einen Tritt, so dass sie aufschwang und den Fremden an der Hüfte erwischte. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass die Türe so durch ihn hindurch gleiten würde wie unser Auto vorhin durch die Nebelbank, aber schon gab es einen dumpfen Schlag, und der Fremde wurde einen Meter zurückgeworfen. Sofort packte ich Paula, schubste sie in den Wagen und machte dann selbst einen Satz hinter ihr her, wobei ich derartig gegen das Wagendach rempelte, dass ich mir eine blutige Schramme an der runden kahlen Stelle auf meinem Kopf holte. Davon merkte ich in diesem Moment jedoch rein gar nichts. Panisch begann ich, nach dem Türgriff zu fingern, fand ihn, zog die Fahrertüre blindlings zu mir ... und spürte dumpfen Widerstand, als die Türe anstatt mit einem satten Klicken einzurasten gegen einen Fremdkörper stieß. Dieser Fremdkörper war der rechte Arm eines unserer Angreifer.
Bevor ich mich versah, wickelten sich die Finger des Fremden um meine Kehle, drückten mir die Luft ab. Seinerseits versuchte der Unbekannte nun, mich wieder aus dem Wagen zu ziehen, während ich irgendwie den Zündschlüssel erreichen wollte. Die Augen traten mir aus den Höhlen, und wie durch einen blutroten Dunst sah ich, dass sich vor dem Fahrerfenster das Innenraumlicht in der Klinge eines rostigen Beiles spiegelte. Es war diese Reflexion von Licht auf kaltem Stahl, die auch Paula endlich aus ihrer Schockstarre riss. Mit aller Kraft versuchte sie, mich von den Fingern um meine Kehle zu befreien.
»Fahr los!«, rief Paula. »Felix, du musst LOSFAHREN!«
Das Beil krachte mit einem schrecklichen dumpfen Geräusch gegen das Fenster der Fahrertüre. In diesem Moment bekam ich endlich den Zündschlüssel zu fassen und drehte ihn um. Der Motor des Ford Taurus erwachte zuerst zum Leben und heulte dann auf, als ich unbändig das Gaspedal durchtrat. Der Wagen machte einen Satz rückwärts, und der Würgegriff meines Angreifers lockerte sich schlagartig, ohne dass er mich jedoch völlig losließ. Geistesgegenwärtig bremste ich den Ford ab, bevor er auf der anderen Seite wieder von der Straße rutschen konnte, wechselte das Automatikgetriebe von R auf D und gab wieder kräftig Gas.
Erneut pochte die Axt gegen die Fahrertüre, und ich hörte das Schultergelenk des Fremden knirschen und knacken, als der Mann in Schwarz nun mit dem Auto mitgeschleift wurde. Doch er kämpfte immer noch mit einer gnadenlosen Intensität und Verbissenheit, die erschreckender war als der Angriff selbst. Die linke Hand am Lenkrad, um die Kontrolle des Wagens kämpfend, versuchte ich mit der rechten, mich von den sehnigen Fingern um meinen Hals zu befreien ... und hatte plötzlich, nach einem hellen, organischen Reißen, einen langen Fetzen seiner Haut in der Hand. Sie ließ sich abziehen wie die Pelle eines knusprig gebratenen Hähnchens und fühlte sich an wie brüchiges, dünnes Leder. Keinen Augenblick, nachdem ich sie von seinem Fleisch gezogen hatte, schien sie sich in Staub aufzulösen, und ich hörte einen gellenden und maßlos wütenden Schrei. Endlich ließ der Würgegriff um meine Kehle nach, und ich drückte den Ford in einen raschen Schlenker. Ruckartig verschwand der sehnige Arm, nachdem die Finger ein letztes Mal über mein Gesicht gepeitscht waren und dabei ein glitschiges Gefühl wie nach der Berührung von rohem Schweinefleisch hinterließen. Ich spürte noch, wie die Hinterräder des Wagens über irgendetwas Großes rumpelten und schrie auf, weil ich fürchtete, dass wir schon wieder von der Straße abgekommen waren. Doch diesmal blieben wir auf Kurs.
Für den Moment waren wir entkommen.
Wenig später warf sich die Nacht fast überfallartig auf uns. Die Scheinwerfer des Taurus fraßen nur winzige Häppchen aus der Dunkelheit heraus, es war, als schwächte irgendwas ihre Leistung ab. Selbst, als ich die Fernlichter einschaltete, brachten sie nur ein dünnes Glimmen hervor.
Ich zitterte. Nein, ich schlotterte. Bis jetzt hatte ich mich immer für einen auf- und abgeklärten Menschen gehalten, der sich in diesem unseren Universum auskannte wie in seiner Westentasche. Ich mochte keine Gruselfilme, und ich glaubte nicht an irgendwelchen übersinnlichen Firlefanz. Auch wenn ich das meiste nicht verstand (in Fächern wie Physik oder Chemie war ich stets eine Niete gewesen), so hielt es dennoch mit den Naturwissenschaften, weil diese für so gut wie alles eine rationelle Erklärung parat hatten. Doch dafür, was ich gesehen hatte, was hier geschehen war? Konnte es dafür eine normale und rationelle Erklärung geben?
Ja, das musste es, das musste es einfach! Aber ich wollte nicht darüber nachdenken ... und ich durfte jetzt nicht darüber nachdenken, während ich konzentriert der Straße folgte. Vom befestigten Weg abzukommen hätte sicherlich unter Ende bedeutet. Eine Erklärung finden konnte ich auch später noch, obwohl mich der innere Zwang, einen Sinn in diesem Irrsinn zu finden (hieß es nicht, dass man den Dämon nicht mehr fürchtete, wenn man ihm einen Namen gegeben hatte) immer wieder gefährlich unaufmerksam werden ließ.
»Er hat gesagt, er wolle Fleisch von uns«, sagte Paula. Ihre Stimme wurde immer hektischer und schrille. »Felix, er hat gesagt, er will Fleisch von uns als Gegenleistung dafür, dass er uns da heraus geholfen hat. Er will ein Stück von unserem Fleisch. Das sind Psychopathen!«
»Pschhhht!«, meinte ich, als spräche ich zu einem verängstigen oder verwirrten Kind. Jedes Wort fiel mir schwer, so sehr schmerzte meine Kehle noch. »Paula, es ist okay ... die sind weg. Wir haben es geschafft. Wir a-«
»Wo hast du uns nur hingebracht, Felix, wo?«, schrie sie mich an. »Wieso musstest du diese gottverdammte Abkürzung nehmen ... wieso nur, du Mistkerl? Die Warnung auf der Karte ... und das, was der Junge von der Tankstelle gesagt hast ... wieso wolltest du nicht hören? Warum?«
»Vier Meilen«, sagte ich, als wäre es eine Rechtfertigung. »Auf dem Schild hieß es, es wären nur verdammte vier Meilen bis Franken Bridge, wir müssen es also bald geschafft haben, Paula. Dann sind wir in Sicherheit, und ...«
Ich verstummte angesichts der nächsten Nebelbank, die uns verschluckte. Unwillkürlich nahm ich noch etwas mehr Gas weg, obwohl wir mangels Sicht nur noch dahin gekrochen waren. Paula begann auf dem Beifahrersitz zu schluchzen, beruhigte sich jedoch schon einen Moment später, als das erste Haus aus dem Dunst auftauchte, und keinen Atemzug später noch ein zweites.
»Ein Haus, Felix, sieh doch!«, rief sie. »Ein Dorf.«
»Ich hab’s gesehen, Paula!«, sagte ich.
»Könnte das Franken Bridge sein?«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, was ich sah, war mit Sicherheit nicht der erste Ausläufer von Franken Bridge oder irgendeiner anderen lebenden Ortschaft.
Wir fuhren mit etwa zehn Meilen pro Stunde durch ein totes Dort. Die Häuser auf beiden Seiten der Hauptstraße waren verlassen, still und zerfallen. Abenddunst ließ ihre Umrisse verschwimmen, wie von einer Kamera mit Weichzeichner aufgenommen, aber dennoch sah ich die vielen zerfledderten amerikanischen Flaggen an Holzmasten, die sich immer wieder träge im eisigen Präriewind aufbauschten. Dennoch war nichts an diesem einsamen Ort ein Opfer von Vandalen geworden, wie es in einer Großstadt sicherlich der Fall gewesen wäre. Alles war einfach verrottet und aufgegeben. Verendet. Das machte alles seltsamerweise noch schlimmer. Die völlige Abwesenheit menschlicher Existenz war verstörender als deren Schattenseiten.
»Wo sind wir hier?«, flüsterte Paula. »Was ist das für eine schreckliche Geisterstadt, und ... Felix, pass auf!«
Im selben Moment sah auch ich die etwa zwei Dutzend zerlumpter Gestalten auf der Straße stehen. Es waren Männer und Frauen aller Altersgruppen ... und Kinder. Mein Fuß drückte instinktiv das Bremspedal durch, obwohl mir mein Unterbewusstsein 'Halt nicht an!' befahl. Doch trotz aller Furcht und Bedenken übernahm in diesem Moment der Mensch die Kontrolle über mich und bekämpfte den primitiven Fluchtdrang. So kam der Wagen zwei Meter vor den Fremden zum stehen.
»Fahr weiter!«, zischte Paula. »Fahr sofort weiter! Das ist eine Falle.«
»Aber da sind Kinder, siehst du nicht?«, flüsterte ich und versuchte auf die Menschentraube vor uns zu deuten, konnte jedoch meine Hand nicht vom Lenkrad lösen.
Schließlich trat einer der Fremden aus der Gruppe. Es war ein älterer Mann mit grauem Haarkranz und wuchernden Augenbrauen, der sich uns mit langsamen, seltsam würdevollen Schritten näherte. Die Frontscheinwerfer des Leihwagens erhellten sein zerfurchtes Gesicht, das so blass war, dass es die Lichtstrahlen fast reflektierte. Er wirkte wie eine gealterte Ausgabe jener Gestalten, die uns erst zurück auf die Straße geschoben und dann überfallen hatten. Auch er trug einen langen schwarzen Ledermantel, ein schwarzes Hemd und dunkle Cordhosen, sowie einen breitkrempigen Hut, den ich mit den Bildern alter Wanderprediger verband. Damit wirkte er wie eine Gestalt aus dem vorigen Jahrhundert.
»Greetings, my dear strangers«, sagte er mit einer heiser raschelnden Stimme. Als er lächelte, spannte sich seine pergamentartige Haut über seinen Wangenknochen. Verblüffenderweise hatte er ein sanftes, einnehmendes Lächeln. «Welcome to the village of White River Bends on the Grounds of the Black Snow. We don’t have too many visitors these days, and we are very happy to see you.«
Ich nickte, war wie gelähmt. Immer mehr Menschen in Lumpenkleidung kamen derweil aus den Schatten zwischen den Hausruinen und versammelten sich um unseren Wagen, kreisten ihn ein.
»I am reverend Clay Sneva«, sagte der alte Mann. Sein Tonfall war zugleich rau und gutmütig. »Allow me a question: D’you want to continue going over our roads to leave the ground again?«
»Was sagt er?«, flüsterte ich.
»Er fragt uns, ob wir diese Straße noch weiter benutzen wollen, um die Gegend wieder zu verlassen«, übersetzte Paula in verzweifeltem Flüsterton. Sie keuchte bei jedem Atemzug.
Ich nickte dem alten Mann erneut zu. Warum sollte ich lügen. Etwas in mir wusste, dass dies zwecklos sein würde.
Der alte Mann öffnete den Mund, und Paula wurde wieder zu seinem Sprachrohr: »Er sagt: Dann muss ich sie leider um etwas bitten ... Es für die Einwohner dieses Grundes von großer Wichtigkeit, von den Reisenden, die das Gebiet durchqueren, einen gewissen Preis zu verlangen. Wir finden, dass das fair ist. Allerdings wollen wir kein Geld ... das ist etwas, das uns hier schon lange nichts mehr nützt. Wir brauchen etwas, ohne das wir nicht Überleben können. Wir brauchen ...« Ich hörte Paula ächzen. »Blutzoll?! Felix, er hat wirklich Blutzoll gesagt ... o Jesus ... Jeeeeeesus ...«
Der alte Mann begann zu lächeln. Die hatten unseren Wagen nun völlig umringt. Einige starrten mit ausdruckslosen Gesichtern zu uns herab, andere stellten eine ungeduldige, wieder andere eine beinahe mitleidige Miene zur Schau. Dies jagte mir den größten Schrecken ein, denn bei aller Anteilnahme lag auch eine völlige und atemberaubende Konsequenz in diesem Blick, die besagte, dass alles bereits feststand und es keine andere Möglichkeit gab, egal wie traurig all dies auch war.
»Er sagt, dass wir keine Chance, zu entkommen ... aber er verspricht ... nein, er schwört bei Gott ... dass sie uns gehen lassen, wenn alles vorbei ist«, übersetzte Paula weiter, ihre Stimme kaum mehr als ein Wimmern. »Er sagt, dass nur dieser ... dieser Blutzoll, mit dem der Boden benetzt werden muss, diese Menschen und ihr Dorf beschützt.«
Sie unterbrach sich für ein leises, würgendes Ächzen, dann fuhr sie fort: »Man will uns nichts böses, aber keiner der Bewohner der Grounds of the Black Snow möchte ... möchte ... verdammt, ich verstehe dieses Wort nicht ... ich glaube, er sagt soviel wie ‚in den Schlund fallen’. Was bedeutet das?«
Der alte Mann erklärte es nicht. Stattdessen verstummte er und verschränkte abwartend die Arme.
»Fahr los!«, fauchte Paula. »Fahr los, um alles in der Welt, Felix ... JETZT FAHR ENDLICH LOS, DU IDIOT!«
Mein Fuß senkte sich tatsächlich über das Gaspedal, und für einen Moment war ich auch bereit es zu tun. Aber dann sah ich, dass direkt vor dem Wagen eine Frau mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm stand. Wenn ich jetzt beschleunigt hätte, so hätte ich diese beiden als erste überfahren. Das verblüffend hübsche Mädchen mochte sechs Jahre alt gewesen sein, hatte schulterlanges, strähniges Haar und musterte mich aus den traurigsten und zugleich hungrigsten Augen, die ich je gesehen hatte. Diese Augen ließen mich nicht mehr los. So lange ich konnte, erwiderte ich ihren Blick, als könne ich dadurch die Geschichte hinter dieser Trauer und diesem Hunger erfahren. Das wunderschöne kleine Mädchen sah mich jedoch einfach nur unverwandt an, ohne Argwohn und Aggressivität, aber mit derselben Härte und Konsequenz wie ihre Mutter. Ich ertrug diese Miene nicht lange.
»Fahr zu!«, schrie Paula erneut, sie klang so rau und schrill vor Angst, dass ich die Stimme meiner Frau kaum erkannte. »Das sind alles Irre ... Felix ... die wollen uns verstümmeln oder umbringen oder beides ... Felix wir müssen hier weg! WEG!«
Ich wusste, dass sie Recht hatte, und, bei Gott, ich versuchte es. Aber ich war nicht in der Lage, den Wagen von der Stelle zu bewegen. Ich konnte keine Kinder überfahren, egal, ob man sie nun aus genau diesem Grund vor unserem Wagen postiert hatte oder nicht. Ich stieß gegen eine unüberwindliche Hemmschwelle in meinem Kopf.
Ein Mann, der in vorderster Reihe stand, ging zwei Schritte vorwärts und stand nun direkt neben meiner Tür. Er trug eine dunkle Uniform, die mich an amerikanische Historienschinken wie Vom Winde verweht oder Fackeln im Sturm erinnerte. Die Abzeichen auf seinen Schulterklappen wiesen ihn als hochrangigen Offizier aus. In der rechten Hand trug er etwas, was wie eine große Knochenschere aussah.
Der Uniformierte öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber im selben Moment rutschte Paula zu mir herüber und stemmte ihren linken Fuß mit aller Kraft auf das Gaspedal. Der Ford heulte erneut auf und beschleunigte genau auf das Mädchen und seine Mutter zu. Ich riss das Lenkrad herum, und eine ältere Frau, die ganz vorne gestanden hatte, wurde von der Stoßstange erfasst und zur Seite gefegt. Der Wagen machte bei der Karambolage einen Satz.
»Paula!«, rief ich. »Verdammt, was MACHST du ...?«
Mit einem lauten, blechernen Krach landete ein Körper auf der Motorhaube. Es war ein Junge, achtzehn oder neunzehn Jahre alt, nicht mehr. Er hob seinen Kopf und starrte mich an, während er sich an den Scheibenwischern festklammerte. Ich ächzte auf. Die linke Gesichtshälfte des Jungen war vom Aufprall förmlich zerschmettert worden, die rechte verzog sich zu einer wütenden Fratze, und es war dieser Anblick, der sich genau so in meinen Verstand einbrannte, wie sich die Umrisse von Bilderrahmen an der Tapete verewigten, wenn man sie nach Jahren von der Wand nahm: ein schmutziges, körniges Negativ.
Jäh stellte sich der Ford unter Paulas unerbittlichem Gasgeben auf der vereisten Hauptstraße dieses seltsamen, vergessenen Ortes quer. Als ich eine Häuserfront halb seitlich und halb von vorne auf uns zurasen sah, konnte ich nur noch mein Gesicht mit den Händen schützen und auf den Einschlag warten. Ich erinnere mich noch an einen RUCK! ... und an eine Explosion von Licht und Schmerz ...
Dann war da dieses Meer von Händen. Wir werden gepackt, aus dem Wagen gezerrt und fortgeschleppt. Ich erinnere mich an Paula, die unablässig sinnlose Hilferufe schreit. Zwar versuche ich halbherzig, mich zu befreien, doch ich bin durch den Unfall groggy, und die Umklammerung, in der man mich hielt, ist viel zu stark. Ich weiß noch, wie vermodert, wie verwest und dunkel die Menschen um mich herum riechen, nicht anders als die Häuser, aus denen dieser Ort besteht. Mitleidlos schauen Menschen und Häuser zu, während man meiner Frau die Haut und das Fleisch an den Armen aufschlitzt, bis ihr Blut auf den Boden quillt. Dort versickert es so schnell in der pulsierende Erde, als würde der Grund das Blut gierig in sich aufsaugen. Bei diesem grotesken Anblick beginne ich erneut zu brüllen und toben, doch es ist zwecklos. Ich habe keine Chance gegen den Mob, der mich gefangen hält. Jäh erstirbt nun auch Paulas Wehklagen, und man trägt meine Frau weg.
Hinterher kauere ich auf jenen massiven Holztisch, auf dem Moment zuvor noch meine Frau gelegen hat. Ich zucke und winde mich wie ein Wurm unter dem gnadenlosen Griff meiner Peiniger, als man den Knochenschneider an meine Hand setzt. Jemand drückt meinen Kopf nach vorne, als ich mich abwenden will, und ein anderer (ich glaube, es ist der Reverend) hält mir erbarmungslos die Augenlider offen. So muss ich zusehen, wie die Klingen zunächst eher zaghaft meine Haut zu zertrennen versuchen. Erst, als der uniformierte Mann den Druck auf die Zangengriffe des Werkzeugs verstärkt, trennen sie meinen Daumen mit einem dumpfen Schnipp! schließlich sauber ab. Der Schmerz ist glühend, zermalmend, nicht vorstellbar, aber noch schlimmer sogar ist die Gewissheit, dass es meine Schuld ist, warum wir hier sind und dies nun durchleiden. Meine Schuld, sonst nichts.
Dies war ist letzte Gedanke, bevor mich der Schmerz in einen Abgrund der Bewusstlosigkeit stürzt.
Und danach? Ich kann sagen, dass die Bewohner der Grounds of the Black Snow tatsächlich ihr Wort hielten.
Als ich wieder zu mir kam, saßen Paula und ich in unserem Leihwagen. Der Ford stand auf einem einsamen Plateau abseits der Straße, wie ich im trüben Morgenlicht erkennen konnte. Vor ein paar Jahren (noch etwas schlanker und aktiver), hatte ich einmal im Mittelmeer einen Tauchkurs besucht, und das milchige Licht am Horizont erinnerte mich mehr als nur ein wenig an die einsame Dämmerstimmung, die unter Wasser herrscht, wenn man sich nur tief genug hinab begibt.