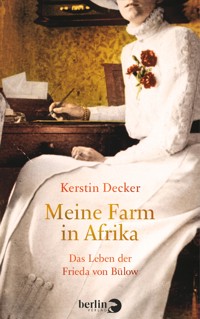13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Elisabeth und Friedrich Nietzsche. Ihr frühes Bündnis gegen die Zumutungen des Daseins schien unkündbar zu sein. Sie gab sich keine Mühe, einen Mann zu finden. Er gab sich keine Mühe, eine Frau zu finden. Bis doch eine zwischen sie trat, Elisabeth ihren Bruder verstieß und Friedrich Nietzsche die eigene Schwester zu seiner Fernsten erklärte. Zur Strafe heiratet sie: einen Antisemiten. Schlimmster Affront gegen den Anti-Antisemiten Nietzsche. »Du entkommst mir nicht!«, weiß Elisabeth, nachdem ihr Bruder in Turin verhaltensauffällig wird: Er hatte ein geprügeltes Droschkenpferd umarmt. Aber sein Ruhm wächst. Friedrich Nietzsche gilt noch immer als der beliebteste, meistgelesene und meistzitierte Philosoph weltweit. Dass erhalten ist, was er schrieb, ist nicht zuletzt ihr Verdienst. Drei Mal wird sie für den Nobel-Preis vorgeschlagen, gar zur »ersten Frau Europas« erklärt. Friedrich Nietzsche hat seiner kleinen Schwester vieles zugetraut, aber auf den Gedanken, dass sie einmal seine Wirkungsgeschichte mitbestimmen würde, wäre er nie gekommen. In aller Beiläufigkeit widerlegt sie sein Frauenbild.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
ISBN 978-3-8270-7906-0
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2016
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: ullstein bild und Time Life Pictures/getty images
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorweg
Dionysos 1943
1 »Fritz ist anders geworden …«
Allein in Tautenburg (Elisabeth)
Allein in Naumburg (Friedrich)
Franziska
Sich anlehnen dürfen
Das Kind heiratet
Die Getäuschte
»Du bist eine Schande für das Grab deines Vaters!«
Das Schweigen des Philosophen
Waldweben
»Also begann Zarathustras Untergang«
Fliegenpilze suchen
Ingwer mit Zwieback
Die Geburtstagstorte
November I (Friedrich)
Die erste Erinnerung oder Ankunft in Naumburg
November II (Elisabeth)
Santa Marguerita Ligure, poste restante
2 Wie heiratet man einen Antisemiten?
Ein Gehirn mit einem Ansatz von Seele
»Entweder er heirathet sie, oder er erschießt sich …«
Advent
Der entlassene Bittsteller
Edmund Kantorowicz, Straßenbahnfahrer
»Himmel! Was bin ich einsam!« oder Der Heilige Abend des Übermenschen
»Wo ist Fritz?«
Sanctus Januarius, der Zweite
Wagner ist tot oder Elisabeth in Bayreuth
Die Einladung
Noch einmal Frühling in Rom
Das gestrichene Kapitel
Du gehst zu Frauen?
Sils Maria, Sommerwinter 1883
Der Zorn des Zarathustra
Mitleidige und Tugendhafte
Die Liebende, abermals
»Sie muß fort nach Paraguay«
Von der Lust, irgendjemandem ins Gesicht zu spucken
3 Im Lamaland
Auf die Schiffe, ihr Philosophen!
Milchvieh und ein Pferd für Nietzsche
Der Försterhof bei Försterrode
Der Kaiser ist tot. Es lebe der Kaiser!
Apostel-Kritik
Der Abschiedsbrief
Schlechte Nachrichten
Chloral oder Dr. Försters Ende
Die Pfütze
4 Überlieschen oder Die Rückkehr der Dschungelfrau
Eli Förster in Berlin
»Der Wald steht leer …«
Der Wille zur Macht. Erster Versuch
»Heil dir, Schiff!«
Der »Lastwagenstil« des Heinrich Köselitz oder Die Suspendierung eines Herausgebers
Überlieschen
Der 50. Geburtstag
Das entsetzliche Bild
Erfolgsautorin Elisabeth
Würdiger verbrauchen!
Die Unterschrift
Dr. Rudolf Steiner
Vorlesungen für eine Einzelhörerin
Die Katastrophe
»Der Fall Elisabeth«
Franziskas letzte Weihnachten
Vorsätze am Meer
»Droben ist ein wahnsinniger Philosoph eingezogen!«
5 Das neue Weimar
Der erste Gast und ein Abschiedsbrief
»The Eagle and the Serpent. A Journal of Egoistic Philosophy and Sociology«
Ich, ein Kriecher?
28 Seiten an Heinrich Köselitz
»… also wirken sie die Strümpfe des Geistes«
Wir Philologen!
Zarathustras Ende
»Mein Programm für das Großherzogthum Weimar«
Die Marketingdirektorin oder Von der Schöpfung eines Hauptwerks
Die Berufung
Zurück in Tautenburg
Potenz und Impotenz oder Rapallo im Dezember
»Man and Superman«
6 Ernest Thiel oder Auftritt des Retters
Der Besuch
»Friedrich Nietzsche, von einer Köchin beschrieben«
Das Jahrhundert des Kindes
Die Köchin schlägt zurück
Herwarth Walden oder Elisabeth und die Avantgarde
»Sie müssen jetzt die Verwalterin des ganzen Weimarischen Erbes werden …«
Das Nietzsche-Archiv, seine Freunde und Feinde
Nobelpreisträgerin Elisabeth?
Vier Anwälte. Sechs Prozesse
Die Verachtung der Vierfüßler oder Gast geht
Nietzsches (und Elisabeths) Briefe an Mutter und Schwester
Das lebendige Denkmal
Das Schweigen des Grafen
7 »The Euro-Nietzschean War« 1914–1918
Ein heroisch gestimmter Igel
Die Bibliothek von Löwen
Auf dem Schlachtfeld von Metz
Philosophischer Zwischenruf
Der Nobelpreis für Elisabeth. Zweiter Versuch
Vom Geist der Nation
»Wir sollten Belgien behalten!« Das Kriegsjahr 1916
Goethe als Vorbild
Kann ein Jude »das Tiefste bei Nietzsche verstehen?«
»An deutschen Gedanken wird die Welt erkranken«
8 Il superuomo Elisabeth und Mussolini
Horaz und der Bezirksverein oder Parlamentarischer Tee im Nietzsche-Archiv
Die Belehrung des Grafen
Die Bonbonniere
Die Stunde der Bibliothekare oder Frau Doktor h. c. Elisabeth Nietzsche
Blut und Geld
Japaner in Weimar oder Die blonde Bestie
Il superuomo
Besuch aus Bayreuth. Oswald Spengler hält einen Vortrag
9 Nietzsches Spazierstock
Das Lama in der großen Politik
Der 85. Geburtstag
Campo di Maggio
Tristan 1933
Karl Schlechta sieht den Führer und schreibt einen Bericht
Ein letztes Buch. Letzte Besuche. Letzte Briefe
Was kommt
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Zeittafel
Literatur und Quellen
Bildnachweis
Guide
Vorweg
Niemand hat sich an dem Andenken Nietzsches schwerer vergangen als seine Schwester. Wer sich für die Schwester entscheidet, entscheidet sich gegen Nietzsche.
Karl Schlechta, Der Fall Nietzsche
Die Schwester ist schuld!
Wie konnten Abertausende deutsche Soldaten mit dem Zarathustra im Gepäck in den Ersten Weltkrieg ziehen?
Die Schwester ist schuld!
Wie war es möglich, dass den Nationalsozialisten Nietzsches Bücher nicht nach dem dritten Satz aus der Hand fielen?
Die Schwester ist schuld!
Wer gab ein Werk heraus, das Nietzsche gar nicht geschrieben hatte?
Die Schwester ist schuld!
Alle Fehlleistungen der Nietzsche-Leser?
Die Schwester ist schuld.
Hätte Friedrich Nietzsche nicht seine Schwester gehabt, er wäre für seine Bücher am Ende selbst verantwortlich. Der Hinweis auf die Schwester ist längst zum großen Freispruch des Philosophen von seinen Missverständlichkeiten und seinen Unmissverständlichkeiten geworden. Elisabeth Förster-Nietzsche, mehr ein Gerücht als ein Mensch, gehört zu den Personen, über die man schon alles zu wissen meint, bevor man überhaupt etwas über sie weiß.
Die Schwester ist schuld.
Aber woran genau?
Welch hartes Los, ausgerechnet mit mir verwandt zu sein!, hatte Friedrich Nietzsche seiner Mutter und Elisabeth immer wieder versichert. Im letzten Herbst seiner bewussten Existenz kehrte er den Befund um: … mit solcher Canaillemich verwandt zu glauben, wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit.1
Der Philosoph lässt sich gehen. Und es kann nicht ganz verfehlt sein, hier von einem Sinneswandel zu sprechen.
Elisabeth lädt die schwerstmögliche Schuld im Nietzsche-Universum auf sich: Auch sie hat zuletzt nicht mehr an ihren Bruder geglaubt. Nicht einmal mehr sie?
Aber wer dann?
Denken wir es, prüfen wir es neu:
Friedrich und Elisabeth Nietzsche. Sie waren sich näher, als Geschwister es gewöhnlich sind. Ihr frühes Bündnis gegen die Zumutungen des Daseins, insbesondere gegen die Misslichkeiten dessen, was die Erwachsenen Erziehung nennen, schien unkündbar zu sein. Er war ihr Schutz, Vaterersatz, Mittelpunkt der Welt, Maß aller Dinge.
Sie gibt sich keine Mühe, einen Mann zu finden. Er gibt sich keine Mühe, eine Frau zu finden. Bis doch eine zwischen sie tritt, Elisabeth ihren Bruder verstößt und Friedrich Nietzsche die eigene Schwester zu seiner Fernsten erklärt. Zur Strafe heiratet sie und verwirklicht seinen Traum von einer Kolonie in Amerika: ohne ihn.
Du entkommst mir nicht!, weiß Elisabeth, nachdem ihr Bruder in Turin verhaltensauffällig wird: Er umarmt ein geprügeltes Droschkenpferd. Aber sein Ruhm wächst. Die Leute lesen offenbar lieber die Bücher eines verrückten Philosophen als die eines gesunden, bemerkt die Schwester, nimmt ihren kranken Bruder als Geisel und editiert seine Werke. Mit kleinen Korrekturen.
Sie gehören zusammen.
Elisabeth Förster-Nietzsche stellt ihren alten Bund wieder her, Puristen werden einmal von Fälschung sprechen.
Zum ersten Mal wird die intime Geschwisterbeziehung so dargestellt, dass der Leser sie mit- und nachvollziehen kann. Das ist wichtig, aus zwei Gründen. Der von Nietzsche genährte populäre Glaube, die Schwester habe sein Verhältnis zu Lou von Salomé zerstört, gilt noch immer als latent wahrheitsfähig. Zum anderen aber werden die brüderlichen Elisabeth-Schmähungen sofort als Waffe gegen sie eingesetzt. Bereits ihr erster Archiv-Mitarbeiter notiert die Stellen, auf die er mit Verblüffung stößt, in »Geheimexzerpten«. Und droht, sie zu veröffentlichen. Sie werden weitergereicht.
Scheinbar unvermittelte Übergänge von der allerpersönlichsten Sphäre der Mitwirkenden ins beinahe Welthistorische mögen unser Gefühl befremden, entsprechen jedoch der Dynamik der Tatsachen.
Friedrich Nietzsche hat seiner Schwester vieles zugetraut, aber auf den Gedanken, dass sie einmal seine Wirkungsgeschichte mitbestimmen könnte, wäre er nie gekommen. In aller Beiläufigkeit widerlegt sie sein Frauenbild.
Können Frauen denken? Noch glaubt das fast keiner, aber die Absolventin einer Mädchenschule sammelt ungerührt einen ganzen Stab von Philosophen und Philologen unter ihrem Oberbefehl. Welche Demütigung.
Um 1900 wird das Weimarer Nietzsche-Archiv zum Treffpunkt der freien Geister Europas. Mit 89 Jahren wird Elisabeth Adolf Hitler den Spazierstock ihres Bruders schenken, aber zuvor steht sie am Beginn der Moderne in Weimar. Drei Mal wird sie für den Nobelpreis vorgeschlagen, gar zur »ersten Frau Europas« erklärt.
Wer war Elisabeth Förster-Nietzsche?
Dionysos 1943
Das Telefon klingelt zu oft im Weimarer Nietzsche-Archiv, auf einer Anhöhe über der Stadt gelegen, mit freiem Blick nach unten. Freier Blick nach unten: Das ist die Nietzsche-Perspektive, auch in Thüringen.
Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin.2
Der Höhenvermesser ist zu diesem Zeitpunkt seit 43 Jahren tot, seine Schwester weilt seit acht Jahren nicht mehr unter den Lebenden.
Denkende Menschen verabscheuen Fernsprechapparate, sie zerreißen jeden Gedanken, falls einer sich sehen lässt, aber der Bahnhof ist schuldlos, er ruft eher selten an. Und der Vorsteher der Güterabfertigung schon gar nicht, aber jetzt ist er dran: Da sei etwas ungemein Großes, ungemein Schweres angekommen, ein griechischer Gott laut Transportschein, Dionysos mit Namen, keine Ahnung, wer das ist, Absender: Mussolini. Adressat: Nietzsche-Archiv Weimar. Also Sie! Was um Himmels willen solle er mit diesem Dionysos machen?
Stehenlassen oder ausladen?
Max Oehler ist alarmiert. Der Langerwartete, er ist also da. Dionysos, der Bürge der Philosophie seines am Ende verrückten Vetters. Der antike Gott des Rausches, des Todes und der Wiedergeburt, der Zerstörung und des Werdens.
Elisabeth hatte Oehler einst mit dem Titel mein Lieblingsneffe versehen, dabei war er ihr Cousin, doch so viel jünger, und kann man Cousins adoptieren? Sie hätte es gern getan, auch trüge ihr Nachfolger jetzt den viel passenderen Namen Max Nietzsche statt Max Oehler. Dem Bahnbeamten ist es egal, ob Max Nietzsche oder Max Oehler den Gott abholt, Hauptsache er macht es gleich. Dionysos, dessen Anblick kein Sterblicher standhielte, wäre er nicht gebannt: im Kunstwerk, im Bildwerk. Und dessen Bürge wiederum Apoll ist, der Gegengott.
Aber was heißt Gegengott? Es gibt nur noch einen, und das ist der Krieg. Ein dionysischer Todesrausch. Die Sirenen heulen über Weimar. Oehler hört es vorm Haus, hört es im Fernsprecher. Der nächste Luftangriff beginnt.
Die Stimme des Vorstehers des Güterbahnhofs wird dringlicher: Was also solle er mit Dionysos machen? Wenn er überhaupt noch etwas machen könne, denn: sie bombardieren den Bahnhof!
Max Oehler, Major a. D., ist es gewohnt, Befehle zu geben. Oder vielmehr: er war es gewohnt. Das ist lange her, denn mit seiner Qualifikation ließ sich seit 1918 vorerst nichts mehr anfangen. Und schon zuvor hatte er gefühlt, dass das Militär vor allem eins ist: eine äußerste Geistesverlassenheit. Natürlich machen einem solche Wahrnehmungen den Dienst in einer Armee nicht leichter, wie auch immer, etwas in ihm erinnerte sich der alten Tonlage, in der man Befehle erteilt, und er bellte in den Hörer: Ausladen!
Ein Befehl ist nur dann ein Befehl, wenn die in ihm liegende Drohung die aller sonst noch existierenden Drohungen übertrifft, in diesem Fall die der Bomben.
Und nun? Bedeutet das nicht, dass jetzt er im Bombenhagel den Gott bergen muss? »Danach blieb mir nichts übrig, als durch die leeren Straßen zum Güterbahnhof zu eilen, während englische Weihnachtsbäume in bezaubernder Schönheit am Himmel brannten. Trotzdem schleppte eine Zugmaschine den Gott auf den Bahnhofsvorplatz.«3
Ab hier musste er den Schwerlaster führen. Der deutsche Oberbefehlshaber in Italien Generalfeldmarschall Kesselring hatte persönlich die Schutzherrschaft über Dionysos’ Abreise übernommen, seine Ankunft nun lag allein bei ihm, Max Oehler, Mitglied der NSDAP seit 1931. Ob er sich manchmal fragt, wie tief Nietzsche ihn und seine Partei verachtet hätte?
Sie scheinen ganz allein auf der Welt, der Nationalsozialist und der Gott, dessen riesiges Marmorhaupt neben ihm ruht. Sie fahren durch den Sprengbombenhagel auf Weimar. Was Max Oehler über sich sieht, ist Schönheit, dionysische Schönheit, ist Untergang.
»Brüder, hinterm Sternenzelt muss ein gütiger Vater wohnen«, hatte mal ein anderer Sohn dieser Stadt gedichtet. Aber das ist lange her. Was wusste Schiller von Dionysos und von diesem Krieg?
Mag sein, es geht Max Oehler wie den uranfänglichen Menschen, die sich unter den Schutz der Götter stellten, die sie schufen. Aber darf er auf solchen Beistand hoffen, ausgerechnet vom Gott des Rausches, der Raserei, der Lust, des Krieges?
Unversehrt erreichen Mensch und Statue die Villa des Archivs. Dahinter erhebt sich dunkel und unvollendet die Weihestätte, die Adolf Hitler dem Philosophen errichten lässt, den er für den Vordenker des Nationalsozialismus hält. Über ihrem Portal steht: FRIEDR. NIETZSCHE ZUM GEDÄCHTNIS ERBAUT UNTER ADOLF HITLER IM VI. JAHRE DES DRITTEN REICHES. Am 15. Oktober 1944 muss alles fertig sein. Mit Mussolinis Dionysos in der Apsis. Am 15. Oktober 1944 würde die Welt den 100. Geburtstag Friedrich Nietzsches feiern. Die Welt?
Und dann, etwas später, bemächtigt sich Max Oehlers eine stille Verzweiflung: Der Gott hatte ihn, hatte sie beide gerettet, aber: Er passt nicht in die Apsis. Dionysos geht durch die Decke.
Die Gedenkhalle ist zu klein für den Gott.
1
»Fritz ist anders geworden …«
Allein in Tautenburg (Elisabeth)
Es ist unmöglich, aber wahr: Ihr Bruder liebt eine andere. Bis eben war sie die einzige Frau in seinem Leben, und nun? Sie hätte das nie geglaubt, er ist nie von einem weiblichen Wesen nur halb so begeistert gewesen4, doch es ist geschehen.
Das ist Verrat.
Wann gab es ein Band zwischen Bruder und Schwester, so eng, so unauflöslich wie das ihre? Der unbedingte Beistandspakt zwischen ihnen, nie unterzeichnet und doch gültig von Ewigkeit zu Ewigkeit, er hat ihn gebrochen. Wegen einer Frau. Aber was heißt Frau? Wegen dieses Kuriosums von einem Weibe: Dieselbe Größe wie ihre Mutter, dieselbe unmöglich dünne Taille, derselbe hochgewölbte Busen (so daß man beim Anblick dieses Oberkörpers immer im Zweifel war, ob der obere oder der untere Theil der unnatürlichste sei) … Und das ist erst der Anfang von Elisabeths Lou-Porträt5.
Dass Fritz einmal so werden konnte, wie er in diesem Sommer war, so – wie soll sie das nur sagen? – eben so wie seine Bücher. Ja, das ist wohl der erschütterndste Befund dieses August 1882, und sie sieht sich außerstande, es noch länger vor sich zu verbergen: Fritz ist anders geworden er i s t so wie seine Bücher.6 Für alle, die in diesem Satz etwas vermissen, sei es gleich gesagt: Elisabeth Nietzsche setzt Kommas nur äußerst sparsam, eher gar nicht. Satzzeichen, weiß sie, sind Prothesen für Minderbegabte, die sich allein mit ihrer natürlichen Intelligenz in einem Text nicht zurechtfinden.
Die Schwester des Philosophen harrt weltverloren allein in einem thüringischen Kleinstort aus, und zwar so: Ich bin halbe Tagelang einsam in den dichtesten Wäldern herumgeirrt7. Es ist Ende August, fast alle Badegäste sind schon weg, auch ihr Bruder und das Mädchen, dem seine Teilnahme gilt. Drei Wochen lang war sie das dritte Rad am Wagen gewesen, aber nein, das ist ungenau: Dieser Wagen hatte von Anfang an nur zwei Räder, das Friedrich- und das Lou-Rad, sie waren Gleichrollende, 20 Tage lang.
Im anderen bei sich selber sein. Ein Meisterdenker, den ihr Bruder gern verspottet, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hat so einmal die Liebe definiert, so schön und trotzdem wahr. Für sie, Elisabeth, blieb bei dieser Seinsweise kein Platz, und wenn die beiden mit ihr sprachen, dann nur, um sich über sie lustig zu machen. So schien es ihr.
Wann hätte Friedrich jemals mit seiner Schwester geredet wie mit dieser 21-Jährigen, so als sei jedes Wort aus ihrem Munde eine Offenbarung?
Wir Neuen, Namenlosen, Schlechtverständlichen, wir Frühgeburten einer noch unbewiesenen Zukunft!8, wird er bald sagen. Vorbereitende Menschen nennt er den Lou-Typus, den Friedrich-Typus in seinem neuen Buch: Menschen mit eigenen Festen, eigenen Werktagen, eigenen Trauerzeiten … gefährdetere, fruchtbarere Menschen, glücklichere Menschen! Denn, glaubt es mir! – das Geheimniss, um die grösste Fruchtbarkeit und den grössten Genuss vom Dasein einzuernten, heisst: GEFÄHRLICH LEBEN! Baut Eure Städte an den Vesuv! Schickt Eure Schiffe in unerforschte Meere!9
Vielleicht ist es nicht falsch, vom Tautenburger Spätsommer 1882 nur für einen Augenblick nach Italien hinüberzuschauen. Denn in dem kleinen Ort Predappio, auf der Höhe Riminis landeinwärts gelegen, steht die Zeugung eines künftigen Nietzsche-Lesers unmittelbar bevor. Er wird das »Gefährlich leben!« zu seinem Wahlspruch machen, ja, man kann sagen, Friedrich Nietzsche wird diesen Mann erst schaffen, denn die Lektüre seiner Schriften bringt den jungen Sozialisten schließlich vom Sozialismus ab und auf seinen ureigenen Weg. Sein Name ist Benito Mussolini.10
Nur verwechselt mich nicht!, bittet Friedrich Nietzsche immer wieder, vergebens. Schon seiner eigenen Schwester scheint er plötzlich wie ein Fremder. Sie kennt ihn wie niemand sonst, und erkennt ihn doch nicht wieder.
Sie, die treue Gefährtin seines Lebens, rechnet er selbstredend nicht zu den maritimen Vesuvbewohnern. Eigentlich mag ihr Bruder gar keine Frauen, er hält sie für ein zu defizitäres Geschlecht. Aber für diese junge Russin machte er eine Ausnahme. Sie sei die Einzige, sagt er, die seine Philosophie wirklich verstehen könne. Wer nicht von dieser Russin entzückt ist »dem fehlt der Blick für Größe« oder (er) »ist eifersüchtig«11, referiert Elisabeth mit Bitterkeit im Herzen den Standpunkt ihres Bruders. Wahrscheinlich hat er nicht einmal vergessen hinzuzufügen, dass die Eifersucht eine spezifisch weibliche Begabung sei.
Er hat sie benutzt.
Er brauchte sie als Anstandsdame, schließlich konnte er nicht allein mit einem jungen Mädchen im Wald wohnen. Es war so demütigend. Und sie hat diesen Ort auch noch für ihn gefunden, für ihn eingerichtet. Es war der schlimmste August ihres Lebens, es war der schlimmste Aufenthalt ihres Lebens. Auch sie müsste jetzt abreisen, endlich abreisen, den Schauplatz ihrer Erniedrigung verlassen, aber sie kann hier nicht weg, aus zwei Gründen. Sie weint die Tage und die Nächte durch, so kann sie nicht unter Menschen gehen, so kann sie nicht Zug fahren, so kann sie nicht nach Hause kommen. Der zweite Grund ist: Ihr Bruder ist dort, Fritz ist zu Hause. Er ist nach Naumburg gefahren, zur Mutter. Sie selbst hat ihn darum gebeten, kategorisch darum gebeten, gleich nachdem das Monstrum weg war. Sie halte es jetzt nicht aus, hat sie ihm gesagt, mit ihm am selben Ort zu sein, dieselbe Luft zu atmen.
Am 26. August 1882 brachte Friedrich Nietzsche die Petersburger Generalstochter nach Dornburg zum Bahnhof, und als er zurückkam, haben die Geschwister sehr gestritten. Er benahm sich, als sei nichts geschehen, als sei alles gut zwischen ihnen, wie immer, eher noch besser. Diese gute Laune, mit der er zurückkehrte, diese Zuversicht, schnitt ihr ins Herz. Elisabeth wusste, dass er wusste, wohin Lou fährt: zu Rée, direkt in die Arme seines besten Freundes. So ist dieses Mädchen.
Und Fritz will das nicht sehen. Der arme Thor macht nur sich und seine Philosophie lächerlich12. Und sie, seine Schwester, macht er auch lächerlich. Sollen sie so enden?
Lou von Salomé, Paul Rée und Friedrich Nietzsche, Frühsommer 1882
Wie er über ihre Schreibversuche gespottet hat. Elisabeth brüte auf ihren kleinen Novelleneierchen, hat er Lou mitgeteilt. Und ihr selbst erklärte er, eine schreibende Schwester, ein schriftstellerndes Frauenzimmer also, wäre »seiner unwürdig«. Sie ist ihm peinlich vorm Angesicht der Welt? Weil es Frauenplunder ist, was sie zu Papier bringt? Weil sie zu viele Adjektive benutzt und jedes Mal die falschen? Oder weil Friedrich in ihrer Novelle die Hauptfigur ist, ein Philologieprofessor Mitte dreißig, der nicht heiraten will? Philosophen sind empfindlich, wenn man statt über ihre Gedanken über sie selber spricht, auch das hat sie in ihrer Novelle vermerkt: Nichts ist Philosophen unangenehmer, als wenn man ihre philosophischen Bemerkungen ins Persönliche überleitet13. Ihr Bruder macht da gar keine Ausnahme. Es ist schwer genug, im eigenen Leben vorzukommen, und jetzt auch noch in der Literatur seiner Schwester? Aber sie hatte keine Wahl. Jeder Autor sollte über etwas schreiben, das er wirklich gut kennt, und sie kennt nichts und niemanden auf dieser Welt besser als ihren Bruder. Georg Eichstedt heißt er in ihrer Erzählung, und natürlich benutzt sie Zitate aus Friedrichs Büchern, schließlich handelt die Geschichte von ihm.
Diese Frau ist schön und klug: ach, wie viel klüger aber würde sie geworden sein, wenn sie nicht schön wäre, heißt es im Aphorismus 282 der Morgenröthe. Bei Elisabeth liest sich das so: »Du weißt aber«, fuhr er – der ledige Professor Georg Eichstedt – lebhaft fort, »daß das Hübschsein mir als keine gute Mitgabe für die Frauen erscheint, es hat meist einen abschwächenden Einfluß auf ihren Geist und Thätigkeitstrieb, und ich möchte wie jener Philosoph sagen, der, als man ihn mit einer Frau bekannt gemacht hatte, welche ebenso schön als klug war, betrübt ausrief: ›Oh, wie viel klüger würde sie noch sein, wenn sie nicht so schön wäre.‹«14
Hat sie das nicht gut formuliert: … einen abschwächenden Einfluß auf ihren Geist …? Ironie ist eine Angelegenheit der Nuancen. Das den Bruder zitierende Alter Ego ihres Bruders bekommt an dieser Stelle Widerspruch von seinem Vater, einem verwitweten Oberst im Ruhestand, der die Berufswahl seines Sohnes immer missbilligt hat: »Aber«, wand hier ein wenig ironisch lächelnd der Oberst ein, »Dein Philosoph scheint mir doch die Frauenwelt recht einseitig zu beurtheilen. Ich habe die hübschen Frauen immer geistreicher als die häßlichen gefunden. Das Bewußtsein eines angenehmen Äußeren giebt den Frauen … Aber nein, Elisabeth Nietzsche hat jetzt wohl keine Freude mehr an ihrer Novelle, auch zum Schreiben gehört ein kleiner Übermut. Sie wird diesem Stück Literatur – vielleicht war es ihr Erstling – am Ende nicht einmal einen Namen geben. Hat Friedrich Nietzsche die Schriftstellerin Elisabeth Nietzsche auf dem Gewissen?
Was besonders kränkt: Sie schmäht er für ihre Schreibversuche, für Lou aber hat er in Tautenburg eine ganze Stillehre verfasst: Der Takt des guten Prosaikers in der Wahl seiner Mittel besteht darin, DICHT an die Poesie heranzutreten, aber NIEMALS zu ihr überzutreten. Oder: Je abstrakter die Wahrheit ist, die man lehren will, um so mehr muß man erst die Sinne zu ihr verführen.15 Er kann das, Elisabeth leugnet es nicht. Noch im Juni hat sie ihm geholfen, das letzte seiner unverkäuflichen Bücher druckfertig zu machen. Er hat es Die fröhliche Wissenschaft genannt. Aber mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, gar nichts, sie täuscht er nicht. Es ist eine Bibel der radikalen Selbstbezüglichkeit, er formuliert das nur viel schöner, damit niemand den Betrug gleich merkt: Menschen mit eigenen Festen, eigenen Werktagen, eigenen Trauerzeiten …? Pah!
Sie sagt gern Pah! Es klingt so definitiv.
Höherer Egoismus? Worte! Ist eine höhere Gemeinheit etwa keine Gemeinheit mehr? Schließlich gibt Friedrich selbst zu, dass Lou »böse« ist, sie sei ein hervorragend böses Wesen, sagt er, auch Voltaire sei böse gewesen und trotzdem ein großer Aufklärer. Aber Lou ist doch nicht Voltaire! Und überhaupt, ein männlicher Schurke mag noch gehen aber ein weiblicher Schurke nützt nie etwas.16 So sieht sie das.
Lies die Bücher meines Bruders nicht, wird sie eine Freundin bitten, sie sind für uns zu schrecklich, unsere Herzen wollen höher hinaus als zur Allbewunderung des Egoismus. Ach und gieb dir keine Mühe und quäle dich nicht diese Bücher mit dem früheren Nietzsche in Einklang zu bringen, es ist nicht möglich17.
Sie weiß nur zu genau, wer dieses Weib mit den beiden anatomisch inadäquaten Körperhälften ist: Sie ist die PERSONIFICIERTE Philosophie meines Bruders18.
Seine Bücher haben, daran ist kein Zweifel, einen sehr schlechten Einfluss auf ihren Bruder. Aber dazu noch die Russin: Das, glaubt Elisabeth, ist mehr, als Friedrichs geistige Zurechnungsfähigkeit ertragen kann. Er ist ganz verwandelt, gerade wie sein Freund Gersdorff als dieser unter dem Einfluß einer fragwürdigen Italienerin stand.19 Und wenn sie daran denkt, wie streng Fritz damals zu dem unglücklichen Gersdorff war!
Ja, sie haben sehr gestritten.
Sie wolle gar nicht über sich sprechen, erklärte sie, wahrscheinlich nicht ohne die selbstlose Pose der Märtyrerin einzunehmen, was ihn erbittert haben dürfte. Sie rede nicht über die Kränkungen, die sie erlitt … Wenn Friedrich Nietzsche etwas hasst, dann sind das Gespräche, die so beginnen. Alles Anklagen und Beschämenwollen ist ihm zuwider, am ersten Tag dieses Jahres hat er sich ein Versprechen gegeben, wie inzwischen jeder in seinem neuen Buch nachlesen kann: Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. WEGSEHEN sei meine einzige Verneinung. Und, Alles in Allem und Grossen: ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender sein.20
Aber der Jasager der Zukunft konnte jetzt nicht wegsehen, er konnte nichts tun, als seiner Schwester zuzuhören. Wenn sie auch über das Maß des ihr zugefügten Leids schweigen würde, über diese infame Person, das sagte sie Friedrich geradewegs ins Gesicht, über diese Larve von einem Menschen gedenke sie fürderhin nicht zu schweigen. Ob gefragt oder ungefragt, ließ sie offen. Die Wirkung ihrer Worte schildert Elisabeth der Freundin Clara Gelzer so: Als ich aber erklärte daß ich über Lou die reine Wahrheit sagen würde, fing er gegen mich zu wüthen an21. Sie solle sich in Acht nehmen! Sie solle sich nur in Acht nehmen, er meine es ernst.
Menschen, die lieben, leben jenseits der Vernunft. Das gilt auch für Philosophen. Wenn sie daran denkt, dass sie dieses Tautenburg für ihren Bruder erst gefunden hat. Dass sie es eingerichtet hat, für ihn und seinen Besuch. Wo wäre er denn ohne sie? Diese Russin wird ihn gewiss nicht pflegen, wenn er krank ist, und krank ist er meistens. Nichts wird sie für ihn tun, diese Frühgeborene einer noch unbewiesenen Zukunft.
Es ist, genau genommen, eine Frechheit, dass ein Mensch, der so sehr auf die Fürsorge seiner Umwelt angewiesen ist wie ihr Bruder, den Egoismus, den radikalen Selbstbezug verklärt. In der Welt, die er erdenkt, möchte sie nicht leben. (E)s bricht mir das Herz diesen veränderten Menschen zu sehen und wie edel war er früher!22
Und dann trat Elisabeth Nietzsche, 34 Jahre alt, unverheiratet, kinderlos, nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit – soweit ihr verweintes Gesicht das zuließ – vor ihren Bruder hin, um ihm zu erklären, dass er keine Schwester mehr habe, solange er sich nicht lossage von dieser Frau.
Weiß sie, dass sie Unmögliches verlangt?
Wenn diese 21-jährige in der Tat die PERSONIFICIERTE Philosophie Friedrich Nietzsches sein sollte: Wie sagt man sich los von sich selbst?
Allein in Naumburg (Friedrich)
Meine liebe Lou, einen Tag später als Sie gieng ich von Tautenburg weg, im Herzen s e h r stolz, s e h r muthig – wodurch eigentlich?, fragt Nietzsche die Freundin. Die Erkundigung, mehr an sich selbst als an die Empfängerin gerichtet, ist durchaus berechtigt, nicht nur in Anbetracht von Lous Reiseziel: Paul Rée.
Rée ist der einzige wahre Freund, den Friedrich Nietzsche noch hat seit seinem Abfall von Richard Wagner, Peter Gast und den alten Getreuen Overbeck nicht mitgezählt. Die übrigen sind etwas von ihm abgerückt; sie glauben, er und seine Philosophie befänden sich auf einem Irrweg, doch er werde gewiss zurückfinden. Zu sich selber, zu Wagner, zu ihnen, irgendwann.
Bei Rée, Nietzsche weiß es, wird Lou vorerst bleiben. Gefährlich leben! Natürlich wird sie nicht lange bei ihm bleiben, nur so lange, bis die beste Herbst-Winter-Residenz für ihren Dreierbund, ihre scheinheilige Trinität der vorbereitenden Menschen gefunden ist. Also ziemlich lange.
Zwei Wochen?
Eine leicht bestürzende Dimension besitzt dieser Gedanke schon, zumindest für gewöhnliche Temperamente, für die ewigen Kleinbürger des Lebens, die er so schwer erträgt. Er aber, der dem Urteil seiner Schwester zufolge neuerdings eine fatale Ähnlichkeit mit seinen Büchern aufweist, ist entschlossen, diese Prüfung mit Anstand zu bestehen.
Nein, Anstand ist das falsche Wort, es ist kleinbürgerlich, es ist äußerlich, Anstand hat man anderen gegenüber. Was er meint, und was seine Schwester wohl nie verstehen wird, ist etwas anderes: Es ist Großzügigkeit, es ist ein elementares Wohlwollen, gründend auf ihrem gemeinsamen Heimatrecht in einem überindividuellen Raum. Gefährlich leben! Alle geistig empfänglichen Menschen hat er dazu aufgefordert. Und mit sich selbst fängt er an. Er baut sein Haus schon jetzt an den Vesuv. Seine Ankunft in Naumburg fiel freilich ernüchternd aus. Argwöhnisch besah ihn die Mutter, wie man einen Schaden besieht.
Warum kommt er allein?
Wo ist Liesbeth?
Was macht sie noch in Tautenburg?
Sie schreibe? Das glaube er doch wohl selber nicht.
Seine Mutter ist das Gegenteil eines vorbereitenden Menschen. Als er sein Theologie-Studium begann, schickte sie ihm umgehend die Mahnung: »Verliebe dich nur nicht zu sehr in den schönen geistreichen Kunstgeschichtsprofessor, man hat hier schon seine Sorge ausgesprochen, daß Du einmal ›Belletrist‹ werden könntest, sobald Du Dir nicht ein festes Ziel stecktest. … ›Das aber wird mein Fritz nicht werden, war meine feste Antwort.‹«23 Und es ist doch geschehen, das Schlimmste, ihr Sohn ist ein Belletrist geworden, näherhin ein kranker Belletrist, dessen Bücher kein Mensch liest. Wie soll er jetzt noch eine Frau finden? Hätte er doch geheiratet, als noch Zeit war, als er noch Professor war! Jetzt werfen sich ihm nur Abenteurerinnen an den Hals. Oder müsste sie richtiger sagen: Er wirft sich Abenteurerinnen an den Hals?
Franziska Nietzsche weiß nichts über Lou, aber dass es sich um ein Wesen höchster Fatalität handeln muss, ist ihr klar, sonst hätte er sie mitgebracht, sonst hätte er sie seiner Mutter vorgestellt. Natürlich haben ihre Kinder sich wieder gegen sie verschworen, sie kennt das, sie kennt das schon lange, aber diesmal muss irgendetwas schiefgelaufen sein.
Misstrauen. Es ist die hervorstechendste Eigenschaft schwacher Menschen, die nicht für sich selbst stehen können. Solcher Menschen wie seiner Mutter, deren Gegenwart alles klein macht. Es könnte hart werden, wenn er ab sofort nicht mehr nur die Mutter, sondern auch Elisabeth gegen sich hätte. Aber er kann sich jetzt nicht auf Naumburger Maß verkleinern. Ihm ist so groß zumute, ja mehr noch: Ihm ist, als müsse er sich ans Klavier setzen und komponieren. So ging es ihm seit Ewigkeiten nicht mehr. Er könnte den Zeitpunkt auch genauer angeben: Seit er Wagner den Rücken kehrte.
Lou hat ihm ein Gedicht geschenkt, beim Abschied auf dem Dornburger Bahnhof. Er las es mit großer Erschütterung, und nie wird er es ohne Tränen können. Ja, er will diesem Gedicht Töne geben, bis Lou ihm sagt, wie es weitergeht.
Er setzt sich ans Klavier. Franziska Nietzsche ist alarmiert: Liesbeth ist weg und ihr Sohn komponiert? Das ist nicht normal. Das ist im höchsten Maße abnorm.
Lou und Rée sind die beiden Menschen, die ihm im Augenblick am nächsten stehen auf Erden. Darf er ihrer temporären Gemeinsamkeit misstrauen? Im Herbst werden sie gemeinsam wohnen, arbeiten und studieren, zu dritt, in einer großen Stadt, in Wien oder Paris. Wahrscheinlich in Paris. Dieses Jahr soll das Jahr seiner Rückkehr zu den Menschen werden! Hatte er nicht seit fünf Jahren, seit seiner Abwendung von Wagner, an Leib und Seele mehr einem Schlachtfeld als einem Menschen geglichen? Er will kein Schlachtfeld mehr sein. Mit meiner Schwester habe ich nur wenig noch gesprochen, doch genug, um das neue auftauchende Gespenst in das Nichts zurück zu schicken, aus dem es geboren war24, berichtet er der Freundin. Das Gespenst ist der ihm unerträgliche Gedanke, seine Schwester könne im Recht sein und Lou habe ihn der Lächerlichkeit preisgegeben in Bayreuth. Lou, wenn sie die letzten drei Wochen empfunden hat wie er, wird den Wink verstehen, sie wird ihm sagen, dass es nicht wahr ist. Lous Gedicht ist genau genommen ein ganz unmögliches Gedicht. Aber es spricht wie aus dem Zentrum seiner Existenz heraus. Er hat einen Mitwisser seines Schicksals, eine Mitwisserin von 21 Jahren.
Gebet an das Leben
Gewiß, so liebt ein Freund den Freund,
Wie ich Dich liebe, Rätselleben –
Ob ich in Dir gejauchzt, geweint,
ob Du mir Glück, ob Schmerz gegeben.
Ich l i e b e Dich samt Deinem Harme;
Und wenn Du mich vernichten mußt,
Entreiße ich mich Deinem Arme,
Wie Freund sich reißt von Freundesbrust.
Mit ganzer Kraft umfaß ich Dich!
Laß Deine Flammen mich entzünden,
Laß noch in Glut des Kampfes mich
Dein Rätsel tiefer nur ergründen.
Jahrtausende zu sein! zu denken!
Schließ mich in beide Arme ein:
Hast Du kein Glück mehr mir zu schenken –
Wohlan – noch hast Du Deine Pein.25
Franziska Nietzsche späht, Friedrich Nietzsche komponiert das in seinem Pathos, seiner Unbeholfenheit fast schon komische Gedicht. Und dazu dieser unmögliche Titel! Ob Frau Pastor Franziska Nietzsche es gelesen hat, heimlich vielleicht, wie Mütter das tun? Er versucht, sich nicht von ihr stören zu lassen. Frauen sind die ewigen Störenfriede des Daseins. Er kann das auch erklären, ungefähr so: Frauen sind Menschen, die ihren Zweck nicht in sich selber haben, sie sind bloße Reproduktionswerkzeuge der Natur, Geschöpfe, die fortpflanzungsbedingt nie die Gelegenheit finden, ein ganzer Mensch zu werden und seelisch volljährig. Eben so wie seine Mutter.
Franziska
Aschenputtel hat zwei Schwestern, Franziska hat drei.
Wenn Adele, Sidonie und Cäcilie in die Kutsche steigen, um in die Welt hineinzufahren, bleibt sie am Tor des Pfarrhofs stehen und sieht ihnen lange nach. Meist ist es ein Sonntag. Adele, Sidonie und Cäcilie fahren auf Gesellschaften, sie fahren zum Kaffeetrinken bei fremden Leuten oder einfach auf »Landpartie«, und vielleicht sind sie sogar schon auf einem richtigen Ball gewesen. Jedes Mal, wenn Franziska allein zurückbleibt, kriechen eine kleine Einsamkeit und eine große Sehnsucht in ihr Herz. Oder ist es eine kleine Sehnsucht und eine große Einsamkeit? Einmal fragte sie die Mutter, ob nicht auch sie mitfahren dürfe. Die Mutter wiederum fragte Adele. Und Adele hat nein gesagt. Eigentlich mag sie Adele. Und Sidonie und Cäcilie ebenso. Sie sind auch keine Stiefschwestern, sondern ihre richtigen Schwestern, aber die Hand eines schweren Schicksals scheint auf ihnen zu liegen. Franziska könnte nicht sagen, wann das angefangen hat. Man nennt es auch das heiratsfähige Alter.
Es muss eine schwere Prüfung sein. Man kann sie bestehen oder durchfallen. Immerhin müssen Adele, Sidonie und Cäcilie diese Prüfung nicht allein bestehen. Sie gehen immer zu dritt los, einen Bräutigam zu suchen. Steht da in Mutters und Vaters Gesicht so ein unbestimmbarer Ausdruck, dem sie entnehmen könnte, dass es nicht unbedingt ein Vorteil ist, zu dritt einen Bräutigam zu suchen? Vielleicht bekommen die Gesuchten Angst vor der Übermacht, oder sie wissen nicht, welche der drei sie nehmen sollen, und nehmen vorsichtshalber gar keine. Franziska kann das nicht beurteilen, sie ist zu jung, eigentlich noch ein Kind. Bis eben ist sie mit ihren fünf Brüdern Schlitten gefahren, dem Alter nach ist sie die Mittlere zwischen ihnen.
Warum soll das Kind das auch schon mitmachen?, hat Adele zu ihrer Mutter gesagt, als diese fragte, ob Franziska mitkommen dürfe. Adele trug ihr Prüfungsgesicht, und es klang wie: Wir sind schließlich nicht zu unserem Vergnügen unterwegs. Na, sie weiß ja nicht. Und wenn man sie fragte, Franziska, was keiner tut, sie wüsste: So wird das nie was! Und ihr würde der Ausflug auf jeden Fall Spaß machen. Falls einer auf die Idee käme, sie zu heiraten, würde sie ihn einfach wieder wegschicken oder, noch besser, sie würde ihn Adele, Sidonie oder Cäcilie schenken.
Aber dass die Lage der drei ernst ist, begreift auch Franziska. Seit sie die Frauen der Nachbar-Pfarrei gesehen hat, besteht darüber kein Zweifel mehr. Nebenan in Röcken ist kürzlich ein neuer Pfarrer eingetroffen, der hat keine Frau, wahrscheinlich, weil er an den dreien, die er mitbrachte, schon genug hat. Die eine ist seine Mutter und die anderen beiden sind seine Schwestern. Franziska glaubt das eher nicht, weil die Schwestern fast so alt aussehen wie die Mutter. Adele, Sidonie und Cäcilie sagen, das sei eine Frage der Perspektive. Zumindest weiß Franziska nun, was passiert, wenn man durch die Prüfung fällt. Dann sieht man irgendwann aus wie Augusta und Rosalie Nietzsche. Aber es ist nicht ihr unvordenkliches Alter allein, es ist auch der Ausdruck ihres Gesichts, ihre Art zu sprechen. Als gehörten sie gar nicht hierher, als seien sie gleich wieder weg, als sei ihr Aufenthalt hier auf dem Land ohnehin ein Irrtum, dessen Korrektur sie täglich erwarten. Als seien sie »unter die Bauern gefallen«.
Franziska kann sich dabei nichts denken. Natürlich sind auch sie, die Oehlers, keine Bauern, zumindest nicht direkt, denn ihr Vater ist der Pastor von Pobles. Aber seine Herkunft ist durchaus bedenklich. Als Sohn eines armen Webers in Zeitz betrat er die Bühne der Welt, und hätte er rückwärts geschaut und seine Ahnenreihe begutachtet, so wäre er zu dem Ergebnis gelangt, dass wenig Grund zur Zuversicht besteht. Über Jahrhunderte hinweg, von 1600 bis 1880, waren die Oehlers Fleischhauer in Greiz. Und doch gelang David Oehler das in der Geschichte dieser Familie Einmalige: Er wurde zu einem, der sich statt durch blutige Arbeit, im Schlachthaus oder am Webstuhl, allein durch das Wort ernähren kann. Und mehr noch, es gelang ihm, eine leibhaftige Rittergutsbesitzerstochter zu heiraten.
Der Vater der Rittergutsbesitzerstochter war aber nicht nur Rittergutsbesitzer, sondern außerdem kurfürstlich-sächsischer Finanzkommissar, zwei Eigenschaften, die es ihm ermöglichten, seiner Tochter eine Equipage, Kutscher und Köchin mit in die Ehe zu geben. Allerdings muss ein Teil dieser Großzügigkeit wohl als Wiedergutmachung betrachtet werden, denn die Braut wies erhebliche Mängel auf. Sie war auf einem Auge blind und lahmte auf einem Bein.
Wie auch immer, eine Rittergutsbesitzerstochter gleicht Generationen von »Fleischhauern« aus, und Franziska und ihre zehn Geschwister, von denen sich drei Mädchen im riskantesten Alter ihres Lebens befinden, sind Pastorenkinder.
Auch wenn ihr Pfarrhof voller Scheunen und Ställe ist: Jeden Sonntag legt der Vater den schwarzen Talar an, und zu elft folgen sie ihm dann in die Kirche, vor den Bauernkindern. Immer vor den Bauernkindern, die kommen zuletzt, aber in mancher Hinsicht haben sie es auch gut. Sie müssen sich zum Beispiel nie um das Klavier ihres Vaters aufstellen, um eine Eine feste Burg ist unser Gott zu singen.
Wahrscheinlich würden den Nietzsche-Frauen die Ohren abfallen, könnten sie das hören. Sie sind sehr geräuschempfindlich. Möglich, sie wären lieber ohne Ohren geboren. Die Nietzsche-Frauen können bestimmt nicht singen, zumindest nicht so laut. Und »Eine feste Burg ist unser Gott« muss man laut und elfstimmig singen, sonst wird es keine Burg. Vielleicht glauben die Nietzsche-Schwestern auch nicht mehr daran, denn wäre Gott eine feste Burg, hätte er Augusta und Rosalie wohl einen Mann gegeben, als noch Zeit war.
Die neuen Nachbarinnen sprechen sehr leise, damit sie einander mit ihren Stimmen nicht wehtun, aber die phonetische Zärtlichkeit ist wohl nur ein Vorwand. Flüstern sie nicht, damit der liebe Gott sie nicht verstehen kann? Franziskas Schwestern sagen, es läge an ihrer Vornehmheit. Franziska, das Kind, hat nur eine undeutliche Vorstellung davon, was das ist, zumindest ist es nichts Gesundes. Rosalie Nietzsche muss sogar manchmal eine Einladung ausschlagen: Sie litte an den Nerven, wird ihr Bruder, der neue Röckener Pfarrer, das begründen.
Die Nerven?
Franziska hat dieses Wort noch nie gehört.
Als es das erste Mal fällt, hätte sie sich beinahe erkundigt, was das sei, schluckte die Frage aber im letzten Augenblick hinunter. Sie kam sich so dumm vor, aber vielleicht ist eine verschluckte Dummheit schon eine halbe Klugheit? Sie fragte einfach hinterher ihre Mutter, doch, seltsam genug, die Rittergutsbesitzerstochter wusste es auch nicht. Sie dachte lange nach, um sich dann zu der Vermutung zu entschließen: Ich glaube, das ist so eine allgemeine Schwäche.26
Der Pfarrer Nietzsche ist ebenfalls schon sehr alt, gleich dreißig, sagen ihre Schwestern. Aber er soll sehr schön Klavier spielen können. Wenn sie nicht alles täuscht, sieht Carl Ludwig Nietzsche ein wenig verzweifelt aus. Es ist gewiss nicht einfach, mit drei Frauen zu leben, die glauben, sie seien unter die Bauern gefallen, und warten, dass sie wieder abreisen dürfen. Pfarrer Nietzsche hat versprochen, am Sonntag nach Pobles zu kommen, um am Klavier zu fantasieren. Er fantasiere wunderbar. Seine Mutter und die beiden Schwestern bringt er natürlich mit, vorausgesetzt, sie leiden nicht an den Nerven. Franziska freut sich schon auf den Sonntag. Natürlich wird sie dabei sein, natürlich wird sie zuhören dürfen. Sie glaubt, Adele, Sidonie und Cäcilie freuen sich auch.
Die drei bekommen ganz glänzende Augen, wenn sie von dem neuen Röckener Pastor sprechen. Carl Ludwig Nietzsche soll früher Prinzessinnenerzieher gewesen sein. Er hat die drei Altenburger Prinzessinnen Elisabeth, Therese und Alexandra erzogen, und zwischendurch spielte er für sie Klavier. Leider wurden Elisabeth, Therese und Alexandra erwachsen, und Carl Ludwig Nietzsche musste sich nach einer neuen Arbeit umsehen. Elisabeth wurde Großherzogin von Oldenburg, Alexandra wurde Großfürstin Konstantin von Russland und Carl Ludwig Nietzsche wurde Pastor in Röcken.
Aber der Stoff seiner Anzüge, sein ganzes Benehmen zeuge von seiner Vergangenheit, sagen ihre Schwestern. Solch »superfeine, schwarze, glänzende Tuchkleider« trage man gewiss »nur bei Hofe«. Und so ein vornehmer Mann, gewissermaßen ein Mann von Welt, kommt am Sonntag in seinem Superfeine-Welt-Anzug zu ihnen, um für sie Klavier zu spielen. Oder kommt er gar nicht wegen ihnen, sondern mehr wegen ihres Vaters? Pastor Oehler ist gewissermaßen der einzige Nicht-Bauer in der ganzen Leipziger Tiefebene zwischen Pobles und Röcken, der einzige Mann, mit dem man reden kann. Auf »Mann« liegt die Betonung. Und trotzdem.
Seltsam, sagen Adele, Sidonie und Cäcilie, dass er noch keine Frau genommen hat. Egal wie, Franziska ist schon sehr aufgeregt.
Adele, Sidonie und Cäcilie sind es auch.
Sich anlehnen dürfen
Die ungeheure Erwartung in Betreff der Geschlechtsliebe verdirbt den Frauen das Auge für alle fernen Perspektiven27, hat Friedrich Nietzsche vor ein paar Tagen notiert, noch für Lou, noch in Tautenburg. Lou wollte von ihm wissen, was Frauen sind, weil sie einen philosophischen Roman schreiben möchte, in dem auch Frauen vorkommen. Lou, dem Mannkind, dessen Umriss die Natur mit allerkühnstem Schwung gezeichnet hat, als gelte es, den Schöpfungstag zu wiederholen, ist diese Spezies mindestens ebenso rätselhaft und befremdlich wie ihm.
Die ungeheure Erwartung … Ein Satz wie ein Paukenschlag. Die Wahrheit über ein ganzes Geschlecht, kaum zwei Zeilen lang? Und doch neigen diese zwei Zeilen zur Infamie, denn sie verkennen die Not Adeles, Cäcilies und Sidonies. Sie ignorieren, dass da keine Wahl ist, keine Horizonte offenstehen, nur dieser eine: Geheiratetwerden. Ihre Ehre, ihre soziale Stellung, alles hängt daran. Und Friedrich Nietzsche erklärt eine gesellschaftliche Nötigung zur Naturtatsache, zu der der Frau? Darf ein Philosoph denn so blind sein, ein Allesdurchschauer von Berufs wegen? Zur Eigenart eines großen Geistes, mag er meinen, gehören auch seine schwarzen Löcher, er wäre zu ausrechenbar sonst. Und Friedrich Nietzsche besitzt nun einmal eine gewisse Reserve diesem Geschlecht gegenüber.
Wahrscheinlich liebt er Lou auch dafür, dass sie an keiner Stelle in seine Definitionen der Frau passt. Er liebt sie für die Konsequenz, mit der sie seine Heiratsanträge ablehnt. Die Empfängerin des Perspektiven-Satzes hat er bestimmt am wenigsten überrascht, denn sie hielt sich schon an ihn, als sie dessen Autor noch gar nicht kannte. Sie habe ihr Liebesleben ein für alle Mal beendet, erklärte sie sowohl Nietzsche als auch Rée. Sie war für Offenheit in diesen Dingen. Sie streicht die eine Perspektive und hat dafür alle anderen!
Wie viel mag sie Rée und Nietzsche gesagt haben?
Den Namen Gillot kennen beide. Denn der Name des holländischen Pfarrers von St. Petersburg gehört mindestens ebenso zu Louise von Salomé wie ihr eigener. Gillot ist der Bürge ihrer Existenz. Bei diesem Gottesmann hat sie Privatunterricht in Theorie und Praxis des Atheismus genommen, studierte mit ihm Kant, Schopenhauer und Kierkegaard, aber auch Kirchengeschichte. Denn De geschiedenes von den godsdienst ist Henrik Gillots theoretisches Hauptwerk, es widmet sich dem Nachweis, dass Weniges so relativ ist wie die Verehrung Gottes, was den Gedanken zulässt, wenn nicht nahelegt, dass diese Verehrung eines Tages auch ganz enden könne.
Lou musste das alles wissen, genau wissen, denn im Alter von zehn Jahren, vielleicht war sie sogar noch jünger, wurde ihr von einem Augenblick auf den anderen bewusst, offenbarungsgleich, dass Gott nicht existiert. Seltsamerweise schien das sonst keinem aufzufallen. Mit Erstaunen sah sie die großen Kirchen, die man einem errichtet hatte, den es gar nicht gibt. Auch ihr geliebter Vater, der General Gustav von Salomé, gehörte zu denen, die einem Irrtum Mahnmale aus Stein errichten ließen.
Gustav von Salomé hatte beim Zaren um die Erlaubnis nachgesucht, eine »deutsch-reformierte Kirche« in Russland begründen zu dürfen, und sie erhalten. 1863 – Lou war zwei Jahre alt – begann der Bau der deutsch-reformierten Kirche am Mojka-Kanal von St. Petersburg. Friedrich Nietzsche, der Lou in diesem Sommer zu seinem Geschwistergehirn ernannt hatte, formulierte das Skandalon dieser Art von Immobilien gerade eben so: Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?28
Konnte es sein, dass alle Erwachsenen irrten, dass die Architektur irrte und die Musik, dass ihre Familie irrte, Mutter, Vater und Brüder; und sie, ein Kind, dessen Alter man an zehn Fingern abzählen konnte, hatte recht?
Natürlich konnte das sein, wusste das Mädchen, das damals noch nicht Lou, sondern mit seinem russischen Kosenamen Lolja gerufen wurde.
Die Krisis kam, als Lolja konfirmiert werden sollte. Sie durfte das nicht zulassen, es ging gegen ihr intellektuelles Gewissen. Nur wem sollte sie das erklären? Kein Mensch glaubt, dass Frauen so etwas wie ein intellektuelles Gewissen besitzen und gar ein Mädchen? Friedrich Nietzsche ist soeben zu der Auffassung gekommen, dass selbst unter den begabtesten Männern und edelsten Frauen kaum ein Träger dieses hinderlichen Organons anzutreffen sei, das ihm als das höchste gilt. Jede Deutung des Verhältnisses Friedrich Nietzsches zu Louise von Salomé geht fehl, wenn sie nicht eins voraussetzt: Zuerst und zuletzt liebt er sie für dieses Gewissen, bedingungslos. Sein Vorgänger hierin war Henrik Gillot.
Dass dieser Holländer kein Mann ist, der Konsequenzen scheut, Gotteskonsequenzen, aber auch andere, bewies das quasi-lutherische Bekenntnis, mit dem der Familienvater von über vierzig Jahren seiner noch nicht volljährigen Schülerin eines Tages gegenübertrat: Hier stehe er, er könne nicht anders und wolle sie heiraten. Seine Familie könne von ihm aus zum Teufel gehen. Der Pfarrer formulierte das zwar etwas behutsamer, aber auf diese Konsequenz lief es hinaus.
Seine minderjährige Schülerin packte bei den Worten ihres Mentors ein wahres Entsetzen, gewiss meinte sie in diesem Augenblick erstmals zu verstehen, was die Religionen meinen, wenn sie vom Leibhaftigen sprechen. Es ist der vollkommen kontraproduktive Einbruch einer Logik in ein Feld anderer Logiken, auf dem sie absolut nichts zu suchen hat. Sie wollte einen Lehrer, keinen Bräutigam.
Das gilt übrigens noch immer, doch der Philosoph, der bald beginnen wird, mit dem Hammer zu philosophieren, mag diese Aussage nicht in letzter Konsequenz auf sich beziehen, womit wir wieder in den letzten Augusttagen im Naumburger Haus am Weingarten wären, wo Friedrich Nietzsche unter den argwöhnischen Blicken seiner Mutter begonnen hat, Lous Lebensgebet zu komponieren, und darauf wartet, dass der gemeinsame Studienherbst zu dritt endlich beginnt.
Vielleicht folgt dem Herbst zu dritt ja ein Frühjahr zu zweit?
Nicht dass er es darauf anlegen möchte, aber steckte in ihrem »Ja«, zu ihm nach Tautenburg zu kommen, nicht schon ein anderes, viel größeres »Ja«? Er ist konventionell genug, es so zu denken.
Franziska Nietzsche wird die Zuversicht und Wohlgemutheit ihres Sohnes kaum ohne wachsende Arglist beobachtet haben. Es gibt auch keinen Grund für eine abweichende Reaktion.
Sie hat zwei unverheiratete Kinder Mitte dreißig. Sie haben beide nicht geschafft, was noch der Dümmste fertigbringt: zu heiraten. In dem Alter, in dem ihre Kinder jetzt sind, sitzt der Mensch längst wohlversorgt unter seinem eigenen ehelichen Dach und hat seinen erotischen Lebensabend längst begonnen … Nein, das denkt Franziska Nietzsche natürlich nicht. Wo nie ein Morgen war, kann es auch nicht Abend werden. Vagabundierende Sinnlichkeit ist ihr kein Begriff, aber Tatsache ist: Ihre Kinder haben beide noch kein eigenes Dach über dem Kopf, sie haben keine Existenz begründet, fast muss sie sich schämen vor den rechtschaffenen Naumburger Bürgern. Sie könnte, nein, sie müsste längst Großmutter sein. Aber weil ihre Kinder nicht geheiratet haben, sitzt nun eins verzückt am Klavier, das andere aber allein im Wald.
Dass dieses Tautenburg nicht koscher war, muss ihr spätestens aufgefallen sein, als ihr der Sohn am 11. Juli von dort schrieb: Es giebt viel zu thun. … Der Verschönerungs-Verein hat mir hier ZWEI NEUE BÄNKE in den Theilen des Waldes aufstellen lassen, wo ich gerne allein spazieren gehe.29 Würde er dort wirklich allein spazieren gehen, hätte er geschrieben »Wo ich gern spazieren gehe …«, aber nun gut, sie will nicht kleinlich sein, wirklich merkwürdig war der Fortgang: Ich habe versprochen, zwei Täfelchen daran anbringen zu lassen. Willst Du die Güte haben und dies besorgen? Und sofort? Sprich mit einem Sachverständigen, WELCHE Art von Täfelchen und Aufschriften sich am besten HÄLT.
Auf dem einen soll stehen: »Der todte Mann. F. N.«
Auf dem andern: »Die fröhliche Wissenschaft. F. N.«
Es muß etwas Feines und Hübsches sein, das mir Ehre macht. Mit herzlichem Gruß Dein Sohn Fritz.30
Der Tautenburger Verschönerungs-Verein will eine Bank aufstellen, auf der »Der todte Mann« steht, von dem Nonsens der zweiten zu schweigen? Sie weiß, dass ihre Kinder sie für nicht sehr gescheit halten, schon wegen ihres Umgangs mit dem lieben Gott, aber manchmal fragt sie sich, ob in dieser Familie nicht sie die Einzige ist, die noch Anspruch auf dieses Adjektiv hat.
Natürlich hat sie die Tafeln bestellt, sie ist es gewohnt zu tun, was ihr Sohn sagt, das ist mütterliche Fürsorge, und Männer sind Kinder, die können nichts allein. Wo wäre ihr Sohn, wenn sie ihm nicht regelmäßig Würste, Kuchen und Socken schickte an all die fremden Orte, an denen er sich herumtreibt und die sie oft nicht einmal dem Namen nach kennt. Im April etwa kam eine Postkarte aus Sizilien: Wäsche im letzten Zustande! Ich pfeife auf zwei noch mögliche Hemden! Auch meine Kleidung ebenso schlicht als schlecht. Aber mein Zimmer 24 Fuß lang und 20 Fuß breit. Für 4 Pfennige 3 Apfelsinen.31 Immerhin kann er sich noch Apfelsinen kaufen, manchmal traut sie ihm nicht einmal das zu. Wenn es in Naumburg Apfelsinen gäbe, würde er sich wohl auch die Apfelsinen von zu Hause schicken lassen.
Ja, wenn er eine Frau hätte!
Aber er will ja keine. Wie viele hat sie ihm schon angeboten: »Komm zu mir; ich wüßte ein köstliches Frauchen für Dich, höchst liebenswürdig, gescheudt, hübsch, wohlhabend und dabei höchst einfach und sauber. Gestern ging ich mit ihr von den Bahnhof bis zur Stadt und sie gefiel mir da wieder so.«32 Er wollte nichts davon hören.
Ja, sie weiß schon, eine Frau, die ihr gefällt, kann ihm gar nicht gefallen. Auch sollte man junge Frauen vielleicht nicht wie Süßspeisen offerieren. Und man kann sie nicht wie diese einfach genießen und weg sind sie. Nein, die bleiben, und ebendeshalb kann Friedrich Nietzsche nicht heiraten, schon gar keine Frauen, die ihr, seiner Mutter, gefallen.
Aber wie soll sie sich eine vorstellen, die sich auf Bänke setzen möchte, auf der »Der todte Mann – F. N.« oder »Die fröhliche Wissenschaft« steht? Und wie verstimmt er war, als die Täfelchen nicht rechtzeitig fertig wurden.
Unser letzte Zusammenkunft, meine liebe Mutter, schrieb er ihr am 7. August, lief etwas melancholisch ab; ob ich schon mit dem entgegengesetzten Wunsche gekommen war: mich bei Dir ein wenig zu erholen, da ich mich sehr angegriffen fühlte. – Daß die TÄFELCHEN immer noch nicht da sind ist ein Jammer: schließlich kommen sie, wenn alle Gäste fort und die Herbststürme vor der Thür sind.33 Ja, was heißt denn hier »alle Gäste«? Und wenn sich ein Herbststurm vor der Thür befinden sollte, dann ist es doch wohl dieses fatale fremde Weib.
Ihr Sohn wird Gründe haben, diese Ausländerin vor seiner Mutter zu verstecken. Liest er den Vorwurf in ihren Augen, wenn er vom Klavier aufschaut? Und Elisabeth kann die Fremde auch nicht gefallen haben, sonst wäre sie nach Hause gekommen.
Was um Himmels willen ist geschehen? Ihren Sohn kann sie nicht fragen, wenn sie ihren Sohn fragt, bekommt sie höchstens eine philosophische Antwort. Also gar keine.
Ja, es fasziniert Friedrich Nietzsche, dass Lou so gar keine Ähnlichkeit mit einer Frau hat. Äußerlich schon, äußerlich durchaus. Er hätte diese spezifische Oberkörper/Unterkörper-Relation gar nicht besser formulieren können als seine Schwester, manchmal hat sie beinahe Talent. Er muss damit rechnen, dass auch Freund Rée nicht entgangen ist, in welch schockierender Flasche dieser so faszinierend unweibliche Geist steckt.
Der Philosoph komponiert.
Paul Rée kann nicht komponieren, hier ist er klar im Vorteil. Das ist er ohnehin. Denn im Vergleich zu Rée ist er beinahe berühmt. Und Lous Naturell, ihr philosophisches Naturell, passt viel besser zu ihm, allen seinen Freunden hat er das schon erklärt. Ja, er ist noch weiter gegangen: Aber vielleicht haben Sie auch ein Gefühl davon, daß ich, sowohl als »Denker« wie als »Dichter« eine gewisse Vorahnung von L gehabt haben muß34, fragte er Köselitz im Juli, um dann im August zu der Feststellung zu gelangen: L und ich sind sich ALLZUSEHR ÄHNLICH, »BLUTSVERWANDT«35.
Hätte er geglaubt, dass er noch einmal so froh werden könnte?
Und er hat es das ganze Jahr schon gefühlt, bereits im Schöpfungsrausch des Januar, den er den Sanctus Januarius nannte, wie jetzt jeder der Fröhlichen Wissenschaft entnehmen kann. Schon als er dieses Mädchen noch gar nicht kannte, rief er Köselitz zu: Lieber Freund, es lebe die Freiheit, Heiterkeit und Unverantwortlichkeit! Leben wir über uns, um mit uns leben zu können!36
Aber wie lebt man über sich unter den tadelnden argwöhnischen Blicken der eigenen Mutter? In ihrer Gegenwart lebt er eigentlich immer unter sich. Sie teilen denselben Raum, aber sie bewohnen verschiedene Welten. Franziska Nietzsche lebt in der Welt des Weibes, also in der Welt der Schwäche, glaubt ihr Sohn. Auch das hat er Lou in Tautenburg erklärt, für ihren Roman.
Allerdings ist Lou noch immer nicht sicher, ob sie überhaupt schreiben kann. Doch er hat ihr gesagt – und Rée sagt das auch –, sie könne schreiben, denn wer denken könne, könne auch schreiben. Seine Mutter hingegen kann nicht denken. Denn an dem Punkt, wo sie anfangen müsste zu denken, beginnt sie zu beten. Das hat sie schon immer getan.
Eine Reaktion, symptomatisch für die Schwäche des Weibes. Die besondere Pointe dabei aber ist: Es gäbe diese Schwäche gar nicht ohne die vorauseilende Selbstdefinition des Weibes als schwaches Geschlecht. Er hat das für Lou so notiert: Das Weib sucht nach Kraft, es blickt nach außen dabei, es will sich anlehnen, es ist ganz Fühlhorn für Alles, woran es sich anlehnen könnte; es schlingt sich verlangend auch um das, was zur Stütze ungeeignet ist und versucht sich daran zu halten … – es glaubt in dem Grade die Kraft außer sich als es an die Schwäche in sich glaubt.37
Friedrich Nietzsche war klar, dass die Empfängerin dieser Definition, sollte er recht haben, als Angehörige ihres Geschlechts schon gar nicht mehr in Frage kommt. Die 21-Jährige aus St. Petersburg kennt bis auf diesen Tag nur einen Menschen, an den sie sich bedingungslos anlehnt, und das ist sie selbst. Dafür liebt er sie. Dem späteren Denker des Willens zur Macht ist sternenklar, dass sein Wille, dem ihren ausgesetzt, gar nicht mehr zählt.
Ist das nicht großartig?
Er sei in allen Dingen der That unerfahren und ungeübt, erklärt er Lou, und schon seit Jahren habe er sich für keine Handlung, keine Absicht mehr vor anderen zu erklären oder zu rechtfertigen gehabt: Meine PLÄNE lasse ich gern im Verborgenen; über meine FACTA mag alle Welt reden! – Doch gab die Natur jedem Wesen verschiedene Verteidigungswaffen – und Ihnen gab sie Ihre herrliche Offenheit des Wollens. Pindar sagt einmal »WERDE der, der du BIST!« Treulich und ergeben F. N.38
Einmal, im Juni, hatte er versucht, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Er hatte versucht, sie in Berlin zu treffen, am Anhalter Bahnhof, aber sie kam nicht, natürlich kam sie nicht. Reumütig schrieb er nach seiner Rückkehr: Liebe Freundin Also: ich habe eine kleine anscheinend sehr thörichte Reise nach Berlin gemacht … Und der Brief endet: Mein Wunsch in Betreff Wiens ist jetzt, wie ein Paquetstück in ein Zimmerchen DES Hauses abgesetzt zu werden, in welchem Sie wohnen wollen. Oder im Hause nebenan, als Ihr getreuer Freund und Nachbar F. N.39
Er lässt sich so gern von ihr entmündigen. Bis vor kurzem war er der Meinung, dass Rée, Lou und er schon im September zu dritt in Wien sein werden, um zusammen zu wohnen und zusammen nachzudenken. Doch dann hat Lou es sich anders überlegt, wie, weiß sie selber noch nicht, und er kann nur warten, bis sie ihm ihren endgültigen Entschluss mitteilt. Er weiß nicht, wo er sein wird in diesem Herbst. Irgendwo am Vesuv, nur so viel ist sicher.
Er hat sie zu seiner Stütze erwählt. Schwach sein! Sich anlehnen dürfen. An wem lehnte er lieber als an dem Mannkind Lou?
Manchmal glaubt er beinahe, es gäbe Religion und Moral, diese Krücken der Menschheit, überhaupt nur, weil es Frauen gibt. Nicht nur in Beziehung auf die Männer, sondern auch in Beziehung auf Religion und Sitte: das schwache Weib glaubt an seine Unmöglichkeit, ungestützt stehen zu können und verwandelt alles, was es leiblich und geistig umgiebt, in Stützen40. Er verdankt diese Erkenntnis nicht zuletzt dem aufmerksamen lebenslangen Studium seiner Mutter.
Das Kind heiratet
Es ist ein fast vollkommener Sommertag in der Leipziger Tiefebene. Und dort, wo sie einen kleinen Huckel bekommt, eine winzige Bodenunebenheit, vielleicht 20 Meter über dem Meeresspiegel, nicht der Rede wert, da liegt der Pfarrhof von Pobles. Die Nietzsche-Frauen und Carl Ludwig stehen auf dem Pobleser Gipfel und loben den legendären Rundblick. Zu sehen ist nichts als Sommerfelder. Aber nur Bauern und Franziska würden eine derart naive, ungebildete Ansicht äußern. Denn diese Felder sind in Wahrheit Schlachtfelder. Tausende tränkten durch die Jahrhunderte diese Erde mit ihrem Blut.
Hier schlug der Schwedenkönig Gustav Adolf an einem Novembertag des Jahres 1632 das kaiserliche Heer unter Wallenstein. Auch deshalb können Pastor Oehler und Pastor Nietzsche heute in ihren einfachen kargen Talaren in ihren einfachen kargen Kirchen auf ihren einfachen kargen Kanzeln stehen und ihr einfaches karges Vernunftchristentum predigen, das so wenig verspricht und so viel fordert, während durch die unbunten Fensterscheiben ihrer Kirchen ein einfaches karges Vernunftlicht fällt. Das alles, sie wissen es genau, haben sie dem König der Schweden zu verdanken, leider hat Gustav Adolf seinen Sieg nicht überlebt. Und fast zwei Jahrhunderte später kämpften preußische und russische Truppen genau hier gegen Napoleon, der gar nicht mehr gut aussah, seit er Moskau verlassen hatte. Er nannte es Rückzug, man könnte auch von einer Flucht sprechen. Seine beklagenswerte Armee befand sich längst in latenter Auflösung und war ohnehin zahlenmäßig unterlegen an diesem 2. Mai 1813. Und doch gelang es: Napoleon siegte. Leider war es das letzte Mal. Die Geschichtsbücher sprechen von der Schlacht bei Lützen.
Lützen? Es ist ungerecht, dass jedes Geschichtsbuch den Namen dieses Kleinstdorfes kennt, während es Pobles oder Röcken beharrlich verschweigt, dabei liegen sie auch gleich nebenan. Die Schlacht hätte ebenso die »Schlacht von Lützen« oder die »Schlacht von Röcken« heißen können. Noch im selben Frühjahr war Napoleon besiegt, in der Völkerschlacht bei Leipzig, und im Oktober wurde Carl Ludwig Nietzsche geboren.
Er würde nicht von Folgerichtigkeit sprechen, und doch neigt Carl Ludwig Nietzsche durchaus dazu, beim Gedanken an die temporäre Gleichursprünglichkeit seiner selbst und des Endes Napoleons eine gewisse welthistorische Befriedigung zu fühlen. Als er die Weltbühne betrat, war die Weltordnung wiederhergestellt, die alte Ordnung also, und jede Ordnung ist eine alte Ordnung, sonst wäre es keine Ordnung, und er, Carl Ludwig Nietzsche, würde sie, so gut er konnte, bewahren. Nieder mit der Revolution! Freiheit? Gleichheit? Brüderlichkeit? Es sind Illusionen. Einzig in Gott ist dieser Dreiklang möglich, nicht auf Erden.
Carl Ludwig Nietzsche mustert die Damengesellschaft. Kein Zweifel, sie sehen Getreidefelder, keine Schlachtfelder. Frauen haben kurze Gedanken, wird sein Sohn einmal vermuten. Und haben sie denn nicht recht? Dieser Sommertag weiß nichts vom Sterben. Die Welt riecht nicht nach Blut, sondern nach Kornfeldern und Ernte, näherhin riecht sie nach Kuchen und Kaffee. Die Tafel ist gedeckt.
Alle üben sich, so gut sie können, in der Kunst, mit möglichst vielen Worten möglichst wenig zu sagen. Man nennt das auch Konversation, gehobene Konversation, denn ohne eine gewisse Bildung kommt man in dieser Disziplin nicht weit. Vielleicht haben die drei unverheirateten Schwestern das Fränzchen ermahnt, in jedem Fall den Mund zu halten. Denn alles, was man in Gegenwart feiner Leute sagen kann, ist das Falsche, es ist eine merkwürdige Erfahrung, und das Kind müsse sie in ihrer aller Interesse nicht unbedingt heute machen. Nichts schockiert vornehme Menschen so sehr wie eine deplatzierte Natürlichkeit, und ist nicht jede Natürlichkeit deplatziert?
Die Mutter Franziska Nietzsche mit achtzehn Jahren
Die Teller werden abgeräumt. Alle sind froh, dass nun die Musik beginnt, denn ab jetzt ist Schweigen unverfänglich, ja erwünscht. Carl Ludwig Nietzsche weiß, was man von ihm erwartet. Mit feierlicher Bewegung nimmt er in seinen Superfeine-Welt-Kleidern am Klavier seines Amtsbruders Platz.