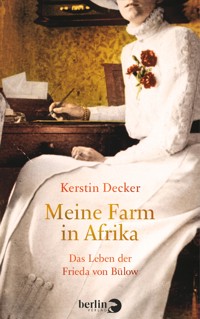Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schwäne, Riesenwürmer. Auch Pferde. Hunde aber hat Richard Wagner nie auf die Bühne gebracht. Und doch waren sie seine treuesten Begleiter. Oder müsste man sagen: Richard Wagner war der treueste Begleiter seiner Hunde ? Niemand kannte den Komponisten besser als Robber, Peps, Pohl und die anderen. Höchste Zeit, ihre Meinung zu hören. Kerstin Decker begegnet ihrem Gegenstand mit bewundernder Ironie. Denn Wagners Hunde – meist Neufundländer oder Jagdhunde, die es an Statur mit dem Chef aufnehmen konnten – fuhren mit ihm über die tosende See nach Paris, sie teilten sein Exil in der Schweiz und fanden am Ende ihre Ruhestatt neben ihrem Meister in Bayreuth. Richard Wagners Leben aus vierbeiniger Perspektive – das gab es noch nie. »Das lustigste Wagnerbuch hat Kerstin Decker geschrieben.« Elke Heidenreich, Die Welt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Decker
Richard Wagner
Mit den Augen seiner Hunde betrachtet
BERENBERG
Vorwort zur Neuausgabe
Vorbemerkung
ROBBER ODER »DER FLIEGENDE HOLLÄNDER«
Achderarmehund
Die Selbstberufung
»Sandwike ist’s …«
Rule Britannia!
In der Rue de la Tonnellerie
Wir schließen!
PEPS IM VENUSBERG
Eine Hundekindheit
Richard! Freiheit! Santo spirito cavaliere!
Hund und Revolution
»… nicht Hund, nicht Vogel will ich wiedersehen …«
Papos Liebestod
Die Wanderung und der Philosoph
Die Queen grüßt Peps
TRISTAN, EIN LEBENSMÜDES PFERD UND LEO, DIE BULLDOGGE
»Wagner ist ein böser Mann!«
Das tote Huhn von Venedig oder Tristan, II. Akt
Der neue Mieter
Ein Teppich für Leo
ZWEI ALTE JAGDHUNDE AUF DER FLUCHT
Weißer Pudel im Schinderkarren
Der Diebstahl
Wotans Abschied
»Ach wir armes Material des Weltdämons!«
Das Schiff …
… geht unter.
DIE NIBELUNGEN IN DEN RABATTEN DES KÖNIGS
»R. W. seinem Pohl«
Das Geschenk
Wotan schlägt kein Rad mehr
Ich glaube nicht an Arthur Schopenhauer!
Epilog oder Karfreitagszauber
Literatur
Anmerkungen
Über die Autorin
Wir sind allein,
völlig allein auf diesem Planeten.
Von all den Lebensformen um uns herum
hat sich außer dem Hund
keine auf ein Bündnis mit uns eingelassen.
Maurice Maeterlinck
Vorwort zur Neuausgabe
Dieses Buch entstand vor zehn Jahren, auch zur Überraschung der Autorin. Man kann sich vornehmen, eine Untersuchung »Richard Wagner und die Tiere« zu schreiben, aber der Vorsatz, das Leben eines Menschen aus dem Blickwinkel seiner Hunde zu erzählen, scheint mehr als vorwitzig. Eine Arbeit über das Verhältnis zwischen Wagner und Nietzsche führte mich tiefer und tiefer in Werk und Leben des Komponisten. Und so wie es Kollateralschäden gibt, gibt es wohl auch Kollateralgewinne, Lesefrüchte. Leider waren sie nicht zu ernten. Jedes Mal sagte ich mir: wie schade! Diese Augenblicke häuften sich, bis die Idee zum Buch plötzlich vor mir stand. Und der Verleger Heinrich von Berenberg fragte nicht etwa: »Was ist denn das für ein hochabsurder Plan?«, sondern er sagte: »Das machen wir!«
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass unsere Gegenwart Richard Wagner zum Verweilen eingeladen hätte, er hätte sich wohl mit Schaudern abgewandt, aber in einem Punkt wäre er mit den Heutigen bestimmt einverstanden: Es ist die Wahrnehmung der Tiere als Mitgeschöpf, eingetreten auf dem Höhepunkt der Entfremdung. Denn die lang gewohnte Unterscheidung zwischen bloßem Schlachtvieh auf der einen und verwöhntem ersatzmenschlichen Haustier auf der anderen Seite sprach nicht für uns.
Der Hund nimmt hier natürlich eine Sonderstellung ein, weil er seit unvordenklicher Zeit Gefährte des Menschen war, im Grunde gar nicht anders gedacht werden kann. Darum habe ich die wunderbare Sentenz von Maurice Maeterlinck vorangestellt: »Wir sind allein, völlig allein auf diesem Planeten. Von all den Lebensformen um uns herum hat sich außer dem Hund keine auf ein Bündnis mit uns eingelassen.« Die Übrigen brauchen uns nicht, auch wenn der Mensch sie zu »Haustieren« gemacht hat, der Mensch, der König der Haustiere.
Typische Kennzeichen der Haustiere sind unter anderem kleinere Gehirne, Ringelschwänze und Schlappohren. In unserem Fall hat die Natur den Schwanz gleich ganz weggelassen, bei den Ohren war sie scheinbar rücksichtsvoller, doch im Vergleich zum übrigen Tierreich hören wir ohnehin fast nichts.
Richard Wagner würde es gewiss begrüßen, dass Tiere im Bürgerlichen Gesetzbuch heute nicht mehr als Sachen gelten, obgleich der geänderte Paragraph 90a munter fortfährt: »Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften … anzuwenden.« Wenn nichts anderes bestimmt ist. Wenn nichts anderes bestimmt ist, macht das Recht im Scheidungsfall noch immer keinen Unterschied zwischen Hund und Standmixer. Andererseits verfassen Professoren bereits Bücher mit Titeln wie »Politische Philosophie der Tierrechte« und schließen sich Initiativen an, die »Grundrechte für Delfine« fordern – immerhin rufen die einander mit Namen. Menschenrechte für Delfine also, für Menschenaffen, aber auch für Hausschweine und Schafe: Selbst wenn man ihnen die aktiven Bürgerrechte wie Wahl-, Versammlungs- und Redefreiheit nicht zugestehe, wären doch schon die passiven Bürgerrechte von Gewicht, etwa das Recht auf leibliche und geistige Unversehrtheit. Natürlich lassen sich Kantianer das nicht gefallen; sie argwöhnen, dass eine »moralische Gemeinschaft, die die Schafe egalitär den Menschen gleichstellen würde, moralisch pervers wäre« (Ernst Tugendhat).
Professoren! Mag sein, der Komponist hätte spätestens an diesem Punkt die Diskussion verlassen, er kannte die Kantianer seiner Zeit. Kein Kantianer würde jemals dem Mitleid Zutritt zu den Fundamenten seiner Ethik gestatten, alles Natürliche ist ihm fremd, und zwar a priori. Wie anders dagegen Wagner. Eine Urszene seiner Kindheit wird im Buch nicht berichtet, schon weil es später einsetzt, und doch entscheidet sie vieles:
Was anfangen mit jungen Hunden, wenn kein Platz ist für sie auf Erden? Zumindest nicht in Eisleben. Zumindest nicht auf dem Hof dieser braven Eislebener Bürger. Man wirft die Weltneulinge in einen Sack und den Sack in den Teich nicht weit vom Marktplatz. Der Achtjährige sah es. Mag sein, er wollte weglaufen und blieb doch stehen. Mag sein, er schrie, es änderte nichts. Vielleicht haben die Teichmörder aus Zartsinn noch einen Stein mit in den Sack gelegt. Damit es schneller vorbei ist. Es war nicht schneller vorbei, denn der innerstädtischen Pfütze fehlte es an Tiefe. Der Achtjährige sah alles. Sollte er wirklich zu der schauerlichen Gattung am Wasser zählen? Mag sein, die Umstehenden haben über die Verzweiflung des Jungen gelacht und etwas von Erwachsenwerden gesagt.
Die Szene am Teich 1821 traf auf eine Innenmembran, die noch nicht durch Gewöhnung vernarbt, noch nicht unempfänglich geworden war durch Wiederholung. Aber ist das im Fall Richard Wagners überhaupt eine richtige Wahrnehmung? Schließlich besaß er eine jener seltenen Seelen, die solche Selbstschutzmechanismen nie entwickeln.
Vielleicht hätte der Achtjährige Trost bei Rousseau gefunden, hätte er die »Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen« gelesen. Der Autor glaubt an »zwei der Vernunft vorausgehende Prinzipien …, deren eines das brennende Interesse an unserem Wohlergehen und unserer Selbsterhaltung ist, während das andere uns eine natürliche Abneigung einflößt, ein fühlendes Wesen und vornehmlich unseresgleichen zugrunde gehen oder leiden zu sehen«. So ist das in jeder Kindheit, so war das in Rousseaus Naturzustand, den wir zu unser aller Unglück verlassen haben. Man wird einmal von der »Grundhärte der bürgerlichen Gesellschaft« sprechen, die diese auch von ihren ordentlichen Mitgliedern verlangen muss. Richard Wagner wird sie nie entwickeln. Er hat den Eislebener Hundemord nie vergessen. Vielleicht wusste er schon damals, dass er auf diesem Stern und unter seinesgleichen nie ganz zu beheimaten sein würde.
Die Musik ist ein guter Weg, bei äußerer Anwesenheit auf Erden zugleich ganz woanders zu sein. »Der Schlaf ist die Nabelschnur, durch die das Individuum mit dem All zusammenhängt«, hat Friedrich Hebbel gesagt. Auch der Schlaf ist ein Zustand offenkundig verweigerter Präsenz, und vielleicht wäre Hebbel einverstanden gewesen, sein Wort über den Schlaf auf die Musik auszudehnen. Auch Musik ist Beheimatung im All, sie besitzt fast immer, das ist oft bemerkt worden, den Doppelcharakter von Ausfahrt und Heimkehr. Ihrer weltzugewandten Seite entspricht die weltabgewandte. Aber weltabgewandt wohin? Nach oben natürlich, immer hinauf zum Vater, zum Licht, zur Empore der Engelschöre, plädieren wohl alle traditionell gestimmten Geister. Bei Wagner ist das anders, jeder »Tristan«-Hörer weiß das. Das All ist die Nacht des kreatürlichen Eins, es ist die Schwebewelt des Mutterschoßes, das tönende Ur-Meer, aus dem wir alle kommen, der Mensch und seine Mit-Tiere. Keiner hat dem zuvor Töne gefunden wie er.
Kerstin Decker,
Berlin-Treptow im Januar 2023
Vorbemerkung
»Geschichte meiner Hunde« sollte das Buch heißen, das Richard Wagner nicht mehr beginnen konnte. Vielleicht hätte er berichtet, worauf die Musikwelt nie kam: dass Richard Wagner ohne seine Hunde gar nicht Richard Wagner geworden wäre.
Ohne die katastrophale Schiffsreise von Pillau nach London kein »Fliegender Holländer«. Zweimal stand der kleine Ostseeschoner »Thetis« im Begriff, statt London direkt den Meeresgrund anzulaufen. Der Rigaer Kapellmeister würde diese werkbegründende Seefahrt niemals unternommen haben, wenn Robber, der Hund, nicht darauf bestanden hätte, ihn zu begleiten. Denn auf die Frage, wie man eine Kutsche so umbaut, dass außer den zahlenden Reisenden auch noch ein Neufundländer hineinpasst, fand selbst Richard Wagner keine befriedigende Antwort. Er las es in den Gesichtern der Mitreisenden: Sie würden von Russland nach Paris laufen müssen.
Und wie hätte er ohne den Zwergspaniel Peps herausfinden sollen, dass E-Dur die Tonart der natürlichen Liebe, Es-Dur aber die der göttlichen Liebe ist? Bei E-Dur spannte sich jede Faser seines kleinen Körpers, bei Es-Dur wedelte er etwas schläfrig mit dem Schwanz. Wagner sang und spielte Peps alles vor, was er komponierte. Und Peps und Robber sind nur die ersten beiden von Richard Wagners Hunden.
Dieses Buch blickt auf den Jahrhundertkomponisten aus der Sicht derer, die ihn am besten kannten. In Nebenrollen treten ein Pferd, zwei Papageien sowie die Pfauen Wotan und Fricka auf. Überhaupt, das Geflügel. Über ein soeben geköpftes Huhn nachzudenken, konnte Richard Wagner zur ästhetischen Grundlagenreflexion geraten: Dieses Mitleiden erkenne ich in mir als stärksten Zug meines moralischen Wesens, und vermutlich ist dieser auch der Quell meiner Kunst. Weil der wahre Musiker jemand ist, der gar nicht an das Unbeseelbare, an das Stumm-sein-Müssen glauben kann?
Nicht die große Geste ist der Schlüssel zu Wagner, es ist die kleinste.
Dieser Musiker komponiert die Einheit alles Seins, und die meinende Sprache ist ihm nur eine unter vielen und ganz sicher nicht die höchste. »Da ist ein Musiker, der mehr als irgend ein Musiker darin seine Meisterschaft hat, die Töne aus dem Reiche leidender, gedrückter, gemarteter Seelen zu finden und auch noch den stummen Thieren Sprache zu geben«, hat Friedrich Nietzsche gewusst.
Aller geschöpfliche Hochmut gegenüber dem vermeintlich vernunftlosen Tier ist Richard Wagner fremd. Nicht nur als Komponist, auch als Hundebesitzer war er wohl einzigartig. Schon gegen das Wort hätte er sich verwahrt: Man besitzt keine Tiere! Es wäre ihm, dem Anwalt der geprügelten Droschkenpferde Europas, dem ersten Kritiker der Tiertransporte (Hühner und Enten auf dem Lago Maggiore) wie eine Demütigung des Hundes erschienen. Wer seinen Hund nicht besitzt, kauft ihn natürlich auch nicht. Es ist eine zu willkürliche Art der Bemächtigung. Andererseits hatte Wagner das auch gar nicht nötig, denn egal, wo er auftauchte, wechselten die Hunde freiwillig ihre Herrn.
Und sie zu verkaufen? Den Neufundländer Robber zu veräußern, hätte ihm aus der ärgsten Pariser Not geholfen, und wovon das Tier ernähren, das mehr fraß als er und so wenig natürliche Anlagen zum Vegetarismus besaß? Allein, es war undenkbar.
Richard Wagner glaubte, seine Biographen müssten ihn zwangsläufig verfehlen. Denn sie würden ihn mit dem verwechseln, der sein Leben lebte, dieses viel zu volle, überbordende Leben.
Es gibt wohl wenige Menschen, deren Geschichte sich erzählen lässt, indem man die Geschichte ihrer Hunde schreibt, und plötzlich verschieben sich die Relationen, wechseln Vorder- und Hintergründe. Es ist ein Vorurteil der Biographen, zu glauben, bei den jeweils Nächsten eines Menschen handele es sich wiederum um Menschen.
ROBBER ODER »DER FLIEGENDE HOLLÄNDER«
Achderarmehund
Vor der Tür des sechsundzwanzigjährigen Rigaer Kapellmeisters liegt ein großer schwarzer Hund, ein Riese selbst unter den Neufundländern. Er ist viel schöner als ich, sagt der Kapellmeister. Und stärker ist er wohl auch. Wie vermisst er seinen Namen. R-o-b-b-e-r. Aber wenn andere ihn rufen, hört er es fast nicht. Sie nennen ihn ohnehin kaum noch Robber, nur Achderarmehund. Achderarmehund, sagen die Nachbarn. Achderarmehund, sagt der Hauswirt.
Robber wartet.
Er durchwartet die Tage, er durchwartet die Nächte. Im Umgang mit den Menschen, das weiß er, helfen nur Nachsicht, Geduld und Beharrlichkeit. Es hat lange gedauert, bis der Kapellmeister einsah, dass dieser Hund sein Hund war. Er konnte es unmöglich wieder vergessen haben.
Vielleicht hatte Richard Wagner irritiert, dass Robber dem Kaufmann Armistead gehört. Von ihm hat er auch seinen fremden Namen: Robber. Räuber. Aber ein Hundeleben ist viel zu kurz, um es bei einem Herrn zuzubringen, der nicht zu einem passt. Wie der Kaufmann Armistead.
Der mündige Hund wählt seinen Herrn selbst. Ein späterer Freund des Kapellmeisters würde einmal die ganze Philosophie des Abendlandes überprüfen, um am Ende einen kategorischen Imperativ einzuführen: Folge nicht mir, folge dir nach! – Aber das tat er doch jetzt schon. Darum musste er den Kaufmann verlassen. Außer sich selbst folgte er nun auch dem Kapellmeister nach, und das war nicht Nachlässigkeit oder Schwäche, das war Konsequenz.
Bisher kannte der Kapellmeister nur Pudel, wenn wir von seinem Versuch absehen wollen, einen jungen Wolf zu zähmen, der allerdings die Gemütlichkeit unsres häuslichen Lebens, wie sein Besitzer bald einsah, nicht vermehrte. Die Tatsache wog umso schwerer, da seinem häuslichen Leben von Anfang an eine entschiedene Tendenz zum Ungemütlichen innewohnte, was nicht zuletzt am Temperament des Ehemannes und seiner Begabung zur Eifersucht lag. Allerdings hatte er Gründe, denn seine Frau war schon zweimal mit ihrem Liebhaber geflohen. Kurz: Pudel waren besser.
Der erste hörte auf den Namen Rüpel, sonst hörte er eigentlich nicht; die beiden anderen hießen Dreck und Speck, waren schwarz wie Robber, hatten aber schneeweiße Nasen. Pudel sind ein Irrtum, weiß Robber. Richard Wagner hat keine Pudelseele. Wenn einer unter allen Einwohnern Rigas eine Neufundländerseele besitzt, stark und schön wie die seine, dann der Kapellmeister.
Ging er aus dem Haus, war Robber schon an seiner Seite. Ging er zurück ins Haus, blieb er davor und wich keinen Schritt. Der Erwählte nannte das förmliche Belagerung.
Ich lieg’ und besitz’, lasst mich schlafen, wird später ein zum Lindwurm gekrümmter Riese in seiner längsten Oper sagen, im »Ring«. Genauso war das schon jetzt. Aber Robber versperrte die Tür vor allem, damit der Inhaftierte genug Muße hatte, nachzudenken. Etwa darüber, dass man Erwählungen nicht ablehnen kann. Vielleicht auch darüber, ob es möglich ist, so viel zu dirigieren wie sein Hund frisst. Aber das würden sie zusammen tun.
Was heißt, ein Hund gehört nicht auf eine Orchesterprobe? Ein Blick hatte genügt, um zu wissen, worauf es hier ankam. Mit einem lächerlich kleinen Stab versuchte sein armer Herr, eine ganze bewaffnete Meute zusammenzuhalten. Was hier fehlte, war er, erkannte der Hund und postierte sich mit finsterer Entschlossenheit neben dem Dirigentenpult. Gemeinsam würden sie die Widerstrebenden in Schach halten. Er achtete vor allem auf die Kontrabässe, die waren am bedrohlichsten. So war es gewesen.
So würde es sein. Sie würden wieder gemeinsam dirigieren. Er musste nur warten können. Der Kapellmeister hat ihn beim Namen gerufen, er ist sein Hund. R-o-b-b-e-r. Manchmal möchte er fast aufspringen, meint er den vertrauten Schritt, die vertraute Stimme schon zu hören, aber dann ist es jedes Mal nicht wahr. Es sind Dämmertage. Der Hund träumt. Der Kapellmeister ruft nicht mehr.
Warum öffnet sich diese Tür nie? Weil er nicht drin ist, natürlich. Sind Belagerungen nur dann welche, wenn der zu Belagernde zu Hause ist? Damals war er gefangen, jetzt ist die Wohnung bald leer. Robber hat selbst gesehen, wie Hausrat hinausgetragen wurde. Aber was heißt das? Er ist da!, verrät noch immer jede Nachforschung seiner Hundenase. Er muss warten. Es ist Juni, es ist unerträglich heiß. Und er ist ein Badehund, sogar im Winter. Nie ist er mit dem Kapellmeister in die Stadt gegangen, ohne im Festungsgraben zu schwimmen. Neufundländer gehören zu den Amphibien. Er hat schon lange nicht mehr gebadet.
Achderarmehund! Der Hauswirt bleibt nachdenklich stehen. Und dann streichelt er ihn. Das heißt nur, wenn er es zulässt. Dem Tonfall nach zu urteilen, ist Achderarmehund! keine Beförderung. Robber weiß, wie Respekt klingt, so klingt er nicht. Aber was ist es dann?
Käme der Kapellmeister gleich wieder, er würde es an den Stimmen ringsum erkennen. Er hat ein sehr gutes Gehör für Töne. Der Kapellmeister sagt, er habe noch nie einen so musikalischen Hund gesehen. Und er hat ihn auch nie spüren lassen, dass er mehr fraß als er.
Hätte Robber den Kontrabassisten verschonen sollen? Er hört ihn noch schreien: »Herr Kapellmeister, der Hund!« Aber da war es schon zu spät. Nichts mehr zu machen. Ihn hatte der tückische Stock nicht täuschen können, zwar bewegte er sich meist langsam, aber immer in seine Richtung, und dann plötzlich wurde die Bewegung stärker. Das ist ein Bogen, sagen die Musiker, aber Stock bleibt Stock, und als er wieder vorschnellte, diesmal heftiger, aggressiver als vorher, sprang Robber los. Direkt auf den Kontrabass. Der Kapellmeister war verstimmt, ja, er war böse, obwohl er selbst erklärte, der Hund hätte recht gehabt: Der Bass sei zu schnell gewesen. Aber böse war er trotzdem. Meine vortreffliche Bestie, hatte er manchmal gesagt, und es war eine Zärtlichkeit gewesen. Jetzt ließ er das »vortrefflich« weg. Das machte Robber sehr traurig. Der lädierte Kontrabass war auch böse, wagte aber nicht, das zu zeigen.
Vielleicht sollten Sie, lieber Leser, wissen, dass wir Neufundländer keine gewöhnlichen Hunde sind. So wie der Kapellmeister, aber ich glaube, das wissen Sie, auch kein gewöhnlicher Kapellmeister ist. Wir sehen nur das ein, was wir wollen. In unserer tiefsten Neufundländerseele sind wir Anarchisten. Nur Anarchisten können wirklich treu sein. Gehorsam ist eine Eigenschaft von Kreaturen, keine von Neufundländern. Aber das mit dem Kontrabass war wirklich falsch. Ich beließ es seitdem bei Blicken, denen der Rekonvaleszente unmissverständlich entnehmen musste, dass das Vorgefallene jederzeit wieder geschehen kann.
Man kann seine Frau verlassen, vielleicht sogar seine Kinder, aber niemals seinen Hund. Herr und Hund. Ich habe schon angedeutet, dass diese Worte lächerlich sind, wenn von uns beiden die Rede ist. Und nicht nur, weil nicht der Kapellmeister sich einen Hund aussuchte, sondern der Hund sich einen Kapellmeister. Wie oft hat er mir gesagt, dass ich der einzige Mensch bin, mit dem man sich hier vernünftig unterhalten kann. Und dass er sehr allein sei: Von nirgends her trat mir eine auch nur im mindesten anregende Persönlichkeit entgegen,1 wird er später etwas unpräzise zu Protokoll geben, richtig lautet der Satz: Von mir abgesehen, trat ihm von nirgends her auch nur eine im Mindesten anregende Persönlichkeit entgegen.
Habe ich Sie erschreckt und Sie fragen sich, ob jetzt schon die Hunde beginnen, Sachbücher zu verfassen? Niemand kannte den Kapellmeister so gut wie wir. Und wir sind genaue Beobachter, zumal wir ebenjene kritische Distanz zu den menschlichen Dingen besitzen, die man von einem richtigen Sachbuch verlangen muss. Doch wir können auch, was den Menschen so schwer gelingt: einfach mal das Maul halten. Wir sind die idealen Co-Autoren.
Der Hund träumt. Nichts freut ihn mehr, nicht Fressen, nicht Baden, solange der Kapellmeister nicht zurückkehrt. Er wird warten. Einmal muss jeder nach Hause kommen.
Die Selbstberufung
Fünfundvierzig Kilometer vor Riga liegt Mitau, wo die Mitauer jetzt die Opern hören, die das Rigaer Theater schon im Winter spielte. Meyerbeers »Robert, der Teufel« gilt als Höhepunkt, aber der Kapellmeister hält das wohl bereits jetzt für einen fahrlässigen Irrtum des Publikums. Am 24. Juni 1839 muss er Beethovens »Fidelio« dirigieren, die Oper, die ihn zum Musiker gemacht hatte. Nie klang eine Rettung zarter und gewalttätiger zugleich. Und wenn er, kurz vorm Ende, der Trompete das Zeichen zu ihrem Freiheitsruf geben muss, wird es zugleich die Fanfare seiner eigenen Befreiung sein. Und nur er weiß es. Leonore befreit Florestan, er spricht sich selbst frei! Wenige Tage noch, und er ist weg!
Es gibt nur eine Schwierigkeit. Was er vorhat, ist mindestens so unmöglich wie die Flucht Florestans aus Roccos Kerker zu Beginn des ersten »Fidelio«-Aktes. Mit den Worten des Selbstretters aus der Knechtschaft des Rigaer Theaters: Er habe beschlossen, dem Brennpunkt des europäischen großen Opernwesens unmittelbar sich zuzuwenden.
Paris also.
Nahezu unmöglich ist das nicht nur wegen des Widerstands seiner Frau Minna, die ein gewisses Misstrauen dagegen hegt, ihre künftige Existenz auf etwas so Fragwürdiges wie das Genie ihres Mannes gründen zu sollen, näherhin auf zwei Akte einer noch nicht fertiggestellten Oper. Aber einen Namen hat sie schon: »Rienzi«. Sie ist in gewisser Hinsicht das Resultat eines Versuchs seiner Frau, ihn zu verlassen. Ja, es war kein bloßes Verlassen, es war eine genau geplante, hochdramatische Flucht. Alle Schränke und Schubladen hatte der damalige Königsberger Musikdirektor eines Mittags leer gefunden, als er todmüde, bleich und hungernd aus der Probe kam, augenblicklich war er noch bleicher, in seinen eigenen Worten: Den Tod im Herzen stürzte ich aus dem Hause, und er stürzte weiter Tausende Kilometer seiner fliehenden Frau hinterher bis nach Dresden, die gemeinsamen Hochzeitsgeschenke unterwegs zu Reisegeld machend, um Minna schließlich aus der Wohnung ihrer Eltern zu locken, die ihn am liebsten gar nicht erst eingelassen hätten. Damals füllten zwei Dinge seine Tage: Er überzeugte Minna, dass vor ihr eine große Zukunft an seiner Seite liege, und nebenbei las er den Roman des Briten Bulwer über Rienzi, den letzten der römischen Tribunen. Sollte in diesem Werk, wenn es erst Noten hätte, nicht der Keim des Ruhmes stecken, den er Minna versprochen hatte?
Wahrscheinlich erklärte er seiner Frau immer wieder, dass zur richtigen Oper nur noch die richtige Stadt fehle. Paris! Er konnte ihren Argwohn dahingehend beschwichtigen, dass er mit Paris »in Verbindung stehe«. In der Tat hatte er Meyerbeer, den Komponisten von »Robert, der Teufel«, dessen Erfolg sich umgekehrt proportional zu seiner Begabung verhält, wie der Bittsteller einmal glauben wird, von seiner Existenz in Kenntnis gesetzt. Er hatte sich auch mit generöser Geste an Scribe, den berühmtesten Operndichter weit und breit gewandt, von beiden jedoch nie eine Antwort erhalten, was ihn aber nicht bekümmerte, konnte er doch seiner Frau mitteilen, er stehe mit Paris in Verbindung. Außerdem hatte jener Scribe tatsächlich einmal seinem Schwager Avenarius geschrieben, und diesen Brief verschaffte sich der Kapellmeister, fest entschlossen, in die eigene Zukunft zu entweichen, zur Vorlage bei Minna: Selbst auf die keineswegs sanguinische Vorstellungsart meiner Frau wirkte dieser Scribesche Brief so bedeutend, daß die den Schrecken, mit mir sich zu dem Pariser Abenteuer aufmachen zu sollen, immer mehr zu überwinden vermochte.2 Das klang noch sehr vorläufig, um nicht zu sagen: widerstrebend, und wahrscheinlich wird erst die Rigaer Entlassung ihres Mannes ihre Zustimmung erzwungen haben, denn Kündigungen sind nur bedingt interpretierbar. Den Gekündigten hatte die Nachricht am meisten überrascht, doch beschloss er sofort, sie als Zeichen zu verstehen, und zwar als Vorzeichen, ja als Verheißung einer großen Zukunft, die sich seit seiner Rienzi-Lektüre nur etwas verzögert habe.
Dennoch lag ein weiterer Riegel vor dieser Zukunft, mindestens so groß wie jener vor Florestans Kerker. Um seine vergangenen und gegenwärtigen finanziellen Verhältnisse steht es nicht gut. Ein früher, einfühlsamer Biograph nennt deren Inhaber mit großer pekuniärer Sensibilität »den von aller Barschaft Entblößten« und beschreibt seine Kreditwürdigkeit wie folgt: »Mehrfache Schuld- und Wechselklagen aus dem drangvollen Königsberger Notjahr waren in seinem letzten Aufenthaltsorte gegen ihn geltend gemacht; auch einige Rigaer Kreditoren hinzugekommen.«3
Für Richard Wagner deutet das Ausmaß seiner Schulden vor allem auf die höchst ungleiche Verteilung des Geldes in der Welt. Eine Makelhaftigkeit, die der russische Staat ausdrücklich zu befördern gedenkt, denn bevor jemand das Zarenreich verlassen darf, muss er die Absicht seiner Entfernung dreimal in den öffentlichen Blättern kundtun, damit jeder, der noch Forderungen an ihn hat, diese auch stellen kann. Richard Wagner wird schon schwindlig, wenn er daran denkt; aber immerhin sind ihm aus jenem Königsberger Notjahr nicht nur Schulden geblieben, sondern auch die Bekanntschaft mit dem Kaufmann und Kunstfreund Abraham Möller, der dem Bedrängten überzeugend darlegte, dass der sicherste Weg, seine Schulden begleichen zu können, darin bestehe, in Paris ein reicher Mann zu werden und sie dann zu bezahlen. Nur die Reihenfolge zwischen Tilgung und Abreise würde sich also verändern, nicht aber die Absicht der Tilgung selbst. Dem Kapellmeister leuchtete das ein. Möller erbot sich, den illegalen Grenzübertritt so gut wie möglich vorzubereiten.
Natürlich ist die Sache nicht ganz ungefährlich, und wahrscheinlich ersparte der Kaufmann dem werdenden Flüchtling die Geschichte des Heldentenors Franz Mehlig, der das Gleiche ein paar Jahre zuvor versucht hatte, alle Gefahren überstand, um hernach in Folge der Aufregung an einem »hitzigen Nervenfieber« zu verscheiden. Vielleicht kannte Möller diese Geschichte auch gar nicht, außerdem würde es das erste Mal sein, dass er seine Fähigkeiten als Fluchthelfer auszuprobieren Gelegenheit findet.
Und Robber? Unmöglich. Richard Wagner weiß es. Wie mag er den Hund in den letzten Rigaer Tagen angeblickt haben. Wie oft mag er ihm erklärt haben, dass es seine, Richard Wagners Pflicht sei, dem eigenen Genie zu folgen. Die erste Tugend des Flüchtlings ist Unauffälligkeit, und was gibt es Auffälligeres als Robber? Und es ist nicht nur seine Größe und die Ernährungslage unterwegs, auch der Umstand, dass man einem Neufundländer nicht sagen kann, was er tun soll – eine Eigenschaft, die sein Herr sonst durchaus zu schätzen bereit ist –, macht ihn als Fluchtbegleiter nur bedingt tauglich. Wie oft hat er sich und dem Hund begründet, dass er ihn zurücklassen muss und doch nicht daran glauben wollen. Und nun ist er hier, in Mitau, ohne Robber, er, Richard Wagner, der Verräter. Und hält es kaum aus. Gut, dass er jeden Abend eine andere Oper dirigieren muss, er würde sonst noch zurück nach Riga fahren und den Hund holen. Also nicht denken! Dirigieren!
Er hatte schon immer Albträume.
Jetzt hat er sie auch verdient.
Und dann rast die schwarze Furie auf ihn zu, mit aller so lang zurückgestauten, ungenutzten Kraft, und wirft ihn fast um. Die Begrüßung dauert lange, wahrscheinlich ist anfangs unklar, ob der Begrüßte sie überleben wird. Und kein Laut, kein Blick des Vorwurfs. Das beschämt ihn. Der Rigaer Hauswirt hatte die Not des Tieres nicht mehr mit ansehen können und Robber mit der Post nachgeschickt. Der entlaufene Kapellmeister verspricht unter Tränen alles, was man bei solchen Gelegenheiten verspricht. Und er meint es so. Alles andere, das weiß er jetzt, wäre ein schrecklicher Irrtum gewesen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen! Und wenn es nach Paris ist. Entweder wir schaffen es zu dritt oder gar nicht, teilt er seiner Frau mit. Sie sieht ihn nachdenklich an. Und dann hören sie den Florestan-Ruf der Trompete.
Die meisten Menschen hören diese Trompete nie. Die meisten Menschen werden nie gerufen von sich selbst. Und so schauen sie auch. Die Mitreisenden besehen ungläubig das Gepäck und die Begleitung des Ehepaares. Müssen diese jungen Leute mit ihrem halben Hausstand verreisen? Und was heißt, der Hund muss in den Wagen? Was heißt hier überhaupt Hund? Ist das nicht eher ein Bär? Manche glauben, der Neufundländer sei entstanden, als die einheimischen Bären Grönlands sich mit den Hunden der vordringenden Wikinger paarten. Aber die Reisenden haben jetzt wenig Sinn für Stammbäume. Entweder der Bär steigt aus oder sie.
Richard Wagner versucht, die Kutsche umzubauen. Stumm blicken die Aufgehaltenen. Dann gibt er endgültig auf, das Tier muss neben dem Wagen herlaufen. Der Kapellmeister wagt nicht, aus dem Fenster zu sehen. Das braucht er auch nicht, denn er hört seinen schweren, hechelnden Atem. Natürlich, Neufundländer sind Lasttiere. Sie zogen den Fischern ihre Schlitten, voll beladen mit Holz für den Winter. Aber genau das ist es: Auf »Winter« liegt die Betonung; der Neufundländer ist ein Winterhund, auf Neufundland ist immer Winter, gewissermaßen. Und jetzt ist Sommer, kurländischer Sommer. Der Kapellmeister erträgt Robbers Anblick nicht. Lieber läuft er selber neben dem Wagen. Und dann lässt er, auf das äußerste gebracht, wieder anhalten. Es folgen erneute ingeniöse Einfälle. Über die Gemütsverfassung der Mitreisenden ist nichts überliefert. Am Ende ist Robber im Wagen, vielleicht schon fast so wie später in London: Kopf und Vorderbeine ragen zum einen Fenster hinaus, Schwanz und Hinterbeine zum anderen.
Wagner hat inzwischen viel Zeit, darüber nachzudenken, welche Strecke noch vor ihnen liegt. Ob die Polen, die Preußen, die Westfalen, die Holländer, die Franzosen auch so tolerant sein werden? Toleranz ist ein anderes Wort für Leidensfähigkeit.
Sie werden nach Paris laufen müssen.
Am Nachmittag des zweiten Tages steigen sie aus; die belästigte, nun tief Luft holende Reisegesellschaft fährt weiter auf der Hauptstraße Richtung Tauroggen; auf die Zurückbleibenden wartet Fluchthelfer Abraham Möller mit seinem kleinen Wagen. Sie nehmen Umwege, um Spuren zu verwischen. In einer schmutzigen Kneipe, die sich nach Sonnenuntergang mit polnischen Juden füllt, warten sie auf das Zeichen zum illegalen Grenzübertritt, da ist Möller schon wieder weg.
Die preußisch-russische Grenze ist ein Graben, an dem alle tausend Schritt ein Wachhäuschen steht, bemannt mit einem Kosaken; zwischen den Häuschen patrouillieren Wachen, um aufzupassen, dass die Kosaken nicht einschlafen und niemand über den Graben springt. Die Chance liegt darin, die Grenze genau in dem Augenblick zu überqueren, wenn die Patrouille nachschaut, ob der Kosake noch wach ist. Und wenn nicht, würde ihn Robber schon aufwecken.
Robber, und das weiß sein Besitzer genau, ist nicht nur ein Hund, den man nicht übersieht, sondern auch einer, den man nicht überhört.
Die Ankunft eines jungen Ehepaares mit unglaublich viel Gepäck und einem unglaublich großen Hund mehrere Tage später in der kleinen ostpreußischen Hafenstadt Pillau belegt, dass die russisch-preußische Grenze nicht feucht gewesen sein kann, denn andernfalls hätte Robber kaum darauf verzichtet, im Graben zu baden. Es war ihm gelungen, was ihm nie wieder gelingen würde: sich so zu verhalten, als wäre er gar nicht da. Mit den Worten seines Herrn: Ich hatte … zu meiner seltsamen Freude das intelligente Verhalten Robbers beobachtet, welcher, als ob er die Gefahr gewahrte, sich lautlos an uns geschmiegt hielt.4 Von so viel Selbstverleugnung wird er sich ab sofort erholen.
Richard und Minna Wagner sind selbst überrascht, in Pillau zu sein. An diese Stadt hatten sie nie gedacht, ebenso wenig wie mit dem Schiff nach Paris zu fahren. Aber ein Schiff ist geräumiger als eine Kutsche, und wenn sie nicht nach Paris laufen wollen, das war ihnen inzwischen klargeworden, empfiehlt sich der Wechsel des Transportmittels.
Das Schiff heißt »Thetis«. Seine Maße sind bereits beschrieben worden; es ist tatsächlich ein wenig größer als eine Kutsche; der werdende Seefahrer nennt es von kleinstmöglicher Gattung, es ist gute fünfundzwanzig Meter lang. Segler wie dieser verkehren gewöhnlich zwischen den Ostseehäfen, aber die »Thetis« will, den Bauch voller Hafer und Erbsen, nach London. Wahrscheinlich ist die Reederei der Ansicht, es ist Sommer, auch auf der Nordsee, und am Bugspriet sänftigt Thetis die Fluten, ganz aus Holz, selbst wenn Nymphen wie sie eher auf Teiche und andere friedliebende Gewässer spezialisiert sein sollten.
Eine letzte Nacht im Pillauer Gasthof und dann eine letzte Mahlzeit an Land, solange ihr Magen noch wissen würde, wo oben und unten ist.
Was für ein Bild des Friedens. Lange, schon gedeckte Tische, und am Fenster steht die Wirtin und füllt gekochtes Obst in eine lange Reihe von Gläsern. Aber noch das vollkommenste Bild irdischer Eintracht hat einen kleinen Sprung, auch in diese tiefste Ruhe dringt nun ein Misston: Der Hauskater faucht den Hund an und flieht über alle Tische. Die Kollateralschäden sind gering. Der Hund stürzt ihm nach, und nun kann von Kollateralschaden nicht mehr gesprochen werden, es handelt sich, das begreifen Richard und Minna Wagner sofort, um einen Totalschaden.
Wenn einer große Ziele verfolgt, bereitet das manchmal viel Ungemach, auch Richard Wagner weiß das, wenige wissen das besser als er, und nein, noch ist Robber dieser lächerliche Pillauer Stubenkater nicht entwischt. In seiner Verzweiflung springt dieser auf den Obsttisch der Wirtin und durch den offenen Fensterspalt ins Freie. Der Hund hinterher. Die Arbeit der Frau findet ein jähes Ende und erfüllt binnen Augenblicken alle Kriterien der Vergeblichkeit.
Robber splittert durch die Scheibe.
Das Ehepaar Wagner steht gelähmt vor Entsetzen, dann spürt es, einander anblickend, einen jähen Fluchtimpuls.
Sie haben knapp hundert Dukaten.
Von den weniger als hundert Dukaten müssen sie die Reise bezahlen – blinde Passagiere reisen billiger – und den Aufenthalt in Paris, bis der Mann mit Hund reich und berühmt ist. Sie können hier unmöglich Totalschadensersatz leisten, sie greifen ihr Gepäck, das, was sie davon fassen können, und stürzen aus dem Gasthof.
Das Reisen als blinder Passagier ist zwar kostengünstig, aber nicht wirklich komfortabel. Zuerst muss die Hafenwache überlistet werden, um überhaupt in die Nähe des Schiffs zu gelangen. Nur gewöhnliche Seefahrer gehen über eine Brücke an Bord, die anderen müssen versuchen, die Rückwand zu erreichen, und warten, ob sie jemand hinaufzieht. Die Wand der »Thetis« ist sehr steil und erstaunlich hoch für ein Fahrzeug der »kleinstmöglichen Gattung«; Richard Wagner spürt jedes Kilo Robbers einzeln, als sie auch diese Fuhre nach oben hieven.
Jedes Schiff verfügt über sein Nibelheim, und dorthin, in die Nacht des Schiffsbauchs, ins Kabelgatt werden sie sofort verbannt. Die Hafenaufsicht erscheint an Bord. Man habe nur Hafer und Erbsen geladen, versichert der Kapitän, die drei größten Erbsen erwähnt er nicht, und die Inspektion findet auch nichts.
»Sandwike ist’s …«
Am 19. Juli 1839 verlässt die »Thetis« den Pillauer Hafen, in acht Tagen gedenkt man London zu erreichen, und Richard Wagner beginnt ein Dasein, wie es auch die Teilnehmer zeitgenössischer Kreuzfahrten kennen. Die Besatzung arbeitet, während er an Deck flegelt und George Sands »La dernière Aldini« liest, um bei dieser Gelegenheit etwas Französisch zu lernen. Neben ihm flegelt sein Hund. Leider herrscht vollkommene Windstille, und auch die »Thetis« flegelt auf dem Meer. Schwer zu sagen, ob Robber schon jetzt den Matrosen Koske ins Auge fasst. Die Besatzung besteht aus dem meineidigen Kapitän Wulff, fünf für die Nachwelt auf ewig Namenlosen und dem unglücklichen Koske, einem älteren, schweigsamen Matrosen aus einem großen Pillauer Matrosengeschlecht. Nach sieben Tagen ist London zwar noch nicht in Sicht, aber dafür Kopenhagen. Der gekündigte Kapellmeister passiert Helsingør, denkt Gedanken der Form »Shakespeare und ich« und ist im Übrigen der Meinung, dass ein richtiger Sommer und eine richtige Seefahrt zusammengehören.
Kurz darauf denkt er das nicht mehr, streng genommen denkt er überhaupt nichts mehr. Am 27. Juli erhebt sich im Skagerrak ein furchtbarer Sturm. Noch im Jahr 1885 wird der bayerische Taschenkalender des legendären »Seesturms von Sandwike bei Arendal« im Jahr 1839 gedenken. Wie er klingt, wenn er sich in der Takelage der »Thetis« verfängt, hört noch heute jeder im »Fliegenden Holländer«. Was er nicht hört, ist das, was sich in der Kajüte des Kapitäns ereignet. Dort liegen der seekranke Kapellmeister, seine seekranke Frau und sein seekranker Hund. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, aber das weiß streng genommen keiner mehr. Immerhin sind sie hier ungestört, denn der Kapitän will bei diesem Wetter nicht schlafen. Oder besser: Sie könnten ungestört sein, kämen nicht die Matrosen in regelmäßigen Abständen hinunter, und dann muss Richard Wagner aufstehen, was ihm nur mit größter Mühe gelingt. Unter seiner Bank ist das Branntweinfass. Alle Rettung, scheint die Besatzung zu glauben, ist, wenn überhaupt, dann in diesem Fass.
Am häufigsten erscheint Matrose Koske, Richard Wagner hört es schon, bevor er in der Tür steht, denn Robber beginnt zu wüten, wenn er nur Koskes Schritt hört. Die anderen lässt er trinken, aber Koske gegenüber verteidigt er das Fass, als gelte es sein Leben. Und Koske muss an das Fass, als gelte es sein Leben. Der fast schon ohnmächtige Zeuge könnte jetzt einwenden, dass sie ohnehin gleich alle auf dem tiefsten Meeresgrunde ruhen würden, gleichgültig ob durstig oder nicht durstig, weshalb man den Dingen nicht vorgreifen solle. Doch zu solchen Stellungnahmen fehlt ihm die Kraft; später gibt er zu Protokoll, dass Robber den armen Matrosen mit stets erneueter Wut anfiel, sobald er die enge Treppe herabgeklettert kam, was mir, dem von der Seekrankheit gänzlich Erschöpften, jedesmal eine mein Übelbefinden zu den bedenklichsten Katastrophen steigernde Anstrengung abnötigte.5 – Da kommt der Kapitän auf die Idee, statt den Grund des Meeres direkt anzulaufen – das wird der »Thetis« erst Jahre später gelingen – zuerst einen Hafen aufzusuchen.
Der Kampf um den Branntwein endet, der Kapellmeister schleppt sich an Deck, um mit eigenen Augen das zu sehen, worauf er schon nicht mehr zu hoffen wagte: Felsen, ganz weit weg in der Ferne. Wunderbar raue, schroffe, unbedingt tödliche und doch heimatliche Felsen, Land eben. Noch glaubt er, es ist eine Felsenkette, aber als sie näherkommen, erfährt er es anders. Kuppe um Kuppe taucht aus dem Meer auf, an ihnen vorbeigesegelt, erkannten wir, daß wir nicht nur vor uns, wie zur Seite, sondern auch im Rücken von diesen Riffen umgeben waren, welche sich hinter uns wieder … zusammendrängten. Es ist Sandviken, nordöstlich von Arendal. Der Sturmwind bricht sich an den zurückgelassenen Felsenkegeln, und je weiter sie fahren in diesem Labyrinth – längst führt ein einheimischer Lotse das Steuer –, umso stiller ist es.
Der Fjord wird zum Dom.
Der Gerettete könnte, was er erfährt, auch innerweltliche Transzendenz nennen. Die einen machen eine Seefahrt, um das zu erleben, andere besuchen etwas später vorzugsweise Wagner-Opern.
Er hört, wie sich der Ruf der Matrosen an den Felswänden bricht. Er versteht die plattdeutschen Worte nicht – Schunerseil – riet em daal!, Schonersegel – reißt sie nieder! –, aber er weiß auch so, was sie bedeuten: Der kurze Rhythmus dieses Rufes haftete in mir wie eine kräftig tröstende Vorbedeutung und gestaltete sich bald zu dem Thema des Matrosenliedes in meinem »Fliegenden Holländer«.6
Und Robber: Ob etwas in seinem Blut ihm zuraunt, dass er sich seiner Ururheimat nähert, gesetzt den Fall, dass er tatsächlich von den Bären Neufundlands und den Hunden der Wikinger abstammt?
Bleich besehen die Matrosen ihr Schiff. Da vorn fehlt was. Der Sturm hat die Nymphe verschluckt. Ein höchst bedenkliches Zeichen, sollten sie nun schutzlos sein? Aber dies ist der Augenblick nach der Gefahr, und es ist zu viel neu gewonnener Frieden zwischen diesen Felsen, als dass die Blicke der Seeleute, auf der Suche nach den Urhebern des Schadens, ungebührlich lange auf den drei blinden Passagieren verweilen dürften. Natürlich sind Matrosen abergläubisch. Sie glauben zum Beispiel, dass man in einer so kleinen Nussschale über zwei Meere bis nach London und wieder zurückkommen kann. Oder richtiger: Gerade beginnen sie wieder, es zu glauben.
Die Mannschaft und die Erstseefahrer ruhen sich aus, der Sturm auf dem offenen Meer noch nicht. Das Haus eines verreisten Norwegers nimmt sie auf, doch nach zwei Tagen will der Kapitän trotz aller Warnungen weiter. Auf der ausfahrenden kopflosen »Thetis« verzehrt Richard Wagner zum ersten Mal im Leben einen Hummer, als sich ein heftiges Fluchen an Bord erhebt. Wagners Tagebuch vermerkt: zwei Stöße. Wieder zurück.7 Der Lotse rammte einen Felsen.
Würde die »Thetis« nun untergehen, wüssten alle, wie stark die beiden Stöße waren. Aber sie schwimmt weiter. Um festzustellen, wie lange noch, wird eine Fahrt zu den Hafenbehörden notwendig, damit diese das Schiff begutachtet. Die maritime Inspizienz befindet sich in der nächstgrößeren Stadt, und der Kapitän lädt den Kapellmeister ein, ihn zu begleiten. Ihr kleines Boot findet seinen Weg durch den weit sich ins Land schneidenden Fjord, Richard Wagner verdaut den Hummer, und sein Geist macht Notizen zu einer nie gesehenen grauenvoll erhabenen Öde.
Der Schaden erweist sich als unbedenklich, so dass die »Thetis« am 1. August 1839 bei gutem Winde von Neuem in See sticht.
Über seine Gemütsverfassung beim erneuten Anblick des offenen Meeres überliefert Wagner nichts, wahrscheinlich sagt er sich, dass es bis London nun nicht mehr weit ist, bloß einmal quer rüber. Und die Amphibie Robber weiß ohnehin: Wasser ist Wasser. Schon bald wird sich seine Rasse, systematisch ausgebildet, Verdienste um die Rettung Ertrinkender erwerben. Wahrscheinlich ist er der Einzige an Bord, der richtig schwimmen kann. Und das Wetter stimmt auch: Je miserabler, desto neufundländischer, desto heimatlicher wird es.
Das Tagebuch des Seefahrers Richard Wagner gibt sich in den folgenden Tagen besonders wortkarg. Sonntag den 4ten Abends stürmischer Nordwind; günstig. Den 6ten Abends conträren Sturm. Mitwoch den 7ten schlimmer Tag. Mittag halb 3 Uhr Sturm am heftigsten.8 Am frühen Nachmittag des 7. August haben sie den Tod nicht nur im Herzen, sondern ebenso vor Augen, lediglich die Art seines Eintritts ist noch offen: Entweder er kommt von oben, oder er kommt von unten. Über ihnen tobt das heftigste Gewitter, unter ihnen schwankt das beweglichste Hochgebirge aus Wasser, in dessen tiefstem Tal sie sich befinden, nur um im nächsten Augenblick auf einen weißschäumenden Gipfel gehoben zu werden. Das Meer, Richard Wagner müsste es zugeben, ist ein begnadeter Regisseur. Was für ein Sinn für Effekte!
Und die »Thetis« ist vorn ganz nackt. Keine schützende Jungfrau mehr am Bug, die hier begütigen und sich zurechtfinden könnte. Die Mannschaft blickt abwechselnd nach oben, nach unten und auf die drei blinden Passagiere. Verzweiflungsvoll boshaft, nennt der von allen Seiten ins Auge Gefasste den Ausdruck ihrer Gesichter. Er weiß nur zu genau, was sie längst denken: Die drei sind schuld! Die beiden und ihr schwarzer Höllenhund.
Mag sein, die Matrosen erwägen längst den letzten Ausweg aus ihrer Lage: Es gilt, dem entfesselten Geist des Elements ein Opfer zu bringen. Richard Wagners Blick sucht unwillkürlich Beistand beim Kapitän. Doch da ist keiner. Wie oft war Wulff diese Strecke gefahren, ohne alle Beschwerde, gerade im Sommer.
Was diesmal anders ist, wissen alle.
Minna Wagner schreit ihrem Mann durch den Sturm zu, dass sie lieber vom Blitz getroffen werden möchte, als bei lebendigem Leib in diesen Fluten zu versinken. Robber beobachtet seinen Herrn nun bei einer merkwürdigen Tätigkeit. Er bindet sich und Minna mit Bettlaken aneinander.
Menschen sind defizitäre Hunde, jeder Hund weiß das. Sie kommen auf ihren zwei Beinen kaum vorwärts, von wirklichem Laufen, Rennen gar nicht zu reden, was sie bezeichnenderweise nicht davon abhält, die Kümmerlichkeit ihrer Fortbewegung den aufrechten Gang zu nennen. Robber hat genug Gelegenheit, die Wahrheit über den aufrechten Gang zu studieren. Schon bei leichtem Schaukeln des Untergrunds können sie sich fast nicht mehr aufrecht halten, aber derart zusammengebunden sind sie gar keiner eigenen Bewegung mehr fähig.
Richard Wagner wird schon bald und nicht ganz zufällig viel Sinn entwickeln für das Opfer, zur richtigen Zeit dem Richtigen gebracht. Sollte er gar seine Frau und sich in die unter diesen Umständen allein wünschbare Darbietungsform bringen, so dass der Gott der Tiefe die Gabe auch bemerken würde und sie nicht verschmähen müsste?
Die Besatzung bräuchte das Doppelbündel nur noch über die Reling zu stoßen. Aber nein, der Kapellmeister wäre gewiss über die Maßen erstaunt, griffen jetzt ein paar rohe Matrosenhände nach ihm, denn er hatte nur die Bitte seiner Frau befolgt, doch sicherzustellen, dass sie gemeinsam den Meeresgrund erreichen und nicht ganz vom Zufall verstreut dort unten ankommen.
Der Sturm macht weiter. Die Seeleute haben schon recht, kein normaler, rechtschaffener Provinzkapellmeister befände sich in Richards Wagners Lage. Es muss eine seltsame Bewandtnis mit ihm haben. Handelt es sich gar um einen verfluchten Kapellmeister? Haben sie nicht die Pflicht, ihn ins Meer zu werfen, schon um sich selbst zu retten? Aber selbst wenn die Matrosen die bereits in Eigeninitiative als Mumien Verpackten in der Nordsee versenken würden, wäre der schwarze Teufel immer noch da. Und wahrscheinlich würde er schon vorher sehr hinderlich sein. Also muss zuerst der Hund ins Wasser. Nur wer soll das übernehmen? Koske? – Von dieser Art sind die Ausweglosigkeiten, die Richard Wagner mehr oder minder deutlich in den Mienen der Matrosen liest und die ihn mehr entsetzen als Luftdruck und Windstärke zusammen: Die Mannschaft hatte aufgegeben, sich und ihr Schiff. Sieht Richard Wagner vor sich die Besatzung des »Holländers«?
Der Sturm umheult sie noch eine ganze Nacht lang, am nächsten Morgen wird die See ruhiger. Die Mannschaft und ihre Gäste gewöhnen sich allmählich an den Eindruck, noch am Leben zu sein. Kapitän Wulff hat keine Ahnung, wo er ist und findet es auch nicht heraus. Sie segeln einem Schiff hinterher, das sie weit vor sich erblicken. Der Schoner da vorn wird schon ein bewohntes Ziel haben. Doch dann kommt die »Thetis« ihm immer näher, was aber nicht daran liegen kann, dass sie schneller segelt, im Gegenteil. Kaum einer nimmt Anteil an den Orientierungsnöten des Kapitäns, allen genügt es vorläufig, dass die »Thetis«, egal wohin, überhaupt noch schwimmt. Da erkennt Wulff mit Entsetzen, dass der Segler vor ihm genau das längst nicht mehr tut. Sandbänke! Im selben Augenblick weiß er, wo er sich befindet: Das da muss Holland sein!
»Klar zum Wenden«, lautet der Befehl.
Am 9. August erreicht die »Thetis« bei Southwold die englische Küste; die Lotsen beginnen einen Kampf um das Schiff, bis es einem schon älteren, grauhaarigen Mann gelingt, das herabgeworfene Tau zu fangen und daran emporzuklettern. Mit blutenden Händen tritt er an Bord, die Besatzung der »Thetis«, einschließlich ihrer drei blinden Passagiere, staunt ihn an wie eine Erscheinung: Dieser Mann kommt vom Festland, noch vor Stunden muss er festen Boden unter den Füßen gespürt haben. Die Brust des flüchtigen Kapellmeisters füllt sich mit einem geradezu religiösen Wohlgefühl, der Lotse übernimmt das Steuer.
Das Schiff braucht bei Weststurm noch volle zwei Tage bis zur Mündung der Themse. Ständig blinken hellrote Warnzeichen durch den Nebel, und Glocken läuten. Sie gehören den unzähligen Wachtschiffen, die vor den allgegenwärtigen Sandbänken warnen, auf denen jährlich bis zu vierhundert Schiffe verenden, wie man Richard Wagner versichert. Seine Frau glaubt bei jedem neuen Glockenton, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, aber ihr Mann kann sich keinen vertrauteren Klang schützender menschlicher Nähe denken und fällt in einen tiefen Schlaf, aus dem ihn nur die vorwurfsvollen Anfragen Minnas, ob er denn im Schlaf sterben wolle, ab und zu wecken.
Die Mündung der Themse! Ist das nicht beinahe schon wie Land? Es ist wie Land. Die »Thetis« wirft den Anker aus, der frühe Morgen bricht an, und alle gehen schlafen. Nur der zukünftige Eroberer von Paris, der Erneuerer der Kunst, im Gepäck eine halbe Oper, bleibt an Deck und beginnt, sich neben dem Schiffsmast zu rasieren. Und ich mache etwas, womit alle Hunde der Welt fast ihr ganzes Leben verbringen: Ich beobachte meinen Herrn.
Dass die Menschen sich ihres Fells so schämen, statt stolz darauf zu sein, gehört zu den auffälligsten Eigenarten dieser von der Natur so mangelhaft ausgestatteten Tiere. Wahrscheinlich ist es ihnen unangenehm, dass ihnen nur so wenige Haare wachsen, zudem nur an so lächerlich wenigen Stellen, dass sie die verbleibenden auch noch ausreißen und die Felllosigkeit zum Ideal erklären. Und was für missbilligende Gesichter sie machen, wenn ich ein halbes Meer oder den ganzen Rigaer Stadtgraben aus meinem schwarzen Fell mit der dichten Unterwolle schüttele.
Nein, nichts Gerades, Schönes, Einfaches ist gemeinhin von den Minderbehaarten zu erwarten, den Kapellmeister ausgenommen, sonst läge jetzt ich nicht bei ihm am Mast neben dem Spiegel. Auch würde mein Herr kaum am frühen Morgen des 12. August 1839 an Deck eines kleinen Ostseeschoners in der Mündung der Themse sitzen und sich rasieren, wäre er bloß ein durchschnittliches Exemplar seiner Art. Es gibt Hunde, damit sie uns Schutz und Geleit gewähren, und koste es ihr Leben. Das glauben von alters her die Menschen. So weit würde er den Egoismus der Gattung nie treiben. Der Kapellmeister ist einer der Ersten, die wissen, dass das Umgekehrte ebenso gilt: Es gibt mich, damit ich meinem Hund Schutz und Geleit gewähre, und koste es mein Leben.
Nein, er hält sich nicht für etwas Besonderes. Der Mensch ist das unglückliche Tier, denn wäre es anders, hätte er keine Kunst und würde sie auch nicht vermissen. Die Existenz der Kunst, deutet sie nicht auf einen großen Makel in der menschlichen Natur? Könnte das Herz denken, stünde es still, wird ein aufmerksamer Mitwisser des Menschen diesen Befund einmal zusammenfassen. Mein Herr ist ein Herzdenker, jetzt schon.
Dieser Morgen ist keiner wie jeder andere, wir gehören tiefer zusammen als zuvor: Der Kapellmeister ist da, ich bin da, und der Sturm ist weg.
So wie Richard Wagner jetzt mögen sich Feldherren nach gewonnenen oder selbst verlorenen Schlachten rasiert haben. Wer sich rasiert, lebt! Ich betrachte meinen Herrn und weiß: Wir sind außer Gefahr. Die Zahl der Schiffe auf der Themse nimmt zu. Vielleicht denkt der Mann vorm Spiegel daran, wie er vor kaum zwei Jahren, noch in Königsberg, die Ouvertüre »Rule Britannia« komponierte. Das Königsberger Theater hatte kurz darauf bankrott gemacht, und auch der Ouvertüre folgte nie mehr auch nur eine einzige Note, die Ankündigung – und Ouvertüren sind nichts als Ankündigungen – zu erfüllen. Immerhin erlebte die Stadt Immanuel Kants noch die Aufführung der »Rule Britannia«, und ihr Komponist war gewissenhaft genug, eine eigenhändige Abschrift anzufertigen und diese an die Londoner Philharmonische Gesellschaft zu adressieren, und zwar an deren Vorsteher Sir John Smart. Auch auf diese Sendung hat er nie eine Antwort erhalten.
Kommen all die großen und kleinen Schiffe, uns zu begrüßen, den Komponisten der »Rule Britannia« und mich, die wir schon fast nicht mehr zu den Lebenden gehörten? Oder sollte es nur an der Tageszeit liegen, an diesem Augustmorgen, aus dem schon ein Vormittag wird?
Richard Wagner, ganz weiß im Gesicht, doch diesmal nicht vor Todesangst, und ein riesiger schwarzer Neufundländer nehmen die Parade der Schiffe auf der Themse ab.
Rule Britannia!
Robber stürzt an Land, gleich neben der London Bridge. Die letzten Wochen, mehr als drei, hatte er auf einem Schiff verbracht, das streng betrachtet nur unwesentlich größer war als er selbst.
Ins Freie! Was für ein Ort!