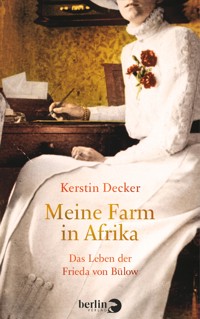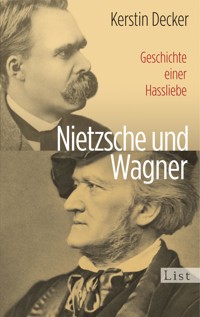14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gottfried Benn hielt sie für die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte, Karl Kraus bekannte, für eines ihrer Gedichte den ganzen Heine herzugeben. Else Lasker-Schüler (1869 - 1945) zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichterinnen. Ihre expressionistische Lyrik steht am Beginn der literarischen Moderne, der sie im Kreis der Berliner Bohème des anbrechenden 20. Jahrhunderts eng verbunden ist. Bravourös gelingt es Kerstin Decker, die eigenwillige deutsch-jüdische Poetin und mit ihr jene künstlerische Blütezeit zum Leben zu erwecken. Im Berlin der Jahrhundertwende schrieb Else Lasker-Schüler ihre ersten Gedichte, war in zweiter Ehe mit dem Schriftsteller und Avantgarde-Förderer Herwarth Walden verheiratet, zeitweise mit Benn liiert, mit Georg Trakl befreundet. Franz Marc malte ihr seinen berühmten »Turm der blauen Pferde«. Sie war die Radikalste unter diesen Radikalen, stand im Zentrum des künstlerischen Aufbruchs, der in Literatur, Kunst und Musik völlig neue Wege beschritt. Ihr Werk ist stark autobiographisch geprägt und vereinigt phantastische und religiöse Elemente mit einer ausgeprägten Naturliebe. 1932 mit dem angesehenen Kleist-Preis ausgezeichnet, musste sie nur ein Jahr später vor den Nationalsozialisten in die Schweiz fliehen, von wo aus sie 1939 nach Palästina emigrierte. Dort starb sie 1945, ihr Grab liegt auf dem Ölberg in Jerusalem. Kerstin Decker hat sich mit vielbeachteten Biographien über Wegbereiter der Moderne einen Namen gemacht. Mit Else Lasker-Schüler, lange verkannt und vergessen und erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt, hat sie sich seit vielen Jahren intensiv befasst. Ihre »federnd leichte« (Der Spiegel), szenische Erzählweise ist wie geschaffen, um dieser faszinierenden Frau ein gebührendes Denkmal zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Im Berlin der Jahrhundertwende schrieb Else Lasker-Schüler ihre ersten Gedichte, war in zweiter Ehe mit dem Schriftsteller und Avantgarde-Förderer Herwarth Walden verheiratet, zeitweise mit Benn liiert, mit Georg Trakl befreundet. Franz Marc malte ihr seinen berühmten »Turm der blauen Pferde«. Sie war die Radikalste unter diesen Radikalen, stand im Zentrum des künstlerischen Aufbruchs, der in Literatur, Kunst und Musik völlig neue Wege beschritt. Ihr Werk ist stark autobiographisch geprägt und vereinigt phantastische und religiöse Elemente mit einer ausgeprägten Naturliebe. 1932 mit dem angesehenen Kleist-Preis ausgezeichnet, musste sie nur ein Jahr später vor den Nationalsozialisten in die Schweiz fliehen, von wo aus sie 1939 nach Palästina emigrierte. Dort starb sie 1945, ihr Grab liegt auf dem Ölberg in Jerusalem.
Kerstin Decker hat sich mit vielbeachteten Biographien über Wegbereiter der Moderne einen Namen gemacht. Mit Else Lasker-Schüler, lange verkannt und vergessen und erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt, hat sie sich seit vielen Jahren intensiv befasst. Ihre »federnd leichte« (Der Spiegel), szenische Erzählweise ist wie geschaffen, um dieser faszinierenden Frau ein gebührendes Denkmal zu setzen.
Die Autorin
Kerstin Decker, geboren 1962 in Leipzig, ist promovierte Philosophin, Reporterin des Tagesspiegel und Kolumnistin der taz. Sie lebt in Berlin. Im Propyläen Verlag erschienen von ihr Biographien über Heinrich Heine, Paula Modersohn-Becker, Else Lasker-Schüler, Lou Andreas-Salomé und die Doppelbiographie über Nietzsche und Wagner.
Von Kerstin Decker sind in unserem Hause bereits erschienen:
Lou Andreas-Salomé
Heinrich Heine
Paula Modersohn-Becker
Nietzsche und Wagner
Kerstin Decker
Mein Herz – Niemandem
Das Leben derElse Lasker-Schüler
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Zitate aus Else Lasker-Schülers Werken und Briefen sind kursiv gedruckt. Es wird zitiert nach: Else Lasker-Schüler, Werke und Briefe, Band 1–8, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1996–2005. Die oft sehr eigenwillige Orthographie wurde beibehalten. Den wörtlichen Reden Else Lasker-Schülers, die nicht kursiv stehen, liegen Zeugnisse Dritter zugrunde. Alle Zitate von Gottfried Benn aus: Gottfried Benn. Sämtliche Gedichte, Klett-Cotta, Stuttgart 1998.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Mai 2019
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009/ Propyläen Verlag
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
(unter Verwendung einer Vorlage von
Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld)
Titelabbildung: ullstein bild
Lektorat: Karin Schneider
ISBN 978-3-8437-2196-7
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Alles Schreiben ist autobiographisch?
Für niemanden gilt diese Vermutung mehr als für Else Lasker-Schüler, die »größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte« (Gottfried Benn).
Ihr Werk ist ihre Autobiographie.
Das Folgende: der Versuch einer Übersetzung.
Gibt es etwas Traurigeres als ein entschlüsseltes Werk?
Dieses Buch ist ein Lob der Schlüssel.
Wer hatte schönere als sie?
Biographie ist radikale Vergegenwärtigung.
»Herwarth! Gestern war ein Monstrum im Café«
Die Poesie setzt sich aus, weil sie nicht weniger ist
als eine Analogie der Existenz – ein objektloses, offenes Wagnis.
… Existenz und Poesie sind in ihren Grundbewegungen
miteinander solidarisch.
Peter Sloterdijk
I.
Die letzte Augustwoche des Jahres 1911 beginnt. Eine Frau geht nach Hause. Sie geht ins Café, in ihr Café. Oder sollte man sagen: Sie geht zur Arbeit?
Nur die Lebensbürger glauben, dass das drei grundverschiedene Dinge sind, ein Zuhause, eine Arbeit, ein Café. Und Thomas Mann. – Wann arbeiten diese Leute eigentlich?, fragte er beim Besuch des Lokals, um dessen Tische lauter Menschen seines Berufs saßen.
Jetzt! Jetzt arbeiten sie. Die nicht mehr ganz junge Frau mit dem schwarzen, halblangen Haar will einen Brief schreiben. Zuerst einen, bald noch einen, am Ende drei. Drei sind verabredet. Drei Briefe direkt aus dem Café.
Die etwas heruntergekommene Gaststätte im Kaiserstil des napoleonischen Frankreich, von Passanten auch »Café Größenwahn« genannt, trägt ihr übliches Einheits-Nikotingelb vom Rokokostuck bis zu den Vorhängen. Die oft mit Ölfarbe oder Buntstiften kleiner und großer Künstler bemalten Marmortische stehen wie gewohnt auf ihren gusseisernen Füßen. Die Spiegel sind halb erblindet, die Polster waren einmal rot. Die Zeitungen tragen den Aufdruck »Gestohlen im Café des Westens« und werden vom Zeitungskellner Rudolf Rattke, dem »roten Rudi«, verwaltet, der – sagt man – mehr von Literatur versteht als alle anwesenden Literaten zusammen. Auch bezahlt er nicht selten die Rechnung der Briefschreiberin und ihres Mannes. Dafür vermerkt die Briefschreiberin manchmal in ihrer Korrespondenz, wenn Herr Rattke etwas gesagt hat oder Grüße ausrichten ließ.
Der Vermerk »Gestohlen im …« ist weit mehr als ein Misstrauensantrag. Er ist ein begründeter Misstrauensantrag. Auch verschmähen die neuen Dichter kein Manuskriptpapier. Nicht Zeitungsränder, nicht Caféhausrechnungen. Sie mag besonders Telegrammformulare. Telegrammformulare passen gut. Denn die neuen Gedichte der neuen Dichter sind, genau gelesen, Telegramme. Bloß kein Wort zu viel, aber das: weltsprengend!
Ein Brief ist etwas anderes. Sie kann den ersten auch nachher im Bett schreiben, vielleicht macht sie das sogar, sie schreibt gern im Bett. Hauptsache, es wird ein echter Caféhausbrief. Und ein Liebesbrief, einer, wie ihn die Welt noch nicht gelesen hat! Und die Welt soll ihn lesen. Im »Sturm«, dem Zentralorgan der Berliner Moderne. Letztlich wird er überhaupt nur zum Mitlesen geschrieben und sie wäre die Letzte, das zu leugnen.
Eine Frau schreibt ihrem Mann, der verreist ist – nichts ist natürlicher. Eine Frau schreibt ihrem Mann, der verreist ist, als Lektüre für alle? Nichts ist unnatürlicher. Aber sie ist eine öffentliche Frau. Sie ist eine Dichterin. Und ihr Mann – ihr zweiter Mann – ist ein öffentlicher Mann, nämlich der Chefredakteur des Zentralorgans. Warum sollte ihre Liebe da nicht öffentlich sein?
Der Dichter wird nicht zuletzt dadurch definiert, dass er öffentlich liebt, und er besitzt dafür auch eine Entschuldigung: die Form.
Else Lasker-Schülers Mann Herwarth Walden ist nach Norwegen gefahren, begleitet von seinem Rechtsanwalt.
Walden hat die Reise nötig, denn es ist anstrengend, eine Avantgardezeitschrift herauszugeben. Wenige wissen das besser als seine Frau und sein Rechtsanwalt Curt Neimann. Der muss die Prozesse führen, in die sein weitgehend mittelloser Mandant immer wieder verwickelt wird.
Im Café des Westens. Von links: Anna Scheerbart, Samuel Lublinski, Salomo Friedlaender alias Mynona, Paul Scheerbart, Else Lasker-Schüler und Herwarth Walden. © Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Walden kann im September zum dritten Mal nacheinander die Miete der ehelichen Wohnung nicht zahlen. Dreimal nicht zahlen können ist sehr gefährlich, denn dann verliert man nicht nur seine alte Wohnung, sondern findet auch keine neue mehr. Weil man auf die schwarze Liste kommt.
Norwegen ist ein guter Ort, die schwarze Liste zu vergessen. Die Reise bezahlt der Rechtsanwalt. Die Daheimgebliebene nennt ihn nur das »Kurtchen«. Ihr Mann und das Kurtchen waren einmal Schulfreunde, jetzt ist das Kurtchen der Schatten ihres Mannes. Auch darum spricht sie im Brief gleich beide an: Lieber Herwarth! Liebes Kurtchen!
Der Liebesbrief ist nicht nur deshalb ungewöhnlich, weil ihn schon am 2. September 1911 alle im »Sturm« lesen können, sondern auch, weil die im Café zurückgelassene Ehefrau darin ihrem Ehemann nicht von ihrer Liebe zu ihm berichtet, sondern darüber, in wen sie sich – in seiner Abwesenheit – gerade verliebt hat: Ich habe nämlich noch nie so geliebt wie diesmal. Wenn es Euch interessiert:…1
Es interessiert die Leser des »Sturm« sehr. Die »Briefe nach Norwegen« entstehen. Es werden viel mehr als nur drei.
Wenn der letzte geschrieben ist, ist im Leben der Else Lasker-Schüler nichts mehr, wie es war.
II.
Sie hat große dunkle Augen und einen schmallippigen Mund. Viele finden ihre Augen schön, den Mund eher nicht.
Sie ist noch immer knabenhaft schlank. Vor ein paar Monaten ist Else Lasker-Schüler zweiundvierzig Jahre alt geworden, aber niemand hat ihr zum Zweiundvierzigsten gratuliert. Das liegt daran, dass niemand von dieser Zahl weiß. Sie glaubt, es sei besser so. Auch schreibt man Liebesbriefe aus Cafés besser mit Anfang, Mitte dreißig.
Alle Welt hält sie für Anfang, Mitte dreißig. Und manchmal denkt sie wie alle Welt. Wenn sie siebenundfünfzig ist, wird alle Welt ihr zum Fünfzigsten gratulieren, dem Geburtstagskind ist das unangenehm. Und wenn sie siebenundsechzig wird …
Die Bürger, solche, die ihre Briefe so ängstlich vor Fremden hüten wie ihr Eigentum und über alles »privat« schreiben, mag man nach Ziffern ehren. Die Bürger mögen sich ihre Jahre als Verdienst anrechnen, aber wer zählt einer Weltenerfinderin die Jahresringe nach? Gratulanten haben keine Ahnung vom Schöpfertum. Ihre bloße Existenz ist eine Leugnung dessen, was sie preisen möchten. Das missfällt der Zweiundvierzigjährigen.
Das Kurtchen und ihr Mann sind fast zehn Jahre jünger als sie.
Herwarth Walden war immer ein getreuer Chronist dessen, was seine Frau über die Liebe weiß. Und dass sie mehr darüber weiß als fast alle anderen und dass sie es tiefer weiß, dass sie es so sagen kann, als habe noch nie jemand vor ihr geliebt – auch dafür hat er sie geheiratet. Das war 1903. Dass sie es immer neu wissen würde, nahm er in Kauf.
Im letzten Sommer lasen alle im soeben begründeten »Sturm«:
Leise sagen –
Du nahmst dir alle Sterne
Über meinem Herzen.
Meine Gedanken kräuseln sich,
Ich muß tanzen.
Immer tust du das, was mich aufschauen läßt,
Mein Leben zu müden.
Ich kann den Abend nicht mehr
Über die Hecken tragen.
Im Spiegel der Bäche
Finde ich mein Bild nicht mehr.
Dem Erzengel hast du
Die schwebenden Augen gestohlen;
Aber ich nasche vom Seim
Ihrer Bläue.
Mein Herz geht langsam unter
Ich weiß nicht wo –
Vielleicht in Deiner Hand.
Überall greift sie an mein Gewebe.
Das ist angewandte Ozeanographie. Welcher Mann, der das liest, und sei es der eigene, dürfte glauben, dieses »Du« sei er? Höchstens ein Partikel darin könnte er, Herwarth Walden, sein. Er ist Künstler und Bewunderer genug, das zu wissen.
Kurz darauf hat die Essener »Rheinisch-Westfälische Zeitung« das Gedicht nachgedruckt. Sie hatte auch etwas darunter geschrieben: »Vollständige Gehirnerweichung, hören wir den Leser – leise sagen.« Eine Hamburger Zeitung druckte nun das Gedicht und dazu die Nachbemerkung der »Rheinisch-Westfälischen«.
Klage!, riet Walden seiner Frau.
Niemand versteht Else Lasker-Schüler besser als ihr Mann. Und niemand verteidigt sie besser. Natürlich öffentlich, im »Sturm«: »Ich habe nichts dagegen, daß die Herren Kunst komisch finden. Ich werde sie aber daran hindern, ihren Geist an Kunst aufzugeilen. Ich werde mich in ihre Verstandesregion hinunterbegeben und ihnen beweisen, daß Impotenz keine Gesundheit ist. Kranke Laien halten sich oft für gesund. Sie sollen aber nicht exzentrisch werden wollen … Sie sollen im Lande bleiben und sich redlich mit Vermischtem nähren … Kunst muss vor Prostitution geschützt werden. Denn Kunst fordert Liebe.«2
Und wenn seine Frau liebt, weiß Herwarth Walden, ist das Kunst.
Das Café unterteilt sich in das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken. Im Ersten sitzt, wer schon einen Namen hat, im zweiten sitzt, wer gern einen hätte. Die Ersten können ihre Rechnung zahlen, die Nichtschwimmer oft nicht einmal das. Sie ist gewissermaßen eine nichtschwimmende Schwimmerin. Wasserkakao ist am billigsten. Gewiss bestellt die Briefschreiberin das Übliche und beginnt den ersten Brief: Liebe Jungens!… Vorgestern war ich mit Gertrude Barrison in den Lunapark gegangen, leise in die ägyptische Ausstellung… ich tanzte mit Minn, dem Sohn des Sultans von Marokko. Wir tanzten, tanzten wie zwei Tanzschlangen, oben auf der Islambühne, wir krochen ganz aus uns heraus, nach den Locktönen der Bambusflöte des Bändigers, nach der Trommel, pharaonenalt, mit den ewigen Schellen.
Das ist Lasker-Schüler’sche Prosa. Ganz hier und ganz im Nirgendwo. Und jeder, der fragt: Ja, wo denn nun?, ist ihr noch nicht gewachsen.
Ist es ihr Mann?
Vielleicht wüsste Herwarth Walden doch gern etwas über den Realitätsgrad dieses Minn, vor allem angesichts des Fortgangs: … er und ich verirrten uns nach Tanger, stießen kriegerische Schreie aus, bis mich sein Mund küßte so sanft, so inbrünstig, und ich hätte mich geniert, mich zu sträuben.
Der letzte Halbsatz ist natürlich boshaft. Dabei kennt Herwarth Walden diesen Minn schon, denn er ist eine Figur aus den Büchern seiner Frau. Sie begegnet immerzu den Helden ihrer Bücher in der Wirklichkeit. Und warum sollte sie nicht in seiner Abwesenheit den gerade wiedereröffneten größten Vergnügungspark Berlins am hinteren Ende des Kurfürstendamms besuchen? Schließlich wohnen sie da und seine Frau mag Rummelplätze. Außerdem, wird der Ehemann sich sagen, sind da noch zwei andere Männer, die seiner Frau sehr gut gefallen, der »Slawe« und der »Bischof«. Drei sind ungefährlicher als einer.
Es handelt sich bei Letzteren nicht um beklagenswerte lebendige Schaustücke eines Vergnügungsparks, sondern um Stammgäste des Cafés am entgegengesetzten Ende des Kurfürstendamms.
Der »Slawe« ist vorerst wichtiger. Ihn möchte sie immer wieder betrachten, wie ein Gemälde: Eine Feuerfarbe hat sein Gesicht, ich verbrenne im Anschaun und muß immer wieder hin… Ich schrieb ihm: »Süßer Slawe, würdest Du in Paris im Louvre gehangen haben, hätte ich Dich statt der Mona Lisa gestohlen. Ich möchte Dich immer anschauen ich würde gar nicht müde werden; ich würde mir einen Turm bauen lassen, ohne Türe. Ich möchte am liebsten zu Dir kommen, wenn Du schläfst, damit Deine Wimper nicht zuckt im Rahmen.… Du warst so schön, man müßte Dich zweimal stehlen, einmal der Welt und einmal Dir selbst.«
Ob Herwarth Walden weiß, wer der Slawe ist? Die Leser des »Sturm« finden die Briefe aus dem Café auch deshalb so interessant, weil sie meist selbst dort verkehren. Wer vor dem Tisch der Verfasserin stehen bleibt, um sie zu begrüßen, vielleicht etwas verlegen, vielleicht etwas zu lang, riskiert mit einem »Achtung, Sie treten ja meinem Neger Achmed auf die Zehen!« empfangen zu werden. Sie mag es, wenn die Gäste sich umdrehen und auf die leere Stelle hinter sich schauen.3
Seit dem 2. September 1911 begutachten die Besucher des Cafés einander mit ganz neuer Aufmerksamkeit. Auf direkte Nachfragen – eine kommt aus Prag – reagiert die Autorin eher abwiegelnd: … aber ich wundere mich, dass Sie mir nicht zutrauen, Menschen formen zu können nach meiner Phantasie. Der Slawe ist nicht in Wirkli[ch]keit. An einer Stelle der Seite hätte ich seinen wirklichen Nam[en] genannt.
Und ihr Mann erfährt: Du brauchst gar keine Angst zu haben, Herwarth, er hat mir auf meinen Liebesbrief gar nicht geantwortet. Ja, der Slawe habe ihr nicht einmal die Hand gegeben. Aus Scheu, aus Vorsicht? Oder vor allem aus Respekt vor Walden? Denn fast alle Gäste des Cafés möchten gern einmal bei ihm veröffentlichen oder es weiterhin tun dürfen, in eben jenem »Sturm«, in dem am 2. September 1911 steht, wer warum zweimal gestohlen werden sollte und wie es in Tanger war. Die Ehefrau fährt fort: … Was ich ein ausgesuchtes Unglück in der Liebe habe. Ihr auch?
Am 2. September sind die Empfänger, die lieben Jungens, noch genau eine Woche unterwegs. Die Absenderin glaubt zu diesem Zeitpunkt, dass sie bloß noch zwei Briefe schreiben wird, schließlich sind die Jungens gleich wieder da.
Was für ein verbaler Hochseiltanz, immer in der Schwebe zwischen übermütigem Spiel und Ernst.
Noch hält sie die Balance.
Sie ist eine Weltenerfinderin, eine Weltenschöpferin, eine Eigenweltenbewohnerin, auch – darin liegen ihr Glück und ihre Tragik zugleich – eine Eigenweltinhaftierte. Für jeden anderen mögen diese Worte zu groß sein, für Else Lasker-Schüler sind sie gerade groß genug. Wenn sie die Wände ihres Ichs fühlt, fällt sie in namenlose Traurigkeit. Das geschieht oft. Depressionen sind Ausdehnungskrisen. Jetzt, Anfang September 1911, spürt sie wohl keine Enge – ihr Ich ist so weit wie die Welt.
Jeder Weltenschöpfer braucht ein Inkognito, einen Ort zum Ausruhen nach der ganzen Creatio ex nihilo. Else Lasker-Schüler geht ins Café, denn es gibt ja nichts Objektiveres wie das Café, nachdem man in seiner Literatur am Schreibtisch zu Haus die Hauptrolle gespielt hat. Entzückend, sich abzuschütteln, seine intensive Last.
Sie geht dorthin, selbst wenn sie nicht viel mehr erschaffen hat als einen alten Teppich:
Ein alter Tibetteppich
Deine Seele, die die meine liebet,
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.
Strahl in Strahl, verliebte Farben,
Sterne, die sich himmellang umwarben.
Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit
Maschentausendabertausendweit.
Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron,
Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl
Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?
Bereits der erste Tag dieses vielversprechenden Jahres 1911 hatte sie erhöht gefunden. Ernannt zur »stärksten und unwegsamsten lyrischen Erscheinung des modernen Deutschland«. Wegen dieses alten Teppichs. Genau zu Silvester hatte das Gedicht in der obersten Kunst- und Sprachaufsichtszeitschrift, der »Fackel«, gestanden. Die Promotion wiederum fand sich nur in einer Fußnote. Aber sie war von einem, der es wissen musste, sie war vom obersten Kunst- und Sprachaufseher persönlich. Karl Kraus hatte seine Auszeichnung wie folgt begründet: »Das hier aus der Berliner Wochenschrift ›Der Sturm‹ zitierte Gedicht gehört für mich zu den entzückendsten und ergreifendsten, die ich je gelesen habe, und wenige von Goethe abwärts gibt es, in denen so wie in diesem Tibetteppich Sinn und Klang, Wort und Bild, Sprache und Seele verwoben sind.«4
Von Goethe abwärts? Else Lasker-Schüler wird da immer ihre Zweifel behalten: »Der reimte doch Wipfeln auf Gipfeln. Das darf doch kein Dichter!«5 Außerdem erscheint ihr die Technik der »Wahlverwandtschaften« ein wenig mangelhaft.
Aber gleichgültig, ob von Goethe auf- oder abwärts: Da nützt die einsame Aufklärungsarbeit eines Franz Kafka gar nichts mehr, der bald einen Prager Schutzmann, der Else Lasker-Schüler rundweg vom Altstädter Ring verhaften möchte, über deren wahre Identität belehren will: »Das ist nicht der Prinz von Theben, das ist nur eine Kuh vom Kurfürstendamm!«
Jeder, der in ihre Welt eintritt, bekommt einen neuen Namen. Das macht es schon für die Zeitgenossen reizvoll und schwierig, die »Briefe nach Norwegen« zu lesen: Wer verbirgt sich hinter welchem Namen? Wenn einer aber seinen alten behalten darf, ist das ein schlimmes Zeichen. Dann wurde ihm der Zutritt zu ihrer Welt entweder nie gestattet oder schon wieder verweigert.
Herwarth Walden heißt natürlich nicht Herwarth Walden. Den Namen hat er erst von seiner Frau bekommen. In Wirklichkeit heißt er Georg Levin. Doch an den Namen erinnert sich schon lange keiner mehr, wahrscheinlich nicht einmal er selbst.
Wer aber mit einer Abkürzung anzutreffen ist, mit B. etwa, der ist verdammt in der Else-Lasker-Schüler-Welt. Eine furchtbarere Strafe ist undenkbar.
B. gibt es wirklich. B. ist Berthold Lasker, ihr erster Ehemann. Da ist er wieder, der höhere Realismus der Else Lasker-Schüler. Es existiert nur eine wirkliche Hölle: ganz vergessen zu sein. Ganz vergessen ist, wem auch noch sein Name genommen wird, der selbst den Toten bleibt. Berthold Lasker weilt noch unter den Lebenden, noch lange, von den ersten Septembertagen 1911 aus gesehen.
Ja, diese große Bekennerin ist zu großen Schweigsamkeiten fähig. Zu tieferem Schweigen als jeder gewöhnliche Mensch. Auch das macht sie zur Dichterin. Welchen Wert hätte denn das Sagen-Können ohne das Schweigen-Können? Erst auf seinem Grunde wird es bedeutsam. Fast zehn Jahre hat ihre erste Ehe gedauert. Kein direktes Wort ist davon geblieben. Nur B.
Und diese große Schweigende, die nie Leichthinsprechende – anders wird man nicht zum Dichter, zur Dichterin – plaudert so leicht-sinnig in den September hinein.
Wie sollte sie nicht? Denn für eine Dichterin geht es ihr erstaunlich gut. Ihr neuer Gedichtband »Meine Wunder« ist gerade erschienen. Gleich wird sie auf Lesereise gehen – sie mag es, aufzutreten. Sogar ihr Schauspiel soll endlich aufgeführt werden. Und zwar am Deutschen Theater. Es heißt »Die Wupper« und sie hat es zu Jahresbeginn im Kabarett schon mal auf Platt vorgetragen. Denn wenn sie auch der »Prinz von Theben« ist, so stammt sie doch aus Elberfeld an der Wupper.
Elberfelder Platt sollten auch die »Sturm«-Leser verstehen, sonst kriegen sie jetzt nicht raus, was die Absenderin über die bevorstehende »Wupper«-Aufführung sagen will: Der Derektör Reenhardt han et meck versproocken optuföhren; wenn meck ens nur der olle Großvatter em erschten Akt vöher nich sterben dut; hä leid on die Luft.… On de Grätz vom Dütschen Triater söll emm speelen.
Selbst der Wiener Karl Kraus empfängt inzwischen Briefe, die beginnen: Verährter Dalai Lama van Wien on Omgägend. Wat söll eck? In die Depesche warn Drockfähler… On nu, lewen Se’ wöll, ming verehrter Dalai Lama on eck ende met Luther sing Sprüchsken: Hier stonn eck, helpen Se meck eck kann nich anders. Wat nu?
Else Lasker-Schüler ahnt nicht, dass Luther sing Sprüchsken bald vor ihr stehen wird wie noch nie in ihrem Leben.
Wer an Else Lasker-Schüler denkt, denkt eigentlich nie an eine Frau mit Witz, mit freiem Lachen. Auch deshalb nicht, weil in jedem Lachen – insofern es nicht eines über andere ist – eine Selbstrelativierung steckt, und zu Selbstrelativierungen, sagt man, hatte sie wenig Talent. Oder doch?
Einen allerletzten Übermutsbrief schreibt sie, zeitgleich mit den ersten aus dem Café, aber dieser hier ist nicht öffentlich, der ist nur an drei Herren in Prag, die sie zum Vorlesen eingeladen haben:
Lieber Wily Haas
Ich schreibe dies bei Gas
Auch an Franz Werfel
Und an R.A. Jokl
Mein Bogen steht auf einem Sokl
Ich liege nämlich im Bett
Ich und mein Skelett
Wie wärs natürlich nett
Wenn ich ein Abend hätt
In Prag inmitten Euch
Ich lese dann schön Zeug
Ich lese wunderschön
Ihr werdet das schon sehn.
Wie sieht Franz Werfel aus?
Und R.A Jokl aus?
Ich hab mich sehr verändert
Meine Augen sind umrändert
Meine Backen sind ganz blaß
Und grün wie Kraut und Gras
…6
Diese letzten vier Zeilen wissen schon mehr als sie.
Der Verrat kommt meist von der Seite, von der man ihn am wenigsten erwartet.
III.
Was ich ein ausgesuchtes Unglück in der Liebe habe. Ihr auch?, hatte sie gefragt. Die Briefschreiberin erkundigt sich auch weiterhin nach dem Befinden der reisenden Jungens: Wie geht es Euch? Ihr seid wohl schon im Wendekreis des Schneehuhns angelangt?
So kann man das nennen. Denn die haben keineswegs Unglück in der Liebe. Ja, Herwarth Walden könnte sich geradewegs den Satz seiner Frau Ich habe nämlich noch nie so geliebt wie diesmal aus ihrem allerersten Brief ausleihen.
Zur selben Zeit, als die Dichterin im Café des Westens das Genre des Liebesbriefs neu erfindet und von all seinen Vorhersehbarkeiten befreit, beschließt das Leben, das Gleiche zu tun.
Die Norwegenreisenden kommen auf dem Weg nach Bergen in das schwedische Landskrona, wo Herwarth Waldens Schwester mit ihrem schwedischen Mann lebt. Außer Waldens Schwester leben auch richtige Schwedinnen in Landskrona, und eine gefällt Walden besonders. Sie ist gewissermaßen die Anti-Else. Eher groß, nicht klein wie sie. Jünger als Herwarth statt viel älter als er. Blond statt schwarz wie sie. Vor allem blond. Sonst ist sie eigentlich nichts. Oder doch, da ist noch etwas. Die Schwedin wird es so formulieren: »… da ich schon als junges Mädchen die ersten ›Sturm‹-Hefte in Schweden gelesen hatte.«7 Wer widersteht solchen Fernwirkungen?
Sie heißt Nell Roslund und ist vierundzwanzig Jahre alt, die Tochter eines Kirchendekans, die eine Vorbedingung ihrer erstaunlichen Lektüre in Schweden so erklärt: »Nach meiner Schulzeit hatte ich einige Monate in Lübeck verbracht und war deshalb durchaus imstande, die Hefte deutsch zu lesen.«8
Nell Roslund ist schuld, dass aus den geplanten drei Briefen nach Norwegen viel mehr werden und dass bis zum Februar des nächsten Jahres kaum ein »Sturm« ohne Nachricht an Herwarth und Kurtchen erscheinen wird. Am Ende wird es – nie hätte die Absenderin daran gedacht – ein ganzer Roman sein. Ein Roman in Briefen, so wie Goethes »Werther«. Hauptheld und Titel: »Mein Herz«. Das Protokoll einer Herzzerreißung. »Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen«. Wie wirklich, das lag nicht im Plan, dieser Realitätsgrad nicht.
Ja, Else Lasker-Schüler schreibt weiter Briefe an ihren Mann, obwohl die beiden Norwegenreisenden längst wieder da sind. Aber die Briefschreiberin benimmt sich, als seien sie noch immer weit weg. Und sie hat recht. Anwesenheit ist keine Frage der Geographie. Else Lasker-Schüler ist in diesen Dingen sehr genau. Erst viel später, sehr beiläufig und im Ton aufrichtiger Überraschung, notiert sie: Also seid Ihr beide doch wieder in Berlin; ich habe das ganz vergessen; laßt Euch ja meine Briefe aus Norwegen zurückschicken. Else
Anwesenheit ist eine Bestimmung der Seele, des Herzens. Und eine gewisse Ortlosigkeit des Befindens klingt schon durch, als sie noch die geordnete Rückkehr ihres Mannes erwartet: Ich bin nun zwei Abende nicht im Café gewesen, ich fühle mich etwas unwohl am Herzen. Dr. Döblin vom Urban – kein anderer als Alfred Döblin – kam mit seiner lieblichen Braut, um eine Diagnose zu stellen. Er meint, ich leide an der Schilddrüse, aber in Wirklichkeit hatte ich Sehnsucht nach dem Café. Er bestand aber darauf, mir die Schilddrüse zu entfernen, die aufs Herz indirekt drücke… Ich hab nämlich gebeichtet, daß ich mir außerdem das Leben meiner beiden Freunde wegen – Minn? der Slawe? – hätte nehmen wollen am Gashahn, der aber abgestellt worden sei; der ganze Gasometer ist geholt worden. Ich konnte die Gasrechnung nicht bezahlen. Auch in der Milch kann ich mich nicht ersäufen, Bolle bringt keine mehr. Wie soll ich nun, ohne zu erröten, wieder ins Café kommen?
Dabei war Herwarth Walden nicht losgefahren ohne die Gewissheit, dass seine Frau zu Hause genug Geld zum Leben hat. Das ist, wie längst angedeutet, nicht der Normalfall im Dasein des Ehepaares Walden, es ist die Ausnahme. Ihr gemeinsames Leben ist eine einzige Notstandserklärung, rein finanziell gesehen.
Und zu alledem diese Zeitschrift. Wie sie vor kaum einem Jahr durch Bonn gelaufen sind und später durch Elberfeld, um die allererste Nummer des »Sturm« in die Briefkästen der Häuser und Villen zu werfen, die ihnen gefielen und in deren Bewohnern sie darum mögliche Abonnenten vermuteten. Sie, Walden und Kokoschka. Sie natürlich als Prinz von Theben, in Pluderhosen, mit Turban und einer Zigarette an langer Spitze. Walden »scharfäugig durch dicke Brillengläser umherspähend, mit spitzem Vogelkopf, großer Hakennase und gelbem langen Haar, in einem verschlissenen Gehrock, dem unvermeidlichen hohen Stehkragen und seinen gelben Schnabelschuhen«9. So wird Oskar Kokoschka sich erinnern, der Maler, der Waldens Frau auch außerordentlich gut gefällt. Kokoschka war »ebenso komisch-elegant noch vom kaiserlichen Schneider in Wien gekleidet«. In Bonn wurden sie »von den zusammengelaufenen Passanten belacht, verhöhnt, von Kindern bejubelt und von verärgerten Studenten fast verhauen«10. Sie wollten eigentlich noch viel weiter, besaßen aber kein Reisegeld mehr.
Else Lasker-Schüler hat die Projekte ihres Mannes zu den ihren gemacht – zuerst den Verein für Kunst und nun auch noch diese Zeitschrift –, obwohl sie wusste, dass sie dem kaufmännisch keinesfalls gewachsen waren.
Um 1910 tritt eine neue Dichter-Generation an. Sie veröffentlicht nicht zuletzt im »Sturm«. © Wikimedia
Nell Roslund, bald Nell Walden, wird das später rückblickend genauso sehen: »Geld an sich interessierte ihn nicht. … Er war in seinen persönlichen Ansprüchen fast spartanisch zu nennen. Doch erforderte der ›Sturm‹ viel Geld, und Waldens kaufmännische Fähigkeiten waren leider ›gleich null‹, wenn er auch selber davon überzeugt war, daß er sie in reichem Maße besitze.«11
Else Lasker-Schüler ist noterprobt. Aber Notstände sind steigerbar. Und es ist doch etwas anderes, zu zweit in Not zu sein als allein.
Nicht lange und auch die Leser des »Sturm« erfahren: Herwarth! Gestern war ein Monstrum im Café mit orangeblonden, angesteckten Locken, und wartete scheints bis Mitternacht auf Dich, Herwarth. Leugne nur nicht, Du kennst sie;… Nachher ging sie in die Telephonzelle… Im Falle des Cafés des Westens steht die Telefonzelle im Café und nicht davor, und der deutsche Kaiser steht als Statue und oberster Fernsprechwächter obendrauf. … ich und Zeugen hörten sie unsere Nummer rufen, aber Deine Sekretärin musste wohl schon gegangen sein, denn das Monstrum stampfte wütend mit dem Fuß, daß die gläserne Tür des kleinen Kabinetts klirrte. Und so stampfen nur Verhältnisse! Es wäre doch eine Gemeinheit, wenn Du mir untreu wärst. Jemand hat hier im Café gesehn, wie sie Dir unterm Tisch eine ihrer künstlichen orangefarbenen Locken schenkte. Aber was wollte ich noch sagen: heute morgen war Minn bei mir in der Wohnung; auf seiner stolzen Schulter trug er einen großen Reisekorb, mich darin sofort einzupacken nach Tanger.… Also bleibe noch ruhig am Nordpol, Du und Kurtchen.
Am Nordpol von Berlin? Was für eine Bannung des Schmerzes im Lachen. Sie möchte das Lachen grenzenlos machen: O, Herwarth, o, Kurtchen! Wie sich die Welt verändert hat; früher war die Nacht schwarz, nun ist sie goldblond.
Karl Kraus ist nicht wohl bei den »Briefen aus Norwegen«. Das ist verständlich, denn auch er kommt darin vor, und normalerweise ist er es, der andere vorkommen lässt. Oder eben nicht. Ob und wie, entscheidet er. Hier entscheidet er gar nichts: Lieber Herwarth, edles Kurtchen! Ich habe mir seit einigen Tagen vorgenommen, Karl Kraus, der Dalai-Lama in Wien soll außerdem Minister werden. Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr anders als auf einem mächtigen Stuhl sitzen. … Vielleicht würde sie dann Hofdichterin, mit einer Apanage? Ich hätte die Angelegenheit Dalai-Lamas längst zur Sprache gebracht, aber die Leute, wie gesagt, lächeln immer langwierig, wenn ich was sage… Der kleine Jakobsohn hat zweiundzwanzig Nummern der Fackel bestellt; ich habe Dir sofort gesagt, Herwarth, er ist gar nicht so schlimm, es wird ihn auch noch der Sturm umreißen. – Die »Sturm«- und »Fackel«-Autorin flüchtet sich in eine Normalität, die es vielleicht schon nicht mehr gibt, in die Normalität des gemeinsamen Kunstkampfes.
Und sie hat prophetische Gaben: Zwar wird Kraus nicht Minister, dafür aber Diktator. Doch sie wird nicht Hofdichterin, sondern entlassen. Denn ab Dezember wird Karl Kraus nicht nur der Chefredakteur der »Fackel« sein, sondern zugleich alle Autoren. Ein Mann, ein Blatt. Die bisherige »Fackel«-Autorin wird das lange nicht verstehen, eigentlich nie. Der Brief an die ewigen Nordpolfahrer endet: Ich kann Euch heute nur eine Postkarte schreiben; der Bischof telefoniert eben, ob wir gleich etwas in Sibirien spazieren gehen wollen. Wir nennen nämlich die Gegend am Lützowerplatz in Charlottenburg Sibirien.
Der »Bischof«, Caféhausgast wie sie, war bis eben nur ein Hintergrundmann, viel unschärfer als Minn und der Slawe. Er scheint zu dem Typus zu gehören, der das Unglück von Frauen bemerkt und dem sie es darum erzählen. Mag sein, dass sie ihn deshalb den »Bischof« nennt. Weil er ein Tröster ist und von der Erotik des Trösters. Er bekommt später noch eine sehr schöne Trost-Szene, die wirklich war, und ist überaus böse, als er sie im »Sturm« lesen muss. Vielleicht weiß der Bischof schon alles, als sie durch Sibirien spazieren gehen. Der werdende Diktator in Wien erfährt es gerade.
Irgendwann im September empfängt Karl Kraus einen Brief von Else Lasker-Schüler, den er nicht in der »Fackel« drucken könnte. Dazu ist er zu schutzlos. Kraus, für alle Welt der große Unvertraute – ihr könnte keiner vertrauter sein: Ich bin so wütend, ich bin so wütend ich habe schon alle Stühle alle Tische Bettlehne Schrank totgeschossen mit einer Pistol. Die Art wie ich belogen wurde von Anfang an, ist so grenzenlos.
Alle Stühle, alle Tische, Bettlehne und Schrank? Eine weiß, Jahre später, von noch einem Beinahe-Todesopfer: Mit dem Revolver in der Hand erscheint die Dichterin – der Berichterstatterin zufolge – in der Redaktion des »Sturm« am Potsdamer Platz 18. Dort gibt es nur Bücherregale vom Boden bis zur Decke, einen kleinen Diwan, Waldens Riesenschreibtisch und darüber eine große runde Gipsplakette mit dem Kopf von Franz Liszt. Herwarth Walden glaubt nämlich, er habe Ähnlichkeit mit ihm, außerdem hat er in seiner Jugend einen Liszt-Wettbewerb gewonnen. Allerdings ist der Komponist nicht mehr gut erkennbar, denn Oskar Kokoschka hat bereits mit Schwarz, Rot und Weiß darübergemalt und aus dem Liszt sein eigenes Porträt gemacht. Außerdem befindet sich noch eine Hand im Raum, eine gelbliche Hand. Es ist die Hand von Karl Kraus, sie ist aber auch nur aus Gips und außerdem auf einer Ebenholzplatte befestigt.
Wenn Kraus könnte, würde er die Hand wohl nun zurückziehen aus Waldens Büro und Leben, wie er es in Wirklichkeit auch tut. Wer eine Else Lasker-Schüler gegen eine kleine Schwedin tauscht, mit dem spricht ein Karl Kraus nicht mehr. Und noch jemand ist anwesend. Eine blonde Sekretärin, die Sekretärin ihres Mannes. Die Eindringlingin betritt also mit der Waffe in der Hand die Redaktion, sieht die Sekretärin, hebt den Lauf, zielt auf die Sekretärin und will …?
Schwer zu sagen, was sie will. Lockenundame erschießen? Alles erschießen, was blond ist? Hat sie da Zeit für langwierige, kleinliche Identitätsprüfungen? Immerhin ist sie eine Dichterin. Die Berichterstatterin ist ausgerechnet Lockenundame selbst, Nell Walden, die Nächteverfärberin.12 Herwarth Walden, schließt sie ihren Bericht, soll seiner Nochfrau im letzten Augenblick den Revolver aus der Hand geschlagen haben.
Alles böse Nachrede? Else Lasker-Schüler kann ungebärdig, trivialromanhaft sein in ihrem Zorn. Nur die mittleren Temperamente begnügen sich grundsätzlich mit mittleren Reaktionen.
Aber hat sie denn Grund, so maßlos enttäuscht zu sein? Ihr Mann hat nur das Gleiche getan wie sie. Er hat sich verliebt. Schon möglich, dass Else Lasker-Schüler der Ansicht ist, für solche Dinge sei die Literatur da. Und für jemanden, der wie ihr Mann das Sich-Verlieben nicht zum literarischen Ereignis umschmelzen kann, ins Ewigkeitsfeste also, scheint es sehr unpassend. Doch wäre das eine hochmütige Sicht der Dinge, und sie mag den Hochmut nicht.
Nein, es muss etwas anderes sein. Das Nichtoffene, das Nichtöffentliche seiner Liebestat? So schreibt sie es Kraus genau zwei Jahre später: Ich sagte immer alles, auch die Schwärmerei damals zu Oskar Kokoschka und alles. Er heimlich.13
Und nun? Mag sein, sie hofft, dass das Monstrum wieder verschwindet wie ein böser Traum. Vielleicht schreibt sie auch darum weiter ihre »Briefe nach Norwegen«, um alles in der Schwebe zu lassen, keinen Endpunkt zu setzen.
Lockenundame sieht auf den Fotos erstaunlich bieder aus, gar nicht wie die große Verführerin, eher hausfrauenhaft. Ist es gar das, was Walden so begeistert? Dass jemand einfach – ganz normal sein kann. Nell Walden erklärt das so: »In seiner ersten Ehe hatten er und seine Frau, Else Lasker-Schüler, eigentlich nur im Kaffeehaus gelebt. Ein behagliches, eigenes Heim kannte er nicht. Als ich in sein Leben trat und für uns eine Wohnung einrichtete, fand er diese sehr hübsch und ging kaum noch ins Café.«14
Tapfer berichtet die Briefschreiberin weiterhin von dort, obwohl: Ich habe das Café satt, aber damit will ich nicht behaupten, daß ich ihm Lebewohl für ewig sage, oder fahre dahin Zigeunerkarren. Im Gegenteil, ich werde noch oft dort verweilen. Gestern ging es Tür auf, Tür zu, wie in einem Bazar; nicht alles dort ist echte Ware: Imitierte Dichter, falsches Wortgeschmeide, Similigedanken, unmotivierter Zigarettendampf.… Warum es einen so ins Café zieht! Eine Leiche wird jeden Abend dort in die oberen Räume geführt; sie kann nicht ruhen. Warum man überhaupt in Berlin wohnen bleibt? In dieser kalten, unerquicklichen Stadt. Aber die so fragt, weiß die Antwort längst: Eine unumstößliche Uhr ist Berlin, sie wacht mit der Zeit, wir wissen, wieviel Uhr Kunst es immer ist. Und ich möchte die Zeit so gern verschlafen.
Daten haben die »Briefe nach Norwegen« nicht, wie auch Else Lasker-Schülers übrige Briefe nur selten eine Zeitangabe tragen, schon weil sie die Botschaften verkleinern würden, als ob sie an etwas so Zufälliges wie einen Tag und einen Monat gebunden seien.
Auch von Minn und dem Slawen berichtet sie weiter – es wäre kleinlich, gerade jetzt aufzuhören. Dabei weiß sie nicht einmal, ob Minn noch in der Stadt ist.
Nein, das Spiel macht keinen Spaß mehr.
Wer aber verträgt den Kopf- und Herzsprung!… Ich bin die letzte Nuance von Verlassenheit, es kommt nichts mehr danach.
IV.
Aber sie muss weiterspielen. Sie hat hier ein öffentliches Amt. Sie hat ein öffentliches, »Sturm« für »Sturm« nachlesbares Gesicht zu verlieren. Im Café wird man den Punktestand mitzählen.
Noch immer beginnen die Briefe mit Liebe Nordländer! oder nur mit Herwarth! Einmal sogar mit Lieber Herwarth!
Und es ist doch gut, dass sie diese Briefe hat. Da kann sie ihren Mann öffentlich darum bitten, Gedichte, die an andere Männer gerichtet sind, abzudrucken. Sie spielt noch immer besser als alle. Herwarth! Bitte, laß diese Gedichte im Sturm drucken, sie sind an Tristan –vielleicht glaubt er dann– bei Gedichten kann man nicht lügen.
Wenn wir uns ansehn
Blühn unsere Augen.
…
Oder:
Herwarth!… noch ein Gedicht für den Sturm. Ich bin rasend verliebt in jemand, aber Näheres sag ich nicht mehr. So kann es immer an Dich gerichtet sein.
Du bist alles was aus Gold ist
In der großen Welt.
Ich suche deine Sterne
Und will nicht schlafen.
Wir wollen uns hinter Hecken legen
Uns nie mehr aufrichten.
…
Wenn ich tot bin,
Spiele Du mit meiner Seele.
Ein bisschen untergehen darf sie, aber das muss Stil haben, großen Stil. Freunde wollen helfen, wollen beide wieder verbinden. Als ob das so einfach wäre. Sie sagt ihrem Mann gleich, dass es das nicht ist:
Was ist das Leben doch für ein eitler Wettbewerb gegen das Aufschweben zur Ewigkeit. Ich bin erregt, ich hatte schon einige Male heute das Gefühl, ich muß sterben. Wenn ich auch im Bilde lebe, Bild bin, aber meine Eindunkelung Dir gegenüber macht mir schon lange Schmerzen. Wir können uns beide kaum mehr sehen, Herwarth; alle die Leute, die uns wieder zusammenbringen wollen, sind nichts weiter als Ölschmierer oder Terpentinwäscher, uns auffrischen wollen sie; über die echten Farben unechte, gezwungene schmieren. Sie möchte eine Brücke besitzen und jeder müsste ihr Brückenzoll zahlen. Karl Kraus’ Sekretär hat sie ein Gedicht geschickt, auch einen Brief dazu, den soll ihr Mann ruhig lesen: Es war Nacht, als Ihr Brief kam, ich hatte mich gerade aufgehängt, konnte nur morgens den Baum nicht wiederfinden. Ob das ein Glück für Ihr Flugblatt ist, kann ich nicht beurteilen. Denn ich bin noch sehr angegriffen von der Aufhängerei und von allem Drum und Dran. Machen Sie gute Stimmung für mich, mir fehlt jede. Auch ist Berlin so langweilig, es ist weder interessant zu leben, noch zu sterben, was ich nun beides beurteilen kann.
Und dann: Liebe Jungens! Ich habe vor, regierender Prinz zu werden. Müßten mir nicht alle Menschen Tribut zahlen?
Aber der real existierende Prinz – zwischen Sterbebäumen und Allmachtsphantasien hin und her schwankend, dabei kann er nicht mal die Lockenundame aus der Welt schaffen – liegt jetzt sehr oft leidend im Bett und öffnet nicht mal seine Post. Walden kommt nur noch selten in die gemeinsame Wohnung in der Katharinenstraße, Gartenhaus, Parterre, Ku’damm-Ende. Und als er doch kommt, findet er unter der ungeöffneten Post auch einen Brief von Karl Kraus, den er liest und ihr nicht zeigen will.
Er sagt nur, sie solle den Dalai Lama nicht mehr erwähnen in ihren Briefen im »Sturm«. Kraus habe sich beklagt. Sie beklagt sich zurück, und natürlich werden die beiden Briefe, die schon geschrieben sind, erscheinen wie sie sind. Mit Kraus drin, 8. November 1911: Ich grüße Sie Excellenz, seien Sie meiner großen, allergrößten Ausnahmeverehrung und allergrößten Achtung gewiß, aber auch meinem unbeugsamen Eigenwillen und meiner unerschütterlichen Stärke. Ihr Prinz von Theben. Jussuf (Else LSchüler).
Kraus interveniert noch einmal, aber nicht beim Prinzen. Das ist unvorsichtig; er begibt sich in höchste Gefahr verstoßen zu werden, denn der Prinz von Theben, der Ohnmächtigste und Allherrschendste zugleich, kann rücksichtslos sein auch gegen sich selbst. Kränkungen kann er nicht verwinden, und dieses Sich-an-Dritte-Wenden ist eine große Kränkung:
Werter Herr Minister.… Mir geht es schlecht; und ich habe eine Antwort von ihnen an mich Selbst erwartet. Ich bin nicht zu verwöhnen, Sie brauchen keine Angst haben. Ich mache mir nie eine Ehre aus etwas. Ich erkläre hiermit–: unsere freundschaftlichen sowie diplomatischen Beziehungen für erledigt. Der Prinz von Theben. Ich mißbrauche Ihre Briefe nicht. Ich werfe jeden Brief nach gelesener Tatsache fort.15
Es wäre eine harte Bilanz dieses Herbstes, nicht nur einen Mann, sondern auch den besten Fern-Vertrauten zu verlieren. Dabei wollte sie doch Ende November bei Kraus in Wien vortragen. Aber sie nimmt jetzt alles in Kauf, Prinz bleibt Prinz, auch ein an Leib und Seele kranker. Und krank ist sie fast immer kurz vor Ende dieses Jahres. Paul Zech, der Mitdichter und Mitelberfelder – und schon deshalb eine Person ganz besonderen Vertrauens –, erfährt es am 3. Dezember: Ich war schwer krank, bin sozusagen mit Opium ernährt worden vier Wochen.
Eigene Briefe in einer Zeitschrift zu haben, eine Instanz zu sein also – vorwiegend für Eigenherzkunde, aber auch für alles, was sonst noch geschieht –, verführt doch, jedem zu sagen, was man denkt, auch denen, denen man es nicht sagen sollte, weil man sie noch brauchen könnte. Und ihr ist jetzt so zerstörerisch zumute – so selbstzerstörerisch, so existenzzerstörerisch auch. Sie nimmt keine Rücksicht mehr, schon gar nicht auf sich.
Musste dieser offene Brief an Paul Cassirer, den Kunsthändler, sein, nur weil der eine Ausstellung machen wollte von einem, dessen Bilder sie nicht halb so gut fand wie die Kokoschkas, nur ähnlich? Kokoschka hatte er vorher ausgestellt, und nun einen Halb- oder Viertel-Kokoschka? Hat Cassirer das nötig? Hat nicht auch er ein Gesicht zu verlieren? Ich hörte mit nicht geringem Erstaunen, daß Sie eine zweite Ausstellung von Kokoschka in Ihren Sälen veranstalten wollen, Kopien seines Genies. Warum das schon bei seinen Lebzeiten?… Ich fordere Sie allerhöflichst auf, Sir, diese Ausstellung zu unterlassen. Oskar Kokoschka ist kein Zwilling, er hat noch nicht einmal einen Vetter, aber einen Meuchelfreund.
Das ist stark, aber nicht unbedingt selbstmörderisch. Schließlich hat Cassirer noch nicht davon gesprochen, ihre Zeichnungen ausstellen zu wollen, das macht er erst viel später. Bei Max Reinhardt ist das schon etwas anderes. Den Intendanten des Deutschen Theaters bloßzustellen, der gerade die ernstesten Pläne mit ihrem Schauspiel »Die Wupper« hat, ist eindeutig selbstmörderisch. Und das nur wegen Hofmannsthals »Jedermann«. Das Stück hatte ihr entschieden missfallen: Ich war nämlich in Jedermann oder heißt es Allerlei? Ich glaube, es heißt Allerlei für Jedermann oder Jedermann für Allerlei. Und die Autorin empfiehlt dem Intendanten ein Kölner »Hänneskentheater« aufzusuchen, weil bei gleichem Anspruch doch ein gewisser Vorzug auszumachen sei: Die Figuren seien lebendig. Ein Vorzug, der bei ungleich höherem Anspruch – das muss sie unbedingt noch sagen – auch auf ihr eigenes Theaterstück zutreffe. Und wie lebendig alles dort sei!
Sie weiß schon genau, wie das ausgeht: Nun wird mein Stück eine Geisel sein in Reinhardts Händen, er wird meine Dichtung ins Feuer werfen oder sie mit ein paar Phrasen seiner Sekretäre wiedersenden lassen. Gleichviel, ich will keine Rührung noch Sentimentalität aufkommen lassen, Herwarth, ich muss meine Dichtung opfern der Wahrheit, dem »Ehrgeiz« zum Trotz. Der Prinz von Theben wirft die letzte Fessel von sich.
Was für ein Jahresende! Nichts als Scherben. Und die Prager Lesung – verschoben, ganz abgesagt? Was heißt, die Prager haben kein Geld? Karl Wolfskehl, Freund, Dichter, Münchner Mittelpunkt-Bohemien, vertraut sie am 19. Dezember an, wie es um den Prinzen und seine Heere steht: … ich verstecke immer meinen Kopf in den Sand der Wüste und muss weinen. Und Krieger sollten nicht weinen, darum schäm ich mich. Und ich wollte Dir erst schreiben wenn es mir besser ginge, aber wir sind schon alle fast verhungert. So schlimm ist es Ramsenit – so heißt Wolfskehl in der Else-Lasker-Schüler-Welt –, und ich habe keine Hoffnung mehr. Aber das darf dich nicht rühren, sonst wankt deine Pyramide.… ich kann keine Träume mehr deuten, nur meine noch, die sind abgebrannt zu Asche und leuchten nicht mehr blau, wie meine wilden Perlen.
Im Februar 1912 lesen die Freunde des »Sturm« die letzten »Briefe nach Norwegen«. Herwarth! Ich muß viel denken, ich hab auch wieder viel Angst. Und mein Herz spür ich immer so komisch, ich kann nachts nicht schlafen und träume mit offenen Augen Wirklichkeiten. Es gibt einen Menschen in Berlin, der hat dasselbe Herz wie ich eins habe, dein Freund der Doktor. Sein Herz ist karriert: gelb und orangefarben mit grünen Punkten. Galgenhumor! Und manchmal ist es schwermütig, dann spiegelt sich der Kirchhof in seinem Puls. Das muß man erleben! Aber meins ist manchmal doppelt vergrößert, oder es ist purpurblau. Wenn er wenigstens Schwärmerei des Herzens kennen würde; aber die Unruhe fühlt er manchmal. Ich erlebe alle Arten des Herzens, nur den Bürger nicht. O, die Herzangst, wenn das Herz versinkt in einen Wassertrichter oder zwischen Himmel und Erde schwebt in den Zähnen des Mondes oder es einsinkt– o, der Augenblick, wenn meine Stadt Theben-Bagdad einsinkt.
Und zuletzt, gleich nach dem Telegramm folgenden Wortlauts: Eben regierender Prinz von Theben geworden. Es lebe die Hauptstadt und mein Volk!, folgt noch ein Gruß an die Norwegenreisenden: Ich hoffe, Dich haben meine Briefe nicht gelangweilt, oder hat Kurtchen oft gegähnt? Lies noch einmal meinen Brief, Herwarth, der mit den Worten endet: Ich bin das Leben. Wie stolz! Nun bin ich wie ein durchsichtiges Meer ohne Boden, ich hab keinen Halt mehr. Du hättest nie wanken dürfen, Herwarth. Was helfen mir nun Deine bereitwilligen Hände und die vielen anderen Finger, die mich bang umgittern, durch die meine Seele grenzenlos fließt. Bald ist alles zu Tode überschwemmt, alles ist in mir verschwommen, alle meine Gedanken und Empfindungen. Ich habe mir nie ein System gemacht, wie es kluge Frauen tun, nie eine Weltanschauung mir irgendwo befestigt, wie es noch klügere Männer tun, nicht eine Arche habe ich mir gezimmert.
Nur selten, fast nie, spricht diese Frau sich ungeschützt aus, ohne Bild, ohne Verfremdung, ohne Spiel. Hier tut sie es, und so werden die Briefe an ihren Mann – ganz anders als begonnen – zum Ende doch Liebesbriefe, wenn auch Nachrufe auf das, was sie gemeinsam waren: Ich bin ungebunden, überall liegt ein Wort von mir, von überall kam ein Wort von mir, ich empfing und kehrte ein, so war ich ja immer der regierende Prinz von Theben. Wie alt bin ich, Herwarth? Tausend und vierzehn. Ein Spießbürger wird nie tausend und vierzehn, aber manchmal hundert und vierzehn, wenn er es »gut« meint. Herwarth, warst Du mir treu? Ich möchte aus Geschmacksgründen in Deinem Interesse, daß Du mir treu warst. Nach mir durftest Du Dich nicht richten, ich hab den Menschen nie anders empfunden wie einen Rahmen, in den ich mich stellte; manchmal, ehrlich gesagt, verlor ich mich in ihm, zwei waren aus Gold, Herwarth, an dem einen blieb mein Herz hangen. Herrlich ist es, verliebt zu sein, so rauschend, so überwältigend, so unzurechnungsfähig… Wie bürgerlich ist gegen die Verliebtheit die Liebe, oder Jemand müßte mich geliebt haben. Hast Du mich geliebt, Herwarth? Wer hat mich geliebt?
Ich würde mich im selben Augenblick zu seinen Füßen niederwerfen wie vor einem Fels, wie vor einem Altar, ich, der Prinz von Theben. Ich würde den Liebenden mit mir tragen in den Tod…
Im Juli wird Karl Kraus erfahren: Wertester Herzog, Sie wissen gewiß, daß Herwarth und ich schon lange jeder einzeln sind– ich sehe ihn gar nicht und wir sind jeder für uns. Und als müsste sie sich noch immer selbst davon überzeugen: Ich und H. sindunerschutterlich auseinander; sehen und sprechen uns nicht. ich habe eingesehn, wir sehen und fühlen anders, wir spielen und lieben anders, ich bin Krieger mit dem [gezeichnetes Herz] er mit dem [gezeichneter Kopf im Linksprofil mit Auge und Ohr]
Material:
ich: Glas mit Burgunder
er: Porzellan mit Mokka16
Krieger ist das Schlüsselwort. Else Lasker-Schüler warf ihrem Mann nicht Ehebruch, sondern Fahnenflucht vor. Seite an Seite hatten sie gestanden im Kampf für die neue Kunst. Und nun ersetzte er sie durch eine Dilettantin.
Der Prinz von Theben ist zu Beginn des Jahres 1912 eine dreiundvierzigjährige verlassene Frau mit unehelichem Kind. Paul, der geliebte Sohn, inzwischen zwölf Jahre alt, ist nicht Herwarth Waldens Kind und nicht das Kind ihres ersten Mannes. Ab jetzt wird sie allein für Paul sorgen müssen.
Nie wieder wird sie eine eigene Wohnung besitzen.
Im letzten Brief nach Norwegen, ganz am Ende, hat sie über das Wohnen geschrieben: Ich flüchte in das Dickicht, Herwarth, ich habe immer das Haus gehaßt, selbst den Palast; wer auch nur ein Gemach sein Eigentum nennt, besitzt eine Häuslichkeit. Ich hasse die Häuslichkeit, ich hasse drum auch die letzte Enge, den Sarg. Ich gehe in den tiefsten Wald, Herwarth… Ich lege mich unter die großen Bäume und strecke mich mit ihren Wurzeln, die sich immer umhalten, wie knorpliche Schlangen.
Man hat Else Lasker-Schüler stets zu sehr aufs erste Wort geglaubt. Sie sagt, wie bürgerlich ist gegen Verliebtheit die Liebe, und man hat es geglaubt. Dabei geht dieser Satz so großartig weiter: Oder Jemand müßte mich geliebt haben. Sie sagt, sie hasse die Häuslichkeit, und man hat es wieder geglaubt. Wie simpel, wie uninteressant wäre das ohne den Widerruf, ohne das Nichtaushaltenkönnen der eigenen Wahrheiten. Meist steht der Widerruf schon im selben Satz. Ihr Gang ins Dickicht ist eine Flucht. Und besitzt, nein, beherrscht der Prinz von Theben statt nur eines Hauses, eines Palastes nicht eine ganze Stadt?
Es ist nicht wahr, dass sie immer das Haus gehaßt hat. Sie liebte es, denn es steht für die Möglichkeit, eine Heimat haben zu können. Alle Erwachsenen sind Heimatvertriebene. Und Else Lasker-Schüler ist eine Heimatdenkerin, eine Heimatdichterin im tiefsten Sinne des Wortes. Niemand hat ihn so formuliert – so in ihrem Sinne formuliert – wie Ernst Bloch: Heimat ist das, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war.
Manchmal fasst sie das Verlorene in einen Satz: Ich wollte, ich wäre Jemand sein Kind.
Das Bürgerkind Else Lasker-Schüler hat den letzten bürgerlichen Halt verloren.
V.
Wir sind nur auf dem Wege, das Leben ist nur Weg, hat keine Ankunft, denn es kommt nirgendwo her. – Tiefstes Weltwissen steht neben scheinbar Alltäglichstem, das ist fast immer so in diesen Briefen. Das ist ihre Fallhöhe, diese scheinbare und doch so absichtsvolle Unordnung. Die bürgerliche Literaturkritik fällt darauf herein und verwechselt es mit Nichtkönnen, setzt ihr höhnischstes Lachen auf und beharrt auf der Unterscheidung von Höherem und Niederem. Doch diese Unterscheidung zählt für die Besucher des Cafés des Westens längst nicht mehr – gerade dieses Wissen eint sie. Es ist eine Bürger-Unterscheidung, und das Hohe der Bürger ist auch danach.
Else Lasker-Schüler muss nicht auf eine Nachwelt warten, die sie versteht. Sie könnte immer wieder die Rezension Paul Zechs lesen, geschrieben, als die »Briefe nach Norwegen« als Briefroman erscheinen. Nur selten wird man von einem anderen Menschen so verstanden, nur selten wird etwas bis dato ganz und gar Unerhörtes, Freches, eine Miss-Form, eine Un-Form von einem anderen Menschen so verstanden, und falls doch, hat er oft nicht die neue Sprache dafür. Paul Zech besitzt sie. Er schreibt über »Mein Herz«: »Sie glaubt nicht an die Realität der Kunst, sie glaubt an die Wahrheit der Illusion und handhabt das Material der Sprache, von den Instinkten eines rein torenhaften Spieltriebs geschwellt, wie eine heilige Sache. Ihr Roman ist – im Sinn des Dogmas – höchste Formlosigkeit, aber ebenmäßig geschliffene Kugel inneren Erlebnisses, getragen vom Blut der Herzhingabe.« Und dabei: was für eine »Kraft des Neuschöpferischen«. In diesen Briefen »wogt die ganze Erlebnisart einer vergeistigten Weltseele vorüber, um dort zu landen, wo noch keines Fuß je und je den Boden betrat in Ungestraftheit. Kunst ist ihr Mittel zur Befreiung aus dem umgitterten Sein der Alltäglichkeit.«17 Ob Zech dabei ahnt, welche Katastrophe ihres Lebens sich mit diesen Zeilen maskiert? »Sie zerschlägt alle Formen der Tradition und schafft in höchster Ergriffenheit ein Neues in Sprache, Gliederung und Aufbau. Schonungslos gegen Mit- und Umwelt. Alle Figuren stehen maskenentrissen und krümmen sich unter der Durchleuchtung ihres seherischen Gefühls.« Nie sei eine künstlerische Szene – das Genre der Kollegenliteratur steht längst in voller Blüte – so porträtiert worden, drei vier knappe Sätze genügen, und es »stehen erlauchte Größen da, plastischer und umgrenzter als in dickleibigen Essay-Büchern. Und nie hat Wortkunst solche Triumphe gefeiert, als in den Aphorismen, die wie silberne Glaskugeln in der Flutung der Geschehnisse auf- und niedersteigen.«18
Und noch jemand denkt an sie, gerade jetzt, im Jahr 1912, aber sie wird das erst viel später erfahren:
»Und ich bin der arabische Schüler, der das Byssus-Gewand der Stern-Herrin zu entfalten betet.
Ich hasse den Tag und die schamlose Sonne.
Ich liebe die Nacht und das judäische Mädchen Tino. Die Jephta-Tochter.
Die Peter Hille der Kleider enthüllte, als er die Byssus-Falten der Prinzessin zerglättete.
Es ist lange her. …
Ihr versteht viel, alles versteht Ihr. (Was man Euch vorlegt.) Aber sagt mir: ich versteh, daß dem schwarzen Schwan Israels der Diamant in die Stirn dringt und wehe tut, sehr wehe.«19 Senna Hoy ernennt sie zur Hohepriesterin der Liebe, ja zur alternativheiligen Trinität: »Und Opfer und Priesterin und Göttin ist uns Tino./Ihr versteht mich./Ihr versteht mich doch.«
Es ist lange her?
Den Namen Tino hatte Peter Hille ihr gegeben. Er hat sie zur Dichterin gemacht, hat sie zum »schwarzen Schwan Israels« ernannt. Es wird für immer ihr größter Ehrentitel bleiben. Und Senna Hoy, der Anarchist, nun langsam in einem Moskauer Gefängnis sterbend, war beider Zeuge.
Turm oder nicht Turm? Eine Kindheit im Wuppertal
In Elberfeld an der Wupper geboren, in Gedanken im Himmel, betreue ich die Stadt Theben und bin ihr Prinz Jussuf. Ich bin weder siebzehn noch siebenzig Jahre, habe keine Uhr und keine Zeit. Meine Bücher laufen so herum und werden einmal im Meer ertrinken. Geld habe ich einmal sehr viel und einmal gar keines.
Früher habe ichs manchmal nicht geglaubt, jetzt aber weiß ich es; ich bin die Else Lasker-Schüler– leider. Auf meinem Geburtsschein steht noch immer Goldelse; aber ich bin nicht zu versetzen. In all den Jahren, die ich lebte, ist mir eines ganz gewiß geworden: ich kann keinen Bohnenkaffee vertragen.
In die Schule ging ich sehr ungern; wenn ich auch immer irgendwo anders war im Gedanken, so rettete mich das doch nicht vor den vielen Strafarbeiten und dem Nachsitzen im Schulzimmer in Elberfeld an der Wupper, darin die Arbeiter und Arbeiterinnen die gefärbte Baumwolle auf ihre Echtheit ausprobierten. Ich aß immer Korinthenbrötchen, die wir uns während der Pause neben dem Schulhof in einer kleinen Bäckerei holten. … Mit fünf Jahren dichtete ich mein erstes Buch; es erschien in einer Auflage von 30000 Stück bei Ullstein. Seitdem leiste ich nichts mehr. Mit elf Jahren wurde ich gelinde aus der Schule genommen; Fräulein Lichtenstein, die Schwester von Hauff-Lichtenstein kam in unser Haus am Fuße des Waldes und unterrichtete mich, aber ich lernte nicht bis drei zählen.
Mit diesem Lebenslauf wird Else Lasker-Schüler einmal in eine Anthologie aufgenommen, die – laut Titel – »Führende Frauen Europas« vorstellt.20 Sie erscheint 1930.
Prüfen wir die Einzelheiten.
Mit fünf Jahren dichtete ich mein erstes Buch; es erschien in einer Auflage von 30000 Stück bei Ullstein. © Stadtbibliothek Wuppertal, Else-Lasker-Schüler-Archiv
In Elberfeld an der Wupper muss in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein kleines schwarzhaariges Mädchen auf dem Turm seines Elternhauses gestanden haben, das schrie, so laut es konnte, hinab auf die anderen Elberfelder: Ich langweile mich so!
Daraufhin, berichtet das Mädchen, als es erwachsen ist – aber richtig erwachsen wird es nie –, seien zwar nicht alle Elberfelder unter dem Turm zusammengelaufen, aber seine Mutter sei gekommen und habe ihm ein neues Spiel erfunden, eines mit Knöpfen. Es wird immer Else Lasker-Schülers Lieblingsspiel bleiben. Sie spielt es ihr ganzes Leben lang, zuerst mit Knöpfen, dann mit Buchstaben, mit Wörtern. Wie die Buchstaben, die Wörter hat jeder Knopf eine andere Form und Farbe. Vor den Buchstaben legte sie die Knöpfe zu Knopfstrophen.
Die Germanisten sind schon immer sehr unzufrieden gewesen mit den autobiographischen Auskünften der Dichterin. Sie sind die geborenen Spielverderber und fangen gleich an: Turm? Vom Turm ihres Elternhauses hat sie gerufen? Das ist unmöglich. Das Haus der Schülers besaß gar keinen Turm!
Sie haben ihr wohl auch nicht geglaubt, dass sie mit fünf Jahren ihr erstes Buch dichtete, obwohl das sehr gut zu einer anderen Altersangabe passt, die sie viel früher gab und sich unmöglich so lange gemerkt haben konnte: Mit vier Jahren lernte ich zum Zeitvertreib von der Gouvernante schreiben. Jedem Buchstaben malte ich ein Tuch um den Hals, da er fror, es war im Winter.21 Darf man wirklich Else Lasker-Schüler’schen Höhen- und Zeitbegriffen vertrauen?
Die Biographen haben auch schlechte Erfahrungen mit ihrem Geburtsdatum gemacht. Im Jahr 1958 wurde es erstmals richtig genannt, in der Dissertation von Karl Josef Höltgen »Untersuchungen zur Lyrik Else Lasker-Schülers«. Schon Heine fand, jeder solle das Geburtsdatum haben, das zu ihm passt. Er wählte die Silvesternacht 1799, um, gerade noch ein Sohn des alten Jahrhunderts, zugleich der erste Mann des neuen Jahrhunderts zu sein. Else Lasker-Schüler liebte Heine sehr. Auch war er gewissermaßen ein Nachbar – aus Düsseldorf am Rhein.
Geboren also ist Else Lasker-Schüler nachweislich nicht am 11. Februar 1876 oder 1891 – dieses Datum wird sie im Alter bevorzugen –, sondern vielmehr am 11. Februar 1869, in der Herzogstraße, in dem Haus, in dem sich ursprünglich auch das Bankgeschäft ihres Vaters befand.
Bankier? Das war eine Berufstätigkeit, die der Tochter später sehr unpassend für ihren Vater schien. Warum bloß müssen alle Juden eine Bank haben, selbst wenn sie eine haben?
Aron Schüler hatte wie Heines Vater ursprünglich im Konfektionsgeschäft angefangen und »bunte Westen« verkauft, als Bankier verkaufte er vor allem Papiere, wie eine Anzeige aus dem Geburtsjahr seiner jüngsten Tochter vermerkt: »Das Bank-Geschäft von A. Schüler, Elberfeld, besorgt den An- und Verkauf sämmtlicher Staats- und Eisenbahnpapiere mit 1/3% Provision franco aller Spesen«. Später muss die »Schülerbank« sich an der Finanzierung des Baubooms der Gründerjahre beteiligt haben, weshalb die Tochter ihn zum Architekten ernennen wird. Und wenn die Bank doch einmal erwähnt werden muss, dann als ein Typus Bank, von dem man nie zuvor gehört hatte und nie wieder hören sollte: eine Bank für Müde und Beladene. Auch als Immobilienmakler – in der Industriestadt Elberfeld herrschte durch den steten Zustrom verarmter Bauern und kleiner Handwerker immerfort Wohnungsnot – war Aron Schüler nach Auskunft seiner Tochter ein bemerkenswerter Mann: Von den Armen nahm mein Vater keinen Mietzins, denn wer in seinem Hause wohnte, der wohnte auch in seinem Herzen.22 Immerhin hat sie, wenn sie das sagen wird, eine große Beglaubigung für das Wesen ihres Vaters – sich selbst: Und ich bin stolz darauf, da mein Vater sich ganz ausgab… die eigene Tochter für seine Weitherzigkeit zeugt, nicht eine Stube besitzt, gar ein Fleckchen erbte.23
Im Übrigen erkennt sie ihm das Naturell eines Kindmannes zu, wie es schon Heine, aus den gleichen und noch anderen Gründen, für seinen Vater getan hatte. Ein Kindmann ist von vornherein vor dem Verdacht gefeit, mit den Zinsen aus fremder Not sein Geld zu verdienen, wie es dem großen antijüdischen Klischee entspricht, das der Tochter nur allzu gegenwärtig ist – und das sie wie Heine mitunter selbst teilt. Einem Kindmann aber kann man nicht einmal seine Religion übel nehmen.
Doch vergessen wir nicht die Schlüsselfrage: Turm oder nicht Turm?
Sie wird verschärft durch die Tatsache, dass es sich beim Turm keineswegs nur um den wichtigsten Teil des Elternhauses handelte, sondern man sich das Wuppertal ihrer Kindheit voller Türme vorzustellen hat. Türme, Aussichtstürme, die ihr bauunternehmerischer Vater errichtet habe und die sie an seiner Hand, sobald sie irgend im Rohbau begehbar waren, hinaufkletterte. Bei diesen Aufstiegen trug das Mädchen Hosen wie ein Junge, weil der Vater – sagt die Tochter – Mädchen nicht so sehr schätzte. Vielleicht aber auch nur, weil zum Klettern Hosen viel praktischer sind.
Der Vater Aron Schüler, Bankier, den – sagt seine Tochter – niemand zu den Erwachsenen zählt. Im »Arthur Aronymus« wird sie ihm ein großes Denkmal setzen. © Stadtbibliothek Wuppertal, Else-Lasker-Schüler-Archiv