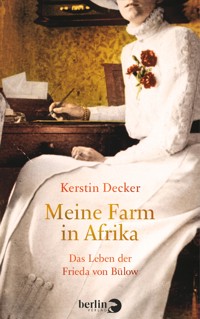
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bin ich ein Sekundärtalent, eine zweitrangige Begabung? Die spätere Schöpferin des »deutschen Kolonialromans« Frieda von Bülow neigt dazu, diese Frage zu bejahen. Doch dann tritt ein Mann in ihr Leben, der ihr mit Nietzsche sagt: Werde, der du bist! »Meine Farm in Afrika« berichtet von einer Frau, die im fremden Land nicht als Eroberin auftritt, sondern gemeinsam mit den Einheimischen ein neues Leben beginnen will. Das Buch taucht tief ein in ein fast vergessenes, äußerst widersprüchliches Kapitel deutscher Geschichte. Es entsteht das Tableau einer Gesellschaft, getragen von Menschen Anfang dreißig, vornehmlich Adlige, die sich gleichsam auf exterritorialem Gebiet neu erfinden wollten: Wir sind zwar Deutsche, aber wir haben es satt, der Poet unter den Völkern zu sein! Aktion statt Traum! Kerstin Decker erzählt mit viel Gespür für die Charaktere und die skurrilen Züge einer Zeit, in der es möglich war, die höchste Erhebung Afrikas auf den Namen Kaiser-Wilhelm-Spitze zu taufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
All unsere Probleme beginnen damit,
dass wir nicht zu Hause bleiben.
Blaise Pascal
Das Glück gleicht durch Höhe aus,
was ihm an Länge fehlt.
Robert Lee Frost
ISBN 978-3-8270-7786-8
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Am 6.Oktober 1889 bestieg der Leipziger Buchhändler Hans Meyer den Kilimandscharo. Er war der Erste, dem es gelang. Auf seinem Hauptgipfel rief er drei Mal Hurra! und hisste die deutsche Flagge. Er nannte ihn die Kaiser-Wilhelm-Spitze.
Unser größter Berg ist 6010Meter hoch, erklärten die Lehrer in einem fernen Land fortan ihren Schülern.
Dies ist ein Roman und ist doch keiner. Denn im Zweifelsfall ist nichts phantastischer, nichts unwahrscheinlicher als die Wirklichkeit.
Ähnlichkeiten mit Personen der Zeitgeschichte sind demnach nicht nur beabsichtigt, sondern ausdrücklich verbürgt. Nichts von dem, was hier folgt, ist erfunden.
Alle Mitwirkenden treten unter den Namen auf, die sie auch im Leben trugen. Zur besseren Orientierung findet sich ein Personenverzeichnis am Schluss des Buches.
ERSTER TEIL
Wie gründe ich eine Kolonie?
Nachtwache
Beim geringsten Laut im Haus fährt der angehende Privatdozent der Philosophie zusammen. Er kennt diese Räume gut, er war nur ein paar Monate fort gewesen. Und jetzt kommt es ihm vor, als habe er sie niemals verlassen. Hier, in 54 Addison Road, Kensington, London, hat er gelebt, allein mit seinem Onkel, das Personal nicht mitgezählt. Wer erst beginnt, das Personal mitzuzählen, expandiert nie.
Am Morgen ist er angekommen. Für Augenblicke scheint ihm alles wie immer: der Onkel und er, allein in den vielen Räumen der Villa. Nur dass sich der Onkel jetzt in dem Zimmer befindet, das bisher ihm gehörte.
Und dass er in seinem Bett liegt.
Wie viele Nächte hat der strebsame junge Mann hier geschlafen, scheinbar fest, während sein Traumbewusstsein weiter an Willenswelt und Weltwille arbeitete. Das ist der Titel seines philosophischen Hauptwerks. Carl Peters ist jetzt 26 Jahre alt. Willenswelt und Weltwille muss jeden Augenblick im Druck erscheinen, bei Brockhaus in Leipzig.
Das erste eigene Buch!
Es wird die akademische Welt auf den Kopf stellen, weiß sein Autor. Aber nicht das macht ihn jetzt so unruhig, so hellhörig, nimmt ihm den Schlaf augenblicklich von der Stirn, sobald sich seine übernächtigten, vor Müdigkeit brennenden Augen schließen wollen. Es war eine anstrengende Reise, ohne Zwischenhalt von Hannover nach London. Etwas zwingt ihn, fortwährend an die Decke des Salons zu blicken, über dem er sein altes Zimmer, sein Bett und in diesem Bett den Onkel weiß.
Drei volle Tage liegt Karl Engel nun schon so da. Die Fenster stehen ein wenig offen, des Geruchs wegen. Durch den Spalt streckt der Londoner November des Jahres 1882 seine Nebelhand ins Zimmer und streicht sanft über die gelösten Züge des Onkels.
Der Nebel war schon da, als sein Neffe an der Victoria Station ausstieg. Dank dieser simplen Verbindung aus Ruß, Schwefeldioxid, Staub und kondensiertem Wasser wissen selbst die Bürger einer so großen Stadt, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Alle Verhältnisse zu anderen sind am Ende doch nur Illusion. Das Nichts beginnt mitunter schon eine Handbreit vom Leib, und natürlich ist die Einsamkeit ein metaphysischer Begriff. Seltsam, dass viele Sprachen kein Wort dafür haben. Fürs Alleinsein schon, aber nicht für die Einsamkeit.
Und das ist etwas anderes.
Einsamkeit. Eigentlich ist es ein schönes Wort.
Nie ist man einsamer als kurz vor Mitternacht allein in einem großen alten Londoner Haus, ganz vom Nebel verschluckt, und mit einer Leiche im ersten Stock, im eigenen Bett. Dem Neubegründer der Philosophie wäre ein anderes Wetter zu seiner Ankunft auch lieber gewesen, gerade zu dieser.
Manchmal ist er nahe daran zu glauben, dass Arthur Schopenhauer doch im Recht war, dabei hat er ihn gerade widerlegt. Willenswelt und Weltwille ist die Fortsetzung von Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung, genauer: deren grundstürzende Verbesserung. Immer wenn Carl Peters an sein Werk denkt – und das macht er sehr oft –, fühlt er sein Inneres weit werden wie die Welt. Es scheint ihm die angemessene Art, sein Ich zu spüren. Er hängt sehr an diesem Ich. Und Schopenhauer nennt es eine Illusion? Leben sei Leiden, sei Erleiden? Nein, das kann er so nicht stehenlassen. Er hat es anders erfahren. Was lebt, wirklich lebt, fühlt wie er. Es nimmt zu, es dehnt sich aus, es expandiert.
Normalerweise. Aber nicht jetzt. Und nicht hier. Hat gar Arthur Schopenhauer den Nebel erfunden? Es ist sein Wetter, erkenntnistheoretisch betrachtet. Der Nebel greift nach allem, was in ihm noch Ich! sagt, er will ihn auflösen, aber sein Herz hämmert immer weiter ein trotziges Ich! gegen die Wände seines Brustkorbs.
Der Anwalt des Onkels war am Vormittag bald nach seiner Ankunft gekommen und hatte ihm mitgeteilt, was er schon wusste: dass er, Carl Peters, zum Testamentsvollstrecker ernannt sei. Bis zehn Uhr abends hatte er Briefe geschrieben. Jetzt will er schlafen. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Es ist seine Pflicht, sich in ein überlegenes Verhältnis zu der Person im ersten Stock zu setzen, die bis vor drei Tagen sein Onkel war und sich inzwischen nicht zu ihrem Vorteil verändert hat. Er hat sich vorgenommen, über die Frage »Ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?« zu habilitieren. Das Problem hatte zwar schon Immanuel Kant untersucht und war zu einem Kopfschütteln gelangt, das man auch unter dem Titel Kritik der reinen Vernunft kennt, aber Carl Peters ist zuversichtlich. Auch große Geister irren, er wird das aufklären. Philosoph sein heißt, den Dingen des Lebens mit Gelassenheit zu begegnen. Nur zählt der Mann über ihm nicht mehr zu den Dingen des Lebens, das macht es nicht leichter.
Das knisternde Kaminfeuer illuminiert den Salon, es hängt den Musikinstrumenten seines Onkels, die überall sind, an den Wänden, auf dem Boden, lange, lebendige Schatten an, um sie im nächsten Augenblick wieder fortzunehmen. So hat er diese Sammlung noch nie gesehen. Können auch Gegenstände Verlassene sein? Können auch sie trauern?
Der Mann im ersten Stock, der jetzt die letzte Nacht in seinem Haus verbringt und am nächsten Morgen abgeholt wird, heißt Carl wie er, nur mit K vorn. Karl Engel, Bruder seiner Mutter, Organist und Klavierspieler. Mit diesen Qualifikationen war er einst nach London aufgebrochen und nie zurückgekehrt.
Die Briten sind das meistbeschäftigte Volk der Erde, sie müssen ihr großes Weltreich draußen und ein ebensolches Fabrikreich auf ihrer Heimatinsel kontrollieren, da können sie unmöglich noch selbst Musik machen. Das haben sie schon immer gern den Deutschen überlassen. Dass der Onkel nie zurückkam, lag aber vor allem daran, dass er sich mitten in das Herz einer Londoner Dame aus erster Familie hineingespielt hatte, deren Bruder der Augenarzt von Königin Victoria und deren Neffe der Handelsminister des Empire war, Joseph Chamberlain. Eine Paget – dies war ihr Name – konnte unmöglich einen hergelaufenen Ausländer heiraten, einen Musikanten dazu.
Konnte sie nicht?
Ich bin eine Paget, beharrte die musikalische Frau, ich heirate, wen ich will! Und das tat sie. Nur öffentlich auftreten durfte der Onkel nicht mehr, das wäre mit seiner neuen Stellung in der Welt nicht vereinbar gewesen. Weshalb er begann, mit dem Geld seiner Frau alte Instrumente zu sammeln und der stilleren, würdevolleren Tätigkeit eines Musikhistorikers nachzugehen. Er brachte es in beiden Disziplinen zu ebensolchem Ansehen wie zuvor als Virtuose.
Erst vor zwei Jahren war seine Frau gestorben. Und nun liegt auch er da, weltenfern von allem, was er bis eben war. Seltsamerweise bestätigt das den Neffen nur in seiner Auffassung, dass die Eroberung der Welt nichts ist, was sich vertagen ließe. Und wenn er »die Welt« sagt, dann meint er die des Geistes. Denn das ist nach allen Erfahrungen, die er gerade hier in London gemacht hat, wohl doch die einzige, in der ein Deutscher es zu etwas bringen kann. Zumindest nach Meinung der Ausländer. Auch der Onkel war in dieser Welt zu Hause gewesen, aber sie hat ihn nicht festhalten können. All die Geigen und Klaviere in diesem großen Salon – sie waren doch nur in Bezug auf ihn. Und nun sind sie Waisen, die wahren Hinterbliebenen des Karl Engel. Was soll er mit ihnen tun? Was soll er mit den vielen Dingen in diesem großen Haus anfangen?
Er wird morgen darüber nachdenken. Morgen wird er es besser wissen.
Er muss nur schlafen können.
Es ist ganz still, auch wenn er manchmal meint, oben eine sich öffnende Tür zu hören. Er weiß, Karl Engel hatte ihm noch etwas sagen wollen. Nur etwas? Nicht viel mehr? Ihm, dem Lieblingsneffen, der größten Hoffnung seines Alters. Ihm, der größten Enttäuschung seines Alters. Über ihm öffnet sich keine Tür, sagt sich Carl Peters. Es sind die Nerven, nur die Nerven. Er hat zwei Nächte lang nicht geschlafen. Wenn es nur nicht so still wäre. Kein Mensch kann bei dieser Stille schlafen. Er hört den Onkel schweigen, es ist eine Grabesstille. Als er am Morgen ankam, war das anders.
Da war das Haus voller Menschen gewesen.
Er kannte diese Leute nicht, doch er fand ihr Betragen gleich unangemessen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in diesen Räumen bewegten. Der geschäftige Lärm, den sie machten. Die Unverfrorenheit, mit der sie Schränke öffneten. Er war nicht darauf gefasst gewesen, hatte aber sofort gewusst, dass es sich um die Familie der Braut handeln musste.
Sein Onkel hatte zuletzt wieder heiraten wollen. Carl Peters ahnt, dass er mit schuld ist an diesem Entschluss. Die Braut sah sehr mitgenommen aus, als er sie begrüßte, er verstand das. Wer am Tag seiner Hochzeit statt des Bräutigams nur seine Leiche vorfindet, mit einem Strick um den Hals, hat wenig Gründe, besser auszusehen. Aber das heißt doch nicht, dass die vom Schicksal Getäuschte hierbleiben kann. Schließlich gehört sie nicht zur Familie.
Niemand gehört so wenig zur Familie wie eine Beinahe-Braut. So ist das.
Der Verfasser von Willenswelt und Weltwille kennt die Nicht-Braut, es ist die kleine Miss Lawrence. Miss Lawrence hatte bereits Mrs. Paget gepflegt, als sie sehr krank war. Trotzdem setzte er die kleine Miss Lawrence vor die Tür, sie und ihre Familie, noch an diesem Nachmittag, ohne Höflichkeitsfrist, sofort. Die Lawrences schafften es eben noch, ihm das Nachtlager im Salon zu bereiten und ein kleines Souper danebenzustellen.
Manchmal versteht er diesen Schopenhauer nicht. Mitleid sei der vornehmste moralische Affekt? Aber so kommt kein Mensch durchs Leben. Erst recht kein Testamentsvollstrecker. Die Briten, überlegt er, hätten nie einen Schopenhauer hervorgebracht. Spricht das nun für oder gegen sie? Immerhin haben sie ihn entdeckt. Und er hat lange genug unter ihnen gelebt, um ihre Vorzüge zu kennen. Es sind nicht wenige.
Heiraten wollte der Onkel also, die kleine Miss Lawrence. Aber man heiratet nicht das Personal. Schon gar nicht hier in London, schon gar nicht in seinen Kreisen. Karl Engel wusste das. Er wusste auch, dass er dem Augenarzt der Königin und dem Handelsminister des Empire nie wieder unter die Augen treten konnte, und der Königin schon gar nicht. Ja, vielleicht könnte er nicht einmal dem Andenken seiner eigenen Frau begegnen.
Die Stille wächst, jetzt, da alle aus dem Haus sind, die unmögliche Braut und ihre unmögliche Familie. Unmögliche Familien sind vor allem eins: zu große Familien. Er hatte den Onkel am Morgen gesehen, nun schiebt sich das Bild immer wieder vor seine Augen. Er wischt es jedes Mal fort, aber es kommt doch zurück. In seinem Schlafrock lag Karl Engel da, und um den Hals zog sich ein roter Streifen. Er hatte es selbst getan.
Ich weiß, wer schuld ist am Tod des Onkels!, flüstert eine Stimme im Ankömmling dieses Tages. Er ist Philosoph genug, sie sofort zu erkennen: Es ist die Stimme seines Gewissens. Dieses hinderliche Organ neigt zu solchen Wortmeldungen, immer ungefragt, immer in den unpassendsten Augenblicken. Er selbst hat das noch nicht oft erfahren, aber schon viel darüber gelesen. Das Gewissen ist wie eine Uhr, die immer richtig geht, nur wir gehen manchmal falsch, wird ein zum Tiefsinn neigender Unterhaltungsautor bald feststellen. Carl Peters teilt der unangemeldeten Rednerin mit, dass er jetzt schlafen müsse; was sie vorzubringen habe, könne sie ihm auch morgen noch mitteilen.
Aber er schläft nicht.
Wie gut er dieses Haus kennt, seine Geräusche in der Nacht. Nach dem Tod seiner Frau hatte Karl Engel ihn, den Mittellosen, zu sich geholt, fast zwei Jahre ist das nun her. Es war genau der richtige Augenblick gewesen. Denn lange hätte Carl Peters sein Probejahr als Gymnasiallehrer nicht mehr hinausschieben können.
Gymnasiallehrer, er wusste, was das hieß: Abschied von seiner Jugend. Abschied vom Leben. Abschied von sich selbst. Das war die Drohung, die über ihm hing. Noch spielte er mit ihr, hielt vor jungen Damen in Hannover Vorträge über Literatur, Mythologie und griechische Geschichte. Nicht, dass er das studiert hätte, aber Philosophie hatte er schließlich auch nicht studiert. Und dann, von einem Tag auf den anderen, ohne Vorankündigung, stand der Horizont weit offen: London.
Carl Peters’ Pflichten im Leben bestanden fortan darin, sich wie ein Gentleman zu kleiden, von seinem Gentleman-Konto Geld abzuheben, und zwar so viel, wie ein Gentleman benötigt, und im Übrigen das zu tun, was ein Gentleman tun muss: was er will. Er hatte nur einen wirklich festen, unumstößlichen Termin am Tag. Zum Fünf-Uhr-Tee musste er da sein, denn dann spielte der Onkel Klavier, er brauchte ein Publikum, er hatte immer eins gehabt, und danach wollte er mit seinem Neffen spazieren gehen. Die Familien, mit denen der Onkel verkehrte, übertrafen einander in dem Bemühen, the foreign nephew in ihre Kreise einzuführen. Sein vertrautes Londoner Leben stand wieder vor seinen schlaflosen Augen, als hätte es nie geendet.
An dieser Stelle übergeben wir das Wort, schon der Glaubwürdigkeit halber, dem Schlaflosen selbst: Ich nahm plötzlich wahr, wie jemand sich auf dem Bett bewegte, dann sich erhob. Ein Schritt wie auf Fußsohlen ging über den Fußboden meines früheren Schlafzimmers. Dann öffnete sich oben die Tür, und jemand kam die Treppe herunter, auf die Tür des Salons zu, in welchem ich lag. Ich erhob mich im Bett und ergriff die Feuerzange neben mir. Mein Haar muß emporgestiegen sein. Der ruhelose Privatdozent wusste, warum er die Zange nicht am Kamin liegen gelassen hatte. In ein paar Jahren würde er nur noch ruhigen Schlaf finden mit einem Gewehr im Arm. Da tappte eine Hand von außen über die Tür zu meinem Zimmer bis zum Griff. Dieser Griff drehte sich, und die Tür ging auf. In derselben stand mein Onkel mit einer Kerze in der Hand, im Schlafrock, in welchem ich ihn am Morgen auf seinem Lager gesehen hatte; ich nahm sogar den roten Streifen um sein Genick wahr, der mich am Morgen so entsetzt hatte. Ich war aufgerichtet im Bett, voll Grauen, er stand 15 – 20 Sekunden in der Tür, lächelnd.
Carl Peters hatte gleich gewusst, dass Karl Engel mit ihm reden wollte. Aber er konnte es offenbar nicht. Stand da, so ungut umrändert, und lächelte nur.
Warum lächeln die Toten? Woher dieser Ausdruck des Einverständnisses? Dann schloß sich die Tür, ich hörte den Schritt die Treppe zurückschlurfen. Die Tür oben öffnete und schloß sich; der Körper streckte sich wieder auf dem Lager über mir aus, und alles war still.1 Nur sein eigenes Herz nicht, es hämmerte gegen den Brustkorb, als wolle es raus.
Hat er wirklich gesehen, was er sah?
Ohne Zweifel. Er hat es gesehen. Aber war das wirklich der Onkel? Ja! Ja! Er war’s, rief die Physis des Autors von Willenswelt und Weltwille mit jedem erhöhten Pulsschlag, mit jedem Nachbeben. Doch sein Verstand verlangte, die Frage zu verneinen, und zwar entschieden zu verneinen.
Es gab demnach nur zwei Erklärungen: Entweder er hatte das Nervenkostüm eines Mädchens, oder der Onkel war nur scheintot. Und was war Karl Engel jetzt, da er, offenbar die Kälte in seinen Adern spürend, es vorgezogen hatte, sich wieder in das Bett zu legen, das nicht sein Bett war?
Ich muss nachschauen, dachte Carl Peters, ich bin es mir schuldig.
Er, der in diesem Hause Arthur Schopenhauer widerlegt und geschlussfolgert hatte, dass der Weise den Willen, dieses unbewusst Dranghafte in allen Dingen, das für Schopenhauer das Weltprinzip ausmachte, nicht zu verneinen, sondern im Gegenteil aufs Höchste zu begrüßen und zu bejahen habe – er sollte jetzt nicht genug davon aufbringen, um die Situation im ersten Stock zu überprüfen?
Der 26-Jährige kann nicht wissen, dass zur gleichen Zeit, genau an diesem Novemberende des Jahres 1882, in einem kleinen italienischen Fischerdorf ein entlaufener, latent suizidgefährdeter Professor sitzt, dessen Gemüt sich kaum in besserer Verfassung befindet als das seine in dieser Nacht – wenn auch aus anderen Gründen –, und über die gleichen Probleme nachdenkt:
Nieder mit Schopenhauer!
Bejahung des Willens!
Bejahung des Lebens!
Carl Peters und Friedrich Nietzsche: Sie werden beide folgenreich werden, auf ihre je eigene Art. Sie ahnen sich beide voraus, selbst dann, wenn sie schon fast kein Gefühl mehr von sich haben.
Nein, der große Bejaher wagt nicht, die Treppe hochzugehen. Die Feuerzange umklammernd, bringt er den Rest der Nacht schlaflos zu, beim leisesten Geräusch auffahrend. Aber der Onkel unternimmt nichts, seinen Neffen erneut zu besuchen.
Am Morgen erscheint der Arzt, um den Ausflügler noch einmal wissenschaftlich zu betrachten, vor Zeugen. Der junge Mann begrüßt ihn mit einer leicht unangemessenen Erleichterung, um nicht von Euphorie zu sprechen. Die Frage, die ihn besonders interessiert, lässt sich nicht so unvermittelt stellen, wie er das wohl möchte, will er nicht das Misstrauen des Mediziners erregen. Schließlich ahnt der Arzt, was der etwas derangiert wirkende Neffe wissen will: Ob der Tote denn wirklich tot sei?
Ja, schon, doch, doch, das würde er wohl annehmen, bestätigt der Gefragte mit einem minimalsten Lächeln und richtet seinen prüfenden Blick auf den Fragesteller. Aber die Annahme allein genüge hier nicht, antwortet dieser in sichtlicher Unruhe, denn … und an dieser Stelle bricht er ab. Der Leichenbeschauer spürt das Zögern des nervösen jungen Mannes, er nickt ihm ermutigend zu, worauf Carl Peters noch die Kraft findet, um eine besonders gründliche Untersuchung zu bitten, denn seine Familie neige zu Scheintoden.
Dieser hier aber sei nicht schein-, sondern ganz tot, und zwar nicht erst seit gestern, bekräftigt der Mediziner schließlich.
Sie wissen beide, dass vor ihnen ein Selbstmörder liegt. Sie wissen auch um die Unmöglichkeit, diesen Befund aufzuschreiben, denn das brächte den nervenschwachen jungen Mann in erhebliche Schwierigkeiten. Weder der Körper des Eigenmächtigen noch dessen Eigentum wären in einem solchen Falle freizugeben, zumindest vorläufig nicht. Nun treffen auch die Geschworenen zur Totenschau ein, zum Inquest, zum Letztbefund über die Persönlichkeit des Verstorbenen. Er lautet nach kurzer Beratung dahin, dass Karl Engel in einem akuten Zustand geistiger Zerrüttung Hand an sich gelegt habe. Nichts von vorsätzlichem Selbstmord.
Als alle aus dem Haus sind, vor allem der Onkel, den sie dankenswerterweise gleich mitnehmen, läuft der unsagbar erleichterte Neffe in den novemberkalten Garten hinaus, in dem er so oft mit Karl Engel gesessen hatte. Er wirft sich auf den feuchten Rasen. Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein musste, um mit genauer Not bestehen zu können. Wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon gar nicht mehr bestehen. Schopenhauers Theodizee. Seine stellvertretende Antwort auf die ewige Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt. Der Herr antwortet nie selbst, er lässt immer andere für sich sprechen. Carl Peters wüsste nicht, wann er je so nah daran gewesen sei, dem Philosophen recht zu geben.
Gewiss sieht er auch noch einmal im oberen Schlafzimmer nach, ob sein früheres Bett wirklich leer ist.
Es ist leer.
Er schläft wieder nicht in der folgenden Nacht.
Bleich steht der nächste Morgen im Fenster. Ebenso bleich steht der angehende Privatdozent auf, besieht den Nachlass des Onkels und beginnt, erste Dinge zu ordnen, mit ebenjenem Sinn für Systematik und Effizienz, den Menschen, die der Schlaf mit ebensolcher Effizienz und Systematik meidet, zu entwickeln pflegen. Gut, dass er am Abend eingeladen ist.
Und dann ist ihm schon schwindlig, bevor er den Wein der Gastgeber getrunken hat, und nachher erst recht. Am liebsten würde er gleich wieder gehen, aber das darf er nicht, er muss bleiben, er muss der dem Onkel nahestehenden Familie, die ihn schon früher eingeladen hatte, Gelegenheit geben, ihn zu bitten, über Nacht zu bleiben. Sie würde es bestimmt tun. Also harrt er aus, er kann nicht zurückgehen, nicht heute. Das erlösende Wort wird, ja es muss gesprochen werden.
Frieda oder der Adel, zweiter Klasse
Sie ist ungefähr so neu in Berlin wie die Straßenbahn. Am 16. Mai 1881 eröffnete Werner von Siemens in Lichterfelde die erste elektrische Linie der Erde, während seine Vertreter auf anderen Kontinenten Fernmeldenetze errichten. Täglich geht irgendwo eine Welt auf, sie weiß es, seit sie in diese Stadt kam. Sie muss bloß die richtige Tür finden, einzutreten.
Frieda von Bülow überprüft ihre Möglichkeiten, sich selbst zu entkommen.
Es sind nicht viele.
Sie könnte heiraten, sie könnte ihre ganze unmögliche Existenz einfach einem Mann übergeben. Es wird ohnehin höchste Zeit, sie ist schon Mitte zwanzig, bald würden Blicke des Bedauerns sie treffen, das tägliche Brot alt gewordener Mädchen, die niemand haben wollte. Überzähliges Dasein, ein verfehltes Frauenleben, am biologischen Zweck geradewegs vorbei.
Ja, sie müsste heiraten. Aber sie kennt niemanden, der vorhätte, sie zu heiraten. Und, fast schlimmer noch: Sie kennt auch niemanden, den sie heiraten wollte.
Sie hat nicht die Anmut ihrer kleinen Schwester Margarete. Margarete ist ihr zweites Ich. Vielleicht hat sie auch nicht Margaretes Talent, aber das zählt nicht: Männer mögen keine Frauen mit Talent, zumindest nicht im eigenen Haus. Doch da ist etwas Herbes in ihren Zügen, beinahe etwas Männliches. Ihre Geschwister nennen sie ohnehin nur Frieder, nicht Frieda, aber das ist eine Zärtlichkeit. Und dieses vorspringende Tatmenschen-Kinn, dieses Bülow-Kinn! Das Kinn ist eine vollkommene Fehlinformation. Sie besitzt nicht die Hälfte des Willens, den es vortäuscht. Welcher Mann heiratet schon ein solches Kinn?
Ja, wenn sie eine gute Partie wäre. Wenn sie eine Mitgift hätte. Aber sie kennt ihre Stellung in der Welt nur zu genau: Sie ist die weitgehend mittellose Tochter eines früh verstorbenen preußischen Legationsrates, seinerzeit Konsul in Smyrna.
Die Familie ging in den Orient, als sie fünf Jahre alt war. Irgendwie sind ihr die Rufe des Muezzins noch immer vertraut, heimatlicher fast als Kirchenglocken. Hugo von Bülow hinterließ eine Frau und fünf Kinder, da war Frieda keine zwölf. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wäre Hugo von Bülow nicht so kurzsichtig gewesen. Seit Menschengedenken hatte der Dennewitzer Zweig derer von Bülow preußische Offiziere hervorgebracht, und noch davor hauptsächlich mecklenburgische Junker. Wer kennt – nein, kannte – nicht den Grafen Bülow von Dennewitz oder den Fürsten Bernhard? Und wie viele Offizierslebensläufe hat der Deutsch-Französische Krieg verklärt!
Was für einen Aufstieg hätte Hugo von Bülow nehmen können, aber nicht mit diesen ihn militärisch disqualifizierenden Augen! Und nun sind sie die »armen Bülows«, Kostgänger bei den glücklicheren Verwandten. Vor allem die Brüder, Albrecht und Kuno, aus denen etwas werden soll.
Aus einem Mädchen muss nichts werden.
Sie weiß nicht recht, ob sie das als Privileg empfinden soll oder als Kränkung.
Frieda von Bülow spürt den Atem der großen Stadt. Als ob hier jeder seine ganz eigene Chance bekäme. Und könnten sie denn freier, zukünftiger leben, schon jetzt? Es ist beinahe eine Künstlerinnen-Kommune. Die drei Bülow-Schwestern wohnen zusammen mit ihrer geliebten Großmutter, Henriette Freifrau von Münchhausen. Die Baronin ist eben erst aus Thüringen gekommen, sie lassen einander jede Freiheit, haben Besuch, wann immer und so viel sie wollen.
Alle Macht der Zukunft!
Nur einen Makel hat die Künstlerinnen-Kommune: Noch ist Margarete die einzige anerkannte Künstlerin darin.
Die kleine Schwester hat einen Roman geschrieben, mit achtzehn Jahren hat sie ihn begonnen, als Titel wollte ihr »Aus der Chronik derer von Riffelshausen« passend scheinen. Die Familie las und war tief beeindruckt. Ein namhafter Kritiker müsse den Roman beurteilen, eine Autorität, beschloss der Familienrat. Ihm wolle man dann folgen wie einem Gottesurteil. Der Beschluss liegt nun schon etwas länger zurück, denn erst musste die Autorität gefunden werden, das war nicht leicht. Und jetzt liest sie noch, schon mindestens ein Jahr. Es ist Fritz Mauthner. Keiner wagt ihn zu drängen.
Frieda und Sophie stehen nicht unter Genieverdacht, und da sie auch nicht unter akutem Heiratsverdacht stehen, müssen sie Lehrerinnen werden. Es ist keine Herzenssache, aber es ist vernünftig, das sagen alle. Das sagt sogar sie. Also eine Künstlerinnen-Kommune mit einer angehenden Dichterin darin und einem gut verborgenen Talent, das ist sie. Sophie hospitiert, und Großmutter Henriette, die Hofmarschallin, hält über alle ihre schützende Hand.
Das machte sie schon immer.
Die von Münchhausen sind Friedas Vorfahren mütterlicherseits, und zwar die der schwarzen Linie, denn es gibt auch eine weiße Linie derer von Münchhausen. In der schwarzen ist das literarische Talent offenkundig, denn ihr entstammt der berühmte Lügenbaron, Hieronymus von Münchhausen. Natürlich haben auch die von Bülows musische Begabungen hervorgebracht, nicht nur Hans von Bülow, den Kapellmeister Richard Wagners. Da ist auch noch Karl Eduard von Bülow, Zeitgenosse der Romantik, der den Simplicissimus von Grimmelshausen wiederentdeckte, das Leben Heinrich von Kleists beschrieb und gemeinsam mit Ludwig Tieck Novalis’ Dichtungen herausgab. Andererseits haben die Münchhausens auch bellizistische Talente in ihren Reihen, so soll Heino von Münchhausen einst mit Friedrich II. ins Heilige Land gezogen sein.
Es gehört zu den Kränkungen der neuen Zeit, dass keiner mehr von dem Ruf seiner Ahnen leben kann. Und ebendarum geht es auch in der »Chronik derer von Riffelshausen«, sie umfasst zwei Generationen einer alten thüringischen, latent insolventen Adelsfamilie, die nur unter größten Anstrengungen etwas aufrechterhalten kann, was man die Fassade eines standesgemäßen Lebens nennen dürfte. Leider hatte auch Henriette nichts als ihre gute Abstammung mitgebracht, als sie Thankmar von Münchhausen, den Hofmarschall des Herzogs von Meiningen, heiratete.
Sophie, Frieda und Margarete von Bülow lieben ihre Münchhausen-Großmutter, sie war das Gesicht, das über ihrer Kindheit stand, ihrer Nach-Smyrna-Kindheit, ihrer Thüringen-Kindheit. Henriette von Münchhausen hat nicht die weltverzagte Art ihrer Tochter, als ginge sie fortwährend in Deckung vor den Zumutungen des Lebens. Ob die Schwestern ihre Mutter Clothilde von Bülow, geborene Münchhausen, auch lieben, könnten sie nicht sagen. Oder doch, natürlich tun sie das. Aber es ist eine andere Art Liebe, wie man sie für jemanden hat, der einem zwar fremd ist, mit dem man aber erstaunlicherweise verwandt ist.
Ausgerechnet Neudietendorf!
Mit neun Jahren hatte Frieda Smyrna verlassen, den in allen Farben leuchtenden Orient, den Strand eines südlichen Meeres. Als sie zwölf wurde, fand sie sich plötzlich wieder in diesem kleinen Ort in Thüringen, an dem einfach alles zu klein war. Und merkwürdig: Man ging hier nicht zum Bäcker, sondern zum Bruder Bäcker, nicht zum Schuster, sondern zum Bruder Schuster. Und die Frauen von Neudietendorf nannten sich Schwestern, obwohl sie nichts weniger als verwandt waren. Es war sehr still in Neudietendorf, denn seine Bewohner vermieden es, beim Leben Geräusche zu machen, sie glaubten, dass Gott jede Lärmbelästigung durch seine Geschöpfe missfällt, es sei denn, sie beten und singen Choräle zu seinem Preis. Die Feste der Neudietendorfer waren grundsätzlich Gottesdienste. Der ganze Ort bildete eine einzige Gemeinde nach dem Vorbild der Herrnhuter, und in eben den Schutz eines solchen Lebens strebte Clothilde von Bülow nach dem frühen Tod ihres Mannes. Schließlich konnte sie in ihrem Alter nicht mehr ins Kloster gehen, auch hatte sie drei Töchter und zwei Söhne, lebendige Zeugen einer denkbar unklösterlichen Lebensführung.
Und so fanden sich ihre Kinder, diese Kinder des Orients, plötzlich unter der strengen Aufsicht von Menschen wieder, denen fast alles, was Kinder gern tun, als Sünde galt.
Das Herrenhaus von Ingersleben
Bei den Schwestern der Töchter-Erziehungsanstalt gingen sie zur Schule. Sie lernten nicht viel, was schon daran lag, dass die Lehrenden selbst nicht viel wussten. Dieser Mangel erregte Letzteren aber einen gewissen Stolz, denn alles Weltwissen ist am Ende eitel, und ein Kind, zumal ein Mädchen, muss vor allem eines lernen: Beten! Sagten die Erziehungsbeauftragten.
Was für ein Glück, dass sie nur zwanzig Minuten durch Wiesen zu laufen brauchten, um in einem Gegen-Neudietendorf anzukommen. Auf Ingersleben wohnte die Großmutter Henriette von Münchhausen, die jetzige Schutzherrin der Berliner Zukunftsverschwörung. Ein schattiger Park umgab das alte Herrenhaus, hier standen an Teichen Blutbuchen und fremdartige Nadelbäume, vor dem Gutshaus aber war ein weiter Rasen ausgebreitet. Ingersleben bedeutet Freiheit, und diese Freiheit beschränkte sich keineswegs auf den englischen Park vorm Haus.
Der eigentliche Ort der Freiheit, der Lieblingsort der Schwestern, war die Bibliothek von Ingersleben. Sie nahm den ganzen weiten Saal des Erdgeschosses ein, wo auch gegessen wurde.
In der Bibliothek von Ingersleben sind die Schwestern eigentlich zur Schule gegangen, sie umfasste jeweils zwischen zwei Buchdeckeln ungefähr alles, was zu wissen den nachbarlichen Neudietendorfern verwerflich schien. Die Schwestern verschmähten weder Geschichtsbände noch Grundlagenwerke des Atheismus wie David Friedrich Strauß’ Das Leben Jesu. Am liebsten aber lasen sie Romane, die Franzosen, die Engländer, die Russen, wobei die Russen schließlich einen klaren Vorsprung gewannen, besonders Turgenjew. Väter und Söhne wurde Margaretes Lieblingsbuch.
Frieda von Bülow als kleines Mädchen
Die Schwestern? Nein, nicht alle drei. Die da von früher Kindheit an alles miteinander teilen, als wären sie ein Wesen, sind Frieda und Margarete.
Frieda ist die älteste, geboren am 12. Oktober 1857. Fast auf den Tag genau ein Jahr später kam Sophie zur Welt, Margarete, Jahrgang 1860, ist die jüngste. Albrecht und Kuno zählten nicht in ihrer Kindheitswelt, denn sie waren noch klein, und es gibt nichts Unerheblicheres, nichts Lästigeres für große Schwestern als kleine Brüder.
Margarete und Frieda.
Ein Herz und eine Seele.
Eigentlich ein schönes Wort, das die Sprache für eine Gemeinschaft wie die ihre hat, wenn es nicht zu einer Gedankenlosigkeit herabgesunken wäre.
Die eine ist nur im Hinblick auf die andere.
Den nicht zu leugnenden Umstand, dass sie in zwei getrennten Umrissen existieren, hielten beide bislang mehr für eine optische Täuschung.
»… seit gestern habe ich 84 Sklaven befreit«
Hier kommt nichts mehr, kein Überhauptgarnichts, glaubte schon mancher. Vorausgesetzt, er hatte es geschafft, nicht in den Sümpfen des Sudd unterzugehen und auch nicht mit einer jener großen schwimmenden Inseln zusammenzustoßen, die auf dem Weißen Nil statt Schiffen verkehren. Sümpfe, schwimmende Inseln und vor allem: Krokodile. Natürlich, man könnte auch am Ufer reisen. Doch der Weg ist keinesfalls komfortabler.
Hier kommt nichts mehr?
Plötzlich wird der Halbdschungel zum Garten: Zitronenhaine, Reis- und Weizenfelder, Tabak- und Kaffeepflanzungen. Der Ankömmling beginnt nach seiner langen Reise durch das Nichts unwillkürlich zu schmecken, was er sieht, zu sehen, was er schmeckt, und doch ist solche Hingegebenheit leichtfertig, will er nicht schon mit dem nächsten Schritt vier Meter tief in die Erde stürzen und den Himmel nur noch als mehr oder minder fernes blaues Rechteck über sich erblicken. Das wäre die zweckwidrige Nutzung einer Löwenfalle, und es gibt gleich mehrere vor dem hohen Palisadenzaun von Lado, sorgfältig bedeckt mit Blättern aller Art.
Am Abend werden kleine Zicklein in die Gruben abgeseilt, die Löwen finden so den Weg besser.
Manchmal weiß Emin Bey schon nicht mehr wohin mit den Grubenlöwen. Man könnte auch von einer Löwenplage in Äquatoria sprechen. So heißt die südlichste Provinz Ägyptens, die dieses ein halbes Jahrhundert zuvor annektiert hatte, als es in Erinnerung seines einstigen Ruhmes von akuten Großmachtphantasien überwältigt wurde, denen es nichts entgegenzusetzen vermochte. Wer mit der Zeit geht, besitzt eine Kolonie.
Emin Bey
Warum sollte nicht auch Ägypten eine haben?
Wahrscheinlich gedachte es auf diese Weise zugleich den Umstand zu kompensieren, dass es seinerseits nur eine Provinz des Osmanischen Reiches ist, wenn auch eine mit erheblichen Vollmachten.
Am südlichsten Punkt des Osmanischen Reiches gibt es neben der Löwenplage auch noch die Elefantenplage und natürlich die Krokodilplage. Gegen Letztere hat Emin Bey einfach einen Palisadenzaun in den Fluss setzen lassen, und seitdem gehen die Einwohner von Lado baden, sooft sie wollen. Im Gegensatz zu den meisten Orten auf der Welt haben die Leute von Lado kurz vorm Äquator nichts gegen ihren Bürgermeister, im Gegenteil.
Emin Bey ist nicht nur der Herr der Stadt, sondern auch Gouverneur von ganz Äquatoria. Charles George Gordon persönlich, einst Führer der Ever Victorious Army im chinesischen Opiumkrieg und längst eine lebende Legende, hat ihn zu seinem Nachfolger ernannt. Obwohl ihm der Mann anfangs durchaus suspekt vorkam.
Denn Emin Bey ist nicht Emin Beys richtiger Name, eigentlich heißt er Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer und kommt aus Oppeln in Oberschlesien. Gordon aber hat er erklärt, er sei Türke. Wahrscheinlich weiß kein Einwohner von Lado, dass ein Oppelner Oberschlesier sie regiert, er selbst vergisst es auch manchmal, zumal es die Dinge nur unnötig kompliziert machen würde.
Während der Verbesserer der Philosophie Arthur Schopenhauers in London eine schlaflose Nacht nach der anderen verbringt und der kommende Denker des Willens zur Macht versucht, den schlimmsten Winter seines Lebens zu überstehen, schreibt Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer aus Oppeln in Lado am Nil einen Brief, dessen letzte Zeilen lauten: So viel weiß ich, daß gegenwärtig meine Provinz die einzige ist, in der Ruhe herrscht und die dem Gouvernement etwas einträgt.2
Letzteres bezieht sich nicht zuletzt auf die Beilegung der Elefantenplage. Es war dem Absender bereits nach kürzester Zeit im Amt gelungen, seinen Regierungsbezirk schuldenfrei zu machen, was sonst nirgends in ganz Ägypten vorkam, und nach drei Jahren erzielte er schon einen Überschuss von 240 000 Mark.
Anfangs hatte der Bürgermeister von Lado die Summen noch ordnungsgemäß an das Generalgouvernement abgeführt, denn damals kam ab und zu ein Dampfer von Khartum, der den Lohn der Staatsdiener und Soldaten sowie neue Staatsdiener und neue Soldaten brachte. Zwar handelte es sich bei den Ankömmlingen meist um Strafversetzte, Trunkenbolde, Kriminelle oder einfach um solche Beamte, deren Unfähigkeit selbst das in Ägypten tolerierbare Maß überschritt, aber Schnitzer hatte längst aufgehört zu klagen. Sein Reich war nun einmal ein Äquatorial-Sibirien, schon weil es so unfassbar weltentlegen war, weil kein gewöhnlicher Ägypter so weit nilabwärts denken konnte.
Natürlich brachte der Dampfer auch jene Güter, die sich in Lado nicht leicht herstellen ließen. Dazu gehörten namentlich guter italienischer Wein, Zucker und Seife sowie Stoffe, Stiefel und das Zubehör, das Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer zum Präparieren unbekannter, von ihm entdeckter Vogelarten benötigte, eine Tätigkeit, die ihn für alle Unbill zu entschädigen pflegt. Über der Entdeckung des Anomalurus etwa, einer Art von fliegendem Eichhörnchen, von dem die Wissenschaft bisher annahm, es komme nur in Guinea vor, konnte der Gouverneur von Äquatoria in hellste Grade des Entzückens geraten. Und wenn er ganz offen reden sollte, so müsste er sagen: Darum bin ich hier.
Natürlich auch, um auszuprobieren, was auf dem Boden Äquatorial-Sibiriens alles wächst, wozu er eine rege Korrespondenz mit Experten für tropische Landwirtschaft unterhält, um sie zu bewegen, ihm Samen der unwahrscheinlichsten Pflanzen zu schicken. Oder auch nur Kaffee.
Verzeihen Sie einem Unbekannten, der Sie zu belästigen wagt, hatte Eduard Schnitzer im August 1880 den großen Botaniker Professor Georg Schweinfurth gebeten, um fortzufahren: Es sind nun zwei Jahre her, daß, als ich die Verwaltung dieses Landes übernahm, ich mich zugleich an Gordon Pascha und an einige tonangebende Persönlichkeiten in Aegypten mit der Bitte wandte, mich durch Zusendung von Sämereien in meiner Aufgabe zu unterstützen. Ich dachte dabei in erster Reihe an Kulturpflanzen, die mit der Zeit dem Lande Gewinn bringen könnten als Chinchona, Cacao, Kaffee, Vanille, Indigo etc., echten Bambus zum Häuserbau hier, und was immer noch sich fände.3Von seinen Uganda-Reisen habe er selbst vieles mitgebracht, was gut angewachsen sei, etwa Dioscorea, Carica oder Papaya. Leider seien aber die Kaffeepflanzen auf dem Transport zugrunde gegangen. Da mir auf meine eben erwähnten Bitten, sowie später auf ein Ersuchen um ägyptischen Reis (ich baue hier Uganda-Reis) und Liberia-Kaffee, nie eine Antwort zu Theil wurde, wagte ich es heute, mich an Sie zu wenden, dem es durch seine Welt-Verbindungen nicht schwerfallen dürfte, dieser Provinz durch Hilfe mit solchen Dingen zum Wohltäter zu werden. Professor Schweinfurth möge, vorausgesetzt, dass er dem Absender ob der Belästigung nicht doch zürne, nur alles an Herrn Konsul Hansal adressieren, der die Beförderung gewiss übernehme. Inzwischen hegt er da Zweifel.
Natürlich muss der Gouverneur einer so großen Provinz regelmäßig all seine Unterprovinzen aufsuchen, schon weil, und darüber pflegt Eduard Schnitzer sich keinen Illusionen hinzugeben, er selbst streng genommen das einzige Element der öffentlichen Ordnung Äquatorias darstellt. Dieses wird von insgesamt fünfzig mit Soldaten und Beamten bemannten Stationen aus regiert, und manchmal ist sich der Gouverneur durchaus nicht sicher, wer das größere Übel darstellt: die Regierenden oder die Regierten.
Denn die Sendboten der ägyptischen Macht pflegen alles, was sie brauchen, in den umliegenden Dörfern zu konfiszieren und nennen dies Ausübung der Staatsgewalt, wobei die Betonung auf der zweiten und dritten Silbe des Doppelworts liegt, auch hat von einer Staatszärtlichkeit noch nie jemand gehört.
Mitunter konfiszieren die Beamten die Einwohner gleich mit und suchen sie mit Gewinn weiterzuverkaufen. Das ist zwar einerseits verboten, sogar streng verboten, andererseits aber eine alte Gewohnheit und ein traditioneller Haupterwerbszweig ganzer zugewanderter Bevölkerungsteile, die eigentlich etwas nördlicher, etwas wüstennäher wohnen, hier unten jedoch bevorzugt ihren Beruf ausüben. Um zwischen allen stets aufs Neue eine wie immer geartete fragile Eintracht herzustellen, reist der Gouverneur, der im Grunde nur ein gut getarnter Ornithologe und Gärtner ist, von Ort zu Ort.
Die Pflicht korrespondiert aber auf erfreuliche Weise mit seiner Neugier, nachzuschauen, was an den verschiedenen Plätzen inzwischen wieder angewachsen ist und welche Vogelarten er vielleicht beim letzten Besuch übersehen haben könnte. Im vergangenen Jahr etwa hatte der oberste Befehlshaber Äquatorial-Sibiriens seine etwas entlegene Provinz Bufi besucht und über die Fortschritte der tropischen Landwirtschaft unter den spezifischen Bodenverhältnissen Bufis das Folgende notiert: Jedes Gehöft umschließt einen kleinen Garten, in welchem Mais, Bamien, eine Art weißer Bohnen, Zwiebeln und Tabak gebaut werden. Die Tomate hat ihren Weg noch nicht hierhergefunden, dagegen sind Bananen, Zitronen, bittere Orangen in jungen Bäumen und die von mir aus Uganda bei uns eingeführte Papaya über Makraka bis hierher gelangt.4An Kulturpflanzen seien außer den üblichen Getreidearten noch süße Bataten (rothrindige), Cor-chorus, Gynandropsis, Hibiscus cannabinus und Baumwolle zweier Arten (eine mit weißgelbem Filz am Samen, während die des Bari-Landes grünen Samen hat) zu erwähnen. Dass der Verfasser seine Stationsbesatzungen zu ehrgeizigen Landwirten und Gärtnern fortbildet, findet seine Rechtfertigung nicht zuletzt in der Absicht, das Konfiszieren von einer Haupttätigkeit ägyptischer Beamter zu einer Nebentätigkeit werden zu lassen.
Zu bemerken ist die Länge des Agrarreports aus Bufi, wogegen der Verfasser für die Tatsache, dass Leoparden hier am hellen Tag die Leute aus ihren Häusern holen, lediglich einen Satz übrig hat – nein, zwei Sätze, denn ihm fiel zudem auf, dass die Katzen die schwarzen Einwohner Bufis fast immer verschonen, wogegen die hellhäutigeren Wüstensöhne, meist Dongolaner, gefährdet waren. Rächten die Leoparden gar stellvertretend den Raub der Landeskinder? Der Gouverneur steht fest auf der Seite der Leoparden.
Am liebsten hätte er die islamischen Nomaden aus Danakil und Dongolaschon längst dahin zurückgeschickt, woher sie kamen: in die Wüsten um Khartum. Meist ziehen sie als Kleinhändler durch das Land, verkaufen den Eingeborenen Stoffe und Pulver, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, diese selbst zu verkaufen. Dass überhaupt noch Neger existieren, sei unter diesen Umständen erstaunlich, schrieb er eben erst dem botanisierenden Professor, den er um neue Kaffeesetzlinge gebeten hatte. Gern lassen sie sich die Dongolaner auch als Dragoman – als Vorsteher – in den schwarzen Dörfern nieder, wo sie die verschiedenen Aspekte ihrer Tätigkeit besonders ertragreich zu verbinden wissen.
Auch in Bufi übergaben die Schwarzen dem Gouverneur bald wie fast überall eine Liste mit den Namen ihrer geraubten und versteckten Brüder und Schwestern, Kinder und Eltern. Mehr als zweihundert fehlten. Zwei Tage später war ihre Zahl nochmals gestiegen: Trotz aller Mühen noch immer mitten in Sklavenhändeln, über vierhundert sind es geworden, die man bis jetzt reklamiert, und dies außer den versteckten Mombuttu- und Njam-Njam-Sklaven.5
Der regierende Ornithologe aus Oberschlesien wusste, dass er nur über ein Mittel verfügte, sie wiederzuerlangen, und das ist die Würde seiner Person. Er ist sich durchaus nicht sicher, ob er eine solche besitzt, ja, mehr noch, seiner Ansicht nach lassen sich die Menschen in zwei Hauptgruppen teilen, in solche, die lachen, und in solche, die ausgelacht werden, und es ist mir stets unklar geblieben, zu welcher ich gehöre.6Das hat sich seit seiner Ankunft in Äquatorial-Sibirien keineswegs geändert. Nur dass er hier niemanden weiß, mit dem er die ihn umtreibende Frage, ob er ein lächerlicher Mensch sei, überhaupt diskutieren könnte.
Er ist vielmehr darauf angewiesen, dass alle ringsum, so verschieden ihre Interessen, ihre Lebenslagen sein mögen, das Gegenteil annehmen. Insbesondere die Abgesandten des sklaventreibenden Volkes derDongolaner, denen er nun gegenübertreten musste.
Er habe noch nie ein verächtlicheres Gesindel gesehen, notierte er, auch wollte er diese Menschen mit ihren simplen, grausamen Weltbegriffen gar nicht beeindrucken, allein er musste es. Und hatte dazu wie so oft nichts als sich selbst, eine Gemessenheit in Bewegung und Sprache, eine äußere Ruhe, der keine innere entsprach, sowie einen überaus scharfen, das Gegenüber gleichsam inhaftierenden Blick durch die Gläser seiner Brille.
Ein Effekt, den er vor allem seiner Kurzsichtigkeit verdankte.
Auch spricht er statt nur einer viele Sprachen, darunter fließend Arabisch und Türkisch sowie mehrere lokale Dialekte, was ihn durchaus als Wesen höherer Ordnung beglaubigt. Das Ergebnis seines Auftritts überrascht ihn dennoch oft genug, und so war es auch in Bufi: Von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittags habe ich heute … einhundertunddreißig Sklaven an ihre Verwandten … zurückgegeben.7Und das war erst der Anfang.
Dieser Bericht hat, wie er gern zugibt, seine Ursprungsfrage etwas aus den Augen verloren, oder sagen wir: Er hat sie in weiten Bögen umkreist, denn manchmal ist die direkteste Verbindung zwischen zwei Punkten eben doch die krumme. Zu erklären waren die Überschüsse der ägyptischen Provinz Äquatoria in Bezug auf die Elefantenplage unter besonderer Berücksichtigung des Umstands, dass im gerade vergehenden Jahr 1882 nur ein einziger Dampfer nach Lado kam.
Nur ein einziger Dampfer!
Der Amateurlandwirt und Sklavenbefreier hat mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit längst begonnen, die erwirtschafteten, jedoch nicht abführbaren Erträge seiner Tätigkeit in Form von Elefantenzähnen einzulagern. Schon sein Vorgänger General Gordon begründete eine Art Elfenbein-Sozialismus im südlichen Ägypten: Alle Elefantenzähne gehören der Regierung!
Man wird den Wert von Emin Beys Elfenbeinmagazinen einmal auf über 1 000 000 Mark schätzen, auch hat der Gouverneur von Äquatoria der Regierung in Khartum unlängst in einer wissenschaftlichen Expertise mitgeteilt, welche bislang verkannten Werte die Rhinozerosse im Maul und die Flusspferde auf der Nase trügen. Beide gebe es, noch immer sträflich unbehelligt, im Überfluss in Äquatoria. Nein, sentimental ist er nicht.
So viel weiß ich, daß gegenwärtig meine Provinz die einzige ist, in der Ruhe herrscht und die dem Gouvernement etwas einträgt, hatte er einem Freund mitgeteilt. Der zweite Teil dieses Satzes darf als erklärt gelten, der erste ist es noch nicht.
Im Frühling dieses Jahres war Eduard Schnitzer an Bord des Dampfers Bordein zu einer Reise in die Hauptstadt des Generalgouvernements nach Khartum aufgebrochen, er würde alte Freunde wiedersehen, etwa Giegler Pascha oder Rosset Pascha. Jede Meile, die die Bordein gen Norden gewann, machte ihn lebendiger.
Giegler Pascha ist Carl Christian Giegler, Vertreter der Firma Siemens und als solcher Jahre zuvor mit der Aufgabe konfrontiert, ein sudanesisches Telegraphenwesen zu errichten; Friedrich Rosset hingegen hatte das Amt des deutschen Vizekonsuls in der sudanesischen Hauptstadt inne. Beide sahen 1875 einen jungen völlig mittellosen Mediziner in Khartum stranden, der sich als Türke ausgab, obwohl sein Pass etwas anderes sagte. Kein Türke heißt Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer. Aber der hoffnungsvolle Mann mit dem Identitätsproblem spielte gut Klavier und noch besser Schach, weshalb Rosset bald begann, ihn mittags zu sich zum Essen einzuladen, was der Pionier des sudanesischen Fernmeldewesens am Abend übernahm. Giegler und der junge Arzt, der sich Emin nannte, der Vertrauenswürdige, spielten nach Tisch oft noch etwas Schach.
Manchmal besuchten sie auch zu dritt den österreichischen Konsul Hansal, der ein Klavier besaß, und dann spielte Emin Bey Chopin und Mendelssohn, oder er begleitete den Konsul, der eine große Meinung von seiner Stimme besaß. Auch hatte er den Wiener Männergesangsverein mitgegründet, bevor er die Leichtfertigkeit beging, diese staubige Stadt mit nichts als Wüste drum herum zu seinem neuen Lebensmittelpunkt zu machen. Khartum!
Dieser Stadt strebte der führende Ornithologe Äquatorias nun nilaufwärts entgegen, als die Bordein an der Nil-Insel Aba vorüberkam. Schnitzer betrachtete sie nicht ohne eine gewisse Nachdenklichkeit. Denn hier war im Jahr zuvor, als er in Bufi Sklaven befreite, ein gutaussehender junger Mann, der eigentlich Schiffszimmermann werden sollte, zu der Überzeugung gelangt, doch einen anderen Beruf ergreifen zu müssen. Er sei, teilte Mohammed Ahmed zuerst den Einwohnern von Aba mit, der Erlöser. Er sei der verheißene letzte Prophet, der Mahdi, der Erneuerer des Islam.
Zwei Dinge waren Mohammed Ahmed aufgefallen: Die Sitten seien verkommen, zu viele Ungläubige regierten im Land. Es konnte dafür nur einen Grund geben: Das Volk Mohammeds ist nachlässig geworden im Glauben. So rief der Sohn eines Bootsbauers auf der Insel Aba im Weißen Nil den ersten Dschihad der Geschichte aus.
Aus seiner neuen Stellung als Mahdi folgte vieles, zum Beispiel zahlt ein Mahdi keine Steuern, und er sicherte allen, die ihm folgen wollten, ebenfalls eine Steuerbefreiung zu.
In diesem Memorandum des Steuerbürgers Mohammed Ahmed gab sich nicht zuletzt ein starker Vorbehalt gegen die Art der Erhebung des Zinses kund, denn er wird von Widerstrebenden gewöhnlich mit der Kiboko eingetrieben, der Peitsche aus harter Nilpferdhaut, die ganz Afrika kennt.
Der Generalgouverneur in Khartum entsandte daraufhin eine Kommission nach Aba, den Fall zu untersuchen und den Propheten gleich mitzubringen. Dies gelang aber nicht, stattdessen blieb die Kommission verschollen. Nun wurden dreihundert Soldaten gen Aba geschickt. Sie kamen nicht wieder. Doch der Erlöser verfügte jetzt über Waffen.
An all das musste der Oppelner Oberschlesier denken, als er an der Insel vorbeifuhr. Er nennt Mohammed Ahmed nur den Fakir, doch das ist nicht Geringschätzung des Bekenners einer fremden Religion, denn es handelt sich um seine eigene.
Eduard Schnitzer stand schon in den Diensten des Osmanischen Reichs, als er noch Arzt auf dem Balkan war. Das Osmanische Reich hat ihn immer gut behandelt, ist es da nicht angemessen, die Religion des Gastgeber-Imperiums nicht zu brüskieren? So ist er schon vor Jahren zum Islam übergetreten, nannte sich fortan Emin, und wahrscheinlich tat ihm das ungemein wohl.
Denn eigentlich heißt er auch nicht Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer. Bei seiner Geburt hieß Emin Bey noch Isaak Eduard Schnitzer. Erst nachdem sein Vater starb, der jüdische Kaufmann Louis Schnitzer, wurden ihm die Namen Karl, Oskar und Theodor zugefügt. Seine Mutter ließ sich und ihre Kinder taufen, um einen Christen zu heiraten. Damals war ihr Sohn wehrlos.
Aber warum sollte er nicht können, was seine Mutter konnte: einfach im Vorbeigehen die Religion wechseln?
Es hatte zudem den Vorteil, die fremden Namen abzuschütteln. Religion ist eine Hülle, eine Konvention, nicht mehr als eine Höflichkeit der Umwelt gegenüber.
Am Ende hat jeder seine eigene, und je tiefer sie ist, umso weniger lässt sie sich einfach bekennen. Was tief ist, liebt die Maske, weiß jener Philosoph, der noch immer in seinem italienischen Fischerdorf sitzt und den noch kaum einer kennt. Emin Bey ist von verwandtem Temperament. Er hat seinen Schritt nie einem Menschen erklärt, auch Charles George Gordon nicht, und der sollte ihn immerhin 1876 einstellen. Als Arzt für Ägyptens südliche Provinzen.
Alle waren sehr traurig, als der Klavier- und Schachspieler Khartum schließlich verließ, um nach Lado zu gehen, wohin ihn der Führer der Ever Victorious Army schließlich doch delegierte, nachdem er diesen Menschen mit tiefem Unbehagen besehen hatte: Man kann für diese Mohammedaner Kolonien erobern und verwalten, man kann ihren Reichtum und Ruhm mehren, durchaus, wenn es dem eigenen nicht schadet, um das Mindeste zu sagen. Aber ihre Religion annehmen?
Er ist Gordon Pascha, die Mohammedaner haben ihm den Titel verliehen, schließlich steht er in ihren Diensten. Und dennoch würde er, Charles George Gordon, Gordon Pascha, nie auf die Idee kommen, sich für einen Mohammedaner auszugeben. Nein, er war sich wirklich nicht sicher gewesen, ob er diesen merkwürdigen schlesischen Arzt ohne Vaterland in seinen Dienst nehmen sollte. Und dann vertraute er ihm schließlich nicht nur die Kranken von Lado, sondern die ganze Provinz an, die er einst für den Khediven von Ägypten miterobert hatte. Bei niemandem, das wusste er inzwischen, wäre sie besser aufgehoben. Nennen wir den Oppelner Oberschlesier von nun an Emin Bey, denn unter diesem Namen kennt man ihn hier, so unterzeichnet er seine Briefe. Bey heißen die, die noch nicht Pascha geworden sind, der Titel zeigt den Rang an in der Beamtenhierarchie des Osmanischen Reiches.
Lado ist so weit weg, dass kein Mensch bemerken würde, wenn es eines Tages einfach fehlte. Aber genau an einen solchen Ort hatte Eduard Schnitzer gewollt. Was zählen hier noch Herkunft, was Identität? Hier ist Identität das, was man täglich neu erwirbt. Giegler Pascha, der Siemens-Vertreter, wurde gerade zum Generalinspektor für die Abschaffung des Sklavenhandels im Sudan befördert. Es war schön gewesen in Khartum. Sie haben noch so viel vor. Und wie gern würde er wieder auf Hansals Klavier Mendelssohn spielen.
Emin Bey schaut zwischen den geblümten Vorhängen der Fenster hinaus auf seine Zitronenbäume und den Fluss. Seltsam, zu denken, dass sein Reich als einziges noch ruhig ist in ganz Ägypten. Überall sonst hat der Fakir es schon in Brand gesetzt.
Wenn endlich wieder ein Dampfer käme!
Wenn er nur Nachrichten hätte aus Khartum!
Ein zweitrangiges Talent. Eine Sekundärbegabung?
Der Welt beitreten! Nicht zuletzt um dieses Selbstgelöbnisses willen sind sie jetzt hier in der größtmöglichen Stadt Berlin und leben doch wie damals in Ingersleben: die Doppelschwestern, die Einzelschwester und die Großmutter.
Wenn da nur diese Nachricht nicht wäre, die sie so traurig macht: Onkel Otto kann Ingersleben nicht halten, ihr Ingersleben. Er will, er muss es verkaufen. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass es endlich schuldenfrei wurde, und das verdankte Friedas Großvater, der Hofmarschall des Herzogs von Meiningen, der Eisenbahn. Denn die Eisenbahn ließ sich nicht von ihrem Vorsatz abbringen, ein neues Gleis quer durch seinen Besitz zu legen, und zahlte dafür eine Entschädigung. Ingersleben war schuldenfrei. Und sein Sohn gibt es auf?
Sie fahren ein letztes Mal, einen letzten Sommer lang an den schönsten Ort ihrer Kindheit und Jugend, wenn man Smyrna wegen Unerreichbarkeit nicht mitzählt. Gibt es nicht Dinge im Leben, die unveräußerlich sind? Heimaten gehören dazu. Immer wieder wird Frieda von Ingersleben träumen. Auch die von Riffelshausen in Margaretes Roman, über den die Autorität noch immer ihr Urteil nicht gesprochen hat und in dem Ingersleben unsterblich geworden ist, stehen fortwährend am Rande ihrer Existenz.
Geld. Sobald das Wort fällt, möchte Frieda von Bülow die Augen schließen. Es ist nicht so, dass sie Geld mit einem Daseinszweck verwechseln würde. Aber seine Abwesenheit macht das Leben zu einem einzigen Hindernislauf. Der Vorteil, welches zu besitzen, liegt dagegen auf der Hand: Man muss nicht immerzu daran denken.
Gibt es einen Adel zweiter Klasse? Die junge Frau lehnt es ab, die Antwort vor sich zu verbergen. Sie lautet: Ja! Zwei Buchstaben nur, ein kurzes, hartes Wort, ein Wort wie ein Schicksal.
Die Herabgesunkenen, die Minderprivilegierten organisieren sich, kluge Männer schreiben ihnen Manifeste, immer lauter rufen diese Letzten von heute, von denen manche sagen, dass sie die Ersten von morgen sein werden. Reichskanzler Bismarck hat bereits Gesetze gegen diese neue Klasse erlassen, um sie zu bändigen: »Sozialistengesetze«. Die Proletarier haben, wenn man ihren Fürsprechern glauben darf, nichts zu verlieren als ihre Ketten. Das ist der Vorteil der Besitzlosen; sie dagegen haben viel mehr als nur einen Namen zu verlieren.
Wer spricht von der Klasse, der sie angehört? Ihre Klasse ist stumm, sie ist zu gut erzogen, um laut zu sein. Zu klagen wäre gegen jede Etikette. Der verarmende Adel leidet und schweigt. Oder er schreibt, wie Margarete, seinen Schicksalsroman. Proletarier! Die haben immerhin noch ihre Kinder. Das lateinische Wort proles bedeutet: die nichts haben als ihre Nachkommen.
Und sie, wird sie jemals welche haben?
Möchte sie denn Kinder haben? Möchte sie leben wie ihre Mutter, ein Stück Inventar im Dasein eines anderen, ein Frauenmöbel, irgendwo abgestellt und dann vom Leben vergessen? Nein, es ist unmöglich. Sie weiß zu viel von sich, schon jetzt, um für diese naive Lebensform zu taugen. Und Heirat ist eine naive Lebensform, letztlich Zeugnis einer fatalistischen Daseinsauffassung. Man kann zum Lobe der von Bülow vieles sagen, aber Gemütsmenschen sind sie nicht. Sie neigen zum Jähzorn, ihr Vater machte da keine Ausnahme. Und es ist eine Zumutung, sich dem Temperament eines fremden Menschen ausliefern zu sollen.
Sie besucht Helene Langes Lehrerinnenseminar, und manchmal ist sie sehr froh darüber. Auf eigenen Füßen durchs Leben gehen! Eine weibliche Fortbewegungsart war das noch nie, aber ihren Töchtern, das weiß auch Mutter Clothilde von Bülow, würde im schlimmsten Fall nichts anderes übrigbleiben. Denn ihr Name macht ihre Stellung in der Welt nicht einfacher, sie können nicht einfach nach unten heiraten.
Auf eigenen Füßen. Für Helene Lange ist es die weibliche Gangart der Zukunft, ist es Tugend statt Makel. Oder nein, es ist Notwehr. Sie wird es einmal so erklären: Eine rauhe Hand hat den häuslichen Herd gestreift und Millionen von Frauen hinausgewiesen in die Welt. … Wir alle wissen, wie es gekommen: wie zu derselben Zeit, wo … dem Manne sich neue, lohnende Felder der Thätigkeit erschlossen, das Sausen der Maschinen begann, die in der Werkstatt erzeugten, was emsige Frauenhände bisher geschaffen … Bei Tausenden von alleinstehenden Frauen hielt bittere Not, bei Tausenden unfreiwillige Muße und geistige Not ihren Einzug.8
Frieda bewundert Helene Lange, ihren Mut, ihre Entschlossenheit, notfalls gegen eine ganze Welt zu stehen, gegen die Welt des Hergebrachten, gegen die Welt von gestern, die zu oft noch die Welt von heute ist.
Und Friedas Schülerinnen würden gewiss etwas ganz anderes lernen als sie selbst in Neudietendorf. Beten zumindest würden sie nicht lernen. Wer in einer Mädchenerziehungsanstalt der Herrnhuter groß wurde, besitzt starke Motive. Sie ist eine Entronnene. Wer den Frömmlern entkommen ist, wirft Ballast ab, zuerst Gott. Sie wird ihren Schülerinnen ungefähr das Gegenteil dessen sagen, was ihre Lehrer ihr gesagt haben. Vor allem, dass das Leben nicht in der Hand des Herrn liegt, sondern in der eigenen. Das geht nicht gegen den Herrn. Er ist entschuldigt, aus dem verzeihlichsten aller Gründe. Wegen Nichtexistenz. Diese Welt ist am besten erklärbar ohne ihn.
Alles liegt in der eigenen Hand?
Und doch erscheint ihr der Gedanke absurd, dass sie in einem Klassenzimmer alt werden soll. Morgen für Morgen, Tag für Tag vor jungen Mädchen stehen, die nichts vom Leben wissen und alles von ihm erwarten. Nein, es muss noch etwas anderes geben, eine Zugabe des Lebens.
So wie bei Margarete, der Schwester, ihrem zweiten Ich. Wie haben sie geträumt vom eigenen Schreiben in der Mädchenerziehungsanstalt von Neudietendorf! Es ist noch nicht lange her. Aber Margarete träumt nicht mehr. Mit achtzehn Jahren hat sie begonnen, ernst zu machen. Margarete, die kleine Schwester. Margarete, die Begabtere. Längst arbeitet sie an ihrem zweiten Roman, er heißt Jonas Briccius und handelt von einem Landpfarrer, der seinen Glauben bewohnt wie eine Festung und das Dorfluder heiratet, um es zu erlösen. Schon in der Chronik derer von Riffelshausen war der Pfarrer besonders gut gelungen.
Schriftsteller sind latent asozial. Sie leben nicht in der Wirklichkeit, sondern in ihren Manuskripten. Sie bewohnen mindestens zwei Welten gleichzeitig. Niemand weiß das so genau wie sie. Margarete und Frieda haben ihre Zweitwelt, die doch die eigentliche ist, den »Rosengarten« genannt. Darf sie Margarete dort allein lassen? Sie ist eine Heimatvertriebene des Rosengartens.
Und wenn Margarete sich Urlaub nimmt von ihren Novellen, von ihrem zweiten Roman, sind schon die da, die auch schreiben. Männer. Bewunderer, etwa Julian Schmidt. Sie behaupten, sie bewundern Margaretes Talent. Sie ist sich da nicht so sicher. Gott sei Dank ist Schmidt schon älter. Aber wenn die Autorität sich meldet, fängt das erst richtig an, ahnt Frieda. Was soll sie da noch, die Schwester? Und doch liebt sie Margarete zu sehr, um ihr Talent und Erfolg zu neiden. Sie liebt sie aber auch zu sehr, um sie mit anderen zu teilen.
Wer bewundert das Talent einer Lehrerin?
Sie könnte wieder beginnen zu schreiben. Vielleicht am Anfang kleine Feuilletons, Margarete schreibt auch Feuilletons für die Tägliche Rundschau, sie kennt den Herausgeber. Und selbst wenn sie, Frieda von Bülow, 25 Jahre alt, ein zweitrangiges Talent wäre, eine Sekundärbegabung: Gibt es nicht eine eigene Würde, ein eigenes Recht der Mittelmäßigkeit? Immerhin wäre es ein Mehrheitsrecht. Also ein Menschenrecht?
Sie muss sich eine Zukunft versprechen.
Die Selbstprophezeiung
Niemand lädt Carl Peters ein, zu bleiben. Sehen seine Gastgeber denn nicht, wie es um ihn steht? Oder geben sie ihm gar eine heimliche Mitschuld an Karl Engels Tod?
Es ist schon spät, als er sich erhebt und in die Londoner Novembernacht hinauswankt. Dennoch nimmt der strapazierte Gast nicht den kürzesten Weg nach Hause. Und wirklich, er hat sich nicht getäuscht, dort vorn steht ein Hotel. Er läuft hinein, ohne eine Tasche, geschweige denn einen Koffer bei sich zu tragen, lässt sich ein Zimmer geben und – schläft augenblicklich ein, schon auf der Bettkante.
Es war alles so schnell geschehen. Noch zu Beginn dieses Jahres war er mit dem Onkel in Tunbridge Wells gewesen. In dieser schönen Landschaft Kents hatten sie gemeinsam den Winter verbracht. Er arbeitete an Willenswelt und Weltwille, und der Onkel schlief. Das war außergewöhnlich, denn der Schlaf mied Karl Engel, so gut er konnte. Hier, in Tunbridge Wells, fand er endlich die Ruhe und Ausgeglichenheit, die London ihm verweigerte. Der Umstand versetzte ihn geradezu in Euphorie. Sein Wohlbefinden hatte einen Namen: Tunbridge Wells.
Und Karl Engel begann, mit seinem Neffen Häuser und Grundstücke zu besichtigen. Er studierte den Widerschein der Immobilien im Mienenspiel des jungen Mannes, las die kleinste Reaktion von dessen Gesicht. Sollte er selbst bauen? Oder nur einziehen? Irgendwann war Karl Engel ganz sicher, das Richtige gefunden zu haben. Da trat er vor seinen Neffen hin und begann ihm darzulegen, was sich nun schon seit einem Jahr in seinem Kopf vorbereitet hatte: Er könne sich ein neues Leben vorstellen. Für sich selbst und für ihn, den Neffen. Vor allem: ein gemeinsames Leben, wie es sich längst auf so erfreuliche Weise bewährt hatte. Ein Leben in Tunbridge Wells. Alles, sein Haus, sein Vermögen, seine Stellung in der Welt, wolle er mit seinem Neffen teilen. Ja, er werde ihn adoptieren.
Wer war Carl Peters denn, bevor Karl Engel in sein Leben trat? Ein Habenichts aus einem kleinen Ort an der Elbe, den schon in der nächstgrößeren Stadt niemand mehr mit Namen kannte. Er habe, erklärte der Onkel seinem Neffen, diesem noch mehr als Britannien, sich selbst und ein neues schlafförderliches Haus zu bieten. Er offeriere ihm eine Karriere als Gentleman. Schon morgen könne er in den Civil Service, in den britischen Staatsdienst, eintreten. Oder weiterhin ganz für seine Studien leben, wie er wolle. Nur eine Bedingung sei an diese Zukunft geknüpft, die morgen schon beginnen könne: Der Neffe müsse aufhören, ein Deutscher zu sein. Er müsse Brite werden, wie er selbst. Es handele sich nur um eine Äußerlichkeit, denn letztlich, da war der Künstler Karl Engel ganz sicher, gehöre doch jeder nur sich selber an. Also letztlich gar keiner Nation.
Was nun folgte, beendete das Leben des Virtuosen und Musikologen mit Schlafstörungen schon zu Lebzeiten. Las Engel das Erschrecken auf den vom Dasein noch kaum beschrifteten Zügen des Neffen? Spürte er die Ablehnung schon vor dem ersten Neffen-Wort? Er sei sich, sagte der Begünstigte, der Güte des Onkels sowie der Größe seines Angebots wohl bewusst. Allein, er könne es nicht annehmen. Weil er ein Deutscher sei. Peters sprach das Wort mit gemessenem Stolz.
Weil er was sei?, wollte Karl Engel fragen. Mit Ablehnung hatte er nicht gerechnet, nur mit verschiedenen Graden des Enthusiasmus. Und nun musste er beinahe lachen. Ja, aber Deutscher könne er doch bleiben, ganz für sich, denn abgesehen davon, dass grundsätzlich jeder sich selber angehöre, werde er seine Herkunft ohnehin niemals los.
Doch so, Karl Engel spürte es, meinte der Neffe es nicht. Er nahm eine ungute Art von Grundsätzlichkeit an dem jungen Mann wahr. Dieser Nationalstolz, war er nicht eher eine Art Nationaltrotz?
Jede Generation erhält ihre eigene Prägung. Über Carl Peters’ Jugend lag der Widerschein der Gründung des Deutschen Reichs. Das Reich und er brachen gemeinsam auf in die Zukunft, die, anders war es nicht zu denken, eine große Zukunft sein musste. Der Sieg von Sedan! Bismarck! Der Kaiser!
Seltsam nur, dass die Nennung seines Heimatlandes noch keinen Fremden beeindruckt hatte. Eher meinte der designierte Privatdozent Mitleid in den Mienen der anderen zu entdecken; ja, er war sicher, daß der Deutsche der Mindestgeachtete unter den Völkern Europas war, daß selbst die Holländer, Dänen, Norweger mit Verachtung auf uns heruntersahen.9





























