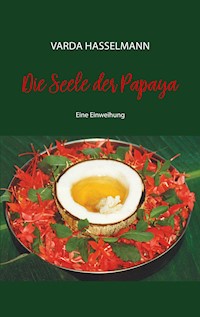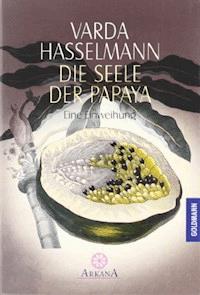5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Burgl Eichner, eine 17-jährige Bauerntochter, pflegt vier Monate lang die Säuglinge auf Dr. Mengeles Zwillingsstation. Sie kennt nichts anderes als die Nazi-Doktrin. Böses hat sie nie getan – und doch war sie „dabei“. Lebenslang gepeinigt von Angst und Scham, erhofft sich Burgl, einsam und in die Jahre gekommen, Erlösung durch eine Wallfahrt nach Santiago. Dort begegnet sie Vincent wieder, einem Freund aus Kindertagen. Er möchte ihr verhärtetes Herz öffnen …
Kann ein Mensch schuldig und unschuldig zugleich sein? Ist Schweigen barmherziger als die Wahrheit? Varda Hasselmann stellt in ihrem zweiten Roman die Frage nach der spirituellen Dimension von Verantwortung und Vergebung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Varda Hasselmann widmet sich in diesem spirituellen Roman einem zeitlosen Thema: Schuld und Vergebung.
Ganze 17 Jahre alt ist Walburga Eichner, genannt »Burgl«, als sie auf die Zwillingsstation von Dr. Mengele nach Auschwitz kommt und dort als Krankenschwester Säuglinge versorgt. An den Verbrechen ist sie nicht aktiv beteiligt, bereits nach vier Monaten wird das Lager aufgelöst. Doch sie war »dabei« – und fühlt sich zutiefst schuldig und verdammt. Sie verschließt sich vor der Welt, verbringt viele Jahre in innerer Erstarrung. Durch eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, so hofft sie, könnte die Last von ihr genommen werden und ihre Seele wieder ins Gleichgewicht kommen …
Ergänzt wird der Roman durch zwei Botschaften der »Quelle« zu den Themen »Wirklichkeit und Illusion menschlicher Schuld« sowie »Sünde«.
Autorin
Dr. Varda Hasselmann, geboren 1946, bereitete sich nach dem Studium der Literaturwissenschaft und Mittelalterkunde zunächst auf eine Universitätskarriere vor. Doch sie folgte ihrer Berufung und machte ihre mediale Begabung zum Beruf. Seit 1983 arbeitet sie als Trance-Medium, gibt Seminare und hält Vorträge. Die medial empfangene Seelenlehre legte sie zusammen mit Frank Schmolke in vielen Büchern dar. Als Autorin fiktionaler Stoffe hat Varda Hasselmann »Die Seele der Papaya« und den Erzählband »Aus lauter Liebe« verfasst.
Weitere Informationen unter www.septana.de.
Von Varda Hasselmann sind bei Goldmann erschienen:
Aus lauter Liebe (11093)
Die Seele der Papaya (12214)
Zusammen mit Frank Schmolke:
Wege der Seele (03587)
Archetypen der Seele (10836)
Die sieben Archetypen der Angst (03771)
Die Seelenfamilie (10837)
Weisheit der Seele (10835)
Welten der Seele (10838)
Varda Hasselmann
Die Seelenwaage
Roman
Septana®, Archetypen der Seele®, Seelenfamilie®, Selixa® und Seelen-Elixiere® sind international geschützte Marken. Sie dürfen für Publikationen und Veranstaltungen Dritter nicht verwendet werden. Auch die Ankündigung von und Werbung für jegliche Veranstaltung mit diesen Wortmarken ist nicht gestattet. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Juli 2015
© 2015 Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic, München
Lektorat: Christine Stecher, München
CC ∙ Herstellung: cb
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN 978-3-641-15684-8V004
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Walburga
Vinzenz
Anhang
• Nachwort
• Wirklichkeit und Illusion menschlicher Schuld
• Sünde
• Anmerkungen
• Adressen
Walburga
Mich kennt keiner. Dafür hab ich gesorgt. Täglich, stündlich, gründlich. Fünfzig Jahre lang und länger. Unsichtbar wollte ich sein. Und unsichtbar werd ich bleiben. Gut durchdacht und raffiniert geplant muss mein Alltag sein. Alles soll sich immer im Rahmen des Normalen abspielen. Bloß nicht auffallen. Bin am Ende nur eine wunderliche Alte, der man gern aus dem Weg geht, jaja. Das passt mir. In unserer Stadt ist es nicht ungewöhnlich, ein bisschen merkwürdig zu sein.
Wenn die Leute wüssten, was ich weiß, was wirklich ist, warum und wieso, würden sie mir ein Doppelleben vorwerfen. Doch für mich ist es nur ein Leben, ein nicht gelebtes Leben, eben mein Leben. Es hat nichts Zwiefaches, dieses Dasein. Mein Innen und mein Außen, mein Sein und mein Anschein sind letzten Endes eins. Ich bin ja keine, die heimlich zwei Ehemänner hat. Oder eine Bettlerin mit Millionen unter der Matratze. Auch keine Mörderin, deren Verbrechen nie entdeckt wurde. Meine Anonymität hält sich in bescheidenem Rahmen. Hab nichts zu verbergen, nur mich selbst. Und ein Erlebnis aus dem Jahr 1944, als ich siebzehn wurde.
Vergeben und vergessen heißt kostbare Erfahrungen zum Fenster hinauswerfen.
Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit
Beim Frühstückskaffee Nachrichten wie immer. Was ich hörte, gab mir den letzten Ruck. Wie jedes Jahr am 27. Januar sollte schon wieder in ganz Deutschland und vielen anderen Ländern der Befreiung von Auschwitz gedacht werden. Gedenktag, Gedenkstunde, Gedenkjahr! Wütend strich ich die Brotkrümel von meinem Küchentisch, wischte mit dem Lappen nach und schaute mich um. War alles aufgeräumt? Ich bin nämlich ordentlich und verlass nie das Haus, bevor es tipptopp sauber ist. Meine beiden Puppenkinder, einander zum Verwechseln ähnlich, saßen in ihren Rüschenkleidchen auf der Eckbank und starrten aus dunkelblauen Kulleraugen zur Tür hin. Ich meinte, ihre Angst zu spüren; streichelte ihnen über Haar und Wangen, nickte ihnen zu und sagte, wie um uns alle zu beruhigen: »Horch, Alma, horch, Cora: Jetzt wird alles gut! Heut geh ich hin!«
Die Meldungen hatten mich aufgebracht und auch ein Feuerfünkchen in mir entzündet, so dass ich meine Idee, die ich seit Kurzem bebrütete, in die Tat umsetzen konnte. Ich brauche nämlich keine Gedenkfeiern. Alle Tage kehren meine Erinnerungen zu Herbst und Winter 1944 zurück. Alle Tage begleitet mich würgende Angst. Alle Tage drückt das Gewicht einer gestaltlosen Schuld auf meine Brust. Aber damit wollte ich jetzt endlich Schluss machen.
Ein Reisebüro hatte ich noch nie betreten. Notfalls besorge ich am Bahnhof Fahrkarten nach Augsburg oder Ulm. In meinen mehr als siebzig Jahren ist das selten genug passiert. Während es viele Günzburger nach Teneriffa, an den Gardasee oder sogar nach Kenia zieht, bleibe ich lieber in der sicheren Umgebung. Früher goss ich manchmal wochenlang Blumen oder fütterte die Katzen anderer Leute; in letzter Zeit nicht mehr. Fernweh oder eine Lust am Unterwegssein hab ich mein Leben lang nicht verspürt, und das war auch an diesem 27. Januar 1999 nicht anders. Nie plagt mich die Sehnsucht, unterwegs zu sein, etwas zu erleben, die Erregung durch Fremdes und Neues zu suchen. Außer wegen jener einen großen Fahrt nach Osten bin ich aus Günzburg kaum herausgekommen. Reisewünsche sind mir in den letzten Monaten des Krieges ein für alle Mal vergangen. Was ich damals durchmachen musste, davon weiß die Jugend von heute nichts. Ich verachte sie dafür.
Seit der Sanierung ist Günzburg nicht wiederzuerkennen. Aus unserer grauen, heruntergewirtschafteten Altstadt ist ein schmuckes Vorzeigestädtchen geworden, mit Straßencafés, billigen Kleiderläden und Asia-Imbissen. Nur unsere schöne Pfarrkirche ist noch nicht vollständig restauriert, da genügt ein bisschen rosa Tünche nicht. Trotz des grauen Wetters hat die Stadt gewiss seit hundert Jahren oder mehr nicht so bunt ausgesehen wie an jenem Vormittag vor fünf Monaten, als ich zum Reisebüro ging. Bei Touristen ist Günzburg jetzt beliebt. Ich aber hab manchmal Mühe, meine altgewohnten Wege zwischen all den Blumenkübeln und pastellfarbenen Hausfassaden zu finden. Zum Ende des alten Jahrtausends bin ich ortsfremd geworden. Nein, meine Stadt ist das nicht mehr. Heimatlos. Hier fühle ich mich heimatlos.
In Denzingen, wo ich geboren wurde, wohne ich schon lange nicht mehr. Das alte Dorf ist inzwischen eingemeindet. Du wirst meine neue Anschrift herausfinden, wenn du mich suchst, Vinzenz, das kann ich nicht verhindern. Alois Mengele, Sohn und Nachfolger unseres Firmenpatriarchen, dessen Fabrik bis vor Kurzem die ganze Stadt beherrschte, hat mir in seiner Arbeitersiedlung, südlich der Ulmer Straße, ein kleines Häuschen besorgt, sozusagen als Wiedergutmachung für ein Leid, um das keiner auf der Welt weiß, nur die Mengeles und ich selbst. Vielleicht ist es auch eine Art Schweigegeld – eigentlich nicht nötig, denn ich hätte sowieso nichts verraten. Als ich den Hof verkaufen und umziehen musste, lebte der Doktor noch. Jedenfalls munkelte man in Günzburg, er sei irgendwo in Südamerika, wie so viele alte Nazis. Journalisten und Geheimdienste fahndeten nach ihm. Geschnappt wurde er nie, wie jeder weiß. Später, im Frühjahr 1985, belief sich die Prämie, die auf seinen Kopf ausgesetzt war, auf annähernd vier Millionen Dollar. So stand es in der Allgemeinen. Dabei war er damals schon zwei Jahre tot.
Von Haus aus Genetiker, hatte er es sich zum Ziel gesetzt, eine »Herrenrasse« von blonden, blauäugigen Ariern zu züchten. Dabei hatten die Zwillinge eine Schlüsselfunktion. Die Vererbungslehre bedurfte der empirischen Bestätigung, und wer hätte sich dazu besser geeignet als eine ihrem genetischen Erbgut nach vollkommen identische Gattung, die eineiigen Zwillinge?
Lagnado/Dekel, Die Zwillinge des Dr. Mengele1
Lange bildete ich mir ein, dass mein Tun oder Nicht-Tun, meine Tat und mein Geheimnis einzig meine Privatsache seien. Hab all die Jahre eine Schuld verborgen, die keine war – oder jedenfalls nicht so schrecklich, dass ich mein Leben hätte drangeben müssen. Jetzt bist du aufgetaucht, Vinzenz Glaser, Teufel im Engelsgewand oder Engel mit Pferdefuß. Reißt mich aus meiner Starre, bespuckst mich mit Barmherzigkeit, hauchst mir Leben ein, um mich zur Hölle zu schicken.
Mein fast vergessener, mein seltsamer Freund! Ich sage seltsam, weil wir ja nie befreundet waren, nicht mal in der Kindheit. Doch plötzlich willst du mein Freund sein, erzählst von damals, glaubst, du könntest mich rumkriegen, gar zu einer Gegenregung von Freundschaftlichkeit bewegen. Du bildest dir ein, dass ein bissle Liebe immer hilft. Aber bei mir wirken solche Tricks nicht. Wenn ich jetzt etwas aufschreibe, dir die notwendigen Bruchstücke meines Lebens erzähle, dann nur, weil ich, nur ich, es so will. Weil ich selbst und ganz allein für mich beschlossen hab, noch ein wenig Heilung und Trost im Schreiben zu finden. Da ich schon fast auf dem Sterbebett liege, versuch ich mir selbst eine Krankensalbung zu spenden. Und am Ende doch noch eine Art Beichte abzulegen, nachdem es beim heiligen Jakob in Santiago nicht geklappt hat.
Die Wallfahrt war umsonst. Meine kleine Hoffnung ist dahin. Deine Bemühungen haben nicht gefruchtet, denn ich war zu bockig und zu feige; ich weiß, ich weiß. Dass ich in den nächsten Tagen mit meiner armseligen Wahrheit herausrücken werde, damit hast du ganz und gar nichts zu tun. Untersteh dich, diesen Sinneswandel deinem Einfluss zuzuschreiben! Du meinst, mich zu kennen, intuitiv zu erkennen, wie du das nennst. Bist aber nichts als ein einsamer Hund, der einer alten Frau nachläuft, die gerade vom Metzger kommt. Hier hast du einen Wurstzipfel, Vinzenz! Ich sag dir etwas, das noch niemand weiß. Also aufgepasst, mach Männchen!
Du ahnst ebenso wenig wie alle anderen hier in unserer Stadt, dass meine mangelnde Bildung, mein schlichtes, ruppiges Gemüt, meine grobgestrickte Art nur gespielt sind. Wer überhaupt an mich denkt oder über mich lästert, hält mich für gestört, betrachtet mich als Psychopathin. Meint sogar, ich sei geistig behindert, vielleicht kriegsgeschädigt durch Verschüttung oder Vergewaltigung. Warum? Weil ich nie jemandem in die Augen schau. Weil ich nur selten und mühevoll den Mund aufmache und die Menschen meide. Es stimmt, dass die Sätze, wenn sie denn von Zeit zu Zeit gesagt werden müssen, nur stockend aus mir herausfallen. Meine Zunge ist es nicht gewöhnt, sich zu bewegen und zu formulieren. Meine Stimmbänder sind verkümmert. Ich wirke verstört, das weiß ich wohl. Aber was ich nicht weiß, ist die Antwort auf folgende Fragen: Bin ich wirklich so – oder doch nicht? Bin ich garstig und irre, oder tu ich nur so? Bin ich längst zu der Person geworden, als die ich seit Jahrzehnten gesehen werden wollte? Oder gibt es noch ein anderes Ich, eine andere Person mit meinem Namen?
Du hast mir gezeigt, dass meine wahre Schuld nicht uralt ist, sondern ganz jung, eine Schuld so unschuldig wie ein Säugling mit üblem Erbgut. Und ich, ich muss mich jetzt vorsichtig sichtbar machen. Du nötigst mich. Du bist der Ansicht, ich solle mich dir anvertrauen. »Mach endlich den Mund auf, Burgl!«, sagst du zu mir. Ob dir wohl klar ist, welch grausame Verantwortung du damit auf dich lädst? Ich soll in Frieden sterben können, ha! Das wünschst du dir, gell, das wünschst du dir. Unterdes wird deine Güte zu einem Spitzpfahl, den du durchs Herz der armen Wiedergängerin treibst. Und hältst derweil das Kreuz über mein Gesicht, um meine arme Seele zu retten.
Eines hast du jedenfalls schon bewirkt: Seit ein paar Tagen fühle ich die Pflicht, mich zu öffnen. Na ja, was man so öffnen nennt. Bin ich nicht wie der Tresorraum einer Bank? Um dort hineinzukommen, muss man entweder die richtigen Schlüssel haben oder eine Bombe hochgehen lassen. Du meinst vielleicht, du könntest den Schlüssel finden, aber glaub mir: Das stimmt nicht. Mich schließt keiner auf gegen meinen Willen. Da muss schon die Bombe her.
Und reden werde ich nicht, dazu kann kein Mensch mich zwingen, oder? Mir zuliebe und nur für dich, Vinzenz, schreibe ich jetzt auf, was ich zu sagen hab. Ich werde dich nötigen, mir mit den Augen zuzuhören, wenn du dies liest. Wahrscheinlich wünscht du dir, dass ich in langen Stunden des Beisammenseins in meiner Stube, bei einem Glas Wein gar, dir alles erzähle. Du möchtest dabei sein. Stellst es dir gemütlich vor. Aber du weißt gar nichts. Nicht einmal das weißt du von mir: Reden kann ich nicht. Das Reden hab ich verlernt in all den stummen Jahren. Hab eine Maulsperre. Nur noch das Nötigste, beim Kaufmann, oder das Oberflächlichste. Aber schreiben, artikulieren mit dem Sprachzentrum in meinem Kopf, das wird schon gehen. Musste ja mit zwanzig Maschine und Steno lernen, um die Stelle im Versorgungsamt zu bekommen. Im Büro waren zum Glück nur Akten zu bearbeiten. Für Publikumsverkehr befand man mich gänzlich ungeeignet. Gut so. Das diente dem Aufbau meiner Fassade.
Du fragst: Was ist das Leben? Das ist, als wollte man fragen: Was ist eine Mohrrübe? Eine Mohrrübe ist eine Mohrrübe. Mehr ist darüber nicht zu sagen.
Anton Tschechow an Olga Knipper, 1904
Während ich dies aufschreibe, schwitze ich vor Angst, und mein Herz stolpert. Das Nitrospray ist mir ausgegangen, doch zum Arzt will ich jetzt nicht mehr so kurz vor meinem Ende. Ein paar Tage wird sie schon noch durchhalten, die altgediente Maschine. Und wenn nicht, dann nicht. Dann blieben mir die Tabletten erspart, auch gut.
Vielleicht wär es die bessere Lösung, nichts zu erzählen und nichts zu gestehen. Was geht dich das alles an, Vinzenz? Wir kannten uns als Kinder. Jetzt treffen wir uns wieder als alte Leute. Ist das etwa Grund genug, die Schließfächer meines Innern zu öffnen, dir sogar die Schlüssel anzuvertrauen – wie komm ich bloß dazu? Erst sperre ich alles weg, als wären es Juwelen und mittelalterliche Urkunden, und dann zeige ich dir, dem erstbesten Dahergelaufenen, meine Geheimnisse wie ein argloses Kind, das seine kleinen Schätze in einer Zigarrenkiste auf dem Speicher versteckt hat! Ich selbst hab ja erst dieser Tage zum ersten Mal in die Kiste hineingeschaut, als hätte ich sie auf dem Dachboden meines Lebens ganz zufällig wiedergefunden und müsste mich jetzt wundern, welch seltsame Dinge ich dort in Verwahrung gegeben hatte.
Dazu gehört eine Begegnung mit dir, an die ich mich absolut nicht mehr erinnern will, von der nur du allein wusstest, als sei ich gar nicht dabei gewesen, was mich noch heute ärgert! Du wirst es nicht glauben, Vinzenz, aber dafür – das stell ich gerade fest – dafür, dass ich über dich schimpfen darf, ohne dass du mir Widerworte gibst oder versuchst, mich zu beruhigen, ist das Schreiben gut.
Seit Tagen beobachte ich schon, dass ich dich und deine imaginierte Meinung in meine Überlegungen einbeziehe. Dass ich dich denken und dich argumentieren lass, um daran meinen Widerstand zu erproben. Berücksichtige dein gelehrtes Pro und Kontra, deine verständnisvollen Einwände, um sie alsbald als banales Geschwätz abzutun. Ich ertappe mich, dass ich mit dir stumme Dialoge führe, wo ich doch immer Weltspezialistin für gedachte Selbstgespräche war: nur ich mit mir, mit Rechtfertigungen und Erklärungen, Entschuldigungen und wütenden Ausflüchten, die sich in meinem Kopf drehten und wanden, bis mir schwindlig wurde. Ich redete dabei nie laut, bin ja noch nicht ganz verrückt, könnt mich ja jemand hören. Hab immer nur die Lippen bewegt, bis sie ganz trocken wurden und ich sie alle paar Stunden mit Nivea eincremen musste. Ich spreche nach Art derer, denen man die Zunge herausgeschnitten hat, weil sie gelogen haben. Sogar beim Lesen bewege ich die Lippen wie ein mittelalterlicher Klosterbruder und bekomme Durst, wenn ich mich mit stummer Kehle über die Gedanken und Taten erdachter Figuren aufrege. Aber seit du mir vor Augen stehst, mit deinem müden, guten Blick und dem kleinen Vinzenz-Lächeln, hab ich keine Lust mehr zu lesen. Ist das nicht schon Grund genug, dich zu hassen?
Zur Hölle mit dir! Meine einzige Freude, die Bücher. Was soll ich denn jetzt den ganzen Tag tun? An dich denken? Ich nehme einen Band zur Hand und leg ihn wieder weg, weil ich mich auf nichts konzentrieren kann. Auch das Fernsehen ödet mich an, egal wie interessant die Sendungen sind. Ein halbes Leben lang hab ich mich am Geheimnis meiner autodidaktischen Bildungsarbeit ergötzen können. Wie Rumpelstilzchen hab ich frohlockt: Oh, wie gut, dass niemand weiß …!
Meine Wohnung könnte heute so voller Bücher sein wie eine Stadtbibliothek, wenn ich nicht jeden einzelnen Band, sobald ich ihn sorgfältig und nachdenklich gelesen hatte, gleich anschließend gut abgewischt in einen öffentlichen Papierkorb geworfen hätte, am Bahnhof oder in der Innenstadt, stets an jenem Tag, bevor aller Inhalt geleert, zermalmt oder zerrissen wurde. So hätte ein Kriminallabor nicht einmal meine Fingerabdrücke auf den Umschlägen entdecken können, und das war mir recht. Die Bücher bestellte ich im Leseklub und per Katalog, zahlte per Nachnahme oder später mit Abbuchung, ließ sie an die Adresse von der Rosa schicken. Denn auch Postboten können geschwätzig sein und sich lauthals wundern, wie viele Päckchen ich alte Frau bekomme. Einmal in der Woche, wenn ich die Rosa zum Kaffee besuchte, holte ich meine neue Lektüre und steckte die Sendung stillschweigend in meinen Einkaufsbeutel.
Keiner sollte erfahren, dass ich lese und was ich lese. Aus diesem Grund besitze ich eben kein Bücherregal, denn hätte am Ende doch einmal jemand mein Häuschen betreten müssen, ein Notarzt oder die Feuerwehr, dann hätte man womöglich Beweise für meine geistige Gesundheit gefunden. Es sollte aber so aussehen, als sei ich mehr oder weniger Analphabetin. Sogar das eine Buch, das ich gerade las, versteckte ich unter meinem Sofakissen, wann immer ich das Zimmer verließ, um in die Küche zu gehen.
Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muss sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Vor allem darf er sich nicht scheuen, immer wieder auf einen und denselben Sachverhalt zurückzukommen – ihn auszustreuen, wie man Erde ausstreut, ihn umzuwühlen, wie man Erdreich umwühlt.
Walter Benjamin, Ausgewählte Schriften
Für mich kam nur ein bestimmtes Reisebüro infrage. Ich war aufgeregt; mein Asthma meldete sich. »Hoffentlich merkt man mir nichts an«, dachte ich immer wieder, »hoffentlich!« Um Zeit zu gewinnen, ließ ich meine Augen auf den Prospekten im Schaufenster ruhen. Ich betrachtete Werbeplakate mit Palmenstränden und rot markierte Sonderangebote. Überall fröhliche Leute, die alle ausschauten, als hätten sie gerade im Lotto gewonnen. Solche Mienen kann ich nicht leiden.
Abschätzige Gedanken gehen mir tagtäglich durch den Kopf, das sind alte Bekannte. Sie kommen jedes Mal, wenn jemand in meiner Nähe glücklich aussieht, auf der Straße, im Supermarkt, sogar im Fernsehen. Lacht mir ein junges, frisches Gesicht aus einer Zeitschrift entgegen oder tun die Leute auf dem Bildschirm gar zu lustig und unbekümmert, legt sich ein Stein auf mein Gemüt.
Ich sage dir, Vinzenz, es tut mir wohl, über mein Schicksal zu murren, ein Schicksal, das keiner kennt und niemand erfahren soll – außer dir jetzt! Aber du bist ja auch verschwiegen, oder? Du bist wahrscheinlich einer von denen, die sich zwingen, alles in christlicher Demut zu akzeptieren und Ja zu sagen zum Schicksal, zum Leid, zum Verlust. Aber ich, ich halte das für verlogenes Gewäsch. Viel ehrlicher finde ich es, meine schlechte Laune in vollem Ausmaß zu fühlen, wenn sie eben schlecht ist. Über die Gegebenheiten hinweglächeln, nur damit es einem ein Quäntchen besser geht, das ist eine Art Selbsthypnose, die Wahrheiten verfälscht. Und wieso sollte ich Ja sagen? Wozu denn? Komm mir bloß nicht mit so was! Sein Schicksal sucht sich doch niemand aus. Ich bin ein Kind meines Jahrgangs, und damit trage ich alles, alles, alles, was damit verknüpft ist, auf meinem Buckel.
Vor dem Reisebüro musste ich mir die Augen abtupfen und mich schnäuzen. Der Wind war eisig. In unserem Alter muss man auf sich achtgeben, gell, Vinzenz? Jede Aufregung schadet. Du wirkst noch recht rüstig, wie machst du das? Hast du schon schwere Krankheiten hinter dir? Mein schwaches Herz und die asthmatischen Lungen verkraften keine Grippe mehr. Leider stirbt man ja nicht gleich davon, wird nur kränker. Die Augen lassen auch sehr nach bei mir.
Frau Taurer, die Inhaberin, kannte ich vom Sehen, wie ich auch die meisten anderen Einwohner der Stadt irgendwie kenne, vom Hörensagen oder aus der Lokalpresse. Schließlich hab ich mein gesamtes Leben hier verbracht, bis auf die wenigen Monate damals im Osten. Das Haus »Zum Stern«, am Marktplatz beim Unteren Tor gelegen, war in unserer Jugend eine Gaststube. Dort holte ich manchmal den Vater ab, wenn er mit Parteifreunden sein Bier trank und ich vom Heimabend kam. Immer noch gibt’s dort schiefe Wände, die stehen aber inzwischen voller Regale. Vor dem Tresen mit einem Computer und vielen kleinen Werbetafeln blätterten zwei junge Leute in Katalogen, als ich eintrat. Eine Blondierte mit kurzem Rock und hohen Absätzen, die trotz des trüben Januarwetters ihre Sonnenbrille übers Haar geschoben hatte, saß auf dem Kundensessel. Solche Leute kennst du, und bestimmt magst du sie genauso wenig wie ich. Oder verzeihst du allen alles?
Frau Taurer hielt den Telefonhörer zwischen Kopf und Schulter geklemmt und besänftigte ihre ärgerlich dreinschauende Kundin mit einem Entschuldigungslächeln. Ich ließ mich in einen Korbsessel fallen und überlegte, ob ich die Mütze abnehmen sollte. Aber mein Haar darunter war zerdrückt und hatte eine Wäsche nötig. Besser einen gepflegten Eindruck machen, beschloss ich, das zahlt sich immer aus. Eine gute halbe Stunde lang beobachtete ich die anderen Kunden und versuchte, daraus noch in letzter Minute zu lernen, wie man sich im Reisebüro verhält. Dabei vergaß ich nicht, immer wieder mein Gedächtnis aufzufrischen, indem ich tonlos die Namen, Daten und Zahlen memorierte, für alle Fälle.
Das Pärchen verließ den Laden. Endlich marschierte auch die Aufgedonnerte aus dem Laden, mit hochhackigen Stiefeln, die bei jedem Schritt knallten. Dieses Geräusch jagte mir Schauer über den Rücken. Ich war an der Reihe. Mühselig stand ich auf und unterdrückte ein Ächzen. Es tut nämlich immer weh, wenn ich länger gesessen hab. Ich war ja nicht daheim, wo ich stöhnen kann, so oft mir danach ist. Ich bückte mich zu meiner Handtasche, noch einmal Schmerzen, und setzte mich auf die Kante des Kundensessels. Die Taurer, eine dralle Person in den Vierzigern, lächelte mir aufmunternd zu. Der Januar war wahrscheinlich ihre beste Saison. Die Reiselustigen geben sich die Klinke in die Hand, wenn es bei uns kalt und nass ist. Mit geübtem Blick versuchte sie Erfahrungen, Bedürfnisse und wirtschaftliche Gegebenheiten ihrer neuen Kundin einzuschätzen. Mit meinem ebenso geübten Widerstand gegen solche Verführungskünste konnte sie nicht rechnen. Ich wusste, die nimmt mich nicht für voll, und begann mein Spiel.
Mein linkes Auge zwinkerte, ich hab da leider so einen Tick, wenn ich angespannt bin. »Also, ich bin die Eichner-Walburga«, sagte ich und hörte vergnügt meine gepresste Stimme. Wie ich es gewohnt war, stellte ich mich absichtlich beschränkt dar und tat, als könne ich nicht bis drei zählen. »Ja, und ich komm heut her zu Ihnen, weil ich unbedingt nach Santiago muss. Also, nach San-ti-ago, das ist in Spanien. Da bin ich doch richtig bei Ihnen?« Ich rieb mir die vom Wind geröteten Augen und schnäuzte mich nochmals, bevor ich weitersprach. »Also, ich muss nach Santiago von Compostela. Also, müssen tu ich vielleicht nicht, aber ich will, also, ich möcht mal verreisen. Nach Compostela. Und zwar schon bald. Über Ostern.«
Sie wollte wissen, ob es eine Touristenreise sein sollte oder eine Wandertour mit Pilgerausweis. Ich hob entsetzt meine Hände. »Um Himmels willen! Also, pilgern möcht ich schon, pilgern ja, aber doch nicht zu Fuß. Ich bitt Sie, in meinem Alter! Eine Wallfahrt soll es trotzdem sein. Also, für den Ablass, hab ich gehört, da macht’s ja keinen Unterschied, wie man dort ankommt. Doch eine Bedingung hätt ich schon: Mit einer ganz bestimmten Gruppe zusammen will ich fahren. Also, die haben bei Ihnen reserviert. Also, da sind Bekannte von mir dabei, das ist das Wichtigste. Also, allein schaff ich das nicht mehr.«
Ablass ist der Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der entsprechend disponierte Gläubige unter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet.
Codex Iuris Canonici, 1983
»Na, dann erzählen Sie mal, was Ihre Bekannten gebucht haben.«
»Ach bittschön, liebe Frau«, säuselte ich, »das müssten Sie mir sagen. Nämlich, das hab ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, bin nämlich ganz durcheinander, mein Gott, das Alter. Ich weiß nur, dass die zwei hier bei Ihnen waren, um die Anzahlung zu leisten.«
Mir wurde heiß. Ich musste alles riskieren, und nur zur Not würde ich ihr sagen, was auf meinem Zettel stand. Ich lockerte mein wollenes Halstuch, während ich auf diese unverfrorene Weise darauf bestand, einer anderen Person überflüssige Arbeit zu machen. Aber es musste sein, meine einzige Chance.
An diesem Vormittag wagte ich den Sprung ins kalte Wasser und schwamm um mein Leben. Ich holte tief Luft um zu gestehen: »Meine Bekannten, das sind nämlich die Zwillinge, Sie wissen schon, die beiden Fräuleins Stadlmayer, Alma und Cora Stadlmayer.«
»Ach Gott, die Zwillinge, ja natürlich! Die haben beim Bayerischen Pilgerbüro gebucht. Ich glaube, das war eine Busreise. Ich habe es nur vermittelt.«
Ich stellte meine Handtasche wieder auf den Boden. Mein Zeigefinger fuhr zum rechten Augenlid und hielt es hinter der Brille sekundenlang fest, während Frau Taurer auf den Monitor schaute und flink die Tastatur des Computers bediente. Das leidige Nervenzucken quälte mich. Aber der Gedanke an meine zwei Lieblinge war tröstend.
Jeder Einheimische kennt die Zwillinge, aber ich, ich kenne sie besser als alle anderen Menschen auf der Welt. Sie gehören zum Stadtbild wie die Giebelhäuser oder die Barockkirche. Selten läuft eine von ihnen allein durch die Straßen auf dem Weg nach Hause, wo die Schwester wartet. Sie haben ja auch denselben Weg zur Arbeit, machen gemeinsam ihre Einkäufe und ertragen unverdrossen, dass man ihnen gerührt lächelnd oder spöttisch nachschaut, wie sie Hand in Hand den langgestreckten Marktplatz entlangschlendern oder die Geschäfte betreten.
»Oh, da haben wir sie ja schon«, bemerkte Frau Taurer in einem Ton, als spräche sie zu einem Kleinkind. »Man muss eben nur wissen, wie, stimmt’s? Außerdem, unter uns gesagt, die zwei vergisst man nicht so schnell. Die sind wirklich lustig anzuschauen, wie sie so absolut gleich daherkommen. Und immer Hand in Hand. Also, die Damen Stadlmayer reisen am Montag den 17. April. Anzahlung war am 12. November. Aber –« Sie hielt inne und machte ihr übertrieben bestürztes Gesicht, eine Miene, die sie wahrscheinlich für begriffsstutzige Senioren reservierte. »Da können Sie leider, leider nicht mehr mitfahren, Frau Eichner, der Bus ist längst voll. Tut mir schrecklich leid.«
Ich bemerkte, wie das Blut mir aus dem Gesicht wich und das Herz einen Moment aussetzte. Meine Hand fuhr vor den halboffenen Mund, und ich erstarrte. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet! Mir entwich ein Ächzen. Diesmal war es echt, das kannst du mir glauben. Noch fast drei Monate bis zum Abreisetermin! So früh schon alle Plätze vergeben? Heilige Walburga! Was sollte aus meinem Plan werden? Du musst wissen, Vinzenz, dass ich mir alles ganz genau zurechtgetüftelt hatte. Jeder Schritt war haarscharf überlegt – und nun diese unerwartete Wendung!
Frau Taurer hörte meinen schmerzvollen Laut, und obgleich sie bestimmt gewohnt war, mit den Enttäuschungen ihrer Kunden umzugehen, reagierte sie doch betroffen. Rasch versuchte sie, die schlechte Nachricht abzumildern, was auch in ihrem Sinne war. Sie bot mir eine ähnliche Fahrt an, zeitlich überlappend, mit Unterkunft im selben Hotel. Dann wäre ich nicht die ganze Zeit allein, sagte sie, und die andere Reisegruppe würde sich ganz bestimmt auch sehr nett kümmern. Ihre Stimme nahm einen tröstenden Ton an: »Ein Geistlicher ist sowieso immer dabei. Und Begleitpersonen für Behinderte gibt es außerdem.«
Ich aber schüttelte den Kopf. Wozu brauchte ich einen Geistlichen? Und behindert war ich auch nicht, oder jedenfalls nicht wirklich. Ich holte noch einmal Luft und überlegte, ob ich mein Spray benutzen sollte. Mein Inneres schrie, und doch klang meine Stimme beherrscht und dümmlich wie immer. Ich setzte auf Hilflosigkeit gepaart mit Halsstarrigkeit: »Also, das hat keinen Zweck. Überhaupt keinen Zweck. Also, ich fahr nur mit denen oder gar nicht.« Fast hätte ich angefangen zu weinen, echte Tränen, so verzweifelt war ich plötzlich.
Weil jetzt nicht mehr viel zu verlieren war, entschloss ich mich, meine letzte Karte auszuspielen. Ich rückte ein wenig näher an den Tresen heran und beugte mich flüsternd zu Frau Taurer hinüber, als wollte ich ein heikles Geheimnis ausplaudern – ich und Geheimnisse ausplaudern!
»Soll doch eine Überraschung sein! Sie haben mich so oft gebeten, die Alma und die Cora, und ich hab immer wieder Nein gesagt, weil mir am Reisen nichts liegt. Aber jetzt im Heiligen Jahr, Sie wissen doch, mit dem besonderen Ablass! Ich bin ja schon so alt, und das nächste Mal werd ich nimmer erleben. Nu, hab ich mir gedacht, wenn die zwei mich mitnehmen täten zum heiligen Sankt Jakob, dann würd ich schon den Mut aufbringen. Aber nur mit den Stadlmayers, nur mit den Zwillingen, sonst auf gar keinen Fall.«
Das dreiste Lügen kam mir nicht so leicht über die Lippen, wie ich gedacht hatte. Immer hab ich es vorgezogen zu schweigen, statt Unwahrheiten zu verbreiten. Schweigen und Verschweigen, das ist sicherer, Vinzenz. Man muss nicht fürchten, sich zu verhaspeln, und niemand kann einem was nachweisen. Aber an jenem Januarmorgen galt es, ein besonderes Ziel zu erreichen. Und da war mir jedes Mittel recht, auch wenn es Herzklopfen bereitete und die Wahrheit arg verdrehte. In Wirklichkeit hatte ich mit den Zwillingen noch nie im Leben ein Wort gewechselt.
Dass die Stadlmayer-Mädle nach Santiago gebucht hatten, hatte ich gerade erst von Gertraud, einer Schulkollegin, erfahren. Die wohnt im selben Haus wie die Zwillinge. Mit Gertraud treffe ich mich so oft wie möglich, obgleich man nicht behaupten kann, ich sei mit ihr befreundet. Unauffällig schaue ich alle paar Tage auf ein Schwätzchen bei ihr vorbei. Das heißt, sie schwätzt, und ich nicke. Oder ich lade sie auf eine Fischsemmel bei der Nordsee ein, nur um durch geschicktes Fragen das Neueste über meine Lieblinge zu erfahren. Diese nachrichtendienstliche Tätigkeit hat sich nun schon seit über fünfzig Jahren bewährt, und ich bin mir sicher, mehr über die beiden Frauen zu wissen als sie selbst. Ich hab’s ja nie bös gemeint, Vinzenz. Denn die Zwillinge, die waren, die sind mein Leben, meine Familie, meine ganze Daseinsberechtigung. All mein Sehnen, Denken und Trachten hat sich immer nur um diese beiden gedreht. Ihnen gilt der erste und der letzte Gedanke meines Tages. Und die Reise nach Santiago sollte nun der Höhepunkt werden. Endlich würde ich ihnen ganz nahe sein! Sie lachen hören! Mit ihnen reden können!
»Solche Busreisen werden vorzugsweise von älteren Herrschaften gebucht, da kann es schon mal sein, dass jemand zurücktreten muss, wegen Krankheit oder Todesfall. Gar nicht mal so selten. Also, liebe Frau Eichner, geben Sie die Hoffnung noch nicht auf. Im Grunde ist das, was die Stadlmayers gebucht haben, genau die richtige Reise für Sie: keine Hetze, viele interessante Stationen in Frankreich und Spanien, alles ganz gemütlich.«
Ich hinterließ meine Anschrift. Ich hab kein Telefon. Wen sollte ich auch anrufen? Und wer mich anrufen? Schrecklicher Gedanke, dass es plötzlich klingeln könnte, mitten in meine Stille hinein. Womöglich ein Reporter, der Dokumente studiert und Dinge herausgefunden hat, die kein Mensch wissen soll.
Nachdem ich meinen Mantel wieder zugeknöpft hatte, beugte ich mich noch einmal zu Frau Taurer hinüber. Mit einem verschwörerischen Zwinkern flüsterte ich ihr zu: »Und kein Wort zu den Stadlmayers, hören Sie, kein Wort, versprochen? Es soll doch eine Überraschung werden!«
Gegen meine Gewohnheit beschloss ich, über den Marktplatz zur Frauenkirche zu gehen, um eine Kerze anzuzünden. Seit Jahrzehnten war ich nicht mehr dort gewesen. Schon auf dem Weg durch die scharfe Winterluft und als ich mit schmerzenden Knien auf der Bank vor dem rechten Seitenaltar kniete, betete ich meinen eigenwilligen Rosenkranz, dessen Worte lauteten: »Maria, Muttergottes, mach, dass der Zweck die Mittel heiligt, und vergib mir meine Lügen. Und mach, dass mein Vorhaben gelingt!«
Mariä Nam thut ieder Zeit
Seltsame ding erweckhen
Den fromen bringt er trost und freud
den bösen forcht und schröckhen.
Votivtafel in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bernried am Starnberger See
Seit wir uns wiederbegegnet sind, wir zwei Alten, geht es mir so schlecht wie nie zuvor. Leben regt sich in mir, als wär ich ein Golem. Ich spüre Dinge, die ich mit dem Ende der Kindheit verloren glaubte. Vor allem aber eine entsetzliche, akute Furcht vor dem Lebendigen. Hab ich nicht als bröckelnde Mumie meine Jahrzehnte hinter mich gebracht, wartend auf die Erlösung einer endgültigen Bestattung? Ich bin böse auf dich, Vinzenz, weil meine Überzeugungen und Gewohnheiten deinetwegen zu Boden fallen wie Putz nach einem Erdbeben. Mit deinem unerbetenen Beistand fange ich ganz langsam und voller Widerwillen an zu begreifen, wie lustvoll ich mich all die Jahrzehnte lang in vermeintlicher Schuld und absurden Schuldgefühlen gewälzt hab, obgleich ich mich tot glaubte. Du hast mir klargemacht, dass ich gerade dadurch Schuld auf mich geladen hab, aber eben nicht die Schuld, an die ich glaubte und die mir die Kraft zur Versteinerung verlieh. Du ahnst, was mit mir ist. Deine Intuition, deine Anteilnahme, deine Herzenswärme haben sich als Bandwürmer in mein Inneres gefressen und wollen nun genährt werden. Unverschämtheit! Es stört mich, dass du in mir drin bist. Wie konnte ich dir nur zuhören! Solange ich tot war, ging es mir nicht wirklich schlecht. Ich empfand ja nichts.
Mit meinem Dasein als Scheintote hatte ich mich arrangiert. Was fällt dir ein, mich wiederzubeleben? Glaubst du dich von Gott für diese Herzmassage beauftragt? Weil du mich auf Biegen und Brechen erwecken willst, weiß der Himmel, warum, fühle ich mich jetzt bemüßigt aufzuschreiben, was mich ein Leben lang gequält hat, mein langweiliges, chronisches Leid. Ich breche meinen Schweigeeid und gebe von mir, was ich weiß und woran ich mich erinnere. Du hast mich aus einem grausigen Traum erweckt. Ich bin erwacht mit einem blutigen Messer in der Hand und zwei Toten neben mir. Wie gern möchte ich dir alle Schuld dafür in die Schuhe schieben! Hast nicht du mich ermuntert oder gar angestiftet, die Wahrheit zu sagen? Und darum geschah das Unglück. Denn mit Wahrheit kann ich nicht umgehen.
Erst seit ich vor zwei Wochen in Santiago nach einer Umarmung des goldenen heiligen Jakobus versucht hatte, mich endlich, endlich zu entschulden und alles gutzumachen, weiß ich, was wahre Schuld ist. Eine Schuld, für die mich kein Richter verurteilen könnte. Eine fürchterliche moralische Schuld.
Der Gedanke der Schuld bringt Sinn in die Vergangenheit.
Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis
Ein so kluges Herz wie du – nein, das hab ich nicht, Vinzenz. Mir fehlt die Wärme, jegliches Mitempfinden und die Liebe zum Mitmenschen und vor allem zu mir, und ohne all dieses darf sich niemand klug nennen, das weiß ich. Ich kann mich nicht leiden. Aber denken kann ich. Mein Hirn hat immer besser funktioniert, als es mir lieb war, und hätte ich den Mut gehabt, mich dir anzuvertrauen, wären wir zwei uns auf unsere alten Tage wunderbare Gesprächspartner geworden. Denn du bist ebenso einsam. Nicht weil du so bösartig oder bitter wärst wie ich, sondern weil deine Seele allzu selten eine andere fand, die ein Echo auf dein besonderes Sein zurückwarf.
Ich suche nichts und niemanden, hab mich längst abgefunden, dass es nichts zu finden gibt. Du aber suchst, hast niemals aufgegeben. Ausgerechnet in mir meinst du nun, eine Seelenverwandte gefunden zu haben? Ich hoffe sehr, dass du dich irrst und einem Wahn unterliegst, der einem Kindertraum entspringt. Wie kannst du so treuherzig und naiv sein zu glauben, mit ein wenig Herzenswärme und tiefen Blicken in meine verkniffenen Augen die Eisenreifen zu brechen, die mein Dasein umschließen? Ach, bist du etwa doch ein Dummkopf, einer, der glaubt, die Liebe könne über alles siegen? Und Gott sei gütig? Und es sei niemals zu spät?
Seit ich beschlossen hab, dich vor meinem Tod auf keinen Fall noch einmal zu treffen, werde ich von Selbstzweifeln geplagt. Beim Abschied hast du mich so innig und mit feuchtem Hundeblick darum gebeten. Bist du denn doch dumm, begreifst du nicht? Oder ist etwa meine sture, hartleibige Weigerung, dem lieben Vinzenz, der es ja sooo gut mit mir meint, Zutritt zu mir und meinem Sein zu erlauben, noch viel dümmer? Meine allergrößte Dummheit, die eigentliche und dümmste Dummheit, dümmer noch als jede meiner raffinierten, hochintelligenten Strategien, die mir erlauben, als Anonyma zu leben und zu sterben?
Ach, hätte ich nur ein schönes Buch, das mich von all dem hier ablenken könnte! Wenn du nun denkst, Vinzenz, ich hätte mich zeitlebens mit Schund vollgestopft, mit Liebesschmökern vom Kiosk oder Heimatromanen, irrst du gewaltig! Ja, zu Anfang, da kannte ich nichts Besseres. Konnte mir auch nicht mehr leisten als Groschenhefte. Und ich gebe zu, dass ich mir auch später bisweilen Erholung durch leichte Kost gönnte, so wie Leute einen Reistag einlegen, um ihre Verdauung zu entlasten. Deshalb besorgte ich mir von Zeit zu Zeit etwas Gemütliches. Anfangs Konsalik, später dann viel Pilcher oder Utta Danella, Nora Roberts, Charlotte Link. Am liebsten etwas über mehrere Generationen mit viel Schicksal. Schmöker, die von großen Gefühlen, Abschied und Leidenschaft, Intrigen und Treue handeln und von Menschen, die engelsgleich gut oder abgrundtief böse sind. Nichts Zweideutiges. Eindeutigkeit entspannt mich.
Natürlich gab es auch schon früh einen Fernseher. Ich schaffte ihn für den Vater an, damit er etwas hatte nach der Arbeit oder wenn ich im Haus herumwerkelte. Der Flimmerkasten ist ja Kamerad der Alleinstehenden, Alten und Verzweifelten. Peter Frankenfeld! Am Abend schaute ich mit dem Vater, damit er nicht ständig ins Wirtshaus ging. Trotzdem musste ich den Alten nicht selten sturzbetrunken die Treppe hinaufschaffen. Dass ich nach seinem Tod für die neue Wohnung ein besseres Gerät kaufte, vor zwölf Jahren auch einen Farbfernseher – das fiel nicht auf, machte mich noch normaler und unsichtbarer als besäße ich keinen, und Kabelanschluss hatte jeder in unserer Straße. Ich zahle sogar Rundfunkgebühr, damit mir nicht etwa einer dieser bestallten Spione ins Haus eindringt. Kulturfilme, Nachrichtensendungen, Diskussionen und Dokumentationen, 3sat, phoenix und BR-alpha, alles sehr lehrreich. Meine Leidenschaft aber gilt dicken Biografien von Dichtern, Malern, Komponisten, großen Politikern – dem Leben der anderen eben, der sichtbaren Leute. Außerdem Bücher zu Weltgeschichte, Heimatkunde, Geografie, Entdeckungsreisen und deutscher Geschichte.
Meine Lesewut begann, als ich nach Weihnachten 1944 fast zwei Jahre lang krank und meist allein in der Kammer lag. Zuerst reichte meine Volksschulbildung nur für Einfaches, Emil und die Detektive oder Die Biene Maja. Ich war ja erst siebzehn und hatte noch nicht viele Bücher in der Hand gehabt. Bald brachte mir die Mutter aus einer Leihbibliothek oder von den Nachbarn, was immer sie finden konnte. Ich las und las und gab alles zurück. So fing es an, dass ich nie ein Buch behalten wollte. Geschichten zogen durch mein Hirn wie Wolken, mal hell und dünn, mal Schönwetterhaufen, dann wieder Gewitterfronten mit Blitz und Donner. Dieses und jenes blieb auch hängen wie Regentropfen an dünnen Zweiglein.
Anfang Mai 1945 war die Mutter plötzlich unter der Erde, und Tante Zita musste mich mit Lesestoff versorgen. Ich beschwor sie, niemandem etwas von meiner neuen Leidenschaft zu verraten.
Mein Kopf wurde weiter, das Verstehen tiefer. Tagsüber bewegte ich mich wie ein Automat, sagte Ja und Nein, ging in die Küche, aß mittags mein Butterbrot und ging früh zu Bett, nachdem ich den Vater versorgt hatte. Dann erst begann ich zu leben, von abends neun bis Mitternacht, lebte bald nur noch beim Lesen. Versuchte, die Fremdsprachen der Gefühle zu lernen, Emotionen und Taten in mich aufzunehmen, die ich bis heute nicht aus eigener Anschauung kenne: Liebe, Nähe, Treuebruch, Hass und Verrat, von den feineren Gemütsregungen gar nicht zu reden. Sehnsucht, Zärtlichkeit, Freundschaft, Mitgefühl, Kinderwunsch – das blieben Indianersprachen für mich, ich würde sie niemals verstehen lernen. Nur einen einzigen Dialekt kannte ich, der hieß Heimweh. Heimweh nach der Kindheit, nach der Küche der Mutter, nach allem, was mir vor dem Bruch im Dezember 1944 ein herrliches Leben in Aussicht zu stellen schien. Seither bin ich gefühlsmäßig schwerbehindert. Glaub nicht, dass ich das nicht weiß! Ohne meine Romane aber, die mir zeigen, von welchen Emotionen die Menschen gebeutelt werden können und wie unterschiedlich sie auf die Tragödien ihres Schicksals reagieren, wäre mir das nicht klar.
Mit den Figuren der Schriftsteller atmete ich und hörte mein Herz klopfen, sonst wär ich nicht die Scheintote, der du begegnet bist, sondern schon vor gut fünfzig Jahren gestorben. Stell dir vor, Vinzenz, sämtliche Werke von Zola, Balzac, Dickens, Thackeray, wenn auch nicht alles von Flaubert und Proust! Kennst du diese Namen? Henry James oder James Joyce waren mir nach mehrfachen Versuchen leider kein echtes Vergnügen, ich gab auf. Aber all die anderen Romanautoren des 19. Jahrhunderts, die Brontë-Schwestern, Jane Austen, Stifter und Fontane! Am liebsten nichts Zeitgenössisches, und weit weg, in fernen Ländern sollte die Handlung spielen. Aber auch Thomas Mann und Heinrich Mann, Fallada, Döblin – welch große Lebensbilder! Den Böll mit seiner Nachkriegstrauer und den Mann ohne Eigenschaften – solche Bücher konnte ich allerdings nicht ertragen, es musste fern sein von mir. Ohne Eigenschaften und elend bis ins Mark war ich ja selber. Mehr davon konnte ich nicht verkraften.
Letzthin holte ich mir auch viel Amerikanisches, Updike, Philipp Roth, gerade die vielen herrlichen jüdischen Schriftsteller … Ach, warum soll ich das alles aufzählen? Es geht mir ja nicht darum, dich zu beeindrucken. Nur verständlich machen möchte ich mich, dir andeuten, wie ich die Jahre seit unserer Kindheit und Jugend verbracht hab. Allerdings möchte ich doch, erlaube es mir, behaupten, dass ich in unserer kleinen Stadt wohl die beste Kennerin des Nationalsozialismus und seiner Folgen bin. Denn diese Thematik wird hier in Günzburg aus gutem Grund ignoriert und nahezu totgeschwiegen. Du weißt selber, warum.
Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und kann die Vergangenheit nicht »auf sich beruhen lassen«, weil sie sonst auferstehen und zu neuer Gegenwart werden könnte.
Jean Améry, 1975, Plakette an einem öffentlichen Platz in Günzburg
Aufbruch nach Santiago. Am Reisetag war ich recht früh dran. Um halb vier aufgestanden. Kein Frühstück, keine Zeit dafür. Am Morgen brauche ich inzwischen lange für meine kleinen Verrichtungen, und vor meiner ersten Reise ins Ausland war ich viel zu aufgewühlt, um mich noch gemütlich an den Küchentisch zu setzen. Alma und Cora, meine Kindle, schauten mir mitleidig nach, als ich zur Tür hinausging, und mir schien, als würden sie mir winken und gute Reise wünschen. Seit Wochen schon hatte ich Angst, etwas falsch zu machen oder die Abfahrt zu verpassen. In Dunkel und Morgenkälte musste ich auf dem Bahnsteig warten, bis der Sechsuhrzug nach Augsburg einfuhr.
Inzwischen hatte es sieben geschlagen. Ich stand vor dem großen Reisebus des Bayerischen Pilgerbüros. In meinem Wintermantel mit dem Kragen aus Kunstpelz war mir heiß. Gern hätte ich mir noch einen neuen gekauft, aber bei meiner Rente? Und mich schaut ja eh keiner an. Auch der braune Koffer mit den Metallschnallen und brüchigen Gürtelriemen war alt und nur klein. Der Vater hatte ihn im Gefängnis dabeigehabt, ein Vorkriegsmodell, aber noch in Ordnung. War ja nie wieder benutzt worden. Ich konnte ihn kaum schleppen; Rollen hatte er nicht. Was nicht hineingepasst hatte, trug ich am Leib: zwei Unterhemden, die hochgeschlossene Bluse, einen Pullover, darüber eine warme ärmellose Weste. Einen Büstenhalter brauche ich nicht. Meine Brust ist flach und mager. Über den Schlüpfer aus Baumwolle gehört bei mir eine laufmaschensichere Strumpfhose aus Helanca, die man abends schnell auswaschen kann, dann eine wollene Unterhose mit knielangem Bein. Seit meiner Jugend auf dem Hof, vor dem Krieg, bin ich an Wollwäsche gewöhnt und werde sie in diesem Leben nicht mehr ablegen, auch nicht in Spanien. Bloß nicht verkühlen, vor allem unten herum. Doch mit all dem Zeug am Leib sehe ich immer noch verhungert aus und dünn wie eine Bohnenstange. So bin ich eben. Burgl, die Habergeiß. Entschuldige meine schamlose Offenheit, Vinzenz, aber wenn du dies liest, bin ich längst dahin und nicht einmal mehr mager, sondern ein Knochengestell.
Ich bezweifelte, dass jemand mir helfen würde, das Köfferchen zu verstauen. Die Fahrerin, eine kleine Person Mitte dreißig mit strubbeligen rot gefärbten Haaren, saß lässig hinterm Steuer. Die sieht ja aus wie der Pumuckl, fand ich. Wie sollte so eine es schaffen, unseren Bus durch halb Europa zu steuern? Jedenfalls traute ich mich nicht, diesen Kobold zu stören. Am Kiosk stand ein Junge mit Zigarette und Bierflasche in der Hand. Um sieben in der Früh! Den mochte ich auch nicht fragen. Reisegenossen waren noch nicht eingetroffen. Ich stellte also das Gepäck neben die Bustür und kletterte die steilen Stufen ins Innere, indem ich mich mit der Hand am Griff hochzog. Hast du’s auch mit die Gnia, Vinzenz?
Die Plätze waren wahrscheinlich vorbestellt. Wo durfte man sich hinsetzen? Ich wollte meinen Koffer im Auge behalten. Unschlüssig verharrte ich ganz vorn. Der Bus sah neu aus und roch auch so. Die Fahrerin nahm keine Notiz von mir. »Hoffentlich raucht die nicht während der Fahrt«, dachte ich, denn sie sah genauso aus, als ob sie das wagen würde. Wie zur Probe setzte ich mich in der ersten Reihe nieder, hinter dem Einstieg. Aus dem Seitenfach der Handtasche, der guten für sonntags, holte ich mein Nitrospray, denn das Herz stolperte wie immer, wenn ich mich anstrenge. Zweimal unter die Zunge, dann konnte ich durchatmen.
Ein Mann mit kurzem grauweißem Kinnbart, tief eingegrabenen Falten und dunkler Kleidung zeigte sich im Einstieg. Er kam nur zwei Stufen hoch, schaute in den leeren Bus und rief wie ein Radiosprecher im Morgenmagazin: »Einen wunderschönen guten Morgen!« Mir warf er einen prüfenden Blick zu. »Sind Sie die Frau Eichner? Freut mich! Ich kümmere mich ums Gepäck!« Das waren deine ersten Worte an mich.
Schon war der Mann wieder verschwunden. Ich war perplex. Meine Lippen bewegten sich ohne Ton. Der kirchliche Reisebegleiter? Mir fiel ein, dass der natürlich eine Passagierliste besaß, deshalb hatte er mich mit Namen angesprochen. Sah auch recht nett aus. Ich fasste ein kleines Zutrauen zu dem Mann. Unwillkürlich schob sich mein Kinn hin und her, auch so eine Angewohnheit von mir, sieht furchtbar aus, ich weiß! Mein angespannter Kiefer lockerte sich. Dann beugte ich den Kopf, streckte die Halswirbel und schüttelte mich, um den Wattenebel von der Schlaftablette zu vertreiben, der mich jeden Morgen umhüllt. Ich befreite mich von meinem Mantel und legte ihn über den Arm, denn ich wollte nicht unverschämt wirken, indem ich gleich zwei Plätze in Anspruch nahm. Auf meinem Haar saß die Strickmütze. Sie wurde in die Tasche gestopft. Mein Haaransatz war feucht. Mit allen zehn Fingern ordnete ich meine steifen Löckchen und bemerkte, dass sie säuerlich nach frischer Dauerwelle rochen.
Nun trudelten auch die übrigen Reisenden ein, manche mit großem Gepäck, andere nur mit einer Reisetasche. Fast alle waren zu zweit. Krumme, Blinde und Lahme im Rollstuhl registrierte ich bar jeder Solidarität mit den Leidenden. Die interessierten mich nicht. »Warum fahren die nicht nach Lourdes?«, dachte ich. Du musst wissen, Vinzenz, ich bin noch um einiges garstiger als du ahnst.
Nur nach den Zwillingen hielt ich Ausschau und wurde nervös. Hatten sie es sich anders überlegt? Der Bus war nahezu voll, als die zwei endlich eintrafen. Erleichtert schnaufte ich und lehnte mich zurück, versuchte, nicht allzu auffällig hinzuschauen. Als die zwei Frauen sich an mir vorbeidrängten, empfand ich ihren Anblick und die leichte Berührung durch ihre Kleider wie eine Weihung. Ein kleiner Wonneschauer durchfuhr mich. So nahe war ich meinen Lieblingen seit Jahrzehnten nicht gekommen. Zuletzt hatte ich sie im Arm gehalten, als sie noch nicht einmal ein Jahr alt waren. Leider mussten die beiden ganz hinten Platz nehmen, weit entfernt von mir, weil sie fast als Letzte in den Bus stiegen. Ärgerlich. Ich blickte mich um, aber in ihrer Nähe war kein Platz mehr frei. Nun war es mir leider unmöglich, die zwei zu belauschen. Aus der Ferne konnte ich auch nichts erspüren und erriechen, und gerade das wär mir doch wichtig gewesen. Aber ich war dann doch einigermaßen zufrieden. Letztlich hatte meine Planung zum Erfolg geführt. Auf dieser Reise würde ich nun Gelegenheit haben, meine beiden Kleinen ganz aus der Nähe zu erleben. Gottfroh war ich, dass ich wegen einer Stornierung doch noch einen Platz ergattert hatte. Vielleicht war ja jemand krank geworden.
Der Bus fuhr los, mit einer Viertelstunde Verspätung. Die Fahrerin gestattete mir, auf dem vorderen Sitz zu bleiben, eigentlich für Behinderte reserviert. »Sie sind ja unsere Seniorin!« Ich war dankbar und zugleich empört, denn außer mir waren noch einige andere klapprige Grauköpfe und Weißschöpfe eingestiegen. Seh ich denn wirklich so uralt aus, Vinzenz?
Auf dem niedrigeren Platz vor mir saß der nette Reiseleiter mit einem Mikrofon in der Hand. »Gut, das ist gut«, dachte ich, »der wird mir bestimmt helfen, wenn ich in Not bin. Ich brauche nur meinen Arm auszustrecken, um ihn auf die Schulter zu tippen.«
Ich betrachtete sein Haar, das der kalte Wind durcheinandergebracht hatte. Fein und ein bisschen zu lang, das sieht dann schnell unordentlich aus. Seine Ohren waren sehr groß und dünn, fast durchscheinend rosarot. Ein Dufthauch wehte von ihm herüber. Rasierwasser. Ich war überrascht. Vaters Rasierwasser, tatsächlich, Pitralon! Ich hatte es wohl zwanzig Jahre nicht mehr gerochen. Dass es das noch zu kaufen gibt. Ja mei, der Vater! Ich war ein bisschen gerührt, denn wir zwei hatten uns verstanden und gern gehabt, hatten beide den Führer verehrt. Das Fläschchen Pitralon stand immer auf dem Wandbrett über der Schüssel, wo er sich wusch und rasierte. Nach seinem Tod schnupperte ich manchmal daran, um mich an ihn zu erinnern. Erst beim Umzug in den Siebzigerjahren, als der Hof aufgegeben werden musste, hab ich es weggeworfen, schweren Herzens, denn mehr war von ihm, dem Vater, nicht übrig geblieben. Die Mutter hab ich auch lieb gehabt, aber das konnte ich erst in der Mitte meines Lebens verstehen. Denn in der Jugend hatte sie mir immerzu Kontra gegeben, wenn die Rede auf den Hitler oder die Kirche kam. Wir sind oft aneinandergeraten.
Alle waren Hitler und seinem Wahn verfallen. Sie hielten für Recht, was Unrecht war. Und sie gerieten zu Verbrechern, ohne das Bewusstsein zu besitzen, Unrecht zu begehen. Wie war das möglich? Waren es teuflische Jünger, die, einmal vom satanischen Meister wachgeküsst, all ihre böse Energie aus eigener Kraft entfalteten? Ganz besondere Verbrecher also? Oder waren es ganz normale Deutsche, die allein durch Zufälle zu jenen wurden, die wir kennen: Synonyme einer kriminellen Diktatur?
Guido Knopp, Hitlers Helfer2
Kaum waren wir auf der Autobahn, drehte sich der Reiseleiter zu den Passagieren um, zählte sie mit dem Zeigefinger ab und verglich sie mit seiner Liste. »Das hätte er lieber vorher tun sollen«, krittelte ich und kniff die Lippen zusammen. Er stand jetzt direkt neben mir, keinen halben Meter entfernt, seine Hüfte auf der Höhe meines Kopfes. Um sein Gesicht zu betrachten, hätte ich meinen Hals verdrehen müssen, aber das ist mühsam und tut meist weh; daher schaute ich weiter geradeaus. Aber ich konnte den Mann riechen. Sein Geruch schien nicht fremd, über den Pitralonduft hinaus. Das verwunderte mich, und ich verstand es nicht. Ich lehnte mich ein wenig nach links, in seine Richtung.
Auf meinen Riechsinn hab ich mich immer verlassen können, mehr als andere Leute. Meine Nase sorgt dafür, dass Vergangenheiten schlagartig Gegenwart werden. Angenehm oder beängstigend, immer stehen mir unmittelbar die Bilder aus Kindheit, Jugend und all den späteren Jahren vor Augen, und die damit verknüpften Gefühle erwachen jäh aus tiefem Schlaf, ob ich es erlaube oder nicht. Ein Fluch! Ich hasse diese Gabe, die mit dem Altwerden nicht abstumpfen will. Während meine Augen trüb und die Beine langsam werden, bleibt meine Fähigkeit zu riechen in ganzer Schärfe erhalten und gerät mir oft zur Pein, denn dagegen kann man sich nicht wehren.
Der Mann machte mich neugierig. Ich wandte den Kopf zum Fenster, weg von ihm, sog die kühle Luft durch die Nase ein, atmete aus, drehte mich dann rasch wieder um und beschnupperte ihn wie ein Jagdhund. So geht es meiner Erfahrung nach am besten. Meine Nase leicht gekräuselt, die Nasenflügel müssen beben. »Ja, hmmm, ja. Ein warmer menschlicher Geruch, längere Zeit nicht gebadet, heute früh Katzenwäsche. Zartes Aroma von Pfeifentabak in Kleidern und Bart wie bei einem, der sich das Rauchen nur selten gestattet. Weiter oben Vaters Rasierwasser auf den glatten Wangen und Menthol von der Zahnpasta. Das Hemd frisch. Jemand benutzt zu viel Waschpulver, Verschwendung, aber es ist das von Aldi, dann geht’s wieder. Und die Person nimmt für den Pullover Weichspüler mit Pfirsichduft. Die Pfarrhaushälterin? Die Frau? Oder versorgt er sich selbst?« Ob er einen Ehering trug, konnte ich nicht erkennen, denn seine Hand hielt das Mikrofon, er fingerte daran herum und probierte es aus: »Test! Test!« Ich wurde ruhiger. »Ein bisschen ungeschickt ist er«, dachte ich, »aber sonst in Ordnung.« Ich legte jetzt auch mein Halstuch ab, faltete es zusammen und lehnte mich zurück.
Meist bin ich den ganzen Tag recht müd von den Tabletten, aber an diesem Morgen noch viel mehr, hatte kaum geschlafen, war so früh aufgestanden. Hinzu kam ein flaues Gefühl in der Magengrube, weil ich nicht gefrühstückt hatte, oder war es etwas anderes? Da unter meinem Sitz das Rad lag, fand ich einen Vorsprung, auf den ich meinen Fuß stellen konnte. Gut, dass niemand neben mir saß. Die erste Aufregung war vorbei. Ich schloss die Augen und gab mich meiner Schläfrigkeit hin. Aber ich schlief nicht ein, zu vieles ging mir durch den Kopf. »Heute verlass ich zum zweiten Mal im Leben meine Heimat«, das wurde mir klar, und mir war bang.
Eine neue Unruhe erfasste mich. Ich dachte zum hunderttausendsten Mal an die Nacht im Dezember 1944. Damals war ich von meiner allerersten Reise heimgekehrt. Die nächtliche Ankunft am frostigen Günzburger Bahnhof tilgte ich später aus meinem Gedächtnis so gut es ging. Damals ahnte ich ja nicht, dass ich dir, Vinzenz, eines Tages davon erzählen würde und dass du, ausgerechnet du, mich in jener Nacht gesehen hattest. Du wusstest um einen Teil meines Geheimnisses und hast geschwiegen. Mir war unvorstellbar, einen Mitwisser zu haben. Ein Leben lang wiegte ich mich in der Sicherheit, mit meinem Geheimnis ganz allein zu sein. In jener furchtbaren Dezembernacht war ich ohnehin viel zu kaputt, um mir wegen irgendetwas Gedanken zu machen.
In späteren Jahren hat mein armes Gemüt es vorgezogen, die eisige Heimkehr einzig mit der Erinnerung ans warme Elternhaus zu verbinden. Eine Weile bot mir das Halt und Trost. Im Lauf der Jahrzehnte wurde meine schreckensvolle Erinnerung von den Bildern des Nachhauskommens zur Familie und zur kuchenduftenden Küche überlagert. Die Weihnachtsmesse im Denzinger Kirchlein, die liebevoll-bohrenden Fragen der Mutter, die Fürsorge des Vaters, der Kummer um die Brüder. Vor allem wurde jede Erinnerung überlagert von der Qual, irgendetwas von meinen Erlebnissen zu berichten und doch nichts sagen zu dürfen, auf keinen Fall, wegen meines Redeverbots. Schönes und Süßes vermengten sich mit Bitterkeit und Weh. Alles wurde verrührt wie ein Teig und verbacken zu einer inneren Erzählung, die für die schmerzende und überstürzte Trennung von meinen Zwillingen keine Zeile mehr frei ließ. Von den Ereignissen und Einzelheiten, die sich abspielten, nachdem eine erschöpfte junge NS-Schwester aus dem überfüllten Waggon geklettert war, sollte niemand je erfahren dürfen. Und am besten war, ich vergaß es gleich selber. Das hatte ich mir und Dr. Mengele geschworen. Einen Eid hatte ich geschworen auf den Führer und die Fahne.
Man kann sich dem Sog einer vermeintlich Gutes verheißenden Diktatur nur schwer entziehen. Wenn alle mitmachen, ist man sehr wahrscheinlich auch selbst dabei, denkt schließlich gar nicht mehr darüber nach und verändert sich.
Joachim Gauck3
»Schweig, Walburga, schweig!«, das war zeitlebens meine Devise. Und wer kann schweigen wie ich? Ich sage nichts, selbst wenn ich zuweilen Wörter spreche. Meine Tarnkappe hat keine Löcher. Ich halte den Mund, gebe nichts von mir. Mit Fleiß hab ich erreicht, dass die wenigen Menschen, die mich überhaupt je zur Kenntnis nahmen – ein paar Nachbarn, Arbeitskollegen oder ehemalige Schulkameraden – mich derart unsympathisch finden, dass sie mich nicht einmal grüßen möchten. Ja, ich bin eine unangenehme Person, freudlos, schroff. Wer mich anschaut, dem wird die Milch sauer. So will ich es haben. Möchte jemand einmal nett zu mir sein und kommt mir dadurch deutlich nahe, und dazu braucht es nicht viel, denn mir ist alles zu nahe, mache ich umgehend eine giftige Bemerkung. Oder ich beleidige die Person mit Absicht, so dass sie es bestimmt nicht noch einmal versucht. Inzwischen ist das zur Gewohnheit geworden, und ich kann nicht mehr recht sagen, ob ich tatsächlich ein solch widerwärtiges Weibsstück bin oder ob ich diese Rolle nur spiele. Möglicherweise war ich schon immer so, wusste es nur selber nicht, oder? Um herauszufinden, was meine Wahrheit ist und was nicht, müsste ich meine Gewohnheiten und meine Miene ändern, mein Lebenskonzept umwerfen, Menschen an mich heranlassen, mich in ihrem Lächeln spiegeln. Und das hättest du wohl gern, dieser eine zu sein, der mich erlöst, gell, Vinzenz? Ich glaub gar, du bist von uns zweien der Irre.
Heute früh kamen mir die größten Zweifel. Ich wachte auf, noch halb benommen von der Schlaftablette, und mir wurde so heiß vor Angst, dass ich die Bettdecke zurückschlagen musste. Was tu ich hier? Schreibe das ganze Zeug für diesen Vinzenz auf, den ich kaum kenne. Mache alles zunichte, worum ich mein Lebtag gekämpft hab. Ich könnte doch das, was ich in Wirklichkeit zu sagen, zu erzählen, zu beichten hab, auf einer halben Seite unterbringen. Ein Schriftstück hinterlassen: »Eidesstattliche Erklärung. Hiermit gestehe ich, dass ich dabei war. Ich beschwöre, dass ich von allen im Lager die Jüngste und Unschuldigste gewesen bin. Anbei ein Brief aus dem Besitz von Dr. Mengele, der Frau Alma und Frau Cora Stadlmayer alles Notwendige erklärt. Mit der Bitte um Weiterleitung.«
Basta. Interessiert aber keinen Menschen, weil ich ja dann schon tot bin, und die Eichner-Walburga würde es auch nicht aus ihrer jetzigen Not befreien. Vinzenz, mich drückt es in der Kehle, ich muss es hochwürgen wie das Gewöll einer Eule. Ich muss es erbrechen und ausspucken. In deinen Schoß. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Das Brechmittel hast du mir eingeflößt. Sag du nur Ja! Ja! Ja! zu deinem Schicksal, wie ich es dir hiermit bereite.
Noch im Dämmerschlaf überfiel mich die Sorge, dass jemand das Tickern und Klappern meiner Schreibmaschine hören könnte. Tippen auf diesem Ungetüm aus den Dreißigern, das man mir Ende der Sechziger beim Ausscheiden vom Versorgungsamt mitgab. Die übrigen Mitarbeiter hatten längst Kugelkopfmaschinen, und das Verschenken der sperrigen Biester war billiger als das Lagern. Also, das Tippen bin ich nicht mehr gewöhnt. Ich prügle die Tasten, dass es knallt, und ein so ungewohntes Geräusch aus meinem Haus muss ja früher oder später einer mitkriegen, von der Straße. Ich hab nicht einmal Doppelfenster. Dann wird sofort geschwätzt. Womöglich spricht mich jemand darauf an, wenn ich in der Siedlung unterwegs bin. »Ja mei, was machen Sie denn da, Frau Eichner? Das klingt ja fleißig. Vielleicht Heimarbeit? Reicht Ihre Rente nicht?«
Im Morgengrauen warf ich mich von einer Seite auf die andere und stellte mir vor, wie die Nachbarn ums Haus herumschleichen, um herauszufinden, was ich da treibe. Deshalb werde ich mit der Hand weiterschreiben, Vinzenz, und das ist auch gut lesbar für dich. Denn beim Versorgungsamt wurde ich damals nur eingestellt, weil ich eine besonders saubere Schrift hatte. Ich hatte sogar noch Sütterlin gelernt, aber das wurde ja dann abgeschafft. Jedenfalls sind die letzten Zeilen, wie du siehst, schon in Schreibschrift niedergelegt. Noch holprig und ungelenk, weil ich lange keinen Stift mehr in der Hand gehalten hab, um mehr als eine Notiz zu machen. Beim Amt musste ich hauptsächlich Zahlen und Standardsätze schreiben. Jetzt aber, jetzt soll ich mein Herz ausschütten, schriftlich.
Soll ich wirklich? Sapperlot, wer befiehlt mir denn das Ausschütten? Ich bin doch selbst die idiotische Herrin und ihre blöde Magd zugleich. Außerdem: Mein Herz ausschütten, das sagt sich so. Bittschön, das schon gar nicht! Es ist nicht voll, weder von Liebe noch von Schmerz. Da gibt’s auch nichts zum Ausschütten. Dieses Herz, mein Herz, das körperliche und das mit den angeblichen Gefühlen, sehe ich vor mir als abgegriffenen Lederbeutel, hart und trocken, schon lange nicht mehr in bestimmungsgemäßem Gebrauch. Nein, ich will mich nur erleichtern, wie jemand, der gallebitteres Glaubersalz schluckt, um seine Verstopfung loszuwerden. Alles auf einmal, auch wenn’s Bauchweh macht.