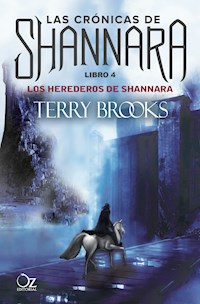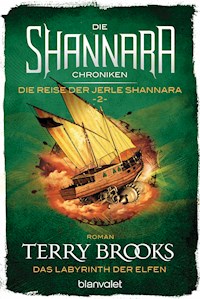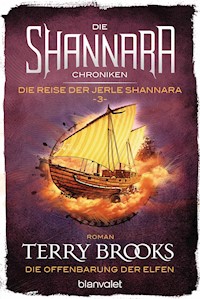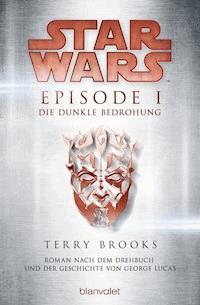8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Shannara-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Eine uralte Bedrohung kehrt in die Welt zurück und sendet seine Mordgeister aus, um die Menschheit und die Elfen zu vernichten. Um diese Macht zurückzudrängen und zu besiegen, benötigt der Druide Allanon die Unterstüzung von Brin Ohmsford, der Hüterin der Elfensteine. Denn nur Brin beherrscht das Zauberlied der Elfen. Doch das Böse hat Allanons Schritt vorausgesehen, und auf Brin wartet nun ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Nur wenn sie bereit ist, sich selbst aufzugeben, gibt es noch Hoffnung für Menschen und Elfen …
Die Shannara-Chroniken – Das Lied der Elfen ist bereits in geteilter Form erschienen unter den Titeln: »Das Zauberlied von Shannara«, »Der Köniig von Shannara« und »Die Erlösung von Shannara«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 953
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Eine uralte Bedrohung kehrt in die Welt zurück und sendet seine Mordgeister aus, um die Menschheit und die Elfen zu vernichten. Um diese Macht zurückzudrängen und zu besiegen, benötigt der Druide Allanon die Unterstüzung von Brin Ohmsford, der Hüterin der Elfensteine. Denn nur Brin beherrscht das Zauberlied der Elfen. Doch das Böse hat Allanons Schritt vorausgesehen, und auf Brin wartet nun ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Nur wenn sie bereit ist, sich selbst aufzugeben, gibt es noch Hoffnung für Menschen und Elfen …
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch DasSchwert der Elfen war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere.
Die Shannara-Chroniken von Terry Brook bei Blanvalet:
Das Schwert der Elfen
Elfensteine
Das Lied der Elfen
Weitere Titel in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Terry Brooks
DIE SHANNARA-CHRONIKEN
Das Lied der Elfen
Roman
Deutsch von Sylvia Brecht
Vollständig durchgesehen und überarbeitet von Andreas Helweg
1
Den vier Ländern stand ein Wechsel der Jahreszeiten bevor, als der Spätsommer langsam in den Herbst überging. Vorbei waren die langen, ruhigen Tage der Jahresmitte, an denen brütende Hitze den Gang des Lebens fast zum Stillstand brachte und das Gefühl vorherrschte, für alles ausreichend Zeit zu haben. Zwar hing die Sommerwärme noch in der Luft, doch die Tage wurden allmählich kürzer, die feuchte Luft wurde trockener, und die Erinnerung an die Unmittelbarkeit des Lebens erwachte von neuem. Überall ließen sich Anzeichen des Übergangs erkennen. In den Wäldern von Schattental verfärbte sich das Laub bereits.
Brin Ohmsford blieb vor den Blumenbeeten stehen, die den Weg auf der Vorderseite ihres Hauses begrenzten, und verlor sich sogleich im Anblick des tiefroten alten Ahorns, der den Hof überschattete. Es war ein gewaltiges Exemplar mit knorrigem Stamm. Brin lächelte. An diesem betagten Baum hingen so viele Kindheitserinnerungen. Ohne nachzudenken, ging sie hinüber.
Sie war ein hochgewachsenes Mädchen – größer als ihre Eltern oder ihr Bruder Jair, fast so groß wie Rone Leah –, und obwohl ihr schlanker Körper zart wirkte, war sie so kräftig wie die anderen. Jair würde in diesem Punkt freilich widersprechen, aber nur deshalb, weil er schon genügend Probleme damit hatte, seine Rolle als Jüngster anzunehmen. Am Ende blieb ein Mädchen ein Mädchen.
Sie strich zärtlich über die raue Ahornrinde und ließ den Blick hinauf zum Gewirr der Äste über ihr wandern. Langes schwarzes Haar umrahmte ihr Gesicht, und es konnte kein Zweifel bestehen, wessen Kind sie war. Vor zwanzig Jahren hatte Eretria genauso ausgesehen wie ihre Tochter jetzt, vom dunklen Teint über die schwarzen Augen zu den weichen, zarten Gesichtszügen. Brin fehlte nur das feurige Temperament ihrer Mutter. Das hatte Jair geerbt. Brin hatte das Wesen ihres Vaters: kühl, selbstsicher und beherrscht. Als Wil Ohmsford einmal seine Kinder verglichen hatte – wozu ihm eines von Jairs eher tadelnswerten Missgeschicken den Anlass geliefert hatte –, war ihm wehmütig aufgefallen, dass Jair zu allem fähig war und Brin ebenso, sie allerdings erst nach reiflicher Überlegung. Brin wusste nicht mehr genau, wer bei dieser Strafpredigt schlechter davongekommen war.
Sie ließ die Hände seitlich am Körper entlanggleiten und erinnerte sich daran, wie sie einmal das Wünschlied auf den alten Baum angewandt hatte. Sie war noch ein Kind gewesen und hatte mit dem Elfenzauber herumprobiert. Es war Hochsommer gewesen, und sie hatte mit dem Wünschlied das grüne Sommerlaub des Ahorns in herbstliches Feuerrot verwandelt; in ihrem kindlichen Denken fühlte sie sich dabei völlig im Recht, denn Rot war schließlich eine weit hübschere Farbe als Grün. Ihr Vater war wütend gewesen; der Baum hatte fast drei Jahre benötigt, um nach dem Schock wieder seinen natürlichen Rhythmus zu finden. Das war das letzte Mal gewesen, dass sie oder Jair den Elfenzauber angewandt hatten, wenn ihre Eltern in der Nähe waren.
»Brin, komm, hilf mir bitte, den Rest zusammenzupacken.«
Ihre Mutter rief nach ihr. Brin tätschelte den alten Ahorn ein letztes Mal und drehte sich zum Haus um.
Ihr Vater hatte dem Elfenzauber niemals ganz über den Weg getraut. Vor etwas über zwanzig Jahren hatte er die Elfensteine, die ihm der Druide Allanon geschenkt hatte, eingesetzt, um die Erwählte Amberle Elessedil auf ihrer Suche nach dem Blutfeuer zu beschützen. Der Elfenzauber hatte ihn verändert; das war ihm damals schon klar geworden, auch wenn er nicht gewusst hatte, in welcher Weise. Das war erst nach Brins und später nach Jairs Geburt offenkundig geworden. Nicht bei Wil Ohmsford hatte sich die Wandlung gezeigt, die der Zauber bewirkte, sondern bei seinen Kindern. Sie trugen die sichtbaren Folgen der Zauberei in sich – sie und vielleicht alle kommenden Ohmsford-Generationen. Wobei sich bislang nicht sicher sagen ließ, ob das auf den Zauber des Wünschliedes zutraf.
Brin hatte ihm den Namen Wünschlied gegeben. Wenn man etwas wünschte, wenn man es besang, erfüllte sich der Wunsch. So war es ihr erschienen, als sie die Kraft in sich zum ersten Mal entdeckte. Früh erfuhr sie, dass sie mit ihrem Lied das Verhalten von Lebewesen beeinflussen konnte. Sie konnte das Laub des alten Ahorns verändern. Sie vermochte einen rasenden Hund zu besänftigen. Sie konnte einen Wildvogel verlocken, sich auf ihrer Hand niederzulassen. Sie konnte sich selbst zum Teil jedes beliebigen Lebewesens machen – oder das Tier zum Teil ihrer selbst. Wie sie das bewirkte, wusste sie nicht genau; es geschah einfach. Wenn sie sang, stellten sich Melodie und Text ganz ohne Absicht und ganz von allein ein – als wäre es die natürlichste Sache von der Welt. Sie war sich dessen, was sie sang, stets bewusst und gleichzeitig auch nicht, da ihr Denken in unbeschreiblichen Gefühlen gefangen war. Diese Gefühle durchfluteten und durchwallten sie, erzeugten etwas Neues in ihr. Und daraufhin pflegte sich der Wunsch zu erfüllen.
Das war das Geschenk des Elfenzaubers – und auch sein Fluch. Ihr Vater hatte es als Letzteres erachtet, als er diese Fähigkeit bei sich entdeckte. Brin wusste, dass er sich tief im Innern vor dem fürchtete, wozu die Elfensteine in der Lage waren, und vor dem, was sie bei ihm bewirkt hatten. Nachdem Brin den Hund der Familie dazu gebracht hatte, hinter seinem Schwanz herzujagen, bis er vor Erschöpfung fast zusammenbrach, und später den ganzen Gemüsegarten hatte welken lassen, verkündete ihr Vater, dass niemand mehr die Elfensteine benutzen dürfe. Er hatte sie versteckt und nicht verraten, wo sie zu finden wären. Seither waren sie in diesem Versteck geblieben. Zumindest glaubte das ihr Vater. Sie war sich dessen nicht so sicher. Einmal, es war noch nicht viele Monate her, hatte Brin bemerkt, wie selbstgefällig Jair grinste, als von den versteckten Elfensteinen die Rede war. Jair würde freilich nichts verraten. Aber sie wusste, wie schwierig es war, vor ihrem Bruder etwas geheim zu halten, und sie vermutete, dass er das Versteck entdeckt hatte.
Rone Leah kam ihr an der Eingangstür entgegen, groß und kräftig. Das rostbraune Haar hing locker auf die Schultern und wurde nur von einem breiten Stirnband gebändigt. Abschätzig kniff er die grauen schelmischen Augen zusammen. »Wie wäre es, wenn du auch einmal ein bisschen mit anpackst, ja? Ich schufte mich hier ab und gehöre nicht einmal zur Familie, um der Katze willen!«
»So oft, wie du hier bist, möchte man das aber fast glauben«, foppte sie ihn. »Was gibt es noch zu tun?«
»Diese Sachen müssen noch raus, das wäre dann wohl alles.« Eine Anzahl von Ledertruhen und kleineren Koffern war im Eingang gestapelt. Rone nahm den größten. »Ich glaube, deine Mutter braucht dich im Schlafzimmer.«
Er verschwand nach draußen. Brin ging durch das Haus zu den hinten gelegenen Schlafzimmern. Ihre Eltern bereiteten sich auf die alljährliche Herbstfahrt zu den entlegenen Gemeinden im Süden von Schattental vor, eine Reise, durch welche sie über zwei Wochen von zu Hause abwesend sein würde. Nur wenige Heiler verfügten über solche Fähigkeiten wie Wil Ohmsford, und im Umkreis von fünfhundert Meilen um das Tal gab es keinen. So bereiste ihr Vater zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, die abgelegenen Siedlungen und bot seine Dienste an, wo sie benötigt wurden. Eretria begleitete ihn stets; sie war ihrem Mann eine große Hilfe und kannte sich in der Pflege der Kranken und Verletzten ebenso gut aus wie er. Diese Reise mussten sie nicht unternehmen – und hätten es wohl auch nicht getan, wären sie weniger gewissenhaft gewesen. Doch Brins Eltern empfanden es als ihre Pflicht. Dem Heilen hatten beide ihr Leben gewidmet, und dementsprechend ernst nahmen sie diese Aufgabe.
Wenn sie sich auf diesen Fahrten der Nächstenliebe befanden, musste Brin auf Jair aufpassen. Diesmal war Rone Leah vom Hochland heruntergekommen, um ein Auge auf die beiden zu werfen.
Brins Mutter packte gerade die letzten Sachen ein, als Brin das Schlafzimmer betrat. Sie schaute auf und lächelte. Langes, schwarzes Haar fiel auf ihre Schultern, und sie strich es sich aus dem Gesicht, das kaum älter wirkte als Brins.
»Hast du deinen Bruder irgendwo gesehen? Wir sind fast zum Aufbruch bereit.«
Brin schüttelte den Kopf. »Ich dachte, er wäre bei Vater. Kann ich dir helfen?«
Eretria nickte, nahm Brin bei den Schultern und zog sie neben sich aufs Bett. »Ich möchte, dass du mir etwas versprichst, Brin. Ihr werdet das Wünschlied nicht benutzen, solange dein Vater und ich unterwegs sind. Weder du noch dein Bruder.«
Brin lächelte. »Ich benutze es praktisch überhaupt nicht mehr.« Sie blickte ihrer dunkelhäutigen Mutter ins Gesicht.
»Ich weiß. Aber Jair, auch wenn er glaubt, ich wüsste nichts davon. Jedenfalls wünschen dein Vater und ich, dass ihr es in unserer Abwesenheit nicht benutzt. Hast du mich verstanden?«
Brin zögerte. Ihr Vater begriff wohl, dass seine Kinder den Elfenzauber in sich trugen, aber er wollte nicht akzeptieren, wie gut und nützlich das Wünschlied war. »Ihr seid, so wie ihr seid: intelligente, begabte Menschen«, sagte er immer. »Ihr braucht weder Trick noch List, um voranzukommen. Seid einfach, wer ihr seid, ohne das Lied.« Eretria unterstützte diesen Rat, obgleich er durchaus duldete, dass sie sich darüber hinwegsetzten, sobald es sich unauffällig machen ließ.
Leider gehörte Unauffälligkeit nicht gerade zu Jairs Stärken. Jair war impulsiv und bis zur Peinlichkeit stur; was nun das Wünschlied anging, so handhabte er es, wie es ihm gefiel – solange er damit ohne Schwierigkeiten durchkam.
Und der Elfenzauber wirkte bei Jair etwas anders …
»Brin?«
Ihre Mutter riss sie aus ihren Gedanken. »Ich wüsste nicht, welchen Unterschied es macht, wenn Jair mit dem Wünschlied herumspielt. Es ist doch nur Spielzeug.«
Eretria schüttelte den Kopf. »Selbst ein Spielzeug kann gefährlich werden, wenn man es falsch benutzt. Abgesehen davon solltest du den Elfenzauber inzwischen gut genug kennen und wissen, dass er nicht harmlos ist. Also, hör gut zu: Du und dein Bruder, ihr seid beide dem Alter entwachsen, da Vater oder Mutter ständig auf euch aufpassen müssen. Aber ein kleiner Ratschlag hin und wieder kann ja nicht schaden. Ich möchte nicht, dass ihr euch in unserer Abwesenheit des Zaubers bedient. Versprich mir das – und dass du Jair davon abhältst, ihn zu benutzen.«
Brin nickte langsam. »Es ist wegen der Gerüchte von den schwarzen Wandlern, nicht wahr?« Sie hatte die Geschichte gehört. Unten im Gasthaus redete man dieser Tage von nichts anderem. Schwarze Wandler – lautlose, gesichtslose Wesen, geboren aus schwarzer Magie, die aus dem Nichts auftauchten. Manche behaupteten, der Hexenmeister und sein Gefolge kehrten zurück. »Ist das der Grund?«
»Ja.« Brins Mutter lächelte über ihre schnelle Auffassungsgabe. »Nun versprich es mir.«
Brin erwiderte das Lächeln. »Ich verspreche es.«
Nichtsdestoweniger hielt sie das Ganze für baren Unfug.
Das Packen und Aufladen nahm eine weitere halbe Stunde in Anspruch, dann waren ihre Eltern reisefertig. Jair kam aus dem Gasthaus zurück, wo er für seine Mutter zum Abschied eine Leckerei besorgt hatte, die sie gerne mochte, und man sagte sich gegenseitig Lebewohl.
»Denk an dein Versprechen, Brin«, flüsterte ihre Mutter ihr zu, küsste sie auf die Wange und drückte sie fest an sich.
Dann saßen die Ohmsford-Eltern in dem Wagen, in dem sie ihre Reise absolvieren würden, und fuhren langsam die staubige Straße hinab.
Brin schaute ihnen nach, bis sie außer Sicht waren.
Brin, Jair und Rone Leah gingen am Nachmittag in den Wäldern des Tals wandern, und als sie schließlich den Rückweg antraten, war es schon spät am Tag. Die Sonne näherte sich dem Horizont des Tals, und die kurzen Mittagsschatten im Wald hatten sich im Abendlicht in die Länge gezogen. Es war noch eine Stunde Weg zum Dorf, aber beide Ohmsfords und der Hochländer waren diesen Weg schon oft zuvor gegangen und fanden sich auch in stockfinsterer Nacht im Wald zurecht. Sie gingen leichten Schritts dahin und genossen das Ende des wundervollen Herbsttages.
»Sollen wir morgen fischen gehen?«, schlug Rone vor. Er grinste Brin an. »Bei diesem Wetter ist es ganz gleichgültig, ob wir etwas fangen oder nicht.«
Als Ältester der drei ging er zwischen den Bäumen vorneweg. Er trug sein Schwert quer über den Rücken in der verschrammten, abgewetzten Scheide, und es zeichnete sich als vager Umriss unter seinem Jagdmantel ab. Einst hatte es der Thronfolger von Leah getragen, aber es wurde längst für diesen Zweck nicht mehr benutzt. Rone jedoch mochte die alte Klinge, die vor Jahren sein Urgroßvater Menion Leah umgeschnallt hatte, als dieser zur Suche nach dem Schwert von Shannara aufgebrochen war. Da Rone sich so für die Waffe begeisterte, hatte sein Vater sie ihm als kleines Zeichen seines Rangs als ein Prinz von Leah geschenkt, auch wenn er der jüngste Prinz war.
Brin schaute zu ihm hinüber und zog die Stirn kraus. »Du scheinst etwas zu vergessen. Für morgen haben wir uns die Arbeiten im Haus vorgenommen, die wir für Vater in seiner Abwesenheit ausführen wollten. Oder?«
Er zuckte fröhlich mit den Schultern. »Dann wird eben einen Tag später ausgebessert – die Arbeit kann warten.«
»Ich finde, wir sollten den Rand des Tals etwas erkunden«, warf Jair Ohmsford ein. Er war schlank und drahtig und hatte das Gesicht seines Vaters mit den elfenhaften Zügen: schmale Augen, schräg gestellte Augenbrauen und leicht spitz zulaufende Ohren, dazu eine Mähne wilden blonden Haars. »Wir könnten nach Spuren von Mordgeistern suchen.«
Rone lachte. »Was weißt du denn über die Wandler, Tiger?« Das war sein Spitzname für Jair.
»Ebenso viel wie du, nehme ich an. Im Tal hören wir die gleichen Geschichten wie ihr im Hochland«, erwiderte der Talbewohner. »Schwarze Wandler, Mordgeister – Wesen aus der Finsternis. Unten im Gasthaus reden sie ständig davon.«
Brin warf ihrem Bruder einen vorwurfsvollen Blick zu. »Und mehr steckt auch nicht dahinter – Gerede!«
Jair schaute zu Rone hinüber. »Was meinst du?«
Zu Brins Überraschung zuckte der Hochländer mit den Schultern. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht.«
Plötzlich wurde sie wütend. »Rone, solche Geschichten gibt es, seit der Hexenmeister vernichtet wurde, und nicht eine davon enthielt auch nur ein Körnchen Wahrheit. Warum sollte es diesmal anders sein?«
»Ich behaupte nicht, dass es anders ist. Ich bin nur lieber vorsichtig. Vergiss nicht, zu Shea Ohmsfords Zeiten glaubten sie auch nicht an die Geschichten von den Schädelträgern – bis es zu spät war.«
»Deshalb finde ich ja, dass wir uns umsehen sollten«, wiederholte Jair.
»Und wozu?«, wollte Brin nun in schärferem Ton wissen. »Auf das Risiko hin, dass wir tatsächlich eins dieser gefährlichen Wesen entdecken? Was willst du dann machen? Mit dem Wünschlied dagegen vorgehen?«
Jair errötete. »Wenn es sein müsste, ja. Ich könnte den Zauber benutzen …«
Sie fiel ihm ins Wort. »Der Zauber ist kein Spielzeug, Jair. Wie oft muss ich dich noch daran erinnern?«
»Ich meinte ja nur, dass …«
»Ich weiß, was du gesagt hast. Du glaubst, das Wünschlied ist allmächtig, aber da täuschst du dich gewaltig. Beherzige lieber, dass dich dein Vater vor der Magie gewarnt hat. Eines Tages handelst du dir große Schwierigkeiten ein.«
Ihr Bruder starrte sie an. »Wieso bist du denn so wütend?«
Sie war wütend, wie ihr nun auffiel, und zwar völlig sinnlos. »Es tut mir leid«, entschuldigte sie sich. »Ich habe Mutter versprochen, dass keiner von uns das Wünschlied anwendet, solange sie und Vater unterwegs sind. Wahrscheinlich rege ich mich deshalb so sehr darüber auf, weil du davon redest, nach Mordgeistern zu stöbern.«
Nun blitzte der Zorn in Jairs blauen Augen auf. »Wer gibt dir das Recht, für mich irgendwelche Versprechungen zu machen, Brin?«
»Niemand, nehme ich an, aber Mutter …«
»Mutter hat keine Ahnung …«
»Um der Katze willen, hört bloß auf!« Rone Leah hob flehentlich die Arme. »Wenn ihr euch so streitet, bin ich immer froh, im Gasthaus und nicht bei euch beiden zu wohnen. Vergessen wir die Sache und kommen wir zu unserem eigentlichen Thema zurück. Gehen wir nun morgen angeln oder nicht.«
»Wir gehen angeln«, plädierte Jair.
»Wir gehen angeln«, stimmte Brin zu, »nachdem wir zumindest ein paar Arbeiten erledigt haben.«
Eine Zeit lang marschierten sie schweigend weiter, und Brin brütete darüber, was sie als Jairs zunehmende Verblendung in Hinsicht auf das Wünschlied betrachtete. Ihre Mutter hatte Recht; Jair wandte die Magie an, wann immer er die Gelegenheit dazu fand. Weil es bei ihm anders wirkte, sah er keine Gefahr darin, anders als Brin. Bei ihr veränderte das Wünschlied tatsächlich Aussehen und Verhalten, bei Jair war es nur ein Trugbild. Wenn er das Wünschlied benutzte, hatten die Dinge nur den Anschein einer Verwandlung. Das verlieh ihm eine größere Handlungsbreite in der Anwendung und ermutigte zu Experimenten. Er tat es im Geheimen, aber er tat es nichtsdestoweniger. Brin war nicht sicher, welche Fähigkeiten er inzwischen damit erworben hatte.
Der Nachmittag ging zu Ende, und der Abend brach herein. Der Vollmond hing wie ein weißes Leuchtfeuer am östlichen Horizont, und Sterne begannen zu funkeln. Mit der Nacht kühlte die Luft merklich ab, in die Düfte des Waldes mischte sich scharf und schwer der Geruch von moderndem Laub. Rings um sie her erhoben sich das Summen von Insekten und der Gesang der Abendvögel.
»Ich finde, wir sollten am Rappahalladran fischen«, verkündete Jair plötzlich.
Keiner antwortete sogleich. »Ich weiß nicht recht«, meinte Rone schließlich. »Wir könnten genauso gut an den Teichen im Tal angeln.«
Brin warf dem Hochländer einen fragenden Blick zu. Rone klang besorgt.
»Doch nicht nach Bachforellen«, widersprach Jair. »Außerdem würde ich gerne für ein, zwei Nächte im Dulnwald zelten.«
»Das könnten wir auch im Tal.«
»Dann könnten wir ebenso gut im Garten bleiben«, erwiderte Jair, allmählich ein wenig gereizt. »Im Duln gibt es wenigstens ein paar Plätze, die wir noch nicht erkundet haben. Wovor habt ihr eigentlich Angst?«
»Ich habe vor gar nichts Angst«, entgegnete der Hochländer abwehrend. »Ich meine nur … Pass auf, warum besprechen wir das nicht später? Ich erzähle euch, was mir auf dem Weg hierher widerfahren ist. Ich hätte mich tatsächlich beinahe verlaufen. Da war dieser Wolfshund …«
Brin fiel einen Schritt zurück und ließ sie vorweggehen und erzählen. Sie staunte über Rones unerwarteten Widerwillen, auch nur einen kurzen Zeltausflug in den Duln zu machen – einen Ausflug, wie sie ihn zuvor Dutzende von Malen unternommen hatten. Gab es jenseits des Tals etwas, wovor sie sich fürchten mussten? Sie blickte finster drein, als sie an die Besorgnis dachte, die ihre Mutter ausgesprochen hatte. Nun auch noch Rone. Der Hochländer hatte die Geschichten von Mordgeistern nicht so rasch wie sie als Gerüchte abgetan. Vielmehr war er sogar außergewöhnlich zurückhaltend gewesen. Normalerweise hätte Rone derartige Geschichten ebenso wie sie lachend als Unfug verspottet. Warum nicht diesmal? Möglicherweise hatte er einen Grund dafür.
Eine halbe Stunde verstrich, dann tauchten allmählich die Lichter des Dorfes zwischen den Bäumen des Waldes auf. Nun war es dunkel, aber der Mond beleuchtete ihnen den Weg. Der Pfad führte hinab in die geschützte Senke, in der das Dorf lag, und verbreiterte sich schließlich vom Fußweg zur Landstraße. Häuser tauchten auf, aus denen sie Stimmen hörten. Brin überkam die erste Müdigkeit. Es täte gut, in ihr behagliches Bett zu kriechen und die ganze Nacht durchzuschlafen.
Sie zogen durch die Mitte von Schattental und kamen an dem alten Gasthof vorüber, den die Ohmsfords so viele Generationen lang geführt hatten. Das Haus war immer noch im Besitz der Familie, doch die Ohmsfords lebten dort nicht mehr – nicht seit Shea und Flick gestorben waren. Freunde der Familie führten das Gasthaus inzwischen und teilten Kosten und Einkünfte mit Brins Eltern. Brin wusste, dass sich ihr Vater im Gasthaus niemals wohl gefühlt und keine Beziehung zu diesem Geschäft gehabt hatte. Er zog sein Leben als Heiler dem eines Wirtes vor. Nur Jair zeigte echtes Interesse am Wirtshaus und das deshalb, weil er so gerne die Geschichten hörte, die die Reisenden mit nach Schattental brachten – Geschichten voller Abenteuer, nach denen sich der rastlose Talbewohner sehnte.
An diesem Abend herrschte großer Betrieb. Durch die offene Tür sah man die hell erleuchteten Tische und den langen Tresen, an dem sich Reisende und Leute aus dem Dorf drängten, lachten und scherzten und den kühlen Herbstabend über einem oder zwei Glas Bier zubrachten. Rone grinste Brin über die Schulter hinweg an und schüttelte den Kopf. Niemand wollte den Abend jetzt schon beenden.
Kurz darauf erreichten sie das Haus der Ohmsfords, ein gemauertes Bauernhaus, das unter Bäumen auf einem kleinen Hügel stand. Sie hatten den halben Pflasterweg geschafft, der zwischen Heckenreihen und blühenden Pflaumenbäumen zur Eingangstür führte, als Brin plötzlich stehen blieb.
Im vorderen Zimmer brannte Licht.
»Hat einer von euch heute früh, als wir aufgebrochen sind, eine Lampe brennen lassen?«, fragte sie ruhig und wusste die Antwort schon. Beide schüttelten die Köpfe.
»Vielleicht haben wir Besuch«, meinte Rone.
Brin blickte ihn an. »Das Haus war abgeschlossen.«
Sie starrten einander wortlos an. Vages Unbehagen beschlich Brin. Nicht jedoch Jair.
»Na, dann gehen wir rein und sehen nach, wer da ist«, erklärte er und setzte sich in Bewegung.
Rone legte ihm eine Hand auf die Schulter und zog ihn zurück. »Augenblick, Tiger. Lass uns nichts überstürzen.«
Jair befreite sich, sah zu dem Licht und dann wieder Rone an. »Was glaubst du denn, wer da drinnen auf uns wartet – einer von den Wandlern?«
»Hör mit dem Unsinn auf!«, verlangte Brin scharf.
Jair feixte. »Daran hast du doch gedacht, wie? Einer von den Wandlern ist gekommen, um uns zu holen!«
»Wie nett von ihnen, dass sie Licht für uns gemacht haben«, erwiderte Rone trocken.
Unentschlossen starrten sie zu dem Lichtschein im Fenster.
»Nun, wir können nicht die ganze Nacht hier draußen stehen bleiben«, entschied Rone schließlich. Er griff über die Schulter nach hinten und zog das Schwert von Leah aus der Scheide. »Sehen wir doch einmal nach. Ihr zwei haltet euch hinter mir. Wenn irgendetwas passiert, lauft zum Gasthaus zurück und holt Hilfe.« Er zögerte. »Nicht dass ich damit rechne, dass irgendetwas passieren wird.«
Einer hinter dem anderen gingen sie zur Haustür, blieben davor stehen und lauschten. Im Innern herrschte Stille. Brin reichte Rone den Schlüssel, und sie traten hinein. Im Flur war es stockfinster bis auf einen Streifen gelben Lichts, der in den kurzen Gang fiel. Sie zögerten, gingen dann leise den Flur hinab und betraten das vordere Zimmer.
Es war leer.
»Nun, kein Mordgeist hier«, verkündete Jair sogleich. »Nichts außer …«
Er schaffte es nicht, den Satz zu beenden. Ein riesenhafter Schatten trat aus dem dunklen Nebenzimmer ins Licht. Der Mann war über zwei Meter groß und von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Umhang gehüllt. Die weite Kapuze war zurückgeschlagen und enthüllte ein hageres, kantiges Gesicht, das wettergegerbt und hart aussah. Das schwarze Haar und der schwarze Bart waren borstig und mit grauen Strähnen durchsetzt. Doch den durchdringenden Augen, die tief im Schatten der breiten Stirn lagen, schien nichts, auch das Verborgene nicht, zu entgehen.
Rone Leah riss das Breitschwert in die Höhe, und der Fremde hob eine Hand.
»Das wirst du nicht benötigen.«
Der Hochländer zögerte, starrte dem Fremden kurz in die dunklen Augen und ließ das Schwert dann langsam sinken. Brin und Jair blieben wie versteinert stehen und konnten sich weder umdrehen und davonlaufen, noch brachten sie ein Wort heraus.
»Ihr habt nichts zu befürchten«, erklang dröhnend die tiefe Stimme des Fremden.
Keiner der drei fühlte sich dadurch sonderlich beruhigt, doch alle entspannten sich ein wenig, da die dunkle Gestalt nicht weiter auf sie zutrat. Brin warf ihrem Bruder einen hastigen Blick zu und stellte fest, dass Jair den Fremden intensiv musterte, als würde er sich etwas überlegen. Der Fremde betrachtete den Jungen, dann Rone, schließlich sie.
»Kennt ihr mich denn nicht?«, murmelte er leise.
Es herrschte eine kurze Stille, dann nickte Jair plötzlich.
»Allanon!«, rief er, und die Aufregung stand ihm im Gesicht geschrieben. »Ihr seid Allanon!«
2
Brin, Jair und Rone Leah nahmen zusammen mit dem Fremden, von dem sie nun wussten, dass es sich um Allanon handelte, am Tisch im Esszimmer Platz. Ihres Wissens war Allanon seit zwanzig Jahren von niemandem mehr gesehen worden. Wil Ohmsford hatte zu den Letzten gehört. Doch die Geschichten über ihn waren allen vertraut. Ein rätselhafter, dunkler Wanderer, der die entlegensten Gegenden der Vier Länder bereist hatte, und gleichzeitig Philosoph, Lehrer und Geschichtsforscher der Rassen – der letzte der Druiden, jener gelehrten Männer, die die Völker aus dem Chaos, das auf die Zerstörung der alten Welt gefolgt war, in die Zivilisation, wie sie heute erblühte, geführt hatten. Allanon war es gewesen, der Shea und Flick Ohmsford sowie Menion Leah vor über siebzig Jahren auf die Suche nach dem legendären Schwert von Shannara geschickt hatte, damit der Hexenmeister vernichtet werden konnte. Allanon hatte Wil Ohmsford geholt, während der Mann aus dem Tal in Storlock die Heilkunst studiert hatte, und ihn überzeugt, dem Elfenmädchen Amberle Elessedil als Führer und Beschützer zu dienen, um nach dem Mittel zu suchen, mit dem sich der sterbende Ellcrys wieder zum Leben erwecken ließ und dabei gleichzeitig die im Westland entfesselten Dämonen gefangen setzte. Sie kannten die Geschichten über Allanon. Und sie wussten: Wo der Druide auftauchte, drohte Ungemach.
»Ich habe einen langen Weg hinter mir, um dich zu finden, Brin Ohmsford«, sagte der hochgewachsene Mann leise und matt. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Reise jemals unternehmen müsste.«
»Warum suchst du ausgerechnet mich?«, fragte Brin.
»Weil ich das Wünschlied brauche.« Es entspann sich endloses Schweigen, während das Mädchen aus dem Tal und der Druide einander über den Tisch hinweg musterten. »Eigentümlich«, seufzte er schließlich, »ich habe früher nicht begriffen, welchen tieferen Sinn es haben könnte, dass der Elfenzauber an die Kinder von Wil Ohmsford weitergegeben wurde. Ich hielt es mehr oder weniger für eine Nebenwirkung der Elfensteine, die sich nicht vermeiden ließ.«
»Wozu braucht Ihr Brin?«, stieß Rone finster hervor. Ihm gefiel das Ganze überhaupt nicht.
»Und das Wünschlied?«, ergänzte Jair.
Allanon blickte Brin unverwandt an. »Sind eure Eltern nicht hier?«
»Nein. Sie sind für mindestens zwei Wochen unterwegs, um die Kranken in den Dörfern des Südens zu behandeln.«
»Ich kann keine zwei Wochen warten, nicht einmal zwei Tage«, flüsterte der große Mann. »Wir müssen jetzt reden, und dann musst du entscheiden, was du zu tun gedenkst. Und wenn du die Entscheidung triffst, zu der es meiner Ansicht nach keine andere Wahl gibt, wird dein Vater mir diesmal nicht verzeihen, fürchte ich.«
Brin wusste sofort, wovon der Druide sprach. »Ich soll Euch begleiten?«, fragte sie langsam.
Er ließ die Frage unbeantwortet. »Lasst mich von einer Gefahr berichten, die die Vier Länder bedroht – ein Unheil, das ebenso groß ist wie jene, mit denen es Shea Ohmsford oder dein Vater zu tun hatten.« Er faltete die Hände vor sich auf dem Tisch und beugte sich zu ihr vor. »In der alten Welt vor der Entstehung der menschlichen Rasse existierten feenhafte Geschöpfe, die sich guter und böser Magie bedienten. Dein Vater wird dir die Geschichte wohl erzählt haben. Diese Welt verging mit dem Auftauchen des Menschen. Die Bösen wurden hinter die Mauer der Verfemung verbannt, die Guten gingen in der Entwicklung der Rassen unter – alle bis auf die Elfen. Aus jenen Zeiten überdauerte jedoch ein Buch. Es war ein Buch der schwarzen Magie, von so furchterregender Macht, dass selbst die Elfenzauberer der alten Welt davor Angst hatten: der Ildatch. Seine Herkunft ist bis heute ungeklärt, offensichtlich tauchte er bereits sehr früh in der Zeit auf, in der das Leben erschaffen wurde. Das Böse in der Welt benutzte ihn einige Zeit, bis es den Elfen immerhin gelang, ihn in ihren Besitz zu bringen. Die Verlockung war so groß, dass ein paar Elfenzauberer, wohl wissend um seine Macht, es wagten, mit seinen Geheimnissen zu experimentieren. Es endete in ihrer Vernichtung. Die Übrigen kamen zu dem Schluss, dass es am besten wäre, das Buch zu zerstören. Doch ehe sie das ausführen konnten, verschwand es. Danach gab es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Gerüchte, er sei benutzt worden, doch nie hörte man etwas Handfestes.«
Er zog die Stirn kraus. »Und dann löschten die Großen Kriege die alte Welt aus. Zweitausend Jahre darbte das menschliche Dasein auf seinem primitivsten Stand. Erst als die Druiden in Paranor den ersten Druidenrat einberiefen, wurde ein Versuch unternommen, das verbliebene Wissen der alten Welt zusammenzutragen, um damit vielleicht beim Aufbau der neuen zu helfen. Alle schriftlich oder mündlich überlieferten Kenntnisse, die erhalten worden waren, wurden dem Rat zugänglich gemacht, damit dieser ihre Geheimnisse entschlüsseln könnte. Unglücklicherweise war nicht alles von guter Natur. Unter den Büchern, die die Druiden aufstöberten, befand sich auch der Ildatch. Er wurde von einem brillanten, ehrgeizigen jungen Druiden namens Brona gefunden.«
»Der Hexenmeister«, warf Brin leise ein.
Allanon nickte. »Er wurde zum Hexenmeister, als die Macht des Ildatch ihn verdarb. Er verlor sich zusammen mit seinen Anhängern in schwarzer Magie. Fast tausend Jahre lang bedrohten sie die Existenz der Rassen. Erst als Shea Ohmsford die Macht des Schwertes von Shannara erringen konnte, wurden Brona und seine Anhänger vernichtet.«
Er machte eine Pause. »Aber der Ildatch tauchte wieder auf. Ich suchte in den Überresten des Schädelberges danach, als das Reich des Hexenmeisters fiel. Ich konnte ihn nicht entdecken. Ich glaubte, er wäre für immer verschüttet. Aber ich habe mich getäuscht. Irgendwie ist das Buch erhalten geblieben. Es wurde von einer Sekte menschlicher Anhänger des Hexenmeisters gefunden – von Möchtegernzauberern menschlicher Rassen, die der Macht des Schwertes von Shannara nicht erlegen und deshalb nicht mit ihrem Herrn vernichtet worden waren. Wie das geschehen konnte, weiß ich bis heute nicht, aber irgendwie entdeckten sie genau die Stelle, wo der Ildatch verborgen lag, und holten ihn zurück in die Welt der Menschen. Sie brachten ihn in ihren Unterschlupf im Ostland, wo sie abgeschieden von den anderen Rassen darangingen, sich in die Geheimnisse der Magie zu vertiefen. Das liegt nun über sechzig Jahre zurück. Und du wirst dir denken können, was aus ihnen wurde.«
Blass beugte sich Brin vor. »Wollt Ihr damit sagen, dass alles von neuem begonnen hat? Dass es einen neuen Hexenmeister und neue Schädelträger gibt?«
Allanon schüttelte den Kopf. »Diese Menschen waren keine Druiden wie Brona und seine Anhänger, und es ist auch nicht die gleiche Zeit seit ihrer Abkehr verstrichen. Aber die Magie verdirbt jeden, der sich auf sie einlässt. Der Unterschied liegt im Wesen der Veränderung. Die Veränderung ist jedes Mal anders.«
Brin blickte ihn an. »Das verstehe ich nicht.«
»Anders«, wiederholte Allanon. »Magie, ob gute oder böse, passt sich dem Benutzer an und der Benutzer sich ihr. Letztes Mal konnten die Geschöpfe, die aus ihrer Berührung hervorgingen, fliegen …«
Der Satz blieb unvollendet. Seine Zuhörer wechselten Blicke.
»Und diesmal?«, wollte Rone wissen.
Die schwarzen Augen verengten sich. »Diesmal bewegt sich das Böse auf Beinen.«
»Mordgeister!«, zischte Jair.
Allanon nickte. »Das Gnomenwort für ›schwarzer Wandler‹. Sie stellen eine neue Form des gleichen Bösen dar. Der Ildatch hat sie geschaffen, wie er Brona und seine Anhänger geschaffen hat, als Opfer der Zauberei und Sklaven der Macht. Sie sind für die Welt der Menschen verloren und der Finsternis verfallen.«
»Demnach entsprechen die Gerüchte der Wahrheit«, murmelte Rone. Seine grauen Augen suchten Brins Blick. »Ich habe es dir bisher nicht erzählt, weil ich keinen Sinn darin sah, dich grundlos zu beunruhigen, doch Reisende, die durch Leah kamen, erzählten, dass Wandler vom Silberfluss nach Westen vorgedrungen sind. Als Jair vorschlug, außerhalb des Tals zu zelten, da habe ich deshalb …«
»So weit kommen Mordgeister?«, fiel Allanon ihm hastig ins Wort. Plötzliche Besorgnis klang aus seiner Stimme. »Wie lange ist das her, Prinz von Leah?«
Rone schüttelte zweifelnd den Kopf. »Vielleicht ein paar Tage. Kurz bevor ich ins Tal aufbrach.«
»Dann drängt die Zeit noch mehr, als ich dachte.« Die Furchen auf der Stirn des Druiden gruben sich tiefer.
»Aber was machen sie dort?«, wollte Jair wissen.
Allanon hob sein dunkles Gesicht. »Vermutlich suchen sie nach mir.«
Stille breitete sich im verdunkelten Haus aus. Niemand sagte ein Wort. Der Druide hatte sie mit dem Blick in Bann geschlagen.
»Hört mir gut zu. Die Burg der Mordgeister liegt tief in Ostland, hoch oben im Gebirge, das sie Rabenhorn nennen. Es ist eine mächtige alte Festung, die die Trolle im Zweiten Krieg der Rassen erbaut haben. Sie heißt Graumark und liegt am Rand eines Bergmassivs, das ein tiefes Tal umringt. Und in diesem Tal ist der Ildatch verborgen.«
Er atmete tief ein. »Vor zehn Tagen stand ich am oberen Zugang zu diesem Tal und wollte hinuntergehen, um das Buch der schwarzen Magie aus seinem Versteck zu holen und zu vernichten. Das Buch nährt die Macht der Mordgeister. Zerstört man es, ist seine Macht gebrochen und die Gefahr gebannt. Und diese Gefahr – ach, ich will euch zuerst von dieser Gefahr berichten. Die Mordgeister waren seit dem Fall ihres Herrn nicht müßig. Vor sechs Monaten flammten Grenzstreitigkeiten zwischen den Gnomen und den Zwergen auf. Jahrelang haben die beiden Völker um den Anarwald gekämpft, so dass das erneute Aufflackern ihres Streits anfänglich niemanden überraschte. Doch diesmal gibt es, ohne dass die meisten es bemerkten, einen Unterschied im Wesen des Kampfes. Die Gnomen werden von Mordgeistern angeführt. Nachdem die Gnomenstämme nach dem Untergang des Hexenmeisters zerstreut und besiegt worden waren, wurden sie nun erneut durch die schwarze Magie versklavt, diesmal unter der Herrschaft der Geister. Und die Zauberei verleiht den Gnomen Kräfte, die sie anderweitig nicht besäßen. So wurden seit dem erneuten Ausbruch der Grenzkriege die Zwerge immer weiter nach Süden gedrängt. Die Lage ist ernst. Gerade beginnt das Wasser des Silberflusses zu faulen, vergiftet durch die dunkle Magie. Das Land, das der Fluss bewässert, stirbt allmählich ebenfalls. Wenn dies geschieht, bedeutet das auch das Ende der Zwerge, und das ganze Ostland wird verloren sein. Elfen aus dem Westland und Menschen aus den Grenzregionen von Callahorn unterstützen die Zwerge, doch diese Hilfe reicht nicht, um der Magie der Mordgeister standzuhalten. Erst die Vernichtung des Ildatch wird alles beenden.«
Unvermittelt wandte er sich an Brin. »Erinnerst du dich an die Geschichten deines Vaters, die ihm sein Vater erzählt hat, dessen Vater sie wiederum von Shea Ohmsford gehört hat, vom Vormarsch des Hexenmeisters ins Südland? Als das Böse kam, senkte sich Finsternis über alles. Ein Schatten legte sich über das Land, und alles darunter verrottete und starb. Nichts vermochte in diesem Schatten zu leben, das nicht selbst Teil des Bösen war. Es geht wieder los, Mädchen – diesmal im Anar.«
Er wandte den Blick ab. »Vor zehn Tagen stand ich vor den Mauern von Graumark, fest entschlossen, den Ildatch zu suchen und zu vernichten. Da entdeckte ich, was die Mordgeister getan hatten. Mit der dunklen Magie haben sie in dem Tal einen Sumpfwald wachsen lassen, einen Maelmord in der Feensprache, eine Sperre von solchem Bösen, das alles erdrücken und verschlingen würde, das einzudringen versucht und nicht an diesen Ort gehört. Versteh richtig: Dieser dunkle Wald lebt, er atmet, er denkt. Nichts vermag ihn zu überwinden. Ich habe es versucht, aber selbst die beachtlichen Kräfte, über die ich verfüge, haben nicht ausgereicht. Der Maelmord hat mir den Weg versperrt, die Mordgeister haben meine Anwesenheit entdeckt. Ich wurde verfolgt, konnte jedoch entkommen. Und nun suchen sie nach mir und wissen …«
Er verstummte. Brin warf Rone, der mit jeder Minute unglücklicher aussah, einen raschen Blick zu.
»Wenn sie nach Euch suchen, werden sie schließlich hierherkommen, nicht wahr?« Der Hochländer nutzte die Pause in der Erzählung des Druiden.
»Letztendlich ja. Aber das geschieht so oder so, egal, ob sie mich nun verfolgen oder nicht. Versteht ihr, früher oder später werden sie ohnehin alles, das ihre Herrschaft über die Rassen bedroht, ausmerzen wollen. Und ihr begreift sicherlich, dass die Familie Ohmsford eine solche Bedrohung darstellt.«
»Wegen Shea Ohmsford und des Schwertes von Shannara?«, wollte Brin wissen.
»Nicht unmittelbar. Die Mordgeister sind keine Geschöpfe eines Trugbildes wie der Hexenmeister, so dass das Schwert ihnen nichts anhaben kann. Die Elfensteine vielleicht. Die Macht dieses Zaubers ist nicht zu unterschätzen, und die Geister werden von Wil Ohmsfords Suche nach dem Blutfeuer gehört haben.« Er hielt inne. »Aber die wirkliche Bedrohung für sie geht vom Wünschlied aus.«
»Vom Wünschlied?« Brin war wie vom Donner gerührt. »Aber das Wünschlied ist doch nur ein Spielzeug. Es ist nicht so mächtig wie die Elfensteine! Warum sollte es für diese Ungeheuer eine solche Bedrohung darstellen? Warum sollten sie vor etwas derartig Harmlosem solche Angst haben?«
»Harmlos?« Allanons Augen blitzten auf, schlossen sich dann jedoch, als wollten sie etwas verbergen. Das Gesicht des Druiden war ausdruckslos. Plötzlich bekam Brin wirklich Angst.
»Allanon, warum seid Ihr hier?«, fragte sie noch einmal und musste sich alle Mühe geben, dass ihre Hände nicht zitterten.
Der Druide schaute wieder auf. Vor ihm auf dem Tisch flackerte die karge Flamme der Öllampe. »Ich möchte, dass du mich ins Ostland zur Feste der Mordgeister begleitest. Ich möchte, dass du das Wünschlied benutzt, um dir Zutritt zum Maelmord zu verschaffen, den Ildatch zu finden und mir zu bringen, damit ich ihn zerstöre.«
Seine Zuhörer starrten ihn sprachlos an.
»Wie?«, fragte Jair schließlich.
»Das Wünschlied vermag sogar schwarze Magie umzukehren«, erwiderte Allanon. »Es vermag das Verhalten jedes lebenden Wesens zu verändern. Selbst der Maelmord kann dazu gebracht werden, Brin einzulassen. Das Wünschlied kann für sie den Durchgang ermöglichen.«
Jair riss verwundert die Augen auf. »Zu alledem ist das Wünschlied in der Lage?«
Aber Brin schüttelte den Kopf. »Das Wünschlied ist nur eine Spielerei«, wiederholte sie.
»Ist es das? Oder hast du es vielmehr bislang nur als solche benutzt?« Der Druide schüttelte langsam den Kopf. »Nein, Brin Ohmsford, das Wünschlied ist ein Elfenzauber, und es besitzt die Macht eines Elfenzaubers. Du begreifst das jetzt noch nicht, aber ich sage dir, dass es so ist.«
»Es ist mir gleichgültig, was es ist oder was es nicht ist, jedenfalls wird Brin nicht gehen!« Rone war wütend. »Ihr könnt nicht von ihr verlangen, sich in ein so gefährliches Abenteuer zu stürzen!«
Allanon blieb ungerührt. »Ich habe keine andere Wahl, Prinz von Leah. Ebenso wenig wie ich eine Wahl hatte, Shea Ohmsford zu bitten, nach dem Schwert von Shannara zu suchen, oder Wil Ohmsford nach dem Blutfeuer. Das Erbe des Elfenzaubers, das ursprünglich an Jerle Shannara weitergegeben wurde, gehört nun einmal den Ohmsfords. Ich wünschte ebenso wie du, dass es sich anders verhielte. Ebenso gut könnten wir wünschen, Nacht wäre Tag. Das Wünschlied gehört Brin, und nun muss sie es einsetzen.«
»Brin, hör mich an.« Rone wandte sich dem Mädchen aus dem Tal zu. »Die Gerüchte sind weitaus schlimmer, als ich dir angedeutet habe. Sie berichten auch davon, was die Mordgeister Menschen angetan haben, sie sprechen von herausgerissenen Augen und Zungen, von Seelen, die allen Lebens beraubt sind, und von Feuer, das bis in die Knochen brennt. Ich habe das bislang nicht ernst genommen. Ich hielt es eher für die Geschichten, die Betrunkene zu später Stunde am Kamin zum Besten geben. Aber jetzt sehe ich das anders. Du darfst nicht mit ihm gehen. Auf keinen Fall.«
»Die Gerüchte, von denen du sprichst, beruhen auf der Wahrheit«, stimmte Allanon leise zu. »Es ist gefährlich. Die Reise kann dich sogar das Leben kosten.« Er hielt inne. »Aber was sollen wir tun, wenn du nicht mitkommst? Willst du dich verstecken und hoffen, die Mordgeister würden dich vergessen? Willst du die Zwerge bitten, dich zu beschützen? Was geschieht, wenn sie fort sind? Dann drängt das Böse genauso wie der Hexenmeister in dieses Land. Und es wird sich ausbreiten, bis niemand mehr da ist, ihm Widerstand zu leisten.«
Jair legte seiner Schwester die Hand auf den Arm. »Brin, wenn wir schon gehen müssen, so werden wir wenigstens zu zweit sein …«
»Wir werden ganz gewiss nicht zu zweit gehen!«, widersprach sie ihm auf der Stelle. »Was auch immer geschieht, du bleibst hier.«
»Wir bleiben alle hier.« Rone schaute den Druiden herausfordernd an. »Wir werden nicht gehen – keiner von uns. Ihr müsst einen anderen Weg finden.«
Allanon schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht, Prinz von Leah. Es gibt keinen anderen Weg.«
Daraufhin schwiegen sie. Brin sank in ihren Stuhl zurück, verwirrt und nicht wenig verängstigt. Sie fühlte sich bedrängt, da der Druide in ihr ein Gefühl unausweichlicher Notwendigkeit erzeugt hatte, in dem er ein Netz von Verpflichtungen über ihr auswarf. Ihre Gedanken drehten sich, und einer kehrte dabei immer wieder. Das Wünschlied ist nur eine Spielerei. Elfenzauber, ja – aber eben nur eine Spielerei! Harmlos! Keine Waffe gegen das Böse, das nicht einmal Allanon überwinden konnte! Und doch hatte ihr Vater sich stets vor der Zauberei gefürchtet. Er hatte sie gewarnt, sie nicht anzuwenden, sie gemahnt, dass es nichts war, mit dem man herumspielen sollte. Und sie selbst hatte sich entschieden, Jair davon abzubringen, das Wünschlied zu benutzen …
»Allanon«, sprach sie ruhig. Das hagere Gesicht wandte sich ihr zu. »Bisher habe ich mit dem Wünschlied nur das Aussehen von Dingen ein wenig verändert – die Farbe von Blättern oder die Blüten von Blumen. Kleinigkeiten. Und selbst das nicht mehr seit Monaten. Wie soll man mit dem Wünschlied bei etwas Bösem wie diesem Wald, der den Ildatch bewacht, eine Veränderung bewirken?«
Er zögerte kurz. »Ich werde es dich lehren.«
Sie nickte langsam. »Mein Vater hat immer von allem Gebrauch des Zaubers abgeraten. Er hat davor gewarnt, sich darauf zu verlassen, weil er es einmal getan hat und es sein ganzes Leben in andere Bahnen lenkte. Wenn er hier wäre, Allanon, würde er sich ebenso verhalten wie Rone und mir raten, nein zu sagen. Genauer ausgedrückt, würde er mir sogar befehlen, mit nein zu antworten.«
Das hagere Gesicht widerspiegelte neue Müdigkeit. »Ich weiß, Talbewohnerin.«
»Mein Vater ist von der Suche nach dem Blutfeuer aus dem Westland zurückgekehrt und hat die Elfensteine für immer weggesperrt«, fuhr sie fort und versuchte, sich beim Sprechen gedanklich in dem Durcheinander zurechtzufinden. »Er hat mir einmal erzählt, er hätte selbst damals schon gewusst, dass der Elfenzauber ihn verändert habe, nur noch nicht, wie. Er gelobte sich, dass er die Elfensteine niemals wieder benutzen würde.«
»Auch das ist mir bekannt.«
»Und trotzdem bittet Ihr mich, Euch zu begleiten?«
»Ja.«
»Ohne dass ich in der Lage wäre, ihn zuerst um seinen Rat zu bitten? Ohne dass ich auf seine Rückkehr warten kann? Ohne auch nur einen Versuch zu unternehmen, ihm eine Erklärung zu geben?«
Der Druide wirkte plötzlich verärgert. »Ich will es dir leicht machen, Brin Ohmsford. Ich verlange nichts von dir, was rechtens oder vernünftig wäre, nichts, was dein Vater gutheißen würde. Ich bitte dich darum, alles aufs Spiel zu setzen, und du hast kaum mehr als mein Wort, dass es notwendig ist, so zu handeln. Ich verlange Vertrauen, wo vermutlich kaum Anlass dazu besteht. All das fordere ich und habe nichts zu bieten. Nichts.«
Daraufhin beugte er sich vor, erhob sich halb von seinem Stuhl, und seine Miene wirkte finster und bedrohlich. »Aber ich sage dir Folgendes: Wenn du die Sache durchdenkst, wirst du begreifen, dass du trotz aller Einwände, die du dagegen anführen kannst, mitkommen musst!«
Selbst Rone widersprach ihm diesmal lieber nicht. Der Druide behielt seine Stellung noch einen Augenblick bei, und seine dunklen Gewänder blähten sich weit, wo er sich mit beiden Armen auf den Tisch stützte. Dann ließ er sich langsam wieder auf seinen Stuhl sinken. Er wirkte nun erschöpft und auf stille Art mutlos. Das war keine Eigenschaft des Allanons, den Brins Vater ihr so oft beschrieben hatte, und das ängstigte sie.
»Ich werde die Sache überdenken, wie Ihr verlangt«, stimmte sie zu, und ihre Stimme war fast ein Flüstern. »Aber ich brauche zumindest eine Nacht. Ich muss mir über meine … Gefühle klar werden.«
Allanon schien einen Augenblick zu zögern, ehe er nickte. »Wir sprechen morgen früh weiter. Überlege es gut, Brin Ohmsford.«
Er wollte aufstehen, und plötzlich stand Jair mit errötetem Elfengesicht vor ihm. »Und was ist mit mir? Was ist mit meinen Gefühlen in dieser Angelegenheit? Wenn Brin geht, komme ich mit! Ich will nicht zurückgelassen werden!«
»Jair, vergiss, dass …«, wollte Brin einwenden, aber Allanon brachte sie mit einem Blick zum Schweigen. Er stand auf, kam um den Tisch und blieb vor ihrem Bruder stehen.
»Du hast Mut«, sagte er leise und legte dem Talbewohner eine Hand auf die schmale Schulter. »Doch du besitzt nicht die Zauberkraft, die ich auf dieser Reise benötige. Deine Magie ist Illusion, und Illusionen werden uns nicht durch den Maelmord bringen.«
»Aber vielleicht täuscht Ihr Euch«, widersprach Jair dickköpfig. »Außerdem möchte ich auch helfen.«
Allanon nickte. »Du wirst deinen Beitrag leisten. Es gibt eine Aufgabe, die du übernehmen musst, solange Brin und ich fort sind. Du musst dich um die Sicherheit deiner Eltern kümmern, dafür sorgen, dass die Mordgeister sie nicht finden, ehe ich den Ildatch vernichtet habe. Du musst sie mit dem Wünschlied vor den Mächten der Finsternis schützen, die nach ihnen suchen. Wirst du das tun?«
Brin störte sich nicht groß an der Vermutung des Druiden, dass es bereits beschlossene Sache wäre, dass sie ihn ins Ostland begleitete, und sie störte sich noch weniger an dem Vorschlag, dass Jair den Elfenzauber als Waffe einsetzen sollte.
»Wenn es sein muss«, versprach Jair mit zähneknirschendem Unterton. »Aber ich käme lieber mit Euch.«
Allanons Hand sank von seiner Schulter. »Ein andermal, Jair.«
»Vielleicht gibt es auch für mich ein andermal«, erklärte Brin spitz. »Noch ist nichts beschlossen, Allanon.«
Das dunkle Gesicht schwenkte langsam herum. »Für dich wird es kein andermal geben, Brin«, sagte er leise. »Deine Stunde ist gekommen. Du musst mich begleiten. Bis zum Morgen wirst du das begreifen.«
Er nickte und schritt, den dunklen Umhang eng um sich gezogen, zur Tür.
»Wohin geht Ihr, Allanon?«, rief ihm das Mädchen aus dem Tal nach.
»Ich bleibe in der Nähe«, antwortete er, ohne den Schritt zu verlangsamen. Einen Augenblick später war er verschwunden. Brin, Jair und Rone Leah starrten ihm hinterher.
Rone fand als Erster die Sprache wieder. »Nun, was jetzt?«
Brin blickte ihn an. »Jetzt gehen wir zu Bett.« Sie stand vom Tisch auf.
»Zu Bett!« Der Hochländer war völlig fassungslos. »Wie kannst du nach alledem ins Bett?« Er deutete vage in Richtung des verschwundenen Druiden.
Sie strich ihr langes schwarzes Haar zurück und lächelte müde. »Wie sollte ich denn etwas anderes tun, Rone? Ich bin müde, verwirrt und verängstigt und brauche Ruhe.«
Sie trat zu ihm und küsste ihn leicht auf die Stirn. »Bleib heute Nacht hier.« Sie gab Jair ebenfalls einen Kuss und drückte ihn an sich. »Geht schlafen, ihr zwei.«
Dann eilte sie den Flur entlang zu ihrem Schlafzimmer und schloss die Tür fest hinter sich.
Sie verfiel für eine Zeit lang in traumerfüllten, unruhigen Schlaf, in welchem unbewusste Ängste Gestalt annahmen und sie wie Gespenster heimsuchten. Gehetzt und zerschlagen fuhr sie von ihrem schweißnassen Kissen hoch. Dann stand sie auf, zog ihr Kleid über und wanderte lautlos durch die dunklen Räume des Hauses. Am Wohnzimmertisch zündete sie die Öllampe an, drehte den Docht herunter, setzte sich und starrte schweigend in die Schatten.
Hilflosigkeit erfüllte Brin. Was sollte sie tun? Sie erinnerte sich gut an die Geschichten, die ihr Vater und sogar ihr Urgroßvater Shea Ohmsford erzählt hatten, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war – wie es gewesen war, als der Hexenmeister vom Nordland heranmarschiert kam, wie seine Armeen nach Callahorn hereinströmten und die Finsternis in seinem Gefolge das ganze Land überzog. Wo der Hexenmeister vorbeikam, erlosch alles Licht. Nun wiederholte es sich: Grenzkriege zwischen Gnomen und Zwergen, vergiftetes Land am Silberfluss, Dunkelheit, die über das Ostland hereinbrach. Alles war wie vor fünfundsiebzig Jahren. Auch diesmal gab es einen Weg, dem Schrecken Einhalt zu gebieten und die Ausbreitung der Finsternis zu verhindern. Und auch diesmal war ein Ohmsford berufen, diesen Weg zu gehen – berufen, wie es schien, weil es keine andere Hoffnung mehr gab.
Sie genoss die Wärme ihres Kleides. Es schien – das war das Schlüsselwort in Bezug auf Allanon. Wie viel steckte hinter all dem Schein? Wie viel von dem, was man ihr erzählt hatte, entsprach der Wahrheit, wie viel war nur Halbwahrheit? Die Geschichten von Allanon waren stets die gleichen. Der Druide besaß gewaltige Kräfte und riesiges Wissen und gab von beidem nur einen Bruchteil preis. Er erzählte, was seiner Ansicht nach unbedingt nötig war, und niemals mehr. Er spannte andere für seine Zwecke ein, und diese Zwecke hielt er oft sorgsam geheim. Wenn man Allanons Weg beschritt, wusste man, dass dieser Weg im Dunkeln gehalten wurde.
Doch der Weg der Mordgeister mochte noch finsterer sein, wenn sie tatsächlich eine neue Form jenes Bösen darstellten, die das Schwert von Shannara vernichtet hatte. Sie musste die Dunkelheit des einen gegen die des anderen abwägen. Allanon mochte in seinem Umgang mit den Ohmsfords unaufrichtig und manipulierend sein, doch er war ein Freund der Vier Länder. Was er auch unternahm, er tat es in dem Bemühen, die Rassen zu beschützen, und nicht, um ihnen Schaden zuzufügen. Und bislang hatte er mit seinen Warnungen immer Recht behalten. Daher gab es keinen Grund zu der Annahme, dass er sich diesmal täuschte.
Aber war der Zauber des Wünschliedes stark genug, die Barriere zu durchbrechen, die das Böse errichtet hatte? Brin mochte es nicht glauben. Was war das Wünschlied anderes als eine Nebenwirkung des Elfenzaubers? Es besaß nicht einmal die Macht der Elfensteine. Es war keine Waffe. Und doch hielt Allanon es für das einzige Mittel, die dunkle Magie zu überwinden – das einzige Mittel, nachdem selbst er gescheitert war.
Nackte Füße tappten von der Esszimmertür heran und erschreckten sie. Rone trat leise aus den Schatten an den Tisch und setzte sich.
»Ich konnte auch nicht schlafen«, murmelte er und blinzelte in den Schein der Öllampe. »Wie hast du dich entschieden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich frage mich immer wieder, was Vater tun würde.«
»Das ist nicht schwer«, grunzte Rone. »Er würde dir raten, die Sache einfach zu vergessen. Es ist zu gefährlich. Und er würde dich auch daran erinnern, dass Allanon nicht zu trauen ist, wie er uns beiden schon oft gesagt hat.«
Brin strich das lange Haar zurück und lächelte schwach. »Du hast mir nicht zugehört, Rone. Ich sagte, ich frage mich immer wieder, was Vater tun würde – nicht, was er mir raten würde. Das ist nicht das Gleiche, weißt du. Wenn man ihn bäte mitzukommen – was würde er dann tun? Würde er nicht einfach gehen, so wie damals, als Allanon ihn vor zwanzig Jahren aus Storlock holte, in dem Wissen, dass Allanon nicht rundweg ehrlich war, und in dem Wissen, dass man ihm nicht alles gesagt hatte. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass er Zauberkräfte besaß, die nützlich sein könnten und über die nur er verfügte?«
Der Hochländer rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. »Aber Brin, das Wünschlied ist … nun ja, es ist nicht das Gleiche wie die Elfensteine. Das hast du doch selbst zugegeben. Es ist nur ein Spielzeug.«
»Ich weiß. Das macht ja gerade alles so schwierig – das und die Tatsache, dass mein Vater entsetzt wäre, wenn er nur für eine Minute daran dächte, ich könnte in Erwägung ziehen, den Zauber als eine Art Waffe einzusetzen.« Sie machte eine Pause. »Aber Elfenzauber ist eine eigentümliche Sache. Seine Macht ist nicht immer deutlich erkennbar. Manchmal liegt sie im Dunkeln. So verhielt es sich beim Schwert von Shannara. Shea Ohmsford hat niemals durchschaut, wie ein so kleiner Gegenstand einen so mächtigen Feind wie den Hexenmeister besiegen könnte – bis er den Versuch unternommen hat. Er tat es einfach auf gut Glück in blindem Vertrauen …«
Rone beugte sich mit einem Ruck vor. »Und ich betone noch einmal: Diese Reise ist zu gefährlich. Die Mordgeister sind zu gefährlich. Nicht einmal Allanon kommt gegen sie an; das hat er dir doch selbst bestätigt! Es wäre etwas anderes, wenn du die Elfensteine einsetzen könntest. Die Steine besitzen immerhin die Macht, solche Geschöpfe zu vernichten. Was würdest du mit deinem Wünschlied anfangen, wenn sie dir entgegenträten – sie so ansingen wie den alten Ahorn?«
»Mach dich nicht lustig über mich, Rone.« Brin kniff die Augen zusammen.
Rone schüttelte schnell den Kopf. »Ich mache mich nicht lustig über dich. Mir liegt zu viel an dir, als dass ich das jemals tun könnte. Ich habe nur das Gefühl, das Wünschlied bietet nicht den geringsten Schutz gegen so etwas wie die Mordgeister!«
Brin wandte den Blick ab, starrte durch die gardinenbehangenen Fenster in die Nacht hinaus, beobachtete das dunkle Schwanken der Bäume im Wind und sah zu, wie sie sich rhythmisch und graziös wiegten.
»Ich auch nicht«, gab sie leise zu.
Eine Zeit lang blieben sie schweigend sitzen und hingen ein jeder den eigenen Gedanken nach. Allanons dunkelhäutiges, müdes Gesicht stand vor Brins geistigem Auge wie ein anklagender Geist. »Du musst mich begleiten. Bis zum Morgen wirst du das begreifen.« Sie hörte ihn wieder diese Worte sagen, hörte die Gewissheit, mit der er sie gesprochen hatte. Aber was soll mich überzeugen?, fragte sie sich. Alle Überlegungen schienen sie nur tiefer in die Verwirrung zu stürzen. Die Gründe standen alle sauber aufgereiht, jene, die fürs Gehen, und jene, die fürs Bleiben sprachen, und doch schlug die Waage in keine der beiden Richtungen aus.
»Würdest du ihn begleiten?«, fragte sie Rone plötzlich. »Wenn du das Wünschlied beherrschen würdest?«
»Das fiele mir nicht im Traum ein«, erwiderte er sofort – ein wenig zu schnell, ein wenig zu schnippisch.
Du lügst, Rone, dachte sie bei sich. Du lügst meinetwegen, weil du nicht möchtest, dass ich gehe. Wenn du richtig nachdenkst, kommen dir die gleichen Zweifel wie mir.
»Was ist denn hier los?«, erklang eine müde Stimme aus der Dunkelheit.
Sie drehten sich um und sahen im Flur Jair stehen, der schläfrig ins Licht blinzelte. Er kam herein und blickte von einem zum andern.
»Wir unterhalten uns nur, Jair«, erklärte ihm Brin.
»Über die Suche nach dem Zauberbuch?«
»Ja. Warum gehst du nicht wieder ins Bett?«
»Gehst du denn? Das Buch suchen, meine ich?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wenn sie nur einen Funken Verstand besitzt, geht sie nicht«, grummelte Rone. »Die Reise ist viel zu gefährlich. Sag es ihr, Tiger. Sie ist deine einzige Schwester, und du willst nicht, dass die schwarzen Wandler sie erwischen.«
Brin warf ihm einen verärgerten Blick zu. »Jair hat in dieser Sache nichts zu entscheiden, also jag ihm keine Angst ein.«
»Ihm? Wer will denn ihm Angst einjagen?« Rones schmales Gesicht war gerötet. »Dir versuche ich Angst zu machen, um der Katze willen!«
»Wie dem auch sei, vor den schwarzen Wandlern fürchte ich mich nicht«, erklärte Jair entschieden.
»Na, das solltest du aber besser!«, fuhr Brin ihn an.
Jair zuckte mit den Schultern und gähnte. »Vielleicht solltest du warten, bis wir Gelegenheit haben, mit Vater zu sprechen. Wir könnten ihm eine Nachricht zukommen lassen oder so.«
»Das klingt vernünftig«, stimmte Rone ihm zu. »Warte wenigstens, bis Wil und Eretria die Angelegenheit mit dir besprechen können.«
Brin seufzte. »Ihr habt doch gehört, was Allanon sagt. Dafür bleibt keine Zeit.«
Der Hochländer verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn notwendig, würde er die Zeit aufbringen. Brin, dein Vater sieht das Ganze vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Schließlich hat er schon seine Erfahrungen gemacht – er hat den Elfenzauber benutzt.«
»Brin, er könnte doch die Elfensteine einsetzen!« Jair sah sie mit großen Augen an. »Er könnte dich begleiten. Er könnte dich mit den Elfensteinen beschützen, so wie das Elfenmädchen Amberle!«
In diesem Augenblick wurde Brin alles klar; diese wenigen Worte enthielten die Antwort, nach der sie gesucht hatte. Allanon hatte Recht. Sie musste mit ihm gehen. Doch den eigentlichen Grund dafür hatte sie bislang nicht in Erwägung gezogen. Ihr Vater würde darauf bestehen mitzukommen. Er würde die Elfensteine aus ihrem Versteck holen und Brin begleiten, um sie zu beschützen. Und genau das musste sie verhindern. Ihr Vater wäre gezwungen, sein Gelübde zu brechen, die Elfensteine nie wieder einzusetzen. Wahrscheinlich würde er niemals zustimmen, dass Brin mit Allanon ging. Stattdessen würde er selbst gehen, damit sie, Jair und ihre Mutter in Sicherheit wären.
»Na los, geh wieder ins Bett, Jair«, sagte sie plötzlich.
»Aber ich bin doch eben erst …«
»Geh. Bitte. Wir sprechen morgen früh über alles.«
Jair zögerte. »Und was ist mit dir?«
»Ich bleibe nur noch ein paar Minuten auf, versprochen. Ich möchte noch einen Augenblick allein sein.«
Jair musterte sie kurz misstrauisch, ehe er nickte. »In Ordnung. Gute Nacht.« Er drehte sich um und verschwand wieder in die Dunkelheit. »Aber mach nicht mehr so lange.«
Brins Augen suchten Rones. Sie kannten einander seit frühester Kindheit, und manchmal wusste der eine, was der andere dachte, ohne dass ein Wort gesprochen werden musste. So wie jetzt.
Der Hochländer erhob sich langsam, und sein schlankes Gesicht wirkte ernst. »Also gut, Brin. Mir ist es auch klar. Aber ich komme mit, verstanden? Und ich bleibe bis zum bitteren Ende bei dir.«
Sie nickte langsam. Ohne ein weiteres Wort verschwand er im Flur und ließ sie allein.
Die Minuten verstrichen. Sie überdachte es noch einmal, erwog sorgsam das Für und Wider. Am Ende kam sie zur selben Antwort. Sie durfte nicht zulassen, dass ihr Vater ihretwegen sein Gelübde brach und wieder Gebrauch vom Elfenzauber machte, dem er feierlich entsagt hatte. Sie durfte es nicht zulassen.
Dann stand sie auf, blies die Flamme der Öllampe aus und ging nicht in Richtung ihres Zimmers, sondern zur Haustür. Sie schob den Riegel zurück, öffnete lautlos die Tür und schlüpfte hinaus in die Nacht. Der Wind strich kühl und voller Herbstdüfte über ihr Gesicht. Einen Moment lang blieb sie stehen und starrte in die Dunkelheit, dann ging sie um das Haus in den dahinterliegenden Garten. Nächtliche Geräusche erfüllten die Stille als stete Musik unsichtbaren Lebens. Am Rand des Gartens blieb sie unter einer riesigen Eiche stehen und blickte sich erwartungsvoll um.
Im nächsten Moment erschien Allanon. Irgendwie hatte sie das gewusst. Schwarz wie die Schatten seiner Umgebung schwebte er lautlos zwischen den Bäumen hervor.
»Ich habe mich entschieden«, flüsterte sie mit fester Stimme. »Ich komme mit.«
3
Der Morgen kündigte sich bald mit fahlem Silberlicht an, das durch den Waldnebel vor der Dämmerung drang und die Dunkelheit westwärts vor sich hertrieb. Die Bewohner des Ohmsford-Hauses erwachten aus unruhigem Schlaf und standen auf. Noch in der gleichen Stunde nahm man die Vorbereitungen für Brins Aufbruch ins Ostland in Angriff. Rone wurde zum Gasthaus geschickt, um Pferde, Geschirr, Waffen und Lebensmittelvorräte zu holen. Brin und Jair packten Kleider und Lagerausrüstung zusammen. Eifrig gingen alle ihren Aufgaben nach. Es wurde kaum gesprochen. Niemand hatte viel zu sagen. Niemandem war groß nach Reden zumute.