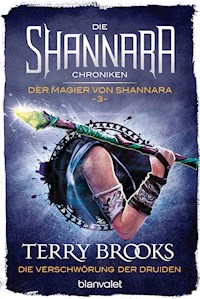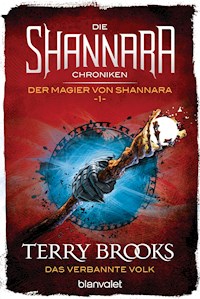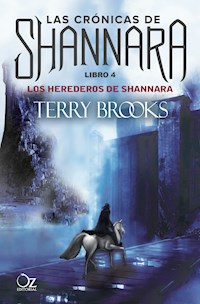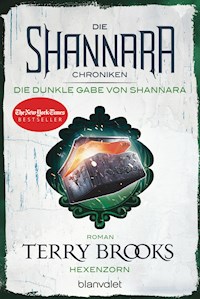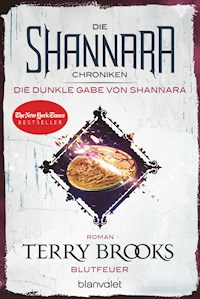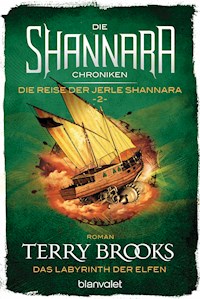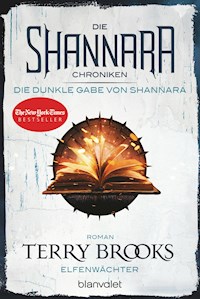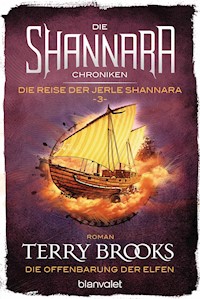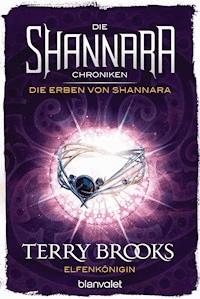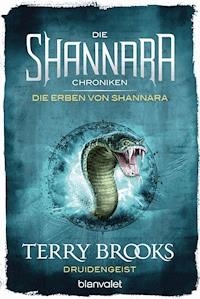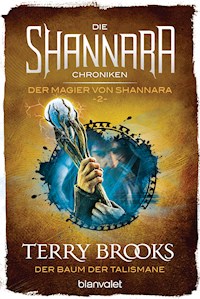
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Shannara-Chroniken: Der Magier von Shannara
- Sprache: Deutsch
Grianne Ohmsford, die Vorsteherin des Druidenrats, sitzt in der Dämonenwelt gefangen, während den Vier Ländern Krieg droht. Alle Hoffnung ruht nun auf ihrem Neffen Pen. Um Grianne zu befreien, muss er den Baum Tanequil finden und aus dessen Holz einen Talisman anfertigen. Doch der Baum befindet sich im Land Inkrim, in das sich bisher niemand wagte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Terry Brooks
Die Shannara-Chroniken
Der Baum der Talismane
Roman
Buch
Die fulminante Fortsetzung des High-Fantasy-Abenteuers! Grianne Ohmsford, die Vorsteherin des Druidenrats, sitzt in der Dämonenwelt gefangen, während den Vier Ländern Krieg droht. Alle Hoffnung ruht nun auf ihrem Neffen Pen. Um sie zu befreien, muss er den Baum Tanequil finden und aus dessen Holz einen Talisman anfertigen. Doch der Baum befindet sich im Land Inkrim, das bisher niemand zu betreten wagte …
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch "Das Schwert von Shannara" war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere, denn bislang sind mehr als zwanzig Bände seiner Shannara-Saga erschienen.
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »High Druid of Shannara, vol. 2: Tanequil« bei Ballantine Books, New York.
Der vorliegende Roman ist bereits 2005 im Goldmann Verlag und im Blanvalet Verlag unter dem Titel „Die Magier von Shannara 2 – Der Baum der Talismane“ erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2004 by Terry Brooks Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München Redaktion: Waltraud Horbas Covergestaltung und Illustration: Max Meinzold
Für den Big Island Book Bunch – Abby, Amanda, Beth, Brian, Eric, Gerard, Judine, Kathy, Kevin, Lloyd, Nan, Paul, Russell, Val and Yvette – die treu dem Glauben sind,
Inhaltsverzeichnis
Eins
Sen Dunsidan, der Premierminister der Föderation, blieb stehen, als er zur Tür seines Schlafzimmers gelangte, und schaute über die Schulter zurück.
Es war niemand da, der nicht hergehört hätte. Seine Leibwache an der Tür, die beiden Posten an den Enden des Flurs – sonst niemand. Hier war nie jemand. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich jeden Abend zu vergewissern. Aufmerksam suchte er den von Fackeln erhellten Gang ab. Schließlich konnte es nicht schaden, sich Sicherheit zu verschaffen. Vorsicht hatte stets ihren Wert.
Er trat ein und schloss leise die Tür hinter sich. Das warme Licht und der süße Duft der Kerzen begrüßten ihn. Er war der mächtigste Mann im Südland, wenn auch nicht der beliebteste. Das hatte ihm nichts ausgemacht, bevor er es mit der Ilse-Hexe zu tun bekommen hatte, doch seitdem verspürte er eine ständige Beunruhigung. Obwohl die Hexe nun endlich verschwunden und in ein Reich des dunklen Wahns und der Blutgier verbannt war, aus dem bisher noch keiner zurückgekehrt war, fühlte er sich nicht sicher.
Einen Augenblick lang stand er da und betrachtete sein Bild in dem riesigen Spiegel an der Wand, dem Bett gegenüber. Eigentlich hatte er den Spiegel dort aus anderen Gründen anbringen lassen: um sich bei Ausschweifungen und Spielen der Lust zu beobachten, die ihm nun so fern erschienen, als hätten sie sich in einem anderen Leben ereignet. Gewiss konnte er diesen Freuden jederzeit wieder frönen, doch würden sie ihm, wie er genau wusste, kein Vergnügen mehr bereiten. Kaum etwas erfüllte ihn heute noch mit Lust. Sein Leben hatte sich zu einer Routine entwickelt, die er teils mit grimmiger Entschlossenheit und teils mit eisernem Willen absolvierte. Jede Handlung, jedes Wort hatte Auswirkungen, die sich weit über den unmittelbaren Moment hinaus erstreckten. Für andere Dinge blieben weder Zeit noch Raum. Eigentlich sah er auch keine Notwendigkeit dafür.
Sein Spiegelbild starrte ihn an, und mit mildem Erschrecken stellte er fest, wie alt er geworden war. Wann war das geschehen? Er stand in der Blüte seiner Jahre, war gesund an Körper und Seele, hatte den Höhepunkt seiner Karriere erreicht, und man konnte ihn durchaus als den wichtigsten Mann der Vier Länder betrachten. Und doch, was war aus ihm geworden? Sein Haar hatte sich fast weiß gefärbt. Sein einst glattes, ansehnliches Gesicht war von Furchen durchzogen und abgehärmt. An manchen Stellen hatten sich die Sorgen in dunklen Flecken niedergeschlagen. Er war leicht gebeugt, früher hingegen hatte er aufrecht gestanden. Selbstvertrauen oder Stärke strahlte er überhaupt nicht mehr aus. Er kam sich vor wie eine leere Hülle, der man das Leben entzogen hatte.
Augenblicklich wandte er sich ab. Die Furcht und der Ekel vor sich selbst waren dafür verantwortlich gewesen. Und vor dem, was der Morgawr ihm in jener Nacht angetan hatte, als dieses Ungeheuer den gefangenen Freien im Föderationsgefängnis das Leben ausgesaugt hatte. Niemals hatte er den Anblick dieser lebenden Toten vergessen können, Kreaturen, deren Existenz über den Willen des Hexenmeisters hinaus keine Bedeutung mehr hatten. Selbst nachdem der Morgawr ausgelöscht worden war, wurde Dunsidan die Erinnerung an diese Nacht nicht los, und der Wahnsinn lauerte nur darauf, dass sich der Premierminister einen Schritt zu weit aus der Sicherheit von Schein und Heuchelei wagte, die seine geistige Gesundheit bewahrten.
Das Amt des Premierministers brachte ihm den Respekt seiner Untertanen ein, doch wurde dieser mittlerweile nicht mehr so willig gewährt wie zu Beginn, als sein Volk große Erwartungen in ihn gesetzt hatte. Diese Hoffnungen lagen längst in der Erde zwischen den Felsen der prekkendorranischen Anhöhe begraben, wo so viele Kämpfer das Leben verloren und ihr Blut vergossen hatten. Die Erwartungen hatten sich verflüchtigt, weil er darin versagt hatte, diesen Krieg zu beenden, der die Vier Länder seit fast drei Jahrzehnten verheerte; weil er sich einer Lösung dieses Konflikts nicht einmal genähert hatte. Die Hoffnungen waren erloschen, weil er daran gescheitert war, das Prestige der Föderation in den Augen jener zu vergrößern, denen das Südland am Herzen lag, und würde er am morgigen Tag sterben, wäre sein Nachlass eine Mischung aus Verbitterung und Enttäuschung.
Er ging zu seinem Bett, setzte sich, griff automatisch nach dem Krug Wein, der auf dem Nachttisch stand, und füllte den Kelch daneben. Anschließend trank er einen großen Schluck und dachte daran, dass er sich zumindest von dieser unerträglichen Grianne Ohmsford befreit hatte. Die verhasste Ilse-Hexe war endlich fort. Mit Shadea a’Ru als Verbündeter, der man allerdings auch nicht trauen durfte, bestand wenigstens die realistische Chance, die Pattsituation zu beenden, an der er in den letzten zwanzig Jahren nichts hatte ändern können. Ihnen gemeinsam war eine Vision über die Zukunft der Welt, eine, in der die Föderation und die Druiden das Schicksal der Rassen lenkten und bestimmten. Zusammen würden sie einen Weg finden, den Krieg der Föderation gegen die Freigeborenen zu beenden und die Vorherrschaft des Südlandes durchzusetzen.
Allerdings hatte sich diese Vision bislang nicht in die Wirklichkeit umsetzen lassen, und nichts deutete darauf hin, dass dies in nächster Zukunft geschehen würde. Shadea hatte es nicht geschafft, den Druidenrat auf ihre Linie zu bringen, und das stimmte ihn besonders ärgerlich. Er fragte sich inzwischen, ob ihr Bündnis nicht sehr einseitig war. Sie konnte aus seiner offenen Unterstützung Vorteil ziehen, er hingegen hatte wenig davon.
Folglich war er gezwungen, ständig Blicke über die Schulter zu werfen, denn der Zweifel ließ nicht nach, und der Widerstand gegen seine Führung wuchs.
Er hatte den Kelch gerade geleert und überlegte, ob er ihn nachfüllen sollte, als es an der Tür klopfte. Unwillkürlich zuckte er zusammen. Früher einmal hätte ihn eher unerwartete Stille erschreckt. Diejenigen, die er am meisten fürchtete, die Ilse-Hexe und der Morgawr, hätten sich nicht die Mühe gemacht anzuklopfen. Nun zurrte jenes leise Pochen die eisernen Bänder um seine Brust und verengte sein Herz. Er ließ sich einen Moment Zeit, bis er ein wenig die Fassung zurückerlangt hatte, erhob sich und stellte den leeren Kelch vorsichtig auf den Tisch neben sich.
»Ja?«
»Verzeiht, Premierminister«, hörte er die Stimme des Hauptmanns seiner Wache. »Ein Besucher möchte ein Wort mit Euch reden, einer Eurer Ingenieure. Er behauptet, es sei dringend, und so wie er aussieht, möchte ich es ihm tatsächlich glauben.« Nach einer kurzen Pause fügte der Mann hinzu: »Er ist unbewaffnet und allein.«
Dunsidan richtete sich auf. Ein Ingenieur? Zu dieser nachtschlafenden Zeit? An seinen Luftschiffen war eine ganze Reihe von Ingenieuren beschäftigt, die an Verbesserungen arbeiteten, um die Flotte effektiver einzusetzen. Selten, wenn überhaupt, suchte einer von ihnen das direkte Gespräch mit ihm, insbesondere zu so nachtschlafender Zeit. Sofort schöpfte er Verdacht, nach einem kurzen Moment der Überlegung kam er jedoch zu der Einsicht, dass ein solches Vorgehen eher auf eine gewisse Verzweiflung hindeutete. Dunsidans Interesse war geweckt. Also schob er seine Vorbehalte zur Seite.
»Herein.«
Der Ingenieur glitt durch die Tür wie ein Frettchen, das sich in seine Höhle verkriecht. Er war ein kleiner Mann, an dem keinerlei äußere Merkmale hervorstachen. Aus seinem Verhalten Sen Dunsidan gegenüber wurde sofort klar, dass er sich auf keinen Fall zu viel herausnehmen würde. »Premierminister«, sagte er, verneigte sich tief und wartete.
»Du möchtest etwas Dringendes mit mir besprechen?«
»Ja, Premierminister. Ich heiße Orek. Etan Orek. Ich arbeite schon seit zwanzig Jahren als Luftschiffingenieur. Ich bin Euer treuester Diener und Bewunderer, Premierminister, und deshalb wusste ich, als ich diese Entdeckung gemacht hatte, dass ich mich geradewegs an Euch wenden muss.«
Er stand gebeugt da und vermied auch nur den Anschein, als würde er sich Sen Dunsidan gegenüber als gleichgestellt betrachten. Sein Benehmen wirkte kriecherisch, und fast beunruhigte das den Premierminister, aber er zwang sich, es zu ignorieren. »Richte dich auf und sieh mich an.«
Etan Orek befolgte den Befehl, obwohl er Sen Dunsidans Blick allen Anstrengungen zum Trotz nicht halten konnte und auf die Gürtelschnalle seines Gegenübers starrte. »Entschuldigt bitte die Störung.«
»Was für eine Entdeckung hast du gemacht, Ingenieur Orek? Ich vermute, es hat mit deiner Arbeit an meinen Luftschiffen zu tun?«
Der Mann nickte rasch. »Oh, ja, Premierminister, genau. Ich hatte mir die Diapsonkristalle vorgenommen und versucht, eine Möglichkeit zu finden, die Leistung der Konverter, die Umgebungslicht in Energie verwandeln, zu erhöhen. Das war in den letzten fünf Jahren meine Aufgabe.«
»Und?«
Orek zögerte. »Mein Herr«, sagte er und wählte diesen noch formelleren und ehrerbietigen Titel, »ich denke, es wäre besser, Euch das Ganze persönlich zu zeigen, als es Euch zu beschreiben. Dann werdet Ihr die Tragweite besser verstehen.« Er strich sich das widerspenstige dunkle Haar aus der Stirn und rieb sich nervös die Hände. »Wäre es zu viel verlangt, wenn ich Euch bitte, mich zu meinem Arbeitsplatz zu begleiten? Ich weiß, die Stunde ist vorgerückt, aber Ihr werdet nicht enttäuscht werden.«
Einen Moment lang bedachte Sen Dunsidan die Möglichkeit, dass es sich um einen Attentatsversuch handeln könnte. Doch drängte er diesen Gedanken beiseite. Seine Feinde würden sicherlich einen besseren Plan haben, falls sie ihn ernsthaft beseitigen wollten. Dieser kleine Mann war zu ängstlich, um den Mord an einem Premierminister durchzuführen. Seine Anwesenheit hatte andere Gründe, und so ungern Sen Dunsidan es zugab, er wollte unbedingt erfahren, worum es sich handelte.
»Du bist dir sicherlich im Klaren darüber, welche unangenehmen Folgen es für dich haben wird, wenn du meine Zeit vergeudest«, sagte er leise.
Etan Orek blickte ihn in einem plötzlichen Anflug von Verwegenheit an. »Ich hoffe eher auf eine Belohnung als auf eine Bestrafung, Premierminister.«
Dunsidan musste ungewollt lächeln. Der kleine Mann war gierig, eine Eigenschaft, die der Premierminister bei jenen begrüßte, die um seine Gunst rangen. Durchaus berechtigt. Er würde ihm die Chance auf Ruhm und Reichtum in Aussicht stellen. »Geh voran, Ingenieur. Zeig mir, was du entdeckt hast.«
Sie verließen das Schlafzimmer und betraten den Korridor. Sen Dunsidans Leibwachen schlossen sich ihnen an und schützten den Rücken des Premierministers gegen Angriffe aus dem Hinterhalt, und allein ihre Gegenwart erfüllte ihn mit neuer Zuversicht. Nie hatte es einen Attentatsversuch gegen ihn gegeben, obwohl er schon einige Komplotte aufgedeckt hatte, die zu einem hätten führen können. Jedes Mal waren die Beteiligten verschwunden, und die Erklärung dafür wurde stets nur im Flüsterton weitererzählt. Die Warnung an alle erreichte ihr Ziel: Wer auch nur laut darüber redete, den Premierminister aus dem Amt zu vertreiben, würde als Verräter betrachtet und entsprechend bestraft werden.
Dennoch wurde Sen Dunsidan nicht so selbstgefällig, um die Möglichkeit eines Attentats auszuschließen. Er wäre ein Narr, dies zu tun angesichts der Ruhelosigkeit seiner Regierung und der Unzufriedenheit seines Volkes. Wenn man ihn mit einem Attentat beseitigte, würden die Verantwortlichen für diese Tat nicht belangt werden. Diejenigen, die seine Stellung im Anschluss daran einnähmen, würden die Meuchler belohnen.
Er ging auf einem schmalen, gewundenen Pfad, und er war sich der Gefahren bewusst. Ein gesundes Maß an Vorsicht hatte deshalb stets seine Berechtigung.
Dennoch hielt er diese Vorsicht in dieser Nacht für überflüssig. Er konnte seinen Entschluss nicht begründen, er wusste lediglich, dass sein Instinkt ihm sagte, er könne darauf verzichten, und sein Instinkt hatte fast immer Recht. Dieser kleine Mann, dem er jetzt folgte, dieser Etan Orek, hatte andere Absichten als die Absetzung des Premierministers. Er hatte sich zu ihm vorgewagt, was sich nur wenige andere getraut hätten, und dazu hatten ihn ganz besondere Pläne getrieben, vermutlich sogar ein besonderes Ziel. Es würde sich durchaus lohnen, beides zu erfahren, auch wenn es erforderlich werden könnte, den Mann im Nachhinein zu töten.
Sie gingen durch die Wohnräume des Premierministers in die Eingangshalle, wo weitere Wachen in ihrer schwarzen Kleidung warteten und mit geradem Rücken ihre im Fackellicht glänzenden Spieße hielten.
»Die Kutsche soll vorfahren«, befahl Sen Dunsidan.
Er stand mit Etan Orek im Eingangsbereich und beobachtete, wie sein Begleiter unruhig von einem Fuß auf den anderen trat und überall hinsah, nur nicht zu seinem Gastgeber. Manchmal machte es den Anschein, er wolle etwas sagen, doch dann überlegte er es sich wohl wieder anders. Auch gut. Worüber sollten sie sich auch unterhalten? Schließlich waren sie keine Freunde. Nach dem heutigen Abend würden sie sich vermutlich niemals wieder unterhalten. Einer von ihnen wäre dann vielleicht sogar tot.
Als die Kutsche in den Hof hinter den eisenbeschlagenen Eingangstüren rollte, wurde Sen Dunsidan der ganzen Sache schon langsam überdrüssig. Es war verhältnismäßig aufwändig, dem Ingenieur seine Bitte zu erfüllen, und eigentlich gab es keinen Anlass zu glauben, die Mühe würde sich lohnen. Aber nun war er schon so weit gegangen, und es hatte keinen Sinn, die Sache fallen zu lassen, ehe er ganz sicher wusste, dass es die Mühe tatsächlich nicht wert war. Im Laufe der Jahre waren ihm schon seltsamere Dinge passiert. Er würde sich in Geduld üben, ehe er sein abschließendes Urteil fällte.
Sie stiegen in die Kutsche, die Wachen nahmen ihre Position auf den Trittbrettern an den Seiten und auf den Bänken vorn und hinten außerhalb des Innenraums ein. Die Pferde schnaubten als Antwort auf die Anweisungen des Kutschers, und das Gefährt setzte sich ruckartig in Bewegung. Das Anwesen war ruhig, nur die Lichter in manchen Fenstern verrieten die Gegenwart der anderen Minister des Koalitionsrats und ihrer Familien. Vor den Mauern waren die Straßen holpriger, scharfe Gerüche drangen ins Innere der Kutsche, und weil hier mehr Menschen lebten, wurde es auch lauter. Über ihnen leuchtete der helle Kreis des Mondes am wolkenlosen Firmament und schien auf Arishaig mit solcher Intensität herab, dass die Stadt klar zu erkennen war.
In Nächten wie diesen, dachte der Premierminister düster, wurde oft Magie angewendet. Man musste einfach nur erkennen, ob es gute oder schlechte Magie war.
Auf dem Landefeld der Luftschiffe am Nordrand der Stadt führte Etan Orek sie zu einem der kleineren Gebäude, einem kastenförmigen Ding, ein wenig abgelegen von den anderen, und gewiss wurden dort keine Fluggefährte untergebracht. Ein Wachposten salutierte. Deutlich verwirrt angesichts des unerwarteten Erscheinens des Premierministers eilte er vor ihnen her und öffnete die Türen des Gebäudes.
Dort angekommen, ging der Ingenieur voraus und deutete auf einen langen Korridor, der von Lampen an jedem Ende kärglich erleuchtet war, während der Bereich dazwischen im Dunkeln lag. Zwei Männer aus Sen Dunsidans Leibwache traten vor und überprüften jede Ecke, an der ein Attentäter lauern könnte, und ihnen dicht auf den Fersen folgte der ungeduldige Etan Orek.
Als sie den zweiten Gang entlanggingen, blieb der Ingenieur auf halbem Wege vor einer kleinen Tür stehen. »Hier herein, Premierminister.«
Er öffnete die Tür und ließ zuerst die Wachen eintreten, deren massige Gestalten sofort im Schatten verschwanden. Sie zündeten Fackeln in Wandhalterungen an, und als Sen Dunsidan hereinkam, war der Raum hell erleuchtet.
Misstrauisch blickte sich der Premierminister um. Der Raum stand voll mit Tischen und Werkbänken, auf denen Arbeitsausrüstung und Materialien lagen. An den Wänden waren Werkzeugregale befestigt, und der Boden war mit Metallresten aller Größen und Formen übersät. Dunsidan sah einige Kisten mit Diapsonkristallen, deren Deckel aufgestemmt waren, und die facettierten Oberflächen der Kristalle glitzerten im Fackellicht. Der Raum machte einen unaufgeräumten Eindruck, als hätte man alles einfach irgendwo abgestellt, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob man es später wiederfinden würde.
Sen Dunsidan sah Etan Orek an. »Nun, Ingenieur Orek?«
»Mein Herr«, erwiderte der andere und trat mit vielen kleinen Verbeugungen an den Premierminister heran – zu nah für dessen Geschmack. »Es wäre besser, wenn Ihr es Euch allein anschaut«, flüsterte er.
Sen Dunsidan neigte sich leicht nach vorn. »Ich soll meine Wachen hinausschicken, meinst du? Verlangst du da nicht ein wenig mehr, als dir zusteht?«
Der kleine Mann nickte. »Ich schwöre Euch, Premierminister, Ihr befindet Euch in absoluter Sicherheit.« Er blickte Sen Dunsidan mit scharfem Blick an. »Ich schwöre es.«
Sen Dunsidan sagte nichts.
»Behaltet sie bei Euch, wenn Ihr es für notwendig erachtet«, fuhr der andere hastig fort und zögerte dann. »Aber möglicherweise müsst Ihr sie hinterher töten lassen.«
Dunsidan starrte ihn an. »Nichts, was du mir zeigen kannst, würde eine solche Behandlung der Männer rechtfertigen, in deren Hände ich täglich mein Leben lege. Du bist anmaßend, Ingenieur.«
Erneut nickte der kleine Mann. »Ich bitte Euch inständig. Schickt sie hinaus. Nur vor die Tür. Damit sie nicht sehen, was ich Euch zeigen muss.« Sein Atem wurde hastiger. »Sie werden in Hörweite sein. Innerhalb eines Augenblicks sind sie wieder bei Euch, falls Ihr das für notwendig haltet. Aber gleichzeitig sind sie in Sicherheit, falls Ihr Euch später meiner Meinung anschließt.«
Einen Moment lang sah Sen Dunsidan seinem Gegenüber fest in die Augen, ohne ein Wort zu sagen, dann nickte er. »Wie du wünschst, kleiner Mann. Aber lass dich nicht zu der Annahme verleiten, ich könnte mich nicht verteidigen, falls du ein falsches Spiel mit mir treibst. Selbst wenn ich nur den Verdacht habe, du wolltest mich verraten, wirst du innerhalb eines Augenschlags tot sein.«
Etan Orek nickte. Seine Augen glitzerten vor Angst und Vorfreude. Worum es sich auch handelte, diese Angelegenheit war ihm wichtig. Er war bereit, alles zu riskieren. Solche Leidenschaft beunruhigte Sen Dunsidan. »Wachen«, rief er, »lasst uns allein. Schließt die Tür. Wartet draußen, bis ich euch rufe.«
Die Wachen befolgten den Befehl. Früher hätten sie gezögert, der Aufforderung nachzukommen. Heute, nachdem sie die unangenehmen Konsequenzen solchen Zögerns mehrmals überlebt hatten, gehorchten sie, ohne Fragen zu stellen. So gefiel es Sen Dunsidan.
Als die Tür geschlossen war, wandte er sich wieder Etan Orek zu. »Es wäre gut, wenn diese Sache wirklich meine Zeit wert ist, Ingenieur. Ich bin langsam mit meiner Geduld am Ende.«
Der kleine Mann nickte energisch und fuhr sich mit der Hand durch das dunkle Haar, während er zur anderen Seite des Raums zu einem langen Tisch vorausging, der mit seltsamen Trümmern überhäuft war. Er grinste verschwörerisch und begann, den Tisch abzuräumen, wobei eine lange schwarze Kiste zum Vorschein kam, die in drei verschiedene Bereiche unterteilt war.
»Ich habe meine Arbeit vor allen anderen geheim gehalten«, erklärte er rasch, »da ich befürchtete, sie könnte gestohlen werden. Oder schlimmer noch, an den Feind verkauft werden. Man weiß ja nie.«
Er hatte jetzt alles außer der Kiste vom Tisch geräumt und blickte Sen Dunsidan wieder an. »In den letzten drei Jahren hatte ich die Aufgabe, neue und bessere Methoden zu entwickeln, Umgebungslicht in Energie zu verwandeln. Das Ziel besteht darin, wie Ihr sicherlich wisst, die Schubkraft der Schiffe unter Kampfbedingungen zu erhöhen, damit sie ihre Gegner besser ausmanövrieren können. Meine Bemühungen, einzelne Kristalle zu verbessern, sind gescheitert. Die Umwandlung hängt von der Zusammensetzung des Kristalls ab, von seiner Form und seinem Platz in der Trennröhre. Ein einzelner Kristall hat eine begrenzte Kapazität, Licht in Energie zu verwandeln, und ich habe trotz aller Bemühungen keine Möglichkeit entdeckt, daran etwas zu ändern.«
Er nickte, als wolle er sich selbst in dieser Ansicht bestätigen. »Aus dem Grund habe ich diesen Ansatz fallen lassen und mich Experimenten mit mehreren Kristallen zugewendet. Versteht Ihr, Premierminister, meine Überlegung ging in folgende Richtung: Wenn ein einzelner Kristall eine bestimmte Energiemenge produziert, dann könnten zwei theoretisch diese Kapazität verdoppeln. Der Trick war natürlich, wie man das Umgebungslicht von einem Kristall zum anderen leitet, ohne Energie zu verlieren.«
Plötzlich interessiert nickte Sen Dunsidan. Nun glaubte er zu verstehen, warum Etan Orek so erpicht darauf gewesen war, ihn hierher zu führen. Irgendwie hatte der Ingenieur das Problem gelöst, unter dem die Föderation seit Jahren litt. Er hatte ein Verfahren entdeckt, mit dem sich die Energieausbeute der Diapsonkristalle in den Luftschiffen erhöhen ließ.
»Zunächst«, fuhr sein Gegenüber fort, »scheiterten all meine Versuche. Als ich eine Möglichkeit fand, wie die Facetten die umgewandelte Energie zu einem weiteren Kristall leiteten, explodierte dieser einfach in der Röhre. Die zusätzliche Energie war zu stark für sie. Also begann ich mit Kombinationen aus mehr als zwei Kristallen zu arbeiten, um eine Alternative zu finden, die Energie nicht so direkt und möglichst ohne Schaden weiterzuleiten.«
»Hast du Erfolg gehabt?« Sen Dunsidan konnte sich nicht mehr beherrschen. Dass Etan Orek seine Geschichte dermaßen in die Länge zog, ermüdete ihn. »Hast du eine Möglichkeit gefunden, die Schubkraft zu erhöhen?«
Der kleine Mann schüttelte den Kopf und lächelte. »Ich habe etwas anderes entdeckt. Etwas viel Besseres.«
Er ging hinüber zu den Fackeln und löschte sie eine nach der anderen, bis nur noch die beiden an der Tür brannten. Dann trat er zu der Kiste, öffnete die Klappe und enthüllte eine Reihe von Diapsonkristallen in verschiedener Größe und Form, die mithilfe von Metallhalterungen in den Fächern der Kiste angebracht waren. Die Kristalle waren der Größe nach in einer Reihe angeordnet, und jeder war mit einem entsprechend geformten Schild vorn und hinten abgeschirmt. Schmale Stäbe zogen sich wie Spinnweben durch die verschiedenen Kammern und verbanden alle Schilde miteinander.
Orek trat zur Seite, damit Sen Dunsidan ins Innere sehen konnte. Der Premierminister blickte hinein, begriff jedoch den Sinn der Installation nicht. »Dafür hast du mich hergeholt?«, fauchte er.
»Nein, Premierminister«, entgegnete der kleine Mann. »Ihr solltet Euch das hier anschauen.«
Er zeigte zur anderen Seite des Raumes, wo eine schwere metallene Panzerplatte an der Wand angebracht war. Dann deutete er wieder auf die hintere Seite der Kiste, wo dunkles Segeltuch einen Gegenstand bedeckte, den Sen Dunsidan übersehen hatte.
Etan Orek lächelte. »Schaut her, mein Herr.«
Er zog das Segeltuch zur Seite und enthüllte einen Diapsonkristall, der wie eine Pyramide mit vielen Facetten aussah. In dem Augenblick, in dem das Tuch entfernt wurde, begann die Pyramide schwach orange zu glühen. »Seht Ihr?«, drängte Orek. »Sie sammelt das Umgebungslicht. Jetzt schaut hin!«
Sekunden später packte der Ingenieur die Stäbe zwischen den Stäben und zog die miteinander verbundenen Schilde zur Seite.
Sofort strahlte das Licht aus der Pyramide von einem Kristall in der Kiste zum anderen und erfüllte sie alle mit dem gleichen orangefarbenen Glühen. Rasch wanderte das Licht von Kristall zu Kristall durch die Kiste und gewann an Stärke.
Mit einer hörbaren Explosion schoss das Licht durch eine schmale Öffnung an der Vorderseite der Kiste und traf als schmaler Feuerstrahl die Panzerplatte auf der gegenüberliegenden Seite des Raums. Das Metall warf Funken und Flämmchen und begann zu schmelzen, und das gebündelte Licht brannte ein faustgroßes Loch in die Platte und in die Wand dahinter.
Schnell zog Etan Orek an einer Stange, die an der Halterung des hinteren Kristalls befestigt war, und nahm diesen aus der Anordnung. Sofort verloren die anderen Kristalle ihre Kraft, und ihr Licht verlosch. Der Ingenieur wartete einen Moment, dann schob er die verbundenen Schilde wieder hinein und deckte den letzten Kristall mit Segeltuch ab.
Er wandte sich Sen Dunsidan zu, und der schockierte Ausdruck auf dem Gesicht des Premierministers entging ihm nicht. »Versteht Ihr nun?«, fragte er. »Versteht Ihr, was das ist?«
»Eine Waffe«, flüsterte Dunsidan und konnte nicht ganz glauben, was er gerade mit eigenen Augen gesehen hatte. Das Metall glühte rot und rauchte. Während er es anstarrte, stellte er sich ein Luftschiff der Freien vor, das von einem solchen Strahl getroffen wurde. »Eine Waffe«, sagte er erneut.
Etan Orek trat näher heran. »Ich habe niemandem davon erzählt. Nur Euch, mein Herr. Ich wusste, so wäre es Euch gewiss lieber.«
Sen Dunsidan nickte nur und erlangte die Fassung zurück. »Das hast du richtig gemacht. Dafür wirst du die angemessene Belohnung erhalten.« Er sah den Ingenieur an. »Wie viele dieser Waffen haben wir?«
Der Ingenieur setzte eine schmerzliche Miene auf. »Nur diese eine, Premierminister. Bisher war ich nicht in der Lage, eine zweite zu bauen. Es dauert seine Zeit, bis man die richtigen Winkel und Brechungen berechnet hat. Keine zwei Kristalle sind exakt gleich, und jede dieser Kisten ist ein Einzelstück.«
Er hielt inne. »Aber eine ist schon mehr, als wir brauchen. Denkt nur. Um die Kristalle in dieser Kiste zu speisen, habe ich nur das Licht der Fackeln an der Tür benutzt, eine schwache Quelle. Stellt Euch die Energie vor, die Euch zur Verfügung steht, wenn die Kristalle dem hellen Sonnenlicht ausgesetzt werden! Bedenkt die Reichweite und den Schussbereich. Ist es Euch aufgefallen? Das Licht verbrennt die Öffnung der Kiste nicht. Das liegt daran, dass sie mit Glas versiegelt ist, und das Licht schmilzt das Glas nicht so wie das Metall. Das Glas wird zwar heiß, jedoch nicht zerstört. Wir können die Stärke unserer Waffe dementsprechend kontrollieren.«
Sen Dunsidan hörte kaum zu, seine Gedanken schwirrten von der Bedeutung dieser Entdeckung zu den enormen Möglichkeiten, die sie barg, bis hin zu der Gewissheit, die er auf einmal spürte, dass er mit einem verwegenen Streich den Lauf der Geschichte ändern könnte. Er atmete schwer, und er musste sich alle Mühe geben, um sich so weit zu beruhigen, dass er seine vordringlichste Sorge zur Sprache bringen konnte.
»Du wirst mit niemandem darüber sprechen, Etan Orek«, befahl er dem Ingenieur. »Ich werde dir einen Raum und ausreichend Material sowie eine Wache zur Verfügung stellen, damit du deine Arbeit ungestört fortsetzen kannst. Falls du Hilfe brauchst, wirst du sie erhalten. Über deine Fortschritte wirst du mir Bericht erstatten, und zwar nur mir. Deine Vorgesetzten werden darüber informiert, dass du zu einem persönlichen Projekt abkommandiert wurdest. Du wirst mir so viele dieser Waffen bauen wie möglich. Und zwar schnell. Wenn du nur eine schaffst, muss die eben reichen. Aber weitere wären äußerst wünschenswert, und damit würdest du noch höher in meiner Gunst stehen.«
Er legte dem Ingenieur die Hand auf die schmale Schulter. »In dir sehe ich Größe. Ich sehe ein Leben in Ruhm und Reichtum. Ich sehe eine verantwortungsvolle Position, die Verwirklichung all dessen, wovon du geträumt hast. Glaube mir, die Wichtigkeit dessen, was du vollbracht hast, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.«
Etan Orek errötete tatsächlich. »Ich danke Euch, Premierminister. Vielen, vielen Dank!«
Sen Dunsidan klopfte ihm bestärkend auf die Schulter und verließ den Raum. Seine Wachen schlossen sich ihm an, als er vorbeiging. Zwei ließ er vor der Tür der Werkstatt stehen, mit dem strikten Befehl, niemanden außer ihm selbst ein- oder hinauszulassen. Der Ingenieur musste hinter Schloss und Riegel bleiben. Die Mahlzeiten würde er in der Werkstatt einnehmen, und er musste auch dort schlafen. Jeden Tag, wenn alle anderen schon nach Hause gegangen waren, durfte er für eine Stunde nach draußen, aber zu keiner anderen Zeit.
Zwei
Der erste Silberhauch der Dämmerung kroch über den Horizont im Osten, als Shadea a’Ru das leise Klingeln des Glöckchens hörte. Sie war bereits wach und saß an ihrem Schreibtisch in den Gemächern der Ard Rhys des Druidenrates, jener Unterkunft, die einst Grianne Ohmsford bewohnt hatte. Wach war sie schon, weil sie nicht hatte schlafen können, da sie sich ständig mit ihren Plänen für den Orden beschäftigte und sich Sorgen über ihre mangelnden Fähigkeiten machte, sie in die Wirklichkeit umzusetzen.
Das Ausbleiben des Erfolgs war nicht so unerwartet. Obwohl die Ilse-Hexe bei den Druiden allgemein unbeliebt gewesen war, wurde Shadea nicht viel besser gelitten. Sie hatte fast ebenso viele Angehörige des Ordens verschreckt wie ihre Vorgängerin, da sie, um ihre Stellung zu erringen, Maßnahmen ergriffen hatte, die nicht bei allen ihre Popularität erhöht hatte. Subtilere Mittel hätten vermutlich eine bessere Wirkung gehabt. Nun bedurfte es ihrer gesamten Überredungskunst, um ihre Gefolgsleute davon zu überzeugen, dass sie sich gewandelt hatte und von jetzt an die verständnisvolle, engagierte Anführerin sei, nach der sie sich in ihrer Dummheit alle sehnten.
In der Zwischenzeit erlahmte der Orden. Das Amt der Hohen Druidin hatte sie sich durch die Hilfe ihrer Verbündeten gesichert, allen voran Traunt Rowan und Pyson Wence, die sich beide besser auf Diplomatie verstanden als sie und die unermüdlich arbeiteten, um so viele Druiden wie möglich auf ihre Seite zu ziehen. Dennoch blieb die Effektivität des Druidenrates beschränkt, und er wirkte kaum beeindruckender oder bedrohlicher als zu Zeiten von Grianne Ohmsford. Da die Nationen und ihre Regierungen den Orden weiterhin mit Misstrauen und Abscheu betrachteten, ließ sich niemand dazu herab, die Stellung der Druiden in den Vier Ländern neu zu überdenken. Die einzige Ausnahme bildete die Föderation – allerdings auch nur deshalb, weil Shadea Sen Dunsidan schon früh zu ihrem Verbündeten gemacht und ihm versprochen hatte, ihm den Rücken zu stärken, damit er den Krieg auf der prekkendorranischen Anhöhe zu seinen Gunsten beenden konnte. Doch sogar der Premierminister ließ sich in letzter Zeit nur selten sehen, er hatte sich nach Arishaig zurückgezogen, und der Kontakt war beinahe vollständig abgebrochen, seit er ihr versprochen hatte, sie in ihrem Amt der Ard Rhys zu unterstützen.
Das allerdings sah einem Charakter wie Sen Dunsidan ähnlich. Als Anführer des Koalitionsrates hatte er sich schon immer durch Manipulationen hinter den Kulissen und durch umsichtige Abwesenheit vor Ort hervorgetan. Lange hatte er sich nach seiner Stellung gesehnt; das war kein Geheimnis. Er hatte sie erlangt, da seine Rivalen auf mysteriöse Weise beide am gleichen Tag gestorben waren, ein Zufall, den man unmöglich übersehen konnte. Hatte er früher oft im Glanz der Öffentlichkeit gestanden, so trat er inzwischen nur mehr selten auf; genau genommen lediglich dann, wenn es unvermeidlich war. Seine durchtriebene und herablassende Art hatte sie mehr als einmal erleben müssen. Dennoch schien er inzwischen unsicherer geworden zu sein. Vermutlich, so glaubte sie, höhlten seine finsteren Geheimnisse das einst so unerschütterliche Selbstvertrauen aus.
Trotzdem war er ein wertvoller Verbündeter. Auch wenn er sich in Arishaig versteckte, spielte das keine Rolle, solange seine Unterstützung für sie offen erkennbar war. Der Trick bestand darin, ihn irgendwie dazu zu bringen, ihr eine Gefälligkeit zu erweisen.
Im Augenblick jedoch musste sie sich zunächst um das kümmern, was das Glöckchen angekündigt hatte. Sie erhob sich von ihrem Schreibtisch und ging zu dem Erkerfenster, das nach Norden lag. Auf dem Sims vor dem Rahmen hatte sie eine Plattform für die Drahtkörbe ihrer Briefvögel angebracht, die gleiche Art im Übrigen, die früher Grianne Ohmsford benutzt hatte. Das Glöckchen verriet ihr, dass der Bote, auf den sie wartete, endlich zurückgekehrt war.
Sie öffnete das Fenster und spähte in den Korb. Der Pfeilsegler mit seinem wilden, dunklen Gesicht starrte sie ebenfalls an, die schlanken Flügel hatte er entlang des schmalen Körpers eingefaltet, und an das rechte Bein war ein winziges Röhrchen mit einer Nachricht gebunden. Sie griff in den Käfig, streichelte den Vogel und sprach beruhigend auf ihn ein. Die Vögel wurden auf ihren Besitzer geprägt und blieben diesem ein Leben lang treu. Deshalb hatte sie die Vögel ihrer Vorgängerin töten müssen, da sie für sie selbst nutzlos waren. Die Treue dieser Tiere war legendär, und wie andere Geschöpfe, die in Einehe lebten, würden sie einen neuen Herrn nie akzeptieren.
Kurz darauf nahm sie dem Segler das Röhrchen vom Bein und ging zum Licht. Sie zog die Kappe ab und holte ein winziges Stück Papier hervor, das sie vorsichtig entrollte.
Die vertraute Blockschrift bestätigte ihr, was sie schon seit Tagen vermutete:
GALAPHILE ZERSTÖRT. TEREK MOLT UND AHREN ELESSEDIL TOT. ICH SPÜRE DEN JUNGEN AUF.
Das Scrye-Wasser hatte ihnen längst die Zerstörung der Galaphile verraten, und sie hatte deshalb ebenfalls angenommen, Terek Molt sei tot, vor allem da sie seitdem keine Nachricht von ihm erhalten hatte. Dass Ahren Elessedil tot war, stellte die erste gute Neuigkeit in dieser Angelegenheit dar. Sie war überaus zufrieden, Grianne Ohmsfords mächtigsten Verbündeten aus dem Weg geräumt zu haben.
Ich spüre den Jungen auf.
Bei diesen Worten überlief sie ein Schauder der Erregung. Aphasia Wye jagte weiterhin Penderrin Ohmsford. Das Schicksal des Jungen war besiegelt. Wenn Aphasia sich einmal auf die Jagd gemacht hatte, gab es kein Entrinnen mehr vor ihm. Sein Erfolg war lediglich eine Frage der Zeit. Sie hatte befürchtet, der Meuchelmörder sei in dem Brand umgekommen, der die Galaphile zerstörte, und nach einigen Tagen ohne Kontakt hatte sie den Pfeilsegler ausgeschickt, um ihn zu suchen. Für sie spielte es keine Rolle, wie er überlebt hatte, nur die Tatsache an sich war von Belang.
Sie trug die winzige Nachricht zu ihrem Schreibtisch und hielt sie an die Flamme der Kerze. Das Papier wurde schwarz, rollte sich auf und verwandelte sich in Asche. Die verkohlten Überreste brachte sie zum Fenster, blies den Staub hinaus und schaute zu, wie der vom Winde verweht wurde.
Aphasia Wye.
Entdeckt hatte sie ihn, den Ausgestoßenen, der ein zurückgezogenes Leben am Rande eines heruntergekommenen, belebten Viertels von Dechtera führte, durch einen Zufall. Sie absolvierte ihr letztes Jahr im Dienste der Föderation und war eine große starke Frau mit wenig Angst und glühendem Ehrgeiz. Auf Aphasia Wye stieß sie, während sie auf der Suche war nach einem bestimmten Deserteur aus der Armee, einem Mann, den sie gut genug kannte, um ihn zu verabscheuen, und dem sie unter anderen Umständen aus dem Weg gegangen wäre. Aber da das Gerücht kursierte, dieser Mann sei in den Randgebieten der Stadt aufgetaucht, sollte sie ihn auftreiben und zurückbringen. In dieser Angelegenheit ließ man ihr keine Wahl.
Aphasia Wye hatte ihn allerdings zuerst aufgestöbert. Er war ein Straßenkind unbekannter Herkunft, der in den düsteren Gegenden von Dechtera als Legende galt. Irgendwann in seinem jungen Leben war er fürchterlich entstellt worden, doch schon zuvor hatte man ihn so schwer misshandelt, dass der Schaden an seinem Körper dem an seiner Seele noch nicht einmal annähernd gleichkam. Gefühlsmäßig und seelisch hauste er in einem Reich, das nur wenige andere je betreten, düster und seelenlos und bar aller Emotionen. Falls es in seinem Leben ein Leitmotiv gab, dann hatte Shadea niemals herausgefunden, worum es sich handelte. Jedenfalls beinhaltete es Töten als rituelle Reinigung, wie sie erfuhr, während sie nach dem Deserteur suchte. Wie weltfremd und launenhaft er war, wurde Shadea klar, als sie die unerwartete Verbindung entdeckte, die Aphasia zwischen ihnen beiden zu spüren schien.
Dass er sie so sehr anzog, mochte mit dem persönlichen Hintergrund zu tun haben, der bei ihnen beiden ähnlich war, da beide als Waisen und Straßenkinder aufgewachsen waren, als Ausgestoßene, die gezwungen waren, ihren Weg durch die Welt auf eigene Faust zu finden. Ebenso akzeptierten sie beide Gewalt als Mittel zum Überleben. Als sie erfuhr, was er dem Deserteur angetan hatte, fragte sie lediglich, ob sie ein Körperteil des Mannes bekommen könne, um seinen Tod beweisen zu können. Sie verlangte keine Erklärung der näheren Umstände. Auch lobte oder missbilligte sie die Tat nicht. Dieses Verhalten hatte ihn möglicherweise beeindruckt.
Vielleicht hatte er auch bemerkt, wie sehr sie sich von ihm angezogen fühlte, wie eigenartig attraktiv sie seine Entstellungen fand, sowohl die äußeren als auch die inneren, da sie dachte, ein solches Leid zu überleben beweise die Widerstandskraft und den Wert einer Person. Dass er widerwärtig anzuschauen war mit seinen krummen, spinnenähnlichen Gliedmaßen machte ihr nichts aus. Gleiches galt für seine Neigung, seine Opfer zu verstümmeln und auszuweiden, was vielleicht auf einen Mangel an Selbstwertgefühl hindeutete. In der Welt der Föderationsarmee zählten die Stärke von Herz und Körper mehr als Charakter und äußere Erscheinung. Beurteilungen beruhten eher auf Ersterem und selten auf Letzterem. Sie bewunderte Aphasia Wye für seine Talente und kümmerte sich nicht um die Verpackung. Töten war eine Kunst, und dieser Mann, diese seltsame Kreatur der Straßen und der Dunkelheit, hatte sie zu einer besonderen Form erhoben.
Im Anschluss daran besuchte sie ihn regelmäßig, redete mit ihm über Tod und Sterben, über Töten und Überleben, und ihre Unterhaltungen bestätigten ihr immer wieder, dass sie sich ähnlicher waren, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mochte. Er sprach in kurzen, stockenden Sätzen, seine Stimme klang wie zermahlenes Glas und trockenes Laub, und stets schwang Verbitterung darin mit. Er hatte keine Zeit, um Worte mit den meisten Menschen zu wechseln, doch bei ihr machte er gern eine Ausnahme. Das sagte er zwar nicht, aber sie spürte es. Ihm mangelte es an Freunden, an einem Zuhause, an allem, was eine normale Existenz ausmachte, und so hauste er am Rande der Zivilisation wie ein Nagetier in einer Müllgrube.
Zuerst konnte sie nichts über sein Leben herausfinden. Womit verdiente er seinen Lebensunterhalt? Wie verbrachte er seine Zeit? Diese Dinge gab er nicht preis, und sie war schlau genug, nicht in ihn zu dringen. Erst nachdem er ihrer sicher war, als er die Verbindung zwischen ihnen für stark genug hielt, erzählte er ihr davon. Er war eine Waffe für diejenigen, die eine brauchten und sie bezahlen konnten. Er war ein tödliches Gift, niemand, den er berührte, überlebte diesen Moment. Die ihn benötigten, fanden ihn, indem sie es auf der Straße verbreiteten. Er ging zu ihnen, wenn er sich dafür entschied; niemandem wurde gestattet, ihn aufzusuchen.
Er war ein gedungener Mörder, auch wenn er sich selbst nicht so bezeichnete.
Zwei Jahre später, als sie sich entschieden hatte, die Föderation zu verlassen und ihren Ambitionen anderswo nachzugehen, wurde sie von einigen Männern betäubt und geschändet, weil man ein Exempel an ihr statuieren wollte. Da man dachte, sie sei tot, ließ man sie zurück, doch sie erholte sich, spürte die Männer auf und tötete sie alle einen nach dem anderen. Aphasia Wye half ihr bei der Suche und überließ ihr selbst das Vergnügen, die Kerle langsam sterben zu lassen. Danach floh sie aus Dechtera und dem Südland in die schützende Isolation von Grimpen Ward und dem Wilderun. Tief im Westland führte sie ihre Studien der Magie fort und bereitete ihre Reise nach Paranor vor, wo sie Druidin werden wollte.
Zwei Monate nach ihrer Ankunft in Grimpen Ward tauchte Aphasia Wye ebenfalls dort auf. Wie er sie fand, blieb ihr ein Rätsel, und es spielte keine Rolle. Denn sie freute sich, ihn zu sehen. Er war ihr gefolgt, sagte er, weil er wissen wollte, was sie tun würde. Das war eigenartig ausgedrückt, doch sie verstand. Er wollte teilhaben an der Gewalt und dem Umbruch, mit denen sie sich vermutlich beschäftigen würde. Er verstand sie genauso gut wie sie sich selbst. In ihrem Leben würde es immer Tote geben, gleichgültig, wohin sie ginge oder was sie täte. Das lag in ihrer Natur. Und in seiner ebenfalls.
Er wohnte nicht bei ihr und auch nicht in der Nähe, was vielleicht ihre Beziehung verraten hätte. Stattdessen hielt er sich in den Randbereichen ihres Lebens und tauchte nur auf, wenn sie das Wort umgehen ließ, dass sie ihn suchte, oder wenn er spürte, dass sie ihn brauchte, wozu er durchaus fähig war. Als sie Iridia kennen lernte, war Aphasia Wye die erste Person, die sie der Elfenzauberin vorstellte. Es handelte sich um eine Art Prüfung. Wenn sich Iridia von Wye schockieren ließe, würde sie in schwierigeren Situationen kaum von Nutzen sein. Iridia schenkte dem Meuchelmörder nicht einmal einen zweiten Blick. Sie war aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Shadea und wurde von der gleichen unbarmherzigen Gier getrieben.
So lebten die drei in Grimpen Ward, bis Shadea mit Iridia ostwärts nach Paranor zog. Aphasia Wye ließen sie zurück, um ihre Vorstellung beim Druidenrat nicht noch komplizierter zu machen. Später, als sie fest aufgenommen worden war und sie Wye brauchte, schickte sie nach ihm. Die anderen, die sich ihrer Verschwörung gegen die Ard Rhys angeschlossen hatten – Terek Molt, Pyson Wence und Traunt Rowan – lehnten ihren gefährlichen Freund instinktiv ab und misstrauten ihm. Molt nannte ihn von Anfang an ein Ungeheuer. Wence fand sogar eine schlimmere Bezeichnung für ihn. Rowan, der während seiner Zeit im Südland von ihm gehört hatte, behielt seine Meinung für sich. Aber wenn der Name Aphasia Wye in seiner Gegenwart fiel, verriet er seine Auffassung stets durch seine Miene.
Alles in allem erfüllte es Shadea a’Ru mit Freude, die Beunruhigung ihrer Mitverschwörer über diesen Mann zu sehen, der nur ihr gehorchte.
Sie wandte sich vom Fenster ihres Schlafzimmers ab und trat an den Schreibtisch. Es gab vieles, was sie nicht über Aphasia Wye wusste. Eigentlich erregte er manchmal auch ihr Unbehagen. Er wirkte oft wie ein Wesen, das unter den Menschen stand, so primitiv, so unvereinbar mit der menschlichen Natur. Es war eine Gabe, so zu sein, und sie zog Nutzen daraus, wenn sie in eine schwierige Situation geriet. Gnadenlos und unerbittlich, wie er war, verfehlte er nie sein Ziel. Sie hätte ihn auch gegen die Ard Rhys eingesetzt, hätte sie nicht geglaubt, Grianne Ohmsford sei ihm überlegen, die einzige Person außer ihr selbst, die sich mit ihm messen konnte.
Aber was den Jungen betraf …
Sie beugte sich vor und blies die Kerzen aus.
Spät am Tage, als die Pflichten verteilt und die Angehörigen des Druidenrates in ihre Unterkünfte entlassen worden waren, erschienen Traunt Rowan und Pyson Wence vor ihrer Tür. Am Morgen hatte sie die beiden von Aphasia Wyes Nachricht in Kenntnis gesetzt, und seitdem hatte sie ihre Verbündeten nicht mehr gesehen. Auf die Neuigkeit hatten sie verhalten reagiert – vielleicht machte sich angesichts der unangenehmen Aufgabe, den Jungen zu fangen, langsam Resignation breit; vielleicht betrachteten sie die ganze Angelegenheit als vergebliche Mühe. Keiner hatte ihr seine Unterstützung aufgedrängt. Sie schienen zu glauben, es genüge, Grianne Ohmsford zu beseitigen, und nach ihrem Verschwinden würden paradiesische Zustände anbrechen. In ihnen brennt das alte Feuer nicht mehr, dachte sie, die Leidenschaft, aus der heraus sie sich mir angeschlossen haben. Doch deswegen machte sie sich keine Sorgen. Sie fühlten sich weiterhin verpflichtet, das zu tun, was notwendig war, und würden nicht in sinnloser Wut einfach verschwinden wie Iridia.
Außerdem schmiedete sie längst Pläne, wie sie die alten Verbündeten durch neue ersetzen konnte.
»Wir haben eine Nachricht erhalten«, begann Traunt Rowan, nachdem er die Tür geschlossen hatte. »Wir haben die Eltern des Jungen gefunden.«
Hochstimmung erfüllte sie. Endlich fügte sich eins zum anderen. Sobald sie die Eltern unter Kontrolle hatten, konnten sie sich zurücklehnen. Niemand sonst würde das Verschwinden der Ard Rhys weiter untersuchen, niemand würde sich genug dafür interessieren, um sich für diese Aufgabe einspannen zu lassen. Kermadec oder Tagwen waren dort draußen vielleicht noch unterwegs, aber sie verfügten nicht über eine Magie, die mit jener von Bek Ohmsford vergleichbar war. Er als Einziger stellte eine Gefahr für sie dar.
»Wo?«, fragte sie.
»Im Ostland. Wir haben das Gebiet durchforstet, seit Molt herausbekommen hat, dass die Eltern des Jungen auf einer Expedition am Anar unterwegs sind. Aber bis vor einer Woche hatte niemand etwas von ihnen gehört. Dann hat ein Händler an der Route zum Jadepass in den Ausläufern von Darklin Reach seine Waren an einen Mann und eine Frau auf einem Luftschiff namens Schnell und Sicher verkauft. Das sind die Gesuchten.«
»Vor einer Woche?« Shadea runzelte die Stirn.
»Ja, aber jetzt kommt’s«, mischte sich Pyson Wence eifrig ein. »Wir haben sie die ganze Zeit im Wolfsktaag-Gebirge gesucht, weil wir glaubten, dort liege ihr Ziel. Nur sind sie dort gar nicht gewesen! Sie haben das Rabenhorn erkundet, weiter östlich und tief im Anar, und deshalb hat sie keine Nachricht von unserer Suche erreicht. Wir haben Glück, Shadea, dass sie noch immer keine Ahnung haben, was ihrem Sohn zugestoßen ist, sonst hätten wir sie ganz sicher verloren.«
»Haben sie inzwischen etwas erfahren?«
Wence schüttelte den Kopf. »Nichts. Das haben wir durch Zufall entdeckt, denn unsere Spione haben herumgefragt, bis sie den Händler fanden. Der allerdings wusste nicht, wie wichtig seine Auskunft für uns ist, und gab sie bereitwillig preis. Jetzt kennen wir also ihren Aufenthaltsort. Was sollen wir tun?«
Sie ging zum Fenster, stand da, schaute hinaus und dachte nach. Vorsicht war geboten; anders als der Junge verfügte Bek Ohmsford über genug Magie, um jeden umzubringen, der ihm einen Grund dafür lieferte. Ihn würde man nicht so leicht beseitigen. Um die Sache richtig anzugehen, musste man ihn nach Paranor locken.
Dann drehte sie sich wieder zu ihnen um und deutete auf Traunt Rowan. »Nimm die Athabasca und fliege nach Osten. Such unsere Spione auf, und sammle alles an Informationen, was du finden kannst. Dann stöberst du die Eltern des Jungen auf.«
»Soll ich sie für dich töten?«, fragte Traunt Rowan, wobei es ihm nicht ganz gelang, den Abscheu vor dieser Aufgabe in seiner Stimme zu verbergen.
Sie trat dicht an ihn heran. »Fehlt dir der Mut dazu, Traunt? Bist du zu schwach, um diese Sache zu erledigen?«
Schweigend sahen sie sich einen Moment lang in die Augen. Immerhin blickte er nicht zur Seite. Er mochte hin und her gerissen sein, aber auch entschlossen.
»Ich habe nie geheuchelt, dass ich dich und deine Pläne unterstütze, Shadea«, sagte er vorsichtig. »Ich hätte mir weder über den Jungen noch über seine Eltern Gedanken gemacht, doch die Entscheidung lag nicht bei mir. Jetzt haben wir damit angefangen, und ich werde tun, was notwendig ist. Doch werde ich nicht vorschützen, es würde mich glücklich machen.«
Zufrieden nickte sie. »Du tust Folgendes. Sag ihnen, die Ard Rhys sei verschwunden, und wir würden sie suchen. Sag ihnen, auch ihr Sohn habe sich auf die Suche nach ihr gemacht, und auch nach ihm würden wir forschen. Wenn sie mit dir nach Paranor kämen, können sie vielleicht bei der Suche helfen. Das alles ist keine Lüge, und in diesem Fall ist die Wahrheit vorzuziehen. Niemand soll außerhalb dieser Mauern sterben, wenn wir es verhindern können.«
Traunt Rowan nickte langsam. »Du wirst sie nur so lange leben lassen, wie sie dir helfen können … wobei?«
»Bei der Suche nach dem Jungen, falls es notwendig wird, und vielleicht, um sicherzustellen, dass Grianne Ohmsford in der Verfemung eingesperrt bleibt. Wenn wir Bek Ohmsford überlisten können, seine Magie einzusetzen, um sie zu finden, werden wir erfolgreich die Bedrohung durch die Ohmsfords ausschalten können.«
»Ich denke, wir sollten ihn einfach umbringen«, warf Pyson Wence ein und wischte ihren Vorschlag vom Tisch. »Er ist zu gefährlich.«
Sie lachte. »Bist du ein solcher Feigling, Pyson? Wir haben unseren größten Feind ausgelöscht, unsere gefährlichste Bedrohung. Was machen wir uns Sorgen wegen jemandem, der so unbegabt ist wie ihr Bruder? Er ist nicht einmal ein Druide! Er übt seine Magie nicht aus, sondern hat sich entschieden, sie zu ignorieren. Ich glaube, wir sollten uns wegen seiner Fähigkeiten nicht allzu viele Gedanken machen. Schließlich besitzen wir als Druiden selbst eine gewisse Macht, wenn ich mich recht entsinne.«
Der kleine Mann errötete angesichts der Rüge, aber, wie Traunt Rowan zuvor, mied er ihren Blick nicht. »Du gehst ein zu großes Risiko ein, Shadea. Wir sind nicht so mächtig, wie du vorgibst. Sieh dir nur den Druidenrat an. Wir können ihn kaum kontrollieren. Ein einziger Fehltritt, und er würde uns vielleicht ganz entgleiten. Statt Grianne Ohmsfords Verwandte zu jagen und Spiele mit ihnen zu treiben, sollten wir lieber unsere Macht festigen und den Rat besser in den Griff bekommen. Nach Molts Tod und Iridias Weggang brauchen wir neue Verbündete. Und Verbündete können wir bestimmt finden. Aber nicht ohne Überzeugungsarbeit und Anreize.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, erwiderte sie gleichmütig und versuchte, ihre Wut im Zaum zu halten. Er war so ein Narr. »Dennoch ist es unsere wichtigste Aufgabe zurzeit, uns den Rücken freizuhalten. Wir dürfen diejenigen, die zur früheren Ard Rhys stehen, nicht zu einer Bedrohung werden lassen.«
Es folgte angespanntes Schweigen, während sie einander ansahen. Dann zuckte Pyson Wence mit den Schultern. »Wie du willst, Shadea. Du bist die Anführerin. Aber vergiss nicht – wir sind dein Gewissen, Traunt und ich. Setz dich nicht einfach über uns hinweg.«
Ich werde schon sehr bald viel Schlimmeres mit dir machen, kleine Ratte, dachte sie. »Ich würde mich niemals über dich hinwegsetzen, Pyson, ohne mir vorher anzuhören, was du zu sagen hast«, erwiderte sie. »Dein Rat ist mir stets willkommen. Ich verlasse mich darauf, dass du ihn mir aus freiem Herzen anbietest.« Sie lächelte. »Sind wir fertig?«
Sie wartete, bis sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, ehe sie sich setzte, um die Nachricht zu schreiben. Traunt Rowan würde beim ersten Licht von Paranor zum Rabenhorn aufbrechen, und sowohl er als auch Pyson Wence hatten sich ihrer Entscheidung über das Schicksal der Ohmsfords gebeugt. Eigentlich ging es ihnen überhaupt nicht um die Ohmsfords, solange sie nur nicht direkt am Blutvergießen beteiligt waren. Sie waren stark genug, wenn es um Manipulation und Betrug ging, nicht jedoch beim Töten. Das war ihre Domäne – und die von Aphasia Wye.
Manchmal dachte sie, wie viel leichter ihr Leben gewesen wäre, wenn sie sich niemals nach Paranor begeben hätte. Vielleicht wäre das der weisere Zug gewesen. Zwar wäre sie heute nicht die Ard Rhys des Ordens, doch sie hätte auch die Bürde der Verwirrung und Unentschlossenheit seiner Mitglieder nicht tragen müssen. Sie hätte ihre Magie allein praktiziert, oder sogar mit Iridia zusammen, und sehr viel erreicht. Doch hatte es sie nach mehr verlangt, die Gier hatte sie getrieben nach der unvergleichlichen Macht, die sich aus der Führung jener ergab, die das Schicksal der Vier Länder am meisten beeinflussen konnten. Sen Dunsidan mochte glauben, die Zukunft der Welt liege bei der Föderation, sie hingegen wusste es besser.
Trotzdem gab es Zeiten, in denen sie sich wünschte, sie könnte die Druiden einfach auslöschen und alles selbst machen. Dann würde die Angelegenheit schneller und wirksamer erledigt. Sie könnte die Konflikte und Streitereien vermeiden. Mittlerweile war sie es leid, ständig von jenen in Frage gestellt zu werden, auf deren Unterstützung sie angewiesen war. Sie wurden zu einer Last, der sie sich frohen Herzens entledigen würde, wenn die Zeit dazu gekommen war.
Rasch schrieb sie die Nachricht, deren Inhalt sie sich schon überlegt hatte, während sie noch dem Geschwätz von Pyson Wence lauschte. Die Zeit des Zögerns war vorüber. Wenn sie nicht stark genug waren, um zu tun, was notwendig war, würde sie Stärke zeigen, die für alle reichte.
Nachdem sie geschrieben hatte, las sie die Nachricht noch einmal:
WENN DU DEN JUNGEN FINDEST, MACH DIR NICHT DIE MÜHE, IHN HERZUBRINGEN. TÖTE IHN UMGEHEND.
Sie rollte das Papier zusammen und steckte es in das Röhrchen, das sie heute Morgen von dem Pfeilsegler gebracht bekommen hatte. Daraufhin ging sie zum Fenster, griff in den Vogelkäfig und befestigte das Röhrchen am Bein des Vogels. Das Gesicht mit dem scharfen Schnabel wandte sich ihr zu, die hellen Augen fixierten sie. Ja, kleiner Krieger, dachte sie, du bist mir ein besserer Freund als die beiden, die gerade gegangen sind. Leider kannst du sie nicht ersetzen.
Nachdem sie das Röhrchen sicher angebracht hatte, zog sie den Segler aus dem Käfig und warf ihn in die Luft. Kurze Zeit später war er verschwunden, flatterte im Zwielicht nach Norden davon. Er würde die ganze Nacht und den nächsten Tag fliegen, denn er war ein ausdauernder und verlässlicher Kurier. Wo immer Aphasia Wye sich aufhielt, der Pfeilsegler würde ihn finden.
Drei
Tagwen verschränkte die Arme, zog das bärtige Kinn in die Brust und gab ein niedergeschlagenes Knurren von sich.
»Wenn das nicht die absurdeste Idee ist, die ich je gehört habe, dann weiß ich auch nicht!« Langsam verlor er die letzten Reste seiner Geduld. »Warum glauben wir eigentlich, es könnte überhaupt möglich sein, so was zu schaffen? Drei Stunden, Penderrin! Und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen.«
Der Junge hörte ihm müde zu, gestand sich ein, dass Tagwen Recht hatte, und begann prompt wieder zu diskutieren.
»Khyber hat Recht; wir sollten uns nicht auf die Elfensteine verlassen. Nicht, solange wir nicht sicher sind, dass dieses Wesen Magie benutzt, Magie, auf welche die Elfensteine reagieren. Bislang habe ich nichts dergleichen bemerkt. Vielleicht ist das Wesen gar nicht menschlich, aber deshalb muss es noch lange nicht über Magie verfügen. Falls doch, und falls wir das herausfinden, kann Khyber die Elfensteine einsetzen. Ansonsten müssen wir uns überlegen, ob wir uns irgendwie einen Vorteil verschaffen können.«
»Nun, wir haben gesehen, wie rasch es sich bewegen kann«, warf das Elfenmädchen ein. »Es ist schneller als wir, in dieser Hinsicht sind wir also nicht im Vorteil.«
»Und wenn wir eine Möglichkeit fänden, es zu verlangsamen?«
Der Zwerg grunzte verächtlich. »Wirklich ein brillanter Einfall! Wir könnten es mit Seilen oder Ketten an den Füßen fesseln. Oder es in den Treibsand oder den Sumpf werfen. Oder wir locken es in eine bodenlose Grube oder eine Felswand herunter. Davon gibt es Dutzende in diesen Bergen. Wir müssen es nur beim Schlafen erwischen und gefangen nehmen!«
»Genug, Tagwen«, sagte Khyber leise. »Das hilft uns auch nicht weiter.«
Unbehagliches Schweigen machte sich breit, während sie einander anstarrten und konzentriert und niedergeschlagen die Stirn runzelten, wobei Tagwens breites Gesicht vor allem Resignation ausdrückte. In der vergangenen Nacht war die Rochen plötzlich am Himmel über den westlichen Ausläufern des Charnalgebirges aufgetaucht. Zwölf Stunden waren seit der erschreckenden Entdeckung vergangen, dass dieses Wesen aus Anatcherae das Luftschiff kommandierte, Gar Hatch und seine Fahrenden getötet und Cinnaminson gefangen genommen hatte. Seitdem hatte niemand mehr geschlafen, obwohl jeder der drei es vorgetäuscht hatte. Jetzt war wieder heller Tag, und sie saßen in der Sonne an einem Berghang und versuchten zu entscheiden, wie sie weiter vorgehen sollten. Vor allem debattierten sie darüber, wie sie Cinnaminson am besten helfen konnten. Pen hatte seine Gefährten zwar überredet, die junge Fahrende nicht im Stich zu lassen, aber damit hatte er sie nicht davon überzeugt, dass es einen Weg gab, sie zu retten.
»Seine Beweglichkeit wäre ihm von weniger Nutzen, wenn wir es in einen engen Raum locken könnten«, schlug Khyber vor.
»Oder es zwingen, auf einen Baum oder eine Felswand zu klettern«, fügte Pen hinzu, »wo Schnelligkeit und Wendigkeit keine Vorteile bringen.«
»Auf einen Felssims oder in einen Engpass, wo der Boden schmal und schlüpfrig ist.«
»Warum zwingen wir es nicht einfach, zu uns herauszuschwimmen!«, fauchte Tagwen gereizt. »Vermutlich kann es nicht sehr gut schwimmen. Dann könnten wir es ersäufen, wenn es näher kommt. Wir hauen ihm ein Ruder über den Kopf oder so. Wo ist der nächste große See?« Verärgert blies er in die Luft. »Haben wir das nicht schon alles durchgesprochen? Wie hoch sind die Chancen, das zu bewerkstelligen? Wie in aller Welt sollen wir dieses Wesen dazu bringen, das zu tun, was wir wollen?«
»Wir müssen es von dem Schiff herunterlocken«, verkündete Pen und sah vom Zwerg zur Elfin und wieder zurück. »Von dem Schiff und fort von Cinnaminson. Wir müssen sie voneinander trennen, wenn wir Cinnaminson befreien wollen.«
»Oh, das dürfte nicht so schwierig sein«, murmelte Tagwen. »Wir brauchen nur den richtigen Köder.«
Er verzog das Gesicht, als ihm bewusst wurde, welches gefährliche Territorium er soeben versehentlich betreten hatte. »So habe ich das nicht gemeint! Bestimmt nicht! Denk nicht einmal im Traum dran, Penderrin. Was auch immer geschieht, du darfst dich auf keinen Fall in Gefahr bringen. Falls dir etwas zustößt, ist jede Aussicht dahin, die Ard Rhys zu retten. Ich weiß, welche Gefühle du für dieses Mädchen hegst, aber du solltest dich besser auf das konzentrieren, weshalb du hier bist. Du darfst dich keinem Risiko aussetzen!«
»Tagwen, beruhige dich«, antwortete der Junge. »Wer hat gesagt, ich würde mich einem Risiko aussetzen? Ich suche nur nach einer Möglichkeit, die Chancen zu unseren Gunsten zu verschieben, damit wir Cinnaminson befreien und fliehen können. Um das Erste zu erreichen, müssen wir dieses Wesen, das sie in seiner Gewalt hat, von ihr trennen, und um das Zweite zu erreichen, müssen wir das Schiff in die Hände bekommen.«
»Wir müssen dieses Ding also vom Schiff und von Cinnaminson fortlocken und dann selbst an Bord gelangen und davonfliegen«, fasste Khyber zusammen. Sie starrte ihn an. »Ehrlich gesagt finde ich, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht.«
»Nun, dann müssen wir unsere Chancen eben verbessern«, beharrte Pen. »Dieses Wesen ist vielleicht stärker und schneller als wir, aber es muss nicht unbedingt auch klüger sein. Wir können unseren überlegenen Verstand einsetzen. Vielleicht gelingt es uns, es auszutricksen und dazu zu verleiten, einen Fehler zu begehen.«
Tagwen stand auf und gab einen rüden Laut von sich, mit dem er keinen Zweifel an seiner Meinung hinsichtlich dieser Äußerung ließ. »Mir reicht es. Ich brauche einen Spaziergang, junger Penderrin, junge Khyber. Ich will dieses dumme Gerede vergessen, damit ich wieder einen klaren Kopf bekomme. Ich war Sekretär und persönlicher Gehilfe der Ard Rhys, als wir uns auf diese Odyssee begeben haben, und ich habe mich noch nicht an mein neues Leben gewöhnt. Natürlich begrüße ich eure Bemühungen, Cinnaminson zu retten, doch kann ich mir nicht vorstellen, dass uns eure bisherigen Vorschläge weiterbringen. Falls ihr während meiner Abwesenheit zu einer Lösung kommt, höre ich sie mir gern bei meiner Rückkehr an.«
Er verbeugte sich steif und ungeduldig und ging davon.
Sie schauten ihm schweigend hinterher, und erst, nachdem er außer Sicht und Hörweite war, sagte Khyber: »Möglicherweise sieht er die ganze Angelegenheit klarer als wir.«
Sofort sträubte sich Pen gegen diese Ansicht. »Du denkst vermutlich auch, wir sollten aufgeben, wie? Sie einfach diesem Ungeheuer überlassen und weiterziehen?«
Das Elfenmädchen schüttelte den Kopf. »Das glaube ich überhaupt nicht. Als ich dir gesagt habe, ich würde dir helfen, habe ich das ernst gemeint. Aber ich frage mich langsam, ob wir Cinnaminson überhaupt helfen können. Vielleicht sollten wir lieber nach Taupo Rough weiterziehen und Kermadec und seine Trolle um Unterstützung bitten. Was auch immer dieses Wesen ist, die Felstrolle werden bestimmt besser mit ihm fertig als wir.«
»Womöglich hast du Recht«, stimmte Pen zu. »Um das jedoch herauszufinden, müssten wir erst einmal nach Taupo Rough gelangen, dann Kermadec überreden, dann zurückkehren und die Rochen finden, die fliegen kann, während wir zu Fuß unterwegs sind. Ich glaube auch nicht, dass uns das wirklich weiterbringen würde. Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, wird es vermutlich zu spät sein. Dieses Wesen wird sich nicht länger mit Cinnaminson abgeben, wenn es keinen Vorteil mehr in ihr sieht.«
Er erinnerte sich daran, wie Cinnaminson, die blind war, aber mit einer Art inneren Sehens gesegnet war, über das Normalsehende nicht verfügten, freiwillig den Verfolger von der Stelle fortgeführt hatte, wo sich Pen und seine Gefährten zwischen den Felsen versteckten. Er war sich nicht sicher, ob sie gewusst hatte, dass er sich da verbarg, dennoch fühlte er das im Herzen. Ihr Mut erstaunte ihn, doch könnte er sie, so fürchtete er, das Leben kosten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: