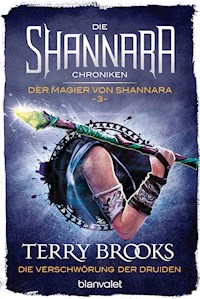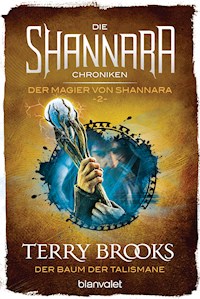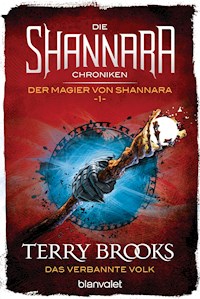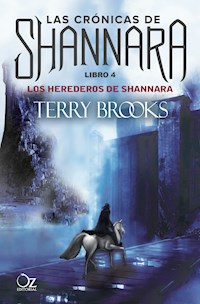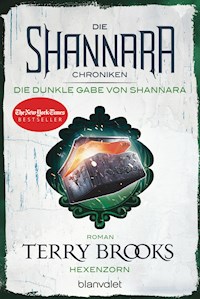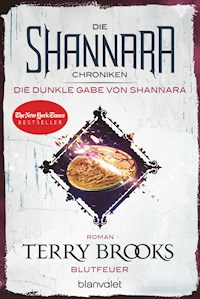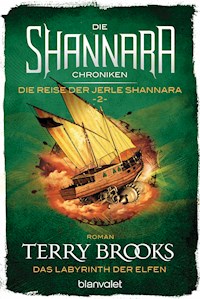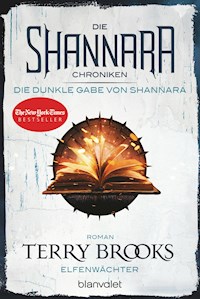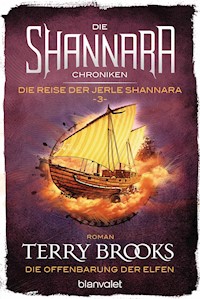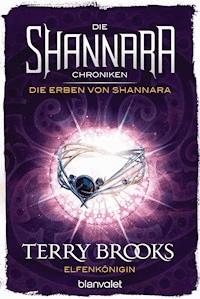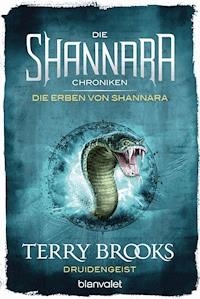7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Shannara-Chroniken: Die Großen Kriege
- Sprache: Deutsch
Die letzten Städte der Menschen sind gefallen. Dämonen und schreckliche Monstren beherrschen nun das Land. Sie machen Jagd auf Logan Tom, Angel Perez und ihre wild zusammengewürfelte Gruppe von Flüchtlingen, die versuchen, sich nach Norden durchzuschlagen — zu jenem sicheren Ort, von dem der geheimnisvolle König vom Silberfluss gesprochen hat. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Flüchtlinge unzählige Gefahren überwinden. Denn auf dem Spiel steht die Zukunft der Menschen und die der Elfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Terry Brooks
Die Shannara-Chroniken
Die Flüchtlinge von Shannara
Roman
Deutsch von Michael Nagula
Buch
Die letzten Städte der Menschen sind gefallen. Dämonen und schreckliche Monstren beherrschen nun das Land. Sie machen Jagd auf Logan Tom, Angel Perez und ihre wild zusammengewürfelte Gruppe von Flüchtlingen, die versuchen, sich nach Norden durchzuschlagen – zu jenem sicheren Ort, von dem der geheimnisvolle König vom Silberfluss gesprochen hat. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Flüchtlinge unzählige Gefahren überwinden. Denn auf dem Spiel steht die Zukunft der Menschen und die der Elfen …
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch "Das Schwert von Shannara" war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere, denn bislang sind mehr als zwanzig Bände seiner Shannara-Saga erschienen.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Genesis of Shannara 3: The Gypsy Morph« bei Ballantine Books, New York.
Der vorliegende Roman ist bereits 2009 im Goldmann Verlag und im Blanvalet Verlag unter dem Titel „Die Großen Kriege 3 – Die Flüchtlinge von Shannara“ erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Copyright der Originalausgabe © 2008 by Terry Brooks Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München Redaktion: Waltraud Horbas Covergestaltung und Artwork: Melanie Miklitza, Inkcraft HK • Herstellung: at
eISBN 978-3-641-18127-7V001
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Für Anne Sibbald, Agentin und Freundin –die Königin des Silbernen Flusses
Inhaltsverzeichnis
1
Wills durchschritt die leeren Korridore der Hölle auf der Suche nach dem Code. Er war jeden Tag in diesen Fluren unterwegs, den ganzen Tag, und suchte. Immerhin war es ja möglich, dass er irgendeine Stelle übersehen hatte und sie am nächsten Tag finden würde. Aber das geschah nicht. Und tief im Herzen wusste er, dass es auch nie geschehen würde.
Es war vorbei. Sie waren am Ende, sie alle. In mehr als nur einer Hinsicht. Die anderen waren schon lange tot. Das gesamte Kommando, ausgelöscht von irgendeinem Virus, der seinen Weg hineingefunden hatte, durch die Luftschächte, durch Filter und Reiniger und Medico-Schirme und alle anderen Sicherheitsmaßnahmen hindurch, die schon Jahre zuvor installiert worden waren. Selbstverständlich waren sie nicht alle gleichzeitig gestorben. Begonnen hatte es mit acht von ihnen, und das lag nun mehr als zwei Jahre zurück. Jedenfalls glaubte er, dass es so lange her war. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Die anderen waren einer nach dem anderen gestorben, ein paar waren gleich krank geworden, andere nicht sofort und hatten so Hoffnungen geweckt, dass einige vielleicht überleben würden. Aber die Hoffnung war trügerisch gewesen. Nur er lebte noch. Er hatte keine Ahnung warum. Ihm kam es nicht so vor, als wäre er anders als die anderen, aber offenbar war das der Fall. Irgendeine kleine genetische Veränderung. Ein Antikörper, über den nur er verfügte. Oder vielleicht irrte er sich auch, und es war einfach nur Glück. Er lebte, die anderen waren tot. Sinn- und zwecklos, das alles. Es gab keinen Preis für den letzten Überlebenden. Nur ein Rätsel ohne Lösung.
Abramson und Perlo waren als Letzte gegangen. Wenn man Major Sowieso nicht zählte – wie hatte sie noch geheißen? Anders, Andrews oder so. Er konnte sich nicht mehr erinnern. Wie auch immer, für sie hatte nie viel Hoffnung bestanden. Sie war krank geworden und krank geblieben, und als sie schließlich starb, war sie bereits wochenlang schon so gut wie tot gewesen: das Hirn kurzgeschlossen, das Gedächtnis leer, der Mund sabbernd. Sie hatte nur noch auf dem Boden herumgelegen, seltsame Geräusche von sich gegeben und sie angestarrt, undeutlich vor sich hin brabbelnd, die Augen weit aufgerissen, das Gesicht verzerrt. Er hätte dem ein Ende gemacht, wenn er sich dazu hätte durchringen können. Aber er brachte es nicht über sich. Perlo hatte es schließlich getan. Perlo hatte nicht die gleichen Vorbehalte gehabt wie er. Er konnte sie sowieso nicht leiden, sagte er. Selbst als sie noch nicht krank gewesen war, hatte sie ihn genervt. Also war es ihm nicht schwer gefallen, ihr die Waffe an den Kopf zu halten und abzudrücken. Sie hätte ihm wahrscheinlich dafür gedankt, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre, sagte er hinterher.
Zwei Wochen später war Perlo ebenfalls tot, erschossen mit derselben Waffe. Er hatte sich entschlossen, nicht mehr länger zu warten. Hatte die Waffe mit beinahe vollem Magazin für die anderen zurückgelassen, ein unausgesprochener Hinweis, dass es vielleicht klug wäre, ihm zu folgen.
Sie hatten den Vorschlag nicht aufgegriffen. Abramson war noch beinahe sieben Monate am Leben geblieben, und er und Wills hatten in dieser kurzen Zeit gut zusammengearbeitet. Beide stammten aus dem Mittleren Westen, hatten jung geheiratet und waren in den Dienst ihres Landes getreten, hatten die Offiziersausbildung hinter sich gebracht, voll patriotischer Pflichterfüllung und stolz darauf, die Uniform tragen zu dürfen. Beide waren Piloten gewesen, bevor sie schnell befördert worden waren und in Kommandopositionen aufstiegen. All das war lange vorbei, aber sie hatten oft über die vergangenen, besseren Zeiten gesprochen. Sie erinnerten sich gerne daran, denn es gab ihnen das Gefühl, dass ihre Beharrlichkeit, ihr Durchhalten einen Sinn gehabt hatte, obwohl die ganze Geschichte kein gutes Ende genommen hatte.
Jetzt fiel es Wills schwer, sich zu erinnern, worin dieser Sinn bestanden hatte. Nachdem Abramson weg war, hatte er niemanden mehr gehabt, mit dem er darüber hätte reden können, und im Lauf der Zeit war das Wissen um diesen Sinn in der Stille des Komplexes versickert. Manchmal sang er oder sprach mit sich selbst, aber das war nicht das Gleiche, wie mit einem anderen Menschen reden zu können. Tatsächlich erinnerte es ihn an die Geschichten von Gefangenen, die in Einzelhaft langsam den Verstand verloren, zu lange allein gelassen mit sich selbst und dem Klang ihrer eigenen Stimme. Manchmal für Jahre. Genau wie bei ihm: Auch für ihn würden es Jahre der Einzelhaft sein, wenn sich nichts änderte, wenn er niemanden fand und niemand kam.
Major Adam Wills war er gewesen – das Militär würde sagen, er war es immer noch, solange er seinem Land tief unter der Erdoberfläche diente, eine Viertelmeile unter Tonnen von Felsen und verstärktem Stahlbeton. Irgendwo tief in den Rocky Mountains wartete er nun schon seit fünf langen Jahren.
Warten. Er dachte über dieses Wort nach. Mitten in einem der endlosen Korridore blieb er stehen und dachte darüber nach. Warten. Worauf? Es schien sich mit der Zeit zu verändern. Zuerst hatte er darauf gewartet, dass die Kriege zu Ende waren. Dann hatte er darauf gewartet, dass jemand kam und die Leute im Raketenkommandozentrum ablöste, die noch am Leben waren. Dann hatte er darauf gewartet, dass man ihn rausließ. Er selbst konnte den Komplex nicht verlassen, wenn nicht jemand mit der entsprechenden Autorität, jemand, der ihm sagen konnte, dass es Zeit war zu gehen, die Fahrstühle von der Oberfläche zum Komplex entriegelte.
Auch nachdem er wusste, dass vielleicht niemand von ihnen am Leben geblieben war, hatte er lange Zeit einfach gewartet und gehofft, dass das, was er sendete, irgendwann zu einer Antwort führte. Er benutzte keinen Sicherheitscode mehr. Er ging einfach auf alle Kanäle und sendete Mayday. Er wusste, was an der Oberfläche geschah. Die Kameras hatten ihm einen großen Teil der Geschichte erzählt. Trostlose, unfruchtbare Landschaften, ein paar umherziehende Gruppen von Menschen, offenbar Plünderer. Eine Handvoll Geschöpfe, wie er sie nie zuvor gesehen hatte und hoffte, auch niemals wieder sehen zu müssen, und endlose Tage voller Sonnenschein. Kein Regen. Colorado war immer trocken gewesen, aber nicht so. Früher oder später musste es doch regnen, sagte er sich.
Oder?
Warten auf den Regen.
Die Regierung war praktisch vollständig ausgelöscht worden, noch bevor man ihn ins Raketenkommandozentrum geschickt hatte, das den Spitznamen Deep Rock trug. Anfangs war er noch an der Oberfläche gewesen, in einer Basis in North Dakota, wo er mit seiner Familie auf dem Kasernengelände lebte. Washington war beim ersten Schlag vernichtet worden, und kurz darauf hatte es auch die meisten anderen Städte an der Ostküste erwischt. Die Umwelt war bereits in Aufruhr gewesen, große Teile des Landes so gut wie unbewohnbar geworden. Terroristen hatten zugeschlagen. Krankheiten breiteten sich aus. Sein letzter Befehl hatte ihn hierher gebracht, zusammen mit den anderen, die in die Bunker und die geschützten Komplexe geschickt worden waren, die das Land überzogen. Zu diesem Zeitpunkt gab bereits ein General der National Command Authority die Befehle aus, nicht nur für das Militär, sondern für das gesamte Land. Die Befehle waren finster gewesen, und alle hatten gewusst, dass es schlecht um sie stand, aber sie hatten auch gewusst, dass sie durchkommen würden. Es hatte Kameraderie gegeben, das Gefühl, gemeinsam eine Katastrophe zu durchleben, bei der jeder allen anderen helfen musste. Keiner hatte daran gezweifelt, dass sie überleben und auch mit dem Schlimmsten fertig werden würden.
Die Amerikaner hatten es schließlich immer geschafft. Ganz gleich, wie schlimm es stand, sie hatten einen Ausweg gefunden. So würde es auch diesmal sein. Sie waren erfüllt von Stolz, Selbstvertrauen und der Überzeugung, dass sie die Ausbildung, die Fähigkeiten und die Entschlossenheit hatten, die man zum Überleben brauchte. Sie hatten sogar widerspruchslos akzeptiert, dass sie ihre Familien zurücklassen mussten.
Wills lächelte unwillkürlich. Was für blinde Narren sie gewesen waren!
Er hatte aufgehört, an all diese Dinge zu glauben, als er die letzten Radiosendungen, die Beschreibungen der Massenhysterie und das Flehen und die verzweifelten Gebete der wenigen Reporter und Ansager gehört hatte, die noch sendeten. Die Zerstörung war vollständig, sie war weltweit. Niemand war verschont worden. Bewaffnete Angriffe, chemische Kriegsführung, Seuchen, die Vernichtung der Umwelt, Terroristenangriffe – eine Checkliste des Wahnsinns, der schließlich alles und jeden überwältigte. Millionen waren tot, und weitere Millionen lagen im Sterben. Weltweit Hunderte von Millionen. Ganze Großstädte waren ausgelöscht worden. Es gab keine Regierungen mehr, keine Armeen, alles, was auch nur entfernt an Recht und Ordnung erinnerte, war verschwunden. Er hatte versucht, seine Familie in der Basis in North Dakota zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Schließlich hatte er akzeptiert, dass es nie mehr eine Antwort geben würde. Sie waren ebenfalls tot – seine Frau, seine zwei Jungen, seine Eltern, all seine Tanten und Onkel und Vettern und Basen und wahrscheinlich auch alle anderen, die er je gekannt hatte.
Nach und nach fühlte es sich so an, als wären alle tot, bis auf die wenigen in Deep Rock, die auf ihr eigenes Ende warteten.
Das selbstverständlich nur zu bald kam.
Wills ging weiter, weiter und weiter. Er hatte kein Ziel, keine besondere Route, keinen Plan. Er ging, um etwas zu tun zu haben. Obwohl der Komplex nur aus acht Räumen bestand, die Vorratsschränke und der Kühlraum nicht mitgerechnet. Obwohl es nur drei kurze Flure gab, die zusammengenommen nicht länger als hundert Yards waren. Er hatte seinen tragbaren Empfänger dabei, der mit dem Kommunikationszentrum verbunden war, das seinerseits eine Verbindung zum Satellitensystem hatte. Es war völlig zwecklos, aber er hatte ihn aus Gewohnheit dabei. Jemand könnte sich melden. Man wusste nie.
Am Kühlraum blieb er stehen und starrte die schweren Eisentüren an. Er stellte sich vor, was sich dahinter befand, aber nur für einen Moment, denn länger ertrug er es nicht. Siebzehn Männer und Frauen, aufgestapelt wie Holz in einem acht mal zehn Yards großen Raum. Gestapelt neben jenen Lebensmitteln, die schon lange verdorben waren. Er konnte es nicht ertragen, daran zu denken, was aus den Leichen wurde, selbst bei den Frosttemperaturen, die das Kühlsystem aufrechterhielt. Er war nicht mehr hineingegangen, seit er Abramson auf den Stapel gelegt hatte, und er war ziemlich sicher, dass er den Raum nie wieder betreten würde. Wozu auch?
Dennoch, er stand vor den Türen und starrte sie lange Zeit an, und in seinem Kopf stiegen finstere Bilder auf. In der alten Zeit wäre so etwas nicht passiert, sie wären nicht alle zusammen gewesen, so dass ein einziger Virus sie auslöschen konnte. Man hätte sie zu einem Dutzend unterschiedlicher Kommandozentralen geschickt. Man hätte nicht mehr als zwei oder drei von ihnen in einem dieser Zentren angetroffen, die jeweils für eine Handvoll Silos verantwortlich waren. Aber als das Ende nahte, hatte jemand in hoher Stellung begriffen, dass ein weiterer feindlicher Angriff bevorstand. Daher hatten sie diese Basis eingerichtet; ihrer Auffassung nach war eine Hauptkommandozentrale notwendig. Sie war das Zuhause von Dutzenden von Teams geworden, die im Laufe von zwanzig Jahren hier ein- und wieder ausgezogen waren. Seine Gruppe von neun Personen war die letzte gewesen, aber das Team vor seinem, in dem Abramson gedient hatte, hatte die Anlage nicht mehr verlassen können. Die National Command Authority hatte beschlossen, das Zentrum vorsichtshalber zu versiegeln. Die normale Rotation war vorübergehend ausgesetzt worden.
Nur bis die Lage sich wieder beruhigte.
Als er weiterging, tat er es weniger entschlossen und ließ den Kopf hängen. Er sollte etwas tun, aber er wusste einfach nicht was. Er wollte hier raus, aber allein würde er das nicht schaffen. Nicht, solange er nicht den Code fand, den er suchte, den Code, der die Fahrstühle aktivieren und die äußeren Tore öffnen würde. So war der Komplex gebaut, um das Eindringen von unautorisierten Personen zu verhindern. Das Militär dachte an alles. Er grinste. An fast alles. Sie hatten nur nicht daran gedacht, dass die hier Eingeschlossenen nicht mehr rauskamen, wenn sie den Code verloren hatten.
Oder vielleicht war es auch kein Versehen gewesen. Vielleicht war es ihnen einfach egal.
Als kommandierender Offizier hatte Aronez den Code bei sich gehabt, als er kam. Nur er kannte ihn, sonst niemand. Nachdem er ihnen Eintritt verschafft hatte, hatte er ihn weggelegt, und alle hatten ihn vergessen. Leider hatte er nicht daran gedacht, ihn weiterzugeben, als er sich mit dem Virus angesteckt hatte. Oder vielleicht hatte er daran gedacht und sich dagegen entschieden. Das wäre dem kalten, berechnenden Aronez durchaus zuzutrauen gewesen. Wie auch immer, er starb innerhalb von vierundzwanzig Stunden, und die Information darüber, wo der Code versteckt war, starb mit ihm.
Wills wusste lediglich, dass er irgendwo niedergeschrieben sein musste, eine Sicherheitsmaßnahme, die Aronez nicht vernachlässigt hätte.
Also suchte er. Jeden Tag, immer wieder von neuem. Endlos.
Er war nicht sicher, warum er das machte. Selbst wenn er hinauskönnte, was sollte er tun? Er war Meilen von allem entfernt und wusste nicht, wo sich andere Menschen befanden. Seine Familie? Sein Zuhause? Seine Vorgesetzten in der National Command Authority? Nicht mehr da. Oh, es gab vielleicht irgendwo irgendwen, aber es war unwahrscheinlich, dass es sich um eine Person handelte, die tatsächlich Befehle ausgeben und ihn ersetzen konnte und wusste, was zu tun war.
Es war unwahrscheinlich, dass ihm jemand seine Verantwortung abnehmen würde, dass es jemanden gab, dem er die beiden roten Schlüssel übergeben konnte, die er an einer Kette um den Hals trug.
Er griff nach unten, um die unregelmäßigen Formen durch den Stoff des Hemds zu betasten. Sein Schlüssel und Abramsons. Na ja, nicht wirklich Abramsons. Abramson hatte ihn Reacher abgenommen, nachdem der gestorben war, denn irgendwer musste ihn ja nehmen, nur für den Fall, dass er gebraucht würde. Nach Abramsons Tod hatte Wills seinen ebenfalls an sich genommen.
Nur für den Fall.
Ja, nur für den Fall.
Als er die Schlüssel betastete, dachte er an das, was früher einmal undenkbar gewesen war. Obwohl er wusste, dass er das nicht tun sollte. Obwohl allein der Gedanke daran finster und entsetzlich war.
Er dachte an die Raketen.
Er dachte daran, sie zu starten.
Das konnte er; er hatte es schon einmal getan. Damals, am Anfang, als der General das Land regierte. Der General hatte den Code gehabt und die Raketenstarts autorisiert. Eine Handvoll gezielter Angriffe gegen Länder und Basen, die selbstverständlich zurückgeschlagen hatten. Wills hatte den Schlüssel zusammen mit einem anderen Mann benutzt, an dessen Namen er sich nicht mehr erinnern konnte. Wie hieß er noch – vielleicht Graham oder Graves, ein Captain? Sie hatten gemeinsam ihre Schlüssel gedreht, um die Schalter zu entriegeln und die Auslöser zu aktivieren. Sie hatten gewartet, während die Zielkoordinaten eingegeben wurden, bis der Mechanismus schließlich aktiviert worden war. Die Sprengköpfe waren bereit gewesen. Meilen von ihnen entfernt waren sie lautlos aufgestiegen – die Stille in ihrem unterirdischen Kommandozentrum war ohrenbetäubend gewesen.
Es war das Ende. Seitdem war nichts mehr geschehen. Der General hatte sich nie mehr mit ihnen in Verbindung gesetzt. Niemand hatte das getan. Die Kommunikationsanlage war verstummt und stumm geblieben, nur die Kameras hatten ihnen Lebensformen gezeigt, die sich über die Oberfläche bewegten, viele von ihnen seltsam und erschreckend. Es gab keine Kommunikation mehr nach außen. Sie konnten nur noch warten, umschlossen in einem Vakuum aus Angst und Zweifeln, aus Unwissen und leerer Hoffnung.
Aber Dutzende von Raketen waren immer noch aktiv und standen ihm zur Verfügung. Dutzende, alle mit atomaren Sprengköpfen, einige hier in ihren Silos in den Bergen, andere weit entfernt an den Küsten. Es gab keine Marine mehr, ebenso wenig wie eine Luftwaffe. Keine Schiffe segelten mehr, keine Flugzeuge flogen –zumindest keine militärischen. Nur die Raketen in ihren Silos waren weiterhin bereit. Aber sie würden genügen, um alles auszulöschen.
Alles.
Er konnte eine Rakete starten, nur um zu sehen, was geschehen würde. Er konnte sein eigenes Ziel wählen, etwas, das dem Erdboden gleichgemacht werden sollte. Er hatte diese Macht. Er hatte die roten Schlüssel und die Kenntnisse. Die Prozeduren, die einer erfolgreichen Netzhauterkennung folgten, waren schon lange verändert worden, um in einer verzweifelten Situation wie dieser auch einen einzigen Schlüsselinhaber mit zwei Schlüsseln zu akzeptieren. Er musste nur eine Fernbedienung aktivieren, die sich in der National Command Authority befand, und das war schon lange geschehen. Die Maschinen hier reagierten nicht mehr auf andere Kommandozentren, wenn es denn noch welche gab. Die Anlage war autonom und unabhängig. Sie tat, was die Personen mit den Schlüsseln ihr befahlen, man brauchte lediglich die notwendigen Kenntnisse und die Schlüssel. Und er hatte beides.
Aber was würde er vernichten?
Und warum?
Er schloss die Augen, um die finsteren Gedanken zu verscheuchen. Mehr Atomsprengköpfe auf den Weg zu schicken würde den Wahnsinn nur noch vergrößern. Daran wollte er keinen Anteil haben. Obwohl es mitunter verführerisch war und er die Mittel hatte, würde er es nicht tun.
Er kehrte zum Mittelpunkt des Kommandokomplexes zurück, setzte sich auf den Stuhl und starrte die Monitore und Anzeigentafeln an. Obwohl keine Menschen mehr da waren, arbeiteten die Maschinen weiter, angetrieben von Sonnenkollektoren an der Oberfläche, und taten, wozu sie geschaffen worden waren. Die Monitore zeigten eine leere Felsenlandschaft, und die Anzeigen wiesen darauf hin, dass sich Wetter und Klima nicht verändert hatten. Einen Augenblick nestelte er am Kommunikationsbord herum, ging die Sendebereiche durch auf der Suche nach einer Kontaktmeldung und fand nichts.
Er betrachtete das gerahmte Bild seiner Frau und der Jungen auf dem schmalen Regal vor ihm, das von jedem Bereich der Workstation aus gut zu sehen war.
Dann beugte er sich plötzlich vor, senkte den Kopf, drückte fest die Augen zu, faltete die Hände und fing an, leise zu beten.
Der Herr ist mein Hirte,mir wird nichts mangeln.Er weidet mich auf grüner AueUnd führet mich zum frischen Wasser.Er erquicket meine Seele, er führetMich auf rechter Straße um seines Namens willen.Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,fürchte ich kein Unglück …
Abrupt hörte er auf, denn die Worte blieben ihm im Hals stecken. Er konnte nicht weiterbeten.
»Bitte«, flüsterte er in die Dunkelheit hinter seinen geschlossenen Augen. »Bitte lass mich nicht hier sterben.«
2
Angel Perez geht die heißen, staubigen Straßen ihres Barrio in Ost-L.A. entlang; ihre kleine Hand umklammert Johnnys Hand. Sie fühlt sich sicher und warm unter dem tröstlichen Mantel seines schützenden Schattens. Seine Hand zu halten ist genug, und so muss sie nicht erst zu ihm aufblicken, um zu wissen, dass er da ist, sich um sie kümmert, in der Nähe bleibt. Die Welt rings umher ist friedlich und ruhig, ein Spiegelbild ihres Gefühls der Sicherheit, ein Sinnbild dafür, was es bedeutet, bei Johnny zu sein. Die Leute sitzen auf ihren Schwellen oder beugen sich aus den Fenstern. Ihre abgehärmten, sorgenvollen Gesichter leuchten auf, wenn sie Johnny sehen. Sie winken und rufen ihm Grüße zu. Alle freuen sich über Johnnys Gegenwart.
Sie blickt zum Himmel auf. Er ist wolkenlos und blau, frei von dem Rauch und der Asche, die sie seit Tagen gequält haben. Seit Monaten. Seit Jahren. In dieser Gegend sind Gangs aufgetaucht, es kam zu Kämpfen und Plünderungen. Aber Johnny hält all das von seinem Viertel fern, und heute gibt es davon keine Spur. Der klare Himmel und die ruhige Luft sind Zeichen dieser Läuterung. Sie lächelt, als sie daran denkt. Sie fragt sich, ob vielleicht etwas Gutes auf sie zukommt. Es wäre doch möglich – vielleicht wird sich das Glücksrad ja tatsächlich bald drehen.
»Ich bin so froh«, sagt sie zu Johnny.
Er antwortet nicht, aber Worte sind auch nicht notwendig, wo sie doch spürt, dass er ihre Hand ein wenig fester drückt. Er versteht sie. Auch er ist froh.
Sie gehen lange Zeit weiter, zufrieden damit, dass sie zusammen sind wie Vater und Tochter, wie Verwandte. So stellt sie es sich vor, sie die Tochter, er der Vater. Es gibt mehr Arten von Verwandtschaft als reine Blutsverwandtschaft. Man braucht Vertrauen und Freundschaft und Ergebenheit. Sie ist erst acht Jahre alt, aber das weiß sie bereits.
Sie kommen aus einer breiteren Straße in eine schmalere und bewegen sich damit auf den Rand des Viertels zu. Über diese Grenzen, die ihr Barrio bezeichnen, darf sie nicht hinausgehen, aber er bringt sie oft bis an die Grenzen, damit sie weiß, bis wohin sie ohne ihn gehen darf. Er selbst bewegt sich auch außerhalb des Barrio, aber er spricht nicht darüber, wohin er geht. Wenn sie fragt, lächelt er nur und sagt, es sei notwendig. Er ist in jeder Hinsicht ihr Vater, auch ohne eine tatsächliche Blutsverwandtschaft. Ihr bester Freund und ihr Beschützer, aber er hat viele Geheimnisse.
An einer Ecke mit Häusern mit herausgebrochenen Fenstern und einstürzenden Mauern stoßen sie auf Gangmitglieder. Sie weiß, was sie sind, denn sie haben die entsprechenden Kennzeichen, aber sie kennt ihre Namen nicht. Johnny bleibt sofort stehen und spricht sie an. Es sind insgesamt fünf. Ihre Kleidung ist zerfetzt und schmutzig, ihre Gesichter sind hart und gefährlich. Sie halten keine Waffen in der Hand, aber Angel weiß, dass sie welche in ihrer Kleidung verborgen haben. Sie starren Johnny lange an, gönnen ihr aber kaum einen Blick. Dann biegen sie ab und verschwinden in den Ruinen.
So reagieren Leute oft auf Johnny. Sie hat es wieder und wieder gesehen. Wenn sie wie diese erbärmlichen Geschöpfe sind, weichen sie zurück. Er hat etwas in den Augen, das sie wissen lässt, was geschehen wird, wenn sie es nicht tun. Er verfügt über eine Präsenz, die dringend davor warnt, ihn herauszufordern. Johnny braucht Geschöpfen, die eine Gefahr darstellen, nicht viel zu sagen. Sie wissen instinktiv, was sie riskieren und dass sie wahrscheinlich verlieren würden.
Das Barrio endet an einem Wald eingestürzter Mauern, Stahlträger und Trümmerhaufen, den Überresten dessen, was einmal ein Lagerhausviertel war. Die Sonne brennt auf schweigende, leere Ruinen. Hier lebt nichts mehr. Nichts hier kann noch Leben erhalten.
»Komm mit«, flüstert Johnny ihr zu.
Er hat sie noch nie weiter mitgenommen als bis hierher, also überrascht sie seine Bitte. Aber sie würde überall mit ihm hingehen. Sie vertraut ihm vollkommen, hat keine Angst.
Sie gehen in den Irrgarten hinein, durch schmale Gassen und manchmal durch Passagen, die nicht einmal Gassen sind. Staub hängt schwer in der Luft, und es ist schwierig zu atmen. Aber sie beschwert sich nicht. Sie ignoriert die Unbequemlichkeit und geht weiter neben ihm her, als wäre alles, wie es sein sollte.
Und wie könnte es mit Johnny auch jemals anders sein?
Aber als sie weiter durch diese surreale Landschaft ziehen, bemerkt sie, dass der Himmel langsam dunkler wird. Das geschieht nach und nach und ohne offensichtlichen Grund. Es gibt keine Wolken, und kein Sturm nähert sich. Die Sonne verblasst einfach immer mehr, bis sie in Zwielicht gehüllt sind. Johnny lässt sich nicht anmerken, ob ihm das auffällt. Er geht stetig weiter, ihre Hand in seiner, mit gleichmäßigem Schritt, unverändert. Sie hält Schritt mit ihm, aber nun sieht sie sich um und wundert sich. Es ist Mittag. Wie kann das Licht nur so trübe sein?
Dann bleibt Johnny plötzlich stehen und lässt ihre Hand los. Es dauert einen Augenblick, bis sie es begreift. Sie bleibt reglos in dem schwindenden Licht stehen und wartet darauf, dass er ihre Hand wieder nimmt. Als er das nicht tut und nichts sagt, blickt sie auf zu ihm.
Er ist nicht mehr da.
Verschwunden.
Schaudernd hält sie die Luft an. Wie ist das passiert? Wie kann er so vollkommen verschwunden sein?
Vor ihr erscheint eine schattenhafte Gestalt in Umhang und Kapuze, das Gesicht verborgen. Sie bewegt sich nicht, sondern steht ihr einfach gegenüber. Angel weiß nicht, was es ist, aber sie fühlt sich plötzlich kalt und allein.
»Quién es?«, ruft sie mit brechender Stimme.
Die Gestalt schweigt weiterhin, starrt sie nur an und bewegt sich dann hölzern durch die Trümmer. Ihr Umhang weht in dunklen Falten hinter ihr her. Angel weiß plötzlich, wer das ist, und was diese Gestalt will. Sie weiß, warum Johnny sie hierher gebracht und zurückgelassen hat.
Sie wartet, erwartet bereits das Undenkbare.
Angel erwachte in beißender Kälte und Dunkelheit. Sie lag halb begraben in einer Schneewehe, ihr zerschlagener Körper steif und kalt. Ihre Wunden unter der Kleidung waren vereist, und an einigen Stellen war die Kleidung gefroren, aber sie spürte kaum etwas von ihren Schmerzen. Der Wind blies in heftigen Böen und wirbelte den Schnee in komplizierten Mustern durch die leere Landschaft. Eispartikel stachen ihr ins Gesicht, wo sie immer noch Gefühl hatte, tanzten an den Rändern ihres Blickfelds wie kleine Lebewesen. Über ihr leuchteten die Sterne hell und klar am wolkenlosen Nachthimmel.
Sie befand sich auf dem Berg, den die Elfen Syrring nannten, war auf einem der oberen Hänge im Schnee zusammengebrochen. Angel war nach ihrem Kampf mit dem Dämon hierhergekrochen, sie hatte versucht, die Eishöhle zu erreichen, in die Kirisin und seine Schwester zuvor gegangen waren. Sie hatte ihre letzten Kräfte mobilisiert, um dorthin zu gelangen, wo sie jetzt war, aber sie wusste bereits, dass das nicht genügen würde.
Sie lag im Sterben.
Sie staunte, wie bereitwillig sie diese Tatsache akzeptierte, wie klar sie es erkannte. Sie hätte dagegen ankämpfen sollen, sich anstrengen, um ihrem Schicksal zu entgehen. Die Elfen wurden vielleicht durch den zweiten Dämon bedroht und brauchten sie. Sie wusste, wenn sie hier liegen blieb, wenn sie nicht mehr aufstehen und weitergehen konnte, würde sie ihnen nicht helfen können. Aber eine tiefe und allumfassende Lethargie durchdrang sie, drückte mit ihrem gewaltigen Gewicht jeden Widerstand nieder und bewirkte, dass sie einfach nur dalag und die dunklen Hände akzeptierte, die nach ihr griffen, um sie zu holen.
Wieder sah sie die Gestalt im Umhang, die im Traum zu ihr gekommen war, die, zu der der Geist von Johnny sie geführt hatte. Der Tod wartete geduldig, bis sie zu ihm kam, und nun hatte sie ihn beinahe erreicht. Wieder dachte sie an den vierbeinigen Schrecken, der sie in diesen Zustand versetzt hatte, ein Geschöpf, das seine Gestalt gewandelt hatte, erst eine Frau mit borstigem blondem Haar gewesen war und dann ein riesiges Katzenwesen – in jedem Fall immer ein Dämon mit dem unersättlichen Bedürfnis, sie zu vernichten.
Was er nun offenbar erreicht hatte.
Sie war müde, so müde.
Angel konnte die Tränen spüren, die sich in ihren Augenwinkeln sammelten, über ihr Gesicht liefen und dort zu Eis wurden.
Mit einer Hand packte sie ihren geschnitzten schwarzen Stab, aber sie konnte kein Leben darin spüren. Die Wärme der Magie schien verschwunden, und die Runen, die die Bereitschaft des Stabs verkündeten, waren dunkel und starr.
Was sollte sie tun? Sie konnte weiter vorwärts durch den Schnee kriechen und nach der Eishöhle und einer Zuflucht suchen. Aber sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, und im Dunkeln gab es nichts, was ihr den Weg gewiesen hätte. Die Wunden, die ihr der Kampf eingebracht hatte, hatten sie vollkommen erschöpft, ihr Energie und Kraft, Willensstärke und Entschlossenheit geraubt. Es fühlte sich alles so hoffnungslos an. Sie wusste, es war falsch, so zu empfinden, aber sie konnte nichts dagegen tun.
Der Traum, dachte sie plötzlich, war eine Vorahnung dessen gewesen, was auf sie zukam. Sie würde Johnny wieder sehen. Sie ging dorthin, wo er auf sie wartete, fern von dieser Welt, fern von diesem Wahnsinn.
Tienes frío, Angel?, hörte sie ihn aus dem Dunkeln fragen. Ist dir kalt? Tienes miedo de morirte? Hast du Angst zu sterben?
»Estoy muy cansada«, flüsterte sie. So müde.
Sie würde zu ihm gehen und hinter sich lassen, was sie noch an diese Welt fesselte, all ihre Hoffnungen und Pläne und ihr Pflichtgefühl gegenüber dem Wort und seinem Befehl. Sie hatte getan, was sie konnte, und mehr war ihr nicht möglich.
Sie schloss die Augen und driftete davon, ein befreiendes und angenehmes Gefühl. Auf dem Versprechen eines langen, tiefen Schlafs schwebte sie, ein Schlaf, nach dem sie an einem besseren Ort aufwachen würde. Wieder bei Johnny. Ihre Kindheit bei ihm war so schön gewesen! Deshalb erschien er jetzt in ihren Träumen. In ihren Erinnerungen war er das Beste in ihrer zerstörten Kindheit gewesen – nicht ihre toten Eltern, ihre kaputte Welt. Nur Johnny.
Dann kam er plötzlich auf sie zu, umgeben von blauem Licht, das in der Dunkelheit blitzte wie ein Stern. Sie öffnete überrascht die Augen, und die Helligkeit erstreckte sich bis zu ihr, umhüllte sie mit Wärme. Sie fiel über die weite verschneite Fläche, ein stetiger Strahl, der von weit her kam, um sie zu umfassen. Sie hob die Hand, versuchte, sie zu packen.
»Angel«, rief jemand.
Sie sah, wie eine Gestalt aus dem Schneegestöber und der dunklen Nacht erschien, in einen schweren Umhang gehüllt gegen die Kälte. Das blaue Licht ging von seiner ausgestreckten Hand aus. Sie versuchte, ihm zu antworten, aber ihr Mund war trocken, und die Worte kamen nur als heiseres Flüstern heraus.
»Angel!«, wiederholte er.
»Johnny«, gelang es ihr zu antworten.
Er kniete sich vor sie, und das blaue Licht erlosch. »Angel, ich bin es, Kirisin«, sagte er und beugte sich vor, das junge Gesicht vor Kälte verzerrt.
Sie starrte ihn an und versuchte, in seinen Zügen Johnnys Gesicht zu finden. Es gelang ihr nicht, aber schließlich erkannte sie, wen sie vor sich hatte. Nicht Johnny. Kirisin. Sie blinzelte gegen ihre Tränen an. Sie war wieder in der wirklichen Welt, lag kalt und frierend auf dem gefrorenen Hang des Syrring, immer noch am Leben, aber nur noch schwach. »Kirisin«, sagte sie.
Er wischte den Schnee von ihr und betrachtete forschend ihre blutige Kleidung. »Kannst du aufstehen?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Ich werde dir helfen«, sagte er sofort. »Du wirst hier erfrieren. Wir müssen dich reinbringen, raus aus dieser Kälte.«
Er brachte sich in eine Position, die ihm eine gewisse Hebelwirkung ermöglichte, und schob einen Arm unter Angel, um sie hochzuziehen. Die Schmerzen fluteten wieder in ihren Körper zurück, als er das tat, die Wunden öffneten sich erneut. Aber er brachte sie in eine sitzende Position, legte dann beide Arme um sie und zog sie auf die Beine. Sie lehnte sich an ihn, unfähig, sich zu bewegen.
»Wenn du nicht gehen kannst, werde ich dich tragen«, sagte er, den Mund an ihr Ohr gepresst, so dass sie ihn trotz des heulenden Windes hören konnte.
Beinahe hätte sie laut gelacht; sie wusste, dass er für eine solche Aufgabe zu klein war. Dennoch, sie ließ es ihn versuchen. Sie nahm ihren schwarzen Stab und stützte sich darauf. Das ermöglichte ihr, einen Schritt zu machen. Dann versuchte sie einen weiteren Schritt, bewegte den Stab, machte noch einen Schritt und so weiter, während Kirisin langsam mit ihr ging, ihr Gewicht auf seinen Schultern, und sie mit den Armen leitete.
»Es ist nicht weit«, sagte er schwer atmend.
Sie nickte. Sprechen konnte sie nicht.
»Ist der Dämon tot?«, fragte er einen Augenblick später. Der Pulverschnee hatte seinen gebeugten Körper bereits mit einer Schicht Weiß überzogen, einer Art Umhang, der aus der Leere herangeblasen worden war. Er sah aus wie ein Geist. Sie wahrscheinlich ebenfalls.
Angel nickte. Tot. »Der andere?«, brachte sie keuchend heraus.
»Ebenfalls tot. Ich werde alles erklären, wenn wir drinnen sind.«
Mühsam legten sie noch ein paar Schritte zurück, und dann noch einige. Der Schnee peitschte auf sie ein, griff sie mit winzigen stechenden Flocken an. Angel war noch nie so kalt gewesen, aber zumindest spürte sie wieder etwas. Nicht überall – der größte Teil ihres Körpers war immer noch taub und reagierte nicht –, aber genug, um zu wissen, dass sie immer noch lebte.
Flüchtig dachte sie an den Traum und an Johnny, der sie vom Leben zum Tod führte, von dieser Welt in die nächste. Es hatte so echt gewirkt, so nah. Sie hatte mit ihm gehen wollen, bei ihm bleiben. Aber nun wurde ihr klar, dass es die Wunden und die Kälte gewesen waren, die sie verlockt hatten. Der Traum war ein Trick gewesen, ein Versuch, ihr ihre Willenskraft zu rauben und sie zur Sklavin zu machen.
Sie war noch nicht bereit für den Tod – er würde warten müssen.
Aber vielleicht nicht sehr lange, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie hatte ihn weggeschoben, aber er verharrte am Rand ihres Blickfelds und in den Winkeln ihres verwundeten Körpers. Er würde schnell kommen, um sie zu holen, wenn sie auch nur ein klein wenig nachgab. Wenn sie überleben wollte, würde sie sich ungeheuer anstrengen müssen.
Eine Anstrengung, zu der nur ein Ritter des Wortes imstande war.
Sie stolperte und wäre beinahe gefallen. Kirisin packte sie fester, um sie aufrecht zu halten, und wartete kurz, bis sie ihr Gleichgewicht wieder gefunden hatte, ehe er weiterging. Sie richtete sich auf und starrte konzentriert in die Dunkelheit vor sich, wo der Berghang sich wie eine schwarze Wand zu den Sternen erhob.
»Ich hätte dich beinahe nicht gefunden«, sagte der Junge plötzlich, aber seine Stimme ging im Heulen einer Windbö beinahe unter. Er rang nach Atem, selbst langsam erschöpft, weil er sie stützen musste. »Zunächst habe ich nicht an sie gedacht. Zu neu, nehme ich an. Aber die Elfensteine können alles finden, sogar dich.«
Das blaue Licht, dachte sie. Es war die Magie der Elfensteine gewesen, die sie in der Dunkelheit gesehen hatte. Kirisin hatte mit Hilfe der Elfensteine nach ihr gesucht. Kluger Junge! Sie hätte ihn von sich aus nicht finden können. Hätte es nie aus dem Schnee und der Kälte herausgeschafft. Er musste das erkannt haben.
»Ich hatte aufgegeben«, gab sie flüsternd zu.
Er antwortete nicht, aber sein Griff um ihre Taille wurde fester. Gib jetzt nicht auf, sagte er ohne Worte. Ich bin hier, und ich helfe dir.
Eng aneinandergedrückt stolperten sie durch die Nacht.
3
Kirisin verknotete den letzten Stich an der letzten von Angels vielen Wunden, legte die Nadel und den Faden beiseite und setzte sich zurück auf die Fersen, um ihre reglose Gestalt zu betrachten. Sie schlief; die Medizin, die er ihr gegeben hatte, half, ihr die Schmerzen zu nehmen und sie bewusstlos zu machen. Auf diese Weise hatte sie wahrscheinlich beinahe nichts von seiner Arbeit gespürt, und das war gut so, wenn man das Ausmaß ihrer Verletzungen bedachte. Aber wenn sie wieder wach wurde, würden auch die Schmerzen zurückkehren, und er würde ihr eine weitere Dosis geben müssen.
Plötzlich fiel ihm auf, dass er ihren beinahe nackten Körper betrachtete; er hatte ihre zerfetzte Kleidung entfernt, um besser arbeiten zu können. Als er es tat, hatte er nur daran gedacht, wie blutig Körper und Kleidung waren, wie viel Blut sie auf dem Hang verloren haben musste und wie nahe sie dem Tod wahrscheinlich war.
Er zog die Decke über sie und stopfte sie vorsichtig unter Angel fest. Wenn sie überlebte, würde sie ihm verzeihen.
»Fertig?«, fragte Simralin von der Seite. Sie saß nun aufrecht und lehnte sich gegen einen Felsvorsprung.
Er schaute zu ihr hinüber und nickte knapp. »Ich habe getan, was ich konnte, Sim. Ich hoffe nur, es ist genug.«
Sie hatten sich tief in die Eishöhle zurückgezogen, wo der Wind und der Schnee nicht eindringen konnten. Nur die Kälte weigerte sich, draußen zu bleiben, und dagegen konnten sie nichts tun. Sie trugen ihre Allwetterkleidung, und Simralin und Angel waren außerdem in Decken gewickelt. Zwei Solarlampen standen am Rand ihres kleinen Lagers und beleuchteten die dunkle Höhle. Ein Feuer wäre besser gewesen, aber sie hatten bis auf ihre Ausrüstung nichts zu verbrennen. Simralin hatte Kirisin ein Sonnenplättchen gegeben, einen künstlichen Hitzegenerator, um ihn unter Angels Behelfsbett zu legen, aber er würde nicht länger als drei Stunden Wärme spenden, und sie hatten keine mehr.
Er lächelte seine Schwester an. »Es scheint dir besser zu gehen.«
Sie verzog das Gesicht und betastete prüfend ihren Kopf. »Lass dich nicht täuschen. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er gespalten worden. Aber zumindest blutet die Wunde nicht mehr.« Sie zog eine Braue hoch. »Es ist vor allem mein Ego, das verletzt wurde. Ich hätte nie daran gedacht, mich zu fragen, was Culph hier machte, wie er seinen angeblichen Tod überlebt oder wie er uns gefunden hat. Ich habe es einfach akzeptiert. Ich dachte, es wäre eine Art von Wunder, drehte ihm den Rücken zu und gab ihm damit die Gelegenheit, mir eins überzuziehen. Dumm von mir.«
»Ich war auch nicht schlauer«, erwiderte Kirisin. »Als ich dich dort blutüberströmt liegen sah, dachte ich, du wärst tot. Selbst nachdem er sagte, dass du nicht tot seist, dachte ich das. Ich war überzeugt, er hätte dich umgebracht.«
Er sprach immer noch von Culph, als wäre er tatsächlich ein Elf gewesen und kein Dämon. Es war ihm unmöglich, das Bild des alten Mannes zu verdrängen, der sich als ihr Freund ausgegeben hatte. Culph hatte sie alle getäuscht, sie auf dem Weg zu dieser Höhle ununterbrochen manipuliert. Von dem Augenblick an, als er Kirisin und Erisha im Archiv im Keller des Palastes der Belloruus-Familie erwischte, hatte er sie ausgenutzt. Diese Erinnerung brannte wie Feuer, und Kirisin wusste, es würde noch lange dauern, bis er sich von ihr lösen konnte.
»Er hätte uns beide umgebracht«, sagte seine Schwester, »wenn er mit dem Loden erreicht hätte, was er wollte. Mich zuerst und dann dich, sobald du mit dem fertig gewesen wärst, was du für ihn hättest erledigen sollen.«
Kirisin schauderte, als er sich daran erinnerte, wie es sich angefühlt hatte, von dem Dämon beherrscht zu werden, hypnotisiert von der Bewegung der Silberschnur und der Ringe, die Culph vor ihm hatte baumeln lassen. Er war vollkommen gebannt gewesen, bis Simralin, die nach dem Schlag auf ihren Kopf wieder zu Bewusstsein gekommen war, dem Dämon ihr langes Messer ins Bein gestoßen, seine Konzentration gebrochen und damit ihrem Bruder gestattet hatte, die Elfensteine zu verwenden, um den Dämon zu vernichten.
Ihn zu Asche zu verbrennen.
Hatte er irgendwie geahnt, dass die Steine dazu fähig waren? Er dachte zum ersten Mal, seit es geschehen war, darüber nach. Vielleicht unterbewusst. Er konnte sich dessen nicht sicher sein, aber seine Instinkte hatten ihm gesagt, dass der Dämon Angst vor dieser Magie hatte, dass er Kirisin von Anfang an gebraucht hatte, damit er ihm helfen würde, sie zu beherrschen. Sobald der Junge sich von der hypnotischen Wirkung von Ringen und Schnur losgerissen hatte, hatte er die Magie heraufbeschworen, und der Dämon hatte sich nicht dagegen verteidigen können. Das war sein Untergang gewesen.
Der alte Culph, jetzt war er tatsächlich tot.
»Was genau wollte er denn von dir?«, fragte seine Schwester.
Sie hatten nur kurz darüber gesprochen, während er versucht hatte, in der Eishöhle Angels Wunden zu versorgen. Zuvor hatten sie keine Zeit gehabt. Der Dämon war tot, seine Schwester bewusstlos, und ihre Freundin und Beschützerin war dort draußen in der kalten Nacht und kämpfte wahrscheinlich gegen den zweiten Dämon, den vierbeinigen, der Erisha getötet und nun Angel wahrscheinlich verwundet oder ebenfalls umgebracht hatte. Kirisin hatte keine Zeit verloren, nachdem er wieder zu Verstand gekommen war. Er hatte sich in seinen Umhang gewickelt und war durch die Höhle zurückgeeilt, auf den Hang des Syrring.
Im Nachhinein fand er es seltsam, dass er sofort gewusst hatte, was er tun musste, um Angel zu finden. Er hatte entdeckt, dass die Elfensteine die Macht besaßen, den Dämon zu vernichten, sich dann aber schnell wieder erinnert, dass es sich eigentlich um Suchsteine handelte, die alles finden konnten, was vor ihrem Benutzer verborgen war. Das galt nicht nur für Gegenstände, sondern auch für Personen. Er hatte am Ausgang der Höhle gestanden, den dunklen Berghang unter dem Sternenhimmel angesehen, sich Angels Gesicht vorgestellt und die Magie heraufbeschworen. Diese Magie war immer noch heiß und lebendig in ihm, sie hatte sich nach seinem Kampf mit dem Dämon noch nicht vollkommen zurückgezogen und war sofort wieder aufgeflackert. Auf dem Höhepunkt des blauen Leuchtens hatte er Angels schneebedeckte Gestalt am Hang entdeckt, keine hundert Schritt unterhalb von ihm, und war sofort zu ihr gegangen.
Nachdem er sie gefunden und zurückgebracht hatte, stellte er fest, dass Simralin wieder wach war, blutig und erschöpft, aber immer noch am Leben. Als sie sah, in welcher Verfassung die Ritterin des Wortes war, hatte sie ihn gedrängt, sich sofort um Angel zu kümmern. Während er das tat, hatte seine Schwester sich das Blut ihrer eigenen Verletzung abgewaschen, sich behelfsmäßig verbunden und nur wenig mit ihm gesprochen. Sie wollte ihn nicht ablenken, solange er an Angel arbeitete. Nur einmal hatte sie gesprochen, und zwar, um ihn nach der silbernen Schnur und den Ringen zu fragen. Kirisin hatte erklärt, wozu sie gut waren, wie sie ihn an den Dämon hatten binden sollen und dass sie das auch getan hätten, wenn Simralin ihn nicht mit ihrem Messer getroffen und damit Kirisin die Gelegenheit gegeben hätte, die Elfensteine zu nutzen, um ihren Feind in Brand zu stecken.
»Ich wünschte, ich hätte es selbst tun können«, hatte sie gemurmelt, bevor sie sich zurücklehnte und eindöste.
Er hatte sich Sorgen gemacht, als sie einschlief; schließlich hatte sie eine Kopfwunde. Aber er war auch zu sehr damit beschäftigt gewesen, Angel zu behandeln, um sich sofort um Simralin kümmern zu können. Nur hin und wieder hatte er mit seiner Heilerarbeit aufgehört, um nach seiner Schwester zu rufen und sie lange genug zu wecken, so dass sie knurren und murmeln konnte, er sollte sie in Ruhe lassen. Aber zumindest war er sich so jedes Mal sicher, dass sie noch lebte.
Dennoch war er erleichtert gewesen, als sie schließlich wirklich wieder erwacht war und begonnen hatte, mit ihm zu sprechen.
»Er hatte vor, mich in die Cintra zurückzubringen und den Loden zu benutzen, um Arborlon, die Ellcrys und die Elfen festzusetzen«, erklärte er. »Sobald er alle Elfen an einem Ort eingesperrt hätte, hätten die Dämonen mit ihnen machen können, was sie wollten. Mich hätte er als Werkzeug benutzt, um das zu erreichen, und ich glaube nicht, dass ihn irgendetwas hätte aufhalten können. Niemand konnte auch nur ahnen, was los ist.«
Er schaute hinab zu seiner ausgebeulten Tasche – wo sich der Beutel mit den Elfensteinen befand. »Weißt du was, Sim? Ich hatte noch nicht darüber nachgedacht, aber die Steine sind für die Elfen ebenso gefährlich wie für alle anderen auch. Die Magie kümmert sich nicht darum, zu welchem Volk man gehört oder ob man gute oder schlechte Absichten hat, sie behandelt alle gleich. Culph musste nur einen Elf finden, den er überreden konnte, die Steine einzusetzen.«
Simralins Lächeln war angespannt und bitter. »Gib dir nicht so schnell die Schuld, Klein-Kah. Keiner von uns hat die Regeln dieses Spiels verstanden. Bis heute nicht. Niemand von uns hat das Wesen der Magie verstanden, die du eingesetzt hast. Dieser Geist in Ashenell, Pancea Rolt Gotrin – sie wusste es. Deshalb hat sie dich gewarnt. Wenn Angel am Hang da draußen gestorben wäre und Culph mich umgebracht hätte, wärest du allein und nicht mehr Herr deiner selbst gewesen. Und das haben wir beinahe geschehen lassen. Wir alle.«
»Nun, es wird nicht wieder passieren«, sagte Kirisin leise. »Das verspreche ich dir.«
»Ich nehme dich beim Wort. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis diese Sache ausgestanden ist. Erst müssen wir nach Arborlon zurückkehren.«
»Warte mal!«, rief Kirisin plötzlich und riss die Augen auf. »Mir ist gerade etwas eingefallen. Culph sagte, dass er – der Dämon sagte, er habe eine Armee nach Arborlon gerufen, um dafür zu sorgen, dass keiner entkommt. Dann wäre er mit mir zurückgekehrt, um die Stadt im Loden festzusetzen! Er hat damit geprahlt, während er diese Schnur und die Ringe benutzte, um mich zu hypnotisieren! Eine Armee von Dämonen und Einst-Menschen, Sim! Sie befinden sich wahrscheinlich schon dort und warten!«
Simralin richtete sich auf, zuckte vor Schmerz zusammen und ließ sich schnell wieder zurücksinken. »Also gut. Dann müssen wir Arissen Belloruus und den Hohen Rat warnen. Wir müssen sie überreden, alle von dort wegzubringen.«
»Wie sollen wir das machen?«, wollte Kirisin wissen. »Der König und wahrscheinlich der gesamte Rat denken, dass wir Erisha umgebracht haben. Sie halten uns für Verräter! Niemand wird uns glauben.«
Seine Schwester starrte ihn einen Moment lang an, dann sagte sie: »Wir werden sie dazu bringen, uns zu glauben.«
»Kein Problem«, bemerkte Kirisin sarkastisch.
»Warte mal, Klein-Kah. Vielleicht brauchen wir es sowieso niemandem zu sagen. Denk doch nach. Eine ganze Armee rückt gegen die Cintra vor? Die Elfen wissen wahrscheinlich schon davon. Späher und Wachen werden es ihnen gesagt haben. Eine ganze Armee kann ihnen doch nicht entgangen sein!«
Kirisin schüttelte den Kopf. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie sie es machen wollten. Vielleicht haben sie vereinbart, dass die Armee nicht näher kommen wird, bis die Elfen im Loden festsitzen.«
Seine Schwester nickte. »Kann sein. Kann sein, dass sie warten sollten, bis du zurückkommst. Die anderen Dämonen können nicht wissen, dass Culph tot ist. Oder seine vierbeinige Begleiterin. Sie werden warten und sehen müssen, was passiert. Das ist unsere Chance.«
»Die Chance, uns vom König in den Kerker werfen zu lassen«, sagte Kirisin. »Ich weiß immer noch nicht, wie wir ihn jemals davon überzeugen sollen, dass wir die Wahrheit sagen. Selbst wenn er die Armee kommen sieht, wird er wahrscheinlich denken, dass wir irgendwas damit zu tun haben. Ich wette, er weiß schon jetzt, was er davon halten soll.«
Einen Augenblick lang schwiegen beide und sahen einander in der Stille der Höhle an, über die Dunkelheit und die Kälte hinweg, die auf sie eindrangen. Kirisin dachte, dass sie auf sich allein gestellt waren, dass es niemanden gab, an den sie sich wenden konnten, niemanden, der ihnen helfen würde. Und so würde es auch bleiben.
»Es wird schon alles gut werden«, sagte seine Schwester leise.
Sicher, dachte Kirisin. Immer vorausgesetzt, wir lernen, zu fliegen und uns in Luft aufzulösen.
»Ich weiß«, sagte er stattdessen. Er gähnte. »Ich bin erschöpft, Sim. Vielleicht werde ich ein bisschen schlafen; du solltest das auch tun.«
Simralin sagte nichts. Sie saß nur da und starrte ihn an. Nach einem Moment sagte sie: »Du wirst schon sehen, Klein-Kah. Es wird gut gehen.«
Sie saß immer noch da und starrte geradeaus, als er einschlief.
Er erwachte und sah Spuren von Tageslicht, die durch vereiste Risse in der Decke bis in die Höhle fielen. Simralin bewegte sich leise, suchte ihre Ausrüstung zusammen und verteilte sie auf zwei Rucksäcke um. Sie sah blass, aber ruhig aus, als das Licht ihr zerschlagenes Gesicht beleuchtete.
»Hast du gut geschlafen?«, fragte sie ohne jede Ironie. Sie hatte immer noch den Behelfsverband um die Stirn und ihren Allwetterumhang um die Schultern und sah aus wie ein Gespenst. Als sie bemerkte, dass er sie anstarrte, fragte sie: »Was ist denn?«
»Du siehst aus, als hättest du so gut wie kein Blut mehr in dir. Geht es dir gut?«
»So gut es unter den Umständen möglich ist. Du solltest lieber aufstehen. Wir brechen auf, sobald ich fertig bin.«
Er stützte sich auf einen Ellbogen, womit sich der Kampf vom Vortag und seine Folgen schmerzhaft wieder in Erinnerung brachten. »Und wohin gehen wir?«
Sie nickte zum Gang hin. »Wieder nach draußen und den Berg runter. Du hast für Angel getan, was du konntest, aber sie braucht jemanden, der als Heiler besser ausgebildet ist.«
Kirisin warf einen Blick zu der Frau, die immer noch schlief. Wenn man von ihrem Gesicht und den Händen einmal absah, war sie tief in den Decken vergraben, die sie ihr am Vorabend gegeben hatten, und er konnte nicht erkennen, ob sie atmete oder nicht. Sie trug frische Kleidung; seine Schwester hatte sie offenbar angezogen, während er noch schlief. Er betrachtete sie einen Augenblick, dann sagte er zu Simralin: »Lebt sie noch?«
»Vor einer halben Stunde zumindest schon. Warum schaust du sie dir nicht an?«
Kirisin raffte sich auf und kämpfte gegen die Steifheit und die Schmerzen in seinen Muskeln und Gelenken an. Ihm war, als hätte man ihn mit Steinen geschlagen. Er ließ den Umhang fallen, stolperte hinüber zu Angel und kniete sich neben sie. Es war nur vage erkennbar, wie sich ihre Brust hob und senkte. Ihr Gesicht war voller Prellungen, und ihre Fingerknöchel waren abgeschürft. Und das waren nur die oberflächlichen Wunden. Die Verletzungen unter den Verbänden sahen viel schlimmer aus.
»Wie können wir sie wieder vom Berg herunterbringen?«, fragte er.
»Am besten machen wir eine Schlinge und tragen sie. Wir können es uns nicht leisten, sie einfach über den Boden zu ziehen. Das Gelände ist dafür zu rau. Sie hat innere Verletzungen – vielleicht ein paar gebrochene Rippen. Unmöglich, sie über diese Unebenheiten zu ziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich so wenig wie möglich bewegt. Vielleicht könnte man ihren Stab als Stütze für die Schlinge verwenden. Warum versuchst du nicht, ihn ihr aus den Händen zu nehmen, damit ich etwas daraus bauen kann?«
Kirisin schaute nach unten. Angel hatte den schwarzen Stab fest mit beiden Händen gepackt, und es sah nicht so aus, als wollte sie ihn loslassen. Dennoch, er griff vorsichtig nach unten und versuchte, den Stab herauszuziehen.
Sofort öffnete die Ritterin die Augen. »Kirisin«, flüsterte sie warnend. »Nicht.«
Er wich rasch zurück. »Tut mir leid. Aber wir brauchen deinen Stab, um eine Schlinge zu bauen, damit wir dich wieder den Berg heruntertragen und … und Hilfe für dich finden können …«
Er brach ab, denn er erkannte plötzlich, dass er nicht wusste, was danach geschehen sollte. Er warf Simralin einen Blick zu, die mit Packen aufgehört hatte und sie beobachtete. »Ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll, wenn wir vom Berg herunterkommen.«
Seine Schwester stand auf und kniete sich neben ihren Bruder. »Sobald wir die Wiesen erreichen, benutzen wir den Heißluftballon, um von hier wegzufliegen.« Sie beugte sich dicht zu Angel. »Es geht einfach um Folgendes: Kirisin hat für dich getan, was er kann, aber er ist dazu ausgebildet, Pflanzen zu heilen und nicht Menschen. Ich weiß nicht, wie schwer du verwundet bist, und er ebenfalls nicht. Wir brauchen jemanden, der sich damit besser auskennt als wir. Wie übel fühlt es sich denn an?«
Angel schüttelte den Kopf. »Gebrochene Rippen, vielleicht auch der Arm. Oder vielleicht sind sie nur angeknackst. Alles tut weh, selbst wenn ich mich nicht bewege.« Sie befeuchtete die Lippen und sah Kirisin an. »Hast du den Loden gefunden?«
Er nickte. »Ich habe ihn.«
»Erzähl mir, was passiert ist.«
Er warf einen Blick zu Simralin, und seine Schwester nickte. Rasch umriss er die Ereignisse, die zum unerwarteten Erscheinen des Dämons Culph und zur Entdeckung seines komplizierten Betrugs geführt hatten. Er erzählte ihr, wie er ins Maul des Eisdrachens gegangen war und sich den Loden geholt hatte, und wie plötzlich der alte Mann vor ihm stand, als er wieder herauskam. Er berichtete, wie der Dämon versucht hatte, ihn mit Hilfe der Silberschnur und der Ringe zu hypnotisieren, weil er ihn in die Cintra zurückbringen wollte, um ihn dort zu benutzen und die Elfen und ihre Stadt mit Hilfe der Magie festzusetzen. Simralin hatte ihn gerettet, indem sie den Dämon mit dem Messer ins Bein stach, was Culphs Konzentration unterbrach und es Kirisin erlaubte, sich aus dem Bann zu lösen und die Magie der blauen Elfensteine einzusetzen.
Er verschwieg bewusst die seltsame Euphorie, die ihn durchströmt hatte, als er die Magie der Elfensteine heraufbeschwor und beherrschte, womit er es sogar vor Simralin verheimlichte. Er war noch nicht bereit, darüber zu sprechen, war nicht bereit zuzugeben, was es bedeuten könnte.
»Ihr wart beide unglaublich tapfer«, sagte Angel. »Ich dachte, wenn ich euch nicht erreichen kann, würde der Dämon euch beide umbringen. Aber am Ende war ich es, die gerettet werden musste.«
»Erzähl uns, was passiert ist, nachdem wir dich zurückgelassen haben«, drängte Simralin.
Also berichtete Angel Einzelheiten ihres Kampfes mit Culphs Begleiterin, dem vierbeinigen Dämon, der sie den ganzen Weg von Los Angeles verfolgt hatte, erst als blonde Frau mit borstig hochgekämmtem Haar und später als wolfsähnliche Bestie. Sie konnten nur darüber spekulieren, wie viel weiter sie sich noch entwickelt hätte; jedenfalls war sie am Ende gefährlich genug gewesen, um die Ritterin des Wortes beinahe umzubringen. Bevor sie das Bewusstsein verloren hatte, war es Angel nur noch gelungen, in die ungefähre Richtung der Eishöhlen zu kriechen.
Sie sagte nichts über ihren Traum von Johnny und das Gefühl, dass er sie auf einen wartenden Tod zugeführt hatte, dem sie sich willig überlassen hätte.
Dann holte sie tief Luft, um sich gegen die unvermeidlichen Schmerzen zu wappnen, und versuchte, sich hinzusetzen. Es gelang ihr nicht, und sie lehnte sich wieder zurück. »Ihr müsst mir aufhelfen«, sagte sie zu den beiden.
»Wir werden dich tragen müssen«, stellte Simralin fest. »Versuch, nichts zu übereilen.«
»Ich versuche es. Aber ich weiß, was auf dem Spiel steht: Kirisin muss zurück in die Cintra. Er muss den Loden benutzen, um die Elfen zu retten. Wenn er das nicht tut, war alles umsonst.«
Simralin nickte. »Kirisin wird seine Chance bekommen, aber erst müssen wir uns um dich kümmern.«
»Ihr müsst mich mitnehmen.«
Überraschenderweise lachte Simralin. »Ein guter Plan. Wieso ist mir das nicht eingefallen?«
»Das habe ich ernst gemeint, Simralin. Du musst mich mitnehmen. Das ist der Auftrag, den ich erhalten habe – euch zu beschützen. Ich darf euch nicht allein gehen lassen.«
»Ich glaube nicht, dass du das entscheiden kannst.« Die Fährtenleserin beugte sich wieder näher zu Angel. »Ich habe schon Tote gesehen, die in besserem Zustand waren als du. Wenn du mit uns gehst, wirst du uns mehr behindern als du helfen kannst. Ich kann nicht dich und ihn beschützen. Und du kannst keinen von uns beschützen, ehe du geheilt bist. Ich bringe dich zu jemandem, der dich wieder gesund machen kann. Dann bringe ich Klein-Kah in die Cintra, wo er tut, was immer er tun muss.«
Angel schüttelte störrisch den Kopf. »Nicht ohne mich.«
Simralin seufzte. »Ich dachte, du hättest versprochen, es uns nicht so schwer zu machen.«
»Mir ist egal, was ich gesagt habe. Ich komme mit.«
»Ich fürchte, das wirst du nicht.«
Sie griff nach unten, legte die Finger direkt unterhalb von Angels Schädelbasis an ihren Nacken und drückte zu. Angels Lider flatterten einen Moment, dann schloss sie die Augen.
Simralin stand auf. »Sie ist bewusstlos. Nachher gebe ich ihr etwas, damit sie bewusstlos bleibt. Sie ist störrisch, wie? Hartnäckig. Kein Wunder, dass sie immer noch lebt.« Sie machte eine Geste zu Kirisin. »Nimm ihr den Stab ab, Klein-Kah. Aber vorsichtig.«
Zusammen bauten sie die Schlinge aus dem Stab und einem der Umhänge. Sie banden und fädelten die Ärmel und den unteren Saum am Stock fest und konstruierten eine Art Wiege. Dann legten sie Angel hinein, schulterten ihre Rucksäcke und hoben die Schlinge hoch. Kirisin hatte das Gefühl, Angel müsste mindestens dreihundert Pfund wiegen.
»Keine Sorge«, knurrte Simralin am anderen Ende des Stabs. »Wir machen unterwegs Rast. Lass mich einfach nur wissen, wenn es dir zu viel wird.«
Es ist jetzt schon zu viel, dachte Kirisin. Aber das sagte er nicht laut, sondern nickte nur. Er würde tun, was er tun musste, um Angel vom Berg herunter zu bekommen. Sie hätte das Gleiche für sie getan.
Sie hätte ihr Leben für Kirisin und seine Schwester gegeben.
Eine halbe Stunde später hatten sie die Höhle hinter sich gelassen und arbeiteten sich über das Eisfeld auf die Schneelinie und die darunter liegende Wiese zu.
4
Kirisin und Simralin brauchten beinahe vier Stunden, um Angel Perez – unterbrochen von vielen Pausen – wieder den Hang des Syrring hinunter und bis zu der Stelle auf der Wiese zu bringen, wo sie den Heißluftballon gelassen hatten. Ihr Weg war noch länger, weil sie gezwungen waren, eine andere Route zu nehmen, um raueres Gelände zu meiden. Als sie den Rand des Eisfeldes erreichten und vom Gletscher auf sichtbaren Boden traten, war es beinahe später Vormittag. Die Sonne stand direkt über ihnen, als sie den Ballon schließlich sahen.
Der Tag hatte hell und klar begonnen, aber im Lauf der Stunden verschleierte sich der Himmel und füllte sich mit Wolken. Ein Sturm bildete sich über den Bergen, und sie würden den Ballon in die Luft bringen müssen, bevor er losbrach, wenn sie nicht noch eine Nacht hier festsitzen wollten. Simralin gab sich alle Mühe, um Kirisin dazu zu bringen, dass er sich weiterbewegte – auch nachdem er ihr gesagt hatte, er könne nicht weiter. Er überraschte sich selbst, indem er jeden Gedanken an seine eigene Unbequemlichkeit beiseiteschob und auf das Drängen seiner Schwester und sein eigenes Pflichtgefühl hörte.
Wie viel von ihrer Welt, fragte er sich, würde die vorhergesagte Zerstörung überleben?
Er dachte daran, wie es sein würde, wenn die Elfen nicht mehr in der Cintra lebten, sondern irgendwo sonst, an einem Ort, den nicht sie kannten oder sich auch nur vorzustellen vermochten. Ihre neue Welt würde ihnen vielleicht vollkommen fremd sein. Er fragte sich, wie sich das Leben verändern würde, wenn die Katastrophe, die die Ellcrys vorhergesehen hatte, schließlich über sie hereinbrach. Dabei benutzte er nicht einmal das Wort falls, wenn es um diese Prophezeiung ging. Er akzeptierte, dass der Untergang ihrer Welt unvermeidlich war, so wie er inzwischen alles akzeptierte, was der Baum ihm gesagt hatte. Die Präsenz von Dämonen unter den Elfen hatte ihn überzeugt, dass sie eine neue Sichtweise der Dinge brauchten. Der Tod von Ailie und Erisha hatte diese Überzeugung nur verstärkt, er war eine scharfe Mahnung, dass das Leben, das ihm einmal so selbstverständlich vorgekommen war, sich dem Ende zuneigte. Diese Periode in der Geschichte der Elfen war vorüber, ebenso wie jene längst vergangene Zeit, als die Magie noch Teil ihres Lebens war. Die Menschen waren zur dominanten Spezies geworden. Kein Elf wollte so denken, schon gar nicht Kirisin, der am liebsten immer noch geglaubt hätte, dass die Elfen eines Tages ihre wichtige Position als erstes Volk in der Ordnung der Welt wiedererlangen würden.
Aber in der Welt der Gegenwart, der Welt der Dämonen und Einst-Menschen und anderer Dinge, die so schrecklich waren, dass sie den finstersten Alpträumen zu entstammen schienen, war keine Zivilisation wichtiger als die andere. Was einer zustieß, würde früher oder später allen zustoßen, und keine Heilerfähigkeiten, keine Elfenstein-Magie und kein Wunschdenken konnten daran etwas ändern.
»Klein-Kah«, rief Simralin scharf und riss ihn damit aus seinen Gedanken. »Der Sturm kommt. Wir müssen aufbrechen, hilf mir mit Angel.«
Zusammen hoben sie die Bewusstlose in den Korb und machten es ihr so bequem wie möglich, stützten sie gegen ihr Gepäck, schnallten sie an und wickelten mehrere Umhänge um sie, so dass sie beim Flug warm bleiben und nicht im Korb herumrutschen würde. Sie verluden ihre Rucksäcke und was ihnen noch an Ausrüstung und Vorräten geblieben war, dann lösten sie die Anker, die den Ballon sicherten, und stiegen auf.