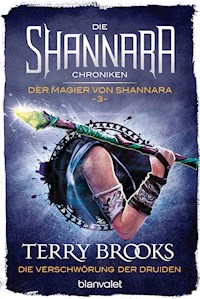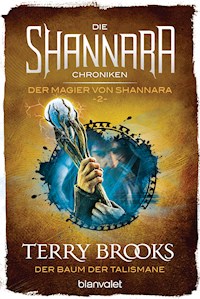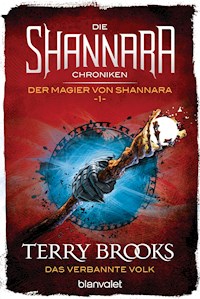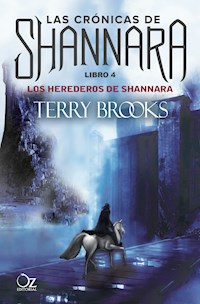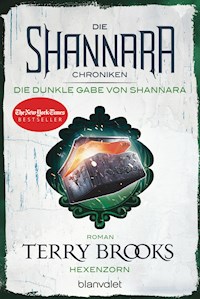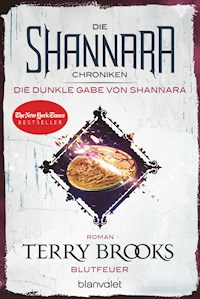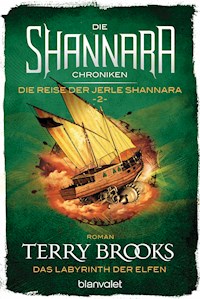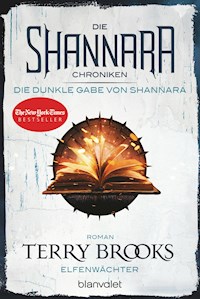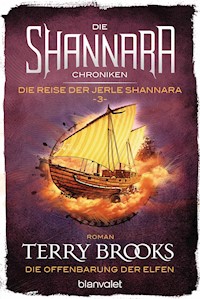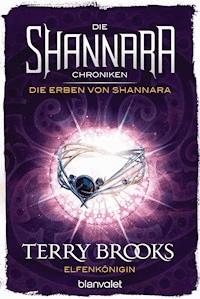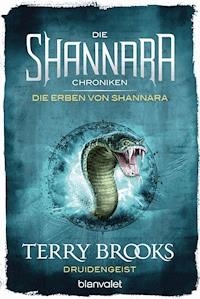2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Roman zum Fantasy-Serien-Highlight 2016
Einst war Amberle Elessedil eine Erwählte des Elcrys, des heiligen Baums der Elfen. Doch sie verließ seinen Dienst und wollte nie zurückkehren. Aber der Elcrys stirbt, und mit ihm vergeht auch der Bann, der die Dämonen aus der Welt der Sterblichen fernhält. Amberle ist die Einzige, die einen neuen Elcrys pflanzen kann, denn sie ist die Letzte der Erwählten. Widerwillig setzt sie alles daran, das letzte Samenkorn des Elcrys mit Hilfe des Blutfeuers zum Leben zu erwecken. Doch die Dämonen wissen von ihrer Aufgabe und sie werden alles tun, um sie aufzuhalten. Zum Glück hat ihr Allanon, der Weiseste der Druiden, den jungen Heiler Will zur Seite gestellt – und mit ihm die Elfensteine von Shannara!
Dies ist Teil 1 von 2 des Romans "Die Shannara-Chroniken - Elfensteine". Teil 2 erscheint unter der ISBN 978-3-641-19102-3.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Einst war Amberle Elessedil eine Erwählte des Elcrys, des heilige Baums der Elfen. Doch sie verließ seinen Dienst und wollte nie zurückkehren. Abe der Elcrys stirbt, und mit ihm vergeht auch der Bann, der die Dämonen aus der Welt der Sterblichen fernhält. Amberle ist einzige, die einen neuen Elcrys pflanzen kann, denn sie ist die letzte der Erwählten. Widerwillig setzt sie alles daran, das letzte Samenkorn des Elcrys mit Hilfe des Blutfeuers zum Leben zu erwecken. Doch die Dämonen wissen von ihrer Aufgabe und sie werden alles tun, um sie aufzuhalten. Zum Glück hat ihr Allanon, der weiseste der Druiden, ihr der junge Heiler Wil zur Seite – und mit ihm die Elfensteine von Shannara!
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch Das Schwert der Elfen war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere.
Terry Brook bei Blanvalet:
1. Das Schwert der Elfen (1: 19099 + 2: 19100)
2.Elfensteine (1: 19101 + 2: 19102)
Weitere Titel in Vorbereitung
Terry Brooks
DIE SHANNARA-CHRONIKEN
Elfensteine
Teil 1
Roman
Aus dem Englischen von Mechthild Sandberg-Ciletti
Vollständig durchgesehen und überarbeitet von Andreas Helweg
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Replace outdated disclaimer texts as necessary, make sure there is only one instance of the disclaimer.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Elfstones of Shannara, Part 1« bei Ballantine Books, New York
Der vorliegende Roman ist bereits in geteilter Form im Goldmann Verlag und im Blanvalet Verlag erschienen unter den Titeln: »Die Elfensteine von Shannara«, »Der Druide von Shannara (Teil 1)«
E-Book-Ausgabe Dezember 2015
Copyright © der Originalausgabe 1982 by Terry Brooks
This translation published by arrangement with Ballantine Books,
A Division of Random House, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1982/1983 by
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Illustration: Max Meinzold, München
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-19101-6V003
www.penguin.de
1
Die nahe Morgendämmerung erhellte schwach den nächtlichen Himmel, als die Erwählten den Garten des Lebens betraten. Draußen lag in tiefem Schlaf die Elfenstadt Arborlon, deren Bewohner noch die Wärme und Geborgenheit ihrer Betten genossen. Für die Erwählten hatte der Tag jedoch bereits begonnen. Ihre wallenden weißen Gewänder bauschten sich leicht in der sommerlichen Brise, als sie zwischen den Posten der Schwarzen Wache hindurchschritten, die – wie über Jahrhunderte hinweg eine endlose Zahl ihrer Vorgänger – starr und unbewegt vor dem gewölbten schmiedeeisernen Tor mit den kunstvollen Einlegearbeiten in Silber und Elfenbein standen. Die Erwählten eilten zwischen ihnen hindurch, und nur ihre leisen Stimmen und das Knirschen unter ihren mit Sandalen bekleideten Füßen störten die Stille des neuen Tages, als sie in die tiefen Schatten des Föhrenhains traten.
Die Erwählten waren die Hüter des Ellcrys, dieses seltsamen und wunderbaren Baumes, des alles überragenden Mittelpunkts des Gartens. Dieser Baum, so berichtete die Legende, schützte seit grauer Vorzeit das Elfenreich vor bösen Mächten, die schon vor Jahrhunderten das Volk der Elfen beinahe vernichtet hätten und die noch in einer Epoche, die weit vor dem Erwachen der Menschheit lag, von der Erde verbannt worden waren. In den folgenden Jahrhunderten hatten sich stets Erwählte gefunden, die den Ellcrys hegten und pflegten. Sie folgten einer Tradition, die von Elfengeneration zu Elfengeneration weitergereicht worden war, und die Elfen betrachteten die Aufgabe, die den Erwählten auferlegt war, als hohe Ehre und feierliche Pflicht.
Von Feierlichkeit jedoch war bei der Prozession, die an diesem Morgen durch den Garten zog, kaum etwas zu spüren. Zweihundertdreißig Tage ihres Dienstjahres lagen hinter ihnen, und das jugendliche Feuer in ihren Adern ließ sich nicht länger unterdrücken. Das anfängliche Gefühl tiefer Ehrfurcht vor der hohen Verantwortung, die man ihnen übertragen hatte, war längst verflogen, und die Erwählten, sechs junge Männer, würden nur eine Aufgabe erledigen, die ihnen seit ihrer Erwählung zur vertrauten Gewohnheit geworden war: die Begrüßung des Baums bei den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Nur Lauren, der jüngste Erwählte dieses Jahres, war still und in sich gekehrt. Er blieb ein paar Schritte hinter den anderen zurück und beteiligte sich nicht an ihrem übermütigen Geplauder. In Gedanken versunken hielt er den Rotschopf gesenkt, und auf seiner Stirn stand eine tiefe Falte der Nachdenklichkeit. Er war so sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, dass es ihm sogar entging, als das Geplapper vor ihm verstummte und sich einer der anderen umwandte und zu ihm gesellte. Erst als eine Hand seinen Arm berührte, hob er überrascht den Blick und bemerkte, dass Jase ihn forschend betrachtete.
»Was ist mit dir, Lauren? Fühlst du dich nicht wohl?«, fragte Jase. Er war einige Monate älter als die anderen Erwählten, die ihn deshalb als Führer akzeptierten.
Lauren schüttelte den Kopf, doch die Besorgnis wich nicht ganz aus seinem Gesicht.
»Nein, nein, es geht mir gut.«
»Aber du wirkst bedrückt. Den ganzen Morgen grübelst du schon. Ja, und gestern Abend warst du auch so still und schweigsam.« Jase legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter und drehte ihn herum, so dass Lauren ihm ins Gesicht sehen musste. »Komm schon, heraus mit der Sprache. Niemand erwartet von dir, dass du am Morgendienst teilnimmst, wenn du dich nicht wohl fühlst.«
Lauren zögerte, dann seufzte er und nickte.
»Also gut, es geht um den Ellcrys. Gestern Abend bei Sonnenuntergang hatte ich den Eindruck, dass Flecken auf seinen Blättern sind. Es sah aus wie Welke.«
»Welke? Im Ernst? Solche Krankheiten befallen den Ellcrys nicht – zumindest hat man uns das erzählt«, erwiderte Jase skeptisch.
»Ich kann mich ja getäuscht haben«, räumte Lauren ein. »Es dämmerte schon. Wahrscheinlich waren es nur Schatten auf den Blättern. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass es sich wirklich um Welke handelt.«
Von den anderen drang verstörtes Gemurmel herüber, und einer von ihnen machte seiner Sorge Luft.
»Das ist Amberles Schuld. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es Unheil bringt, wenn man ein Mädchen erwählt.«
»Es gab auch früher schon erwählte Mädchen, und deswegen ist nie etwas Schlimmes geschehen«, protestierte Lauren. Er hatte Amberle gemocht. Man konnte gut mit ihr reden, obwohl sie die Enkelin von König Eventine Elessedil war.
»Seit fünfhundert Jahren nicht mehr, Lauren«, entgegnete der andere.
»Hört mal, das reicht«, mischte sich Jase ein. »Wir haben vereinbart, kein Wort über Amberle zu verlieren. Das wisst ihr alle.«
Einen Moment lang schwieg er und dachte darüber nach, was Lauren gesagt hatte. Dann zuckte er die Schultern. »Es wäre schlimm, wenn dem Baum etwas passieren würde, schon gar, solange er unserer Pflege anvertraut ist. Aber es ist nun einmal so, nichts auf dieser Welt hält ewig.«
Lauren war entsetzt. »Aber, Jase, wenn die Lebenskraft des Baumes nachlässt, ist der Bann gebrochen, und die Dämonen, die jetzt in ihm gefangen sind, sind frei!«
»Glaubst du denn wirklich diese alten Märchen, Lauren?«, fragte Jase lachend.
Lauren starrte den Älteren ungläubig an.
»Wie kannst du ein Erwählter sein und sie nicht glauben?«
»Ich kann mich nicht entsinnen, dass mich jemand danach gefragt hat, was ich glaube, als ich erwählt wurde. Dich vielleicht, Lauren?«
Lauren schüttelte den Kopf. Denen, die sich um die Ehre bewarben, in den Kreis der Erwählten aufgenommen zu werden, wurden niemals Fragen gestellt. Die jungen Elfen, die im vergangenen Jahr das Erwachsenenalter erreicht hatten, wurden dem Baum ganz einfach vorgestellt. Zu Beginn des neuen Jahres versammelten sie sich im Garten des Lebens, um dann unter seinen ausladenden Ästen durchzuschreiten und von ihm angenommen zu werden. Jene, die der Baum an den Schultern streifte, wurden die neuen Erwählten, die ihm bis zum Ende des Jahres zu dienen hatten.
Lauren konnte sich noch an die glühende Freude und den Stolz erinnern, die er verspürt hatte, als sich ein schlanker Zweig zu ihm hinuntergeneigt und ihn berührt hatte. Im gleichen Moment hatte er seinen Namen vernommen.
Und er dachte auch an die Verwunderung aller Anwesenden, als Amberle gerufen worden war …
»Das ist doch nur ein Ammenmärchen«, sagte Jase. »Eigentlich soll der Ellcrys den Elfen nur eine Mahnung sein, dass sie genau wie er alle Veränderungen überstehen, die in der Geschichte der Vier Länder stattgefunden haben. Der Baum ist ein Symbol für die Kraft unseres Volkes, Lauren – nichts weiter.«
Er bedeutete ihnen, den Weg durch den Garten fortzusetzen, und wandte sich ab. Lauren verfiel wieder in tiefes Nachdenken. Es machte ihn betroffen, wie beiläufig der ältere Freund die Legende vom Baum abgetan hatte. Allerdings stammte Jase ja auch aus der Stadt, und Lauren hatte beobachtet, dass die Bewohner von Arborlon alten Überlieferungen und Traditionen nicht solche Bedeutung beimaßen wie die Bewohner des kleinen Dorfes im Norden, wo er geboren war. Doch alles, was über den Ellcrys und den Bann der Verfemung berichtet wurde, war nicht einfach eine Legende – es war das Fundament des wahrhaft Elfischen, das bedeutendste Ereignis in der Geschichte seines Volkes.
Vor langer, langer Zeit, noch vor der Geburt der neuen Welt, hatte ein gewaltiger Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen getobt, und die Elfen hatten schließlich gesiegt, indem sie den Ellcrys schufen und einen Bann der Verfemung verhängten, der die Dämonen des Bösen in zeitlose Finsternis verbannte. Und solange der Ellcrys seine Kraft bewahrt, solange würde das Böse nicht über das Land herfallen können.
Solange der Ellcrys bei Kräften blieb …
Voller Zweifel schüttelte er den Kopf. Vielleicht hatte ihm nur seine Fantasie etwas vorgegaukelt, als er gemeint hatte, Flecken auf den Blättern des Baumes zu sehen. Vielleicht hatte ihn das Dämmerlicht genarrt. Und wenn nicht, dann mussten sie eben ein Heilmittel finden. Und es gab immer ein Heilmittel.
Wenige Augenblicke später hatte er zusammen mit den anderen den Baum erreicht. Zögernd blickte er auf, dann stieß er einen Seufzer der Erleichterung aus. Der Ellcrys schien unverändert. In vollendeter Gestalt reckte sich der silberweiße Stamm himmelwärts, und über ihm spannte sich sanft gewölbt ein Netz sich verjüngender Äste und Zweige, deren breite, fünfzackige Blätter blutrot leuchteten. Am Fuß des Baumes wucherte grünes Moos in Rissen und Spalten der glatten Borke und zog sich durch das Silberweiß wie smaragdgrüne Bäche, die einen Berghang hinunterschießen. Keine Wunden entstellten die schönen Linien des Stammes, kein Ast war geknickt oder gebrochen. So vollendet schön, dachte er. Und wieder begutachtete er aufmerksam den Baum, fand jedoch kein Anzeichen der Krankheit, die er befürchtet hatte.
Die anderen gingen und holten die Geräte, die sie zur Pflege des Baumes und des Gartens brauchten. Als sich auch Lauren aufmachen wollte, hielt Jase ihn zurück.
»Möchtest du heute den Morgengruß sprechen, Lauren?«, fragte er.
Lauren dankte ihm stammelnd vor Überraschung. Eigentlich wäre Jase an der Reihe gewesen; doch er schien die Hoffnung zu hegen, er könne Lauren damit aufmuntern, wenn er ihm diese besondere Aufgabe übertrug.
Lauren trat unter das ausladende Dach der Zweige und legte seine Hände auf den glatten Stamm, während die anderen sich etwas abseits versammelten, um den Morgengruß zu sprechen. Erwartungsvoll blickte er gen Himmel und hielt Ausschau nach dem ersten Sonnenstrahl, der den Baum erleuchten würde.
Doch beinahe in demselben Moment wich er erschrocken zurück. Die Blätter unmittelbar über ihm waren mit dunklen Flecken übersät. Beklommen entdeckte er nun auch an anderen Stellen Flecken, überall im Laub des Baumes. Das war keine Täuschung des trügerischen Spiels von Licht und Schatten. Das war Wirklichkeit.
Hektisch winkte er Jase herbei und zeigte ihm die fleckigen Blätter, während die anderen dazukamen. Sie schwiegen, wie es das Ritual zu dieser morgendlichen Stunde gebot, doch Jase entfuhr ein nur mühsam unterdrückter Aufschrei des Schreckens, als er sah, wie groß der Schaden schon war. Langsam schritten die beiden jungen Männer um den Baum. Überall entdeckten sie jetzt Flecken, manche noch kaum sichtbar, während andere sich bereits so weit ausgedehnt hatten, dass kaum noch etwas vom ehemals leuchtenden Blutrot zu sehen war.
Ganz gleich, wie er zu der Legende stand, die sich um den Baum rankte, Jase war zutiefst erschrocken, und sein Gesicht spiegelte seine Bestürzung wider, als er zurücktrat, um sich flüsternd mit den anderen zu beraten. Lauren wollte sich ebenfalls zu ihnen gesellen, doch Jase schüttelte heftig den Kopf und deutete zum Wipfel des Baumes hinauf. Die ersten Strahlen der Morgendämmerung hatten die obersten Zweige beinahe erreicht.
Lauren kannte seine Pflicht. Ganz gleich, was geschah, die Erwählten mussten dem Ellcrys den Morgengruß entbieten, so, wie das seit der Gründung ihres Ordens Tag um Tag erfolgt war.
Behutsam legte er seine Hände auf die silberne Borke, und die Worte des Morgengrußes formten sich auf seinen Lippen, als ein schlanker Ast des uralten Baumes sich leicht abwärts neigte und seine Schulter berührte.
»Lauren!«
Der junge Elf fuhr beim Klang seines Namens heftig zusammen. Doch niemand hatte gesprochen. Der Laut war durch seinen Geist gedrungen, die Stimme kaum mehr gewesen als ein schemenhaftes Bild seines eigenen Gesichts.
Es war der Ellcrys!
Lauren hielt den Atem an, drehte den Kopf und warf einen flüchtigen Blick auf den Zweig, der auf seiner Schulter ruhte. Dann wandte er sich hastig wieder ab. Er war überwältigt. Nur einmal bisher hatte der Baum zu ihm gesprochen – am Tag seiner Erwählung. Auch damals hatte er seinen Namen gesagt; er hatte ihrer aller Namen genannt. Es war das erste und letzte Mal gewesen. Seitdem hatte er nie wieder mit einem von ihnen gesprochen. Außer mit Amberle, doch Amberle gehörte nicht mehr zu ihnen.
Er warf einen Blick auf die anderen. Sie starrten ihn an, neugierig, weil er so plötzlich innegehalten hatte. Der Zweig, der auf seiner Schulter ruhte, glitt abwärts und umschlang ihn locker. Lauren zuckte bei seiner Berührung unwillkürlich zusammen.
»Lauren! Ruf die Erwählten zu mir!«
Die Bilder flackerten auf und verschwanden wieder. Zögernd winkte Lauren die anderen zu sich. Sie traten näher und schauten zu den silberglänzenden Blättern empor. Fragen lagen ihnen auf der Zunge. Zweige senkten sich hernieder, umschlangen jeden einzelnen. Der Ellcrys flüsterte leise.
»Hört mich. Merkt euch, was ich euch sage. Lasst mich nicht im Stich!«
Ein kalter Schauder befiel sie. Über dem Garten des Lebens lag tiefe, dumpfe Stille, so als wären die Erwählten die einzigen Lebewesen auf der ganzen Welt. In schneller Folge jagten Bilder durch ihre Köpfe, Bilder, die Grauen und Entsetzen übermittelten. Wären die Erwählten dazu in der Lage gewesen, hätten sie sich abgewendet und sich versteckt, bis der Albtraum, der von ihnen Besitz ergriffen hatte, vergangen war. Doch der Baum hielt sie in seinem Bann, und die Bilder ergossen sich über sie, und das Grauen wuchs, bis sie meinten, es nicht länger ertragen zu können.
Dann endlich war es vorüber. Der Ellcrys schwieg, seine Zweige lösten sich von ihren Schultern und spannten sich weit auf, um die Wärme der Morgensonne aufzufangen.
Lauren stand da wie erstarrt, Tränen auf den Wangen. Fassungslos blickten die sechs Erwählten einander an, während die geflüsterte Wahrheit lautlos in ihren Köpfen widerhallte.
Die Legende war keine Legende. Die Legende war Wirklichkeit. Jenseits eines Bannes der Verfemung, den der Ellcrys aufrechterhalten hatte, lauerte in der Tat die Macht des Bösen. Nur der Ellcrys hatte das Elfenvolk vor Unheil und Gefahr bewahrt.
Und jetzt starb er.
2
Weit im Westen von Arborlon, jenseits des Grimmzackengebirges, regte sich etwas, das schwärzer war als die Dunkelheit des frühen Tages. Es war plötzlich da und zuckte und zitterte wie unter der Wucht von Schlägen, die es zu treffen schienen. Einen Augenblick hielt der schwarze Schleier noch, dann riss er auf, zerfetzt von der Gewalt, die er eingeschlossen hatte. Triumphierendes Kreischen und Heulen gellte aus der undurchdringlichen Schwärze, während Dutzende von klauenbewehrten Gliedmaßen zum Licht drängten und den Riss zu vergrößern suchten. Plötzlich barst die Schwärze in einer gewaltigen Fontäne roten Feuers, und die klauenbewehrten Hände zuckten verbrannt und rußgeschwärzt zurück.
Wutschnaubend kam der Dagda Mor aus der Finsternis. Sein Stab der Macht spie heiße Flammen, als er die Ungeduldigen zur Seite stieß und kühn durch die Öffnung trat. Einen Moment später folgten ihm die dunklen Gestalten des Raffers und des Wandlers. Andere Leiber drängten verzweifelt vorwärts, doch die Ränder des Risses schlossen sich schnell und sperrten die Finsternis und die Wesen, die in ihr lebten, aus. Nur Augenblicke dauerte es, dann war die Öffnung völlig verschwunden, und die drei ungewöhnlichen Gestalten standen allein.
Argwöhnisch blickte der Dagda Mor um sich. Sie standen im Schatten des Grimmzackengebirges. Das Morgenlicht, das schon den Frieden der Erwählten erschüttert hatte, war kaum mehr als ein schwacher Schimmer am östlichen Himmel jenseits der mächtigen Bergkette. Wie gewaltige spitze Zähne bohrten sich die grimmigen Gipfel in den Himmel und warfen bedrohliche Schatten auf die Trostlosigkeit der Rauen Platte, die sich vom Fuß der Berge nach Westen ins Leere erstreckte – eine nackte, unfruchtbare Wüstenei, in der Lebensspannen in Minuten und Stunden gemessen wurden. Nichts regte sich dort. Kein Laut durchbrach die Stille des frühen Morgens.
Der Dagda Mor lächelte, und seine krummen Zähne blitzten. Niemand hatte seine Ankunft bemerkt. Nach all den Jahren war er endlich frei, wieder frei unter denen, die ihn einst eingekerkert hatten.
Aus der Ferne hätte man ihn vielleicht für einen von denen halten können. Er hatte durchaus Ähnlichkeit mit einem Menschen, denn er ging aufrecht auf zwei Beinen und seine Arme waren nur um ein Geringes länger als die eines Menschen. Er hielt sich nicht gerade, sondern ging vornübergebeugt und gekrümmt, doch die dunklen Gewänder, die ihn einhüllten, ließen nur schwer erkennen, was die Ursache war. Erst wenn man ihm ganz nahe war, konnte man den großen Buckel sehen, der sich über seinen Schultern wölbte. Oder die dichten Büschel grünlichen Haares, die wie Riedgras aus allen Teilen seines Körpers sprossen. Oder die Schuppen, die seine Unterarme und Beine bedeckten; die Krallen an Händen und Füßen; die Ähnlichkeit seines Gesichts mit der Fratze einer Katze; die glimmenden schwarzen Augen, die so täuschend ruhig wirkten wie zwei Brunnen, in deren Tiefe jedoch das Böse und die Zerstörung lauerten.
Hatte man all diese Merkmale einmal gesehen, so konnte man keinen Zweifel mehr am Wesen des Dagda Mor hegen. Dann war offenbar, dass er kein Mensch war, sondern ein Dämon.
Und der Dämon wurde getrieben von Hass. Er hasste mit einer Inbrunst, die an Wahnsinn grenzte. In den Hunderten Jahren seiner Gefangenschaft in dem schwarzen Kerker hinter der Mauer des Banns der Verfemung hatte dieser Hass ungehindert wuchern und wachsen können. Und jetzt verzehrte ihn dieser Hass. Er war alles, was ihm geblieben war. Er verlieh ihm seine Macht, und diese Macht würde der Dagda Mor einsetzen, um die Geschöpfe zu vernichten, die ihn in dieses Elend gestürzt hatten. Die Elfen! Alle Elfen! Und selbst das reichte jetzt nicht mehr, seinen Hass zu stillen; nein, das war nicht genug nach den Jahrhunderten der Verbannung aus dieser Welt, die einst ihm gehört hatte, nach den Jahrhunderten im stumpfen, leblosen Nichts nie endender Finsternis und erbärmlichen Stillstands. Nein, die Vernichtung der Elfen würde nicht ausreichen, die Schmach wiedergutzumachen, die ihm angetan worden war. Auch die anderen mussten vernichtet werden. Menschen, Zwerge, Trolle, Gnomen – alle Rassen der verabscheuenswürdigen Menschheit, die auf dieser Welt lebten und sie als ihr Eigentum beanspruchten.
Seine Rache, dachte er, würde kommen. Genauso wie seine Freiheit gekommen war. Er spürte es. Jahrhundertelang hatte er abgewartet, beständig an der Mauer des Banns gelauert, um ihre Stärke zu prüfen, nach schwachen Stellen zu suchen, weil er die ganze Zeit über gewusst hatte, dass sie eines Tages würde nachgeben müssen. Und nun war dieser Tag gekommen. Der Ellcrys war dem Tode nahe. Ach, süße Worte! Am liebsten hätte er sie laut hinausgeschrien! Er war dem Tode nahe und konnte den Bann der Verfemung nicht länger aufrechterhalten.
Der Stab der Macht glühte rot in seinen Händen, als der Hass ihn durchströmte. Die Erde unter der Spitze des Stabes verbrannte zu schwarzer Asche. Mit einer ungeheuren Willensanstrengung beruhigte sich der Dagda Mor, und der Stab kühlte wieder ab.
Eine Zeit lang würde der Bann der Verfemung noch weiterwirken. Der vollständige Verfall würde nicht über Nacht eintreten, sondern sich vielmehr über mehrere Wochen hinziehen. Allein der kleine Riss hatte eine ungeheure Anstrengung verlangt. Doch der Dagda Mor verfügte über unermessliche Kräfte, über weit größere Kräfte als jene, die noch hinter der Mauer des Banns gefangen saßen. Er war ihr Führer; er herrschte über sie. Einige hatten es gewagt, in den langen Jahren der Verfemung dieser Herrschaft zu trotzen – nur einige wenige. Er hatte sie unterworfen, ein abschreckendes Exempel an ihnen statuiert. Jetzt gehorchten ihm alle bedingungslos. Sie fürchteten ihn. Und sie teilten seinen Hass auf jene, die ihnen diese Erniedrigung angetan hatten. Auch sie verzehrten sich vor Hass. Er hatte in ihnen ein rasendes Verlangen nach Rache entfacht, und wenn sie endlich wieder frei waren, würde es lange, lange Zeit dauern, dieses Verlangen zu befriedigen.
Vorläufig aber mussten sie noch warten. Vorläufig mussten sie Geduld üben. Doch es würde nicht mehr lange dauern. Mit jedem Tag würde die Kraft des Bannspruchs nachlassen, so wie die Lebenskraft des Ellcrys täglich mehr schwinden würde. Es gab nur ein Mittel, dies zu verhindern – eine Wiedergeburt.
Der Dagda Mor sann vor sich hin. Die Geschichte des Ellcrys kannte er gut. War er nicht dabei gewesen, als der Baum zum Leben erwacht war, als er ihn – den Dagda Mor – und seine Brüder aus ihrer Welt des Lichts in das Verlies der Finsternis verbannt hatte? Hatte er nicht das Wesen der Zauberkunst gesehen, die sie besiegt hatte – eine Zauberkunst von solcher Macht, dass sie selbst über den Tod hinaus wirksam blieb? Und er wusste auch, dass seine Freiheit ihm auch jetzt noch wieder geraubt werden konnte. Wenn es einem der Erwählten gelang, ein Samenkorn des Ellcrys zum Kraftquell des Baumes zu bringen, dann konnte der Zauberbaum wiedergeboren und der Bann der Verfemung erneuert werden. Dies wusste er, und dieses Wissen war der Grund dafür, dass er den Ausbruchsversuch gewagt hatte. Er war keinesfalls sicher gewesen, dass es ihm gelingen würde, die Mauer des Bannspruchs zu durchbrechen. Es war ein gefährliches Wagnis gewesen, so viel Kraft einzusetzen; im Falle eines Scheiterns wäre es für diejenigen hinter der Mauer, die über beinahe ebenso große Kräfte verfügten wie er, ein Leichtes gewesen, ihn in diesem Zustand der Schwäche zu vernichten. Dennoch hatte er das Risiko eingehen müssen. Die Elfen waren sich der Gefahr, die ihnen drohte, nicht bewusst. Noch wiegten sie sich in Sicherheit. Sie hielten es nicht für möglich, dass einer im finsteren Verlies des Bannes der Verfemung über so gewaltige Kräfte verfügte, um die Mauer zu sprengen. Zu spät würden sie erkennen, dass sie einem Irrtum erlegen waren. Wenn es so weit war, würde er, der Dagda Mor, schon dafür Sorge getragen haben, dass der Ellcrys nicht wiedergeboren und der Bannspruch nicht erneuert werden konnte.
Aus diesem Grund auch hatte er die beiden anderen mitgenommen.
Er blickte sich nach ihnen um. Den Wandler entdeckte er sofort, denn er war in einer ständigen Verwandlung von Farbe und Gestalt begriffen und übte sich darin, die Lebensformen nachzuahmen, die er hier vorfand – am Himmel einen nach Beute spähenden Falken, dann einen Raben; auf dem Boden zunächst ein Murmeltier, dann eine Schlange, ein vielbeiniges Insekt mit einer Schwanzzange, dann wieder etwas anderes. Die Verwandlungen erfolgten in so rascher Folge, dass das Auge sie kaum wahrnehmen konnte. Denn der Wandler vermochte alles und jedes zu sein. In der Finsternis, wo er nur seine Brüder zum Vorbild hatte, war ihm die Entfaltung seiner besonderen Kräfte versagt gewesen. Ja, sie waren praktisch nutzlos gewesen. Hier jedoch, in dieser Welt, waren die Möglichkeiten schier unendlich. Alles konnte er sein, Mensch oder Tier, Fisch oder Vogel, ganz gleich welche Größe, welche Gestalt, welche Farbe, welche Fähigkeiten, er konnte ihre Eigenschaften vollendet nachahmen. Selbst dem Dagda Mor war die wahre Gestalt des Wandlers fremd; dieses Wesen wurde von einem so ausgeprägten Hang getrieben, die Gestalt anderer Lebensformen anzunehmen, dass es nie das Wesen darstellte, das es in Wirklichkeit war.
Es war eine ungewöhnliche Gabe, und die böse Energie des Wandlers war beinahe so groß wie die des Dagda Mor. Auch in seinen Adern floss Dämonenblut. Er war zutiefst von Selbstsucht und Hass beherrscht, er war falsch und hinterhältig und genoss es, anderen zu schaden. Nie hatte er den Elfen und ihren Verbündeten etwas anderes entgegengebracht als Feindseligkeit, und er verachtete ihre liebevolle Sorge um das Wohl der niedrigeren Lebewesen, die ihre Welt bevölkerten. Dem Wandler bedeuteten niedrigere Lebewesen nichts. Sie waren schwach und leicht verletzbar; sie waren dazu bestimmt, von höheren Wesen – so wie er selbst eines war – für ihre Zwecke benutzt zu werden. Die Elfen waren nicht besser als die Geschöpfe, die sie zu schützen suchten. Sie konnten oder wollten nichts vortäuschen, wie er es ständig tat. Sie waren alle in dem Wesen gefangen, das sie verkörperten; sie konnten nichts anderes sein. Er jedoch konnte jede Gestalt annehmen, welche immer er wollte. Er verachtete sie alle. Der Wandler hatte keine Freunde. Und er wollte keine. Außer einem, dem Dagda Mor, denn der Dagda Mor besaß etwas, was selbst ihm Achtung abverlangte – eine Macht, die größer war als seine eigene. Einzig aus diesem Grund hatte sich der Wandler bereitgefunden, sich ihm zu unterwerfen.
Den Raffer zu finden brauchte der Dagda Mor etwas länger. Er entdeckte ihn schließlich kaum fünf Schritte entfernt. Völlig reglos stand er da, wenig mehr als ein Schatten im blassen Licht des frühen Morgens, ein Stück schwindender Nacht vor dem Grau des öden Flachlands. Von Kopf bis Fuß in eine Robe von der Farbe feuchter Asche gehüllt, war der Raffer beinahe unsichtbar, zumal sein Gesicht im Dunkel seiner weiten Kapuze verborgen war. Keinem lebenden Wesen war es gestattet, diese Züge öfter als einmal zu sehen. Der Raffer zeigte sie nur seinen Opfern, und seine Opfer ereilte der Tod.
Um vieles gefährlicher noch als der Wandler war der Raffer, denn sein einziger Lebenszweck bestand im Töten. Er war ein wuchtiges Geschöpf, muskulös, kräftig und groß wie ein Bär, wenn er sich zu seiner vollen Höhe aufrichtete. Doch diese Massigkeit täuschte, denn er war keineswegs schwerfällig. Er bewegte sich mit der Geschmeidigkeit und Anmut des geschicktesten Elfenjägers – behände, gewandt, schnell und lautlos. Und wenn er einmal die Jagd aufgenommen hatte, gab er nicht eher auf, als bis er sein Opfer erlegt hatte. Etwas, was der Raffer einmal als Beute anvisiert hatte, entkam ihm nie.
Selbst der Dagda Mor begegnete dem Raffer mit Vorsicht, obwohl dieser seine Kräfte nicht mit den seinen messen konnte. Er war auf der Hut, weil der Raffer ihm aus einer Laune heraus diente, nicht aus Furcht oder Respekt wie die anderen. Der Raffer fürchtete nichts. Er war ein Ungeheuer, dem das Leben nichts galt, nicht einmal sein eigenes. Und er tötete nicht, weil er Freude daran hatte, wenngleich er in Wahrheit selbstverständlich auch Freude am Töten fand. Er tötete, weil sein Instinkt es ihm befahl, weil er es notwendig fand zu töten. In der Finsternis der Verfemung, abgesondert von allen Lebewesen außer von seinen eigenen Brüdern, war er manchmal kaum zu bändigen gewesen. Der Dagda Mor hatte ihm weniger bedeutende Dämonen zum Töten opfern müssen und hatte ihn nur mit einem Versprechen zähmen können. Wenn sie erst einmal aus dem Bann der Verfemung befreit waren – und der Tag der Freiheit würde kommen –, dann würde sich dem Raffer eine ganze Welt voller Lebewesen auftun, an der er sich laben konnte. Dann konnte er jagen, solange es ihm beliebte. Am Ende würde er sie vielleicht alle töten.
Der Wandler und der Raffer. Der Dagda Mor hatte eine gute Wahl getroffen. Der eine sollte ihm Auge sein, der andere Hand, und dieses Auge und diese Hand würden in das Herz des Elfenvolkes eindringen und jede Möglichkeit einer Wiedergeburt des Ellcrys für immer zunichtemachen.
Mit scharfem Blick spähte er nach Osten, wo hinter den Gipfeln des Grimmzackengebirges jetzt die Morgensonne unaufhaltsam hochkam. Es war Zeit zum Aufbruch. Noch heute Abend mussten sie in Arborlon sein. Auch dies hatte er mit Sorgfalt geplant. Die Zeit war kostbar; keine Minute durfte er vergeuden, wenn er die Elfen überraschen wollte. Sie durften erst dann von seiner Rückkehr in die Welt erfahren, wenn es schon zu spät war, irgendetwas dagegen zu unternehmen.
Der Dagda Mor winkte seine Gefährten mit sich, dann drehte er sich um und schlurfte schweren Schrittes in den Schatten der zerklüfteten Berge. Er schloss die schwarzen Augen voller Genugtuung, als er im Geist schon den Erfolg auskostete, den ihm die kommende Nacht bringen würde. Wenn die heutige Nacht vorüber war, gab es für die Elfen keine Rettung mehr.
Nach dieser Nacht würden sie nur noch tatenlos zusehen können, wie ihr geliebter Ellcrys dahinsiechte, ohne dass auch nur Hoffnung auf eine Wiedergeburt bestand.
Ja, so war es. Nach dieser Nacht würden alle Erwählten tot sein.
Tief im Schatten der felsigen Gipfel verharrte der Dagda Mor. Mit beiden Händen umschloss er den Stab der Macht, stellte ihn aufrecht, die Spitze fest in die trockene, rissige Erde gerammt. Leicht senkte er den Kopf, und seine Hände umspannten den Stab fester. Lange stand er so, regungslos. Seine beiden Gefährten kauerten hinter ihm und beobachteten ihn neugierig aus gelb funkelnden Augen.
Plötzlich begann der Stab der Macht schwach in einem bleichen roten Schein zu glühen, der die massige Gestalt des Dämons aus der Dunkelheit heraushob. Gleich darauf erglühte der Stab in einem Licht von tieferem Rot, das zu pulsieren begann. Es strömte von dem Stab in die Arme des Dagda Mor und färbte seine grünliche Haut blutrot. Der Dämon hob den Kopf, und Feuer züngelte aus dem Stab himmelwärts, schoss in einem feinen, leuchtenden Flammenstreif in den Morgen hinein wie ein erschrecktes lebendes Wesen. In Sekundenschnelle war es verschwunden. Das Glühen, das den Stab der Macht erleuchtete, flammte noch einmal auf und erstarb.
Der Dagda Mor trat einen Schritt zurück und senkte den Stab. Die Erde rund um ihn war schwarz und verkohlt, und die feuchte Luft roch nach verglimmender Asche. Auf dem weiten Ödland herrschte Totenstille. Der Dämon ließ sich nieder, und seine schwarzen, unergründlichen Augen schlossen sich befriedigt. Danach rührte er sich nicht mehr. Und seine beiden Gefährten blieben so reglos wie er. Gemeinsam warteten sie – eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Und noch immer warteten sie.
Bis schließlich aus den endlosen leeren Weiten des Nordlands auf gewaltigen Schwingen der geflügelte Albtraum herabschwebte, den der Dämon herbeigerufen hatte, um ihn und seine Gefährten nach Arborlon zu tragen.
»Jetzt werden wir sehen«, flüsterte der Dagda Mor.
3
Gerade erst war die Sonne hinter dem Horizont emporgestiegen, als Andor Elessedil aus der Tür seines kleinen Hauses trat und den Fußpfad zum eisernen Tor des Schlossparks hinaufschritt. Als zweiter Sohn Eventines, des Königs der Elfen, hätte er im königlichen Palast leben können; doch schon vor Jahren hatte er sich mit seinen Büchern in das kleine Haus zurückgezogen und führte dort ein ruhiges Leben, wie es ihm im Palast nicht vergönnt gewesen wäre. Zumindest hatte er das damals geglaubt. Jetzt war er davon nicht mehr so überzeugt; da die Aufmerksamkeit seines Vaters nahezu ausschließlich dem Ältesten, Arion, galt, hätte Andor wahrscheinlich auch im Palast ungestört leben können.
Er atmete die frische und frühe Wärme der Morgenluft und lächelte. Ein idealer Tag für einen Ausritt. Die Bewegung würde ihm und dem Pferd guttun.
Mit vierzig war er kein junger Mann mehr. In den Augenwinkeln zeigten sich kleine Fältchen, und die kantige Stirn durchzog eine tiefe Furche; doch sein Schritt war leicht und schnell und seine Züge waren beinahe jungenhaft, wenn er lächelte – was dieser Tage selten vorkam.
Als er sich dem Tor näherte, sah er Went, den alten Gärtner, schon bei der Arbeit. Mit einer kleinen Hacke in der Hand stand er, dürr und betagt, über eines der Blumenbeete gebeugt. Als er Andor herannahen hörte, richtete er sich mühsam auf, und eine Hand griff zum Rücken.
»Guten Morgen, Prinz. Ein schöner Tag, nicht?«
Andor nickte. »Ein herrlicher Tag, Went. Bereitet der Rücken noch immer Kummer?«
»Hin und wieder.« Der alte Mann rieb sich vorsichtig das Kreuz. »Das Alter. Aber mit den Jungen, die mir als Helfer zugeteilt werden, kann ich es immer noch aufnehmen.«
Wieder nickte Andor. Er wusste, dass diese prahlerischen Worte des Alten der schlichten Wahrheit entsprachen. Schon vor Jahren hätte Went in den Ruhestand gehen sollen, doch er hatte sich hartnäckig geweigert, seine Arbeit aufzugeben.
Die Wachposten nickten ihm zu, als Andor durch das Tor schritt, und er erwiderte den Gruß. Lange schon hatten die Wachen und er beschlossen, auf Formalitäten zu verzichten. Arion, der Kronprinz, mochte darauf bestehen, mit ehrfürchtigem Respekt behandelt zu werden; Andor, von niedrigerem Rang, gab sich auch mit weniger zufrieden.
Er schlenderte die Straße entlang, die sich hinter einigen Zierbüschen nach links den Stallungen entgegenwand. Plötzlich zerrissen Hufgetrampel und ein lauter Ruf die morgendliche Stille. Andor sprang zur Seite, als ihm Arions grauer Hengst entgegenflog, dass der Kies aufspritzte. Wiehernd bäumte sich das Tier auf.
Noch bevor das Pferd ganz zur Ruhe gekommen war, sprang Arion aus dem Sattel und trat zu seinen Bruder. Blond und hochgewachsen stand er dem kleinen, dunklen Andor gegenüber, und die Ähnlichkeit mit ihrem Vater in diesem Alter war unverkennbar. Es verwunderte daher niemanden, dass er, der außerdem noch ein hervorragender Athlet, ein glänzender Reiter und Jäger war, ein Meister im Umgang mit Waffen jeglicher Art, dass er also Eventines ganzer Stolz und helle Freude war. Zudem ging von ihm eine Ausstrahlung aus, deren Zauber sich kaum jemand entziehen konnte.
»Wohin, Brüderchen?«, fragte er jetzt. Fast immer, wenn er mit seinem jüngeren Bruder sprach, lag in seiner Stimme ein feiner Anflug von Spott und Verachtung. »Ich würde Vater jetzt an deiner Stelle nicht stören. Ich habe gestern bis in die tiefe Nacht hinein mit ihm über dringende Staatsangelegenheiten beraten. Als ich eben bei ihm hineinschaute, schlief er noch.«
»Ich wollte zu den Stallungen«, entgegnete Andor ruhig. »Ich hatte nicht die Absicht, irgendjemanden zu stören.«
Arion lächelte überlegen und ging zu seinem Pferd. Er schwang sich geschmeidig auf den Rücken des Tieres, ohne den Steigbügel zu benutzen. Dann drehte er sich leicht zur Seite und blickte zu seinem Bruder hinunter.
»Ich muss für ein paar Tage ins Sarandanon. Die Bauern dort sind ganz aus dem Häuschen – wegen irgendeines alten Märchens, nach dem uns allen schreckliches Unheil drohe. Das ist natürlich der blanke Unsinn, aber ich muss hin, um die Leute wieder zu beruhigen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Bevor Vater nach Kershalt aufbricht, bin ich wieder zurück.« Er lachte. »Inzwischen kannst du ja hier nach dem Rechten sehen, hm, Brüderchen?«
Mit leichter Hand zog er flüchtig am Zügel und preschte los, hinaus durch das Tor und auf und davon. Andor stieß eine leise Verwünschung aus und machte kehrt. Die Lust auf einen Ausritt war ihm vergangen.
Nicht von Arion, sondern von ihm hätte sich der König nach Kershalt begleiten lassen sollen. Die Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Trollen und den Elfen war eine äußerst wichtige Angelegenheit. Zwar war das Fundament schon gelegt, doch der Ausbau der Beziehungen erforderte weiterhin viel Diplomatie und geschicktes Verhandeln. Arion war zu ungeduldig, zu leichtfertig und den Bedürfnissen und Vorstellungen anderer gegenüber nicht offen genug. Andor fehlten sowohl die körperliche Gewandtheit seines Bruders – auch wenn er beileibe nicht schwerfällig war – als auch Arions natürliche Gabe, andere zu führen. Doch er verfügte über Besonnenheit und Urteilsvermögen sowie über die Geduld und die Einfühlungskraft, die in der Diplomatie vonnöten waren. Bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen man ihn hinzugezogen hatte, konnte er diese Fähigkeiten hinreichend unter Beweis stellen.
Er zuckte mit den Schultern. Es hatte keinen Sinn, sich noch länger mit dieser Sache zu beschäftigen. Er hatte den König gebeten, ihn auf dieser Reise begleiten zu dürfen, und war abgewiesen worden. Der Vater hatte Arion den Vorzug gegeben. Arion würde eines Tages König werden; er musste sich die notwendige Übung in der Staatsführung aneignen, solange Eventine noch am Leben war und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Und das war vielleicht ganz vernünftig so, dachte Andor.
Früher einmal hatten er und Arion einander sehr nahegestanden. Damals hatte Aine noch gelebt – Aine, der jüngste der Elessedil-Söhne. Doch Aine war vor elf Jahren bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen, und danach hatten die Bande des Blutes für den Zusammenhalt nicht mehr ausgereicht. Amberle, Aines kleine Tochter, hatte bei Andor Beistand gesucht, nicht bei Arion, und die Eifersucht des Älteren war bald in offene Verachtung umgeschlagen. Als Amberle dann die Aufgaben, die ihr als Erwählte des Ellcrys oblagen, einfach im Stich gelassen hatte, schrieb Arion seinem Bruder die Schuld daran zu, und seine Verachtung hatte sich zu kaum verhohlener Feindseligkeit gesteigert. Andor vermutete, dass er auch beim Vater gegen ihn intrigierte. Doch er hatte keine Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen.
Tief in Gedanken schritt er durch das Tor und schlug den Fußweg zu seinem kleinen Haus ein, als ihn ein lauter Ruf aus seiner Versonnenheit riss.
»Herr! Prinz Andor! Wartet!«
Überrascht blickte Andor der Gestalt in weißer Robe entgegen, die wild mit den Armen fuchtelnd auf ihn zugelaufen kam. Es war einer der Erwählten, der rothaarige – hieß er nicht Lauren? Höchst ungewöhnlich, dass einer der jungen Männer sich zu dieser Stunde außerhalb des Gartens des Lebens aufhielt. Er wartete, bis der junge Elf ihn erreichte und mit schweißnassem Gesicht schwankend vor ihm zum Stehen kam.
»Herr, ich muss den König sprechen«, stieß der Junge atemlos hervor, »aber die Wache lässt mich nicht vor. Könnt Ihr mich gleich jetzt zu ihm bringen?«
Andor zögerte. »Der König schläft noch.«
»Ich muss ihn aber auf der Stelle sprechen!«, beharrte der andere. »Bitte! Diese Sache kann nicht warten.«
Verzweiflung spiegelte sich in seinen Augen und in seinem angestrengten weißen Gesicht. Die Stimme überschlug sich in seinem Bemühen, dem Prinzen klarzumachen, dass sein Anliegen dringend war und keinen Aufschub duldete.
Andor fragte sich, was denn von solcher Wichtigkeit sein könnte.
»Wenn du in Schwierigkeiten bist, Lauren, kann ich dir …«
»Es geht nicht um mich, Herr! Es geht um den Ellcrys!«
Da gab es für Andor kein Zaudern mehr. Er nickte und nahm Lauren beim Arm.
»Komm mit!«
Gemeinsam eilten sie zum Herrenhaus, während die Wachen ihnen verwundert nachblickten.
Gael, der junge Leibdiener des Königs Eventine Elessedil, schüttelte entschieden den Kopf – auch wenn der schlanke Körper unter dem dunklen Morgengewand sich förmlich krümmte vor Unbehagen und seine Augen denen Andors nicht begegnen wollten.
»Ich kann den König nicht wecken, Prinz Andor. Er befahl mir – sehr nachdrücklich –, ihn auf keinen Fall zu stören.«
»Willst du mir allen Ernstes sagen, dass ich meinen Vater nicht sprechen kann?«
Gael antwortete nicht. Als Andor Anstalten machte, auf das Schlafgemach des Königs zuzugehen, eilte der junge Elf an ihm vorbei.
»Ich werde ihn wecken. Bitte wartet hier.«
Es dauerte ein paar Minuten, bis er wieder erschien. Sein Gesicht war noch voller Besorgnis, doch er nickte Andor zu.
»Er erwartet Euch, Prinz Andor. Aber nur Euch allein.«
Der König lag noch in seinem Bett, als Andor eintrat, und leerte gerade das Glas Wein, das Gael ihm offenbar eingeschenkt hatte. Er nickte seinem Sohn zu, dann streifte er vorsichtig die warmen Bettdecken ab. Sein alter Körper fröstelte in der frühmorgendlichen Kühle des Raumes. Gael, der mit Andor eingetreten war, reichte dem König einen Morgenrock. Eventine schlüpfte hinein und gürtete das Gewand fest um die Körpermitte.
Trotz seiner zweiundachtzig Jahre war Eventine Elessedil bei ausgezeichneter Gesundheit. Sein Körper war straff und beinahe noch jugendlich muskulös. Er war immer noch ein guter Reiter, mit dem Schwert noch immer so schnell und sicher, dass seine Gegner ihn fürchteten. Sein Geist war scharf und wach; wenn die Situation es verlangte, wie das häufig vorkam, konnte er schnell und entschlossen handeln. Er besaß ein stark ausgeprägtes Gefühl für Ausgewogenheit und gesunde Proportionen – die Fähigkeit, alle Aspekte einer strittigen Frage klar zu sehen, jeden sachlich zu beurteilen und sich schließlich für jenen zu entscheiden, der seinem Volk und ihm selbst den größten Nutzen versprach. Ohne diese Gabe hätte er nicht König bleiben können – er würde wahrscheinlich nicht einmal mehr leben. Andor war ziemlich sicher, diese Gabe von seinem Vater geerbt zu haben, wenn sie ihm auch in seiner augenblicklichen Lage wertlos erschien.
Der König zog die handgewebten Vorhänge, die eine ganze Wand des Raumes verhüllten, auseinander und öffnete die hohen Fenstertüren, die zum Wald hinausblickten. Weiches, mildes Licht flutete ins Zimmer, und der süße Geruch des Frühtaus strömte herein. Im Rücken des Königs eilte Gael lautlos durch das Gemach und entzündete die Öllampen, um die dunklen Schatten der Nacht aus Ecken und Nischen zu vertreiben.
Vor einem der Fenster verharrte Eventine und blickte einen Moment lang unverwandt auf das Spiegelbild seines Gesichtes im leicht beschlagenen Glas. Die Augen, die ihm entgegensahen, waren von einem auffallend leuchtenden Blau, aber hart und durchdringend, die Augen eines Mannes, der in seinem Leben allzu viel Unerfreuliches gesehen hatte. Seufzend wandte er sich an Andor.
»Also, Andor, was gibt es? Gael sagte, du seist mit einem der Erwählten gekommen, der mir etwas mitzuteilen hätte.«
»Ja, Vater. Er behauptet, eine dringende Botschaft vom Ellcrys zu überbringen.«
»Eine Botschaft von dem Baum?« Eventine runzelte die Stirn. »Wie lange ist es her, seit er das letzte Mal einem Menschen eine Botschaft aufgetragen hat – sind es nicht schon mehr als siebenhundert Jahre? Wie lautet denn die Botschaft?«
»Das wollte er mir nicht sagen«, antwortete Andor. »Er will es nur Euch mitteilen.«
Eventine nickte. »Gut, dann soll er seine Botschaft bringen. Führ ihn herein, Gael.«
Gael verneigte sich und eilte hinaus, ohne die Tür des Schlafgemachs hinter sich zu schließen. Kaum war er gegangen, da stieß ein großer, zottiger Hund die Tür auf und trottete zum König hinüber. Es war Manx, sein Wolfshund, und er begrüßte das Tier liebevoll, indem er ihm den grauen Kopf kraulte und sacht über das struppige Fell an Rücken und Flanken strich. Seit über zehn Jahren begleitete Manx ihn auf allen seinen Wegen, stand ihm näher und war ihm treuer, als irgendein Mensch es je hätte sein können.
»Er wird auch schon grau – genau wie ich«, murmelte Eventine.
Sekunden später flog die Tür auf, und Gael trat ein, gefolgt von Lauren. Der junge Mann blieb einen Augenblick unter der Tür stehen und warf einen unsicheren Blick auf Gael. Der König nickte seinem Leibdiener zu, zum Zeichen, dass er entlassen war. Auch Andor wollte gehen, doch ein Wink seines Vaters gab ihm zu verstehen, dass er bleiben solle. Gael verneigte sich ehrerbietig und zog sich wieder zurück. Diesmal schloss er die Tür fest hinter sich. Als er gegangen war, trat der junge Erwählte einen Schritt näher.
»Herr, bitte verzeiht – sie waren der Meinung, dass ich – dass ich zu Euch gehen sollte …« Er hatte Mühe, die Worte hervorzubringen.
»Es gibt nichts zu verzeihen«, beschwichtigte ihn Eventine. Mit einer Herzlichkeit, die Andor wohlbekannt war, ging der König raschen Schrittes auf den jungen Mann zu und legte ihm den Arm um die Schultern. »Ich weiß, dass diese Sache dir sehr wichtig sein muss, sonst hättest du deine Pflicht im Garten des Lebens sicher nicht im Stich gelassen. Hier, setz dich und berichte mir.«
Er warf einen fragenden Blick auf Andor, bevor er den jungen Mann zu einem kleinen Schreibtisch auf der anderen Seite des Zimmers geleitete. Er bedeutete ihm, in einem der Sessel Platz zu nehmen, und ließ sich selbst in dem anderen nieder. Andor folgte ihnen in die Schreibecke, blieb jedoch stehen.
»Du heißt Lauren, nicht wahr?«, fragte Eventine den Erwählten.
»Ja, Herr.«
»Gut, Lauren, dann berichte mir nun, weshalb du zu mir geeilt bist.«
Lauren straffte sich und legte seine Hände fest gefaltet auf den Tisch.
»Herr, der Ellcrys hat heute Morgen zu den Erwählten gesprochen.« Seine Worte glichen eher einem Flüstern. »Er sagte uns – er sagte uns, dass er bald sterben wird …«
Andor spürte, wie ein eisiger Schauer ihn durchrann. Einen Moment lang schwieg der König, er saß da wie erstarrt, den Blick unverwandt auf den jungen Mann gerichtet.
»Da muss ein Missverständnis vorliegen«, bemerkte er schließlich.
Lauren schüttelte mit heftigem Nachdruck den Kopf.
»Nein, Herr, es ist kein Missverständnis. Der Baum hat zu allen von uns gesprochen. Wir – wir haben es alle deutlich vernommen. Er stirbt. Der Bann der Verfemung fängt schon an sich aufzulösen.«
Sehr langsam erhob sich der König und ging zum offenen Fenster hinüber. Wortlos starrte er in den Wald hinaus. Manx, der sich am Fuß des Bettes zusammengerollt hatte, sprang auf und folgte ihm. Andor sah, wie die Hand des Königs zum Kopf des Hundes wanderte, um ihm gedankenverloren das Fell zu kraulen.
»Bist du ganz sicher, Lauren?«, fragte Eventine. »Bist du wirklich sicher?«
»Ja. – Ja.«
Der Junge saß immer noch am Tisch, das Gesicht in die Hände vergraben, und weinte leise, beinahe lautlos vor sich hin. Eventine blickte weiterhin wie geistesabwesend in das Grün der Wälder, die seine und seines Volkes Heimat waren.
Andor war innerlich wie zu Eis erstarrt und verstört von der schockierenden Nachricht. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was er gehört hatte, drang nur langsam in sein Bewusstsein vor. Der Ellcrys starb! Der Bannspruch würde seine Wirkung verlieren. Die bösen Mächte, die in Fesseln gelegt worden waren, würden wieder frei sein. Das bedeutete Chaos, Wahnsinn, Krieg! Und am Ende die totale Zerstörung.
Er hatte die Geschichte seines Volkes unter Anleitung seiner Lehrer studiert und sie in den Büchern seiner Bibliothek nachgelesen. Es war eine Geschichte, die von Legenden umrankt war.
In uralter Zeit, noch vor den Großen Kriegen, vor der Dämmerung der Zivilisation in der alten Welt, ja, noch vor dem Erscheinen der alten Rasse der Menschen, hatte zwischen den guten und den bösen Mächten ein erbitterter Kampf getobt. Die Elfen hatten in diesem Ringen auf Seiten des Guten gestritten. Es war ein langer, schrecklicher, alles verheerender Kampf gewesen. Am Ende jedoch hatten die Mächte des Guten obsiegt und das Böse niedergerungen. Doch das Böse konnte nicht vernichtet werden, sondern nur verbannt. Darum vereinten das Elfenvolk und seine Verbündeten ihre magischen Kräfte mit der Lebenskraft der Erde selbst, um den Ellcrys zu schaffen und durch sein Dasein einen Bann der Verfemung über die Geschöpfe des Bösen zu verhängen. Solange der Ellcrys lebte und gedieh, konnte das Böse nicht auf die Erde zurückkehren. Eingeschlossen in das Nichts der Finsternis mochte es hinter den Mauern des Banns heulen und wimmern, die Erde war unerreichbar.
Bis zum heutigen Tag hatte dies gegolten! Doch wenn der Ellcrys siechte, dann war auch der Bannspruch aufgehoben. Es stand geschrieben, dass dies eines Tages geschehen würde, denn es gab keine Macht, die so stark war, dass sie ewig währen konnte. Und doch hatte es den Anschein gehabt, als würde der Ellcrys niemals vergehen. Schon so viele Generationen lang stand er unverändert an seinem Platz im Garten des Lebens, ein fester Punkt im wechselvollen Wellenschlag des Lebens. Allmählich hatte sich in den Elfen die Überzeugung festgesetzt, dass es immer so bleiben würde. Aber das, so schien es jetzt, war ein törichter Irrtum gewesen.
Mit einer ruckartigen Bewegung wandte der König sich um, warf einen kurzen Blick auf Andor und kehrte an seinen Schreibtisch zurück. Dort setzte er sich wieder und umschloss Laurens Hände mit den seinen, um den Jungen zu beruhigen.
»Du musst mir alles erzählen, was genau der Baum zu dir gesagt hat, Lauren. Jede Einzelheit. Du darfst nichts auslassen.«
Der junge Mann nickte wortlos. Die Tränen waren versiegt, seine Züge wieder ruhiger und gelassener.
Eventine ließ seine Hände los und lehnte sich erwartungsvoll zurück. Andor holte sich einen hochlehnigen Stuhl heran und setzte sich zu ihnen.
»Herr, Ihr wisst, auf welche Art der Baum zu uns spricht?«, fragte Lauren vorsichtig.
»Auch ich war einmal ein Erwählter, Lauren«, antwortete Eventine.
Andor blickte seinen Vater überrascht an. Das hatte er bisher nicht gewusst. Lauren jedoch schien diese Enthüllung Vertrauen einzuflößen. Er nickte und wandte sich an Andor, um ihm die Sprache des Baumes zu erklären.
»Seine Stimme ist keine Stimme in dem Sinn, dass man sie hören kann. Er spricht vielmehr in Bildern, die vor unserem geistigen Auge auftauchen. Worte als solche kommen höchst selten vor; die Wörter sind unsere Übersetzung der Bilder und Gedanken, die der Baum ausstrahlt. Die Bilder kommen und gehen sehr rasch und sind meist nicht sehr klar gezeichnet. Wir müssen versuchen, sie so gut wie möglich zu deuten.«
Er schwieg kurz und wandte sich wieder an Eventine.
»Ich – der Ellcrys hat vorher nur ein einziges Mal zu mir gesprochen, Herr. Damals, als er mich mit den anderen erwählte. Das, was wir über seine Art, sich mitzuteilen, wussten, hatten wir einzig den Schriften unseres Ordens und den Lehren der Erwählten, die vor uns dem Baum gedient haben, entnommen. Und obwohl der Ellcrys jetzt selbst zu uns gesprochen hat, ist das alles immer noch sehr verwirrend.«
Eventine nickte ermutigend, und Lauren fuhr in seiner Botschaft fort.
»Herr, der Ellcrys hat heute Morgen sehr lange zu uns gesprochen. Nie zuvor hat er das getan. Er rief uns zu sich und sagte uns, was werden würde und was wir, die Erwählten, zu tun hätten. Die Bilder waren nicht sehr deutlich, doch es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Baum stirbt. Er hat nur noch eine kurze Lebensspanne vor sich; wie viel Zeit ihm noch bleibt, ist ungewiss. Der Verfall hat schon begonnen. Und in dem Maße, wie der Baum dahinsiecht, verfällt auch der Bann der Verfemung. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit der Rettung – die Wiedergeburt des Baumes.«
Hastig umfasste Eventine die Hand des jungen Mannes. Auch Andor, betäubt und verwirrt von der Todesprophezeiung des Ellcrys, war diese Möglichkeit entfallen. Die Wiedergeburt, davon berichteten die ältesten Geschichtsbücher, dass der Ellcrys wiedergeboren und der Bann auf diese Weise aufrechterhalten werden konnte.
»Dann dürfen wir noch hoffen«, flüsterte er.
Eventines Blick war auf Lauren geheftet.
»Was muss geschehen, um diese Wiedergeburt herbeizuführen?«
Lauren schüttelte den Kopf.
»Herr, der Baum hat sein Schicksal in die Hände der Erwählten gelegt. Nur durch uns kann eine Wiedergeburt erfolgen. Ich kann die Gründe des Baumes hierfür nicht verstehen, doch die Bilder waren klar. Der Ellcrys wird einem von uns sein Samenkorn geben – welchem von uns, sagte er nicht. Es zeigte sich kein Gesicht. Doch es war ganz deutlich, dass nur einer der Erwählten, die das letzte Mal von ihm erkoren wurden, das Samenkorn empfangen kann. Niemand sonst kommt in Betracht. Derjenige, den der Baum ausersieht, muss das Samenkorn zum Lebensquell der Erde tragen, zum Blutfeuerbrunnen. Dort muss das Samenkorn in das Feuer eingetaucht werden. Wenn das geschehen ist, muss es dorthin zurückgebracht werden, wo der alte Baum steht. Es wird dann Wurzeln schlagen, und ein neuer Baum wird daraus erwachsen und den Platz des alten einnehmen.«
Einzelheiten der Legende fielen Andor jetzt wieder ein – das Hervorbringen des Samenkorns, seine Weihe durch das Ritual am Blutfeuerbrunnen, die Wiedergeburt. All dies hatten die alten Gelehrten in der merkwürdigen, formalen Sprache jener Zeiten aufgezeichnet. Die meisten Elfen hatten diese uralten Geschichten längst vergessen oder sie nie gekannt.
»Und wo ist dieser Blutfeuerbrunnen zu finden?«, fragte der König unvermittelt.
Lauren sah ihn mit unglücklicher Miene an.
»Der Baum zeigte uns einen Ort, Herr, aber – aber wir konnten ihn nicht erkennen. Die Bilder waren zu schemenhaft, es schien beinahe so, als könne der Baum selbst den Ort nicht richtig beschreiben.«
Eventines Stimme blieb ruhig.
»Dann berichte mir, was euch gezeigt wurde. Ganz genau.«
Lauren nickte. »Es war eine Wildnis, die rundum von Bergen und Sümpfen eingeschlossen war. Nebelschwaden trieben darüber hin, die bald dichter wurden, bald sich lichteten. In dieser Wildnis ragte ein einsamer Berggipfel empor, und im Herzen dieses Berges schlängelte sich ein Gewirr von unterirdischen Gängen, die bis in die Tiefe der Erde reichten. Irgendwo in diesem Labyrinth gähnte eine Tür aus Glas – aus einem unzerbrechlichen Glas. Und hinter dieser Tür loderte der Blutfeuerbrunnen.«
»Und Namen gibt es nicht für die einzelnen Teile dieses Rätsels?«, erkundigte sich der König geduldig.
»Nur einen, Herr. Aber es war ein Name, der uns nicht bekannt war. Das Labyrinth, in dem der Blutfeuerbrunnen verborgen liegt, heißt offenbar Sichermal.«
Sichermal? Andor überlegte angestrengt, doch der Name wollte ihm nichts sagen.
Eventine blickte Andor an und schüttelte sein greises Haupt. Er erhob sich, tat ein paar Schritte, blieb dann plötzlich stehen und wandte sich wieder an Lauren.
»Ist euch sonst noch etwas gesagt worden? Habt ihr sonst kein Zeichen bekommen?«
»Nichts. Das war alles.«
Der König nickte dem jungen Elfen bedächtig zu.
»Gut, Lauren. Du hast recht getan, dass du damit sofort zu mir gekommen bist. Würdest du jetzt einen Augenblick draußen warten?«
Als die Tür sich hinter dem jungen Erwählten geschlossen hatte, kehrte Eventine zu seinem Sessel zurück und sank schwerfällig hinein. Sein Gesicht schien um Jahrzehnte gealtert, und seine Bewegungen glichen denen eines uralten Mannes. Manx trottete zu ihm und blickte mitfühlend zu ihm auf. Eventine seufzte und strich dem Hund müde über den Kopf.