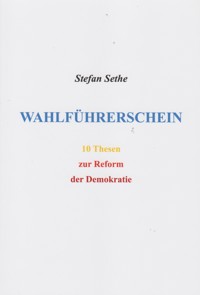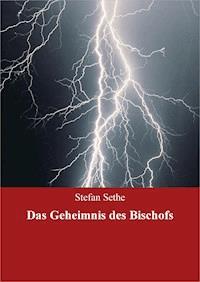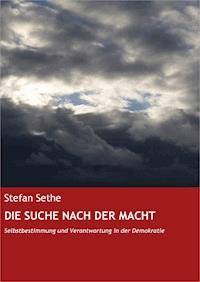
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stefan Sethe plädiert für einen Liberalismus im Rahmen grüner Nachhaltigkeit. Einst Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion ist er heute Mitglied der Grünen. Mit symptomatischen Artikeln der letzten 40 Jahren und aktuellen Einschüben entfaltet er ein von praktischer Erfahrung geprägtes Gesellschaftsmosaik, welches mit provokanten Vorschlägen und nachdenklichen Reflexionen zu einem radikalen Umdenken in Politik, Verwaltung und Wirtschaft ermuntert. Weniger Staat, mehr bürgerliches Engagement lautet die Forderung des überzeugten Liberalen. Anhand zahlloser Beispiele aus dem persönlichen Erleben benennt der ehemalige Regierungssprecher politische Fehlentwicklungen und degenerierte Verwaltungsmechanismen. Mehr denn je sind Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Zivilcourage und die Übernahme von Bürgerpflichten erforderlich, um der Demokratie in Deutschland und Europa den Boden zu bereiten. Der Autor zeigt aber auch oft überraschende und unorthodoxe, immer aber mutig-kreative Veränderungsmöglichkeiten. Er selbst hat den Anfang gemacht, indem er auf seine Beamtenpension verzichtete. Heute lebt er als Anwalt und freier Autor in Erfurt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Sethe
DIE SUCHE NACH DER MACHT
Selbstbestimmung und Verantwortung in der Demokratie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Von einem der auszog, die Macht zu suchen
Nicht nur Soll und Haben
Bundesministerium der Justiz
Macht
Gedanken zur Sozialen Selbstverantwortung
Mehr Mut zum Liberalismus
Alexis de Tocqueville
Wehret den Anfängen !
Anmerkungen zur Diätendiskussion
Bundestagspräsident
Und ich scheiterte!
Wendepunkt
VCD
Bürokratie aus Angst vor der Verantwortung
Versicherungsmentalität: Die Deutschen - ein Volk von Hypochondern
Kostendämpfung durch Selbstbeteiligung
Randgruppen: Ablasszahlungen statt tätiger Hilfe
verantwortungslose Verkehrspolitik
ungenutzte Beschäftigungspotentiale
Schuldenfalle
Lebensqualität
Presse
Wahl-Führerschein
? W A S T U N ?
grüner Liberalismus
Europa
Sozialdienst
Ehrenamt
Kultur
Legislative
Exekutive
Judikative
Wirtschaft
Bildung
auf dem Weg zum Matriarchat
Kirchen
Gegenbewegung
Aktive Alt-Liberale gesucht
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nachwort
Beruflicher Werdegang
Impressum neobooks
Vorwort
Habe nun, ach!Wirtschaft, Philosophie,
Juristerei und Soziologie,
Und leider auch Politik
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor
Jeder kennt die Monologe in Goethes„Faust“:
„Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort!“
Und weiter geht es:
„Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?“
Leider habe ich sehrspät „gestockt“ und zu lange „das Wort“ in mein Leben einfließen lassen: Bin Presse- und Regierungssprecher geworden, glaubte oft, mit Worten gegen Windmühlenflügel kämpfen zu können. Inzwischen weiß ich:
„Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muss es anders übersetzen, …
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!“
Einvon Goethe vielleicht etwas zu stiefmütterlich behandelter Kernsatz, denn ohne Kraft ist keine Bewegung möglich, und die Kraft ist es, die meistens fehlt. Um Veränderungen zu bewirken und Worte in Taten umzusetzen, muss man vor allem auch physisch und psychisch dazu in der Lage sein. Letztlich hatte der alte Geheimrat aber doch sehr richtig erkannt:
„Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang wardie Tat!“
Möge es künftig mehr Menschen beschieden sein, Kräfte zu mobilisieren, die zur Erneuerungen führen! Nicht im Stile dumpf protestierender „Wutbürger“, sondern als Vernunftbürger, die gezielt vor gehen gegen die allgemeine Pflichtvergessenheit, gegen die Verantwortungsscheue von Politikern und Verwaltung und gegen die Verantwortungslosigkeit unserer Wohlstandsgesellschaft! - Um jedoch den hehren teutonischen Weisheiten des Verwaltungsjuristen Goethe ein wenig mehr Leichtigkeit zu verleihen, sei noch der Moralist und Skeptiker Erich Kästner zitiert, der Goethes Drama auf die eingängige Formel brachte: „Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es!“
Es geht in diesem Buch nicht darum, den Stein der Weisen zu finden oder gar gefunden zu haben. Natürlich irre ich mich in vielem, und natürlich gibt es zu jedem Thema inzwischen profiliertere und ausführlichere Darstellungen. Ich bitte, meine Beiträge, Artikel und Erinnerungen aus 40jähriger politischer und Verwaltungstätigkeit daher vor allem alsAnregungen zu verstehen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, sich selbst infrage zu stellen, Vorurteile immer wieder zu überprüfen, kritisch und kreativ andere Sichtweisen zuzulassen, ständig nach neuen Lösungen zu suchen – und ggf. dafür zu kämpfen.
Betriebsblindheit gepaart mit Routine und Veränderungsängsten haben in den letzten Jahrzehnten gesellschaftliche Verkrustungen geschaffen, die immer schwerer aufzubrechen sind, und die Industriestaaten, namentlich Deutschland, in lähmende Zwangslagen gebracht haben, aus der sie sich nur noch sehr schwer befreien können. Es muss deshalb darum gehen, sich die geistige und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bewahren. Es mag trivial klingen, doch nur wer sein Herz nicht an materielle Güter hängt, wer Reklame ignoriert, wer Sachzwänge belächelt, nur der bewahrt sich die geistige Freiheit und Frische, die eine Gesellschaft braucht, um sich zu erneuern und zu entwickeln.
Von einem der auszog, die Macht zu suchen
… und er beschloss, Politiker zu werden - und das besonders schnell: Klassensprecher, Schulsprecher, Geschäftsführer des Stadtschülerrates, Mitglied des Landesschülerrates, Doppelstudium Jura und Politik in Rekordzeit. Nun ist es kein Verdienst, Prüfungen und Karriereschritte besonders rasch hinter sich zu bringen. Es spricht eher manches dafür, dass wir es hier mit einem Dünnbrettbohrer zu tun haben könnten. Die Politik besteht aber fast nur aus extrem dicken und harten Brettern. Ein frühes Scheitern schien daher vorprogrammiert.
Der weitere Verlauf bestätigte leider die Prognose: Noch nicht einmal 30 Jahre alt, war unser junger Held – die Leser werden ahnen, dass es sich dabei um den Autor handelt – nach Referendariat und Geschäftsführerausbildung bei Wirtschaftsverbänden und Unternehmen schon fest verankert im Leitungsbereich des Bundesministeriums der Justiz. …
… Und gleich in einer Position vergleichbar einem Regierungsdirektor. Ende 1979 war ich nach Bonn zum Vorstellungsgespräch ins Bundesministerium der Justiz geladen worden. Es ging um meine erste richtige Stelle nach dem Examen. Zwar hatte ich mich gleich nach der zweiten Staatsprüfung als Anwalt zulassen lassen und noch einen Ausbildungsgang für den Geschäftsführernachwuchs bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände absolviert, aber eine echte Anstellung war das nicht gewesen.
Meine Vorstellung im Bundesjustizministerium stand unter einem besonders guten Stern:
Um nicht zu spät zu kommen, hatte ich bereits die Nacht vor dem Termin im Bonner Hotel am Tulpenfeld zugebracht. Es war der 22.11.1979, ein Donnerstag. Beim Frühstück hatte ich in der frisch erschienenen Wochenzeitschrift „Die Zeit“ geblättert und war dabei auf einen von mir verfassten Artikel zu Sozialbilanzen gestoßen: Ein ganzseitiger Artikel, Aufmacher des Wirtschaftsteils. Es war ein Abfallprodukt meiner Tätigkeit bei den Arbeitgebern gewesen. Seitdem ich den Artikel vor einem halben Jahr an „Die Zeit“ geschickt hatte, hatte ich nichts weiter davon gehört. Und nun hielt ich meine ersten richtigen Artikel in Händen:
Nicht nur Soll und Haben
Stefan Sethe - Die Zeit;23.11.1979
Sozialbilanzen: Auf dem Weg zu einer neuen Unternehmens-Ethik
Elmar Pieroth, Unternehmer und CDU-Politiker, umschrieb die derzeitige gesellschaftliche Situation der Unternehmen mit den Worten: „In den fünfziger und sechziger Jahren waren die Bundesbürger froh, dass die ,Schlote rauchten‘. Heute bilden sich Bürgerinitiativen, weil diese Schlote rauchen.“ Wie tiefgreifend dieser Meinungsumschwung inzwischen verwurzelt ist, zeigt sich nicht zuletzt auch an den Ergebnissen der letzten Kommunal- und Landtagswahlen, wo die „Grünen“ immer wieder für neue Schlagzeilen sorgten.
Weniger spektakulär und von der Öffentlichkeit kaum bemerkt hat jedoch auch eine neue Ära im Selbstverständnis der Unternehmen begonnen. Als Beginn dieser Ära lässt sich ziemlich genau der Juli 1973 ermitteln. In jenem Monat legte die Steag AG in Essen neben ihrer Handelsbilanz und dem Geschäftsbericht eine „Sozialbilanz“ vor, in welcher zum ersten Mal der Versuch gemacht wurde, die gesellschaftlichen Beziehungen eines Unternehmens aufzuzeichnen und damit auch der öffentlichen Diskussion preiszugeben.
Diese erste, aus heutiger Sicht noch sehr rudimentäre „Sozialbilanz“ eines deutschen Unternehmens enthielt bereits ein inneres Beziehungsfeld, in dem die monetären Leistungen an die Belegschaft sowie die Aktivitäten zur Sicherung der Arbeitsplätze aufgeführt waren, sowie ein äußeres Beziehungsfeld, in welchem beispielsweise die Leistungen zur Verminderung der Umweltbelastung und die Förderung gemeinnütziger Ziele erwähnt wurden.
Schon am Beispiel der Steag fällt auf, dass der Begriff Sozial-„Bilanz“ für diese Form der Berichterstattung nicht gerade sehr glücklich gewählt ist. Nicht nur, dass sich die Unternehmen bis heute schwer tun, auch Negativposten, wie etwa die Umweltbelastung durch das Unternehmen oder empfangene Subventionen, gleichrangig neben den auf soziales Engagement hindeutenden Aufwendungen zu erwähnen. Es ist auch unmöglich, eine Vergleichbarkeit der Soll- und der Haben-Seite zu erreichen. Schließlich lassen sich bei bestem Willen die Aufwendungen für einen Betriebssportplatz und einen tödlichen Betriebsunfall nicht gegeneinander aufrechnen.
Einen Ausweg aus diesem Dilemma schien das mittlerweile von manchen Unternehmen praktizierte Verfahren des goal decounting zu bieten. Man setzt sich zu Beginn einer Berichtsperiode ein realistisches Ziel, wie zum Beispiel die Unfallhäufigkeit pro Tausend Beschäftigte im kommenden Jahr von 9,7 auf 9,4 zu senken. Je nachdem, ob man dieses Ziel erreicht, übertrifft oder darunter bleibt, ist der jeweilige Bilanzposten ausgeglichen, positiv oder negativ. Abgesehen von der hierbei immer noch nicht gelösten Frage der Gewichtung im Gesamtzusammenhang bietet sich dieses System aber keineswegs für alle Berichtsposten an, so dass eine durchgängige Bilanzierung im technischen Sinne auf diesem Gebiet nicht möglich ist. Man spricht daher immer häufiger von einer gesellschaftsbezogenen Berichterstattung statt von einer Sozialbilanz und erweckt damit auch gar nicht erst die ohnehin kaum erfüllbare Hoffnung auf Vollständigkeit der vorgelegten Berichte.
Die Sozialbilanzierung hat unter den Unternehmern inzwischen zahlreiche Anhänger gefunden. Sie haben sich zu einem großen Teil im Arbeitskreis „Sozialbilanz-Praxis“ zusammengeschlossen. Neben Umsatzriesen wie VW, BASF, Bayer und Shell sind hier vor allem auch engagierte kleinere Betriebe tonangebend und treiben die Entwicklung voran.
Die Bemühungen um eine stärkere Vergleichbarkeit und daher Standardisierung der Berichterstattung haben bereits zu zahlreichen Erfolgen geführt. So ist man sich inzwischen darin einig, dass die immer noch als „Sozialbilanz“ apostrophierte Berichterstattung aus einer Sozialrechnung bestehen soll, in der alle quantifizierbaren Größen aufgeführt werden sollen, sowie aus einem allgemein gehaltenen Sozialbericht, welcher auch zum Beispiel zu dem jeweiligen Stand der Mitbestimmung Stellung beziehen sollte und aus einer Wertschöpfungsrechnung. Einig ist man sich mittlerweile auch, dass es kaum praktikabel ist, Nutzen und Schaden jeweils gegeneinander aufzurechnen.
Es wäre sicherlich nicht richtig, diese Bemühungen der Unternehmen schlicht als neues Instrument der Firmenimagewerbung abzutun, wie dies zunächst oft recht polemisch von den Gewerkschaften versucht wurde. Freilich mussten diese sich auch häufig genug provoziert fühlen durch allzu schönfärberische Sozialbilanzen, die sich nicht scheuten, soziale Erfolgsquoten von 99,95 Prozent bekanntzugeben und nicht selten unterließen, die Negativposition überhaupt nur zu erwähnen.
Inzwischen haben die Gewerkschaften jedoch erkannt, dass der Großteil der sozialbilanzierenden Unternehmen nicht nur an vordergründigen und kurzfristigen Imageerfolgen interessiert sind. Sie bemühen sich vielmehr ernsthaft, ihre gesellschaftliche Verantwortung neu zu definieren und die veränderten gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten bei der Planung von Fortschritt und Wachstum zu berücksichtigen.
Die Sozialbilanzierung zwingt die Unternehmen, sich Gedanken über konkrete ökonomische und gesellschaftsbezogene Ziele zu machen, diese zu formulieren und sich später daran messen zu lassen. Mögliche negative gesellschaftliche Folgen bestimmter wirtschaftlicher Maßnahmen werden eher erkannt. Andererseits ist aber die Sozialbilanz auch geeignet, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Verzahnung von Wirtschaft und Gesellschaft zu rationalisieren, indem die Sozialbilanzen sehr anschaulich zeigen, was höhere Lebensqualität kostet und wo gesellschaftliche Ansprüche utopisch werden, also mit dem realen Leistungsvermögen der Wirtschaft nicht mehr ins Gleichgewicht gebracht werden können.
Obwohl inzwischen deutlich geworden ist, dass Sozialbilanzen, sollen sie von der Öffentlichkeit ernstgenommen und nicht nur als Schönwetterbroschüre abgetan werden, auch Fakten enthalten müssen, die zuzugeben einem Unternehmen im ersten Moment nicht immer ganz leicht fällt, nimmt dennoch die Zahl der Firmen zu, die eine Sozialbilanz vorlegen. Ermuntert werden sie durch mehrere klare Empfehlungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sich an diese neue und zum Teil recht aufwendige Form der Berichterstattung heranzuwagen, wobei die Arbeitgeber allerdings betonen, dass es sich um freiwillige Unternehmensaktivitäten handelt, die den Einflussbereich des Betriebsrates oder gar der Gewerkschaften nicht tangieren.
Rein juristisch gesehen mag diese Auffassung sicherlich zutreffend sein. In der Praxis führt die Nichtbeteiligung des Betriebsrates jedoch dazu, dass eine Sozialbilanz, für die lediglich die Unternehmensleitung verantwortlich zeichnet, gegen den Vorwurf der Einseitigkeit zu kämpfen hat. Es kann dann passieren, dass – wie bei der BASF sehr spektakulär geschehen – der rosa gefärbten Schönwetterbilanz der Unternehmensleitung eine ebenso einseitige, tiefschwarze Negativbilanz von der Gewerkschaft entgegengesetzt wird.
Nachdem bereits, in einigen Unternehmen die Zusammenarbeit von Unternehmensleitung und Betriebsrat im Hinblick auf die Sozialbilanzierung zur Routine geworden ist, werden sich wohl auch andere Unternehmen und deren Betriebsräte über einen Grundkonsens einigen müssen, wenn man dem ohnehin viel zu schnell zur Reglementierung bereiten Staat keinen Anlass geben will, die gesellschaftsbezogene Berichterstattung dem Aktienrechteinzugliedern. Damit würde eine Materie, die sich noch im lebendigen Experimentierstadium befindet, frühzeitig und unausgereift der Versteinerung preisgegeben.
Die Entwicklung einer neuen Unternehmens-Ethik und eines veränderten Verantwortungsgefühls in der Unternehmerschaft vollzieht sich langsam aber stetig. Behördliche Reglementierungen oder übermäßiger gewerkschaftlicher Druck würden diese freiwillig und engagiert begonnene Entwicklung in die Defensive drängen und damit bestenfalls eine Festschreibung des status quo bewirken.
Bundesministerium der Justiz
Frohgemut klemmte ich die Zeitung unter den Arm und erschien pünktlich um 10 Uhr zum Vorstellungsgespräch im Kreuzbau des Bundesjustizministeriums. Mein erster Gesprächspartner dort war der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sepp Binder, der, wie ich später merkte, der einflussreichste Mitarbeiter des Hauses war. In der internen Hierarchie kam er gleich nach dem Minister, noch vor dem Staatssekretär. Das Gespräch begann etwas zäh, aber spätestens als ich mit den Worten: „Ach, haben Sie übrigens heute schon meinen letzten Artikel in der Zeit gesehen?“ die entsprechende Seite aus meiner Jackentasche gezaubert hatte, war der Bann gebrochen. Binder war selbst früher Zeit-Redakteur gewesen und gehörte zu den Bewunderern ausgerechnet des für den Wirtschaftsteil verantwortlichen Redakteurs, Michael Jungblut.
Alles andere war dann nur noch Formsache. Da ich im Leitungsbereich tätig werden sollte, sprach ich ein paar Worte mit Hans-Jochen Vogel, der für ein gutes Jahr mein oberster Chef werden sollte - bevor er als Regierender Bürgermeister nach Berlin ging und von Jürgen Schmude als Bundesjustizminister ersetzt wurde -, mit Vogels Staatssekretär Günther Erkel und dem für das Personal zuständigen Abteilungsleiter. Erst beim Personalreferenten wurden Einzelheiten meiner Einstellung erörtert. Personalchef Stückrath rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum und druckste verlegen: „Also verstehen Sie mich bitte richtig, mir sind ein wenig die Hände gebunden. Soviel, wie Sie als Rechtsanwalt verdient haben, können wir Ihnen leider nicht bieten.“ Ich schaute ihn amüsiert an. Keinen Pfennig hatte ich bisher als Anwalt verdient. Aber da sah man wieder einmal, was das Image ausmacht. „Wie wäre es denn mit BAT Ia?“ fragte mein Gegenüber. Nun war es an mir, unruhig zu werden. Mir wurde heiß und kalt zugleich. BAT Ia entsprach einem Regierungsdirektor. Für eine Erst-Einstellung unglaublich hoch. Üblicherweise musste man sich erst einmal langsam an den Regierungsrat heran dienen. Wenn man Glück hatte, war nach etlichen Jahren ein Oberregierungsrat zu erreichen und mit viel Sitzfleisch kam dann nach frühestens zehn Jahren eventuell schon mal eine Position als Regierungsdirektor in Sicht. Mein Vater, ein fleißiger, kluger und sehr fähiger Kopf, hatte es nach einem erfolgreichen Verwaltungsleben gerade mal bis dorthin gebracht. Ich ließ mir aber nichts anmerken: „Tja, das ist natürlich hart.“ Kunstpause. „Aber die Aufgabe ist so interessant, dass man schon mal gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt.“
Mit 29 schon Regierungsdirektor! Es gelang mir – typisch vielleicht für einen Dünnbrettbohrer – schon dreißig Monate später als Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, zwei weitere Gehaltsstufen übersprungen zu haben, d.h. ich wurde entsprechend einem Leitenden Ministerialrat bezahlt, hatte ein eigenes Spesenkonto, durfte mich von der Fahrbereitschaft des Bundestages fahren lassen, hatte Sitz in etlichen Gremien, wie Parteivorstand, Fraktionsvorstand etc. und war Mitherausgeber einer Zeitschrift. Gerade einmal 32 Jahre alt, war ich bereits ausgestattet mit den Insignien der Macht.
Doch auf der Suche nach der Macht hatte ich mich immer nur um die Macht selbst gekümmert und niemals einen Gedanken darauf verschwendet, was ich denn damit anfangen sollte. Wie Jürgen Möllemann und ähnlichen Politikern fehlte mir das moralische und theoretische Rüstzeug, um Macht gestalten und ausüben zu können oder auch nur zu dürfen.
Wenn ich damals bereits im Justizministerium die Augen besser geöffnet hätte, hätte ich schon beim Minister-Wechsel von Vogel zu Schmude – übrigens genau an meinem 30. Geburtstag – entscheidende Erkenntnis für mein politisches Leben gewinnen können und damit manche Sackgasse vermieden: Vogel stand ständig unter Strom, war immer und überall präsent. Er übernachtete sogar häufig im Ministerium neben seinem Arbeitszimmer. Wir im Leitungsbereich hatten einen Bereitschaftsdienst einzurichten und wurden mit weit reichenden Pieps-Geräten, wie man sie aus den TV-Krankenhausserien kennt (damals gab es noch keine Handys) zur ständigen Erreichbarkeit ausgestattet. Bei Lichte betrachtet gingen aber von Vogel selbst niemals wirklich kreative, eigene Impulse aus. Letztlich verwaltet er nur das Erbe, das schon Gustav Heinemann seinen SPD-Nachfolgern im Ministerium (Ehmke, Jahn und Vogel) hinterlassen hatte, bevor er Bundespräsident geworden war. Heinemann hatte alle justizpolitischen Meilensteine bereits vorbereitet und konzipiert, die Jahn mehr oder minder auf den Weg brachte und die dann schließlich Vogel formal und bürokratisch umsetzte. Kreativität war nicht so Vogels Ding. Letztlich blieb er gefangen im selbsterzeugten Stresskäfig, der kaum Muße ließ, um über den bürokratischen Tellerrand hinaus zu blicken. Ein – wenn auch logisch brillant agierender – Workaholic mag ein guter Staatssekretär sein, ist aber niemals ein guter Minister. Obgleich gerade in jener Zeit Stan Nadolnys „Entdeckung der Langsamkeit“ ein Bestseller wurde, und zuvor Herman van Veen mit seinem Lied „Weg da“ („Wir müssen rennen, springen, fliegen, tauchen, hinfall'n und gleich wieder aufsteh'n; wir dürfen keine Zeit verlieren ...“)die zunehmend krankmachende Hast in der Gesellschaft thematisiert und die Herzen der Deutschen erobert hatte: Vogel rackerte atemlos weiter. Mit mehr Ruhe und Übersicht hätte er gewiss Bedeutenderes vollbringen können. (Wer Gelegenheit hat, das Wohnhaus Konrad Adenauers in Röhndorf zu besichtigen, sollte sich auch den Terminkalender des ersten Kanzlers der Bundesrepublik anschauen. Er wird verblüfft sein, mit wie wenig Zeitdruck und Terminen sich ein Land regieren lässt, wenn man in der Lage ist, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und die richtigen Prioritäten zu setzen.)