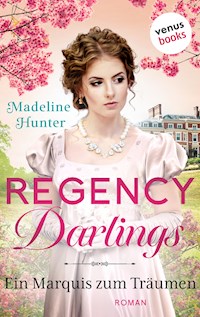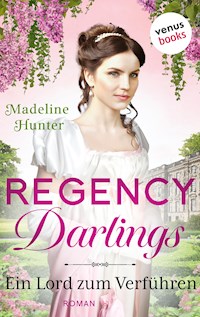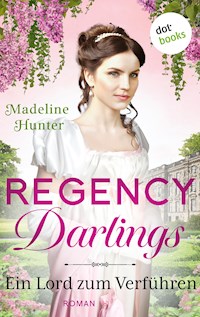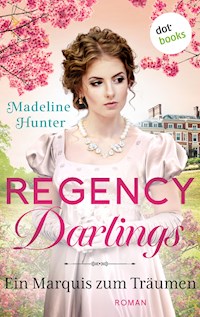9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fairbourne Quartet
- Sprache: Deutsch
Lady Lydia Alfreton verfasste einst ein skandalöses Manuskript und wird nun damit erpresst. Um das geforderte Geld aufzutreiben, geht sie in ihrer Verzweiflung auf eine Wette mit dem arroganten Duke of Penthurst ein - der Einsatz: ihre Jungfräuligkeit. Als sie beim Kartenspiel verliert, ist der Schock groß. Denn neben dem Erpresser, der damit droht, ihren Ruf zu zerstören, kommt nun noch ein zweites Problem hinzu: ein Duke, der entschlossen ist, ihre Wettschuld einzufordern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Zu diesem Buch12345678910111213141516171819202122Die AutorinDie Romane von Madeline Hunter bei LYXImpressumMADELINE HUNTER
Die Sünden der Lady Lydia
Roman
Ins Deutsche übertragen vonAnja Mehrmann
Zu diesem Buch
Seit sie erwachsen ist, fühlt sich Lady Lydia Alfreton vom Korsett der gesellschaftlichen Zwänge mehr und mehr erstickt. Nur im Spielsalon lebt sie auf und ist beflügelt von ihrer geradezu unglaublichen Glückssträhne. Doch als sie wegen eines skandalösen Manuskripts erpresst wird, das sie in ihrer Jugend geschrieben hat, muss sie in kurzer Zeit eine gewaltige Summe Geld aufbringen. Zu viel, um es beim Kartenspiel zu gewinnen. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den attraktiven Duke of Penthurst, der ihr vor einiger Zeit eine Wette vorgeschlagen hatte, die sie normalerweise niemals annehmen würde. Der Einsatz: ihre Jungfräulichkeit. Als sie ausgerechnet bei diesem Spiel die schlechtere Karte zieht, ist Lydias Schock groß. Sie hat nun immer noch kein Geld und dafür den arroganten Duke am Hals, den sie nicht ausstehen kann. Er steht für alles, was sie in ihrem Leben ablehnt. Wie kann sie sich einem Mann hingeben, der gewohnt ist, alles zu bekommen und für den sie vermutlich nur eine von zahllosen Eroberungen sein wird? Beide haben allerdings die Rechnung ohne die Gefühle gemacht, die plötzlich in ihnen aufwallen. Doch ganz gleich, wie stark der Funke ist, der zwischen ihnen überspringt – um die tiefe Kluft zwischen ihnen zu überwinden, müssen beide ihr Herz offenbaren und alten Schmerz hinter sich lassen …
1
September 1799
Lydia starrte auf die Kaskade aus Seide und Musselin, die über Sarahs Arm hinabfiel. Sie nahm die Farben der Stoffe kaum wahr, einzig ihr Tastsinn schien ihr noch zu gehorchen. Hart und kantig spürte sie in ihrer Hand den Brief, den sie zerknüllt hatte.
»Welches wünschen Sie, Milady?« Sarah deutete auf das Musselinkleid. »Der Earl mochte dieses blaue immer besonders gern. Da er zugegen sein wird, wäre es eine gute Wahl.«
Das fragliche Kleid hätte einem jungen Mädchen während seiner ersten Saison gut zu Gesicht gestanden, doch zu Lydia mit ihren fast vierundzwanzig Jahren passte es keinesfalls. Ihrem Bruder, dem Earl of Southwaite, gefiel sie in diesem Kleid, denn er sah immer noch das junge Mädchen in ihr. Und das würde er so lange tun, bis sie eines Tages heiratete. Jedoch nahm die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals dazu kommen würde, mit jedem Jahr ab, das verging.
Gott sei Dank.
Sie schloss kurz die Augen, um sich zu sammeln, und strich den zerknitterten Brief auf ihrem Schoß glatt.
Die Tinte war verschmiert, doch die Worte waren noch lesbar. Abermals kroch Lydia ein kaltes Schaudern den Rücken hinauf. Diesmal jedoch, statt nur Vorbote eines Schocks zu sein, kollidierte das Frösteln mit der glühenden Hitze ihrer Empörung, während die Bedeutung der Worte erneut in ihr Bewusstsein drang.
Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, sich heute Abend bei Mrs Burton mit mir zu treffen, um über gewisse empörende Nachrichten Ihre Person betreffend zu sprechen, die mir zu Ohren gekommen sind. Wenn wir uns beraten, davon bin ich überzeugt, können wir Ihnen einen großen Skandal ersparen.
Ihr Diener
Algernon Trilby
Der Schuft hatte ihr die Ankündigung einer Erpressung geschickt. Was für ein Unsinn. Gäbe es in ihrer Vergangenheit doch irgendetwas, das interessant genug war, um so etwas heraufzubeschwören! Dieser Dummkopf hatte sich wahrscheinlich einfach geirrt.
Sie stellte sich vor, dass der fade Mr Trilby diesen Brief irrtümlich an sie adressierte und versehentlich dem wahren Opfer seiner Erpressung eine Einladung zu einer seiner langweiligen Zaubervorstellungen geschickt hatte. Hätte sie sich nicht für Taschenspielertricks interessiert, sie hätte ihn niemals gut genug kennengelernt, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Zofe raschelte mit den beiden Kleidern. Ihre halbmondförmigen, vor verzweifelter Ungeduld hochgezogenen Augenbrauen reichten bis fast an ihren Haaransatz.
»Keines von beiden«, winkte Lydia ab. Sie stand auf, verließ das Ankleidezimmer und setzte sich an den kleinen Schreibtisch in ihrem Schlafgemach. Eilig schrieb sie einige Zeilen nieder und rief nach Sarah, noch bevor sie damit fertig war.
»Sorge dafür, dass einer der Diener dies zu Cassandra bringt. Und dann bereite mein grünes Abendkleid vor.«
»Das grünseidene? Sie meinten doch, Lady Ambury habe gesagt, es sei ein zwangloses Dinner.«
»Ich gehe nicht zu ihrem Dinner. Ich habe abgesagt.«
»Das ist recht plötzlich.«
»Plötzlich, aber notwendig. Heute Abend muss ich zu Mrs Burton.«
Um Sarahs Mund zuckte es missbilligend. Lydia nahm diese Vertraulichkeit hin, weil sie und Sarah schon als Kinder in Crownhill miteinander gespielt hatten, dem Landsitz ihrer Familie, auf dem Sarahs Vater noch immer als Stallknecht diente.
»Sprich einfach aus, was du denkst«, sagte Lydia, die sich bereits wieder auf dem Weg zum Ankleidezimmer befand. »Ich ertrage es nicht, wenn du das Gesicht verziehst, anstatt etwas mit Worten zu sagen.«
Sarah war ihr langsam gefolgt und legte die beiden Kleider ab. »Gewiss können Sie auf einen Abend am Spieltisch verzichten, um ihn stattdessen mit Ihrer Familie und guten Freunden zu verbringen. Ich glaube, Lady Ambury und Lady Southwaite haben dieses Dinner mit großer Sorgfalt geplant.«
Lydia durchwühlte ihre Schmuckschatulle. »Und das bedeutet, dass sie irgendeinen Mann eingeladen haben, dessen Bekanntschaft ich machen soll. Noch ein Grund mehr, lieber zu Mrs Burton zu gehen. Cassandra wird ihre Tante mitbringen, um das Geschlechterverhältnis bei Tisch auszugleichen, oder Emma nimmt eine von unseren Tanten mit. Meine Abwesenheit wird keine ernstlichen Unannehmlichkeiten nach sich ziehen.«
Sarah öffnete einen Schrank und nahm das grüne Seidenkleid heraus. »Sie wollen doch nur, dass Sie ihn kennenlernen, falls Sie mit Ihrer Vermutung überhaupt recht haben. Ein unverbindliches Bekanntmachen ist doch noch keine Zumutung. Und was Mrs Burton betrifft – wie viel Spaß können Sie dort schon haben, nachdem Ihr Bruder Sie um dieses Versprechen gebeten hat?«
»Southwaite hat mich um nichts gebeten. Er hat es von mir verlangt.« Die Erinnerung an das Gespräch mit ihrem Bruder war so frisch, dass diese Kränkung noch immer schmerzte.
»Er will doch nur Ihr Bestes«, murmelte Sarah.
Natürlich wollte er das. Jeder wollte das. Southwaite und seine Frau Emma, Cassandra und ihre beiden Tanten, alle wollten, was sie für das Beste für sie hielten. Das galt sogar für Sarah.
»Er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das Glück Sie verlässt«, fuhr Sarah fort.
Was jedoch – sehr zur Enttäuschung ihres Bruders – noch immer nicht geschehen war … Ihre unheimliche Fähigkeit, stets als Gewinnerin den Spieltisch zu verlassen, kam all jenen unmoralisch vor, die glaubten, dass man erntet, was man sät. Den unbedeutenden Ruhm, den das Glück beim Spiel ihr eingebracht hatte, bewerteten sie als skandalös. Also hatte Southwaite, nachdem er vergeblich auf ihre Strafe in Form eines großen Verlustes gewartet hatte, sich eingemischt, um dafür zu sorgen, dass es einen solchen Verlust niemals geben würde. Sollte sie je mehr als fünfzig Pfund an einem Abend aufs Spiel setzen, würde er ihr das Taschengeld streichen und dafür sorgen, dass jedes Spielkasino in der Stadt davon erfuhr.
»Vielleicht war er auch besorgt, dass Sie allzu sehr von der Spielleidenschaft gepackt werden.« Sarahs Blick war weiterhin auf das grüne Kleid geheftet, das sie nach Beschädigungen absuchte. »Es ist bekannt, dass manchen Leuten so etwas widerfährt. Das geht so weit, dass sie sich nicht vom Spieltisch fernhalten können, ungefähr so, wie ein Trinker die Finger nicht vom Gin lassen kann.« Sie griff nach ihrem Nähkorb. »Sie lassen sich andere Vergnügungen entgehen, sogar Abende im Freundes- und Familienkreis, um sich in diese Spielhöllen zu begeben. Und auch wenn sie ihre Gewinne sinnvoll einzusetzen verstehen, kann doch der Nervenkitzel selbst allzu verlockend sein.«
Lydia beobachtete im Spiegel, wie Sarah sich auf Nadel und Faden konzentrierte. Als kleine Mädchen hatten sie zusammen im Schmutz gespielt, und noch heute waren sie eher Freundinnen als Herrin und Zofe. Lydia hatte ihren beiden Tanten getrotzt und darauf bestanden, dass Sarah an ihrer Seite blieb, obwohl das für das Mädchen zwei Jahre der Ausbildung und Anleitung durch eine erfahrenere Bedienstete bedeutet hatte.
Sarahs indirekter Tadel jedoch gefiel Lydia überhaupt nicht. Es gab zu viele Menschen, die sich berechtigt fühlten, sie zu ermahnen, mit ihr zu schimpfen und sie zu manipulieren. Sie war doch eine erwachsene Frau, um Himmels willen!
»Befürchtest du, dass ich zu diesen Personen gehöre, Sarah? Trunken vor Aufregung? Unfähig, mich zurückzuhalten? Dass das Spiel für mich Nervenkitzel ist und nicht Mittel zum Zweck?«
»Nein, Milady. Ich würde niemals …« Sie errötete.
Natürlich würde sie. Sie hattees gerade getan. »Sei beruhigt, denn ich habe meine Pläne für heute Abend nicht geändert, um spielen zu können.«
»Ja, Milady.«
»Die Wahrheit ist – und versprich mir, es niemandem zu sagen –, dass ich zu Mrs Burton gehe, um mich dort mit einem Mann zu treffen.«
Erneut blickte sie in den Spiegel und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass Sarah vor Schock und Neugier die Augen aufgerissen hatte.
»Jetzt bring bitte diesen Brief nach unten und hilf mir, mich fertig zu machen.«
Clayton Galbraith, Duke of Penthurst, war der Ansicht, dass kein Mann, egal, welchen gesellschaftlichen Ranges, von sich behaupten konnte, einen guten Charakter zu haben, wenn er den älteren Mitgliedern seiner Familie gegenüber nicht Geduld und Höflichkeit an den Tag legte. Darum rang er um Gelassenheit, während er seiner Tante Rosalyn zusah, die an einem der Tische in Mrs Burtons Spielsalon ihr Glück versuchte.
Rosalyn hatte ihn gebeten, sie zu begleiten. Er wartete noch darauf, dass sie ihm den Grund dafür verriet. Bisher schien es so, als hätte sie seine Gesellschaft nur gesucht, um ihm den Klatsch und Tratsch eines ganzen Monats mitzuteilen.
Doch dafür hätte sie ihn nicht in diesen Salon schleifen müssen, schließlich wohnte sie in seinem Haus, und das schon ihr ganzes Leben lang. Sie hatte nie geheiratet, denn für die Tochter eines Dukes bedeutete eine Heirat oftmals einen Verlust an Ansehen und gesellschaftlichem Rang, wie sie gern erklärte. Er vermutete den wahren Grund darin, dass eine Heirat sie aus der herzöglichen Residenz geführt und es ihr erschwert hätte, sich in die Angelegenheiten ihrer Bewohner einzumischen. Da der Duke inzwischen die einzige Person war, die noch dort lebte, war er damit gemeint.
Ihr modisches Abendkleid von der Farbe eines zugefrorenen Sees passte gut zu ihrer sehr hellen Haut, dem grauen Haar, den dunklen Augen und ihrer majestätischen Haltung. Zwischen in gedämpftem Ton vorgetragenen vertraulichen Bemerkungen verlor sie ihr Geld in sehr geruhsamem Tempo. Um ihr einen Gefallen zu tun, passten sich alle am Tisch ihrer Spielweise an. Nach und nach verabschiedeten die anderen sich, sodass sie und Galbraith allein dasaßen. Was, wie er argwöhnisch dachte, von Anfang an Rosalyns Absicht gewesen war.
Zur Entschuldigung schob er dem Croupier eine Guinee hin, während seine Tante blinzelnd auf das Blatt spähte, das sie soeben erhalten hatte. Je magerer im Alter ihr Gesicht und je schärfer ihre Züge wurden, desto ähnlicher sahen er und sie sich. Er hatte die Ähnlichkeit nicht bemerkt, bis er ihr als Siebzehnjähriger eines Tages einen Krankenbesuch abgestattet und sie ohne Schminke und Lächeln und Perücke gesehen hatte. Dasselbe Kastanienbraun der Augen und die gleichen fein geschwungenen Augenbrauen, gewiss, und vielleicht sogar der gleiche breite Mund, wobei ihre Gesichtszüge natürlich weniger streng wirkten.
»Um Kendale ist es wirklich schade«, murmelte sie und betrachtete eingehend die Karten. »Er hat viel zu lange gezaudert. Je älter ein Mann wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendein junges Ding ihm den Kopf verdreht.«
Penthurst überlegte, ob er seinen Freund Viscount Kendale in Schutz nehmen oder gleich die Herausforderung annehmen sollte, die ihm soeben vor die Füße geworfen worden war. Verdammt, wenn seine Tante diesen Abend geplant hatte, um das leidige Thema seiner Ehelosigkeit anzuschneiden, dann würde er sehr deutlich werden und ihr keinen Schritt entgegenkommen. »Er scheint sehr glücklich und sehr verliebt zu sein. Würdest du ihm weniger wünschen?«
»Kendale und verliebt? Wer hätte das je gedacht? Tss!«, zischte sie aufgebracht und verlangte eine neue Karte. »Sie ist vollkommen unpassend. Jeder weiß das, er eingeschlossen. Er hätte seinem Stand entsprechend heiraten sollen. Auch wenn er sehr verliebt ist, hätte er sich selbst nicht verleugnen müssen.«
»Dafür ist er zu rechtschaffen. Und du solltest jetzt aufhören. Wenn du noch eine Karte nimmst, kommst du wahrscheinlich über einundzwanzig.«
»Rechtschaffen? Nennt man das heutzutage so, wenn ein Angehöriger des Hochadels sich romantischen Vorstellungen hingibt, die besser zu einem Schulmädchen passen würden? Ich hoffe, du verfügst über wesentlich mehr Verstand als Rechtschaffenheit dieser Art.«
»Sei versichert, mit meinen Frauen bin ich so gnadenlos pragmatisch, dass mich niemals jemand so bemitleiden wird, wie du Kendale bemitleidest.«
Trotz seines guten Rates verlangte sie eine weitere Karte. Und hatte damit verloren. »Nun, zumindest hat er geheiratet, nicht wahr?«
In ihrer Stimme schwang widerwilliges Lob mit. »Sie ist sehr hübsch, das muss ich zugeben. Und trotz ihrer Herkunft verfügt sie über einen gewissen Stil.«
Penthurst weigerte sich, Rosalyn weiterhin bei Laune zu halten. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf den Ballsaal, der in diesem Haus in Mayfair als Kasino diente. Mrs Burton führte dieses vornehme Etablissement, in dem man in London, abgesehen von den Clubs für die Gentlemen, ein Vermögen verspielen konnte. Und es war vermutlich der einzige Ort dieser Art, den eine Dame allein besuchen konnte, ohne dass jemand die Stirn runzelte. Von offizieller Seite hatte es Schritte gegen andere Kasinos gegeben, die von kultivierten Frauen in ihren eigenen Häusern betrieben wurden. Doch Mrs Burtons Kundschaft war adlig, und das verschaffte ihr besondere Freiheiten.
»Da wir gerade von hübschen Mädchen sprechen«, sagte seine Tante, während der Croupier mit dem Rateau ihren Einsatz abzog, »habe ich schon erwähnt, dass Lady Barrowtons Nichte in der Stadt erwartet wird? Sie soll ja berühmt sein für ihre Schönheit.«
»Soll? Hat niemand sie bisher gesehen?« Er lauschte der Konversation nur mit halbem Ohr, denn im Grunde wusste er bereits, was er nun zu hören bekommen würde. Stattdessen konzentrierte er sich auf den Eingang zum Ballsaal. Eine dunkelhaarige Frau war gerade angekommen. Lydia Alfreton.
Das war merkwürdig. Denn er war sicher, dass Southwaite eine Dinnerparty erwähnt hatte, die heute Abend in Amburys Haus stattfinden und an der seine Schwester teilnehmen sollte. Stattdessen war sie nun hier, bereit, ihr beträchtliches Glück am Spieltisch herauszufordern.
Das grüne Kleid, das sie trug, schmeichelte ihrem dunklen Haar und der sehr blassen Haut. Sie wirkte glücklich. Leider sah sie so nur aus, wenn sie spielte. Wenn man ihr tagsüber begegnete, blickten ihre Augen durch einen hindurch, matt und leer, und ihre Miene blieb ausdruckslos.
»Natürlich ist Lady Barrowtons Nichte schon gesehen worden. Andernfalls könnte sie nicht berühmt sein. Allerdings war sie noch nie zuvor in der Stadt. Sie kommt, um sich vor ihrem Debüt den letzten Schliff zu holen.«
»Ein Kind also. Kinder sind immer hübsch. Und süß. Und langweilig.«
»Wohl kaum ein Kind. Ein frisches, unschuldiges Mädchen. Ich würde euch gern miteinander bekannt machen.«
»Ich bin nicht interessiert, aber vielen Dank.«
Die Anwesenheit des Croupiers schien Rosalyn plötzlich zu missfallen. In herrischem Ton schickte sie ihn fort. Der Mann zog sich sofort zurück, wobei er beträchtlich viel Geld unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen ließ. Sie wandte sich Galbraith zu und beugte sich zu ihm, sodass ihre folgenden Worte nicht überhört werden konnten. »Du musst endlich heiraten, und dieses Mädchen ist perfekt.«
»Ich habe dir schon vor langer Zeit gesagt, dass ich mich in dieser Sache nicht manipulieren lasse. Wenn du glaubst, dass ich mich füge, nur weil du das Thema an einem öffentlichen Ort und nicht zu Hause ansprichst, dann irrst du. Und inzwischen hast du gewiss auch verstanden, dass ich keine Neigung verspüre, ein junges, ahnungsloses Mädchen zu ehelichen – sollte der Tag, an dem ich heirate, überhaupt je kommen.«
Resigniert seufzte sie. »Ich habe deine Vorliebe für ältere Frauen noch nie verstanden.«
»Ach nein?«
Rosalyn errötete und wandte den Blick ab, um die Frage nicht beantworten zu müssen. Etwas anderes zog ihre Aufmerksamkeit auf sich, und sie runzelte die Stirn. »Vermutlich sollte ich deine Vorlieben hinnehmen, da deine Instinkte sich als richtig erwiesen haben, zumindest soweit es diese Frau dort betrifft. Ihre arme Mutter würde sich im Grab umdrehen.«
Er selbst musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sie von Lydia Alfreton sprach. Dennoch tat er es, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Mrs Burton Lady Lydia begrüßte und sie zum Spieltisch geleitete.
»Diese Frau betreffend hatte ich überhaupt keine Instinkte. Aber verständlicherweise war ich verärgert, weil du und Lady Southwaite beschlossen habt, wen ich heiraten soll. Da war das Mädchen noch nicht einmal einen Tag alt. Derartige Heiratsvereinbarungen sind antiquiert, zudem entbehren sie jeder rechtlichen Grundlage und dürfen nicht geduldet werden.« Als er im Alter von fünfzehn Jahren den Herzogstitel geerbt hatte, war es eine seiner ersten Taten gewesen, sich von diesem lächerlichen Arrangement zu distanzieren. Außer seiner Tante sprach niemand mehr darüber. Er bezweifelte, dass sich überhaupt noch jemand daran erinnerte.
»Celeste war meine engste Freundin, sie war so lieb und so gut. Wer hätte gedacht, dass ihre Tochter … nun, dass sie sich so entwickeln würde.« Sie deutete mit einer Hand auf Lydia, die soeben beim Würfeln gewonnen hatte. Um ihren Tisch hatten sich Leute versammelt, um ihr zuzusehen. Vielleicht zog sie ihr Ruf der ewigen Gewinnerin an. Vielleicht lag es auch an ihrer lebhaften Aufgeregtheit. In ihren Augen brannte ein Licht, das sie der Welt sonst niemals zeigte, sie hob den Blick und die Arme und lachte nach jedem Gewinn, als dankte sie der Vorsehung, sie wieder begünstigt zu haben.
Seine Tante schnalzte mit der Zunge. »Tagsüber ist sie wie eine Sphinx, undurchschaubar. Hier und jetzt am Abend ähnelt sie einer Zecherin, die sich am Wein berauscht hat. Wenn Southwaite sie nicht im Zaum hält, wird sie ihn noch ruinieren. Das sagen alle. Sie richtet ihn, sich selbst und die ganze Familie zugrunde.«
»Aber sie gewinnt. Wenn sie so weitermacht, ist es wahrscheinlicher, dass sie das Vermögen der Familie verdoppelt, anstatt es zu verspielen.« Das war das Problem. Southwaite war überzeugt, dass ein einziger großer Verlust der Spielleidenschaft seiner Schwester ein Ende setzen würde.
»Ich rede nicht vom Spielen.«
Das weckte seine Neugier. »Du redest doch nicht etwa von Männern?«
»Und warum nicht?«
»Sie interessiert sich nicht für Männer. Glücksspiel, ja. Pferde, ja. Kunst und Literatur, ja. Aber sollte es Gerüchte bezüglich jener anderen Art von Ruin geben, dann sind sie falsch.«
»Zweifellos hat Southwaite das behauptet. Als ob er Bescheid wüsste.« Ihre Augen wurden schmal, als sie zur anderen Seite des Saales spähte. »Beim Spiel pflegt Lady Lydia Umgang mit zahlreichen Männern, und im Gespräch mit ihnen ist sie nicht gerade zimperlich, habe ich gehört. Ihre Tante Amelia ist deswegen regelrecht außer sich.« Sie schüttelte den Kopf. »Meine liebe Celeste. Vielleicht ist es gut, dass sie das nicht mehr erleben muss.«
Er unterdrückte den Wunsch, noch einmal zu wiederholen, dass diese Gerüchte meilenweit von der Wahrheit entfernt waren. Aber was wusste er schon? Gewiss machte Southwaite sich Sorgen um seine Schwester. Und wenn es nicht nur ihre Neigung zum Glücksspiel war, die der Familie Sorgen bereitete, würde man Penthurst wohl kaum darüber in Kenntnis setzen.
Als wollte er die Worte seiner Tante bestätigen, näherte ein Mann sich dem Spieltisch, an dem Lydia saß. Dicht neben ihr blieb er stehen. Penthurst neigte den Kopf, um das Gesicht des Burschen besser sehen zu können. Als er ihn erkannte, konnte er ein Lachen nicht unterdrücken. Algernon Trilby? Trilby und Lady Lydia? Das konnte einfach nicht sein.
»Was ist so amüsant?«, fragte seine Tante.
»Ich denke darüber nach, was du mir gerade gesagt hast, und ich konnte meine Reaktion nicht unterdrücken.«
»Lach du nur. In solchen Dingen stimmen die Gerüchte fast immer.« Sie winkte den Croupier heran und widmete sich wieder ihren Karten.
Und abermals brachte sie das Gespräch darauf, ihn der süßen, unschuldigen Nichte von Lady Barrowton vorzustellen. Er wich jeder verbindlichen Zusage aus, das Mädchen kennenzulernen. Während sie in diesem Tanz um Einmischung und Widerstand mit Bedacht ihre Schritte wählten, ertappte Penthurst sich dabei, dass er gelegentlich zu Lydia hinüberspähte, die beim Würfeln gerade mühelos zu gewinnen schien.
Offenbar kannte sie Trilby. Sie sprach mehrmals mit ihm. Und was sie sagte, ließ den Mann erröten. Schließlich verdrückte Trilby sich und sah den Pharao-Spielern zu. Lady Lydia schien zu wissen, wie sie unerwünschte Aufmerksamkeit anmutig, aber endgültig loswerden konnte.
Beinahe hätte er seine Tante darauf hingewiesen, damit sie der Schwester seines Freundes unnötigen Klatsch ersparen würde. Doch gerade, als er den Mund aufmachen wollte, verließ auch Lydia den Tisch. Nicht mehr mit strahlenden Augen, sondern mit dem leeren Gesichtsausdruck, der seine Tante veranlasste, sie eine Sphinx zu nennen. Sie ging direkt auf die Terrassentüren zu und verließ den Saal.
Zwanzig Schritte später folgte Algernon Trilby ihr.
»Bitte entschuldige mich. Ich werde mich ein Weilchen zurückziehen, und dann kannst du mich nach Hause bringen.« Seine Tante streckte die Hand aus, damit er ihr beim Aufstehen half.
»In ein paar Minuten komme ich dich holen«, sagte er.
»Nicht zu bald. Der beste Klatsch und Tratsch ist im Aufenthaltsraum zu hören.«
»Ich warte, bis du genug hast.«
Sie machte sich auf den Weg. Dreißig Pfund ließ sie auf dem Tisch liegen, als wäre es ihr zu mühsam, sie wieder in ihr Ridikül zu stecken. Für eine Frau, die ihr Leben lang von Dukes versorgt worden war, war es das vermutlich auch. Mit einem Handzeichen bat er um neue Karten.
Als seine Tante fort war, kamen andere Gäste, um an dem Tisch zu spielen. Es folgten kurzweilige Partien. In der vierten Runde blickte er sich im Saal um und bemerkte, dass weder Lydia noch Trilby zurückgekommen waren. Nichts deutete darauf hin, dass Lydia ein Rendezvous geplant hatte, doch mit jeder Minute, die verging, würden mehr Leute glauben, dass genau dies der Fall war. Er stellte sie sich dort draußen mit Trilby vor, der ihr bestenfalls auf die Nerven gehen, sie schlimmstenfalls aber belästigen würde.
Penthurst warf die Karten auf den Tisch, stand auf und ging auf die Terrassentüren zu. Hätte es sich um seine Schwester gehandelt, hätte er von Southwaite schließlich auch erwartet, sie im Auge zu behalten.
2
Lydia hielt das Blatt Papier in das Licht der Laterne und las die Worte, die ihr inzwischen vertraut waren. Dann starrte sie Algernon Trilby wütend an. »Mir diesen Brief zu schicken und dieses Treffen von mir zu verlangen, war unverzeihlich. Und jetzt wagen Sie es auch noch, Andeutungen zu diesem Blatt Papier zu machen, das Sie mitgebracht haben. Sind Sie verrückt geworden?«
»Vielleicht sind Sie ja verrückt geworden.« Sogar im Licht der Laterne sah sie, dass er rot wurde. Er täuschte hochmütige Empörung vor, um sein Unbehagen zu überspielen. Sobald er die Terrasse betreten hatte, hatte sie ihn mit einem Maß an Ärger begrüßt, wie sie ihn an einem Ort zu zeigen wagte, zu dem jeder Zutritt hatte.
»Ich war schockiert, als ich es gelesen habe«, fuhr er fort. »Wirklich schockiert, ich muss schon sagen. Dass Sie solche Risiken eingehen. Die Ehre Ihrer Familie aufs Spiel zu setzen …«
»Seien Sie nicht dumm. Woher haben Sie das?« Sie wedelte mit dem Blatt Papier vor seinem Gesicht herum.
»Ich habe es gekauft. Ich habe ziemlich viel Geld dafür bezahlt, um Ihnen den Skandal zu ersparen, falls es in die falschen Hände geraten wäre.«
»Es ist einem längeren Text entnommen. Einem viel längeren.«
»Allerdings. Das Tagebuch, aus dem es stammt, gereicht Ihnen nicht gerade zum Vorteil. Auch erklärt es nicht, warum Sie so genau Buch über die Schiffe geführt haben, die in Portsmouth vor Anker liegen, und über die Fahrten vor knapp zwei Jahren. Es sieht aus, als ob … nun, es scheint, Sie waren …« Er hob die Augenbrauen und schürzte die Lippen.
Lydia starrte auf die Liste der Schiffe. Die Aufzeichnungen ließen völlig falsche Gründe für ihre Aufzeichnungen über die Seeflotte vermuten.
In einer vernünftigen Welt würde kein Mensch davon ausgehen, dass ausgerechnet sie für die Franzosen die heimische Flotte ausspähen würde. Leider war die Welt in diesem Augenblick nicht vernünftig. Sie wimmelte von Menschen, die sich vor einer bevorstehenden Invasion und vor französischen Agenten fürchteten, die mitten unter ihnen lauerten. Auch ihr eigener Bruder verbrachte viel Zeit damit, das Königreich vor solchen Dingen zu schützen.
Was für ein Durcheinander! Und dass so etwas ausgerechnet einem Dummkopf wie Trilby in die Hände fallen musste … Sie atmete tief ein, um ihre aufgewühlten Gefühle zu beruhigen.
»Es ist kein Tagebuch. Es ist ein Roman, in der ersten Person geschrieben.« Kein guter Roman. Ein sehr grober erster Entwurf. Ein launenhafter Versuch romantischen künstlerischen Schaffens, während sie darauf gewartet hatte, dass etwas Wundervolles passieren würde. Allein die Erinnerung an das Manuskript rief schmerzliche Sehnsucht nach der Vergangenheit in ihr wach, und nach einem Frühling, in dem sie noch Träume gehabt hatte.
Mehr als eineinhalb Jahre hatte sie dieses Blatt Papier nicht mehr gesehen. Seit dem Tag, an dem sie erfahren hatte, dass letzten Endes nichts Wunderbares geschehen würde. Niemals. Sie hatte das Manuskript im Cottage ihrer Tante Amelia in Hampshire zurückgelassen, unvollendet.
Oder hatte sie es zu Ende geschrieben? So viele Erinnerungen an jene Zeit waren von der dumpfen, grauen Wolke verschluckt worden, in der sie danach so lange gelebt hatte.
Trilby faltete die Hände auf dem Rücken und rümpfte missbilligend die Nase. Sein blondes, spärliches Haar bildete einen spitzen Ansatz in der Mitte der Stirn. Er trug es zurückgekämmt, was sein ohnehin schmales Gesicht noch länger erscheinen ließ. Der Schuft wagte es, vornehm zu tun, und musterte sie, als wäre er zu einem Urteil über sie gelangt.
Wer hätte gedacht, dass dieser wenig bemerkenswerte Mann in der Lage war, ihr so große Probleme zu bereiten? Ein halbes Jahr zuvor war er in die Stadt gekommen und von einem Cousin in die Gesellschaft eingeführt worden. Dieser Cousin war der jüngere Bruder der Ehefrau eines Baronets. Niemand hätte Algernon Trilby auch nur eines Blickes gewürdigt, wenn nicht einige Gastgeberinnen seine Taschenspielertricks für eine amüsante Art der Unterhaltung gehalten hätten, um sich manche Stunde in ihren Salons zu verkürzen. Lydias Interesse an diesen Tricks hatte ihr Trilbys Bekanntschaft eingebracht.
Direkt vor seinem Gesicht zerknüllte sie das Blatt Papier in der erhobenen Faust. »Sie müssen mir den Rest des Manuskripts geben. Sofort. Es wäre unehrenhaft von Ihnen, es zu behalten.«
Er starrte auf ihre Faust und straffte die Schultern. »Da, wo es herkommt, befindet sich noch mehr. Das da können Sie behalten, wenn Sie wollen.«
Ihre Gedanken überschlugen sich, als sie dieses »Mehr« hörte. Ihr fiel wieder ein, wie dilettantisch sie die Längen des Romans mit Aufzählungen der Speisen bei Festgelagen gefüllt hatte oder mit der Beschreibung von Ballkleidern – oder von Schiffen, die vor Anker lagen. Letzteres war ein Versuch gewesen, Lokalkolorit hinzuzufügen, genauso wie die Aufzählung der Angehörigen der Bürgerwehr entlang der Küste nahe Crownhill, dem Anwesen ihrer Familie.
Oje. Das würde ebenso falsch verstanden werden wie die Aufzählung der Schiffe.
Die Figuren ihres Romans nahmen vor ihrem geistigen Auge wieder Gestalt an und auch die Details ihrer Affäre, die sich auf wenig Erfahrung, aber umso mehr auf Fantasie stützten.
Schließlich drängten sich einige der intimeren Szenen zwischen Held und Heldin in den Vordergrund. Vor allem eine Szene, die sie in einer besonders einsamen Nacht voller Liebeskummer geschrieben hatte, spielte sich in ihrem Kopf ab …
Gütiger Himmel.
Sie trat von der Laterne zurück, damit er ihre Reaktion nicht sah. Es gab Kapitel in diesem Roman, im Vergleich zu denen diese Seite verblassen würde, sollten sie allgemein bekannt werden. Und wenn die Leute annahmen, dass es sich um ein Tagebuch handelte …
»Haben Sie es gelesen?«
»Nicht alles. Das hielt ich für nicht korrekt.«
»Nun, das wäre es auch nicht, obwohl es sich um eine erfundene Geschichte handelt. Es ist so schlecht geschrieben, dass ich den Gedanken unerträglich fand, jemand könnte es lesen. Dass ich geglaubt habe, solch ein literarisches Unterfangen müsste Listen der Schiffe enthalten, die ich von jenem Hügel aus beobachtet habe, ist Beweis genug für seine geringe Qualität.«
»Oder für etwas anderes«, murmelte er.
»Noch einmal: Es ist nur ein Roman. Sie müssen ihn mir zurückgeben. Das wissen Sie.«
Er kratzte sich die Stirnglatze, während er über ihre Worte nachdachte. »Es hat mir viel Mühe bereitet, ihn in die Hände zu bekommen. Wie gesagt, nur um Sie zu schonen. Ich bin kein reicher Mann. Ich hätte gern eine Entschädigung für meine Kosten.«
Darum ging es also. »Wie viel Mühe hatten Sie damit, Mr Trilby?«
»Mühe für zehntausend Pfund.«
Ihr stockte der Atem. War er verrückt geworden? Sie bezweifelte, dass er mehr als hundert Pfund ausgegeben hatte. Wo hätte er zehntausend in bar auch auftreiben sollen?
Und woher sollte sie so viel Geld nehmen?
Die ungeheuerliche Höhe des Betrages entmutigte sie. Offensichtlich kannte Trilby den Wert dessen, was er gefunden hatte. Sie glaubte nicht, dass sie ihn herunterhandeln konnte, obwohl sie es natürlich versuchen musste.
»Ich kann Sie unmöglich sofort für all Ihre Ausgaben entschädigen.«
»Gehen Sie einfach wieder hinein, und lassen Sie die Würfel rollen, oder spielen Sie Karten. Ich habe gesehen, wie talentiert Sie sind.«
»Und wenn ich verliere? Dann liege ich finanziell am Boden und kann Sie auf keinen Fall bezahlen, jahrelang nicht. Ich werde eine Möglichkeit finden, Ihnen einen großen Teil zu geben, und ich verspreche Ihnen, den Rest später zu zahlen. Bis Sie schließlich voll und ganz entschädigt sind.« Es würde sie umbringen, in Zukunft nur noch zu spielen, um diesen Erpresser zufriedenzustellen. Sie wusste sehr viel Besseres mit den Gewinnen anzufangen, und es würde ihr das Herz brechen, das zu vernachlässigen.
Er verschränkte die Arme und verzog das Gesicht. »Wenn Sie nicht wissen, wie Sie es ermöglichen sollen, dann weiß es vielleicht Ihr Bruder.«
Die Vorstellung, dass Southwaite diesen Roman zu sehen bekommen und – Gott bewahre! – jene Szene lesen würde, brachte sie nahezu aus der Fassung. »Wenn mein Bruder davon erfährt, wird er Sie wahrscheinlich herausfordern und töten, weil Sie es gewagt haben, mich zu erpressen.«
Angesichts der Drohung trat er einen Schritt zurück, doch er gab nicht auf. »Erpressen? Da bemühe ich mich, Sie vor den schlimmsten Spekulationen Ihren Charakter und Ihre Loyalität betreffend zu bewahren, und Sie beschuldigen mich solcher Dinge? Das verletzt mich zutiefst.«
»Sie sind nicht verletzt. Sie sind ungeduldig und gierig.«
»Solche Beleidigungen kann ich nicht hinnehmen. Wenn Southwaite nicht kooperiert, finde ich sicherlich anderweitig Verwendung für diese Aufzeichnungen. Es gibt Leute, die für so etwas ganz schnell bezahlen.« Er deutete auf ihre Faust. »Für den Rest dieser Liste da, zum Beispiel. Vielleicht zahlt ja die Regierung dafür.«
»Niemand außer mir wird Sie für Ihre Mühen entschädigen. Wäre es nicht besser, einen Teil des Betrages in Kürze zu bekommen und den Rest später, statt einer viel geringeren einmaligen Zahlung jetzt sofort?«
Trilby tat weiterhin beleidigt, dachte aber über ihren Vorschlag nach. Sie wandte sich ab, verschränkte die Arme und wartete. Plötzlich bemerkte sie einen Mann, der nahe beim Haus stand, so als hätte er gerade erst die Terrasse betreten. Er schaute umher, bis sein Blick auf sie fiel. In demselben Augenblick spürte sie, wie Trilby ihr die Hand auf die Schulter legte, um ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen.
Der Mann an der Tür hatte die Berührung wahrgenommen, dessen war sie sicher. Plötzlich schien er größer zu werden. Er machte einen Schritt nach vorn und stand im Licht der Laterne. Er war von beeindruckender Statur und trug einen eleganten mitternachtsblauen Gehrock, der dezente, aber teure Goldstickereien an den Kanten aufwies, als hätte sein Eigentümer nur mit Bedauern auf die fantasievollere Kleidung vergangener Tage verzichtet. Die winzigen Lichtreflexe dieser Goldfäden verrieten ihr, wer er war.
»Lady Lydia, wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Die Stimme bestätigte ihr seine Identität, und sein Gesicht war nun deutlicher zu sehen. Der Blick des Duke of Penthurst war weniger auf sie gerichtet als vielmehr auf Mr Trilby, der hinter ihr stand. Kühle, goldene Lichter tanzten in Penthursts tief liegenden Augen, als er näher kam, und ließen ihn gefährlich wirken. Trilby erstarrte.
Penthurst musterte ihn mit unverhohlenem Zorn. »Sir, bitte lassen Sie die Dame los.«
»Tun Sie besser, was er sagt, Mr Trilby. Seine Gnaden hat bei Duellen schon Männer aus geringerem Anlass als diesem getötet. Da er ein Duke ist, steht ihm das zu.«
Trilby zog die Hand so hastig zurück, als stünde ihre Schulter in Flammen. Mit zwei langen Schritten entfernte er sich von ihr. »Ich … also … ich …«
»Penthurst, es ist mir ein Vergnügen.« Sie knickste. »Kennen Sie Mr Trilby? Wir sind uns hier draußen zufällig begegnet, und er hat mir das Geheimnis eines seiner Tricks anvertraut.«
»Ich bin ihm noch nie begegnet, obwohl ich von den Kunststückchen schon gehört habe. Ich wusste nicht, dass dazu auch das Belästigen von Frauen gehört.«
Trilby blieb der Mund offen stehen. »Beläs…? Nein, niemals, Sir. Ich … ich …«
»Wohl kaum eine Belästigung, Sir. Nur ein leichter Klaps auf die Schulter, um mir zu zeigen, dass der Trick zu Ende war.«
»Mehr als ein Klaps, wie mir scheint.«
»Ihnen mag es durchaus so erscheinen. Hätten Sie ihn nicht erschreckt, wäre es gewiss nur ein sehr kurzer Klaps gewesen.«
Penthursts Miene blieb streng.
Um der Konfrontation ihre Dramatik zu nehmen, stellte Lydia die Männer einander vor. Penthurst schien darüber nicht erfreut, Trilby hingegen konnte vor Erleichterung kaum an sich halten. Er plapperte und katzbuckelte eine halbe Minute lang und versuchte, Konversation zu machen, wobei der Duke ihm kaum behilflich war.
»Nun, ich muss … also, ich sollte wohl …« Trilby verabschiedete sich und wäre beinahe über seine eigenen Füße gestolpert.
Penthurst blickte in den Garten hinaus, das Licht der Laterne beleuchtete sein Profil. Lydia ging einen Schritt auf die Türen zu.
»Habe ich Sie bei etwas gestört, Lydia?«
Sie drehte sich zu ihm. »Nur bei einem Gespräch.«
»Als ich herausgekommen bin, wirkten Sie verärgert. Hat dieser Mann Sie bedrängt?«
»Nur mit seinem langweiligen Gerede.«
»Er hat Sie angefasst.«
»Er wollte meine Aufmerksamkeit auf sich lenken, das war alles. Ich fürchte, er ist ein ziemlicher Dummkopf.«
»Es wirkte so, als hätten Sie eingewilligt, sich hier draußen mit ihm zu treffen.« Er wandte sich zu ihr und blickte sie an. »Das ist aufgefallen.«
»Ihnen ganz offensichtlich.«
»Und anderen auch. Solche Dinge fallen immer auf.«
»Dann war es leichtsinnig von mir, in seiner Gegenwart zu erwähnen, dass ich frische Luft brauche. Obwohl ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, wer außer mir noch frische Luft braucht, nicht wahr? Wenn Sie mir gefolgt sind, um mich zu retten, dann war das unnötig. Auch wenn die Geste ritterlich war – was ich tue, geht Sie nichts an.«
»Als Freund Ihres Bruders und Ihrer Familie und als Gentleman konnte ich nicht zulassen, dass Sie einem Mann wie Trilby zum Opfer fallen. Oder dem Tratsch, den es nach sich ziehen könnte, dass er Ihnen nach draußen gefolgt ist, auch, wenn Ihr Betragen ihn dazu eingeladen hat.«
Diese Bemerkung brachte sie um den letzten Rest ihrer bereits erschütterten Gemütsruhe. Penthurst war der Grund, dass sie überhaupt etwas mit Trilby zu regeln hatte. Und was die Manieren des Dukes betraf – sie empfand aus verschiedenen, höchst einleuchtenden Gründen eine ernsthafte Abneigung gegen ihn. Einer der Gründe bestand darin, dass Penthurst sich tatsächlich mit Männern geringerer Herkunft duellierte, und dass er stets ungestraft davonkam. Ein weiterer Grund war, dass er so stolz und von oben herab mit ihr sprach, gleichzeitig aber eine allzu große Vertraulichkeit an den Tag legte.
Letzteres hatte mit ihrer sehr langen gemeinsamen Geschichte zu tun. Seit Jahren schon war er mit Southwaite befreundet, und so lange sie zurückdenken konnte, hatte der Duke zum Freundeskreis der Familie gehört. Lydia jedoch hatte er niemals akzeptiert oder gar gemocht. Wenn sie als Kind in eine Balgerei geraten war, die ihr Bruder und seine anderen Freunde für amüsant hielten, hatte Penthurst sie oftmals kritisch beäugt und sie gelegentlich, wie jetzt auch, gemaßregelt.
Ihrer Meinung nach hatte ein reifes Alter nur wenige Vorteile, und einer davon war der, dass sie den Duke of Penthurst nicht öfter ertragen musste als unbedingt nötig. Sie war nicht bereit, an einem Tag unter seiner Arroganz zu leiden, an dem ein sehr großes Problem in ihr Leben getreten war.
»Wie freundlich von Ihnen, Sir, mich an meine Schwächen zu erinnern, damit ich mich bessern kann. Ich fühle mich geehrt, dass Sie sich meinetwegen solche Mühe machen. Aber nun sollten wir in den Salon zurückkehren, sonst gibt es womöglich noch Gerüchte über uns.« Und damit marschierte sie auf die Terrassentüren zu.
Er erreichte den Eingang eher als sie und öffnete ihr eine Tür. »Warum sind Sie überhaupt hier? Ich dachte, Sie sollten heute Abend an einer Dinnerparty teilnehmen?«
»Da müssen Sie sich irren.« Flink schob sie sich an ihm vorbei und betrat den Saal.
Er schloss zu ihr auf. »Ihr Bruder erwähnte es heute Nachmittag en passant, als ich ihn aufsuchte. Ein kleines, zwangloses Dinner bei Ambury, hat er gesagt, mit Ihnen und einigen anderen. Haben Sie den Termin vergessen, oder war der Lockruf des Glücksspiels stärker als Sie, sodass Sie nicht einmal einen Abend lang widerstehen konnten?«
Sie überlegte, ob sie seine zweite Vermutung bestätigen sollte. Das würde vermutlich zu einem weiteren Tadel führen, denn schließlich tadelte jedermann sie wegen ihrer Neigung zum Glücksspiel. Jedenfalls konnte sie ihm schwerlich erklären, dass sie das Dinner abgesagt hatte, um sich mit einem Erpresser zu treffen.
Also musste ihr schlechtes Gedächtnis als Begründung herhalten.
»Oje, ich glaube, Sie könnten recht haben. Vielleicht habe ich es vergessen.« Sie blinzelte heftig und tat bestürzt. »Aus irgendeinem Grund habe ich geglaubt, das Dinner finde erst morgen statt. Wie nachlässig von mir. Gleich morgen früh muss ich an Cassandra schreiben und sie um Vergebung bitten.«
Penthurst zog seine Taschenuhr hervor. »Sie können es noch schaffen. Sie werden zu spät kommen, aber das wäre verzeihlich.«
»Ich glaube nicht …«
»Warten Sie hier. Ich hole meine Tante und rufe die Kutsche. Wir machen uns auf den Heimweg und bringen Sie zu Ambury.«
»Das ist nicht nötig …«
Doch Penthurst war schon fort und durchquerte mit großen Schritten den Saal.
Am liebsten hätte sie mit dem Fuß aufgestampft. Nun würde sie bei dem Dinner auftauchen, obwohl sie abgesagt hatte, und das würde ihren Bruder und alle anderen dazu bringen, ihr Fragen zu stellen. Sollte Penthurst sich doch um seine eigenen Angelegenheiten kümmern!
Da entdeckte sie Trilby. Ihre Blicke kreuzten sich. Er zupfte an seinem Kragen, zog eine Grimasse, dann lächelte er. Er verhielt sich, als hätten sie gemeinsam ein Komplott geschmiedet, das beinahe gescheitert wäre.
Wenigstens wirkte er nicht mehr beleidigt. Was hoffentlich bedeutete, dass er nichts Überstürztes unternehmen würde, zum Beispiel Kontakt zu ihrem Bruder aufnehmen. Pantomimisch stellte sie den Akt des Schreibens dar, wies erst auf sich selbst, dann auf Trilby, um ihm mitzuteilen, dass sie ihm alsbald eine Nachricht schicken würde. Wenn sie nach Hause kam, würde sie darüber nachdenken, was in dieser Nachricht eigentlich stehen sollte.
Da Mr Trilby nun vorerst besänftigt war, begab sie sich zur Tür, zu Penthurst und seiner Tante.
Amburys Haus lag nur fünf Blocks von Mrs Burtons Spielsalon entfernt. Penthurst kam zu dem Schluss, dass es die längsten fünf Häuserblocks waren, um die er jemals in einer Kutsche gefahren war. Dass seiner Tante Lydias Gesellschaft missfiel, war noch wohlwollend ausgedrückt. Wenn sie Gelegenheit dazu gehabt hätte, hätte sie sich geweigert, sie einsteigen zu lassen. Darum hatte Penthurst sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Nun saß seine Tante neben Lydia, mit verkniffenem Gesicht und Augen, die grausame Blitze auf ihre junge Begleiterin schleuderten.
»Es ist eine Dinnerparty, hast du gesagt, als du mich abgeholt hast. Stimmt das, Lydia? Bringen wir Sie zu einer Dinnerparty? Dafür ist es doch schon recht spät.«
Regungslos und mit ausdrucksloser Miene saß Lydia da, ihre dunklen Augen wirkten trüb vor Gleichgültigkeit. Ihr Gesicht zeigte keine Reaktion auf die fortgesetzte Befragung. Es war, als hätte sie ihre Fähigkeit zu hören eingebüßt, so teilnahmslos wirkte sie.
»Werden die Gäste dieser Dinnerparty es nicht merkwürdig finden, dass Sie zu spät kommen und noch dazu in diesem Seidenkleid? Es ist viel zu aufwändig und passt im Grunde nur auf einen Ball.«
»Gewiss werden sie es merkwürdig finden«, raffte Lydia sich zu einer Antwort auf. »Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich sofort nach Hause fahre. Penthurst, vielleicht können Sie dem Kutscher befehlen, auf der anderen Seite des Berkeley Square zu halten, sodass ich heimgehen kann, anstatt mich zu Ambury zu bringen.«
»Ich fürchte, Lady Ambury würde mir nie vergeben, wenn ich Ihnen dabei behilflich wäre, sie sitzen zu lassen«, sagte er.
»Lady Ambury?« Selbstzufriedenes Begreifen zeichnete sich im Gesicht seiner Tante ab. »Ah. Natürlich.«
Das erweckte die Sphinx zum Leben. Lydia drehte den Kopf und begegnete dem missbilligenden Blick, der ihr zugedacht war. »Natürlich was, Lady Rosalyn?«
Penthursts Tante schnaubte und hob das Kinn. »Nichts, nichts.«
»Ich bitte Sie inständig, es mir zu sagen. Mir scheint, Sie platzen beinahe vor Verlangen, das zu tun.«
Kein Seitenblick diesmal, sondern ein direktes, erstauntes Starren. Ihre tief liegenden Augen schienen unter der gerunzelten Stirn noch weiter zu verschwinden.
Er kannte diesen Gesichtsausdruck. »Tante Rosalyn …«
»Misch du dich bitte nicht ein. Das Mädchen hat verlangt, dass ich es ausspreche, also werde ich das tun.« Sie drehte sich mit dem ganzen Körper zu Lydia, um der Herausforderung direkt zu begegnen. »Ihre Freundschaft mit Amburys Frau macht Ihnen keine Ehre. Ihr Bruder hat es Ihnen einst untersagt, und die amourösen Abenteuer seines Freundes hätten ihn nicht von dieser gesunden Ansicht abbringen sollen. Da es aber so ist und Sie nunmehr wieder mit ihr befreundet sind, kleiden Sie sich natürlich in dünne Seide und besuchen allein ein Spielkasino. Lady Amburys Einfluss auf Sie hätte Ihrer Mutter unendlichen Kummer bereitet, und ich würde meine Pflicht ihrem Andenken gegenüber vernachlässigen, wenn ich das nicht erwähnte.« Die schwungvolle Geste, mit der sie ihre Rede beendete, schaffte es, nicht nur Lydias Kleid, sondern ihren ganzen Charakter mit einzuschließen.
Penthurst tastete nach seinem Taschentuch, bereit, Lady Lydia zu trösten, falls sie zu weinen anfangen würde. Seiner Tante warf er einen strengen, missbilligenden Blick zu. Sie war berüchtigt für ihre Fähigkeit, andere Frauen zum Weinen zu bringen. Und dies war weder der richtige Ort noch der passende Zeitpunkt, und Lydia war auch nicht ihre Schutzbefohlene.
Doch Lydia weinte nicht. Sie zeigte nicht einmal Ärger, außer, dass etwas in ihrem Blick aufflammte. »Sie schätzen Cassandra nicht, wie ich höre. Oder mich, was ich daraus folgere. Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn wir beide nichtssagende Leben fristen würden, anstatt weltgewandte Unabhängigkeit an den Tag zu legen. Sie haben recht. Sie hat mich beeinflusst, aber nur zum Guten. Ich wünschte, Sie hätte Ambury nicht geheiratet und sich nicht zähmen lassen, denn dann hätte ich mich ihrer Gesellschaft erfreuen können, wenn ich zum Teufel gehe.«
Der Tante blieb der Mund offen stehen.
»Sie selbstsüchtiges, eigensinniges Mädchen!«, geiferte sie und klopfte sich auf die Brust, als hätte ihr Herz einen Schlag ausgesetzt. »Ihre Mutter war meine beste Freundin, und dieses Verhalten ist ihrer Tochter nicht würdig. Na schön, dann gehen Sie eben zum Teufel! Amelia hat mir ihre Besorgnis anvertraut, doch offenbar war sie zu schüchtern, um auch ihre schlimmsten Befürchtungen zuzugeben.«
»Meine Tante Amelia kennt mich kaum. In den vergangenen zwei Jahren haben wir nur sehr wenig Zeit miteinander verbracht. Wenn mein Bruder eine Gefängniswärterin für mich braucht, so bedient er sich Tante Hortenses.«
»Hortense! Als wäre die zu irgendetwas nütze! Ihr Benehmen mag respekteinflößend sein, aber ihr fehlen Entschlossenheit und Urteilsvermögen. Sie hält sich für gewitzt, dabei würde sie nicht einmal merken, wenn ein Händler ihr zu wenig Wechselgeld herausgibt. Gewiss führen Sie sie an der Nase herum, wenn sie Sie begleitet. Haben Sie um Hortense gebeten, damit Sie unter ihren Augen verwahrlosen können?«
»Jetzt beleidigen Sie meine Tante. Sind Sie fertig, oder stehen noch mehr Leute auf Ihrer Liste?«
Penthurst blickte aus dem Fenster. Ein Häuserblock noch. Womöglich kam es gleich zu Faustschlägen. »Meine Damen, ich glaube, es wäre besser, dieses Gespräch zu beenden, bevor Sie beide Riechsalz brauchen.«
Nun richtete sich der Zorn seiner Tante auf ihn. Er begegnete ihm mit festem Blick, und was auch immer sie hatte sagen wollen, sie schluckte es hinunter.
Lydia tat das nicht. »Ich finde, es war sehr unfreundlich von Ihnen, meine Mutter in diese Sache hineinzuziehen, ganz zu schweigen davon, sie als Vorwand zu benutzen, um mir Vorhaltungen machen zu können. Zu Ihren Pflichten meiner Mutter gegenüber gehört es wohl kaum, mich zu beleidigen.«
Seine Tante erhob sich ein kleines Stück von ihrem Sitz. »Ach nein? Sie unglaublich dreistes Mädchen! Ihre Mutter und ich waren einer Meinung, wenn es um Sie ging, und auch sonst waren wir uns immer einig. Es bekümmert mich noch heute, dass ich tatsächlich erleichtert war, als die Sturheit meines Neffen mich von meiner Pflicht entbunden hat. Wenn Sie nun zum Teufel gehen, werden Sie wenigstens nicht meine Familie mit sich in den Abgrund reißen.«
Mit einem abschließenden empörten Schnauben blickte die Tante wieder geradeaus und blendete Lydias Existenz aus. Lydia neigte den Kopf und sah Penthurst fragend an.
Er begriff, dass ihr niemand von jenem alten Abkommen zwischen ihrer Mutter und seiner Tante erzählt hatte. Er hatte sich noch nie gefragt, ob sie davon wusste oder nicht, doch es ergab durchaus Sinn, dass man sie im Ungewissen gelassen hatte. Sie war fünf Jahre alt gewesen, als er von der Vereinbarung Abstand genommen hatte.
Endlich hielt die Kutsche an. Überaus froh, etwas frische Luft zu bekommen, stieg er aus und reichte Lydia die Hand. Im Innern des Gefährts saß seine Tante wie eine gebieterische Statue aus Stein und starrte geradeaus.
Lydia blickte über den Platz auf das Haus ihres Bruders. »Es wäre weniger blamabel, wenn ich jetzt einfach nach Hause ginge.«
»Gewiss hat niemand etwas gegen Ihr Kommen.«
Ihre Ankunft machte den Diener, der ihr die Haustür öffnete, nervös. Über die Schulter blickte er zum Speiseraum, aus dem Stimmen drangen, und er wirkte verwirrt. Er entschuldigte sich und verschwand im Innern des Hauses.
»Ich habe doch gesagt, dass ich besser nach Hause hätte fahren sollen«, sagte Lydia zu Penthurst. »Wenn ich so spät noch herkomme, sorge ich womöglich für eine Szene.«
Der Diener kam mit Lady Ambury wieder. Dunkelhaarig, blauäugig und sinnlicher, als es gut für sie war, begrüßte die vormalige Cassandra Vernham erfreut ihre Freundin. »Ich habe darauf bestanden, dich hier in Empfang zu nehmen, damit du weißt, dass du noch immer willkommen bist.« Sie gab Lydia einen Kuss, dann richtete sie den Blick ihrer blauen Augen auf Penthurst. »Wie ich sehe, hattest du vorher schon ein Rendezvous, Lydia. Wie freundlich von dem Duke, dich mit uns zu teilen und dich hier abzuliefern, bevor der erste Gang beendet ist.«
»Kein Rendezvous«, sagte Lydia und errötete leicht. »Ich … also, er …«
»Du musst es mir nicht erklären, Liebes. Jedenfalls nicht, bevor das Dinner vorbei ist. Möchten Sie sich uns anschließen, Penthurst? Dann ist die Besetzung bei Tisch wieder ausgeglichen.«
»Leider wartet eine andere Dame auf mich.« Er verabschiedete sich von ihnen, begab sich wieder zu besagter Dame und stählte sich für die Fahrt zurück zum Grosvenor Square.
Auf halbem Weg dorthin drang Lady Amburys letzte Bemerkung durch den endlosen Strom entrüsteter Worte, den seine Tante ausspie, in sein Bewusstsein. Dann ist die Besetzung bei Tisch wieder ausgeglichen. Das hieß, dass Lydias Ankunft die Tischgesellschaft zahlenmäßig aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, was bedeutete, dass sie letzten Endes nicht erwartet worden war. Sie hatte den Termin nicht vergessen. Sie hatte abgesagt, um zu Mrs Burton fahren zu können.
Um zu spielen? Oder zu einer Verabredung mit Algernon Trilby? Nicht Letzteres, wie er hoffte. Wenn sie zum Teufel gehen wollte, konnte sie einen besseren Teufel finden als diesen.
3
»Warum gehen wir so schnell?« Sarah musste sich beeilen, um mit Lydias zielstrebigen Schritten mitzuhalten.
»Als Leibesübung. Ein bisschen in Wallung zu kommen ist gesund, Sarah. Für gewöhnlich sind wir viel zu träge.«
Außerdem lief Lydia Gefahr, zu spät zu ihrer Verabredung mit Mr Trilby zu erscheinen. Nach gründlicher Überlegung war sie zu dem Schluss gekommen, dass es unklug wäre, irgendwelche schriftlichen Bemerkungen zu ihrem Roman zu machen, und darum hatte sie ihn gebeten, sich an diesem Morgen mit ihr im Park zu einem Gespräch zu treffen.
»Wenn Sie nur ein wenig in Hitze geraten wollten, hätten wir auch dreimal um den Platz laufen können«, maulte Sarah. »Sie haben davon gesprochen, die frische Morgenluft zu genießen, und nicht von einem Wettrennen am Ufer des Serpentines entlang.«
»Da sorge ich dafür, dass du an die frische Luft kommst und einen schönen Tag genießen kannst, und dir fällt nichts Besseres ein, als dich zu beklagen. Beim nächsten Mal werde ich dich zu Hause lassen.«
»Damit Ihre Tante Hortense mich ausschimpfen kann? Nein, danke, Milady. Eine halbe Stunde lang hat sie mir die Hölle heißgemacht, als sie vor zwei Tagen erfuhr, dass Sie allein zum Buchladen gegangen waren.«
Dass Sarah die Hölle erwähnte, erinnerte Lydia an ihren Streit mit Penthursts Tante in der Kutsche zwei Abende zuvor. Ganz sicher stand ihr deswegen noch ein Tadel bevor. Die Schelte würde sie erreichen, nachdem sie durch die ganze Familie gegangen war, bis jemand ausgewählt wurde, der ihr ins Gewissen reden sollte.
Wer würde das sein? Nicht ihr Bruder. Ihn musste sie schon sehr provozieren, damit er sie wegen ihres Betragens zur Rede stellte. Tante Hortense? Ihre Lektionen hatten in der Vergangenheit nur wenig ausrichten können, also würde die Wahl vermutlich auf jemand anderen fallen. Emma? Die Frau ihres Bruders würde sie nicht tadeln.
Wenigstens hatte Emma – im Gegensatz zu allen anderen – verstanden, dass sie kein Kind mehr war. Doch Emmas für gewöhnlich sehr unverblümte Worte würden sich womöglich als noch unangenehmer erweisen als ein Tadel. Letzterem musste sie keine Beachtung schenken, aber vermutlich würde es ihr schwerfallen, Emmas direktem Blick und ihren Fragen auszuweichen.
Natürlich würde niemand Penthursts Tante die Schuld geben. Sie war ein Bollwerk der feinen Gesellschaft, und jeder schloss sich ihrem Urteil an. Kein Mensch würde glauben, dass sie Lydia wegen ihres Charakters angegriffen hatte, wegen ihrer Erziehung, ihres Verhaltens und ihrer Tugend, und das alles in nur sechs oder sieben Sätzen. Und wer es glaubte, würde vermutlich annehmen, dass sie es verdient hatte.
Lydia schritt aus und fühlte sich gekränkt. Ihre Situation in der Familie erinnerte sie an die zusätzlichen Probleme, die Mr Trilby ihr bereitete. Stets unterstellten die Leute ihr das Allerschlimmste, obwohl sie niemals auch nur Gelegenheit gehabt hatte, sich schlecht zu benehmen! Irgendwie war sie zu Southwaites Problemschwester geworden, nur weil sie es vermied zu heiraten und etwas … anderes wollte. Irgendetwas, was weniger vorhersagbar war. Einen Hauch Abenteuer dann und wann. Einen Grund, sich aufzuregen. War sie verrucht, weil sie sich ein paar Erfahrungen jenseits der gewöhnlichen wünschte, die Frauen ihres Standes zugebilligt wurden?
Sie blickte sich suchend um, während sie mit Sarah tiefer in den Park hineinging. Eine Bürgermiliz übte, wie fast an jedem Tag. Einige Gentlemen ritten in der Ferne auf ihren Pferden vorbei, nutzten die frühe Stunde und das Fehlen von Besuchern, um die Tiere zu hartem Galopp anzutreiben.
Weiter vorn, hinter der Miliz, erblickte sie Mr Trilby, der auf und ab ging, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Es hatte nicht den Anschein, dass er genug Gespür haben würde, ihr entgegenzugehen, sodass sie sich wie zufällig begegnen konnten.
Als sie Sarah um die Bürgerwehr herumführte, bemerkte einer der Soldaten die Zofe und schenkte ihr ein gewinnendes Lächeln. Sarah gab vor, es nicht zu sehen, doch sie errötete.
Lydia ging noch dreißig Meter weiter, sodass sie beachtlichen Abstand von der Miliz hatten. »Warum verschnaufen wir hier nicht ein wenig? Wir können den Soldaten beim Drill zusehen. Hast du etwas dagegen, Sarah?«
Sarah zuckte mit den Schultern, doch sie beobachtete die Übungen genau. Vor allem die Bewegungen eines gewissen hochgewachsenen jungen Mannes mit sandfarbenem Haar und freundlichen blauen Augen. Immer, wenn er sich umdrehte und sie ansah, bedachte er Sarah mit einem Lächeln. Sarahs Wangenröte vertiefte sich.
Trilby verstand den Wink und ging in ihre Richtung. Bevor er zu nahe herangekommen war, hob Lydia die Hand und entfernte sich ein wenig von Sarah. Neben Mr Trilby blieb sie stehen und beobachtete weiterhin die Miliz.
»Haben Sie das Geld dabei?«, fragte er.
»Halten Sie mich für eine dumme Gans? Wie soll ich es denn herbringen? In meinem Ridikül?« Sie hob den kleinen Beutel hoch.
»Ich dachte, ein Bankwechsel …«
»Das kann ich nicht, nicht einmal auf meine Mitgift, ohne dass mein Bruder davon erfährt. Sie haben eindeutig nie das Leben einer Frau gelebt, Mr Trilby, und wissen gar nichts über unsere Beschränkungen.«
»Das will ich doch hoffen.«
»Das sollten Sie auch. Ich habe nicht um ein Treffen gebeten, um Ihnen zehntausend Pfund zu überreichen, das müsste sich doch von selbst verstehen. Andernfalls hätte ich doch gewiss verlangt, dass Sie das Manuskript mitbringen, nicht wahr? Ich wollte Sie sehen, um weiter mit Ihnen über diese Sache zu reden.«
Trilby hob die Hände und entfernte sich eilig ein paar Schritte. Aufgebracht drehte er gleich darauf wieder um und kam zurück. »Es gibt nichts zu bereden. Das Tagebuch hat mich …«
»Der Roman. Es ist kein Tagebuch.«
»Der Roman hat mich zehntausend gekostet. So viel muss mindestens dabei herausspringen. Innerhalb einer Woche, Lady Lydia. Meine finanzielle Lage ist sehr angespannt aufgrund dieses Kaufs, den ich um Ihretwillen getätigt habe, und länger kann ich nicht warten.«
Ihre Gedanken überschlugen sich, als sie auszurechnen versuchte, wie viel Geld sie innerhalb einer Woche würde auftreiben können. Keine zehntausend, so viel war sicher. Auch nicht, wenn sie all ihren Schmuck und jedes Seidenkleid versetzte.
»Innerhalb einer Woche ist es mir unmöglich.«
»Dann machen Sie es möglich. Tischen Sie Ihrem Bruder irgendeine Geschichte auf, die er schlucken kann. Leihen Sie sich etwas von Freunden. Sie führen ein privilegiertes Leben, und es sollte ein Leichtes für Sie sein, einen solchen Betrag aufzubringen, wenn Sie ein wenig darüber nachdenken.«
Mr Trilby legte mehr Selbstvertrauen und Rückgrat an den Tag als zuvor auf Mrs Burtons Terrasse. Sie wünschte, Penthurst hätte sich dort nicht eingemischt. Vielleicht hätte sie einen niedrigeren Preis aushandeln können oder mehr Zeit, wenn der Mann nicht zwei Tage gehabt hätte, in denen er wieder Mut fassen und zu seiner Linie zurückkehren konnte.
Mit dem Kinn deutete er auf die Bürgerwehr. »Die da wären bestimmt nicht erfreut zu hören, dass Sie die Flotte beobachten, egal, wer Ihr Bruder ist. Noch weniger würden ihnen die Beschreibungen von ihresgleichen an der Küste gefallen. Oh ja, das habe ich auch gelesen, während ich auf eine Nachricht von Ihnen gewartet habe. Kann sein, dass Sie nach Frankreich fliehen müssen, ob Sie nun spioniert haben oder nicht, wenn diese Seiten allgemein bekannt werden.«
Dieser Mann brauchte ihr die Stimmung draußen im Land nicht zu erklären und auch nicht die Fehldeutungen, die daraus entstehen konnten. Beim Dinner in Cassandras Haus hatten die Männer lange über den Krieg geredet, wie alle anderen auch. Soweit sie wusste, hatte ihr Bruder mit einem inoffiziellen Wachsystem an der Ostküste zu tun, das in der Hoffnung aufgebaut worden war, das Eindringen von Agenten verhindern zu können.
Selbst wenn sie die schlimmste von Trilbys Drohungen überlebte, würde es genug Getuschel geben, um alle gegen sie aufzubringen – ihren Bruder, ihre Tanten, Emma. Und zwar, bevor irgendjemand die anderen Kapitel gelesen hätte, diejenigen, die man als schockierend anschauliche Darstellungen der Liebeskunst betrachten würde. Was hatte sie sich nur dabei gedacht?
Dass niemand sie jemals lesen würde, natürlich. Und doch hatte Mr Trilby es getan. Nur er?
»Das Manuskript ist gestohlen worden. Wenn nicht von Ihnen, wie ist es dann in Ihre Hände gelangt?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Ich möchte wissen, wie viele Leute es gesehen haben. Wenn Sie nicht der Dieb sind, dann haben Sie es von einem anderen bekommen. Durch wie viele Hände ist es gegangen, bevor es in Ihren gelandet ist?«
»Sie sollten lieber darüber nachdenken, wie es jetzt wieder in Ihre Hände kommen soll, will ich meinen.«
»Wenn schon halb London die Seiten durchgeblättert hat, warum soll ich dann dafür zahlen, dass es geheim bleibt? Versetzen Sie sich in meine Lage, dann verstehen Sie, warum ich das wissen muss.«
»Nur wenige Leute haben es gesehen. Sie müssen sich wegen der Verschwiegenheit derer, die es vor mir hatten, keine Sorgen machen. Das verspreche ich Ihnen.«
Das Versprechen eines Erpressers war nicht dazu angetan, sie zu beruhigen, doch sie hoffte, dass er die Wahrheit sagte. Sie wünschte es sich. Doch ob es die Wahrheit war oder eine Lüge, ihr Dilemma blieb dasselbe.
»Eine Woche, Lady Lydia. Vor Ablauf der sieben Tage verlange ich einen Brief von Ihnen, in dem Sie mir mitteilen, wo Sie mir die Entschädigung überreichen werden. Mindestens so lange bleibe ich im Haus meiner Cousine.« Und damit ging er fort.
Lydia schlenderte zurück zu Sarah, die den jungen Mann nicht aus den Augen gelassen hatte. »Hast du dich wieder beruhigt, oder hat er dir jetzt komplett den Atem verschlagen, Sarah?«
»Er ist ein gut aussehender Bursche, nicht wahr? Groß und stark und ziemlich hübsch.«
»Er hat ein sehr schönes Lächeln. Wie heißt er?«
»Woher soll ich das wissen?«
Lydia lachte. »Soll das heißen, dass du die letzte Viertelstunde damit verbracht hast, mit einem völlig Fremden zu flirten? Sarah, also wirklich! Ich bin schockiert.«
»Ich wollte das nicht. Irgendwie habe ich vergessen, wo ich bin.«
»Tante Hortense wird entsetzt sein«, neckte Lydia sie. »Sie wird darauf bestehen, dass wir dich für wenigstens drei Tage auf Wasser und Brot setzen.«
Sarah blies die Wangen auf und verdrehte die Augen. »Nur, wenn sie es erfährt. Ich glaube kaum, dass Sie es ihr erzählen werden. Und wenn ich wegen meines Benehmens befragt werde, ertappe ich mich womöglich dabei, auszuplaudern, wie Sie diese Viertelstunde verbracht haben, in der ich mich so fahrlässig habe ablenken lassen.«
Noch ein Erpressungsversuch. Jedoch war es verzeihlich, dass Sarah diesen Trumpf ausspielte. Zu viele Leute stellten Anforderungen an sie, von denen die meisten, wenn sie sie erfüllen würde, zu einem Verrat an Lydias Vertrauen und ihrer Privatsphäre führen würden. Sie beneidete Sarah nicht um die Art und Weise, wie sie mit den Ansprüchen so vieler Herrinnen jonglieren musste.
Sie hakte Sarah unter, und so liefen sie gemeinsam, wie sie es als junge Mädchen oft getan hatten. »Wahrscheinlich wollen Sie von jetzt an, dass wir jeden Morgen durch den Park laufen.«
»Ich glaube nicht, dass hier an jedem Morgen dieselbe Truppe versammelt ist. Ich schätze, sie wechseln sich ab.« Sie warf einen letzten Blick über die Schulter. »Gewiss gibt es irgendwo eine Liste, welche Miliz an welchem Tag den Park nutzt. Die Art von Aufstellung, die nur jemand wie ein Earl zu sehen bekommt.«
»Ich werde meinen Bruder darauf ansetzen, aber ich werde ihm erklären müssen, warum. Andernfalls kommt er vielleicht zu dem Schluss, dass es mir heute Morgen den Atem verschlagen hat und nicht dir.«
»Was jedoch nicht auf Sie zutrifft, da Sie es schon erwähnen. Wenn überhaupt, wirken Sie eher verärgert. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich das sage, aber wenn ich meinen strammen Soldaten mit ihrem blassen, dünnen Gentleman vergleiche, hatte ich wohl den besseren Morgenspaziergang.«
Viscount Ambury hielt sein Pferd neben dem von Penthurst im Zaum, als sie auf der Rückseite des Parks eine kleine Anhöhe hinaufritten. Die Tiere schwitzten nach dem schnellen Galopp und tänzelten vor Aufregung.