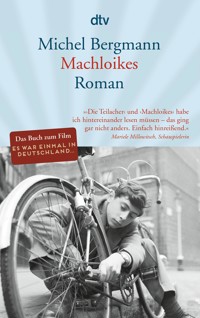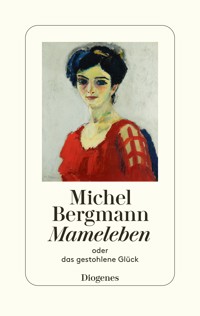9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dramatisch, bitter und voll liebenswertem Humor.« Senta Berger 1946 hatten sie noch in ausrangierten Güterwaggons gehaust, in Kellern und halben Ruinen. Die Treppen baufällig, die Nachbarn grimmig, das politische Klima frostig. Bermann, Fajnbrot, Verständig, Krautberg und die anderen waren zurückgekehrt, oft als einzige Überlebende ihrer Familie. Bei jedem Wetter, mit Horch, VW oder Tempo Dreirad waren sie Tag für Tag unterwegs, verkauften Weißwäsche in Aussteuerpaketen und fanden das Unerwartete: die Kraft, wieder an Liebe, Nestbau und Zukunft zu glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1946, Frankfurt am Main. Sie hausen in ausrangierten Güterwaggons, in Kellern, halben Ruinen, ehemaligen Krankenhäusern. Die Treppen baufällig, die Nachbarn grimmig. Das politische Klima ist frostig, der Blick in die Zukunft schemenhaft. David Bermann, Jossel Fajnbrot, Emil Verständig, Moische Krautberg, Max Holzmann und die anderen sind zurückgekehrt. Fast alle sind sie aus den Lagern gekommen, oft als einzige überlebende ihrer Familie. Bei jedem Wetter, mit Horch, VW oder Tempo Dreirad waren sie Tag für Tag unterwegs, verkauften Weißwäsche in Aussteuerpaketen und fanden das Unerwartete: die Kraft, wieder an Liebe, Nestbau und Zukunft zu glauben.
1972, Frankfurt am Main. Gebannt lauscht der junge Alfred Kleefeld den Geschichten der alten Männer nach dem Begräbnis seines Onkels David Bermann. Am Ende erfährt Alfred von einer wunderbaren Liebesgeschichte in dunklen Zeiten und von einem Geheimnis, das sein Leben für immer verändern wird. Michel Bergmann erzählt in diesem berührenden, humorvollen Roman, was sie, die Teilacher, aus ihrem Leben gemacht haben und wie sie sich mit viel Chuzpe durch die schwierigen, wilden Nachkriegsjahre kämpften.
Michel Bergmann ist bei dtv außerdem lieferbar:
Machloikes
Herr Klee und Herr Feld
Alles was war
Weinhebers Koffer
Michel Bergmann
Die Teilacher
Roman
Für meinen Sohn Emanuel, dem ich zeigen wollte, woher ich komme, und für meine Frau Anke, die mir zeigte, wohin ich will.
Im Gedenken an David B.,
den Einstein unter den Teilachern
Man muss nicht meschugge sein, um Teilacher zu werden, aber es kann nicht schaden!
1.
Tja, ich muss dann mal wieder.
Schwester Elisabeth warf Alfred einen aufmunternden Blick zu. Er schaute ihr hinterher, wie sie in ihren weißen Gummilatschen auf den Flur schlappte. Dann war die Tür zu. An der Innenseite hing ein rot-blau gestreifter Frotteebademantel.
Onkel Davids Bademantel.
Alfred blickte sich um. In einer Ecke waren leere Kartons unterschiedlicher Größe gestapelt. Persil, Milupa, Grundig und Neckermann stand auf den Pappschachteln, die darauf warteten, gefüllt zu werden. Die Heimleitung wollte jeden Stau vermeiden. Ab Montag war das Zimmer wieder vermietet. Dann zog der nächste alte Mensch ein.
Um auf das Ende zu warten.
Es ist nicht fair, dass Dinge Menschen überleben, dachte Alfred. Alle Gegenstände sollten mit ihren Besitzern sterben. Das wäre gerecht. Der Tod eines jeden Menschen beschämt mich. Diesen Satz hatte Alfred vor Jahren irgendwo gelesen. Heute war er wie für ihn geschrieben.
Eine Viertelstunde war vergangen, und er hatte noch immer nicht mit seiner Arbeit begonnen. Der junge Mann lief im Zimmer umher, sah auf die verwaisten Bilder, Möbel, Bücher, Medikamente und Toilettenartikel und war fast ängstlich, sie zu berühren.
Das Schachbrett, der Fernseher, das alte Radio mit Plattenspieler, daneben die Schallplatten, die schon Jahre nicht mehr gehört worden waren. Während er sie beiläufig durchsah, überlegte er, welche Erinnerungen David wohl mit ihnen verbunden hatte. Romantische Rendezvous, ausgelassene Partys, intime Momente des Glücks, traurige Erinnerungen an tote Freunde, an Reisen, interessante Bücher auf südlichen Terrassen. Die Platten bildeten gleichsam die Tonspur eines Lebens.
Elvis Presley, Comedian Harmonists, Leonard Bernstein, Benny Goodman, Joseph Schmidt, Paul Anka, Mozart, The Platters, Charles Aznavour, Folk Blues Festival, Beethoven, Frank Sinatra, Gershwin, Beatles, Louis Armstrong, Edith Piaf, Pat Boone, Maria Callas, Bert Kämpfert, Caterina Valente, Glenn Miller, Yves Montand, Harry Belafonte, Dean Martin, Ray Charles. Dazwischen steckten französische Schellackplatten. Er blies den Staub weg, holte eine aus der verschlissenen Hülle, klappte den hölzernen Deckel des Plattenspielers nach oben und drückte auf die Einschalttaste. Das magische Auge leuchtete auf, daneben die Radioskala mit Hilversum, Radio Luxemburg und Beromünster. Alfred stellte den Plattenspieler auf 78, legte die schwere Platte auf den Teller und setzte behutsam die Nadel auf.
Er hörte einen jiddischen Schlager, den man unter Knistern und Rauschen kaum verstand:
Ich hab gekennt a jidl, gewejn so reich wie a lord –
Er hat gekäuft a monat zirik a grojßen najen Ford –
A schejner wugen, 8 zylinder, gemult in schwarz und rojt –
Gehabt an accident, gebrochen kopp, geblieben tojt!
Drum dank ich dir Gott, dass ich hab ihm nich,
Drum dank ich dir Gott, dass ich hab ihm nich,
Zu sein beim heiligen Petro?
Da fuhr ich lieber Metro!
Jototot, dank dir Gott, dass ich hab ihm nich... nich...
nich... nich1
Alfred stand nachdenklich und merkte im ersten Augenblick gar nicht, dass die Nadel hing. Er griff nach dem Plattenarm. Ein hässliches Kratzen war zu hören. Er nahm die Platte, steckte sie in die Hülle zurück. Er schloss den Plattenspieler, kniete sich auf den Boden, zog den braunen Bakelitstecker vorsichtig aus der Steckdose, denn er wollte vermeiden, an das blanke Kabel zu greifen, das herausschaute. Er nahm den Plattenspieler hoch, um ihn zu den Kartons zu tragen. Um endlich damit zu beginnen, alles an einem Platz zu sammeln. Aber er fand keinen. So stellte er den Plattenspieler wieder dahin zurück, wo er seit Jahren unverrückt gestanden hatte.
Alfred war nicht imstande, mit seiner Arbeit zu beginnen. Tausend Gedanken kreisten in seinem Kopf. Vor ein paar Tagen noch hatte David hier in diesem Zimmer gelebt. Der kalte Rauch der letzten Zigarette war noch zu riechen. Wie war es ihm ergangen in den letzten Jahren? Beschissen. War er einsam? Sicher. Fühlte er sich verlassen? Na klar. Was war in ihm vorgegangen, wenn es nicht die schleichende Krankheit war, die seine Gedanken bestimmte? Na, was schon!
Mit siebzig, vor fünf Jahren also, hatte er seine schöne Wohnung in der Fressgasse aufgeben müssen und war hierher gezogen, ins Jüdische Altersheim, an den Arsch der Welt, wie er sagte. Es war aus mit seinen täglichen Besuchen im Wiener, wo er seinen Café au lait und ein Croissant zu sich nahm. Kein Unterleitner mehr, wo er mit den anderen Teilachern lästern konnte. Vorbei seine unschuldigen Flirts mit der drallen Kleinen im Feinkostgeschäft. Keine überflüssigen Diskussionen mehr mit dem alten Dummbabbler vom Zeitungskiosk. David Bermann, der Luftmensch, der optimistische Pessimist, war ein Sozialfall geworden, krank und auf andere angewiesen. Seine kleine Rente als Verfolgter des Naziregimes reichte vorne und hinten nicht.
Und geklebt hat er auch nie.
Ein Teilacher soll kleben?
Alfred hatte ein schlechtes Gewissen. Nicht deshalb, weil er sich wie ein Eindringling in Davids Welt vorkam, sondern wegen der kleinen Lügen in der Vergangenheit, die jetzt schmerzhaft in seinem Herzen brannten.
Ausreden, erfundene Termine, um David nicht besuchen zu müssen. Gewiss, er liebte David, aber ihn zu besuchen passte nur selten in seine Pläne. Es gab immer Wichtigeres in seinem jungen, nervösen Leben. Mädels abschleppen aus der Hütten-Bar zum Beispiel. Und dann am Telefon stets das taktvolle Verständnis des alten Mannes für die vorgeschobenen Nöte eines jungen Mannes.
Das erleichterte das Gewissen.
Mehr als einmal hatte ihn David davon überzeugt, dass er gar nicht unglücklich sei, wenn Alfred nicht auftauchen würde, er habe selber so viele Termine und Verabredungen. Alfred wusste genau, dass auch das Lügen waren. Fromme allerdings. Sie kamen aus Güte zustande. Oder war es so, dass David sich weniger wert wurde mit den Jahren, dass er seine Interessen zurückstellte, resignierte vor der Zeit, die allein der Jugend gehörte, die Zeit, die davoneilte und die Alten hilflos zurückließ? Ich muss mich zusammenreißen, dachte Alfred, sonst werde ich hier nie fertig.
Aber schon war er zum Fenster gegangen, hatte die graue, verrauchte Gardine zur Seite geschoben und hinausgeblickt in den kleinen Park. Es regnete. Vor drei Wochen hatte hier noch Schnee gelegen. Vor drei Wochen, als er Onkel David zum letzten Mal sah.
2.
Alfred glaubte nicht mehr an den Winter, seit er im Süden lebte. Jetzt, nachdem er aus der Straßenbahn gestiegen war, musste er feststellen, dass er nicht angemessen gekleidet war. Ein zu dünner Regenmantel, weder Schal noch Mütze. Alfred fühlte sich elend. Er hatte Angst vor diesem Besuch, denn er wusste nicht, was ihn erwarten würde. Es war der 20. Dezember 1971, Davids fünfundsiebzigster Geburtstag. Alle wussten, dass David Bermann todkrank war, aber keiner sprach darüber. Zu seiner Parkinson’schen Krankheit war Lungenkrebs gekommen. Das machte den Besuch nicht gerade leichter.
Wenn ihn seine Mutter am Telefon nicht so eindringlich beschworen hätte – tu’s für mich! –, wäre er vor der Toreinfahrt umgekehrt. Aber so war er mit seinen über dreißig Jahren noch immer ein guter Junge, der folgsam den Wünschen seiner Mutter nachkam. Ein Wort von ihr genügte, um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie hatte auch bestimmt, er solle sich warm anziehen.
Wenigstens einen Schal! Da oben ist es kalt. Alles muss ich dir sagen.
Der Verzicht auf den Schal war seine persönliche Rache an der Mutter. Wie dumm. Gerade sein extravaganter langer Schal hätte ihn nicht nur gewärmt, sondern auch als Künstler ausgewiesen.
Rothschild-Heim der Israelitischen Kultusgemeinde Frankfurt am Main stand auf dem Messingschild neben der Einfahrt.
Alfred atmete tief durch, betrat das Kopfsteinpflaster, durchschritt den Torbogen, in dem seine Schritte verhallten, und machte sich auf den Weg über die verschneite Wiese, obwohl auf den Wegen Salz gestreut worden war. Er versuchte, nur auf jungfräulichen Schnee zu treten, um Spuren zu hinterlassen, die sich nicht mit denen anderer vermischen sollten. Und das in italienischen Halbschuhen. Kindisch!
Das zweistöckige Haus hatte Mauern aus grauem Rauputz und ein Walmdach aus Schiefer. Hier war vor dem Krieg mal das Jüdische Krankenhaus gewesen. Alfred sah hinauf zum eisgrauen Himmel. Es würde bald wieder schneien, dachte er. Dann ging er zum Eingang, ein kurzer Wink zum Pförtner hinter der Scheibe, ein routiniertes Nicken, der Ton des Türsummers. Es öffnete sich die breite Tür aus hässlichem, bräunlichem Riffelglas. Am Türrahmen hing eine Mesusa. Sie war weit unten befestigt, für die Rollstuhlfahrer, und von enormer Größe, für die Sehbehinderten. Alfred betrat die kleine Halle. Der Geruch des Altersheims schlug ihm entgegen: eine Mixtur aus abgestandener Suppe, Mottenkugeln, Bohnerwachs und Desinfektionsmitteln. Ein trister Gummibaum stand in der Ecke, daneben ein Schwarzes Brett, wo die Hausordnung, Neuigkeiten und aktuelle Hinweise für die Feiertage zu finden waren.
Eine blau-weiße Spendenbüchse vom Keren Kayemeth befand sich auf einer kleinen Anrichte darunter. Sie war mit einer Schnur befestigt, man konnte ja nie wissen.
Unbeholfen stand Alfred für einen Moment im Flur, grüßte scheu eine alte Frau, die an ihm vorbeischlurfen wollte, plötzlich stehen blieb und zu ihm hochsah.
Ihr seid der dokter Bienstock, sagte sie mit jiddischem Tonfall.
Nein, antwortete Alfred, tut mir leid.
Asoj, ich hab gedenkt, ihr seid der naje dokter, der wus jetzt macht dienst fir dem dokter Herschkowitz.
Alfred schüttelte freundlich den Kopf.
Die Frau raffte den Kragen ihres geblümten Morgenmantels zusammen und ging mit einem rätselhaften Lächeln davon.
Alfred hatte die Nummer auf ihrem linken Unterarm bemerkt.
Er sah ihr hinterher. Sie war bestimmt ziemlich hübsch gewesen, als sie jung war. Und jetzt schlich sie hier über den Flur wie ein Geist und wartete auf den Tod. Wie mochte das sein, wenn jeder Tag der letzte sein konnte? Ein abwegiger Gedanke, sagte er sich dann. Diese Frau hatte das alles bereits durchlebt. Als er sich noch einmal nach ihr umdrehte, war sie verschwunden.
Zuerst hörte er das Geräusch der Gummilatschen auf den grünlichen Linoleumfliesen. Dann kam die kleine, untersetzte Schwester Elisabeth um die Ecke und begrüßte ihn. Sie war immer gut gelaunt. Sie tat nicht nur so. Sie freute sich, Alfred wiederzusehen, und legte ihm die Hand auf den Arm. Es war für das Personal und vor allem für die Insassen eines Altersheims jedes Mal eine Offenbarung, wenn junge Menschen das Gebäude betraten. Sie waren Boten aus einer fernen Welt.
Schwester Elisabeth war stolz auf diesen Besucher. In ihren Augen war Alfred ein Filmstar. Sie wusste alles über ihn, denn David hatte ihr oft von diesem Genie erzählt. Am Frankfurter Schauspielhaus hatte Alfreds Karriere begonnen. Inzwischen lebte er in Rom. Dass er als Vampir oder Western-Bösewicht in B-Filmen auftrat, die fließbandmäßig in Cinecittà hergestellt wurden, war nicht von Belang. Seinen überschaubaren Erfolg verdankte Alfred nicht nur seinem Können, seinem eindrucksvollen Raubvogelgesicht, seiner markanten Stimme und seiner langen, dünnen Statur. Onkel David hatte damals seine Verbindungen spielen lassen und dabei Tucholsky zitiert: Wenn man Leute kennt, braucht man keine Beziehungen.
Schwester Elisabeth erstattete Bericht, während sie neben Alfred über den Flur zu Davids Zimmer lief und Mühe hatte, seinen langen Schritten zu folgen. Nein, es gehe ihm leider nicht gut, aber David Bermann sei ein Stehaufmännchen.
Es ist verrückt. Heute liegt er hilflos und zitternd im Bett, morgen ist er bereits um acht Uhr früh geschniegelt und gestriegelt. Und bereit, in die Stadt zu fahren, in sein geliebtes Caféhaus.
Typisch Onkel David!
Kürzlich rief er abends an. Wir sollten nicht auf ihn warten. Er wäre mit dem Wagen unterwegs. Wo sind Sie?, habe ich gefragt. In München! Na, stellen Sie sich das vor. Was hätte da passieren können? Er – allein – mit der Klapperkiste nach München!
Unglaublich.
Leise klopfte Schwester Elisabeth an die Tür. Herr Bermann?
Von innen hörte man ein kräftiges »Wir kaufen nichts!«.
Die Schwester sah Alfred mit einem Na-was-habe-ich-gesagt-Blick an und öffnete die Tür.
Sie haben Besuch... Der Herr Kleefeld ist gekommen.
David saß in seinem Sessel, trug einen viel zu weiten Glencheckanzug mit Weste, darunter eine dezente Krawatte über einem weißen Nyltest-Hemd, aus dessen Kragen sein dünner Vogelhals ragte. Er war rasiert und roch wie immer nach »Pétrole Hahn«, seinem französischen Haarwasser. Das silbrige Haar war akkurat nach hinten gekämmt. Er drückte seine Kippe im Aschenbecher aus, erhob sich mühsam und humpelte mithilfe eines Stocks in die Mitte des Zimmers, wo ihn Alfred umarmte.
Onkel David! Bleib doch sitzen. Happy birthday!
Bubele! Schön, dass du da bist.
Ehe ich’s vergesse – viele Grüße von Mama, sagte Alfred und übergab ihm einen Briefumschlag, den David rasch einsteckte. Alfred wusste, dass dem alten Mann Geldgeschenke peinlich waren.
Danke, brummte er verlegen.
Er hielt Alfred am Oberarm fest und sah zu ihm auf.
So bist du gekommen? Du wirst dich verkühlen. Hast du keinen Schal?
Mir ist nicht kalt, wirklich nicht.
Ja, du bist jung. Wer jung ist, friert nicht.
David zeigte zu einem Sessel am Fenster, der neben einem kleinen Tisch stand, darauf ein Schachbrett.
Setz dich, willst du was essen? Ich lass dir was kommen, ein Sandwich. Mit Pökelfleisch. Spielt a roll.
Danke, aber ich habe am Bahnhof gefrühstückt.
Du Glücklicher. Hier weckt man uns um sechs, um zu sagen, dass wir bis sieben schlafen können, und dann bringen sie um acht das Frühstück, was heißt Frühstück, a dreck! Die haben doch keine Kultur. Muckefuck. Um einen vernünftigen Kaffee zu kriegen, muss man schon drohen mit dem Anwalt!
David zitterte, aber er sprach, ohne zu stottern.
Alfred sah ihn an. Es erschien ihm, als sei David seit dem Sommer nicht nur viel dünner, sondern auch kleiner geworden.
Du siehst wunderbar aus, log er.
So was sagen sich nur alte Kacker. Willst du was trinken? Einen Schnaps trinkst du?
Alfred winkte ab.
Nicht um diese Zeit.
Er führte David zurück zu seinem Sessel. Während sich der alte Mann hineinplumpsen ließ, setzte sich Alfred ihm gegenüber.
Nu, erzähl. Wie geht es deiner Mutter?
Gut. Es geht ihr gut.
Was macht sie? Wo steckt sie?
Sie ist an der Côte d’Azur, bei den Schimmels.
Was du sagst. Nicht schlecht. Ich kannte den Schimmel noch, als er mit Schmuck und Uhren reiste. Nebbich, alles echtes Fastgold. Die Uhren hießen »Omeka«, mit K, verstehst du? Aber, was soll ich dir sagen, die Leute haben gekauft wie blöd. Jeden Tag steht doch irgendwo ein Freier auf, den man betuppen kann.
Die Schimmels sind nett.
David war nicht überzeugt.
Schon. Sie ist emmes ganz nett, aber er... er ist doch ein potz!
Wenn man eine Villa in Cap Ferrat hat, kann man nicht viel falsch gemacht haben.
David wollte davon nichts hören.
Du kommst so selten, da werde ich jetzt mit dir über den Schimmel reden. Ausgerechnet. Von mir aus kann er liegen in der Erd! Erzähl. Was macht die Arbeit? Filmst du?
Alfred nickte.
Ja, es gibt immer was zu tun.
Wann kriegst du den Oscar? Ich will das noch erleben, dass du den Oscar bekommst.
Alfred lächelte verlegen.
Das wird noch dauern.
Soll sein, sagte David, ich hab Zeit. Was heißt Zeit?
Er schaute plötzlich hektisch auf die Uhr.
Wir müssen los.
Alfred war überrascht.
Wo willst du hin, um Gottes willen?
Na, wohin schon? Kunden aufsuchen!
Onkel David, du willst auf Tour? Du kannst doch nicht mehr arbeiten.
Was heißt, ich kann nicht mehr arbeiten? Ich muss! Wer schenkt mir was?
Er versuchte, sich zu erheben, und griff nach Alfreds Hand. Der zog ihn hoch.
Da, die Autoschlüssel. Du fährst.
David zeigte auf die Ablage neben der Tür. Dann klopfte er auf die Außentasche seines Anzugs.
Auftragsblock! Das Wichtigste. Und was zu schreiben.
Er zeigte auf den Kugelschreiber, der neben dem Einstecktuch aus der Brusttasche ragte. Alfred wusste, dass er keine Chance hatte, David von seinem Vorhaben abzubringen.
Der alte Mann humpelte zum Garderobenständer neben der Tür und griff nach seinem Mantel. Alfred half ihm hinein. David nahm einen Schal vom Haken und drückte ihn Alfred in die Hand.
Hier, nimm. So gehst du mir nicht raus.
Alfred protestierte nicht und legte sich den Schal um.
Schöner Schal, sehr weich.
Kunststück, sagte David, Kaschmir. Beste Qualität. Von Lipschitz. Du weißt, im Steinweg. Ich kaufe nur bei Lipschitz. Er ist ein ganef, aber die Ware ist erstklassig. Apropos Ware, wir nehmen heute nur Bestellungen auf. Die Ware kannst du später ausliefern.
Alfred nickte halbherzig. Übermorgen würde er wieder im Zug nach Italien sitzen.
Davids klappriger, alter beigefarbener Opel Caravan war nach einigem Gejaule angesprungen und lief jetzt einwandfrei. Das war erstaunlich, denn der Wagen hatte noch nie einen Ölwechsel, eine Inspektion oder eine Reinigung kennengelernt.
Alfred saß dicht hinter dem Lenkrad wie ein Anfänger, der Sitz ließ sich schon lange nicht mehr nach hinten verstellen. Kein Wunder, all der Kleinkram unter dem Sitz verklemmte die Mechanik. Alfred schob ein paar Hebel hin und her. Er versuchte, mithilfe des Gebläses die Scheibe frei zu bekommen, dann rollte er los.
Auf dem Beifahrersitz hatte sich David eine Zigarette angezündet und hielt sich an der Schlaufe am Seitenholm neben der Tür fest. Er zog an der Zigarette und sagte, nachdem er ausgehustet hatte:
Wir fahren nach Seckbach. Du weißt noch, wie du da hinkommst?
Alfred verzog den Mund, na klar, und bog ab.
Nach einem weiteren Hustenanfall fragte David:
Hast du eine Freundin, da unten in Rom?
Alfred schwieg.
Sag schon, eine kleine rassige Italienerin?
Eine?
Richtig so, meinte David, als ich in deinem Alter war... Wie alt bist du jetzt?
Dreiunddreißig.
Mein Gott, dreiunddreißig! Als ich dreiunddreißig war...
Er dachte nach.
Das war noch vor Hitler. Na, stell dir vor.
Er schaute nach draußen, zeigte dann aus dem Fenster.
Das ist doch die Rohrbachstraße! Hier war es, hier in der Rohrbachstraße, da habe ich eine gekannt, sie hieß Adele, glaube ich, oder Adelheid... ? Wichtigkeit! Jedenfalls war sie sehr fesch. Und ein Figürchen, sage ich dir. Wie gedrechselt. Ich habe sie auf dem Postamt angesprochen. Ich habe sie irgendwas Blödes gefragt. Wie rum man die Briefmarke draufklebt oder so. Auf hilflos machen, das zieht immer bei den Frauen. Ich habe früher nicht schlecht ausgesehen, weißt du.
Ich weiß. Sonst hätte dich Mama nicht als Liebhaber genommen.
Sie? Mich? Als Liebhaber?
David wurde nachdenklich.
Ja, deine Mama... Sie sieht immer noch unberufen gut aus. Sie wird nicht älter.
Ich werde es ihr sagen.
Fahr links hier.
Aber nach Seckbach geht es geradeaus. Da steht es.
Das machen sie nur, um Feinde zu verwirren. Falls die Russen kommen, sollen sie Seckbach nicht finden. Links. Verlass dich auf mich.
Alfred fuhr links um die Ecke. Durch den Schneematsch brach der Kombi ein wenig nach hinten aus.
Du hast keine Winterreifen, stellte Alfred fest.
Was du sagst! Ich habe noch nicht mal Sommerreifen!
David wischte die Seitenscheibe frei. Die enge Vorstadtstraße war mit Autos vollgestellt.
Na, schau dir das an! Jeder schmock hat heutzutage ein Auto. Und die Häuser sind schlecht? Die Deutschen leben! Man muss nur den Krieg verlieren. Halt hier rechts an. Rechts. Das gelbe Haus.
Das ist eine Einfahrt.
Schon. Aber es ist die Einfahrt von den Kupfers. Da wollen wir hin, zu den Kupfers. Alte, gute kojnim. Ich werd dir zeigen, wie man die keilt. Damit du was lernst. Falls das mit der Filmerei nicht mehr klappt, kannst du immer als Teilacher arbeiten. Was kann man wissen im Leben?
Alfred fuhr den Opel in die Einfahrt. Die Räder drehten auf der Schräge etwas durch. Ein Hund bellte, und eine ältere Frau schaute missbilligend aus der Haustür.
Zu wem wolle Sie? Hier dürfe Sie aber net halte, rief sie Alfred zu, aber der war bereits an der Beifahrertür und half David aus dem Wagen.
Mein Gott, der Herr Bermann! Ei, gibt’s denn so was!
Die Frau hatte eilig ihre Schürze abgenommen, kam angelaufen und schüttelte David herzlich die Hand.
Herr Bermann, ei, dass Sie uns mal besuche komme...
David gab der Frau einen galanten Handkuss. Sie wurde rot.
Verehrte Frau Kupfer, darf ich Ihnen den Herrn Kleefeld vorstellen, mein bester Mitarbeiter. Er wird mal das Geschäft übernehmen.
Alfred gab der Frau artig die Hand. Sehr angenehm.
Ei, komme Sie doch rein. Mein Mann wird sich freuen... Er ist nicht mehr so gut zu Fuß...
Wem sagen Sie das.
David hakte sich bei Alfred unter und humpelte zum Haus.
Die Frau lief zur Eingangstür und nahm vor Davids unsicher tretenden Füßen ein Kinderdreirad von der Treppe.
Unser kleiner Jörg. Lässt alles stehen und liegen. Der Lauser.
Ihr Jüngster?, fragte David.
Ei, Sie mache Witze. Unsere Gerlinde, die kenne Sie doch auch noch, sie hat vier Bube inzwischen.
Ja, die habe ich mir auch immer gewünscht...
Er schaute zu Alfred, zwinkerte und flüsterte:
... beim Poker!
Frau Kupfer schenkte aus einer großen Kanne Kaffee nach. Auf dem niedrigen Rauchglastisch lag der Adventskranz. Drei Kerzen waren bereits runtergebrannt. Daneben stand das gute Meißener, und auf einem Teller lagen Spekulatius.
David thronte im Ohrensessel, rauchte und hustete. Der alte Kupfer saß in seinem karierten Hemd mit Hosenträgern auf der braunen Cordcouch. Sein linker Arm mit der schwarzen Lederhand ruhte auf einem herzförmigen Kissen, auf dem gestickt stand: Immer mit der Ruh!
Alfred saß auf einem runden, roten, kunstledernen Sitzkissen, das bei jeder Bewegung zischte. Er fühlte sich unwohl. Die Atmosphäre bedrückte ihn. Er schaute sich um. In der Ecke neben der Fernsehtruhe stand eine bunte Tütenlampe mit drei Biegearmen. An der Wand dahinter hing die glutäugige Zigeunerin. Selbstverständlich gestickt.
Frau Kupfer stellte die blaue Kanne mit dem roten Schaumgummi-Tropfenfänger ab und stülpte einen gesteppten Kaffeewärmer darüber. Sie setzte sich neben ihren Mann.
Ei, so ist das Leben, sagte Frau Kupfer nach einem Moment des Schweigens.
Ja. So vergeht die Zeit, gell, ließ sich Kupfer vernehmen.
Da haben Sie was Wahres gesagt, Herr Kupfer, meinte David. Und wie geht’s sonst so? Die Gesundheit?
Man wird nicht jünger, bemerkte Kupfer.
Ja, ja. Das ist wahr.
Aber Sie werden nicht älter, Herr Bermann.
Alt werden ist doch keine Kunst. Die Kunst ist, jung zu bleiben.
David zeigte an sich herunter.
Jedenfalls die Front muss jung bleiben.
Alle lachten.
David ergriff die Gelegenheit:
Übrigens, wir haben neue Ware reinbekommen, ich sage Ihnen, erstklassig!
Mit einem Blick zu Alfred suchte er Unterstützung.
Brav bestätigte der:
Ja. Wirklich fantastisch.
Hier! Fassen Sie diesen Schal an! Fassen Sie ihn an!
Folgsam griff Frau Kupfer nach dem Kaschmirschal von Lipschitz, den ihr Alfred reichte.
Na, was sagen Sie jetzt?, rief David Beifall heischend.
Schön weich ist der, bemerkte die Frau.
Weich! Was heißt weich? Ein Traum. Kaschmir! Den habe ich für Sie als Decke! Da sind Sie baff. Zwei mal zwei fünfzig.
Er zeigte auf die wollene grüne Plaid-Decke mit Fransen, die auf der Couch lag.
Das ist was anderes als dieser tinnef!
Die haben wir von Ihnen gekauft, sagte Kupfer und grübelte. Wann war denn das?
David bekam die Kurve.
Ja, damals, nach dem Krieg, da war das noch was. Aber das hat man heute nicht mehr. Heute hat man Kaschmir! Für so eine Decke allein müssen zweiundsiebzig Himalaya-Ziegen dran glauben. Und wenn ich Ihnen den Preis sage, werden Sie mich für meschugge halten...
David zückte siegesgewiss seinen Block.
Was darf ich aufschreiben? Es muss ja nicht gleich Kaschmir sein. Aber Weihnachten kommt unaufhaltsam, da führt kein Weg dran vorbei. Also, wie sieht es aus mit Wäsche? Bettwäsche, Schrankwäsche, Handtücher, Badetücher, Aussteuer, hn?
Er zeigte zum Fußboden.
Ich besorge Ihnen auch einen Teppich. Noch vor Heiligabend liegt der hier drin. Einen echten Perser. Nicht so ein Juteding. Der fällt ja schon auseinander. Damit blamieren Sie sich nur.
Frau Kupfer schaute Alfred hilflos an.
Ei, Herr Bermann, also... Wir brauche nichts. Und wenn wir was brauche, gucke Sie mal...
Sie zog unter dem Beistelltisch einen Versandhauskatalog hervor.
Da kriegt man doch alles, gell... beim Neckermann. Wäsche, Kleidung... frei Haus.
Sie hielt ihm den Katalog unter die Nase. David runzelte die Stirn und wandte den Blick angewidert ab.
Neckermann, Schmeckermann! Den habe ich schon gekannt, als er noch über die Dörfer fuhr und Leute übers Ohr gehauen hat. Das ist doch alles Dreck. Habe ich Sie nicht jahrelang ordentlich bedient?
Herr Kupfer nickte.
Doch. Doch. Wir waren immer zufrieden, da gibt’s nix, gell, Ilse...
Frau Kupfer pflichtete ihrem Mann bei.
Ei, sicher, aber die Zeite habe sich geändert, Herr Bermann.
David wurde laut:
Nein, Frau Kupfer, die Zeiten haben sich nicht geändert... Die Moral der Kunden hat sich geändert! Treue ist nur noch ein leeres Wort! Leider!
Frau Kupfers Stimme klang enttäuscht.
Ei, das dürfe Sie jetzt nicht sagen, wir waren immer treue Kunden gewesen. Aber nach dem Krieg und heut, das kann man doch nicht vergleiche.
Kupfer sprang seiner Frau zur Seite.
Nein, das kann man nicht vergleiche.
Seine Frau sah Alfred Hilfe suchend an.
Der legte David die Hand auf den Arm.
Die Kupfers haben recht. Man kann sie doch nicht zwingen. Wenn sie alles haben...
Ein lähmendes Schweigen war zu hören.
David versuchte, sich zu erheben, fiel zurück, wurde noch ärgerlicher, versuchte es wieder, hielt sich dabei an Alfred fest und zog sich hoch. Demonstrativ steckte er seinen Auftragsblock und seinen Kugelschreiber weg. Er zitterte jetzt, und auch das Stottern wurde stärker.
Alfred machte sich auf einen Schub gefasst.
W... w... wir g... g... gehen!
Frau Kupfer war untröstlich.
Ei, Herr Bermann, bleiben Sie, wir haben uns doch immer gut verstanden... Sag doch auch mal was, Hubert, und sitz net so dumm rum...
Herr Kupfer hatte sich inzwischen mühsam erhoben.
Darf ich Ihnen noch ein paar Äpfel mitgeben?
David humpelte zur Tür.
D... das w... war d... das letzte Mal, d... dass i... ch hier w... war!
Sie fuhren lange schweigend. Es hatte zu schneien begonnen, und die kleinen Wischer kämpften mit einem rhythmischen Weinen verzweifelt gegen die weißen Flocken.
Alfreds Nase stieß beinahe gegen die beschlagene Windschutzscheibe. David saß stoisch und hielt sich an der Schlaufe fest. Er nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette und sagte nach einem längeren Hustenanfall:
St... stell d... d... dir vor, Ä... Ä... Äpfel wollte e... e... er uns g... g... geben, de... de... der m... mie... miese goj! D... d... die ka... ka... kann er sich in d... d... den tu... tuches r... rein... stecken!
Und nach einer weiteren Pause:
I... i... ich h... h... hatte s... sie f... fast so w... weit. Ich hä... hätte s... sie k... keilen können. I... ich h... habs ver... ver... verkackt.
Alfred sagte leise:
Onkel David, was du erzählst. Du hast es großartig gemacht, aber die Leute haben alles, die brauchen keine Wäsche mehr.
W... was heißt? J... j... jeder b... b... braucht Wä... Wä... Wäsche!
Alfred hatte eigentlich gehen wollen, aber David bat ihn, noch bis zum Abendessen zu bleiben. Dann hatte er seine Pillen genommen und sich hingelegt. Er lag angezogen auf seinem Bett, den Mund leicht geöffnet, und schnarchte.
David war trotz seiner Krankheit und seines Alters ein schöner Mann. Ein ovales Gesicht mit einer klassischen Nase. Mit erstaunlich wenig Falten und einem dunklen Teint. Sein silbergraues Haar war lang und dicht und verriet nur in der Mitte des Schädels eine dünne Stelle.
Seine schmalen Hände waren gepflegt, überhaupt machte er einen adretten Eindruck. Alfred griff nach einer Kamelhaardecke und legte sie dem alten Mann über die Beine.
Er sah sich die gerahmten Fotos an den Wänden an und die, welche nur lose in den Ecken der Rahmen steckten. Er selbst als Junge an einem Ufer – Murnau am Staffelsee, zelten wollten sie damals unbedingt, aber es schiffte ununterbrochen, und das Abenteuer endete schließlich in einem Hotel. Hier, seine Mutter in Pisa, wo sie den Schiefen Turm festhielt, wie alle Touristen, daneben sein älterer Bruder Moritz, wie immer schlecht gelaunt und mit der hochmütigen Aversion, fotografiert zu werden. David und Alfred auf der Terrasse einer Villa bei Amalfi, hier war es, dass David seinem Freund Otto Zinner von Alfreds Schauspielambitionen erzählte. Das hatte Alfred verlegen gemacht, aber auch stolz. Zinner reagierte jovial und gab die Information prompt nach Rom weiter, wo er einen Studioboss kannte. So stellte sich Alfred in Cinecittà vor und bekam seine erste kleine Filmrolle. Von da an nannte er sich Freddy Clay. Seine Mutter war ganz aus dem Häuschen und stolz auf ihren Jüngsten. Ein Filmschauspieler! Moritz reagierte wie immer eifersüchtig. Er hatte die Situation für einen seiner bewährten cholerischen Anfälle genutzt und geschrien, er könnte irgendwann den Nobelpreis bekommen – das war nichts gegen eine Komparsenrolle in einem billigen Dracula-Film!
Alfred musste schmunzeln bei dem Gedanken.
Dann hingen da Fotos der Bermanns. Galizien um 1910.
Vater Jakov Bermann mit dem langen Bart, die Mutter Lea mit der Perücke, Davids Brüder und die kleine Schwester. Daneben ein Foto aus den Zwanzigern: das Wäschekaufhaus Gebrüder Bermann. Im Vordergrund die Belegschaft, aufgereiht wie auf einem Klassenfoto, die stolzen Bermanns erste Reihe Mitte.
Ein großes Foto zeigte David in der lässigen Haltung eines Dandys, ein Bein auf dem Trittbrett eines eindrucksvollen Cabriolets, in der Hand die unvermeidliche Zigarette. Daneben David auf einem Kamel, in Uniform, auf dem Kopf eine Yashmagh, das Berbertuch. David of Arabia.
Erstaunlich, dass David die alten Fotos über die Zeit gerettet hatte. Ein weiteres zeigte eine Gruppe fröhlicher Männer in Badehosen. Alles Teilacher. Alfred erkannte einige. Verständig, Fajnbrot, Fränkel.
In der Ecke aber, als Solitär, hing ein Porträt von Alfreds Mutter. »Reutlinger, Paris«, stand auf dem Passepartout zu lesen. Eine schöne Frau.
Dann das Foto einer Gedenktafel irgendwo in Frankreich: »En souvenir de la famille. Tous déportés par l’ennemi.« Darunter mindestens fünfzehnmal der Name Bermann. Gegen sechs erwachte David bei bester Laune. Die Pillen hatten gewirkt. Der Schub war vorüber.
Spielst du noch Schach?, fragte Alfred.
David stand am Waschbecken und klatschte sich Old Spice ins Gesicht.
Würde ich gern, aber ich finde keinen Partner.
Warum nicht?
Sie behaupten, ich würde anfangen zu zittern, wenn ich mich aufrege, und dann würde ich die Figuren absichtlich umstoßen. Wer braucht das Geschrei von diesen miesniks, die nicht verlieren können?
Er drehte sich zu Alfred um, rieb die Hände aneinander und strahlte ihn unternehmungslustig an.
Nu? Wie sieht dein alter Onkel aus?
Like a million dollar, sagte Alfred.
David schnippte mit den Fingern, griff nach seinem Stock und rief: Yalla!
Alfred saß neben David im gut besuchten Speisesaal. Ihr Zweiertisch stand an der mit Raufasertapete beklebten weißen Wand, über ihnen ein Bilderrahmen mit einem gedruckten Stich, auf dem ein grantiger Moses mit den beiden Gesetzestafeln zu sehen war.
David zeigte zu dem Bild.
Du weißt, warum es zehn Gebote sind?
Nein.
Gott sagte: Ich habe Gebote für euch. Und Moses fragte, was kosten die? Nix, sagte Gott. Okay, dann nehme ich zehn!
Die Heimbewohner saßen an weiß gedeckten Tischen, vor sich das schwere weiße Geschirr, und schlürften zitternd ihre Hühnersuppe mit Nudeln. Die Löffel klapperten. Manchmal starrten einige alte Leute plötzlich indiskret zu ihnen herüber, zeigten sogar mit dem Finger und flüsterten mehr oder weniger gut hörbar miteinander, und Alfred schämte sich, jung zu sein.
Die Heimleiterin, Frau Kaminker, hatte inzwischen die fünfte Chanukka-Kerze am Leuchter entzündet. Frau Kaminker war eine schlanke Dame um die sechzig. Sie klopfte gegen ihr Weinglas und rief in den Saal:
So, jetzt singen wir alle...
Einige wenige Alte sangen mit zittrigen Stimmen das Maos Zur.
Anschließend gab Frau Kaminker die Überraschung bekannt:
Unser lieber Freund David Bermann wird heute fünfundsiebzig!
Von vielen Tischen kamen Rufe wie »Mazl tov« oder »Fünfundsiebzig ist doch kein Alter«, oder andere riefen »Bis hundertundzwanzig!«. Und manche aßen einfach mechanisch weiter, als sei nichts vorgefallen.
Vier alte Damen kamen an den Tisch, um den Jubilar ausführlich zu küssen und zu herzen. Vor ihren teils noch kauenden Mündern und fettigen Lippen drehte David das Gesicht weg. Mürrisch nahm er die Huldigungen entgegen.
Alte Leute, stellte Alfred befremdet fest, verhalten sich alten Leuten gegenüber weitaus weniger respektvoll, als man es erwarten würde. Keine Spur von Rücksichtnahme, stillem Einverständnis oder Solidarität. Sogar Häme und Sadismus glaubte er zu spüren. Wie aufs Stichwort flüsterte ihm David ein kurzes »Jetzt pass auf!« zu. Dann rief er zu einem dicklichen Herrn am Tisch gegenüber:
Na, Herr Wormser, wie geht’s denn heute so?
Wormser ließ seinen Löffel sinken, schien wie angeknipst aus einer Art Lethargie zu erwachen. Laut und gut vernehmbar sagte er in den Saal:
Ich will ficken!
Frau Kaminker sprang auf, drehte sich empört zu ihm um und zischte:
Herr Wormser!
Der sprach einfach weiter:
Frau Kaminker, ich werde Sie nach dem Abendbrot mal so richtig durchficken! Was halten Sie davon?
David zog Alfred zu sich.
Morbus Pick. Man sagt nur noch Sauereien. Nicht schlecht, was? Unser Hausarzt, der Herschkowitz, er nennt es »ethische Ausfälle«. Du kennst ihn, er ist ja ein »Feiner«. Na, stell dir vor: ethische Ausfälle! Eigentlich kriegen das meistens Frauen. So einer hätte ich mal begegnen sollen!
Pause.
David bemerkte Alfreds Verlegenheit.
Du hast rachmunes? Bubele, glaub mir, das sind keine Heiligen. Und du findest auch wenig Philosophen. Schau sie dir an. Alle gaga. Der Mensch wird nicht weise, wenn er in die Jahre kommt. Der Mensch verblödet.
Alfred war verunsichert. Was sollte er sagen?
David legte nach:
Sie waren jung, jetzt sind sie alt, das ist die ganze chochme. Sie denken ans Fressen, an die Verdauung, an Arthrose, sie lieben schmutzige Witze, am besten mit Kacken, Pischen und Furzen. Eigentlich haben wir alle a bissel den Pick. Apropos, kennst du den? Wo der Mann zum Arzt kommt und hat Blähungen. Und der Arzt sagt: Wie lange leiden Sie denn schon unter Blähungen? Da sagt der Mann: Was heißt leiden? Mein größtes Vergnügen!
Alfred musste lachen, obwohl er den Witz schon seit Jahren kannte. Das war einer der klassischen David-Bermann-Witze. David wurde ernst.
Alt werden ist eine Katastrophe, glaube es mir. Kein junger Mensch kann es sich vorstellen. Man kann es nur erleben. Du wachst auf, es tut dir weh. Hier tut weh, da tut weh. Wenn dir nix wehtut, bist du tot. Plötzlich bist du nicht mehr fähig, auf einen Stuhl zu klettern, gestern hast du es noch gekonnt. Wenn du nachts dreimal pischen gehen musst. Oder wenn du nicht mehr weißt, wo du gestern warst. Oder was du zu Mittag gegessen hast. Oder du erinnerst dich sechzig Jahre zurück. Dann bist du alt, mein kleiner Alfred. Alt zu werden ist eine Ungerechtigkeit. Weißt du, dass man trotzdem immer noch an Sex denkt? Es hört nie auf. Nur die Durchführung lässt zu wünschen übrig. Heute habe ich Angst, dass eine soll, Gott behüte, Ja sagen.