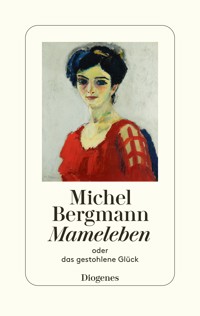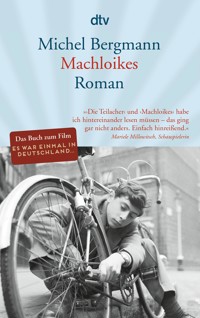
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Teilacher sind zurück! Frankfurt 1953: Zu ihrer Verwunderung haben die Teilacher, die jüdischen Handelsvertreter, sich eingerichtet im Nachkriegsdeutschland. Manche von ihnen sind sogar sesshaft geworden: Robert Fränkel, die Berliner Stimmungskanone, zum Beispiel. Doch eines Tages steht der CIA vor seiner Tür – er soll mit den Nazis kollaboriert haben, in SS-Akten taucht sein Name auf. Dabei hat er im Lager doch nur Witze erzählt, bis jemand fand, er könne Hitler Humor beibringen. Und so fangen die Machloikes (jiddisch: Streit, Durcheinander) an...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frankfurt 1953: Zu ihrer eigenen Verwunderung haben die Teilacher, die jüdischen Handelsvertreter, sich eingerichtet im Nachkriegsdeutschland. Acht Jahre nach dem Krieg beginnen die Wunden zu vernarben. Es gibt die Bundesrepublik Deutschland, einen volkstümlichen Präsidenten und einen scharfkantigen Kanzler. Die Teilacher ziehen weiter mit ihren Wäschepaketen von Tür zu Tür. David Bermann, das Verkaufsgenie, genießt mit seiner alten Liebe Baby und ihren zwei Söhnen die Früchte hart erarbeiteten Wohlstands. Robert Fränkel, die Berliner Stimmungskanone, hat geheiratet, ist Vater einer Tochter und besitzt einen Teppichladen. Der 14-jährige Alfred hilft bei ihm aus und ist froh über sein erstes selbst verdientes Geld. Außerdem ist er heimlich in Juliette verliebt. Das Leben zeigt sich von überraschend sonniger Seite. Allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Fränkel mit den Nazis kollaboriert habe. Schließlich wird er sogar von einem CIA-Beamten vorgeladen, dem er erklären soll, warum sein Name wiederholt in Akten der SS auftaucht. Dabei hat Fränkel im Lager doch nur Witze erzählt. Witze, die so gut waren, dass er einige davon Hitler beibringen sollte. Und damit fangen die Machloikes an.
Von Michel Bergmann ist bei dtv außerdem lieferbar:
Die Teilacher
Herr Klee und Herr Feld
Alles was war
Weinhebers Koffer
Michel Bergmann
Machloikes
Roman
Für meine Schwester Ruth Jody
Prolog
Die wilden Jahre waren vorbei und langsam begannen die Wunden zu vernarben. Es gab die Bundesrepublik Deutschland, einen volkstümlichen Bundespräsidenten und einen scharfkantigen Kanzler. Und es gab die Teilacher, die jüdischen Handelsvertreter, die von Tür zu Tür zogen, um den Deutschen Wäschepakete zu verkaufen. Es war für die Juden aus Osteuropa und für die wenigen zurückgekehrten jüdischen Frankfurter keine Frage, dass sie nur kurzzeitig im Land der Täter bleiben wollten. Ein wenig Geld machen, dann ab nach Israel oder in die USA, nach Kanada oder Australien, in die gelobten Länder, die alle das große Glück verhießen. Vor allem sollten es ihre Kinder einmal besser haben. Deshalb war die Bundesrepublik für die Juden lediglich ein Transitland. Aber es kam anders.
David Bermann, der König der Teilacher, kehrte aus Algerien in seine Heimatstadt Frankfurt zurück und blieb. Er wurde Mitarbeiter des polnischen Juden Max Holzmann, der ebenfalls blieb und sich in die blonde, deutsche Else verliebte und sie 1949 heiratete. Und das, obwohl er in Auschwitz Frau und Tochter verloren hatte. Emil Verständig kehrte mit seiner Frau aus Schanghai zurück und blieb ebenfalls. Auch Jossel Fajnbrot, der von Oskar Schindler gerettet wurde, blieb. Moische Krautberg blieb ebenso und erhängte sich, weil er Treblinka nicht aus dem Kopf bekam. Jankel Lubliner kam mit siebzehn aus dem KZ und blieb und machte eine Karriere als Unterweltboss. Barbara »Baby« Kleefeld, David Bermanns heimliche Vorkriegsgeliebte, kam Anfang der Fünfziger mit ihren zwei Söhnen Moritz und Alfred aus den USA zurück. Und blieb. Sie und David wurden wieder ein Paar, und die Jungens nannten ihn »Onkel«. Und Robert Fränkel, die Berliner Stimmungskanone, blieb ebenfalls, heiratete und machte sich selbstständig. Und damit fingen die Machloikes an …
1.
Glaub mir, er wird kriegen machloikes!
Ach was! Du übertreibst, meinte David.
Ich übertreibe? Wo übertreib ich?
Fajnbrot schaute Hilfe suchend zu Verständig.
Was sind machloikes?, fragte Alfred und sah von seinem »Illustrierten Klassiker« auf. Der Fünfzehnjährige liebte diese Comicheftchen. Es war der beste Weg, die klassische Literatur zu entdecken, ohne dicke Wälzer lesen zu müssen.
Das ist so was wie Ärger, antwortete Onkel David kurz.
Der lange Emil Verständig schlug sich auf Fajnbrots Seite. Das war keine Überraschung. Er widersprach David gern. Er schob sich seinen Hut, den er niemals abnahm, ins Genick, kniff sein gesundes Auge zusammen und stierte mit seinem Glasauge in die Ferne, als ob er damit etwas erkennen konnte. Er nannte es gelegentlich sein »Gestapo-Auge«, denn die hatte es ihm ausgeschlagen.
Ich sage dir, Fajnbrot hat recht.
Jossel Fajnbrot nickte dankbar. Der untersetzte Mann mit dem dunklen Teint, dem gegelten Haar und seinem zweireihigen Glencheckanzug kam Alfred vor, wie aus einem alten Gangsterfilm.
Der Junge vertiefte sich wieder in sein Heft. Er kannte das. Es war wie immer. Die Männer stritten über ein Thema und am Ende behielt jeder recht. Zwei Juden, drei Meinungen, wie David einmal so treffend bemerkte.
Die drei Teilacher und Alfred Kleefeld saßen zur Mittagszeit auf der Terrasse bei »Unterleitner«. Jawohl, Unterleitner hatte inzwischen eine Terrasse! Und von dort aus konnte man die Hauptwache im Zentrum der Stadt überblicken.
Das hatte Alfred in der Vergangenheit oft getan. Er hatte hier oben gestanden und auf den Verkehr geschaut. Denn das große Dreieck mitten in Frankfurt war verkehrsumbraust, und es gab die unterschiedlichsten Autos, die der Junge, als er noch kleiner war, brav in sein Späherheft eingetragen hatte:
Chevrolet Bel Air, Opel Olympia, Borgward Hansa, Studebaker Commander, BMW Isetta, Mercedes 300, Pontiac und Goliath und wie immer eine Menge Jeeps und Lkws der US-Army. Dazu Tempo-Dreiradpritschen, Lastwagen mit und ohne Holzvergaser, Busse, und dazwischen wuselten schwarze Volkswagen, die Alfred mit ihren geteilten Rückfenstern und ihrem Heck an Kakerlaken erinnerten. Dazu kamen Pferdefuhrwerke, Handkarren, Motorräder mit und ohne Seitenwagen sowie Motorroller und Fahrräder ohne Zahl.
Der Krieg war seit acht Jahren vorbei. Und hätte es nicht die zahllosen Trümmergrundstücke gegeben, die wie Wunden die Stadt überzogen, und die Fassaden der Ruinen mit ihren toten Fenstern, man hätte meinen können, achtzig Jahre wären vergangen.
Die Straßenbahnen klingelten, die Eisenräder kreischten in den Kurven, die Schaffner stellten mit einer Stange die Weichen, bevor sie behänd auf die anfahrende Bahn sprangen. Gelbrote E T-Taxis waren zu sehen und schwarze deutsche. Die Menschen hasteten durch die Straßen, flanierten über die Plätze, die Schaufenster der Geschäfte verführten zum Einkaufen, man rannte zum DeFaKa, in das erste Kaufhaus der Stadt. Die Kaffeehäuser und Gaststätten waren gut besucht. Man gönnte sich wieder was.
Kurz, alle waren fröhlich, nur die Teilacher waren verärgert, das war Alfred klar. Auf jeden Fall schienen sie über die Angelegenheit aufgebrachter, als es Max Holzmann war, den es ja letztlich anging.
Seit Jahren arbeitete Robert Fränkel für ihn, hatte in dieser Zeit gutes Geld verdient, war anständig behandelt worden, und es gab keinen Grund, Verrat zu üben. Verrat? Das sah sein Chef anscheinend anders.
Jeder Friseurlehrling, so meinte Holzmann kürzlich, macht sich selbstständig irgendwann und nimmt mit Kunden. So ist das. Das Leben wird weitergehen schon, auch mit ohne Herrn Fränkel.
Wie dem auch sei, David Bermann fühlte sich gar nicht gut bei der ganzen Angelegenheit. Schließlich war er es gewesen, der Fränkel seinerzeit gegen den Widerstand der anderen durchgesetzt hatte. Und nun das.
Was weiß ich, sagte David, wenn er einen Imbiss aufgemacht hätte oder ein Bordell oder wieder als Conférencier arbeiten würde, geschenkt, aber sich selbstständig machen, in Wäsche? Das gehört sich einfach nicht, das ist …
Ah, es gehört sich nicht!, fiel ihm Verständig ins Wort, oj, Bermann, Überraschung! Fränkel hat uns ausspioniert! Er ist ein linker Vogel! Stell dir vor! Ich habe schon immer gesagt, er ist ein arroganter potz. Moische Wichtig!
Und Fajnbrot sagte abschätzig:
Eine Berühmtheit! Beim Film hat er gespielt! Ufa – Schmufa!
Verständig hakte nach:
Ihr kennt doch Abi Friedländer, der mit der Glatze, der in Leder macht, der ist auch Berliner. Und was soll ich euch sagen? Er hat noch nie was von ihm gehört. Who the hell is Fränkel?
Fajnbrot nickte und rief:
Ich werd dir sagen, was er ist, dein Fränkel: a niemand!
Eine gute Gelegenheit für David, das Thema zu wechseln.
Kennt ihr den, fragte er, wo der Rabbi inbrünstig betet: Oh Herr, nimm mein Gebet an, obwohl ich ein Niemand bin! Das hört der Kantor und ruft laut: Schöpfer der Welt. Vernimm mein Flehen, obwohl ich doch ein Niemand bin! Das hört der schammes und schreit noch lauter: Du Allmächtiger! Ich rufe Dich, obwohl ich nur ein Niemand bin! Da schaut der Rabbi zum Kantor und flüstert:
Schlimm, wer sich alles heute schon ein Niemand nennen darf!
Die Männer lachten.
Auch Alfred grinste hinter seinem Heft. Immer hatte David für alles einen passenden Witz parat. Wo holte er die nur her?
Eine Pause entstand.
Emil Verständig zog an seiner Zigarettenspitze, dass die Camel nur so glühte.
Fajnbrot griff ein Stück Würfelzucker, kaute es und nahm dann einen Schluck aus seinem Teeglas. Das machte er immer so, wie seinerzeit in der Bukowina. Er setzte das Glas ab und sagte hintergründig:
Wenn ihr mich fragt, es wird schon stimmen, was sich erzählen die Menschen.
So? Was sagen sie? Red schon!
David wollte es jetzt wissen.
Fajnbrot formte mit Daumen und Zeigefinger ein O und betonte jedes einzelne Wort.
Er hat kollaboriert, hat er, mit die Nazis.
Nazis! Das war das Wort, bei dem Alfred aufmerkte. Er ließ sein Heft sinken und hörte interessiert zu.
Blödsinn! Nein, davon wollte David nichts hören. Was die Leute reden!
Ah, Bermann weiß besser!
Fajnbrot zog anerkennend die Mundwinkel nach unten, nickte zu Verständig. Der hielt den Daumen hoch.
David blinzelte in die Sonne und meinte:
Man kann über Fränkel sagen, was man will, aber glaubt mir, an dieser Sache ist nichts dran. Nichts. Schmonzes!
Du warst dabei?
Verständig schaute ihn ernst an.
Ich weiß, was ich weiß, antwortete David.
Alfred fand das wenig überzeugend, aber der Onkel fuhr rasch fort:
Ich habe ihn vor Jahren schon gefragt nach der Sache, und er hat mir geschworen, dass da nix dran ist.
Schon, ließ sich Fajnbrot hören, und das glaubst du? Nicht lang, hat er noch geschrien: ich … selbstständig? Meschigge werd ich sein! Niemals! Und heute? Da hast du deinen Fränkel!
Verständig nickte.
Wo er recht hat, hat er recht!
Wieder entstand eine Pause.
Herr Gravenholt kam, der distinguierte Ober, stets kultivierter als die Gäste, nahm das Geschirr lautlos weg, wischte danach gekonnt den Tisch ab. Dabei fragte er:
Darf es noch etwas sein, die Herren? Wir haben frischen Käsekuchen, nach jüdischer Art, von Madame höchstpersönlich.
Nein danke, sagte David.
Wie Sie wünschen …
David tätschelte kurz Alfreds Hand.
Bubele, komm. Wir müssen Benzingeld verdienen, für unsere Reise.
Wo fahrt ihr hin?, fragte Fajnbrot.
Nach Knokke, sagte Alfred, während er sich erhob.
Nach Knokke! Ihr wisst zu leben.
David warf ein paar Münzen auf den Tisch. Dabei murmelte er:
Glaubt mir, Fränkel ist kein schlechter Mensch.
Aber auch nicht kein guter, meinte Fajnbrot.
Bist du broiges?, wollte Verständig wissen.
David winkte ab.
Ach was! Ich muss zu einem Kunden. Eschborn. Reklamation. Inmitten meines Tuches befindet sich ein Loch.
Die Teilacher grinsten.
Yalla!, rief David dem Jungen zu.
Er klopfte auf den Tisch und ging los.
Alfred schnappte sich sein Heft und nickte den beiden Männern kurz zu. Dann folgte er David auf dessen Slalom zwischen den Tischen.
Verständig und Fajnbrot sahen ihnen hinterher.
Mit Bermann kann man doch nebbich alles machen, sagte Fajnbrot, er ist zu gutmütig, ist er.
Verständig legte seine Hand auf Fajnbrots Arm.
Jossele, merk dir: Gutmütigkeit ist ein Stück Dummheit. Hat meine Mama selig immer gesagt.
Dabei beobachteten sie David, wie er die Straße überquerte und zu seinem Wagen ging. Ein eleganter Mann von fünfundfünfzig Jahren, picobello gekleidet, mit wippendem jugendlichem Schritt.
Aber, dir gesagt, als Teilacher ist er unschlagbar, meinte Fajnbrot.
Was heißt unschlagbar, bestätigte Verständig, eine Bombe!
Auguste Winter, eine mittelalte pummelige Frau mit Kittelschürze, sah zu David Bermann hinüber, der am Fenster stand und das Laken prüfend gegen das Tageslicht hielt. Alfred saß brav am Tisch vor einem Glas Frischa-Limonade und aß Marmorkuchen.
Und, fragte die Frau fast ängstlich, sehen Sie’s?
Das ist kein Loch, liebe Frau Winter, das ist ein Anschluss. Da wurde beim Weben bei der Fertigung neu angesetzt. So was kommt vor. Das ist normal.
Herr Winter, kriegsversehrt mit nur einem Bein, saß auf dem Sofa. Neben sich hatte er die Krücken geparkt. Er mischte sich ein:
Das kann ja sein, aber bei dem Preis, da kann man was anderes erwarten, gell.
David sah ihn an.
Bei dem Preis? Sie machen Witze, guter Mann. Was wollen Sie noch? Runde Waschlappen mit Goldrand? Für sage und schreibe fünfhundertachtzig haben Sie ein komplettes Aussteuerpaket mit Tischdecke, Servietten, Laken, Überzügen, Kissen, Handtüchern, Badetuch, Küchentüchern und was weiß ich gekriegt! 1-a-Qualität! Also, kommen Sie …
Alfred war gespannt, wie es weiterging.
Das mag ja sein, meinte Winter knarzig, aber die Ware muss trotzdem einwandfrei sein.
Und seine Frau ergänzte:
Ei, was denkt denn unsere Heidi, wenn wir der so was hinterlassen tun?
Ah, meinte David, Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder Sie benutzen die Sachen täglich, oder Sie heben sie auf für die Kinder. Oder …, er machte es spannend, … Sie wollen eine Garantie!
Herbert Winter sah den Teilacher groß an.
Eine Garantie? Gibt’s des?
Das war auch für Alfred neu.
Na, sicher. Geben Sie mir hundert Mark, und ich garantiere für die Haltbarkeit. Geht was kaputt, also nicht durch Ihre Schuld, dann tausche ich die Ware anstandslos um. Jederzeit!
Die Frau sagte misstrauisch.
Ei, und wenn ich Sie dann nicht mehr finde?
Wo soll ich sein? Im KZ?
Alfred verschluckte sich an seinem Kuchen und musste husten.
Herr Bermann! Wie könne Sie denn so was sagen? Ich meine nur, wenn Sie nicht mehr bei der Firma Holzmann arbeiten.
Kunden wie Sie lasse ich doch nicht im Stich. Erst wenn ich in der Kiste liege!
Damit nahm er das Laken und legte es gekonnt zusammen.
Ist ja schon gut, meinte Herr Winter, und David sagte:
Sie holen jetzt das Geld, und ich hole ein neues Betttuch.
Frau Winter machte sich auf den Weg in die Küche.
David ging zur Zimmertür und rief der Frau hinterher:
Und einen Kaffee trink ich auch noch!
Dann zeigte er auf Herrn Winter.
Und Ihnen zeige ich jetzt mal eine echte Plaid-Decke, beste englische Ware, Schottenmuster, Schurwolle, Lamm, da sind Sie baff! Nicht so einen Dreck …, damit zeigte er auf eine billige Filzdecke, die auf einem Sessel lag, … und wenn Sie den Preis hören, lassen Sie mich abholen ins Irrenhaus!
Der Herr Bermann, sagte Winter und schüttelte den Kopf, ihr Judde wisst, wie’s geht, gell!
2.
Alfred fühlte sich wie in einem Film, während das Auto mitten in der Nacht leise über die leere Autobahn dahinglitt. Neben ihm auf der Rückbank saß Moritz, der eingenickt war und dessen Gesicht regelmäßig von den gelblichen Lichtern angestrahlt wurde, die über der Autobahn hingen. Vorn saß Baby, seine Mutter, die sich an ihren geliebten David schmiegte, der am Steuer seines neuen Ford saß und in die Nacht starrte – die unvermeidliche Zigarette im Mundwinkel. Aus dem Autoradio erklang leise »Mister Sandman«.
Zu Beginn der fünfziger Jahre war Belgien das Traumland für die Juden aus Deutschland. Den Belgiern ging es damals viel besser als den meisten Menschen in Europa. Es gab einen huldvollen König, es gab den Kongo, der fröhlich ausgebeutet wurde, es gab das Diamantenzentrum der Welt in Antwerpen, die Montanindustrie und es gab US-Autofabriken. Jeder Belgier fuhr mindestens einen amerikanischen Straßenkreuzer. Viele neue Straßen durchzogen das Land, einige davon Autobahnen, die mancherorts sogar beleuchtet waren.
Die vier waren auf dem Weg ans Meer, nach Knokke, wo sie ein paar Tage verbringen wollten. Es war Pfingsten. Moritz hatte vor ein paar Wochen ein gutes Abitur hingelegt und würde im Herbst mit seinem Studium beginnen. Alfred war auch nicht schlecht in der Schule. Davids Geschäfte liefen gut, und Baby fühlte sich großartig als Übermutter.
Bis zuletzt hatte es Streit gegeben, denn Baby wollte endlich mal bekowed wohnen, am liebsten im eleganten »Memlinc Palace« oder im »Grand Hotel Motke« direkt an der Strandpromenade.
David jedoch fühlte sich seinem alten Bekannten Moische Pomeranz verpflichtet, den er noch aus der Französischen Legion kannte, und der ein kleines Hotel, das »Royal Pomerance«, in einer schmalen Nebenstraße besaß, die zum Strand führte. Ostern waren sie schon nicht zu Pomeranz gefahren, wie sonst üblich, sondern nach Lugano, weil Baby darauf bestanden hatte.
Man tut eine mizwe, wenn man bei ihm wohnt.
Na, fabelhaft! Jedes Jahr tun wir ihm die mizwe! Aber was ist mit uns?, fragte Baby. Kein Sonnenstrahl kommt ins Zimmer, und ich muss wieder in der Kälte sitzen.
Weißt du, was man machen muss, wenn einem kalt ist?
David sah sie an. Dann sprach er weiter:
Man muss zittern und mit den Zähnen klappern!
Sie haute ihm mit der flachen Hand liebevoll auf den Hinterkopf.
Meschuggener, rief sie.
Du wirst nicht älter, war das Erste, was Pomeranz zu David sagte, als der aus dem Wagen stieg.
Hör schon auf, meinte Bermann, das sagen sich nur alte Kacker.
Die Männer umarmten sich und klopften sich dabei gegenseitig auf den Rücken. Dann erst begrüßte der Hotelier Baby mit einem gekonnten Handkuss, danach die beiden Söhne.
Na, ihr zwei, wie geht’s? Was gibt’s Neues?
Moritz lächelte gezwungen, und Alfred ging nach hinten zum Laderaum.
Moritz wird jetzt studieren, sagte Baby.
Mazl tov, rief Pomeranz, und was? Jura? Medizin?
Soziologie, sagte der Junge.
Was ist das?, meinte Pomeranz. Davon kann man leben?
Das werde ich sehen, sagte Moritz.
Wenn nicht, wird er aufmachen ein Hotel, sagte David, spielt a roll.
A broch, meinte Pomeranz verzagt. Die Menschen meinen doch immer, man braucht nur stehen am Eingang und die Gäste werden kommen und areinwerfen das Geld zum Fenster. Jeder glaubt, es ist ein Vergnügen, zu haben ein Hotel. Ich kann euch erzählen, was heißt »Vergnügen«.
Moischeleben, ich soll nicht wissen, sagte David milde lächelnd. Du hast es emmes schwer. Keiner hat es nebbich so schwer wie du.
Ihr lacht, sagte Pomeranz mürrisch. Der Hotelier schnappte sich Davids großen schwarzen Koffer mit den tausend Hotelaufklebern und alle folgten ihm ins Haus.
Moishe, was meinst du, kann ich den Wagen hier stehen lassen?, rief David ihm hinterher.
Pomeranz sah sich um.
Natürlich nicht.
David zeigte in die Straße.
Was heißt? Da stehen doch alle.
Na, sicher, meinte Pomeranz, aber die fragen auch nicht vorher, so wie du. Du bist und bleibst a jecke!
Baby lachte.
Sie hakte sich bei David unter und beide verschwanden im Flur.
Zur Begrüßung spendierte der Hotelier Baby ein Pimm’s, den Jungs Schweppes und für David?
A glusl tei!
Als Erstes gingen die beiden Jungs zum Strand. Sie überquerten die Straße, die an der Promenade entlangführte. Während hier oben viele Besucher flanierten, war es am Strand fast menschenleer. Moritz und Alfred liefen die mit rötlichem Klinker gepflasterte Schräge hinunter in den Sand, obwohl es daneben eine Treppe gab.
Sie liefen bis zu einer Mole, deren glitschige aufgeschichtete Steinquader weit hinaus ins Meer ragten. Hier zwischen den Steinen, in den Ritzen unter den Algen, fanden Moritz und Alfred das, worauf sie aus waren: riesige Krabben, die verzweifelt versuchten zu entkommen. Die beiden hatten vor, sie zu fangen, um sie am Strand um die Wette laufen zu lassen. So wie sie es schon vor Jahren getan hatten.
Während Moritz sich bereits ein wenig zu alt für dieses Spiel vorkam, ging Alfred völlig darin auf. Er gab den Krabben Namen von Automobil-Rennfahrern, wie Ascari oder Farina, und machte »Sportreportagen«. Irgendwann verschwanden die Rennasse in den Brechern, die an den Strand schlugen.
Später saßen die Brüder einträchtig nebeneinander, ließen den Sand durch die Finger rieseln und sahen hinaus auf die graue See. Es roch nach Meer und Tang. Am Horizont zog ein großes Schiff vorbei, und die Sonne versuchte einen diesigen Wolkenschleier zu durchbrechen.
Sie sprachen über die Gezeiten, die Sache mit der Anziehungskraft des Mondes und so. Physik war nicht gerade Alfreds Stärke, aber er hatte ja seinen älteren Bruder. Moritz besaß eine enorme Allgemeinbildung.
Und während sie das Wasser beobachteten, kamen sie zwangsläufig auf die Vergänglichkeit zu sprechen und darauf, dass es im Grunde keine Gegenwart gibt. Moritz schnippte mit den Fingern:
Siehst du, eben war es noch Gegenwart, und nun ist es schon Vergangenheit.
Das ist Ansichtssache, meinte Alfred. Jeder hat seine persönliche Gegenwart. Ich kann einen Moment, den ich genieße, für mich hinauszögern. Also Gegenwart kann eine Sekunde sein, aber auch eine Ewigkeit.
Mag sein, erwiderte sein Bruder, aber es gibt sicher eine physikalische Norm, eine Regel.
Dazu müsste man den Begriff Zeit definieren können.
Einstein kann das.
Ja, Einstein!
Baby hatte sich bei David untergehakt und flanierte mit ihm auf der Promenade, so wie es alle taten um diese Tageszeit. Ab und zu blieben sie stehen, um nach den Jungs Ausschau zu halten. Ein älteres jüdisches, orthodoxes Ehepaar, sie mit Perücke, er mit Schläfenlocken und Pelzhut, watete in der Gischt und versuchte belustigt den Wellen auszuweichen. Er hatte die Hosenbeine hochgekrempelt, sie ihren langen wollenen Rock angehoben.
Da fällt mir der Witz ein, sagte David, wie sie aus dem Meer gelaufen kommt und ruft: Jankele, hast du gesehen, die Wellen haben mich geküsst. Ja, sagt er, und ich habe auch gesehen, wie sie sich hinterher gebrochen haben!
Baby musste so laut lachen, dass sich die Passanten umdrehten, die gerade vorbeigingen.
Alle hatten sich am Abend darauf gefreut, endlich einmal wieder ins edle Restaurant des Casinos essen zu gehen. Aber David wollte Pomeranz partout nicht enttäuschen, der es sich vorgenommen hatte, seine Freunde festlich zu bewirten. Schon seit Tagen hatte sich Claire, seine belgische Gemahlin, darauf eingestellt, die Gäste aus Frankfurt mit einem Vier-Gänge-Menü zu beeindrucken. So saß man nun in dem kleinen, schwach beleuchteten, miefigen Allzweckraum, der als Frühstücks-, Aufenthalts-, Wohn- und Speisezimmer diente, und Frau Pomeranz servierte Erlesenes aus der jüdisch-flämischen Küche.
Wie gern hätten die Jungs eine Riesenportion Pommes frites gehabt, und auch Baby sehnte sich nach allem, nur nicht nach zerkochtem Fisch mit ungesalzenen Kartoffeln und labbrigen Karotten. Als schließlich das Kompott serviert wurde, Pflaumen mit Aprikosen in einer Art Gelee, eine Spezialität des Hauses, waren alle erleichtert, denn das Dinner war damit zweifelsfrei beendet, und man hatte es überlebt. Als Frau Pomeranz erschien, um die Huldigung entgegenzunehmen, meinte David:
Madame Pomeranz, Ihr seid eine balebuste comme il faut.
Merci, sehr nett von Sie, Monsieur Bermann.
Die Lockschensupp, superbe. Le Fisch, genial, le fromage, aufm Punkt et le Kompott, wie bei der mamme! Aber euer Brot – chapeau!
Baby trat David heimlich gegen das Schienbein.
Ein paar Minuten später saßen sie alle an der Bar oder das, was in diesem Hause so genannt wurde. Pomeranz hatte darauf bestanden, seine Gäste noch zu einem Schnaps einzuladen. Die Jungs tranken Schweppes, ein Getränk, das es in Frankfurt nicht gab.
Was weißt du von der Relativitätstheorie?, wurde David plötzlich von Moritz gefragt. Bevor David etwas sagen konnte, war Pomeranz dazwischen:
Alles ist relativ, wollte Einstein damit sagen. Schau, rauchen eine Zigarette ist a kurzes Vergnügen, relativ. Es dauert zehn Minuten. Aber zehn Minuten sitzen mit dem tuches auf einer heißen Herdplatte ist relativ lang! Er lachte heftig über seinen Witz.
David sah Moritz an.
Weißt du, was Einstein mal gesagt hat? Manche Männer bemühen sich ein Leben lang, das Wesen einer Frau zu ergründen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen, zum Beispiel mit der Relativitätstheorie.
Baby lächelte gequält, dann sah sie auf die große Standuhr in der Ecke.
Meine Herren, sprach sie zu ihren Söhnen, es ist fast Mitternacht.
Es ist doch noch früh, maulte Alfred.
Nicht für dich, sagte seine Mutter.
Die Jungs erhoben sich.
Seht ihr, bemerkte David, das hat Einstein gemeint.
Unmittelbar neben dem »Grand Café« an der Strandpromenade lag der »Luna-Park«, ein Ort, der Moritz, aber besonders Alfred wie magisch anzog. Es war ein großer überdachter Jahrmarkt mit vielen unterschiedlichen Automaten, die gurrten und surrten, schrillten, lärmten, klingelten, tönten, Musik machten und auch sprechen konnten. »Bermuda«, »Big Round up« oder »Stadium« hießen die bunten Flipper-Maschinen, und man musste keine achtzehn sein, wie in Deutschland, um sie bedienen zu dürfen. Die wenigen, die es in Frankfurt gab, standen ohnehin in den einschlägigen Kneipen und Etablissements des Bahnhofsviertels oder in Bars für GIs. Jungs in Alfreds Alter wurden rausgeworfen, sobald sie auf der Bildfläche erschienen. Anders in Belgien. Hier konnten Alfred und sein Bruder nach Herzenslust flippern oder mit Elektrogewehren auf Bakelitbären schießen und stundenlang bleiben und möglichst viele Punkte machen, für die es dann bunte Plastikmünzen gab.
Die konnte man eintauschen und dafür Freispiele oder Gutscheine für Pommes frites oder »Salem«-Menthol-Zigaretten bekommen, über die sich besonders Onkel David freute, denn die waren, so glaubte man seinerzeit, »sehr gesund«. Am Ausgang lauerten dann die letzten Verlockungen: große Glaskästen mit allerlei Krimskrams und einem kleinen Kran, den man von außen steuern konnte und mit dem man dann die Objekte der Begierde herausholen konnte. Aber ging der Greifarm einmal nach unten, ließ er sich nicht mehr steuern und deshalb vergriff man sich meistens und ging mit leeren Händen ins Hotel zurück.
An jedem Sonntagvormittag fand auf der Terrasse des »Luna-Parks« ein Gesangswettbewerb für Kinder statt, veranstaltet von der berühmten Wasserfirma »Apollinaris«. Die Kinder, meistens kleine Mädchen, wurden von den Müttern hübsch hergerichtet und auf die Bühne geschickt, wo sie einen Schlager ihrer Wahl, aber auf jeden Fall als Zugabe den Hit »Apopo-Apopo-Apollinaris« zum Besten geben durften. Eine erlesene Jury aus selbst in Flandern unbekannten Stars beurteilte die kleinen Kandidaten, und es gab naturgemäß viele Tränen, aber nicht nur aus Freude. Den Vätern blieb es schließlich vorbehalten, am Schluss handgreiflich zu werden, wenn ihnen eine Entscheidung nicht passte, und das war der Grund, warum Baby, David und die Jungs gern bei diesem Ereignis dabei waren. Dann bemühte sich ein dicklicher, verschwitzter, kurzatmiger Conférencier mit zu engem weißem Jackett und roter Papierrose im Knopfloch, die Streithähne zu trennen und ihnen klarzumachen, dass es nur einen Gewinner geben konnte – obwohl selbstverständlich alle gleich gut waren, keine Frage. Aber das Leben, so meinte er weise, sei nicht immer gerecht und auch die Besten müssten oft steinige Wege gehen. Und während der Mann am Akkordeon noch ein letztes »Apopo-Apopo-Apollinaris« intonierte, verließen die Kämpfer schwer atmend die Arena und zogen ihre kreischenden Kinder hinter sich her. Wenn sich die Reihen lichteten, blieb meist eine zerstrittene Jury zurück und ein Conférencier, der sich sein blaues Auge kühlte.
Baby und ihre Männer machten sich auf den Weg zum Restaurant »Rubens«, und die Jungens sangen dabei: »Apopo-Apopo-Apollinaris«.
Leider blieben die nächsten Stunden in Knokke nicht ungetrübt.
Bereits beim Mittagessen bestand Baby darauf, in ein anderes Hotel zu gehen, aber David hatte Pomeranz gegenüber ein schlechtes Gewissen. Außerdem würde der jetzt die Zimmer nicht mehr vermieten können.
Daraufhin erklärte Baby sich bereit, die Zimmer weiter zu bezahlen, aber trotzdem das Hotel zu wechseln. So kam es, dass David in der folgenden Nacht allein in seinem Hotelzimmer im »Royal Pomerance« lag, an die Decke starrte, wo regelmäßig das rote Neonlicht der Bar von gegenüber aufflackerte. Er bereitete sich bereits grimmig darauf vor, was er Baby am nächsten Tag alles an den Kopf werfen würde. Deshalb war an Schlaf nicht zu denken.
Nach dem verdrießlichen Frühstück in dem kleinen Hotel (Madame hatte für vier Personen gedeckt!) und einem unangenehmen Gespräch mit Moische Pomeranz verließ David den Ort der Niederlage, zündete sich eine Gitanes an und begab sich zum »Memlinc«, wo er Baby und die Jungs fröhlich und aufgekratzt im eleganten Frühstückssaal antraf. In einer Ecke befand sich ein Trio, bestehend aus Geige, Bass und Klavier, und spielte beliebte belgische Frühstücksmelodien. Die weiß beschürzten Kellner schwebten über die dicken Teppiche und trugen auf großen Tabletts schweres Geschirr und Silberkännchen herum.
Nachdem sich David grußlos zu den Seinen gesellt hatte, erhoben sich Moritz und Alfred wie auf ein Signal hin und verließen den Tisch. Sie ahnten, dass der Morgen ungemütlich werden würde.
Schweigend saßen sich Baby und ihr Lebensgefährte gegenüber. Eigentlich wollte David mit seinem Donnerwetter beginnen, aber es wäre das erste seines Lebens gewesen, denn er hatte die Seele eines Schafs. So begann Baby:
David, ich glaube, wir müssen mal etwas Grundsätzliches klären. Mein Leben kann nicht darin bestehen, dass du den Takt vorgibst.
Er lachte.
Ich? Ich gebe den Takt vor? Lächerlich. Du entscheidest doch immer!
Ich?, ging sie dazwischen, wer wollte denn unbedingt nach Knokke? Wer wollte zu Pomeranz? Wer hat es einfach entschieden? Merkst du denn nicht, dass sich alles nach dir richtet?
Das konnte David so nicht stehen lassen.
Habe ich irgendwann mal etwas gegen deinen Willen gemacht?
Immer! Und ich habe mich gefügt, aber das ist jetzt vorbei.
Du dich gefügt? Unser Leben wird doch von dir bestimmt. Wer wollte denn nach Lugano an Ostern?
Ach, Gottchen, ein Mal konnte ich mich durchsetzen!
Ein Mal? Du kannst es ja gar nicht aushalten, wenn du nicht das Sagen hast.
Sie lächelte bitter und stellte dann fest:
David, bitte, alles richtet sich nach dir. Wann wir wohin fahren und wie lange. Was es kosten darf, und was wir kaufen. Aber du vergisst, ich bin eine selbstständige Frau. Ich habe zwei Söhne großgezogen, ich habe immer für mich gesorgt. Ich komme von ganz unten, das weißt du. Ich hatte es nie einfach im Leben.
Obwohl sie damit maßlos übertrieb, widersprach ihr David nicht.
Seit wir uns kennen, das sind jetzt genau …
Sie überlegte noch, und er sagte spontan:
Fast fünfundzwanzig Jahre.
Stell dir vor! Und in diesen Jahren hast du mein Leben bestimmt!
Ich?, David konnte es nicht glauben, sie hatte sich doch nie was vorschreiben lassen.
Ich bin sogar wegen dir aus New York zurückgekommen. Habe keine Rücksicht auf meine Kinder genommen. Meinst du, das war leicht?
In ihren Augen zeigten sich erste Tränen.
David wusste, jetzt hatte er verloren. Gut, er hätte sagen können: Wer hat dich gezwungen? Aber das wäre das Ende der Ferien geworden, und er wollte die letzten Tage noch einigermaßen harmonisch verbringen. Denn nichts war ihm mehr zuwider als eine permanente Krisenstimmung. So hörte er sich sagen:
Baby, Liebling …
Und er tastete nach ihrer Hand. Sie ließ es geschehen.
Lass uns nicht streiten, ab jetzt machen wir es so, wie du willst. D’accord?
Ich will ja gar nicht recht haben. Ich will nur meine Meinung sagen dürfen. Du bist manchmal wie ein Diktator.
Er nickte schuldbewusst, obwohl er sie nicht verstand.
Ein Kellner beugte sich über den Tisch und begann abzuräumen.
Bonne journée, Messieur-Dames, sagte er dabei.
Das war das Zeichen zum Aufbruch. Bald würde für das Mittagessen eingedeckt werden.
Baby und David erhoben sich.
Willst du mal mein Zimmer sehen?, fragte sie.
Gern, meinte er.
Sie gingen los durch den Saal, und die wenigen Gäste sahen ihnen hinterher. Ein hübsches Ehepaar, mögen sie gedacht haben. Sie so blond, so schön und natürlich, er so elegant, gewiss ein erfolgreicher Geschäftsmann.
3.
Die Kaiserstraße war die Achse, die das Viertel rund um den Hauptbahnhof mit der Innenstadt verband. Bevor sie im oberen Teil eleganter wurde, rund um den Kaiserplatz, dem Kreisel am Frankfurter Hof und bei Mercedes-Benz, machte sie bis zur Gallusanlage einen eher schäbigen Eindruck. Dort mündeten die Flüsse in die breite, ehemals repräsentable Straße: Mosel-, Elbe- und Weserstraße und in diese wieder Neckar, Werra oder Nidda. In jeder dieser Straßen hatten sich zwischen den Ruinen und Trümmergrundstücken neben Bars, Stundenhotels und Kneipen auch Schuster, Schneider, Schlosser, Kürschner, Fahrradwerkstätten, Uhrmacher und Kurzwarenhändler angesiedelt. Auch eine Autowerkstatt konnte man finden, mit einer Esso-Zapfsäule auf dem Bürgersteig, bei der das Benzin per Hand gepumpt wurde. Viele der Geschäfte machten sich Konkurrenz. So gab es die Straße der Schmuck- und Uhrenhändler, der Pelzkaufleute, der Teppichverkäufer und der Trödler.
Unweit der Ecke Mosel- und Kaiserstraße hatte Robert Fränkel kürzlich eine leer stehende ehemalige Garage gemietet, in einer halben Ruine, die bis zum ersten Stock reichte und dort provisorisch abgedichtet war. Flachbau nannte man das seinerzeit. Er lag zwischen einem Kino und einem der ersten Schnellimbisse. Die meisten Teilacher waren der Meinung, dass er hier ein Wäschelager aufmachen würde. Aber Fränkel hatte ganz andere Pläne, die er bis zur Eröffnung seines Ladens nicht verriet.
Dann aber Ende Mai, an einem Freitagmittag, wurde das große Geheimnis gelüftet, als Robert Fränkel feierlich sein Firmenschild enthüllte und gleichzeitig das Gitter hochziehen ließ …
»Robby’s Teppichparadies« konnte man deutlich lesen, und kurz darauf strömten die Gaffer in den Laden. Auch Bermann und Verständig waren unter den Premierengästen. Und sie waren beruhigt, dass Fränkel nicht in Wäsche machte.
Staunend gingen die potenziellen Kunden durch den riesigen Raum, der noch nach Benzin und Altöl roch und wo an den Wänden Teppiche aller Farben, Größen, Materialien und »Provenienzen« hingen.
David war anfangs verblüfft, dass sich Fränkel, der ein Gespür für Geschäfte hatte, ausgerechnet ins Teppichmetier begab. Denn um ihn herum lagen förmlich in Spuckweite die Läden von Salim Rahmani, dem Perser, auch »Ali Salami« genannt, und Elias Ter-Vanasian, dem kleinen, stark beringten Armenier.
Wenn der dir die Hand gibt, sagte Verständig einmal bissig, dann zähl hinterher besser deine Finger nach!
In der hinteren rechten, ziemlich dunklen Ecke stand ein mächtiger Schreibtisch, darum ein paar pseudobarocke Sessel, das war Fränkels »Büro«. Hier wurde an die engsten Bekannten warmer Sekt ausgeschenkt, und für die Unverwüstlichen gab es Bourbon, allerdings ohne Eis. Im Nu hatten die anwesenden Teilacher diesen Platz okkupiert und schmusten mit und über Fränkel, der sichtbar stolz Hof hielt.
Auch einige Bardamen und Huren aus der Nachbarschaft ließen es sich nicht nehmen, ein kostenloses »Pitzelwasser« zu nehmen, wie sie den Sekt nannten, und eventuell würde auch ein Freier dabei abfallen. Bei den Teilachern allerdings, das wussten die Damen, war kein Blumentopf zu gewinnen.
Kennt ihr den, fragte David, wo einer fragt: Na, was kostet’s denn, Fräulein? Da sagt sie: Dreißig Mark. Da sagt er: Zwanzig! Sie schüttelt den Kopf: Zwanzig kostet es mich ja schon!
Die Männer lachten.
Während die neugierigen Frankfurter einige Male scheu Fragen stellten, schwadronierte Fränkel über die herausragende Qualität seiner Teppiche, die zwar echt aussahen, aber von denen nicht einer aus Persien kam, geschweige denn je von einer kundigen Hand geknüpft worden war. Seine Preziosen kamen aus dem kleinen Belgien, besser gesagt, aus der Fabrik von Harry van der Meulen in Mechelen.
Sie waren aus Wolle, Sisal oder Jute. Sie hatten klassische Täbris-, Mesched-, Kirman-, Afghan- oder Bucharamuster und waren bunt und eindrucksvoll. Sie durften nur nicht feucht werden, das bekam den Farben gar nicht. Egal, die Preise waren moderat.
Drehte man eine der Ecken am Teppich um, erschien auf der Unterseite ein exotisches Etikett mit allerlei französischen und flämischen Worten und einer von Fränkel mit Tinte geschriebenen Zahl darunter. Diese Ziffer verriet den Verkäufern den Einkaufspreis, sodass sie nach Belieben erhöhen konnten. War da also eine hundertzwanzig, dann verlangten sie zweihundertzwanzig Mark und erhielten zehn Prozent vom Gewinn, dem sogenannten »Riss«, in diesem Fall also zehn Mark. An einem guten Tag konnte ein Verkäufer über fünfzig Mark machen. Deshalb war dieser Job sehr begehrt.
Als Fränkel eröffnete, hatte er drei Verkäufer: Samuel »Schmul« Honigbaum, ein älterer, missmutiger Mann mit Auschwitz-Karriere, den Fränkel eher aus Mitleid eingestellt hatte. Ein einnehmendes Wesen hatte er wahrlich nicht. Honigbaum war stets mürrisch, hatte das Lachen verlernt. Dadurch wirkte er seriös, und viele Kunden hielten ihn für den Chef.
Er machte sich ständig Notizen und schaute unbestechlich drein. So hatte sich bald das Spiel eingebürgert, dass die anderen Verkäufer Honigbaum zum Schein fragten, ob man dem Kunden einen Preisnachlass gewähren könne. Dann legte Schmul die Stirn in Falten, überlegte einen Moment und sagte dann gequält:
Soll sein. Ihr werd’ mich ruinieren noch.
Honigbaum hatte einen Tick: Er verfasste Listen! Er liebte es, Listen zu erstellen mit allem Möglichen. Diese Manie stammte noch aus der Zeit, als er im Krankenbau des Lagers arbeiten musste und dort für Dr. Josef Mengele Listen zu führen hatte. Über Eingänge und Abgänge, über Alte und Junge, Männer, Frauen und Kinder, Zwillinge und Behinderte, Fleckfieberopfer, Typhustote, Kälte- oder Heilgasversuche. Er machte das mit einer derartigen Akribie, dass er mit der Zeit glaubte, unverzichtbar zu sein. Mengele nannte ihn spöttisch »meinen Listenjuden«, und dies wurde für Honigbaum eine Auszeichnung. Erst in den Wochen bevor die Rote Armee unaufhaltsam näher rückte, wurde es auch für Honigbaum kritisch, denn die SS wollte die Immobilie unbewohnt übergeben. Aber Honigbaum rettete sich dadurch, dass er den Lagerkommandanten Rudolf Höß davon überzeugte, täglich Inventarlisten zu erstellen, um den Überblick zu behalten.
Das war besonders wichtig, nachdem Gaskammern gesprengt worden waren, die Arbeit »von Hand« erledigt werden musste oder die Häftlinge auf die Todesmärsche geschickt wurden. Immerhin ging es um den Restbestand der über zweihunderttausend ungarischen Juden, das war kein Pappenstiel. Da waren »Unregelmäßigkeiten« an der Tagesordnung. Auch kamen immer mehr Sachwerte abhanden. Auch dafür war es zwingend notwendig, den Überblick zu behalten.
Honigbaums großer Auftritt kam, als er am 27. Januar 1945 dem verblüfften Oberst Wladimir Bryschtschenko, dem russischen Divisionskommandanten der 60. Armee »Ukrainische Front«, auf dem Appellplatz seine aktuellen Listen übergeben konnte.
7134 Gefangene waren darauf verzeichnet.
Name deiner?
Honigbaum, Samuel, Towarischtsch Kommandant!
Wo kommen?
Lwow.
Jewrej?
Da.
Choroscho.
Der Kommandant nahm die Liste, blätterte sie durch. Er war offensichtlich beeindruckt.
Spasibo bratan, sagte er anerkennend.
»Bruder« hatte der Oberst den Häftling Honigbaum genannt. Der spürte, dass er zurück im Leben war.
Im Frühjahr 1947 begann in Warschau der Prozess gegen den Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, und auch Schmul Honigbaum war als Zeuge geladen. Nachdem der Richter das Verfahren eröffnet hatte, beschrieb der Gerichtspsychologe den SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß als geistig normal, allerdings ohne Moral und vollkommen gefühllos. Er war gewissenhaft und sorgfältig, ein Befehlsempfänger ohne Hang zum Sadismus. Was die Judenvernichtung betraf, so hatte Höß keinerlei moralische Bedenken. Außerdem war er davon ausgegangen, niemals zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Als das Gericht ihn fragte, ob er denn an die Schuld der Juden glaube und der Meinung sei, sie verdienten ihr Schicksal zu Recht, meinte Höß, dies seien unrealistische Fragen. SS-Männer hätten darüber nicht nachzudenken, sie hätten Befehle zu befolgen.
Schmul Honigbaum konnte während seiner Anhörung mit seinen Listen glänzen. Auch das Gericht war dankbar für die präzisen Aufzeichnungen. Selbst Höß schien so etwas wie Stolz auf seinen Ex-Häftling zu empfinden. Da war es kein Wunder, dass der ehemalige Lagerkommandant am Abend vor seiner Hinrichtung darum bat, Honigbaum möge eine Liste seiner Hinterlassenschaft erstellen.
Der Lagerkommandant blieb der ordnungsliebende, pflichtbewusste Mann. Nachdem er Honigbaum alle Angaben diktiert hatte, bedankte sich Rudolf Höß mit Handschlag. Er wusste, was sich gehörte.
Am nächsten Morgen wurde Höß nach Auschwitz gebracht und dort gehenkt.
Als Honigbaum mit seiner Arbeit in »Robby’s Teppichparadies« begann, war es für jene, die seine Marotte kannten, keine Überraschung, dass er Fränkel anbot, für ihn ein paar Listen zu führen. Wareneingangslisten, Bestandslisten, Verkaufslisten, Listen der Putzmittel und eine Strichliste, auf der man die tägliche Kundenzahl ersehen konnte. Zuerst war Fränkel befremdet und zögerlich, aber als er spürte, dass die Ablehnung der Listen zu mentalen Ausfällen bei Honigbaum zu führen drohte, gab er klein bei, und Schmul war glücklich. Er führte seine Listen, neben den privaten für sich, versteht sich. Nachts übertrug er seine Aufzeichnungen säuberlich auf liniertes Papier und überreichte sie morgens seinem Chef. Der warf sie dann ungelesen heimlich weg. Irgendwann allerdings wurde die Situation kritisch, als Honigbaum seine alten Listen einsehen wollte, um eine Liste aller Listen anfertigen zu können. Da flunkerte Fränkel rasch, indem er behauptete, er habe sie abgeben müssen, der CIA interessiere sich dafür. Damit war Honigbaum auf dem Olymp angekommen und fragte nie wieder nach.
Der zweite Verkäufer war Kelbassa. Jürgen Kelbassa aus Castrop-Rauxel, dreiundzwanzig, ein hundertprozentiger goj. Er rühmte sich, mit dem gleichnamigen Fußballer, dem Nationalspieler von Borussia Dortmund, verwandt zu sein, was trotzdem nicht verhindern konnte, dass seine Kollegen immer grinsten, wenn sein Name fiel. Denn »kielbassa« heißt auf Polnisch »Wurst«. »Wurst« durften ihn die Kollegen allerdings niemals im Beisein von Fränkel nennen. Der wurde dann fuchsteufelswild. Keiner wusste warum.
Kelbassa war eine merkwürdige Figur. Er war freundlich und hilfsbereit, etwas einfältig und litt wie ein Hund, dass er aus einer unbelehrbaren Nazifamilie stammte. Deshalb war seine Liebe zu Juden schon gnadenlos und pathologisch. Er verteidigte noch die größten jüdischen Lumpen und Ganoven, wenn es mal wieder zu Konflikten oder Bandenkriegen im Bahnhofsviertel gekommen war. Gleichzeitig fühlte er sich in klassischer linker Ruhrgebietstradition dem Proletariat zugehörig und war sicher einer der wenigen in Frankfurt, die nach Stalins Tod vor ein paar Wochen weinten und so etwas wie Trauer und Verlust empfanden. Kelbassa, einst als Hitlerjunge gestartet, als Volkssturmpimpf den Krieg gemeistert, dann als Falke den sozialistischen Werktätigen zugeflogen, war ein typisches Kind seiner Zeit, hin- und hergerissen in seinen politischen Ansichten. Er verzieh es sich nicht, dass er im Westen lebte, und drohte immer wieder damit, rüberzugehen. Tat er aber nicht, obwohl ihn keiner zurückhielt.
Die Massenmorde und die antisemitischen Exzesse Stalins wollte er genauso wenig wahrhaben wie die Aussicht auf kollektive Läuterung der Deutschen nach der Hitlerzeit. Er kannte seine Landsleute, und dass seine ehemaligen verbohrten Kameraden und Flakhelfer aus der Hitlerjugend plötzlich überzeugte Demokraten sein sollten, konnte und wollte er nicht glauben. Kelbassa war besonders aufmerksam und witterte überall Verrat. Er hatte mit seiner Familie gebrochen, um sich ganz der individuellen Wiedergutmachung zu widmen. Das führte gelegentlich dazu, dass er Kunden des Ladens verwies, die seiner Meinung nach antisemitische Bemerkungen gemacht hatten, was nicht so selten vorkam. Kaufen wollten die Leute ganz gern beim »Judd«, aber halten taten sie nicht so viel von ihm.
So konnte der zuvorkommende Herr Kelbassa auch mal handgreiflich werden, wenn ihm einer zu dumm kam oder einen blöden Spruch drauf hatte. Er war deshalb gelegentlich bitter enttäuscht, wenn sein Chef, der Herr Fränkel, trotzdem solche Kunden bediente.
Der belehrte ihn in diesem Fall:
Pecunia non olet, wie der Schwede so treffend zu sagen pflegt, Geld stinkt nicht!
Wenn Kelbassa widersprach, meinte der Berliner Fränkel verschmitzt:
Ick habe an dem Jeld länger Freude als wie er an dem Teppich!
Der Dritte war Blum. Ein Galizianer. Man kannte den geschniegelten, gut aussehenden Mann von zweiundzwanzig nur unter diesem Namen. Blum. Blum hatte tubenweise Brisk im Haar, trug stets schneeweiße Hemden, enge Ami-Anzüge und benutzte »Robby’s Teppichparadies« lediglich als Operationsbasis, denn seine tatsächlichen Geschäfte pflegte er mit anderen Waren zu machen: Poker, Uhren, Dollars, Autos, Frauen.
Blum hatte ebenfalls eine K Z-Karriere hinter sich, aber die hatte ihn, im Gegensatz zu Honigbaum, nicht gebrochen. Im Gegenteil. Blum hatte Überlebenswillen entwickelt, er war vierzehn als Mauthausen befreit wurde. Er hatte seine gesamte Familie verloren, auch im Kopf.
Fränkel hatte mit einem, für damalige Verhältnisse, bombastischen Eröffnungsverkauf begonnen. Dem sollte ein Sommerschlussverkauf folgen, der »sich gewaschen hatte«. Im Herbst dann: »Blätter und Preise fallen« und schließlich der Weihnachtsverkauf: »Leise rieseln die Preise«, selbstverständlich mit Tombola. Zum Jahreswechsel dann: »Neues Jahr – neue Preise«.
Das Geschäft lief prächtig, und Fränkel war der König. Er stand vor seinem Laden, warf einen kleinen Teppich auf das Trottoir und ließ sein Talent als Entertainer aufblitzen:
Kommse näher, kommse ran, hier wernse beschissen wie nebenan! Hereinspaziert, die Herrschaften! Ja, da könnse ruhig rufflatschen! Den könnse strapazieren! Da könnse en Elefanten drüber jagen, wa! Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Der reißt nicht, der fusselt nicht, der Teppich überlebt uns alle!
Das waren die Sprüche, die Fränkel abließ und die Menschen scharenweise in sein Teppichparadies lockte. Da er auch noch ganz leidlich Akkordeon spielte, kam es vor, dass man seine berüchtigte Hans-Albers-Parodie aus »Liliom« aus dem Laden vernehmen konnte:
Auf dem Rummelplatz ist was los, mein Schatz,
mal schießen, der Kleine? – Das Kalb mit fünf Beine! –
Das Riesenkind – jeder Wurf gewinnt!
Doch das schönste Vergnügen, wo ist das zu kriegen?
Komm auf die Schaukel, Luise! Es ist ein großes Pläsir.
Du fühlst dich im Paradiese, und zahlst nur nen Groschen dafür. –
Ach – komm auf die Schaukel, Luise – ich schaukel her dich und hin,
und zeig dir nachher auf der Wiese, Luise, wie gut ich dir bin.