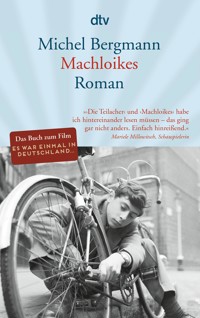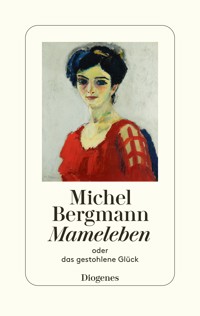9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schlimme am Altwerden ist, dass man jung bleibt Mit dem Weggang von Frau Stöcklein müssen die jüdischen Brüder Kleefeld sich nach einer neuen Haushaltshilfe umsehen. Moritz (77) ist emeritierter Professor für Psychologie, sein Bruder Alfred (75) hat einst in mittelmäßigen Dracula-Filmen mitgewirkt. Bevor die beiden auch nur die Chance haben, in Rentner-Routine zu versinken, erscheint Zamira – mit jugendlichem Charme und Klugheit erobert sie die Herzen der alten Männer, und das Leben könnte einfach und schön sein, wäre Zamira nicht ausgerechnet Palästinenserin ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Haushälterin kündigt, und so müssen die Brüder Kleefeld, wohnhaft in einer Villa im Frankfurter Westend, sich nach einem Ersatz für die gute Frau Stöcklein umsehen. Es bewirbt sich Zamira, die die Herzen der alten Herren bald mit Klugheit und jugendlichem Charme erobert: Moritz ist siebenundsiebzig und emeritierter Professor für Psychologie, sein Bruder Alfred ist zwei Jahre jünger und hat einst in mittelmäßigen Dracula-Filmen mitgewirkt. Das Leben könnte einfach und schön sein, wäre Zamira nicht ausgerechnet Palästinenserin. Zwischen Adrenalinkicks und zarter Anmache setzen die beiden Brüder sich mit der konfliktreichen Gegenwart und ihrer eigenen bewegten Vergangenheit auseinander.
Mit dem Schicksal des Brüderpaars Kleefeld beschließt Michel Bergmann seine meisterhafte, humorvolle Trilogie über jüdisches Leben im Deutschland der Nachkriegszeit.
Von Michel Bergmann ist bei dtv außerdem lieferbar:
Die Teilacher
Machloikes
Alles was war
Weinhebers Koffer
Michel Bergmann
Herr Klee und Herr Feld
Roman
Wahre Jugend ist eine Eigenschaft, die sich nur mit den Jahren erwerben lässt.
Jean Cocteau
1
Meine Herren! Ich werde Sie verlassen!
Moritz starrte sie an. Sein Löffel sank in die Suppe.
Aber Frau Stöcklein. Warum denn, um Himmels willen?
Alfred schaute nur kurz hoch und aß dann weiter.
Die Haushälterin blickte verlegen auf ihre Hände.
Ich bin heute fünfundsechzig und …
Moritz unterbrach.
Was? Heute?
Sie nickte und zog ein Taschentuch aus ihrer Schürze.
Moritz erhob sich.
Und wir haben es vergessen! Meine liebe Frau Stöcklein!
Er nahm die weinende Frau ungelenk in den Arm.
Es ist das erste Mal, dass Sie es vergessen haben, schniefte sie.
Er wollte sie beruhigen.
Alles Gute. Alles, alles Gute. Sie dürfen sich etwas wünschen.
Ein Kochbuch, murmelte Alfred kauend.
Moritz schaute zu seinem Bruder.
Hast du etwas gesagt?
Alfred sah Frau Stöcklein an.
Kann ich den Pfeffer haben? Solange Sie noch unter uns weilen.
Wie er diese Frau verabscheute, die sich als Hausherrin aufführte und seinen Bruder gegen ihn beeinflusste. Über drrreißig Jahrrre, so beschwor sie ihn mit ihrem oberhessischen »R«, über drrreißig Jahrrre haben wir das so gemacht und plötzlich kommt dieser Schauspieler daher und will mir erzählen, wie ich was zu tun habe! Schauspieler! Wie sie das aussprach! Wie Kinderschänder!
Einmal hörte er sie am Telefon zu ihrer Tochter sagen, ohne den Herrn Prrrofessor wär der schon verhungert! Nix Gescheites gelernt, aber den grrroßen Herrn spielen. Kein Wunder, dass die Frrrau Prrrofessor den nicht leiden konnte. Ein Schmarrrotzer ist das!
Ja, das hatte Alfred gehört. Er war daraufhin in die Küche gekommen und hatte lächelnd gesagt:
Der Schmarotzer wartet immer noch auf seinen Tee!
Sie war dunkelrot angelaufen und hatte sofort den Wasserkocher angeworfen.
Frau Stöcklein war die klassische Haushälterin, die »nichts vom Leben« hatte, wie sie gern betonte. Aber sollte Alfred deshalb Mitleid empfinden? Was hätte denn aus dem Trampel aus Nidda werden sollen? Miss Universum?
Frau Stöcklein war vor über dreißig Jahren zu den Kleefelds gekommen. Sie hatte als Aushilfsköchin im Jüdischen Altersheim gearbeitet, bevor man sie Fanny empfahl, die wieder einmal auf der Suche nach einer Perle war, weil es keine länger als einen Monat bei ihr aushielt. Ihr Reinlichkeitsfimmel war pathologisch. Man hätte jederzeit in der Küche eine Operation am offenen Herzen durchführen können.
Frau Stöcklein blieb. Ihr gefiel die geregelte Arbeit und dass sie zu einem Familienmitglied wurde. Ihre Tochter Susanne war damals fünfzehn. Die beiden zogen unters Dach, in die kleine, gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung.
Als die Tochter aus dem Ruder lief, die Schule schwänzte, sich nachts in der Stadt herumtrieb, waren es die Eheleute Kleefeld, die sich kümmerten. Sie versuchten, den störrischen Teenager wieder in die Zivilisation zurückzuführen. Aber Susanne war ausgewildert. So wurde sie, nicht überraschend, mit siebzehn Mutter. Frau Stöcklein war entsetzt, aber hatte sie es in dem Alter nicht ebenso gemacht? Es gehörte bei den Stöckleins zur Familientradition.
Inzwischen hatte Susanne vier Kinder von drei Männern und lebte in einer Art Kommune im Vogelsberg. Wenn sie mal nach Frankfurt kam, um ihre Mutter anzupumpen, machte sich Alfred aus dem Staub. Er ekelte sich vor Tattoos. Besonders solchen am Hals. Susanne und ihre Bikerfreunde waren lebende Horrorgemälde. Frau Stöcklein dagegen freute sich auf ihre hyperaktiven Enkelkinder und tat dann so, als sei alles in bester Ordnung.
Das ist die Jugend von heute, gell, entschuldigte sie die Barbaren. Mit iPhone, iPad und »ei geil« zogen sie schließlich von dannen. Natürlich versäumte es Moritz nie, Susanne noch selbst gemachte Marmelade mitzugeben, seine Spezialität!
Herr Professor, super, Sie sind ein total echter Schatz, echt, bedankte sich dann Susanne. Wahrscheinlich, dachte Alfred, warf sie das Glas in der nächsten Kurve aus dem Auto. Quittenkonfitüre mit Ingwer von einem alten, jüdischen Spinner! Geht’s noch?
Alfred war erleichtert. Schon bald würde er Frau Stöcklein nicht mehr ansehen müssen, wenn sie mit ihrem unförmigen Oberkörper in dieser dunklen Anrichte steckte. Wenn nur noch der fette Hintern herausragte und sie schnaufend das »Schabbesgeschirr« ans Tageslicht zerrte. Jeden Freitagabend deckte sie den Tisch dem Schabbes gemäß, mit zwei Leuchtern und silbernen Weinbechern. Alfred betrachtete sie zu diesem Anlass wie ein Wissenschaftler. Als sei Frau Stöcklein eine fette Mikrobe in der Petrischale.
Wie er dieses düstere Speisezimmer verabscheute! Dumpf, überladen eingerichtet. Der Geschmack seiner Schwägerin Fanny. Und das im 21. Jahrhundert, unfassbar! Eine Vitrine mit Nippes, schwere Stühle, der wuchtige Tisch mit der geklöppelten Decke. Bilder an den Wänden mit biblischen Motiven. Das Rote Meer wird geteilt, Abraham, der Isaak opfern will! Kokolores!
Es gibt nichts Schlimmeres, als von einem anderen Menschen abhängig zu sein, dachte Alfred, als er in seinem Zimmer vor dem Spiegel stand und sein Hemd anzog. Das mit dem Schabbes tat er nur Moritz zuliebe, jahrzehntelang war ihm Schabbes egal gewesen, er hatte noch nicht einmal an Schabbes gedacht, wenn Schabbes war. Aber nun, da er mietfrei im Haus seines Bruders seinen Lebensabend verbrachte, war er gezwungen, Kompromisse zu machen. Und einer davon war dieser gottverdammte Schabbes!
Überhaupt das Jüdische!
Moritz Kleefeld war einmal als ein Linker gestartet, der an die Genese einer gerechten, sozialistischen Gesellschaft glaubte. In den ersten Jahren an der Universität wurde er von seinen konservativen Kollegen angefeindet, weil er sich auf die Seite der 68er geschlagen hatte. Aber dann machte er erste bittere Erfahrungen.
Der linke Antisemitismus, der durch die Unterstützung von palästinensischen Terrororganisationen in den Siebzigern seinen Höhepunkt fand, ließ Moritz zweifeln. Die Nachbeben waren bis heute spürbar. Das Verteufeln von Israel gehörte inzwischen zum guten Ton und galt als Konsens. Viele seiner Studenten trugen bewusst oder gedankenlos die kefiah um den Hals, den »Pali-Lumpen«, wie er es nannte, erschienen damit selbstzufrieden zu den Vorlesungen, fühlten sich auf der richtigen Seite der Geschichte und hörten gleichzeitig ihren jüdischen Professor über »Aggression als politische Komponente« referieren.
Ebenso widerte ihn der Antiamerikanismus an, der es inzwischen zum deutschen Selbstverständnis gebracht hatte. Nicht die Tatsache, dass er US-Staatsbürger war, verlieh ihm diesen kritischen Blick. Ihm war klar, Nixon oder Bush jr. hatten ihren Anteil am miserablen Ruf der Amerikaner, aber die Linke war nicht bereit zu differenzieren. Die USA waren in ihren Augen keine Kulturnation. Sie liebten zwar die amerikanische Lebensart, Hollywood, Facebook und Apple, aber der Amerikaner an sich war ein militanter Einzeller, eine Hamburger mampfende Dumpfbacke. Dass allein der Staat Kalifornien innovativer war als Deutschland, trotz maroder Stromnetze und Schlaglöchern, wollten sie hier nicht wahrhaben. Wahrscheinlich nahmen sie den Amerikanern bis heute übel, dass ihr Volk einst durch sie befreit wurde.
Der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Osteuropa führte Moritz die ungeschönte Wahrheit vor Augen, war aber eher eine logische Folge des »faschistoiden Sozialismus«, wie er es bezeichnete. Er konnte nicht aufhören, links zu sein, nur weil ihm die Ansichten vieler Linker nicht passten. Links und religiös sein schlossen sich für ihn nicht aus. Er hatte das Judentum ohnehin stets als eine »linke« Religion begriffen. Stand nicht im Talmud: Der kann nicht glücklich sein, der einen anderen unglücklich weiß? Das war jüdisch! Aufgeschlossenheit und Wagemut. Unzufrieden mit dem Gegebenen, Suche nach neuen Wegen, soziales Engagement, die Verantwortung für den Nächsten, nicht allein gut sein, sondern die Welt gut machen.
Das waren für Moritz Kleefeld die Ingredienzien einer aufgeklärten, humanistischen, jüdischen Ausrichtung. Deshalb nahm er heute sein Judentum ernster als früher. Die Pflege von Traditionen gehörte zur »Schablone des Lebens«, wie er es auch in seinen Arbeiten beschrieb. Nur auf einem sicheren Fundament der Moral, des Wissens und des Vertrauten konnte Neues errichtet werden. Deshalb bestand er auf einem koscheren Haushalt: aus Selbstdisziplin! Wobei er Gebote, Regeln und Rituale auf seine Weise modifizierte. Eine Art »Koscher-light-Version«. Ebenso verhielt es sich mit dem Schabbes.
Alfred klopfte an die Tür zum Badezimmer, das zwischen den Zimmern der Brüder lag und von jeder Seite eine Tür hatte.
Bist du da drin?, fragte er.
Zwei Minuten!, rief Moritz.
Moritz sah sich im Spiegel an. Das Alter zu ehren hatte er sein gesamtes Leben befolgt und nun stellte er fest, dass er selbst alt geworden war. Wurden nicht, so kam es ihm vor, Nase und Ohren größer? Er sollte mal wieder zu Dr. Nielsen gehen und sich die Leberflecken nachschauen lassen. Oder waren es Altersflecken? Ansonsten konnte er mit seinem Aussehen zufrieden sein. Immerhin war er achtundsiebzig. Er fand, dass er aussah, wie ein emeritierter Professor aussehen sollte: freundliches Gesicht, ein Schnauzbart, lockiges weißes Haar. »Professor Einstein« hatte mal eine seiner Studentinnen zu ihm gesagt. Das schmeichelte ihm.
Das gemeinsame Badezimmer war eine Katastrophe! Als seine Frau noch lebte, war es halbwegs erträglich. Fanny schlief ohnehin morgens länger als er, sodass sie sich gut aus dem Weg gehen konnten. Außerdem hatte er sich im Lauf des Ehelebens an die Requisiten seiner Frau gewöhnt, die er zum überwiegenden Teil für verzichtbar ansah. Die vielen Cremes und Tuben, Puderdosen, die Parfums und Sprays, die diversen Pasten, die zahllosen Pinselchen, Bürstchen, Spängchen, Kämmchen, Klämmerchen, Gummibändchen, Pads, Q-Tips, Wimpernzangen und Pinzetten. Die Pillen, Dragees, Pastillen und Kapseln. Dazu Watte, Zahnseide, Bodylotions, Körpermilch, Shampoos, Deos und Gels ohne Ende. Dazwischen Mascaras und Stifte. Nicht zu reden von den Proben und Souvenirs aus Hotels. Auch an das Spülen, Föhnen, Gurgeln, Zupfen, Schaben, Schrubben, Rubbeln und Klatschen hatte er sich gewöhnt.
Nun aber, seit Alfred im Haus lebte, war alles anders. Sein Bruder konnte sich nicht daran halten, nur seine Seite und nur seine Handtücher zu benutzen. Niemals machte er das Waschbecken sauber, bevor er das Bad verließ, und so fanden sich überall Haare und weitere unappetitliche Hinterlassenschaften und verdarben Moritz die gute Morgenlaune. Dann noch das Gurgeln und Husten, das Nasehochziehen, das laute Niesen, entsetzlich.
Hinzu kam, dass auch Alfred merkwürdige Salben, Lotionen und Wässerchen hatte, die angeblich dazu dienen sollten, die unaufhaltsame Alterung aufzuhalten. Er zupfte sich sogar die Augenbrauen, was Moritz überhaupt nicht verstand. Auch einen batteriebetriebenen Rasierer besaß er, mit dem man Nasenhaare entfernen konnte, und einen speziellen Kurzhaarschneider, der zu unrasiertem Aussehen verhalf und ihm den Anschein von Boheme geben sollte. Boheme! Ein alter unrasierter Mann sah aus wie ein alter unrasierter Mann! Dann noch der antiquierte Duft von Acqua di Selva, den nur Alfred für unwiderstehlich hielt. Kurz, seine äußerliche Eitelkeit entsprach in keiner Weise seinem nachlässigen Umgang mit dem Badezimmer. Und mit seinem eigenen Zimmer ebenso, und mit der Wohnung insgesamt. Er ließ alles liegen und es war an der armen Frau Stöcklein, ihm ständig irgendetwas hinterherzutragen. Oft fanden sich im Salon noch am Morgen seine Schuhe und Socken, die er beim Fernsehen achtlos ausgezogen hatte. Den Trenchcoat pflegte er über den Stuhl im Flur zu werfen, obwohl sich unmittelbar daneben eine Garderobe mit Kleiderbügeln befand. Moritz hatte dafür kein Verständnis. Klar, als Schauspieler war es Alfred gewohnt, dass ihm Sachen hinterhergetragen wurden und andere auf seine Kleider achteten. Oder hing seine Schlamperei damit zusammen, dass es nicht sein eigenes Haus war, in dem er lebte, und er keinen ideellen Zugang dazu hatte und keine Achtsamkeit verspürte? Für Moritz war er ein Ignorant.
Alfred mit Hut, in einem exotischen Hausmantel, Moritz mit kippa, Strickjacke, Hemd und Krawatte saßen sich schweigend am Tisch gegenüber. Darauf standen zwei Schabbesleuchter mit brennenden Kerzen. Über die challe war ein Tuch gedeckt, blau mit einem silbernen Davidstern.
Moritz beendete die bracha:
… hamauzi lechem min ha’arez.
Den Ritus und die Gebete hielt er nicht korrekt ein, aber das merkte hier keiner. Nach dem Segensspruch wartete er, dass sein Bruder »omejn« sagte, aber der schaute bloß gelangweilt.
Alfred, mit seinem scharf geschnittenen Gesicht und der Habichtsnase, trug seinen schwarzen Hut, den »Schabbesdeckel«, wie er ihn nannte, wie ein ironisches Aperçu.
Moritz sagte nach einer Pause selbst:
Omejn.
Er nahm die challe, riss ein Stück ab, tat Salz drauf und reichte es seinem Bruder. Der ergriff das Brot, biss ein Stück ab und murmelte dabei:
Omejn, gut Schabbes, cheers!
Dann nahm er seinen Becher und trank einen Schluck Rotwein.
Moritz reagierte verärgert.
Warum wartest du nicht auf die broche?
Broche-schmoche! Bis dahin bin ich verdurstet!
Sein Bruder hob seinen Becher hoch und murmelte rasch den Segensspruch.
Dann trank auch er einen Schluck.
Er setzte sich und betätigte die Fußklingel.
Alfred sah an sich hinunter und sagte ironisch:
Sieht gut aus, nicht? Reine Seide. Jetzt sehe ich aus wie ein Chassid.
Moritz verzog den Mund.
In der Tat. Sehr geschmackvoll!
Alfred reagierte gespielt naiv:
Oh, don’t you like it?
Moritz lehnte sich zurück.
Ich habe mir abgewöhnt, dich positiv beeinflussen zu wollen.
Alfred daraufhin:
Gott soll mich abhüten. Dein Geschmack! Allein diese Strickweste!
Moritz reagierte:
Erstens, berufe dich nicht auf Gott. Zweitens, immer noch ansehnlicher als das da!
Er zeigte abfällig auf Alfreds Hut.
Was willst du?, sagte Alfred, habe ich extra für deinen Schabbes ausgegraben.
Es ist nicht mein Schabbes, es ist Schabbes!
Nein, es ist dein Schabbes! Keiner pflegt den Schabbes so inbrünstig wie du. Du gibst dich dem Schabbes förmlich hin …
Moritz zupfte ein Stück von der challe ab und sagte dabei:
Es ist allein der Schabbes, der die Juden über Jahrtausende zusammenhielt. Es ist dem unbeirrten Festhalten am Schabbes zu verdanken, dass das Judentum nach wie vor existiert. Alle intelligenten, seriösen und traditionsbewussten Juden pflegen den Schabbes.
Das ist ein Widerspruch! Intelligent, seriös, traditionsbewusst und auch noch Jude!
Alfred nahm ebenfalls ein Stück Brot.
Banause!, sagte Moritz.
Alfred erwiderte kauend:
Moische! Gerade am Schabbes rücken die weltlichen Fragen in den Hintergrund. Säkular wird sekundär!
Moritz blieb ruhig.
Und du wirst ordinär. Und nenn mich nicht Moische.
Wie soll ich dich ja nennen? Professor Moische?
Bevor Moritz etwas sagen konnte, betrat Frau Stöcklein mit der Suppenterrine den Raum und bemerkte sofort die miese Stimmung. Sie stellte die Terrine auf den Tisch und sagte dabei:
Na, na, nicht schon wieder Streit an Ihrem Schabbes!
Alfred erhob Einspruch:
Sie irren, gute Frau. Es ist nicht mein Schabbes! Es ist der Schabbes des seriösen, intelligenten, traditionsbewussten Professors. Finden Sie nicht, Schläfenlocken würden ihm gut stehen?
Frau Stöcklein schaute Alfred strafend an. Sie wollte etwas sagen.
Lassen Sie, Frau Stöcklein, sagte Moritz, mein Bruder kann nicht anders. Er leidet an PTBS.
Was ist das denn wieder?, fragte Frau Stöcklein.
Eine Posttraumatische Belastungsstörung, sagte Moritz.
Während er sich dabei die Serviette in den Kragen steckte, war Alfred heftig am Salzen.
Frau Stöcklein war aufgebracht.
Da! Jetzt salzt er wieder! Das macht er immer! Warum probieren Sie nicht erst?
Bevor Alfred sich äußern konnte, sagte Moritz:
Es ist das Krankheitsbild! Er glaubt, er sei zu kurz gekommen.
Alfred sagte freundlich leise:
Nenne mir doch bitte schön einen Punkt, an dem ich deiner Meinung nach zu kurz gekommen bin, hn? Ich bin größer als du, jünger als du, schöner als du!
Moritz tippte sich auf die Stirn.
Und meschuggener als ich! Bon appétit!
Frau Stöcklein stand noch einen Moment unschlüssig, bevor sie sagte:
Meine Herren! Ich werde Sie verlassen!
2
Es war Alfred nicht leichtgefallen, sich wieder an das Leben in Frankfurt zu gewöhnen. Fünfzig Jahre Abwesenheit waren eine lange Zeit. Er musste sich dazu durchringen, am gesellschaftlichen jüdischen Leben der Stadt teilzunehmen, um nach Freunden von damals zu forschen und Erinnerungslücken zu schließen. Obwohl er nicht schüchtern war, hatte er Hemmungen, sich bei Leuten zu melden und zu sagen:
Hier ist Freddy Kleefeld, erinnerst du dich noch?
Welcher Freddy?
Da war ihm Marian Perlmann, der Hausarzt seines Bruders, eine Hilfe. Der hatte zu allen Kontakt. Alfred hatte Perlmann bereits gekannt, als sie noch Kinder waren. Als sie gemeinsam 1954 mit vielen anderen Juden in einem Café das Endspiel von Bern auf einem winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher angeschaut hatten und sich der kleine Marian als Einziger über den deutschen Sieg gefreut hatte und nicht verstand, warum ihn alle nach seinem Jubelschrei am liebsten umgebracht hätten.
Einmal im Monat kam Perlmann vorbei, er wohnte nur ein paar Häuser weiter. Er maß Blutdruck, hörte Moritz ab, untersuchte ihn, verschrieb Medikamente. Seit Beginn dieses Jahres hatte er mit Alfred einen weiteren Patienten.
Durch Perlmann erfuhr Alfred vom Verbleib einiger Menschen, die er in seiner Jugend gekannt hatte: Alle Teilacher wie Fränkel, Verständig, Szoros und Fajnbrot waren gestorben, ebenso Max Holzmann, dieser allerdings als Multimillionär. Benny Kohn war Journalist und lebte in Berlin, Maxele Grosser hatte das Modegeschäft seiner Eltern übernommen, Lenny Hofheimer war Neurologe und arbeitete in Houston, Arie Getter erfolgreicher Anwalt in Toronto, Danny Stern war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Alfreds »Buddy« Leo Bialik lebte als Arzt in St. Louis. Milly Freiberger hieß Legovici, hatte zwei Kinder und saß in Washington, wo sie eine Agentur leitete. Juliette Lubinski war jetzt Frau Dr. Tisch aus Zürich. Alfred nahm sich vor, sie zu googeln und den Kontakt aufzunehmen. Es war aufregend, Menschen aus der Vergangenheit zu treffen. Es war so, als würde man sich selbst in einer anderen Zeit begegnen.
Perlmann hatte vor einigen Wochen ein Treffen mit ein paar alten Freunden organisiert. Der Abend war unterhaltsam. Die Freunde aus der Jugendzeit waren erfolgreiche Geschäftsleute geworden, hatten Kinder und Enkel. Die meisten lebten ein behagliches bürgerliches Leben, spielten Golf und ertrugen ihre dominanten jüdischen Frauen mit der Nachsicht, die aus einem langen Eheleben resultierte. Es sei denn, sie waren geschieden und hatten gojische Partnerinnen. In diesen Fällen erfuhr Alfred von Rosenkriegen, von nächtlichen obszönen Anrufen oder Lackschäden an Maseratis.
Alfred hatte erwartet, als Filmschauspieler im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Aber nach ein paar Minuten war es so, als sei er nie weg gewesen. Er gehörte gewissermaßen wieder zum Inventar. Die meisten kannten seine Filme nicht. Henry Reichmann sagte sogar voller Stolz, dass er nie ins Kino gehe. Er interessierte sich nur dafür, wie hoch die Gage war, die Alfred für einen Film bekam. Alfred log und nannte eine beachtliche Summe.
Wieso kriegst du so wenig? Dieser James Bond, dieser Craig oder wie er heißt, kriegt fünfzehn Millionen.
Siebzehn!, verbesserte ein anderer.
Das werde ich mir nicht mehr antun, sagte sich Alfred, als er nach Hause ging.
Seitdem Moritz Witwer war, wurde er für einige jüdische Damen attraktiv. Insbesondere für Norma Mizrahi, die selbst vor einem Jahr Witwe geworden war. Norma war Ende fünfzig, nicht unattraktiv, blond, lebhaft. Sie besaß ein kleines, edles Hotel im Westend, das »Le Petit Grand«. Die Paare Kleefeld und Mizrahi waren locker befreundet gewesen. Ab und zu war man sich im Café oder bei Veranstaltungen der Gemeinde begegnet, auch bei der WIZO, für die die umtriebige Norma unverdrossen die Werbetrommel schlug und wo Fanny und Moritz gern gesehene Spender gewesen waren.
Norma hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den trauernden Moritz aus seiner Lethargie zu holen und ihn wieder dem gesellschaftlichen Leben zuzuführen. Schließlich wusste sie selber, was es bedeutete, einen geliebten Menschen zu verlieren. Sie erschien hin und wieder unangemeldet beim Professor und holte ihn aus seiner »Höhle«, wie sie lachend bemerkte, damit er nicht »verstaubte«. Moritz war unfähig, sich gegen die gnadenlose Hilfsbereitschaft von Norma zu wehren. Zumal sie stets betonte, dass dies sicher auch im Sinne der verstorbenen Fanny, ihrer angeblich engsten Freundin, wäre. Sie schleppte Moritz zu Vorträgen, Konzerten und Wohltätigkeitsveranstaltungen und der ließ es, arglos wie er war, geschehen. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass einige Bekannte der Meinung sein könnten, dass Frau Mizrahi und Professor Kleefeld mehr verband als nur gesellschaftlicher Umgang. Auch Frau Stöcklein ließ durchblicken, dass sie über die enger werdende Freundschaft zu dieser Dame nicht erfreut war. Mit Alfreds Auftauchen veränderte sich die Lage und Norma hielt sich vorerst zurück. Sie rief ab und zu an, erzählte Neuigkeiten aus der Gemeinde und versuchte, auch Alfred einzubinden.
Einmal war es ihr gelungen, beide Brüder zu sich nach Hause einzuladen, und zufällig war ihre geschiedene Cousine Stella aus Tel Aviv anwesend, die Alfred anschwärmte und sich zwischendurch über das ach so teure und unkultivierte Leben in Israel echauffierte. Frankfurt sei durchaus eine Option, die sie sich für ihr weiteres Leben vorstellen könnte. Auch ein Partner wäre angenehm. Stella war auffallend an Alfreds ereignisreichem Leben interessiert, hörte ihm aufmerksam zu, lachte ausgiebig über seine Witze und berührte dabei immer wieder absichtlich unabsichtlich seine Hand.
Als Moritz und Alfred vor die Tür traten, nieselte es. Deshalb sorgten sich die Frauen um die Gesundheit ihrer Gäste und Norma bot an, sie mit dem Auto nach Hause zu bringen. Moritz und Alfred lehnten ab. Im Gegenteil, meinten sie, es wäre angenehm, in der frischen Nachtluft zu spazieren. Als sie dann durch den immer stärker werdenden Regen nach Hause rannten, war ihnen klar, dass sie darauf achten mussten, nicht in ein Spinnennetz zu geraten. Frauen verstanden sich gut darauf, die Eitelkeit der Männer für sich zu nutzen.
Am nächsten Morgen hatte Moritz eine Erkältung.
3
Der mit aggressiven Graffiti besprühte Fiat Ducato stand in der Einfahrt. Ein muskulöser, tätowierter Mensch im T-Shirt schleppte einen Karton.
Alfred verfolgte die Aktivitäten mit Genugtuung. Er befand sich auf dem kleinen Balkon seines Zimmers im Erdgeschoss und rauchte einen Zigarillo. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen mit Moritz hatte er sich schlussendlich bereit erklärt, seine täglichen drei Zigarillos draußen zu rauchen. Er war die Streiterei mit seinem pedantischen Bruder leid. Dreimal am Tag einen kleinen Zigarillo! Das hatte doch was Gemütliches, aber Moritz tat so, als würde ein Tsunami hereinbrechen:
Ich bestehe darauf, dass du in diesem Hause nicht rauchst!
Warum?
Noch nie ist in diesem Hause geraucht worden und so soll es, bitte schön, auch in Zukunft bleiben.
Hast du Angst, du bekommst Lungenkrebs vom Passivrauchen?
Es ekelt mich.
Wenn du wüsstest, was mich hier alles ekelt!
Dann kannst du ja gehen!
So gab ein Wort das andere. Alfred knickte ein, was selten vorkam, aber sein Bruder war nun mal der Hausherr, was konnte man machen? Alfred empfand diese Zurechtweisung als kleinkariert. Doch zu seiner Verwunderung konnte er im Lauf der Zeit den Viertelstunden auf dem Balkon einiges abgewinnen. Immer wenn er hier saß, erlebte er etwas:
Ungeschickte Fahrer beim Einparken, brüllende Kinder, denen der Ball unter ein abgestelltes Auto gerollt war, Joggerinnen, die verschwitzt und mit wippenden Brüsten die Straße hinunterhechelten, Typen auf Liegefahrrädern, hektisch telefonierende Jungmanager mit Businessköfferchen, alte Frauen mit Rollator, bekopftuchte türkische Mütter mit kreischenden kleinen Sumoringern. Ab und zu gab es Sielarbeiten, meistens dann, wenn die Straße gerade frisch asphaltiert worden war. Alfred sah Kehrmaschinen, Männer mit phosphorgrellen Arbeitswesten und blödsinnigen Laubpüstern. Bella, die struppige Hündin im Vorgarten nebenan, die immer wieder vergebens den Elstern hinterherhetzte und hoch in die Luft sprang, selbst wenn die Vögel sich bereits auf dem nächsten Baum befanden und hämisch schrien. Auch Eichhörnchen gab es. Kurz, Alfred freute sich inzwischen auf seine drei täglichen Rauchpausen.
Heute war es besonders vergnüglich. Frau Stöcklein zog aus!
Alfred hörte, wie der Klotz zu Susanne sagte:
Jetz simmer gleich dorsch.
Alfred sah seinen halben Hintern samt Schlitz, natürlich mit Behaarung und Tattoo, in einer dieser viel zu knappen Hosen, wie sie heute Mode waren, und hörte ihn sagen:
Sieh zu, dasse raus kimmt.
Er kroch aus dem Transporter und nahm ihr einen Koffer ab.
Sie ging los in Richtung Haus.
Ich geh mal gucke, wo sie bleibt …
Sie schaute kurz zum Balkon, aber Alfred hatte sich verzogen.
Er stellte fest, dass der kleine blonde Torsten, Frau Stöckleins Enkelsohn, in seinem Zimmer stand und auf das große, gerahmte Filmplakat starrte, das Alfred als Vampir zeigte, der sich über eine junge Frau beugte. Darauf stand:
»Freddy Clay – Sylvia Vermont in: The Night of the Vampire. A film by Ramon Polinsky«.
Alfred näherte sich dem Jungen von hinten und sprach einen Satz aus seinem berühmtesten Film:
Wer schleicht sich denn so still und heimlich in mein Schloss?
Der Fünfjährige erschrak und drehte sich um.
Das bist du, gell?, fragte er.
Alfred war in Erwartung einer Demütigung.
Ja, sagte er leise.
Der Film ist doof!
Alfred hatte es geahnt.
Machst du da Leute tot?
Ja.
Alle?
Alfred lächelte.
Nur kleine, blonde Buben!
Damit ging er zu seinem Schreibtisch, der überladen war mit Papier und Notizen, mit einem Laptop, Büchern und Stiften. Alfred arbeitete an seinen Memoiren. Er hatte noch kaum etwas geschrieben, aber bereits einen Titel: »Bis hier und weiter«. Das gefiel ihm.
Moritz hatte schon gelästert:
Wen soll das interessieren, was ein kleiner B-Movie-Actor da an Belanglosem von sich gibt?
Alfred war gekränkt. Zumal er immer wieder im Arbeitszimmer seines Bruders auf diverse Buchrücken starren musste, auf denen gut leserlich der Name Moritz Kleefeld zu erkennen war.
Alfred startete seinen Laptop, als der Knabe an den Schreibtisch kam und den Brieföffner sah.
Ist das dein Messer?, fragte er.
Alfred nickte.
Der Junge begann, seine Hand auf dem Schreibtisch zu bewegen. Sie näherte sich dem Gegenstand der Begierde wie ein Insekt. Der Kleine provozierte Alfred, indem er nach dem Brieföffner greifen wollte.
Krieg ich das?
Nein, sagte Alfred scharf und seine Augen wurden zwei schmale Schlitze.
Ich will das aber haben, sagte der Junge.
Alfred wurde lauter:
Nein! Verstanden?
Das ist meins …
Hüte dich!
Der Junge blieb unbeeindruckt.
Ich würd’s jetzt nehmen, gell?
Das glaube ich nicht, sagte Alfred mit einem dunklen Unterton. Dabei beugte er sich vor und kam dem Gesicht des Jungen gefährlich nah.
Ich rate dir jetzt zu verschwinden!
Die Hand des Jungen kam dem Objekt näher und näher.
Alfreds Kiefer begann zu mahlen, wie in einem seiner Western.
Da! Der Junge griff nach dem Brieföffner!
Im nächsten Moment hatte Alfred den Duden genommen und schlug damit dem Jungen auf die Hand!
Der starrte eine Sekunde verblüfft, dann …
Moritz und Frau Stöcklein standen auf dem Flur und sprachen leise miteinander, als sie ein hysterisches Kreischen hörten!
Beide schauten entsetzt in die Richtung, aus der die Schreie kamen.
Um Gottes willen!, rief Frau Stöcklein.
In diesem Augenblick lief Susanne bereits aufgeregt an beiden vorbei, zu Alfreds Zimmer.
Torsten!, schrie sie.
Da kam der Junge auch schon brüllend angerannt und warf sich seiner Mutter in die Arme.
Liebling! Was ist denn?, fragte sie aufgeregt.
Auch Frau Stöcklein ging in die Hocke.
Sie bemerkte, dass sich das Kind die Hand hielt.
Torsten, hast du dir wehgetan?, fragte sie. Sag doch der Omi, was du hast.
Moritz stand hilflos daneben. Er wollte auch etwas sagen.
Möchtest du vielleicht einen Bonbon?
Torsten schaute ihn wutverzerrt an und presste die Worte hervor:
Der Mann hat mich gehauen!
Welcher Mann?, fragte Moritz.
Der Junge zeigte nach hinten.
Der böse Mann da hat mich gehauen!
Alle starrten auf Alfred, der auf den Flur getreten war und mit wehendem Hausmantel auf die Gruppe zuging. Mit diabolischem Lächeln. Wie aus einem Horrorfilm.
Na? Was hat er denn, der Kleine?, fragte er.
Er hat sich wohl wehgetan, sagte Frau Stöcklein unsicher.
Ach, sagte Alfred.
Susanne nahm den Jungen auf den Arm.
Er ist müde, von der Fahrt. Ich geh dann schon mal raus, also tschüs, sagte sie rasch und gab Moritz die Hand.
Und nochmals vielen Dank. Für alles, was Sie für meine Mutter getan haben …
Aber ich bitte Sie. Ihre Mutter war eine unverzichtbare Hilfe in meinem Leben und im Leben meiner verstorbenen Frau.
Frau Stöcklein begann zu weinen.
Herr Professor, Sie waren immer so gut zu mir, wimmerte sie.
Moritz nahm Frau Stöcklein in die Arme. Auch er war gerührt.
Alfred wurde sachlich:
Machen wir’s kurz und schmerzlos. Ich habe zu tun. Auf Wiedersehen.
Er gab Frau Stöcklein die Hand.
Dann hielt er dem Jungen die Hand hin und sagte freundlich:
Na, junger Mann, kriege ich kein Händchen?
Torsten auf dem Arm seiner Mutter schaute Alfred ängstlich an und schüttelte den Kopf.
Darf ich Ihnen noch etwas Marmelade mitgeben, fragte Moritz, um die Stimmung aufzulockern.
Oh, ja super, sagte Susanne, die ist immer total lecker, echt.
Als der Ducato davonfuhr, stand Moritz vor dem Haus. Er winkte kurz, dann schaute er dem Wagen nach, bis der an der Ampel losgefahren war und rechts abbog. Die Vorstellung, dass Frau Stöcklein nun nicht mehr für ihn sorgen würde, versetzte ihm einen Stich ins Herz. Ein halbes Menschenleben hatte sie zum Haus gehört, sie war ein Teil von ihm geworden im Lauf der Jahre. Gemeinsam mit seiner Frau hatte sie die Alltagssorgen von Moritz ferngehalten, sodass er sich auf seine akademische Karriere konzentrieren konnte. Fuhr er zu einem Kongress oder einer Gastvorlesung, wusste Frau Stöcklein, was in welchen Koffer sollte, es fehlte ihm unterwegs nie an etwas. Während seiner Gastsemester in Berkeley, als Fanny und er für längere Zeit drüben waren, hütete sie hier das Haus. Für einen Winter hatten sie die Haushälterin sogar nach Kalifornien mitgenommen, aber der amerikanische Alltag war ihr fremd geblieben. Die Supermärkte waren zu groß, die Portionen zu üppig, die Wege zu weit, die Töne zu schrill, das Leben zu verschwenderisch. Sie verabscheute Halloween. Und rosafarbene Weihnachten unter Palmen bei Sommertemperaturen? Unmöglich. Sie bekam Heimweh.
Moritz konnte sich nicht erinnern, dass Frau Stöcklein einmal mehr als zwei Wochen Urlaub am Stück genommen hatte. Als seine Frau krank wurde, kümmerte sie sich aufopferungsvoll um sie, ging mit ihr zu den Ärzten und zur Chemotherapie und war schließlich auch an jenem schrecklichen Tag an ihrer Seite, als Fanny plötzlich starb. Das würde er nie vergessen. Und nach Fannys Tod war sie ihm eine große Hilfe. Während er verzweifelte, schier unfähig, seine Tage zu organisieren, war Frau Stöcklein an seiner Seite. Sie erledigte Behördengänge, kümmerte sich um Trauergäste und überließ ihn seinem Schmerz.
Frau Stöcklein lehnte Alfred von Anbeginn ab. Obwohl er sich in den ersten Wochen bemühte, sie von seinem Charme und seinem einnehmenden Wesen zu überzeugen, war sie in der Vergangenheit zu sehr von Fanny gegen ihn beeinflusst worden. Irgendwann war es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Alfred begann, gegen Frau Stöcklein zu stänkern, sie schlechtzumachen, an ihr herumzumäkeln und sie dermaßen überheblich zu behandeln, dass sie schließlich aufgab.
Nun stand Moritz in der Einfahrt und machte sich Vorwürfe, dass er seinen Bruder nicht in die Schranken gewiesen und sich nicht eindeutiger zu Frau Stöcklein bekannt hatte. Sie spürte offenbar keinen Rückhalt mehr und hatte resigniert. Dieses Versäumnis machte ihn traurig. Heute war sie für immer gegangen. Die gute … wie hieß sie noch mal? Gerlinde. Ja. Genau. Gerlinde Stöcklein.
Minuten später rief Norma an und Moritz machte den unverzeihlichen Fehler, vom Weggang der Haushälterin zu berichten. Nur mit Mühe konnte er die Freundin davon abhalten, sofort zu kommen, um den Haushalt zu übernehmen. Sie bot sogar an, bei Bedarf eines ihrer portugiesischen Zimmermädchen auszuleihen, aber Moritz bedankte sich brav: Sein Bruder sei gelernter Junggeselle und hätte bereits jetzt alles im Griff.
Okay, sagte Norma, aber Moritz, wenn was ist …
Versprochen, sagte er.
Soll ich nicht doch …?
Norma! Wir kommen wunderbar zurecht, wirklich. Mach’s gut.
Übrigens, Stella schwärmt immer noch von Alfred. Sag ihm Grüße von ihr. Mach ich, sagte Moritz, tschüs, Norma. Ja, tschüs. Und melde dich, wenn du mich brauchst. Klar. Habt ihr genug zu essen?
4
Moritz saß im Wintergarten und sorgte sich. Er bekam zwar eine stattliche Pension und hatte sein Geld, so glaubte er, einigermaßen sicher hier und in den USA angelegt, aber was war heute noch sicher in Zeiten der Krise? Die Krise! Sie war überall. Im Fernsehen, im Internet, im Radio, auf jeder Seite der Zeitung. Und vor allem in den Köpfen! Hatten sich die normalen Bürger in der Vergangenheit kaum mit Wirtschaft beschäftigt, war nun jeder zum Experten geworden. In den zahllosen Talkshows wimmelte es von ihnen. Vor wenigen Jahren noch waren Hedgefonds, Derivate und Ratings abstrakte Begriffe gewesen, über die man nicht nachdachte. Es gab sie, so wie das Ozonloch, die Rüstungslobby, die Gesundheitskosten oder die Massentierhaltung. Alles war, so wurde dem Volk versichert, komplex, etwas für Fachleute. Moritz sah im Fernsehen Männer in teuren Anzügen und blau-weiß gestreiften Hemden mit weißen Kragen. Die trafen sich in Brüssel oder Frankfurt, verkündeten irgendwelche Prozente. Es wurden aus Millionen Milliarden. Jetzt mussten Schirme aufgespannt werden, denn es gerieten nicht nur Menschen auf die schiefe Bahn, sondern auch Banken und am Ende Staaten. Jetzt schlug die Stunde einer neuen, fiktiven Gewalt: der Terror der Märkte!
Die Märkte, dachte Moritz. Sie waren wie unersättliche Drachen nach Jahren der Harmonie aus der Höhle gekommen und wüteten. Ein Staat nach dem anderen geriet in ihren verheerenden, kochenden Atem. In Nanosekunden machten sie gewaltige Umsätze an den Börsen, Maschinen entschieden jetzt über unser Schicksal. Wer oder was waren diese Märkte? Waren sie nicht unsere Brut? Hatten wir sie nicht an unserem Busen genährt und gehofft, sie zähmen zu können?
Sie entzogen sich den Gesetzen und waren zutiefst unmoralisch. Die alten Fakultäten gab es nicht mehr. Sie waren miteinander verschmolzen. Wirtschaft und Philosophie, Finanzen und Psychologie, Marktwirtschaft und Ethik. Moritz nahm sich vor, den amorphen Zustand unserer Gesellschaft zu analysieren. Darüber war er schließlich eingenickt …
… als er durch ein Klappern aufgeschreckt wurde. Alfred kam mit dem Teewagen durch die Tür.
Teatime, Sir, sagte er launig.
Moritz reckte sich.
Hast du auch Kaffee gemacht?
Kaffee? Du glaubst doch nicht, dass ich auch noch Kaffee koche? Du weißt genau, dass ich mit meinem kranken Herzen keinen Kaffee trinken darf. Außerdem bekommt man Rheuma davon. Das habe ich gerade gelesen.
Mein Herz ist kerngesund. Und Rheuma habe ich schon. Ich brauche meinen Kaffee!
Bitte. Du erinnerst dich sicher noch, wo die Küche ist …
Moritz erhob sich, während Alfred sich setzte.
What a lovely day!, rief er. Bin ich froh, dass die klafte weg ist. Wir schaffen das schon. Wäre doch gelacht!
Moritz ging ohne ein Wort aus der Tür.
Er stand in der großen Küche und wusste nicht, wo er zuerst suchen sollte. Er öffnete ein paar Türen am Küchenschrank und forschte nach der Kaffeedose. Schließlich fand er sie auf dem Sideboard.
Im Eckschrank dann die Kanne und das Filterpapier. Er suchte nach einem Topf, füllte Wasser aus dem Hahn hinein, zündete die Gasflamme an und setzte den Topf auf den Herd. Dann fiel ihm ein, dass sie ja einen elektrischen Wasserkocher besaßen. Moritz nahm den Topf vom Herd und ließ Wasser in den Kocher ein. Dann wartete er, bis es kochte.
Jetzt wurde ihm bewusst, was der Verlust der Haushälterin im alltäglichen Leben bedeutete: putzen, waschen und vor allem kochen. Wenn er das Alfred überließ, gab es von nun an täglich Spaghetti. Vermutlich würden beide in den nächsten Wochen öfter im Café Laumer zum Frühstück auftauchen und könnten sich abends hin und wieder eine Pizza kommen lassen oder eine Dose mit Gemüse aufmachen oder was auftauen, aber schön war das nicht. Das Haus würde langsam verkommen, denn es war nicht damit zu rechnen, dass Alfred je einen Staubsauger bewegen würde, und für ihn selbst war die körperlich anstrengende Hausarbeit Gift. Warum hatte er sich nicht sofort nach Frau Stöckleins Kündigung um eine Haushälterin bemüht? Hatte er am Ende gehofft, sie würde bleiben?
Als er den dampfenden Wasserkocher in der Hand hielt, wurde ihm schlagartig klar, dass es nicht schlecht wäre, zunächst Kaffee in die Filtertüte zu füllen!
Als das Wasser durch den Filter gluckerte und ihm Kaffeeduft in die Nase stieg, dachte er mit einem Mal an glückliche Tage in der Bockenheimer Landstraße, wenn es am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen gegeben hatte. Gerüche waren der beste Katalysator für Erinnerungen.
Moritz war sechzehn, Alfred dreizehn. Sie machten das Riesensonntagsrätsel mit Onkel David und wetteiferten, wer am schnellsten die Lösung hatte. Er war damals nicht schlecht. Es wurde viel gelacht, Onkel David war ein genialer Witzeerzähler. Onkel David! Der Mann der ihnen so nah war und doch auf rätselhafte Weise stets ein wenig fern blieb. Wieso hatte seine Mutter das Geheimnis so lange für sich behalten? Erst nach Davids Tod erfuhren sie die Wahrheit. Nichts war mehr wie vorher.
Der Kaffee war fertig. Moritz nahm die Kanne und ging aus der Küche. Als er in den Wintergarten kam, saß Alfred im Korbsessel und nippte an seinem Tee.
Morgen kaufe ich Nescafé, sagte Moritz.
Er wollte sich einen Keks nehmen, aber dann bemerkte er den Teller.
Was ist das für ein Teller?, fragte er.
Darauf hatte Alfred nur gewartet.
Meißen? Hutschenreuther? Was weiß ich?
Ist er milchig?
Tu mir bitte einen Gefallen und hör auf mit diesem Aberglauben, milchig, fleischig!
Dann zeigte er auf den Keks und näselte wie im Englischkurs:
Is this cookie really kosher?
Alfred nahm provozierend einen Keks und biss hinein. Mit den Krümeln spuckend rief er:
Der Keks schmeckt. Er kann nicht koscher sein!
Du musst ja nicht koscher essen, aber mir gibt es etwas. Dieser Teller ist milchig, sagte Moritz.
Alfred drohte mit dem Finger.
Nein, er ist fleischig! Und es steht geschrieben: Es sollen dir wachsen Schweineohren und Schweinshaxen!
Moritz winkte ab.
Ich werde mich heute nicht streiten.
Sehr schade. Wirklich. Was kann ich tun, damit wir uns ja streiten? Wie wäre es mit dem Thema Fanny Kleefeld, geborene Trindel. Das belgische Kaltblut! Dein treu sorgendes Weib, meine charmefreie Schwägerin.
Moritz lächelte:
Sie hat dich sofort durchschaut.
Alfred grinste frech:
Sie war wie ihr Land: klein, farblos, künstlich gebildet!
Moritz griff zur Zeitung und sagte:
Und wenn du dich auf den Kopf stellst. Du kannst mich nicht provozieren. Wo ist das Feuilleton?
Alfred ließ nicht locker.
Oder der Holocaust. Immer wieder lustig! Ist doch dein Lieblingsthema. Wie wär’s damit?
Er schaute fragend, nahm den Teelöffel, hielt ihn wie ein Mikro und sprach wie ein Reporter:
War Hitler von der Schuld der Juden innerlich überzeugt oder hat er sie nur als Vorwand benutzt? Was meinen Sie, Professor?
Moritz fragte:
Hast du deine Herztabletten genommen?
Gut, dass du das sagst …
Alfred griff in seine Tasche, zog sein Pillendöschen heraus.
Habe ich sie ja genommen, nein genommen? Was weiß ich?
Nimm sie besser.
Alfred nahm eine Tablette.
Plötzlich wirkte er krank und zerbrechlich. Alfred saß vor seinem Laptop, als er ein Scheppern hörte. Er lief in die Küche, wo Moritz auf dem Boden kniete und damit beschäftigt war, in Essig getränkte Scherben eines Gurkenglases vorsichtig zwischen den Gewürzgurken herauszupicken. Alfred schloss mit langem Arm wortlos die Tür des Kühlschranks.
Ich weiß nicht, wie das passiert ist, sagte Moritz zerknirscht.
Ich kann’s dir sagen, es ist runtergefallen.
Ich habe es übersehen. Ich wollte mir ein Joghurt holen.
Alfred ging in die Hocke.
Mein Gott, bist du ungeschickt! Man nimmt die Gurken, tut sie zur Seite und wischt dann alles zusammen.
Man kann sich schneiden.
Du kannst dich schneiden! Komm, lass mich das machen.
Er ging in die Hocke. Moritz erhob sich stöhnend und rieb sich die Knie.
Alfred sah zu ihm hoch:
Ein Mensch soll so blöd sein! Wie kannst du dich auf die Fliesen knien, mit deinem Rheuma? Meschugge. Mach uns lieber ein Brot.
Moritz war froh, dass er etwas tun konnte.
Mit was?
Nicht mit Gurken!
Vorsichtig, um nicht in das Gurkendesaster zu treten, öffnete Moritz den Kühlschrank und entnahm Butter und Scheibenkäse.
Dann ging er zum Küchenschrank, holte ein Brot aus dem Brotkasten und ein Messer aus der Schublade. Auf einem Brett auf dem Küchenblock schnitt er zwei Scheiben ab.
Nicht vergessen: milchiger Teller, sagte Alfred, während er zum Besenschrank ging, um Schaufel und Handfeger zu holen.
Du chochem, deine ejzes fehlen mir noch, sagte Moritz.
Für Mai war es relativ kühl und Alfred hatte die Heizung in seinem Zimmer etwas hochgedreht. Er surfte im Internet. Fast täglich suchte er nach seinem Namen, aber die Einträge vermehrten sich nicht. Auf der IMDb-Seite stand seine Filmografie, sie endete mit einem Film aus dem Jahr 2008. Ein italienischer Mehrteiler fürs Fernsehen mit dem Titel »Fluch der Vergangenheit«. Auch so ein Meisterwerk!
Darin spielte er wieder einmal einen Untoten, einen toskanischen Edelmann, der von den Schergen Garibaldis im Keller lebendig eingemauert worden war und der plötzlich in der heutigen Zeit auftaucht, um sich an den Nachkommen seiner Feinde zu rächen. Darunter ist natürlich, wie konnte es anders sein, auch eine verdammt gut aussehende junge Frau, die ihn schließlich zur Strecke bringt, weil sie Liebe heuchelt. Beim Showdown stößt sie ihn in einen riesigen Bottich mit Olivenöl, in dem er qualvoll ertrinkt. Ein Stunt, den er gern selbst gemacht hätte, aber die Versicherung war nicht bereit, das zu akzeptieren. Was letztendlich allerdings auch keine Rolle mehr spielte: Es war ein lausiges Drehbuch und daher konnte kein guter Film entstehen.
In den folgenden Jahren war Alfred bei diversen Castings. Überall wurde ihm gesagt, dass er ein toller Typ sei, nur nicht so richtig in die Rolle passen würde. Die Leute waren zu feige, ihm einfach zu sagen: He, verzieh dich, kauf dir eine Schnabeltasse! Obwohl er das genau wusste, wollte er es nicht glauben. Wie viele ältere Schauspieler gab es, die noch erfolgreich waren und gut im Geschäft? Clinty zum Beispiel, mit dem er in den Sechzigern Italowestern gedreht hatte, war zum Superstar geworden. Ein reicher Produzent und begnadeter Regisseur. Aber heute war an ihn nicht mehr ranzukommen. Vor ein paar Jahren hatte Alfred ihm geschrieben, ihn an die guten, alten, gemeinsamen Zeiten erinnert, an die verrückten Partys, und hatte beiläufig erwähnt, dass er sich über einen kleinen Job in einem seiner Filme freuen würde. Zurück kam ein Autogramm:
»Loving you, Clint Eastwood«. Das war’s.
Gegen Abend schaute Alfred bei seinem Bruder rein, um ihn zu fragen, ob er denn was kochen sollte. Zum Beispiel Spaghetti mit einer pikanten Sahnesoße. Moritz hatte Besuch von einem seiner ewigen Studenten, einem gewissen Maik Lenze.
Maik! Das hatten uns die Ossis eingebrockt, dachte Alfred. Die wollten hip sein und hatten keine Ahnung von Orthografie. Eltern wissen offenbar nicht, was sie ihren Kindern mit überchochmezten und fehlerhaften Vornamen wie Marcell, Timm, Devid, Mendy oder Shantall antun. Besagter Maik Lenze hatte seit Jahren die Absicht, ein Dr. Maik Lenze zu werden, und Moritz half ihm dabei mit Engelsgeduld. Der Student kam mindestens einmal in der Woche vorbei, um mit dem von ihm hochverehrten Professor Kleefeld seine Ergüsse zu diskutieren. Oft hatte er sie ihm schon vorab per Mail geschickt und so war Moritz vorbereitet. Einmal konnte Alfred den Titel von Maiks Dissertation lesen und der Respekt vor seinem Bruder wuchs von Stund an: Soziologische Untersuchung der technisch-wissenschaftlichen und psychologischen Ausrichtungen und Gegebenheiten in der Institutionalisierung und Organisation der ambulanten Palliativversorgung. Donnerwetter, da musste man erst mal drauf kommen.
Als Maik schließlich gegangen war, gab es Spaghetti mit Sahnesoße, die niemand so lecker zubereiten konnte wie Alfred, der alte Römer.
Seitdem sie mehr als eintausend TV-Sender empfangen konnten, waren sie überfordert. Bereits drei Mal war Tom, der Gymnasiast von nebenan, gekommen, um ihnen die Fernbedienung, die Favoritenliste und weitere Geheimnisse zu erklären, aber immer wieder verstellten sie die programmierten Einstellungen. Natürlich schob jeder das Missgeschick auf den anderen:
Ich habe das Ding nicht berührt!
Du hast es zuletzt in der Hand gehabt!
Ich?
Ja, du!
Dir ist es doch runtergefallen, nicht mir.
Runtergefallen? Es ist auf den Teppich gerutscht. Was soll da passieren?
Diese Dinger sind empfindlich.
Nicht so wie du!
Wir müssen Tom rufen.
Als sie an jenem Abend wieder einmal vor einem toten Bildschirm saßen, sagte Moritz plötzlich:
Wir brauchen jemanden.
Finde ich nicht. Wir kommen doch ganz gut zurecht.
Ja, wenn man nicht putzt und nichts macht, läuft es ganz gut, das stimmt, sagte Moritz bissig.
Okay, eine Putzfrau, das sehe ich ein.
Nein, ich will jemanden haben, der kocht, wäscht, putzt und sich kümmert. Wie die Stöcklein eben.
Ah, ich koche dir nicht gut genug.
Freddy, meinte da Moritz fast liebevoll, du kochst ausgezeichnet, aber du kannst nur ein einziges Gericht!
Alfred erhob sich.
Sie irren, Majestät, aber da du auf deinem koscheren Fraß bestehst, sind mir die Hände gebunden. Es gibt großartige Fleischgerichte mit Crème fraîche oder Käse oder was weiß ich. Aber solange du nicht ablässt von deiner exzellenten »cuisine juive« …
Dabei küsste Alfred verzückt seine Fingerspitzen und sprach dann weiter:
Es gibt keine Religion mit so vielen Hinweisen, Rezepten und Speisegesetzen und einer so miserablen Küche!
Moritz musste grinsen.
Das war nicht schlecht, kleiner Bruder.
Am nächsten Morgen frühstückten sie im Laumer. Sie saßen an ihrem Stammtisch, hinten im Nebenraum, an der Tür zur Terrasse.
Linda, die unverdrossene Kellnerin, hatte von Moritz einen koscheren Teller in Empfang genommen. Alfred saß hinter der Zeitung versteckt.
Es war ihm peinlich, dass der verrückte Professor sein Geschirr mit ins Café brachte! Auch andere Gäste schauten befremdet. Einmal hatte einer die Kellnerin darauf aufmerksam gemacht, dass der Alte in der Ecke das Besteck geklaut hätte, er habe gesehen, wie Messer, Gabel und Teelöffel in seiner Anzugjacke verschwunden waren. Linda hatte den Mann aufgeklärt und der konnte nur ungläubig den Kopf schütteln. Dass es so was gab. Heute. Wo wir mit Smartphones telefonieren, online einchecken und Drohnen fliegen lassen. Genauso empfand es auch Alfred, aber er hatte es aufgegeben, seinen Bruder von diesen archaischen Ritualen abhalten zu wollen. Anfangs hatte er versucht, ihm klarzumachen, dass der Teller in dieser nicht koscheren Umgebung ebenfalls nicht koscher sein konnte, aber Moritz hatte sich eine abstruse Theorie zurechtgelegt, von der er nicht abließ.
Soll er doch seinen verschissenen Teller überallhin mitnehmen, dachte Alfred. Besser als einen Stoffschimpansen als Gesprächspartner dabeizuhaben, wie Fritz Lang in seinen letzten Jahren.
Die Kleefelds aßen Butterbrötchen und zwei Eier im Glas. Moritz mit, Alfred ohne Schnittlauch. Dazu Tee und Kaffee. Im Laumer gab es keinen Streit um die Zeitung, jeder hatte seine Frankfurter Allgemeine. Manchmal blätterte Alfred auch in der Gala oder der Bunten und erzählte Moritz Geschichten von seinen Begegnungen mit einigen Prominenten, die er auf Fotos aus Hollywood oder Cannes entdeckt hatte. Sein Bruder hörte sich das brav an. Aber es interessierte ihn nicht. Wenn Moritz dann mal eine abfällige Bemerkung machte, wie »Es gibt Wichtigeres«, konnte es leicht zur Auseinandersetzung kommen. Schließlich, so argumentierte Alfred, müsse er sich informieren, wer was macht, denn vielleicht gäbe es ein Filmprojekt, wo genau ein Schauspieler wie er gefragt war. Dem wollte Moritz nicht widersprechen, im Gegenteil, es hätte ihn froh gemacht, wenn Alfred mal wieder einen Job gehabt hätte. Das würde seinem Ego guttun.
5
»Niveauvolle Hausdame gesucht. 2 gutsit. Herren su. ab sof. versierte Haushälterin. Leichte Tätigkeit in Villa, Westend, hübsch. sep. Wohng., Verpflg. inkl., gute Bezahlg., Sa. Nachm. u. So. frei. Chiffre Nr. …«
So sah die Annonce aus, die Alfred über den Tresen schob. Die junge Frau in der Anzeigenannahme fühlte sich gestört und sah Alfred missmutig an.
Guten Tag, sagte er freundlich.
Keine Reaktion. Die Frau sah sich den Text emotionslos an.
Soll das so bleiben?
Haben Sie einen besseren Vorschlag?
Wir könnten die Hausdame fetter machen.
Okay, meinetwegen, machen Sie sie fetter.
Wie oft soll das Inserat erscheinen?
Ich würde es gern mit einem Mal versuchen, in der nächsten Wochenendausgabe.
Holen Sie die eingehende Post ab oder sollen wir die zuschicken?
Bitte zuschicken.
Das macht dann 42 Euro.
Alfred bezahlte.
Vielen Dank.
Die Frau schwieg.
Als er vor die Tür trat, in den kühlen aber sonnigen Mai, musste er plötzlich an David denken. Was hätte der dieser unfreundlichen Annoncentante erzählt?
Er hätte sie zuerst gefragt:
Sagen Sie, foltert man Sie heimlich im Keller, damit Sie hier arbeiten?
Da hätte sie schon mal doof geguckt.
Glauben Sie nicht, dass ein Lächeln helfen könnte, den Kunden froh zu stimmen? Frohe Kunden kaufen mehr. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht.
Und schon hätte er hinter dem Tresen gesessen. Sprechen Sie Leute immer mit dem Namen an, hätte er ihr geraten, das schafft Vertrauen. David hätte am Ende eine große Anzeige mit Foto und Rand und einem unwiderstehlichen Text zusammengestellt für 420 Euro und der Kunde wäre glücklich gewesen.
So ging er los. Diese Tussi würde ihm nicht den Tag verderben.
Er war sommerlich gekleidet, ein wenig dandyhaft. Mit Ray-Ban-Brille und seidenem Tuch, um den Hals zu kaschieren. Er schaute zwei jungen Mädchen nach, die in fast durchsichtigen Kleidchen an ihm vorbeistöckelten.
Als er in die Fressgasse einbog, die nur wegen der Fressgeschäfte, die es dort von jeher gab, so genannt wurde, überkam ihn ein nostalgisches Gefühl. Es war Frühling, die Sonne schien. Stühle, Tische und Sonnenschirme standen vor den Restaurants und Cafés. Er kannte diese Straße schon, als es noch keine Fußgängerzone gab, als er hier die Welt aus Davids Wohnzimmerfenster im ersten Stock über Feinkost Plöger beobachten konnte. Als Autos, Motorräder mit Seitenwagen, Brauereikutschen und Handkarren durch die Straße fuhren. Als kräftige Männer mit Lederlappen auf den