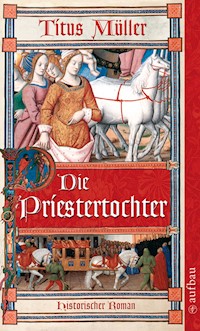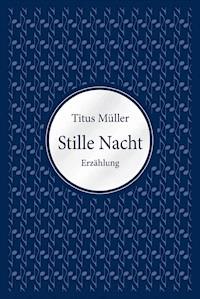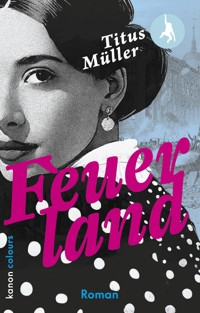5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Basel 1348: Auf einen Schlag verliert die Jüdin Saphira ihren Beruf, ihre Familie, ihre Heimat. „Bringe dieses Kästchen zum König“, flüstert der Vater ihr vor seinem Tod zu. Doch die junge Frau wird von mächtigen Feinden gejagt. Es sind dunkle Jahre – die Pest wütet in der stolzen Stadt, und deren Bürger richten ihren Zorn gegen die jüdische Minderheit. Aber eines haben Saphiras Verfolger nicht bedacht: Zwei Männer sind unsterblich in sie verliebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Saphira ist eine glückliche junge Frau. Die Tochter des jüdischen Geldverleihers Simon-ben-Levi lebt als Federhändlerin im mittelalterlichen Basel. Ihr Herz gehörte dem Ritter Thomas von Bärenfels, von allen Tam genannt, der allerdings etwas schüchtern ist. Das wiederum kann man von seinem besten Freund Christian Münch nicht behaupten, der ein Frauenheld und Draufgänger ist. Christian missbraucht das Vertrauen seines gutmütigen Freundes und verführt die bildhübsche Saphira. Diese stellt bald fest, dass sie von ihm schwanger geworden ist. Ausgerechnet da bricht über Basel die Pest herein, und Tams Vater, der Anführer des sogenannten Psitticherbundes, zettelt eine Verschwörung gegen die Juden an, die als Sündenböcke des Unglücks der Stadt dienen. Eines der ersten Opfer ist Saphiras Vater, Simon-ben-Levi, der seiner Tochter im Tod ein folgenschweres Versprechen abringt …
Titus Müller hat seinen Bestsellerroman, der zuerst 2005 erschien, für diese Ausgabe behutsam überarbeitet.
Der Autor
Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, studierte in Berlin Literatur, Geschichtswissenschaft und Publizistik. 1998 gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt. 2002 veröffentlichte er, 24 Jahre jung, seinen ersten Roman: Der Kalligraph des Bischofs. Es folgten weitere historische Romane wie Die Brillenmacherin (2005). Titus Müller wurde mit dem C. S. Lewis-Preis und dem Sir Walter Scott-Preis ausgezeichnet. 2011 erschien im Blessing Verlag sein Roman über den Untergang der Titanic: Tanz unter Sternen. Für den Roman Nachtauge (Blessing, 2013) wurde Titus Müller 2014 im Rahmen einer Histo-Couch-Umfrage zum Histo-König des Jahres gewählt. 2015 veröffentlichte er den Roman über die 1848er Revolution: Berlin Feuerland (Blessing Verlag).
TITUS MÜLLER
Die Todgeweihte
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Vollständige deutsche Taschehaunbucsgabe 10/2015
Copyright © 2005 der Originalausgabe by Titus Müller/Aufbau Verlag
Copyright © 2015 dieser überarbeiteten Ausgabe Heyne Verlag, Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagabbildung: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von akg images und shutterstock.com; U2, U3 (Hothum, Norman »Landkarte Basel« © VG Bild-Kunst, Bonn 2016).Karte von Basel: Norman Hothum
Satz: im Verlag
ISBN: 978-3-641-16624-3V003
www.heyne.de
Erster TeilSommer 1348
1
Jedes Wort der Briefe kannte Saphira auswendig. Sie zog das Bündel unter ihrem Kopfkissen hervor. Küsste es. »Guten Morgen, Liebster. Guten Morgen, Tam.« Wieder hatte sie von ihm geträumt. Es half, wenn die Briefe unter dem Kopfkissen lagen. Die Erinnerungen an den Traum flatterten wie samtweiche Falter durch ihren Kopf: Umarmungen, Geständnisse, Blicke. Am Ende der lange Kuss. Nie hatten sie sich bisher geküsst. Würde es sein wie im Traum? Sie spürte immer noch seine Lippen auf ihrem Mund, obwohl es doch gar nicht wirklich geschehen war.
Sie seufzte. Noch im Bett sprach sie das Morgengebet: »Ich danke dir, lebender König, dass du mir voller Erbarmen meine Seele zurückgegeben hast, denn deine Treue ist groß.« Sie stand auf. Die Sonnenflecken wärmten ihre Füße. An den Fußsohlen blieben Sandkörnchen und kleine Steine haften, sie hatte ihr Zimmer lange nicht gefegt. Der Krug und die Schüssel standen bereit. Dreimal übergoss sie sich die rechte, dreimal die linke Hand mit Wasser.
Es roch nach angebranntem Haferbrei. Vater hatte sich das Frühstück selbst gerichtet. Er achtete den Glauben der Christen und verbot den Mägden, am Sonntag zu arbeiten. Saphira hatte ihm schon ein Dutzend Mal erklärt, dass die Christen ihren Ruhetag nicht so streng handhabten wie die Juden, aber er antwortete stets, sie versuchten auf ihre Weise Gott zu ehren, und es sei seine Pflicht, das zu würdigen. Wie sonst solle er erwarten, dass die Christen auch ihm das Ausleben seines Glaubens ermöglichten? Ein alter Jude, der sich Haferbrei kochte. Er gelang ihm selten.
Saphira lauschte. Das Haus war still. Vater war schon zur Synagoge gegangen, um im Minjan zu beten, im Kreis der zehn Männer. Sie zog sich an, griff das gefaltete Leinentuch und sprang die Treppe hinab. Heute würde sie Tam sehen.
In der Küche kostete sie vom Haferbrei. Der Vater hatte ihn nicht nur anbrennen lassen, er hatte ihn außerdem noch versalzen. Es kostete Überwindung, den Holzlöffel abzulecken. Wie konnte ein kluger Geschäftsmann in der Küche ein solcher Tollpatsch sein? Sei’s drum. Hunger hatte sie sowieso nicht. Die Vorfreude füllte ihren Bauch.
Sie schlüpfte an der Haustür in ihre Holzschuhe. Als sie nach draußen trat, kreischte die Tür in den Angeln. Gedankenverloren berührte Saphira die Mesusa am Türpfosten, die kleine Tora-Abschrift, die so gefaltet war, dass das Wort Schadai zu sehen war: Allmächtiger. Im Schritt auf die Straße führte sie die Hand an die Lippen, wie es das Gesetz befahl.
Es war noch kühl. Saphira liebte diese Stunde. Die Nachtwächter brachten die Pfandstücke ins Zunfthaus, die sie den Säufern für Lärmschlagen und Prügeleien abgenommen hatten: Mützen, Ringe, Gürtel. In den Ritterhöfen entlang der Stadtmauer schöpften die Dienstmägde Wasser, die Brunnenwinden quietschten. Hühner und Ziegen, Hunde und Tauben erwachten.
Niemand achtete darauf, ob eine Jüdin den blaugestreiften Schleier trug. Noch hockten die geschwätzigen alten Weiber nicht hinter ihren Fenstern. Saphira war in dieser Stunde eine Bürgerin der stolzen Stadt Basel, eine Federhändlerin, jung und frei.
An der Ecke knarrte die Mühle. Der Bach, der entlang der Trennmauer die Gasse hinabfloss, führte wenig Wasser. Wenn es mittags wieder so heiß wurde und das noch ein paar Tage lang, würde das Mühlrad irgendwann stocken. Dann mussten sie alle zur Klingenthalmühle pilgern, um ihr Getreide gemahlen zu bekommen.
Sie folgte der Grünpfahlgasse hinunter zum Rindermarkt. Die Holzschuhe klapperten auf dem Pflaster und klatschten bei jedem Schritt gegen ihre Fersen. Ob sich Vater gerade vor dem Toraschrank der Synagoge verbeugte? Am prachtvollen Synagogenhaus blieb sie stehen. Gesang drang durch die Mauern: Der Herr der Welt, er hat regiert, eh’ ein Gebild geschaffen war.
Die Kanalputzer arbeiteten heute nicht. Man roch den Birsigkanal bis hier oben, der Gestank von Abfällen und Unrat war beißend. Eine Schande, dass an diesem fauligen Ufer Menschen leben mussten. Auch Juden wohnten dort, arme Familien, die sich kein Steinhaus leisten konnten. Sie waren tagein tagaus dem Pfeifen der Ratten und dem stechenden Geruch des Birsigs ausgesetzt und starben früh. Niemand wurde alt am Kanal.
Bei der Tränke vor der Synagoge hockte ein Krüppel. Krücken lehnten neben ihm. Ein Ritter beugte sich zu ihm hinunter, sein Schwert berührte fast den Boden, ein großes Schwert und ein großer Mann. Das Prunkgewand für die heutige Bürgermeisterwahl, einen roten Waffenrock mit dem Stern im Wappen, hatte er bereits angelegt. Das war ein Sterner, einer der Ritter, die sich in der Trinkstube »Zum Seufzen« versammelten und die Habsburger unterstützten. So zeitig war er auf den Beinen? Saphira hatte kein Geld und keinen Brotkanten bei sich, gut, dass der hohe Herr sich um den Krüppel kümmerte.
Aber warum redete er so lange mit ihm? Für gewöhnlich warfen die Menschen im Vorbeigehen eine kleine Münze ab. Sie sahen die Bettler kaum an, geschweige denn, dass sie mit ihnen sprachen. Hatte er nicht – er hatte die Hand an der Kehle des Alten! Saphira wich zurück. Sie drückte sich gegen die Wand der Synagoge. Wenn sie fortlief, würde der Ritter ihre Holzschuhe klappern hören. Warum war er nicht längst hochgeschreckt von ihren Schritten? Leise schlüpfte sie aus den Schuhen und bückte sich, um sie aufzuheben.
Der Krüppel zappelte an der Hand des Ritters, er wurde von ihm hochgehoben. Sein Gesicht verfärbte sich. Er begann wild zu nicken und röchelte unverständliche Worte. Der Ritter ließ ihn los. Hart fiel er zu Boden. Während der Misshandelte sich aufrappelte, fasste sich der Ritter an den Gürtel. Gold blinkte auf.
Er gab dem Krüppel einen Goldgulden! Niemand verschenkte so viel Geld. Bettler bekamen Pfennige. Rheinische Gulden wurden gebraucht, um Jahreslöhne auszuzahlen. Schweigegeld, schoss es ihr durch den Kopf. Erst hatte er ihn bedroht, jetzt gab er ihm Schweigegeld. Sie umklammerte ihre Holzschuhe und wagte nicht, sich zu rühren.
Der Bettler zog die Krücken heran und richtete sich auf. Er machte eine Geste mit der rechten Krücke. Rasch drehte der Ritter sich um.
Saphira schrak zusammen. Das kantige Gesicht Ramsteins!
»Was tust du hier, Weib?«, fragte er barsch.
»Ich gehe zur Mikwe, um mich unterzutauchen.«
»Ein Bad? So früh am Morgen?« Er trat auf sie zu, langsam, drohend.
Wie zum Beweis hielt sie ihm das Leinentuch entgegen. »Es … ist ein rituelles Tauchbad. Jüdische Frauen müssen sich nach der Monatsblutung reinigen.«
»Jüdin, und ohne Schleier.« Nun stand er dicht vor ihr. Sie musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu sehen. Der Ritter fragte: »Weißt du, wer ich bin?«
Ramstein, rechte Hand des Sternerführers und Bürgermeisters Münch, ein Mann, der nie auch nur einen Blick auf Bettler warf. »Ein Ritter, der einem armen Krüppel ein Almosen gegeben hat«, wisperte sie.
»Du bist eine kluge Frau.« Er wies auf die Mikwe. »Geh, nimm dein Bad.«
Zitternd schlich sie zur Tür. Der Ritter und der Krüppel standen da, ohne sich zu rühren. Gern hätte sie die Mikwe hinter sich geschlossen, aber sie musste zuerst eine Talglampe entzünden, es gab hier keine Fenster. Feuerstein und Stahl klickten. Endlich Licht. Sie zog die Tür zu.
Ramstein würde nicht wagen, in das jüdische Bad einzudringen. Das konnte er nicht tun, ohne den Zorn der Juden auf sich zu ziehen. Saphira stellte die Schuhe ab und ging mit der Lampe die Wendeltreppe hinunter. Schritt für Schritt ertasteten ihre Füße die kalten Steine. Das Becken befand sich tief im Erdreich, tiefer, als die Keller der Christen reichten, bei einer Quelle. Still war es in der Mikwe. Kalt.
Unten angekommen, entzündete sie weitere Lampen. Dann entkleidete sie sich. Sie fror, an den Armen und am Bauch bekam sie Gänsehaut. Eigentlich mochte sie das rituelle Reinigungsbad. Sie fühlte sich immer wie neugeboren, wenn sie aus dem eisigen Quellwasser stieg. Heute aber fürchtete sie sich. Was, wenn er ihr doch folgte? Auch ein Ramstein konnte nicht auf dem Rindermarkt vor den Fenstern der Bürgerhäuser töten. In der Mikwe waren sie ungestört. Niemand würde sie schreien hören. Hatte er sie deshalb losgeschickt?
Sie stieg in das Becken. Das Verlangen, aus dem vor Kälte beißenden Wasser wieder herauszuspringen, überwand sie mit der Übung der vergangenen Jahre. Als sie bis zum Bauch im Becken stand, hielt sie die Luft an, hockte sich nieder und verharrte mit dem Kopf unter Wasser. Dann tauchte sie auf und schöpfte zitternd Atem. Die Regel war, zweimal unterzutauchen, um sicherzugehen, dass wirklich jedes Haar und jeder Fetzen Haut benetzt waren.
Sie ging erneut in die Hocke. Mit Eisfingern versuchte die Kälte, ihren Schädel zu knacken. Keuchend tauchte Saphira auf. Befolgte sie denn die Regeln sonst so streng? Den Gesetzen gemäß hätte sie das Bad bereits gestern Nacht nehmen müssen, nachdem die sieben reinen Tage vorüber waren, Tage, an denen sie mit einem Stoffstreifen keinen Blutstropfen mehr entdecken konnte. Nach den Gesetzen musste sie sich überhaupt nicht untertauchen als unverheiratete Frau. Sie tat es ihrem Vater zuliebe und – ihr Herz schlug schneller, als sie sich das eingestand – weil sie hoffte, dass Tam sie einmal zärtlich umarmte, sie streichelte, dass sie sich küssten, sich entkleideten und ihre Körper fühlten, warm und weich. Konnte es nicht geschehen, dass sie die Beherrschung verloren und miteinander schliefen? Natürlich wäre es eine Sünde, eine abscheuliche Sünde, aber die Menschen waren schwach.
Ihre Beine wurden taub. Sie stieg aus dem Wasser und rieb sich trocken. »Vergib mir diese Gedanken, Adonai.« Das Leinentuch kratzte über die Haut. Um sich zur Ordnung zu rufen, strich sie besonders hart und gründlich darüber. »Es ist natürlich Unfug. Er ist Christ, ich bin Jüdin. Wir teilen nicht das Bettlager.«
Sie zog sich an. Das Kleid saß wohltuend fest an ihrem Leib. Vom kalten Wasser war ihr warm geworden. Eines nach dem anderen blies sie die Lichter aus und nahm das letzte in die Hand. Sie drehte sich auf der untersten Treppenstufe noch einmal um. Das nasse Tuch hatte sie vergessen. Sie trat an das Becken heran und hob das Leinentuch auf.
Ein Schaudern legte sich auf ihren Nacken. Langsam richtete sie sich auf. Sie hielt den Atem an. Die Wasserfläche im Becken –
Das Wasser kräuselte sich und schlug kreisförmige Wellen. In die Stille hinein grollte der Felsen. Es hörte sich an, als wütete ein Untier im Boden. Bis zu den Knien bebte es, und im Bauch setzte sich das Grollen fort.
Saphira schrie. Sie rannte zur Treppe, hastete die Stufen hinauf. In ihrer Vorstellung sah sie einen Drachenkopf aus dem Wasser tauchen, gefolgt von einem langen Hals. Der Kopf stieß vor und jagte ihr nach auf der Treppe, den schlangenhaften Hals hinter sich herreißend. Sie stieß gegen die Wand. Das Licht erlosch. Wimmernd tastete sie sich in der Dunkelheit vorwärts.
2
Wo die Landwege zu den Walliser und Bündner Alpenpässen den Rhein überquerten, gleich an der Straße, die durch die Burgunder Pforte ins Rhônetal führt, lag die Stadt Basel. Der Fluss schnitt mitten durch sie hindurch. Auf dem einen Ufer erhob sich Großbasel, am anderen Ufer kümmerte eine Neugründung dahin, die von den Großbaslern belächelt wurde, Minderbasel genannt. Beide Teile zusammengenommen aber waren nichts als ein großer bewohnter Bauplatz.
Aus den Wäldern fuhr man Holz heran. Lastkähne schleppten Fracht von Steinbrüchen, Lehmgruben und Ziegeleien herbei. Längst konnte die Stadtmauer das Wuchern nicht mehr aufhalten. Entlang der Ausfallstraßen wurden Häuser errichtet. Vom Kreuztor nach draußen zum Dominikanerkloster hin wuchsen Läden, Werkstätten und Hütten. Hinter dem Spalentor spross ein neues Stadtviertel zum Kloster der Gnadenthaler Nonnen, dort wagte man sogar, eine Vorstadtmauer mit eigenem Tor zu errichten. Auch aus dem Aeschentor strömten die Zimmerer und Bauleute der Spinnwetternzunft.
Die Einwohner legten rings um die Vorstädte Gärten, Äcker, Wiesen und Weinberge an. Sie hackten die harte Scholle, bis sie in kleine Stücke zerbrach. Gräser rupften sie aus. Sie gruben und säten und schleppten Wasser vom Brunnen heran. Andernorts klopften und hämmerten die Basler, sägten Holz zurecht, hobelten, bis sie knöcheltief in Spänen standen. Sie arbeiteten, als gelte es ihr Leben. Nur einmal im Jahr ließen sie die Werkzeuge liegen. Einmal im Jahr feierten sie ihr Fortkommen: am Tag der Bürgermeisterwahl.
Der 22. Juni 1348 war ein solcher großer Tag. Die Sonne stieg über Strohdächern und Holzschindeln auf, weckte die Ritter in ihren Häusern entlang der Stadtmauer auf dem Petersberg, Nadelberg, Heuberg, lockte Handwerker, Domherren, Leutpriester und Kapläne, Augustinermönche und Johanniter auf die Straße.
In den Gottesdiensten wurde getuschelt. Wen würden Kaufleute, Ritter und Domherren zum Bürgermeister vorschlagen? Wen würde daraufhin der Bischof auswählen? Die Tore der Kirchen brachen auf und entließen das Volk. Schon begann das Drängeln, Rennen, Stoßen.
Nur unter dem wuchtigen Salzturm am Rhein hielt sich die Morgenruhe. Dort warteten die Möwen auf Abfälle der Fischer. Auf schwarzen Steinen saßen sie am Ufer, weiße Tupfer, die ein Maler gekonnt platziert hatte, und sahen zum Wasser hin. Dann und wann lüpfte eine den Flügel und wendete den Kopf.
Heute gab es nichts für die Möwen. Die Fischer hatten sich mit den Fährleuten zusammengetan, um mit einem Schwarm von Booten Menschen aus Minderbasel zum Großbasler Ufer überzusetzen. Die Brücke war bald überfüllt, gegen Zahlung einiger Pfennige kam man mit Ruderschlägen schneller über den Rhein. Und Eile war geraten.
Siebentausend Stadtbewohner drängten zum Münsterplatz. Sie verstopften die angrenzenden Straßen, lärmten, schoben hierhin und dorthin. Auf dem Platz zwangen Schergen die Menge auseinander, um Boden für einen Tjost zu schaffen. Sie stellten Pfosten auf, spannten Tücher dazwischen.
Schnurmacher und Schneider drängten sich um Stände mit geschmorten Innereien. Sie trugen Hemden aus feinstem Brennnesselstoff, jeder sah es, er war glatter als Leinen und weicher als Seide. Man beneidete sie, man fasste heimlich nach einem Hemdzipfel, um den zarten Stoff zu befühlen. Die ärmeren Handwerker – Hausfeurer, Töpfer und Sattler in schlichten wollenen Überwürfen – ballten sich am Münster, der Basilika von rotem Sandstein, hinter der der Platz in steilen Klippen zum Rhein abfiel. Sie staunten nicht über die Strebepfeiler und Blendarkaden des Münsters, über die reichen Kapitelle und Friese. Heute gab es andere Genüsse für Auge und Ohr.
Seiltänzer balancierten hoch über der Menschenmenge eine Schubkarre. Sie riefen nach einem Freiwilligen, der bereit war, sich in die Schubkarre zu setzen. Wie grauste es dem Volk, wie genoss es das Schaudern! Narren schlugen Purzelbäume vor dem Münsterportal. Brennende Fackeln wurden in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Gauner verdoppelten durch einen Zauber Geldstücke – und ließen sie zum Bedauern der Spender kurz darauf durch ein kleines »Missgeschick« verschwinden.
Die Basler Stadtpfeifer spielten auf. Der Rat ließ Krapfen in die Menge werfen. Die Glückshafen-Lotterey verkaufte Lose und den Traum vom großen Goldgewinn. Basel feierte.
Da der Tjost pünktlich zur Mittagsstunde beginnen sollte, füllte sich die Tribüne bald mit den hohen Herrschaften der Stadt. Safranzünftler saßen neben Ehegattinnen reicher Weinhändler, Ritter nahmen Platz, Ratsherren und feine Damen. Als alle Reihen besetzt waren, verkündete der Herold des Bischofs das Wahlergebnis: Konrad von Bärenfels war der neue Bürgermeister. Das Volk jubelte. In der obersten Reihe der Tribüne stand der Bejubelte auf. Lächelte er? Die Falten um die Augen schienen das zu sagen, aber der Mund war so tief im Bart verborgen, dass man sich nicht sicher sein konnte. Zumindest hob er die Arme und winkte der Menge zu. Das Kettenhemd des Ritters klirrte dabei, und am Prunkgewand blinkten Goldfäden.
Etwas weiter unten in der Tribüne warfen sich zwei junge Männer vielsagende Blicke zu. Sie hätten Rivalen sein müssen, Todfeinde. Einen der beiden Männer nannte man Tam, schottisch für Thomas, obwohl er nicht Schotte, sondern Basler war. Der Name hing an ihm seit Kindheitstagen wie eine Klette und ließ sich nicht abschütteln. Tams langgezogenes, knochiges Gesicht passte nicht recht zu den buschigen Brauen, die er vom Vater geerbt hatte, und den grauen Wolfsaugen. Er hätte einen guten Kanzleigehilfen abgegeben. Keinen Ritter jedenfalls. Keinen Sohn des winkenden neuen Bürgermeisters. Vielleicht zog er deshalb eine Grimasse und brachte den anderen damit zum Lachen.
Der Lachende hieß Christian Münch. Sein Vater hatte bis zum heutigen Tag Basel regiert. Christian war füllig, ein lockiger Rotschopf mit Sommersprossen. Ein Sieger. Er sprühte vor Lebenskraft und Selbstsicherheit. »Sie werden es nie begreifen«, stöhnte er. »Dieses ganze Wahlspielchen, ich meine: Durchschauen die das nicht?«
Tam grinste. »Hauptsache, sie jubeln. Die hätten sich auch gefreut, wenn man ihnen einen abgeranzten Bettler zum Bürgermeister gegeben hätte.«
»Stell dir das mal vor, wie ein Habenichts statt deines Vaters da oben auf der Tribüne steht und der Menge zuwinkt. Fliegen umkreisen seinen Kopf – sie jubeln. Unrat purzelt ihm aus der Tasche – sie feiern.«
»Oder einen Kanalputzer, man könnte ihnen mal einen Kanalputzer als Bürgermeister vorsetzen!«
»Oder einen Juden!« Christian prustete. »Siehst du den da hinten mit den Schläfenlocken und dem gelben Judenhut? Dem würden sie auch zujubeln.«
Tam wurde ernst.
Christian sagte: »Oder einem Köhler. Die Kleider, die nach Rauch stinken, das schmutzige Gesicht, stell dir das mal vor!«
Aber Tam war nicht mehr nach Lachen zumute. Er begann wieder die Suche unter den Gesichtern auf dem Münsterplatz. Sie musste doch wissen, dass er auf der Tribüne saß! Also würde sie sich nicht hinter ihr aufhalten, sondern dort, wo er sie erblicken konnte.
Christian stieß ihn an. »Schau mal, die hatte ich letzte Nacht. Siehst du sie? Die mit den schwarzen Haaren.«
»Sie hat ein Kind auf dem Arm!«
»Das ist nicht ihres. Vielleicht die kleine Schwester. Was weiß denn ich! Aber hübsch ist sie, oder?«
Widerwillig nickte Tam.
»Und dort, die sich da an den Obststand lehnt! Gut, kein Vergleich mit der Schwarzhaarigen, aber …«
Tam stöhnte. »Du bist besessen, Christian.«
»Und du bist neidisch.«
»Unfug.« Er war nicht neidisch. Wie konnte Christian sich mit solchen Frauen abgeben? Die Frau am Obststand aß einen Apfel. Aber wie sie das tat! Zuerst biss sie Stück für Stück die obere Hälfte herunter und kaute. Dann riss sie mit den Zähnen den Stiel heraus und spuckte ihn fort. Schließlich zerbrach sie den restlichen Apfel mit den Zähnen und schluckte ihn herunter. Er konnte sich nicht vorstellen, was Christian an diesem derben Weib fand. Dazu die Flatterhaftigkeit, sich jeden Tag für eine andere zu begeistern! Für ihn gab es nur Saphira. Saphira bewunderte er, von Saphira träumte er. Er wusste, dass es für ihn im ganzen Leben keine andere geben würde.
Wieder glitten seine Blicke über die Menge. Da war sie. Die Ritter führten ihre Pferde durch eine Schneise zum Tjostplatz, dort stand sie in der ersten Reihe und sah zu ihm herauf. Er vergaß zu atmen, verschluckte sich. Lächelte. Seid gegrüßt, Schöne!, formte er lautlos mit den Lippen. Sie schaute nur und reagierte nicht darauf. Dann verschwand sie in der Menge. Etwas stimmte nicht mit ihr. Warum ging sie? Warum hatte sie nichts gesagt, nicht gewinkt, nicht einmal gelächelt?
»Wem machst du da Zeichen?«, fragte Christian.
»Saphira.«
»Die Jüdin, von der du mir erzählt hast?«
»Sie ist wieder verschwunden. Ich verstehe das nicht.« Er sah sich nach Vater um. »Wenn mein Vater mitkriegt, dass ich auch nur zu ihr hinschaue, reißt er mir die Zunge heraus, hackt mir die Ohren ab und stürzt mich kopfüber in den Brunnen.«
»Das hat er gesagt?«
»Ja, so ähnlich.«
Christian grinste. »Darfst dich eben nicht erwischen lassen.«
»Kann er das sehen? Von da oben?«
»Väter sehen alles. Man muss aufpassen.«
»Auf keinen Fall lasse ich mir Saphira von ihm verbieten. Da kann er toben, wie er will.«
»Das nenne ich Kampfgeist!« Christians Gesicht leuchtete. »So gefällst du mir. Du musst eben klug herangehen an die Sache. Wo nächtigt ihr bisher?«
»Wir nächtigen gar nicht. Das ist Liebe, Christian, davon verstehst du nichts. Da redet man. Man sieht sich in die Augen. Man träumt.«
»Soso, man träumt. Bist du dir sicher, dass das alles ist, was sie von dir will?«
»Du kennst sie nicht.« Saphira liebte Träume. Mitunter träumte sie dreimal, viermal in einer einzigen Nacht, und wenn er sie am Tage traf, wusste sie jeden Traum zu berichten. Die Träume kamen zu ihr wie die Katzen. Die Tiere der Nachbarn huschten auf Samtpfoten die Treppen hinauf in ihr Zimmer. Sie fühlten sich angezogen von ihr, ließen sich streicheln und setzten sich auf ihr Bett und auf die Truhe, um sie zu beobachten. Dass die Katzen sie liebten, hing sicher damit zusammen, dass Saphira eine Frau war, die man gern anschaute. Aber woher kamen die Träume?
Träume waren etwas Leichtes, ein Windstoß, ein Gedanke konnte sie fortblasen. Saphira war wie sie von zarter Beschaffenheit. Ein böses Wort machte sie zittern. Sie handelte mit Federn, eine Federhändlerin von diesem Aussehen und dieser Verletzlichkeit musste einfach träumen. Was wusste schon Christian?
Am Tjostplatz kündigte der Herold die ersten beiden Ritter an.
»Ah, Ramstein«, sagte Christian. »Willst du sehen, wie wir Sterner euch armselige Psitticher niederwalzen?«
Ramstein saß auf einem riesenhaften schwarzen Ross. Den roten Waffenrock des Ritters zierte ein weißer Stern. Auch die Lanze, die er in den Himmel reckte, war rot und weiß bemalt. Er nickte mit dem Helm, zum Zeichen, dass er bereit sei.
Tam mochte nicht für tausend Goldgulden mit dem Psitticher tauschen, der gegen ihn anzureiten hatte. Vater hätte es sicher gern gesehen, wenn er in weißem Mantel mit grünem Papageienvogel für die Psitticher stritte. Aber er eignete sich eben nicht für Kriegsspektakel.
Der Psitticher nickte. Der Herold gab ein Zeichen mit der Fahne. Die Menge verstummte, sie sah gebannt auf die Pferde, die kaum noch zu halten waren. Endlich senkten die Ritter die Lanzen und preschten aufeinander zu. Die Hufe knallten auf das Straßenpflaster, ein aufpeitschender, wilder Rhythmus. Dann krachten die Lanzenspitzen auf die Schilde der Gegner. Der Schild des Psittichers zersplitterte und im Vorbeireiten stieß ihn Ramstein vom Pferd. Er kam hart auf, das konnte man bis zur Tribüne hören. Glücklicherweise schleifte ihn das Ross nicht weiter; es blieb mit zitternden Flanken stehen. Gehilfen eilten herbei und zogen den Gestürzten vom Platz.
Tam schüttelte sich. Er stellte sich blutende Wunden unter Helm und Rüstung vor. Vielleicht war die Schulter ausgerenkt oder gar der Arm gebrochen. Warum hatte Vater zugelassen, dass dieser Anfänger gegen den stärksten Sterner anritt? Hatten sie nicht ebenbürtige Ritter vorzuweisen? Tam drehte sich um, weil er Vaters Gesicht sehen wollte. Der Tribünenplatz war leer. Vater verpasste einen Tjost? Eher war er gegangen, um sich selbst zu rüsten. Er konnte Ramstein besiegen.
»Gnadenlos!«, rief Christian. »So ist er, unser Ramstein.«
Da war Saphira wieder. Sie sah ihn nicht an. Am liebsten wäre er zu ihr gegangen, aber es würde zu vielen auffallen. »Fällt dir eine Möglichkeit ein, Saphira unbemerkt zu treffen?«, fragte er. »Ich muss sie sehen.«
Christian rieb sich das Kinn. »Du weißt, ich bin immer für Draufgängereien zu haben. Heute wäre ich an deiner Stelle vorsichtig. Dein Vater wird genau auf dich achten. Warte bis morgen.«
»Es geht ihr nicht gut, das sehe ich.«
»Auf die Entfernung? Ist sie das, dort, am Sperrband?«
»Wenigstens werde ich ihr einen Brief überbringen. Sie soll wissen, dass ich mich von Vater nicht einschüchtern lasse und zu ihr stehe, auch wenn wir uns heimlich treffen müssen.«
»Meinst du, daran zweifelt sie, wenn du es ihr einen Tag nicht sagst?«
»Liebende wollen es jeden Tag hören.«
»Da täuschst du dich. Liebe heißt Sehnsucht. Das bedeutet, den anderen warten zu lassen. Es ist ein Teil der Kunst.«
Tam schüttelte den Kopf. »Liebe ist kein Handwerk. Das Herz gibt dem Liebenden ein, was er zu tun hat.«
»Du bist so versponnen!« Christian schlug ihm mit der Faust aufs Bein. »Alter Minnegeist!«
»Ich muss Saphira schreiben.«
»Wie du meinst. Lass mich den Brief überbringen.«
Tam sah den Freund an. Warum schlug er das vor? »Was liegt dir daran?«
»Du denkst …?« Christian lachte. »Ich? Nicht im Traum würde ich daran denken, ich meine, da bist du einmal verliebt – glaubst du, ich freue mich nicht für dich?«
Christian war ein Frauenheld, wie er in den Liedern besungen wurde. »Ich überbringe den Brief selbst.«
»Heute zur Bürgermeisterwahl? Dein Vater wartet doch nur darauf.«
»Sie gefällt dir wohl?«
Christian sah zu ihr hinunter. »Nein.«
»Wirklich nicht?«
»Zu zerbrechlich. Zu kindhaft. Ich mag eher die erwachsenen Frauen.«
»Also gut. Du bringst ihr den Brief. Mir liegt viel an Saphira. Alles.«
»Sie ist keine Versuchung für mich.«
Ein Mann stürmte auf die freie Fläche unten auf dem Tjostplatz. Tam hatte ihn des Öfteren in der Trinkstube »Zur Mücke« gesehen, wo Vater die Psitticher um sich scharte. Schergen bückten sich unter die aufgespannten Tücher und eilten zu ihm, um ihn zu packen. Noch ehe sie ihn erreichten, schrie er: »Ihr Sterner seid vermaledeite Trottel! Nieder mit den Habsburgern!«
Christian stöhnte auf.
Ramstein sprang von seinem Rappen, stieß die Schergen beiseite, die den Pöbler davonschleppen wollten, und verpasste ihm einen Fausthieb ins Gesicht. Die Habsburger hatten längst ihre Pläne für Basel aufgegeben, aber nach wie vor empfanden es die Ritter des Sternerbundes als üble Schmähung, wenn das Adelshaus beleidigt wurde, für das sie damals Partei ergriffen hatten.
Von überallher stürmten Psitticher und Sterner auf den Tjostplatz. Sie schlugen einander, schrien und rangen sich zu Boden. Kleider zerrissen. Das Volk johlte. Der erste warf einen Stiefel, der nächste einen Becher, und bald prasselte auf die Kämpfenden ein, was gerade zur Hand war.
Wo war Saphira? Sie steckte doch mitten im Gedränge! Tam sprang auf und nahm in großen Sätzen die Treppenstufen der Tribüne. Unten angekommen, beugte er sich über das Tribünengeländer und brüllte: »Auseinander, ihr Schwachköpfe!«
Niemand hörte auf ihn. Er schwang sich über das Geländer. Saphira war nirgends zu sehen. Wurde sie zwischen den Kämpfenden erdrückt? Lag sie am Boden und wurde getreten? Tam zwängte sich durch die Raufenden, machte Gebrauch von den Ellenbogen. Er rief ihren Namen.
Dann sah er sie: das blaugestreifte Tuch vom Kopf gerutscht, die Haare aufgelöst. Sie hielt sich den Bauch. Offenbar hatte sie einen Schlag abbekommen. Immer wieder wurde sie gestoßen und abgedrängt. Als Tam sie beinahe erreicht hatte, bemerkte sie ihn und versuchte nun ebenfalls zu ihm zu gelangen. Da stellte sich ein rotgesichtiger Mann in seinen Weg. »Noch so ein Psitticher«, sagte er. »Ihr könnt nicht genug kriegen.« Er packte Tam an der Schecke und zog ihn derbe heran. Knöpfe platzten ab. Die Stirn des Mannes donnerte gegen Tams Nasenwurzel. Tam sah Funken fliegen, der Schädel platzte ihm schier vor Schmerz. Er spürte eine Woge in sich aufwallen, die er nicht kannte: Er hasste diesen Mann. Er hasste ihn dafür, dass er sich zwischen ihn und Saphira schob. Tam holte aus und setzte ihm die Faust ins Gesicht. Als er den Gegner taumeln sah, schlug er ihm die Linke in den Magen, packte ihn an der Schulter und warf ihn beiseite. Es verschaffte ihm auf eine fremde Art Erleichterung, auch wenn ihn die Faust schmerzte. Wo war Saphira?
Sie lag am Boden und bemühte sich, wieder aufzustehen. Er hob sie auf, stützte sie. Mühsam bahnte er ihr einen Weg durch die Raufenden.
»Ihr seid tapfer«, sagte sie.
»Nur für Euch«, gab er zurück. Beim Sprechen dröhnte ihm der Kopf.
Endlich waren sie dem brodelnden Kessel entronnen. Hier standen nur noch Werfer, Anfeurer und solche, die bei Gelegenheit einem der Raufbolde in den Hintern traten, um gleich darauf in der Menge unterzutauchen.
»Kommt, ich bringe Euch nach Hause«, sagte er.
»Besser nicht. Man sieht uns schon misstrauisch an.«
»Nehmt das Tuch ab! Dann weiß niemand, dass Ihr Jüdin seid.«
»Viele kennen mich vom Markt. Lasst, Tam. Es geht schon.« Sie löste sich von ihm. »Danke, dass Ihr mich da rausgeholt habt.«
»Keine Widerrede, ich bringe Euch.«
»Achtung!«, schrie Saphira.
Er drehte sich um und fing einen Fausthieb mit dem Gesicht auf. Funken regneten vor seinen Augen herab. Blut rann ihm warm über die Wange. Es war der rotgesichtige Mann. »Du schon wieder?«, brummte Tam. »Jetzt ist es genug.« Er zog sein Schwert.
»Nichts für ungut«, stammelte der Schläger. »Das muss nicht bis aufs Letzte ausgetragen werden.« Er wich zurück.
Christian erschien. »Meine Güte, Tam, was ist denn in dich gefahren? Bist du tollwütig? Steck das Schwert weg!« Er legte ihm die Hand auf den Arm und wollte ihn fortziehen. »Liegt dir die Ehre der Psitticher neuerdings so am Herzen?«
Tam wand sich frei. Saphira war verschwunden. Und es war nicht einer der angesehenen Psitticher in der Nähe. Mitläufer rauften da, niedere Adlige, Bürger, die zum Randfeld des Psitticherbundes gehörten. Wo aber steckten die fähigen Männer? Wo blieb der Vater? Hier war etwas faul. Der schwache Turniergegner zu Beginn, dann der Pöbler. Diese Rauferei war kein Zufall.
Er drehte sich um und lief mit blanker Klinge durch die Volksmenge. Man machte ihm erschrocken Platz.
Christian folgte ihm. »He, Tam, sagst du deinem Freund bitte, was mit dir los ist? Und steck das Schwert weg!«
Tam ging schweigend voran. Das Gedränge wurde immer dichter bis zum Fahnengässlein. Vor der »Mücke«, der Trinkstube, in der sich die Psitticher zu versammeln pflegten, waren Pferde angebunden. Pagen lümmelten auf den Stufen. Die Fensterläden des Parterregeschosses waren geschlossen.
»Ich komme nachher zu dir auf den Petersberg«, sagte Tam.
»Sei vorsichtig. Verdirb es dir nicht mit deinem alten Herrn. Und wasch dich erst mal.« Christian wies auf sein Gesicht.
Er steckte das Schwert ein und wischte sich mit der Armbeuge das Blut aus dem Gesicht. Dann ging er die kurze Treppe hinauf und öffnete die Tür. Im Vorraum standen Wachen. Sie sahen ihn verblüfft an. »Herr von Bärenfels, was ist mit Euch geschehen?«
»Lasst mich durch«, befahl er knapp.
Die Wachen warfen sich Blicke zu. »Wir dürfen niemanden einlassen, junger Herr.«
»Wollt Ihr dem Sohn des neuen Bürgermeisters den Eintritt verwehren?«
»Euer Vater gab den Befehl, nicht einmal dem König die Tür zu öffnen.«
Tam zögerte kurz. Dann sprang er vor, stieß die Wachen beiseite und öffnete die Tür.
Der Sommersaal der »Mücke« war umgeräumt. Eine lange Tafel stand in seiner Mitte, bis zum letzten Platz besetzt. Es war dunkel, einige Kerzen verbreiteten mageren Lichtschein. An der Tafel saßen die bedeutenden Ritter, die Tam auf dem Münsterplatz vermisst hatte. Außerdem konnte er dickbäuchige Männer in geschlitzten Florentinermänteln ausmachen, die im Gesicht geschminkt waren: Die Augenränder waren geschwärzt, die Wangen mit roter Farbe bemalt. Was geschah hier?
An die dicken Männer gewandt, sagte der Vater: »Das ist mein Sohn, Thomas.« Er musterte ihn. »Hast du dich der Prügelei angeschlossen? Wer hätte das gedacht!«
Tam sah an seiner zerrissenen Schecke hinunter. Dann fasste er den Vater ins Auge. »Warum habt Ihr diese Rauferei befohlen?«
Konrad von Bärenfels erhob sich. »Meine Herren, ich denke, wir sind fertig für heute.«
Die Männer standen auf. Wortlos verließen die Geschminkten den Raum, die Ritter standen in kleinen Gruppen beisammen und unterhielten sich gedämpft. Lächelnd trat der Vater auf Tam zu. »Du überraschst mich. Hätte nicht geglaubt, dass du dich für die Ehre der Psitticher prügeln würdest. Sonst interessieren dich doch nur Dichtkunst, Musik und andere weibische Tugenden! Hast du dich wacker geschlagen? Vielleicht wird doch noch ein Ritter aus dir.« Er tätschelte ihm die Schulter.
»Ihr habt die Psitticher versammelt und habt mir nicht Bescheid gegeben?«
»Ich bin nun Bürgermeister. Eine erste Beratung war notwendig.«
»Eine Beratung, von der Ihr durch eine Rauferei ablenken wolltet? Niemand sollte bemerken, dass Ihr Euch trefft, so ist es doch. Wer waren die Fremden?«
»Niemand, der dich beunruhigen sollte, mein Sohn.« Konrad von Bärenfels warf einen raschen Blick zur Tür.
Tam folgte seinem Blick, gerade noch rechtzeitig, um ein Männlein auf Krücken hinauskriechen zu sehen.
3
Saphira war gern hier. Sie fühlte sich jedes Mal wie in einem Schiffsbauch. An den Wänden des Ladens waren Säcke, Körbe und Ledertaschen aufgeschichtet. Die Luft schien sich seit Ewigkeiten zu stauen. Staub tanzte darin, und durch das kleine Lukenfenster griffen Sonnenfinger.
Auf dem Tisch lagen Stutze von Pfauen- und Reiherfedern, die sie für Hüte vorbereitet hatte. Straußenfederbüsche für Helme und Pferdegeschirre waren auf einem Wandbord aufgereiht, Federbesen hingen darunter an Haken. Mit ihnen würden junge Mägde in Basler Herrenhäusern die Möbel abstauben.
Es gab tausenderlei Verwendung für Federn. Ärzte stopften kleine Leinenkissen mit Flaum aus, um sie in den Mund der Kranken zu legen oder auf Wunden zu drücken. Die Kanzleien kauften Gänsekiele. Wohlhabende ließen ihre Schlafmützen füttern für eine geruhsame Nacht. Und mancher füllte ein Kissen, um sich weich zu betten.
Sie litten keine Not, im Gegenteil. Vater hatte gute Geschäfte gemacht in den vergangenen Jahren. Aber es hatte nie außer Frage gestanden, dass Saphira arbeiten würde. Da den Juden nur der Geldverleih oder der Handel offenstand, hatte Vater ihr geraten, wegen ihres zarten Körperbaus mit etwas zu handeln, das leicht zu tragen war, und so war sie auf die Federn gekommen. Sie hatte es nie bereut.
Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Gleich setzte wieder das Zittern ein, das sie seit dem Morgen in der Mikwe fortwährend befiel. Oben war es gewesen, neben den Körben mit den Krähenfedern, da, wo die Daunensäcke lagerten. Ihr Herz raste. Sie spähte hinauf.
»Peterchen, Minka, Lisa, habt ihr mich erschreckt!« Saphira entspannte sich, atmete aus.
Die Katzen streckten sich.
»Na kommt, lasst euch die Nacken kraulen. Kommt her.« Sie hockte sich nieder. Auf lautlosen Pfoten sprangen Minka und Lisa herab und strichen ihr um die Beine. Peterchen blieb oben und beobachtete, wie Saphira die beiden Katzen streichelte. »Ihr habt euch da einen bequemen Platz gesucht auf den Daunen. Würde ich genauso machen.«
Minka und Lisa schnurrten behaglich. Hier war nichts davon zu spüren, dass in der Mikwe das Böse losgebrochen war. Hier war sie sicher, hier war sie zu Hause. Und doch konnte sie die Angst nicht völlig vertreiben, die von ihr Besitz ergriffen hatte. Sie war gewarnt worden. Die Kreatur war entfesselt worden, als sie mit unzüchtigen Wünschen an Tam dachte. Sie musste Tam lassen.
Bei dieser Vorstellung fühlte sich ihr Hals an, als hätte ein Arzt ein ganzes Dutzend Leinensäckchen hineingestopft. Sie konnte nicht schlucken, ihr wurde heiß. Tam, der heute einen Schrank von einem Mann verprügelt hatte, um sie aus dem tobenden Kessel der Raufenden herauszuholen. Tam, der Sanfte und doch Starke, der Einzige, dem sie Glauben schenkte, wenn er ihr Freundlichkeiten sagte.
Wie sollte sie einen wie ihn unter den Juden finden? Etliche machten ihr den Hof, aber sie sahen nicht sie, sondern nur den zierlichen Körper, der ihnen gefiel, und die sanfte Frauenseele, die sie sich untertan machen wollten. Allein Tam begriff das Wunder, das jeden Menschen eigen machte, sodass keiner dem anderen glich. Tam wollte sie sich öffnen. Sie liebte ihn und wollte keinen anderen finden.
Aber die Warnung dieses Morgens zu überhören war unmöglich. Hinzu kam die Vernunft, die ihr wieder und wieder in den vergangenen Wochen gesagt hatte, dass die Liebe zwischen ihr und Tam keine Zukunft hatte. Eine Ehe zwischen einer Jüdin und einem Christen war nicht gestattet, und eine Liebschaft zwischen ihnen würde grausam bestraft werden.
Wenn du ihn wirklich liebst, lässt du ihn frei, sagte eine Stimme in ihr. Du schadest ihm, wenn du dich weiter mit ihm triffst. Du machst ihn unglücklich. Sie legte sich auf den Boden, zog sich eine Federtasche als Kissen heran und starrte zur Decke. »Ich will ihn nicht verlassen«, flüsterte sie. Ihr Atem ging schwer. Tränen liefen ihr über das Gesicht und rollten seitwärts die Wangen hinab, sie benetzten die Ohrläppchen. Saphira wischte mit dem Handrücken darüber.
Du wusstest immer, dass es verboten ist und böse enden würde, sagte die Stimme. Willst du wenige Monate träumen, oder willst du heiraten, Kinder in deinem Haus aufziehen, gemeinsam mit der Familie Frühstück und Mittagsspeise und Abendbrot essen und aufrecht über die Straße gehen können?
»Dann muss ich eben Christin werden.« Es klang fremd aus ihrem Mund. Wenn sie dem jüdischen Glauben den Rücken kehrte, würde das ihrem Vater das Herz brechen. Vielleicht würde er nie wieder ein Wort mit ihr sprechen. Er würde auf die andere Straßenseite wechseln, wenn sie sich begegneten, das Gesicht abwenden und denken: Das war einmal meine Tochter, jetzt ist sie eine Fremde.
Und Konrad von Bärenfels würde Tam eine Ehe mit ihr sowieso nicht gestatten.
Minkas Schnurrhaare kitzelten ihr Gesicht. Die Katze begann, mit der feinen rauen Zunge die Tränen von Saphiras Wangen zu lecken.
Auf dem Zinngeschirr lagen Trauben. Sie spiegelten sich rot und prall in den Trinkgläsern. Tam pflückte einige Beeren ab und steckte sie sich in den Mund. Er biss darauf und schluckte den süßen Saft. Danach kaute er lange die saure Haut.
An den Wänden der Familie Münch hingen keine Wirkteppiche wie bei ihm zu Hause. Tam konnte sich einfach nicht daran gewöhnen. Die Räume erschienen ihm nackt ohne die schweren, pelzigen Farbflächen. Bei Christian waren die Wände stattdessen mit Leinen bespannt, auf das mit rötlicher Farbe Verzierungen gedruckt waren, kleine, wiederkehrende Muster. Wo die Muster aussetzten, prangten Bilder von schwarzer Farbe. Männer und Frauen, die Reigen tanzten. Ritter und orientalische Bogenschützen im Kampf. Szenen aus der Ödipussage. Es wirkte zierlicher als bei ihnen. Weibischer, hätte Vater gesagt.
Durch das Fenster hörte man im Hof den Springbrunnen plätschern. Von Zeit zu Zeit rief ein Pfau seinen hohen Laut. Aus der Ferne klangen das Stimmgewirr und die Musik des Stadtfestes herüber.
»Wie lange willst du noch nachdenken?«, fragte er Christian.
Der saß in sich zusammengekauert vor dem Schachbrett und stützte das Kinn auf die Hände. »Ist eben schwierig.« Dann warf er plötzlich die Hände in die Luft und sagte: »Ich fasse es nicht, dass ich mir das antue: Auf dem Münsterplatz tobt das Fest, und ich sitze hier mit dir und spiele Schach. Was mir da an Vergnügen entgeht!«
»Du meinst, welche Frauen du verpasst.«
Christian schien es nicht gehört zu haben. »Was hat eigentlich deine Mutter zu der Platzwunde gesagt?«
»Sie wollte gleich den Stadtarzt rufen. Ich konnte es mit Mühe verhindern. Dafür hat sie mir überall im Gesicht herumgetupft und mich gescholten. Es reiche, einen Mann im Haus zu haben, der sich nur dann stark fühle, wenn andere vor ihm am Boden liegen. Ich glaube, manchmal leidet sie unter meinem Vater.«
»Alles hat zwei Seiten, Tam. Sie kann nicht einen stolzen Ritter zum Ehemann haben und sich zugleich einen Minnesänger an ihrer Seite wünschen.« Christian setzte den Springer.
Der Zug, den Tam die ganze Zeit erwartet hatte. »Na endlich.« Er dachte noch einmal kurz nach, dann rückte er wie geplant den Läufer vor. Die Figur aus geschnitztem Walrosszahn lag schwer und angenehm kühl in der Hand.
Christian überlegte. Schließlich schlug er einen Bauern.
»Kennst du das Schachbuch des Jacobus de Cessolis?«, fragte Tam.
»Wer ist das?«
»Er war Dominikanermönch in Genua. Du kennst es wirklich nicht? Das kennt doch beinahe jeder.«
»Ich lese eben nicht, ich mag die Dinge lieber zum Anfassen.«
»Ein Schachbuch, habe ich gesagt, keine Liebesgeschichte. Ich erkläre es dir. In den ersten drei Kapiteln behandelt er die Erfindung des Schachspiels und seinen Nutzen zur moralischen Unterweisung des Königs, zum Vermeiden von Langeweile und zum Anregen gedanklicher Tätigkeit. In den nächsten fünf Kapiteln stellt er die edlen Schachfiguren vor: den König, die Königin, die Läufer beziehungsweise Richter, die Springer beziehungsweise Ritter, die Landvogttürme. Dann folgen in acht Kapiteln die niederen Figuren. Jedem Bauern ordnet er ein Handwerk zu.«
»Lässt du wohl meinen Bauern stehen!«
Tam seufzte und nahm einen eigenen Bauern. »Also, jedem Bauern ordnet er ein …«
»Berührt, geführt. Den musst du jetzt setzen.«
»… Handwerk zu, manchen auch zwei.« Er zeigte der Reihe nach auf seine Bauern. »Schmied, Wollmacher, Metzger und Schreiber, Kaufmann und Geldwechsler, Arzt und Quacksalber, Wirt, Verwalter.« Zuletzt wies er auf den geschlagenen Bauern am Feldrand. »Schließlich die Gruppe der Wahrsager, Landstreicher und Spieler. Außerdem werden die Bewegungen und das Vorrücken der Schachfiguren ausgedeutet.«
»Schön, kommst du jetzt mal wieder runter von deinem Ross? Spielen wir weiter.«
»De Cessolis erklärt die Welt mit dem Schachspiel – ist das nicht grandios? Er flicht Aristoteles mit ein, Cicero, Seneca, Chrysostomos und Augustin.« Tam stellte den Bauern wieder hin und setzte die Königin. »Schach!«
»Na wunderbar.« Christian fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Das hast du wieder lange vorbereitet, richtig? Kann ich überhaupt noch gewinnen?«
»Ich wüsste nicht, wie.«
Christian stand auf. »Warum spiele ich überhaupt gegen dich?«
»Du kannst doch nichts dafür, dass du verlierst. Der eine kann dies besser, der andere jenes. Du bist dafür gut mit Menschen. Wie leicht es dir beispielsweise fällt, mit Frauen zu reden! Liegt das an deinen Schwestern? Ich meine, bei vier Schwestern sind Frauen für dich nichts Geheimnisvolles mehr, du weißt, wie sie denken und fühlen, nicht wahr?«
Als Christian nicht antwortete, steckte Tam sich eine weitere Weinbeere in den Mund und ließ sie zerplatzen. »Ich kann dir sagen, warum mir das Schachspiel so leichtfällt. Es ist nicht mein Verdienst.«
»Nun bin ich aber gespannt.« Christian trat zum Fenster. »Da draußen tobt das Leben, Mann.«
»Ich habe das noch keiner Menschenseele preisgegeben. Wirst du schweigen?«
»Was für eine Frage!«
»Also gut. Meine Mutter hat mich selbst gestillt. Über die Muttermilch habe ich gute Anlagen für den Verstand aufgenommen.« Christian wandte sich um und riss die Augen auf. »Deine Mutter hat bitte was? Das ist ja widerwärtig! Hattet ihr kein Geld für eine Amme?«
»Sie wollte eben das Beste für mich. Sie liebt mich.«
»Lass dir eines sagen: Würde sie dich lieben, dann hätte sie dir diese Schande nicht angetan. Du wärst wie ein anständiger Mensch von einer Amme aufgepäppelt worden. Abgesehen davon hat dir die Muttermilch vielleicht eingeflößt, schüchtern zu sein. Klüger bist du nicht. Wir hätten Dame oder Mühle spielen sollen, dann hätte ich dich geschlagen.« Er trat zum Tisch und sammelte die Figuren ein. »Warum hast du das nie erzählt mit deiner Mutter? Jetzt verstehe ich so einiges.«
»Sehr witzig.«
»Gib mir den Brief. Ich gehe am besten gleich, bei dem Gedränge fällt es nicht auf, wenn ich mich vor dem Haus von Simon-ben-Levi herumtreibe. Ich habe auch einen Ruf zu verlieren.«
»Rede nicht zu lang mit ihr.« Tam reichte ihm das zusammengefaltete Pergamentstück. »Es genügt, wenn du ihr sagst, dass ich dich geschickt habe.«
Christian füllte die Figuren in einen Brokatsack. »Siehst du, im Säcklein liegt der König bald unten, bald oben.«
Tam schüttelte den Kopf. »Versuche es nicht, Christian. Das Denken ist meine Aufgabe. Der König steht immer oben. Aber er hängt von denen ab, die unter ihm stehen. Ein Rossnagel hält ein Eisen, ein Eisen hält ein Pferd, ein Pferd einen Mann, ein Mann ein Haus, ein Haus ein Landstück, ein Landstück ein Königreich. So hängt das Königreich von einem Rossnagel ab.«
»Komm, ich gebe dir ein Rätsel auf, du Schlauberger. Wann schmeckt der Wein besser? Während du ihn anschaust, wie er im Pokal glänzt, oder während er dir die Kehle hinunterrinnt?«
»Rühr sie nicht an, hörst du?«
»Deine Eifersucht gefällt mir. Lass dir einen Rat geben von einem, der weiß, wie man es macht. Wenn du sie wiedersiehst, berührst du sie, wie aus Versehen, aber sanft, an der Hüfte, an der Hand, ganz wie du willst. Dann suchst du ihre Augen und machst ihr mit einem Blick klar, dass es kein Versehen war. Als Nächstes: eine längere Berührung. Wenn sie sich dir entzieht, lässt du sie gehen. Du wartest. Dann versuchst du es noch einmal. Die Frauen wollen erobert werden, sie wird es dir schwermachen, aber das gehört zum Spiel, verstehst du?«
»Für mich ist das kein Spiel, Christian.«
»Nenne es, wie du willst. Ich gehe jetzt, ich will die Sache hinter mich bringen und dann endlich zum Stadtfest zurückkehren. Dir scheint es ja besser zu gehen als erwartet.«
Auf dem Weg zur Mühlengasse traf er einige junge Rittersöhne. Sie versperrten ihm zum Scherz den Weg. Als er sie beiseiteschob, sagten sie: »War wieder dieser Langweiler bei dir?«
Christian blieb wie angewurzelt stehen. Er drehte sich um.
»War doch nicht böse gemeint!« Die Rittersöhne hoben abwehrend die Hände. »Mann«, sagte einer, »lass uns zum Rossmarkt in die Vorstadt gehen, da stehen die Buden mit dem Würzwein. Hab’ vorhin ein paar dralle Weiber dort gesehen, was sagst du?«
»Ihr wartet hier, bis ich wieder da bin.«
»Schon gut, Meister.«
Er ging weiter. In seinem Rücken hörte er sie sagen: »Der ist empfindlich heute.« War es so? War er empfindlich? Unsinn. Sie wussten genau, dass sie Tam in Frieden lassen mussten. Manchmal kam ihm sein Freund verletzlich vor wie ein Kind, das er zu beschützen geschworen hatte. Es war keine leichte Aufgabe. Tam mochte klug sein. Besonders lebensfähig war er nicht.
Christian lächelte. Die Rothaarige, die ihm da entgegenging, gefiel ihm ausgezeichnet. Und sie kam gerade in das passende Alter. Da sie das Haar offen trug, war sie zumindest unverheiratet. Eine Verlobung war kein Hindernis. Christian steuerte auf sie zu.
Sie stutzte.
Ja, du bist gemeint, Süße! Er verneigte sich leicht.
Röte flog über ihre Wangen. Sie schlug den Blick nieder.
Wie versehentlich strich er mit zwei Fingern über ihre Hand. Die Haut war rau, die Knöchel verhornt. Eine Wäscherin. Es machte nichts, der mollige Körper würde ihn weich empfangen. »Du bist Wäscherin?«, fragte er.
»Ja, Herr.« Sie wich ein wenig zurück.
Er folgte ihr. »Eine Schönheit!«
Zweifelnd sah sie ihn an.
»Das meine ich ernst. Vielleicht treffen wir uns einmal am Rheinufer und gehen ein wenig spazieren?«
Sie schluckte. »Meint Ihr das ernst, Herr?«
»Natürlich nur, wenn du willst.«
Die Wäscherin machte einen unbeholfenen Knicks. »Sehr gern, Herr.« Ihre Lider flatterten.
Er wusste, er hatte sie gewonnen. »Komm!« Am Ellenbogen führte er sie zu einem Stand mit Backwaren. »Zwei Honigkuchen«, sagte er und nestelte am Geldbeutel. Er zählte nicht, füllte die Hand mit einigen Silberpfennigen und legte sie auf den Tisch. »Behaltet den Rest.« Die Frauen liebten Freigebigkeit. Und ihm fiel sie nicht schwer.
»Der ist für dich.« Er drückte ihr einen der Honigkuchen in die Hand. »Ich muss zur Mühlengasse, kommst du ein Stückchen mit?«
Sie nickte.
Unterwegs aßen sie. Er fragte: »Schmeckt’s?«
»Traumhaft!«, sagte sie und spuckte dabei versehentlich einige Krümel aus, wofür sie sich sofort entschuldigte. Sie machte sogar einen Knicks, offenbar hatte sie das bei hohen Damen gesehen und meinte, es gehöre sich so.
»Du musst nicht andauernd vor mir die Knie beugen«, sagte er. »Wie heißt du?«
»Marie.«
»Es gibt viele Maries, aber nun, wo ich dich getroffen habe, bekommt der Name einen ganz neuen Klang für mich.« Das war nicht gelogen. Sie gefiel ihm, vielleicht würde es etwas Dauerhafteres werden und eine Woche währen oder einen Monat gar. Ihre Brauen standen ein wenig dicht und die Hüfte war dafür umso breiter. Aber Marie war auf eine betörende Art unbeholfen, die ihn mit dem Verlangen erfüllte, sie abzuküssen. Er besah den weichen Hals, den er bald mit seinen Lippen ertasten würde.
»Du trägst ein Schwert, also bist du Ritter«, sagte sie zögerlich. »Zu welcher Familie gehörst du?«
»Ich bin der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters. Ein Münch. Nenne mich Christian.«
Sie blieb stehen. »Und Ihr –«
»Sag Du zu mir.«
»Und du gibst dich mit mir ab?«
Er lachte. »Die Freude ist ganz meinerseits.« Er zog sie weiter.
»Ist es ein Unglück für deine Familie, dass heute dieser Konrad von Bärenfels gewählt wurde?«
»Wir wussten es doch lange vorher. Man trifft seine Vorbereitungen. Nächstes Jahr ist mein Vater wieder Bürgermeister.«
»Wie kannst du das wissen?«
»Das Prinzip hinter diesen Wahlen ist sehr einfach. Man kann sie steuern. Es ist alles eine Frage der Macht. Die Regel schreibt vor, dass sich jedes Jahr ein Sterner und ein Psitticher abwechseln. Immer im Wechsel ein Sterner und ein Psitticher, verstehst du das? Die beiden Rittergesellschaften hüten dieses Gesetz wie den Stab des Mose.«
»Aber dennoch können unter den Rittern viele vom Bischof erwählt werden!«
Christian schmunzelte. »Ich erkläre dir, wie es läuft. Der Rat nennt dem Bischof drei Namen, aus denen er auswählen darf. Männern, die so mächtig sind wie Konrad von Bärenfels oder mein Vater, fällt es nicht schwer, dafür zu sorgen, dass man außer ihnen zwei völlig unmögliche Vorschläge macht. So bleibt dem Bischof eigentlich keine andere Wahl, als Konrad von Bärenfels und meinen Vater zu benennen, immer hübsch im Wechsel.«
Kinder hatten einen Hanfstrick als Ziellinie auf die Straße gelegt. Sie kamen Christian und Marie entgegengerannt, ein Wettlauf. Der Lange, Schmächtige kam zuerst ins Ziel. Er japste um Atem, grölte erfreut und schnaufte. Die anderen stemmten die Hände in die knochigen Hüften und beugten sich vor, um sich zu erholen. Da erblickte der Sieger Marie. Er sah wütend von ihr zu Christian.
Sie beugte sich zu dem Burschen hinunter und fauchte: »Verschwinde, und kein Wort zu den Eltern, oder ich spucke dir von heute an den Rest deines Lebens ins Essen!«
Er verschränkte die Arme und blieb stehen, bis sie vorübergegangen waren.
Das war der Vorteil seines Standes: Selbst wenn Maries Vater zornig werden sollte, konnte er nichts gegen Christian unternehmen. Er musste sich um so etwas nicht sorgen.
Zwei Schergen sahen ihnen misstrauisch in die Gesichter. »Das mit der Prügelei hätte ich dir vorher sagen können«, sagte der eine zum anderen.
»Wenigstens sind die Glockenseile eingezogen, damit niemand Sturm läuten kann.«
»Zuerst schmieren sie einander im Scherz Ruß ins Gesicht, und dann stürzen sie den verhassten Nebenbuhler in den Brunnen.«
»Diese Stadt ist ein Auffangbecken für Schurken geworden, ich sage dir, bald kann man am helllichten Tage die Straße nicht mehr überqueren.«
Christian lachte in sich hinein. Sie verstanden nichts vom Leben, diese Griesgrame. Er legte Marie den Arm um die Hüften. Sie fügte ihre Hand auf die seine. Immer wieder war es aufregend, das Erobern und sich Näherkommen.
Sie passierten Rümelins Mühle. Ins Haus des Juden konnte er sie nicht mitnehmen. »Marie, ich habe noch ein Geschäft zu erledigen.«
»Verstehe.« Rasch zog sie ihre Hand zurück.
»Nein, so ist es nicht. Es wird nicht lange dauern. Gehen wir danach ein wenig am Ufer spazieren?«
Sie nickte. »Gern«, hauchte sie.
»Sei so gut und geh voraus zum Rhein. Ich komme in Kürze nach. Treffen wir uns am Salzturm?«
»Wie du wünschst, Herr. Ich meine … Christian.«
Sie würde seine Belohnung sein, wenn er Saphira den Brief übergeben hatte.
4
Die zerlumpten Kinder sprangen um ihn herum, schrien und tobten. Die Versuche der Waisenmutter, sie zur Ruhe zu bringen, blieben erfolglos. Er war Ritter! Er konnte sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Konrad von Bärenfels ballte eine Faust vor dem Bauch und brüllte: »Ruhe!«
Augenblicklich war es still. Die Kinder sahen ihn ängstlich an.
»Na also, es geht doch.« Er nickte. »Manchmal braucht es eben einen Mann. Was sagtet Ihr gerade?«
Die Waisenmutter wiederholte: »Dass die anderen hohen Familien der Stadt ihre Spenden dieses Jahr halbiert haben. Die Münch, die von Ramstein, sie geben noch, ja, aber es wird immer weniger, und dabei werden es mehr und mehr Münder, die ich zu füllen habe.«
»Ihr könnt Euch auf Konrad von Bärenfels verlassen, meine Beste.« Er gab seinem Kammerherrn einen Wink, und der reichte der Waisenmutter mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck einen prallen Beutel. Konrad sagte: »Ein wahrer Ritter vergisst nicht, die Schwachen zu beschützen. Das ist unsere edelste Pflicht.«
»Habt Dank! Habt tausend Dank! Gott segne Euch, hoher Herr Bürgermeister!« Die Waisenmutter versuchte seine Hand zu küssen. Er konnte sie gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Sie knickste und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Ja, ja, schon gut.« Er nahm eine Waise auf den Arm und beschaute sich das verschüchterte Mädchen. Obwohl die Kleidung es nicht von den Kindern unterschied, die auf der Straße lebten, und obwohl es genauso zerbrechlich wirkte mit seinen bis auf den Knochen abgehungerten Ärmchen, war es doch gekämmt und trug ein Schleifchen im Haar. Der Blick der Kleinen irrte zur Waisenmutter, und sie streckte die Arme nach ihr aus. »Zu ihr willst du?«, fragte er enttäuscht.
»Es ist sicher der Bart, Herr.« Die Waisenmutter fasste sich aus Verlegenheit an die hochgesteckten Haare. »Er macht ihr Angst. Sie kennt keinen Vater. Jedes andere Kind würde liebend gern auf Eurem Arm sitzen.«
Konrad setzte die Kleine ab und sie rannte zur Waisenmutter, um sich hinter ihren Beinen zu verstecken. Er sah sich um. »Zeigt mir eure Spielsachen, Kinder.«
Nach einem kurzen Schreckmoment stürmten sie los. Truhendeckel quietschten. Es begannen Balgereien. »Ich will dem Bürgermeister das Holzpferd zeigen!« »Nein, ich zeige es ihm!«
Schließlich kamen die Kinder zurück. Gleich mehrere von ihnen hielten einen Ball, andere eine armselige Puppe aus Stroh. Zwei Jungen brachten ein Holzschwert mit abgebrochener Parierstange. Am Pferd fehlte nichts, und obwohl es mühelos von einem Kind getragen werden konnte, hielten sich gleich zehn Kinder daran fest. Offensichtlich war es das beliebteste Spielzeug. Jeder wollte der sein, der es vorstellte.
»Nun gut. Ihr seid versorgt. Ja, also, bald beginnt das Festmahl mit den Meistern der Zünfte. Ich muss weiter.«
»Heute am Tag der Wahl habt Ihr bereits so viel zu tun? Ich dachte, Ihr würdet vielleicht zum Abendessen bleiben.«
»Die Arbeit fragt nicht nach dem Tag.« Natürlich hatte sie gehofft, er würde gehen. Von dem, was er, der Kammerherr und die vier Knappen verzehrten, konnte sie ihre Kinder eine ganze Woche versorgen. Die Waisenmutter war listig. Es missfiel ihm. »Möge es ein gutes Jahr für Euch werden, Frau.«
Sie knickste. »Danke für alles, hoher Herr.«
Er winkte den anderen und ging zur Tür.
Kaum hatten sie die Straße betreten, begann der Kammerherr mit seiner Fistelstimme auf ihn einzureden. »Herr von Bärenfels, musste es wirklich eine so außerordentlich hohe Summe sein?«
Konrad bestieg das Pferd. »Dieselbe Summe wie jedes Jahr.«
Der Kammerherr bestieg seinen Schimmel. Zu den Seiten gingen die Knappen neben ihnen her. »Zwölf Gulden«, rief der Kammerherr verzweifelt. »Herr von Bärenfels, gebt zwei Gulden hinzu, und Ihr habt den ganzen Jahressold eines Armbrusters ausbezahlt! Wollt Ihr die Armenfürsorge allein auf Eure Schultern nehmen?«
»Schweig still. Ich lasse mir von meiner Schatztruhe nicht vorschreiben, ob ich als Ritter lebe oder nicht. Als Bürgermeister bin ich Vorbild für die anderen. Und ich stehe in einer langen Familientradition, die dem Ritterstand immer Ehre gemacht hat. Gold ist nur Mittel zum Zweck.«
»Natürlich habt Ihr recht, Herr von Bärenfels. Nur bedenkt, dass Ihr« – er senkte seine Stimme, es war kaum mehr ein Raunen – »tief verschuldet seid!«
»So? Und wie kommt das?«
»Die Wiederwahl hat einiges gekostet. Ich weiß bald nicht mehr, wie ich uns die Gläubiger vom Hals halten soll.«
»Mein kleiner Kammerherr«, Konrad von Bärenfels lächelte, »kennst du mich so wenig? Es ist für alles gesorgt. Bald werden wir Gold in Fülle haben. Du wirst einen ganzen Tag zum Zählen brauchen.«
Die Menschen am Straßenrand jubelten ihm zu. Er tat, als würde er es nicht wahrnehmen, auch wenn es ihn vor Freude glühen ließ.
Mit allem hatte Christian gerechnet: mit Simon-ben-Levi, dem er einen Vorwand für sein Kommen hätte erzählen müssen, mit einem Diener, der ihm Prügel androhte, selbst damit, dass die Jüdin ihre Bekanntschaft mit Tam verleugnete. Als Saphira selbst öffnete und ihm mit einem tränennassen Gesicht gegenübertrat, fehlten ihm die Worte. Katzen schlüpften an ihr vorbei ins Freie. Endlich brachte er heraus: »Störe ich?«
»Kommt herein.« Sie ließ ihn in den Laden eintreten. Drinnen lehnte sie sich mit dem Gesäß an einen Tisch, nicht recht auf der Kante sitzend, aber auch nicht recht stehend, und wies ihm den einzigen Stuhl. »Tam schickt Euch, nicht wahr?«
Es roch nach Hühnerstall. »Ich wusste nicht … Wenn mein Besuch unpassend ist, komme ich später wieder. Möchtet Ihr lieber allein sein?« Er war es nicht gewohnt, eine Frau derart gewählt anzusprechen. Für gewöhnlich machte er einen Bogen um die Frauen seines Standes. Ihre Verlobten, Väter oder Ehegatten konnten ihm nachsetzen, deshalb beschränkte er sich auf die Niedriggestellten. Aber war Saphira nicht eine davon? Sie war die Tochter eines jüdischen Geldverleihers! Dennoch brachte er kein Du über die Lippen. Sie hatte etwas an sich, das ihr Würde verlieh. Sogar jetzt, wo sie sich die geröteten Augen mit dem Handrücken auswischte.
»Nein, es ist gut. Da Ihr einmal hier seid, könnt Ihr eine Nachricht an Tam überbringen.« Sie presste die Lippen aufeinander. Es rannen neue Tränen.
Offenkundig stand es nicht zum Besten mit ihr und Tam. Er hätte zu keinem besseren Zeitpunkt eintreffen können. Sein Besuch konnte für die beiden die Rettung bedeuten. »Ihr wollt ihn nicht mehr sehen.«
Sie nickte.
»Aber im Grunde Eures Herzens wollt Ihr ihn doch sehen.«
Sie schloss die Augen. Nickte erneut.
Hatte der Geldverleiher ihr verboten, Tam zu treffen? »Wovor fürchtet Ihr Euch? Niemand weiß von Euch und ihm. Ihr könnt Euch im Geheimen begegnen.«
»Gott sieht es. Es ist nicht rechtens. Und es hat keine Zukunft. Nie wird es eine Zukunft haben.«
So lag die Sache also. Christian kannte diese Einwände. Frauen scheuten häufig die Sünde, unverheiratet das Bett zu teilen. Man musste ihnen bewusst machen, dass sie nicht die Einzigen waren, sondern dass es im Gegenteil allzu menschlich war, seinen Neigungen nachzugeben. »Natürlich. Ihr versucht mit aller Kraft, gut zu sein.« Öffnet die Augen!, wollte er sagen. Es geht allen so wie Euch. Unser Herz ist schwach. Und Ihr seid jung – Ihr werdet genug Gelegenheit haben, Euch zu bessern und Gottes Zorn zu besänftigen. Er wollte sagen: Seid nicht zu streng mit Euch. Ganz so, wie er es bei anderer Gelegenheit gesagt hatte. Aber er brachte es nicht über die Lippen, weil ihm plötzlich klar vor Augen stand, dass es an ihr abprallen würde wie eine Schmeißfliege an der Scheibe eines Kirchenfensters.
Die Jüdin war wirklich verzweifelt. Sie suchte keine Ausrede, um ihr Gewissen zu besänftigen, keinen Schleichweg, um zu einer verbotenen, kurzwährenden Erfüllung zu gelangen. Sie liebte Tam und weinte, weil ihrer beider Leben nicht vereint werden konnten. Christian stand auf. Er ergriff ihre Schultern. »Ich kann Euch nicht helfen«, sagte er. Es betrübte ihn selbst. »Ich kann Euch nicht helfen. Eine Ehe zwischen Euch und Tam ist unmöglich.«
Saphira lehnte die Stirn an seine Brust. Ihre Schultern zuckten, und das Gesicht nässte sein Hemd. »Und wenn ich Christin werden würde?«
Er hielt ihren Kopf, streichelte ihn. »Tam ist der einzige Sohn Konrads von Bärenfels. Er muss ihm würdige Enkel schenken und die Kinder einer bekehrten Jüdin hätten nicht den Rang, den Konrad sich wünscht. Er wüsste die Ehe zu verhindern.«
Sie bebte vor Schmerzen.
Mit Mühe hielt er sie fest. »Es geht vorüber. Heute sieht die Welt schwarz aus für Euch, aber in einigen Wochen scheint wieder die Sonne. Glaubt mir!«