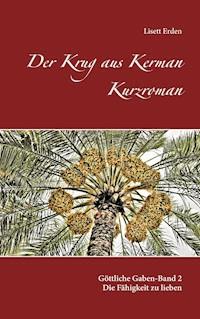Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Göttliche Gaben
- Sprache: Deutsch
Die ambitionierte Journalistin Wendelgard steigt erfolgreich Treppen hoch und fällt durch fremde und eigene Unzulänglichkeiten Treppen wieder hinab. Kann sie ihre hohen Ansprüche an sich selbst und andere herunterschrauben und im Berufs- und Familienleben auf der Alltagsstufe Erfüllung und Glück finden? Wer sie durch ihre bewegten Lebensjahre begleitet, wird gewahr ihres unerschütterlichen Vertrauens auf die Kraft der Hoffnung, des Wandels und des Beistands ihrer religiösen Vorbilder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Haustreppe
Wendeltreppe
Freitreppe
Helixtreppe
Mühlenstiege
Ebenerde
Deine Hände
Mein ganzes Leben habe ich nach
ihnen gesucht.
Treppen stieg ich empor,
ging über Pflasterstraßen,
Züge trugen mich fort,
Wasser brachten mich her,
und auf der Haut der Trauben
meinte ich dich zu fühlen.
Das Holz gab unversehens
mir Berührung mit dir,
und die Mandel verhieß mir
deine heimliche Sanftheit,
bis deine Hände sich
schlossen auf meiner Brust,
um hier nun wie zwei Flügel
zu beenden die Reise.
Pablo Neruda
(übersetzt von Fritz Vogelsang)
Haustreppe
Die Sommerhitze lag auf dem Hausdach über dem Obergeschoß wie ein Heizkissen auf der höchsten Stufe. Einige Strahlen schoben sich durch die Spalten der Fensterläden und heizten den Teppichläufer vor dem Kleiderschrank auf, sodass die Barfüße brannten und sie wie ein armer Tanzbär zu trippeln begann. Die Ahornbäume am Ufer des Baches vor dem Häuserblock dösten faul vor sich hin. Ab und zu schreckten sie auf, wenn eine leichte Wasserbrise zu ihnen hochschwang. Wendelgard stand vor dem Schrankspiegel und sah darin zu, wie ihre Mutter sie anzog. Das neue Kleid durfte sie heute tragen. Vor ein paar Tagen hatte sie es zu ihrem dritten Geburtstag geschenkt bekommen. Zum Sonntagnachmittagsspaziergang mit Mama, Bruder, Oma und Opa putzte Mama die Kinder heraus. Das Kleidchen war leichtstoffig und ziemlich lang, da es ja wo möglichst nächstes Jahr noch passen sollte. Ein Gefühl von Eleganz und Schönheit rieselte die kleinen Fältchen hinunter. Sie betastete die gesmokte Partie auf der Brust und betastete die kleinen bunten Blüten auf dem zart lindgrünen Stoff. Millefleurs sur les prés (tausend Blümchen auf den Wiesen). Lindgrün waren auch ihre Augen; manchmal, wenn die Sonne eintrat, schien die Iris honiggelb, von einem türkisblauen Ring umgeben; bernsteinen meinte ihre Patentante. Mama sagte nie etwas über ihre seltene Augenfarbe. Für sie gab es braun, wie ihre eigenen, oder blau wie die von Papa.
„So ein schönes Kleid, Mama!“
„Gefällt es dir?“
„O ja, sehr!“
Das Mädchen stand ganz versonnen im Schattenspiel des Lichts, wach und schläfrig zugleich. Ihr Fühlen entschwebte in eine von ihr nicht zu benennende Dimension, eingelullt von einem federleichten Augenblick. Der warf ins Kleidchen Samen, die bis in ferne Epochen ihre Fruchtbarkeit bewahrten.
„Nein, das Strohhütchen nicht! Nein. Es sperrt meinen Kopf so ein!“
„Das Hütchen muss sein, wegen der Hitze.“
Sie fügte sich, ungern.
„Pass auf, dass du es nicht wieder verlierst! Wie die anderen.“
Wendelgard trug dieses Geschehen mit sich in die Jahre als etwas Kostbares. Zum ersten Mal war sie bewusst eingetaucht im Meer des Schönen und in seinem sanften Fließen mitgeschwommen, hatte seinen Farbzauber beäugt und seinen erfrischenden, betörenden Duft gerochen.
Im Alltag nahm sie gerne das Edle wahr und bezeichnete es so. Frieder, ihr Mann, hatte eines Tages angefangen, sie damit zu necken oder ironisch zu treffen, indem er sie so benannte oder ihrem Urteil zuvorkam, gespreizt sprechend: „Das ist aber edel.“
Das Wort war prall gefüllt mit erlebten Augenblicken, ein Schatzsäcklein von reinen Gedanken, wahrhaftigem Handeln, echten Empfindungen, klaren Gerüchen, Gesichten, Lauten, Farben und Formen, die mehr Reichtum ausmachten als materieller Wohlstand. Sie fühlte sich geschaffen, Besonderes, Glanzvolles aufzuspüren und auch davon zu sprechen. Dies aber interessierte andere oft gar nicht und sie hielten sie bei Gesprächen für übersteigert oder unverständlich und schwenkten ungeniert zu einem anderen Thema ab. Es berührte sie mit bitter schmeckender Beschämung und druckte im Hals. Ganz selten traf sie jemanden, der mit ihr in die gelbgrüne Sphäre entgleiten wollte. Das war Glück pur.
In den Räumen der Abtei war es an jenem Morgen kühl. Wendelgard betrat deshalb gar nicht erst den Pilger-Shop, sondern drängte nach draußen, in die Sonne. Ein wenig Zeit blieb ihr noch zum Umschauen. Die Umgebung der Basilika bestach durch Ästhetik und Pflege und zeigte ein sonntägliches Gehabe. Angelockt von einem eigenartigen Singsang schlug sie den Weg zu einem Aussichtspunkt ein, von wo man einen reizvollen Blick auf das südliche Jerusalem genießt. Gleiches Vorhaben hatten auch einige Globetrotter. Kein Auto störte die Ruhe; die Leute nutzten das Sträßchen zum Verweilen und Plaudern. Eine hohe Mauer aus Jerusalem-Bruchsteinen an seinem Rand bildete den Bühnenhintergrund für ein skurriles Geschehen.
König David trat da auf, in hellblauer Tunika, golden gegürtet, golden gekrönt, die Füße in Sandalen. Er tänzelte wie damals, als er die Bundeslade zum Heiligtum hinauf begleitete, und seine Frau Michal sich seiner kindischen Attitüde wegen schämte. Die Komik sprang über auf die Zuschauer; einige ließen sich mitbewegen von seinem eigenartigen Geliedel, einem Mix aus Welt- und Herzenssprachen, den er mit einer Karneval-Kinderharfe beleierte. Zugleich ernüchterte die Bloßstellung, da sie ihn angreifbar machte. Sich den Stimmungen und Erwartungen der Beschauer auszusetzen, verlangt Mut. Der beliebteste Herrscher dieses Landes war gleichsam das Vorbild für die Spezies homo ludens. Wieder einer mit dem Jerusalem-Syndrom, meinte jemand im Vorbeigehen herablassend.
Als er eine Kleingruppe anträllerte, hielt sie an und reagierte auf seine Drei-Ton-Konversation. Im Verlauf derselben setzte er einer der Frauen eine zweite Krone auf und stellte sie mit Ehrerbietung dem Publikum vor, ihre
Hand galant zur Schulterhöhe führend:
„Halleluja, die Königin aus … (sie nannte das Land) mit Namen … (Maria, sagte sie) Maria.“
Auch ihre Begleiter segnete er und huldigte ihnen. Fröhlich gingen sie auf sein liebenswürdiges Getue ein und tanzten rhythmisch mit, in einem Variationsschritt von Samba. Selbstverständlich schossen sie auch Fotos von ihrer Krönung. Denn zu Hause glaubte man ihnen gewiss nicht ohne Beweise.
Anscheinend hatte ihn Wendelgard so entzückt und berührt angeschaut, er lud sie mit Blicken zum Unterhalten ein. Bereitwillig teilte er aus seinem Leben mit: Hier sei er schon einmal gewesen vor ein paar Jahren; danach sei er weit gereist; Kinder habe er in einer fernen Stadt. Die Stürme seines Lebens hätten sich mittlerweile beruhigt, er wolle nun endlich die Verantwortung für seine Familie übernehmen. Aber heute sei er noch mal König David, der ja auch Schuld auf sich geladen. Mit seinem Spiel wolle er die Menschen in dieser hektischen und unfriedlichen Stadt ein wenig erfreuen. (Auf einen Spendenteller hatte er tatsächlich verzichtet.)
„Ein gläubiger Mann hat mir, es ist einige Zeit her, eine Geschichte erzählt, die mich zu meinem Handeln animiert hat. Wollen Sie sie hören?“
„Sehr gerne.“
„Der Läufer Gottes Elias erschien einmal einem Rabbi auf einem Marktplatz. Dieser fragte ihn, ob unter den vielen Menschen hier einer wäre, der an der künftigen Welt Anteil haben würde. Drei nannte ihm der Prophet. Zwei davon waren Spaßmacher, die ihre Possen so begründeten: Sehen wir jemanden betrübt, so erheitern wir ihn; wenn Leute sich zanken, bringen wir sie zum Lachen.“
Weiter strich David seine Leier, bog die Hüfte nach links und mit sachtem Schwung nach rechts zu einem schaukelnden Hüpfschritt und zitterkrähte hold sein Hosianna.
Das Kleidchen war eines Tages verschwunden. Ebenso ein dunkelblaues Strickkleid mit besticktem Brusteinsatz. Papa hatte es „verfuggert“ gegen einen Rucksack Kartoffeln und ein paar Eier. Ebenso weg war ein Matrosenanzug des ein Jahr älteren Bruders Wolfgang. Ob er ihn auch so vermisste? Sie jedenfalls weinte. Mama war mittraurig und tröstete, so gut sie in ihrem eigenen Kriegsleid konnte. Jedoch, das Essen wärmte den knurrenden Bauch und füllte wohl. Wendelgard merkte auch wie alle in der Familie, wie gut es war, satt zu sein. Aber der Verlust der Kleidchen war schmerzlich und unbegreiflich. In den Tränen versalzten die angenehmen Gefühle und brannten bis in die Brust. Unwiederbringlich Verlorenes tat weh. Es ohnmächtig hinnehmen zu müssen tat noch weher und zwickte. Der Schmerz bekleckerte die Erinnerung und trocknete zu einer braunen Kruste. Diese bedeckte das Plattförmchen ihres kleinen Lebens, klebte sich an ihre Füßchen, mit denen sie oft stolperte, auf ebenem Boden. Die Knie waren ständig eitrig und zugepflastert.
Eine Bombe hatte ihre Miet-Etage getroffen und sie wohnten nun eine Weile bei den Großeltern im Haus. Großvater, ein Schreiner, hatte eine Holztreppe gebaut, vom Erdgeschoß in den ersten Stock, welche das Kind liebte. Von da aus führte noch eine steile Stiege, hinter einer Flurtür zugänglich, auf den Speicher. Weitere drei Treppen aus Sandstein gab es außerdem draußen. Von einem kleinen Vorplatz, auf den der Hausflur zulief, ging eine, schon etwas ausgetreten, in den Hof hinunter und von da eine, glitschig bemoost in den nassen Jahreszeiten, in den Keller. Nicht zu vergessen die Eingangstreppe auf der Straßenseite, von einem Mauerbogen überdacht. Treppen, die kleine Absätze hatten, Mäuerchen, Nischen zum Spielen, Verstecke. Kein großes Haus, nach dem ersten Weltkrieg gebaut und von den sparsamen Großeltern abgezahlt. Kein Schloss Chambord mit vierundachtzig Treppen. Aber mit genug Treppen, um das Steigen hinauf und hinab zu üben.
Sie meidet heute das Treppengehen. Die Knie tun es nicht mehr locker. Besonders das Rechte ist verschleißgeschädigt. Vor drei Jahren wurde es operativ behandelt. Nur langsam trat Besserung ein. Eine Erlösung, wieder Strecken gehen zu können, Wanderungen zu machen mit ihrem Mann und Freunden, Rundgänge um den Ort, im Burgpark, in näherer und entfernterer Natur. Auf Bahnhöfen nutzt sie den Aufzug, um aus der Unterwelt hinaufzusteigen und umgekehrt von der Lichtwelt hinunter. Wenn er nicht funktioniert, lässt sie beim Treppensteigen den Strom der hastenden Menschen an sich vorbei und nimmt äußerst seitlich eine Stufe nach der andern, im Zeitlupentempo.
Die Massivholztreppe in ihrem eigenen Haus war anstelle einer „steilen Hühnerleiter” von einem Kunstschreiner aus dem waldigen Umland millimetergenau eingesetzt worden. Sie war die teuerste Investition gewesen (teurer als die Heizung), die sie in dem älteren Bau getätigt hatten. Für weitere Verschönerungen blieb kein Geld mehr. Aus einem hellbraun, leicht rötlich schimmernden Hartholz gefertigt, dreht sie sich unten für sechs Stufen um einen massiven Pfeiler empor, eine Spindel, ein Stückchen Wendeltreppe formend. Der Meister bedauerte, kein Schnitzbild in den Pfosten machen zu dürfen, für einen Luxusaufschlag, ein Berufssymbol oder ein religiöses. Wie waren seine Vorlagen kunstvoll! Ansehnlich ist er dennoch geworden in seiner einfachen, klaren Struktur: glatt, glänzend und griffig, dreistöckig, wobei die unteren Teile runde und eckige Ausbuchtungen haben. Die Enkelkinder schleudern mal schnell ihren Anorak darüber. Ein Geländer aus schön geschwungenen Latten strebt hinauf.
Gleichwohl erhielt die Treppe schon beim Einsetzen eine Kerbe auf der dritten Stufe, weil nämlich ein Arbeiter seinen Hammer von oben herabfallen ließ. Schon drei Jahrzehnte narbt sie da. Sie hatten nach erstem Zetern (insbesondere jammerte Wendelgard, das Ungeschick mit seiner hässlichen Auswirkung nicht fassen zu wollen) kein Aufheben mehr darum gemacht und sie akzeptiert, dem Ablauf der Ereignisse zugehörig.
Die metallene Kellertreppe beließen sie, obwohl sie kein ideales Steigungsverhältnis hat (die senkrechte Setzstufe misst höher als von der Bauordnung vorgegeben), weswegen Wendel erst nur ungern und bald gar nicht mehr hinunterging, aus Protest, weil Friedrich keine Handlungsnotwendigkeit sah. Ebenfalls blieb die ausziehbare Bodentreppe ein Provisorium und ein Tabu für die Hausfrau. Lediglich war sie ihrem Mann von unten her behilflich, wenn er die Weihnachtskisten und die Koffer runter reichte. Sie empfand diese beiden Behelfstreppen als eine Einengung ihrer Steigmöglichkeiten.
Auf Großvaters Treppe verweilte sie gerne, sitzend, guckte durch die gedrechselten Stäbe in den Flur, dideldumdeite Kinderreime und Liedchen, lernte Gedichte, lutschte eine rotgestreifte Zuckerstange in Kirmes- und Jahrmarktzeiten. Herrlich ließ es sich auf dem Zwischenpodest spielen. An Weihnachten stand ihre Puppenküche da; und einen Tritt höher das Puppenschlafzimmer. Das Christkind hatte eine gute Wahl getroffen, ihr einen vom übrigen Familientrubel so abgelegenen Platz zu schenken. Ungestört konnte sie hier plaudern und mimen, Möbelchen verrücken, manchmal auch mit einer Straßenspielfreundin. Ein Weihnachtsglück, das bis zu Ostern reichte. Von außen betrachtet absolut nichts Spektakuläres, kommentierte sie, erwachsen geworden, dieses Winkeltreiben.
Später las sie darauf. Wenn sie zu sichtbar und zu lange auf der Treppe las, schimpfte Mama und rief sie zu einer Arbeit. Lesen war ein rotes Tuch für sie. Zwangsläufig entdeckte Wendelgard ein neues Lese-Land. Unter Großmutters weinrotem Plüschsofa, von dem lange Troddeln vorne herunterbaumelten, ließ es sich unbemerkt herrlich lesen und tagträumen. Nur dass sie danach meist, von feinen, grauen Flusengebilden umwoben, als Spinnenfee wieder auftauchte, denn mit Putzen nahmen es die beiden Mütter nicht so ernst.
Auch Wolfgang nutzte die Stufen. Seine Messdiener-Gebete lernte er auswendig, indem er laut skandierend „Ad-de-um-qui-lae-ti-fi-cat-iu-ven-tu-te-me-a” hoch und abwärts lief. Weil sie Gefallen an dem fremden Klang und dem eigenartigen Sprachrhythmus hatte, sprach und sprang sie ihm hinterher. Leider durfte sie, eine Ungerechtigkeit in ihren Augen, keinen Altardienst verrichten. Die Gebete aber hat sie nicht umsonst geleiert. „Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf …“ Für sie bedeutete dies ganz klar: Hinauf! Und das Latein, quasi die Schmiere fürs Emporschreiten, von Papa hochgeschätzt und gekonnt, blieb ihr gefällig und sie lernte es später.
Heute liest sie nicht mehr auf der Treppe im Flur ihres Hauses. Nur zum Schuhebinden sitzt sie auf der zweituntersten Stufe; der Schuhlöffel hängt deswegen gleich daneben an der Wand. Auch zum Telefonieren nimmt sie gelegentlich Platz da. Das Träumen und Fabulieren findet woanders statt. Oder überhaupt nicht? Phasenweise schon noch und auch intensiv, nach nächtlichem Aufwachen in Seitenlage im Bett und im Morgengrauen auf dem Rücken liegend, wenn sich die Zimmerwände voneinander trennen und der Blick in den Kosmos schweifen kann.
In einer Tabelle erfasst sie gerade alle Pros und Contras zum Verbleiben in ihrem eigenen Haus. Eine innere Unruhe treibt sie schon etliche Jahre dazu, sich mit einem Umzug zu befassen. Um nicht aus irgendwelchen Launen heraus zu entscheiden, macht sie eine sachliche Bestandsaufnahme. Siehe da, die Pro-Spalte ist viel länger und weist ihre wichtigsten, guten Kontakte auf, die aufzugeben leichtfertig wäre. An oberster Stelle die zu ihren Kindern und Enkelkindern, die um die Ecke wohnen. Sämtliche baulichen Lücken und Reparaturnotwendigkeiten (kaum zu glauben, dass Keller- und Speichertreppe schon seit dreißig Jahren hätten erneuert werden müssen) stehen bei Contra. Ein Narr, wer glaubt, dies jetzt noch bewerkstelligen zu können oder wollen. Die Flurtreppe, ihr früher so lieb, rangiert auf dem negativen Depot ganz oben. Hinaufkommen ist nun anstrengend geworden, mangels Wendigkeit. Gewiss, es gibt Treppenlifte. Nein, einen solchen zu nutzen, erscheint ihr geradezu grotesk. Sich hochfahren zu lassen, statt zu gehen, wenn auch zuweilen schon recht mühsam, mitnichten!
Und wie wär´s mit einer Wohnraum-Reduzierung? Im Erdgeschoß verbliebe genug Raum zum Leben. Bescheiden zwar, aber ausreichend. Auf einer Ebene leben! Ein körperlich empfundenes Verlangen. Nicht mehr steigen müssen. Nicht mehr Angst vorm Rutschen oder Fallen haben; sie trägt im Herbst und Winter graue, glatte Filzlatschen ohne feste Sohle. Zweimal ist sie schon einige Stufen herunter geglitten, schmerzhaft auf dem Hintern. Alles schön und gut, allein - es fehlt das Ein-Verständnis ihres Mannes. Er denkt und fühlt nicht so. Oder fürchtet er den Aufwand einer Veränderung? Gespräche braucht es, Kompromisse.
Als ihr die geliebten Kleidchen genommen worden waren, so mit vier, nahm sie sich eines wieder.
Die Kusine Rosalia besaß eine ganze Schar von Puppen in allen Größen, dazu eine Unmenge Kleidchen und Mäntelchen, Röckchen und Käppchen, sodass sie den ganzen Tag mit An- und Ausziehen hätte beschäftigt sein können. Wenn Wendelgard sie besuchte im zehn Kilometer entfernten Dorf, so alle paar Wochen (Mama fuhr mit dem Fahrrad, und sie saß auf dem Gepäckträger), dann badete sie in diesen Mädchenherrlichkeiten. Ihre eigene Entbehrung diesbezüglich löste sich in dem Stoffhaufen auf wie ein Eisklumpen in warmem Wasser, und sie griff nach den feinsten Stücken für ihre bevorzugten Puppen und kleidete sie an. Röschen schaute eine Weile zu und enteilte - gelangweilt.
„Schenkst du mir ein Kleidchen, nur ein ganz kleines, für meine einzige Puppe, sie hat nichts zum Wechseln?“
Rosa lehnte strikte und perfide ab, die Absage geradezu genießend.
Da keimte in Wendi der Vorsatz, bei Gelegenheit eines einfach mitzunehmen, es einzustecken, zu mopsen. Wäre das gestohlen? „Nein, nein! Sie hat doch so viel! Sie merkt doch gar nichts.“
Aber haben Mama und Papa ihnen, den beiden Kindern, nicht fest eingebläut, dass man nicht stehlen darf? Stehlen ist was Schlimmes. Da ist man böse. Sie wollte gut sein.
Seufzend faltete sie die Sachen zusammen, lustlos.
Beim übernächsten Besuch, ließ sie ein rotkariertes Gretel-Kleidchen mitgehen, mit grünen Litzen am Saum und kurzen Ärmelchen. Es zog so schwer in der Jackentasche und war doch nur so winzig und leicht.
Sie wunderte sich über sich. Sie kannte sich nicht mehr. War sie das? War da wirklich ein Kleidchen? Der Gepäckträger schnitt arg in die Oberschenkel, wie noch nie. Immer wieder betastete sie das Diebesgut. Nach der halben Wegstrecke hoffte sie, es sei weg, verloren gegangen, habe sich mit leisem Peng verpufft.
Niemals zog sie es ihrer Puppe an, es passte auch nicht, war viel zu eng. So lag es nun auf dem Boden ihrer Schachtel, ganz zuunterst ihrer Habseligkeiten, wertlos geworden, unbedeutend, Plunder, und doch ein gewichtiges rotes Schamstück.
Keine Erinnerung gibt es mehr daran, wann sie es entsorgt hatte. Sie hatte sie verdrängt. Zu alledem log sie auch noch, vorsätzlich. Rosalia hatte doch tatsächlich diesen „Zottel” vermisst. Die Tante hatte Mama nach dem Verbleib besagten Fummels gefragt und gemutmaßt, dass Wendelgard ihn entwendet haben müsste.
Mama entrüstete sich über ihre Kusine. Ihre Tochter und stehlen! Eine freche Behauptung. (Sie war ihrer Kusine sowieso nicht grün.) Verletzt war ihr Stolz; sie wehrte schnippisch ab. Auf der anderen Seite, die der beiden Basen, schlugen die Zweifel Blasen.
„Du hast das Kleidchen doch nicht mitgenommen?“, fragte Mama.
„Hab ich nicht.“ Wendis Stimme zitterte nicht.
„Wusste ich ´s doch.“
Als wäre es die steinerne Hoftreppe hinunter gefallen und hart, sehr hart aufgeschlagen, erging es dem Kind. Schmerzlich der Aufprall, dunkel der Bluterguss inwendig, gebildet aus dem Schock, etwas gemacht zu haben, was es eigentlich gar nicht gewollt hatte, das einfach so über es gekommen war, das ihm passiert war, das schlecht war, das es aber getan hatte, das es jetzt verabscheute! Und das für so einen hässlichen, gemeinen Fetzen. Jetzt war ihr inneres Gewand, ihr Engelskleid befleckt.
Ein zweiter Absturz folgte bald darauf, wie vom ersten angezogen. Zu Ostern.
Dieses Fest! Im beginnenden Frühling erblühte es wie eine Blume, eine Narzisse, gelb und fröhlich.
Bunt das Nest! Blaue, grüne, lila Eier! Der rote Zuckerhase! Auf frischem Moos gebettet! Sie hatten es im nahen Tal gepflückt und dabei den Osterhasen über einen Acker flitzen sehen, während Mama den jungen Löwenzahn für Salat stach. Die Veilchen märzten so lieb, als das Mädchen ihre violetten Köpfchen hob.
Ein Spielzeug gab es außer dem Eiernest. Wendelgard leb-, leib-, liebte Ostern, weil überall in allem etwas strömte, was sie nicht benennen konnte aber spürte, etwas, was Mamas Gesicht entspannte und Papa scherzen ließ.
In der frühen Morgenstunde erwachte sie, vor der Zeit, sofort hellwach. War der Hase schon dagewesen? Warum warten bis nach dem Frühstück? Schon mal vorweg lugen! Aber so, dass die Eltern es nicht merken. Sie würden schimpfen. Papa war für Disziplin, er war Soldat. Mama hätte mehr Verständnis, sie hasste seine Auffassung von Zucht und Ordnung. Leise stahl sie sich aus dem Bett und schlich zur Loggia. Die Tür war angelehnt. Da lag das Nest, neben einem Blumentopf. In der zwielichtigen Dämmerung eingehüllt in Grau.
Die Osterfreude war kaputt, weggeflogen wie die Glocken der Kirche am Karfreitag. Futsch!
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht … in das sehnsuchtsvolle Herz …
Ernüchtert, enttäuscht zog sie sich die Decke über den Kopf. Beschämt war sie, tief, und wälzte sich unruhig in einen Halbschlaf, bis Mama kam und sie weckte.
Es kam keine rechte Freude mehr in ihr auf, gleichwohl sie sich beim Eiersuchen anstrengte und so tat, als ob sie überrascht sei. Das vergrößerte auch noch die Scham und beschattete ihr Herz.
Spätere Ostern verliefen schön. Im Garten des großelterlichen Hauses suchten sie die Nester. Ihres lag im Rhabarber, unter den frischen Blättern, meist ein bunter, dicker Ball daneben. Eine leuchtende Kugel, die so fremd nach frischem Gummi roch und glänzte, und so verführerisch Spiellust erzeugte. Unterm Zwetschgenbaum ragten die Stelzen hervor. Großvater zimmerte sie jährlich neu. Auf Stelzen laufen war eine Leidenschaft. Von der Erde auf die Fußsockel, hochhieven und los. Die Geschwister konnten es meisterlich, spielten sogar Fangen auf den Holzbeinen, staksten die Treppen damit rauf und runter. Nie gab es eine Verletzung. Wohl ein Wackeln, das man aber abfing. Groß sein, Höhenluft atmen, weit blicken. Die Stupsnase schnupperte mit empor und ließ sich von Mamas irrsinniger Korrektur-Maßnahme, einer aufgesteckten Wäscheklammer, nur für Sekunden geduldet, nicht gerade richten.