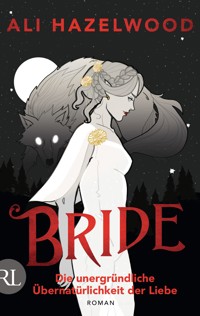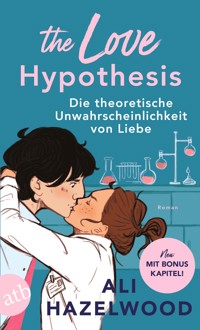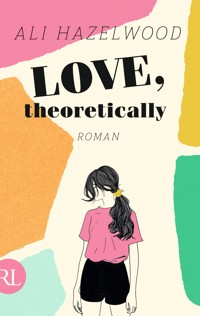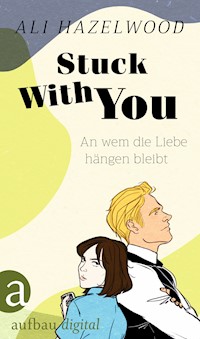Die Unannehmlichkeiten von Liebe – Die deutsche Ausgabe von „Loathe to Love You“ E-Book
Ali Hazelwood
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Steminist Novellas
- Sprache: Deutsch
Zu blöd, dass ich dich liebe …
Die Naturwissenschaftlerinnen Mara, Sadie und Hannah sind es gewohnt, sich in männlichen Domänen zu behaupten. Und sie wissen: In der Wissenschaft – wie in der Liebe – sind es die Gegensätze, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen. Obwohl sie also vernünftig genug sein sollten, ihren Erzfeinden aus dem Weg zu gehen, findet sich Mara mit dem Mitbewohner aus der Hölle unter einem Dach. Und während Sadie ihrem fiesen Ex ungewollt nahekommt, ist Hannah in einer existenziellen Notlage auf ihren niederträchtigen Kollegen angewiesen. Schon bald geraten alle drei in Gefahr, sich die Finger an ihren (nervtötend heißen) Gegenspielern zu verbrennen …
Drei unwiderstehlich heiße, lustige, feministische Storys über drei junge Naturwissenschaftlerinnen und ihren Kampf um die Karriere – und die Liebe
Mit exklusivem Bonusmaterial – und dem schönsten Gruppen-Happy-End ever!
In diesem Band erscheinen zum ersten Mal gemeinsam die drei Storys »Under One Roof – Liebe unter einem Dach«, »Stuck With You – An wem die Liebe hängen bleibt« und »Below Zero – Die unerwarteten Abgründe der Liebe«, die bereits einzeln als E-Book veröffentlicht wurden.
Sie werden ergänzt von einem exklusiven Bonuskapitel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Hannah, Mara und Sadie und sind beste Freundinnen und wissen als Naturwissenschaftlerinnen nur zu gut, was für explosive Reaktionen extreme Gegensätze mitunter auslösen. Und dennoch findet sich Umweltwissenschaftlerin Mara mit dem unausstehlichen Liam, Konzernanwalt und Klimazerstörungs-Lobbyist der übelsten Sorte, in einer Zwangs-WG wieder – unkalkulierbar emotionale Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Genau deshalb meidet Sadie ihren Ex, einen wikingerhaften Alptraum namens Erik. Bis sie mit ihm in einem winzigen Aufzug steckenbleibt – und als gute Ingenieurin weiß sie leider, dass veränderte Variablen in einer Gleichung auch ein neues Ergebnis zur Folge haben.
NASA-Wissenschaftlerin Hannah verlässt sie ohnehin nicht auf Gefühle, sondern auf Algorithmen und automatisierte Steuerung. Doch als sie sich in den frostigen Weiten der Arktis in Not gerät, muss sie nicht nur die Hilfe ihres Erzfeinds Ian akzeptieren – sondern auch, dass es in Fragen der Chemie zwischen ihnen heiß hergeht …
»Hazelwood ist ein absolutes Romance-Powerhouse.« Christina Lauren, New York Times-Bestsellerautorin
Über Ali Hazelwood
Ali Hazelwood hat unendlich viel veröffentlicht (falls man all ihre Artikel über Hirnforschung mitzählt, die allerdings niemand außer ein paar Wissenschaftlern kennt und die, leider, oft kein Happy End haben). In Italien geboren, hat Ali in Deutschland und Japan gelebt, bevor sie in die USA ging, um in Neurobiologie zu promovieren. Vor Kurzem wurde sie zur Professorin berufen, was niemanden mehr schockiert als sie selbst. Ihr erster Roman »Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe« wurde bei TikTok zum Sensationserfolg und ist ein internationaler Bestseller. Zuletzt erschien von ihr bei Rütten & Loening »Das irrationale Vorkommnis der Liebe«.
Mehr unter: www.AliHazelwood.com
Instagram: @AliHazelwood
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ali Hazelwood
Die Unannehmlichkeiten von Liebe – Die deutsche Ausgabe von „Loathe to Love You“
Aus dem Amerikanischen von Anna Julia Strüh
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Under One Roof — Liebe unter einem Dach
Prolog — Gegenwart
Kapitel 1 — Sechs Monate zuvor
Kapitel 2 — Fünf Monate und zwei Wochen zuvor
Kapitel 3 — Fünf Monate und eine Woche zuvor
Kapitel 4 — Vier Monate und drei Wochen zuvor
Kapitel 5 — Vier Monate und zwei Wochen zuvor
Kapitel 6 — Vier Monate zuvor
Kapitel 7 — Drei Monate zuvor
Kapitel 8 — Einen Monat und zwei Wochen zuvor
Kapitel 9 — Einen Monat zuvor
Kapitel 10 — Drei Wochen zuvor
Kapitel 11 — Zwei Wochen zuvor
Kapitel 12 — Eine Woche zuvor
Kapitel 13
Epilog — Sechs Monate später
Stuck With You — An wem die Liebe hängen bleibt
Kapitel 1 — Gegenwart
Kapitel 2 — Drei Wochen zuvor
Kapitel 3 — Gegenwart
Kapitel 4 — Drei Wochen zuvor
Kapitel 5 — Gegenwart
Kapitel 6 — Drei Wochen zuvor
Kapitel 7 — Gegenwart
Kapitel 8 — Drei Wochen zuvor
Kapitel 9 — Gegenwart
Kapitel 10 — Zwei Wochen und sechs Tage zuvor
Kapitel 11 — Gegenwart
Kapitel 12
Epilog — Einen Monat später
Below Zero — Die unerwarteten Abgründe der Liebe
Prolog — Spitzbergen, Norwegen Gegenwart
Kapitel 1 — Johnson Space Center, Houston, USA Ein Jahr zuvor
Kapitel 2 — Caltech Campus, Pasadena, Kalifornien Fünf Jahre und sechs Monate zuvor
Kapitel 3 — Spitzbergen, Norwegen Gegenwart
Kapitel 4 — Johnson Space Center, Houston, Texas Ein Jahr zuvor
Kapitel 5 — Spitzbergen, Norwegen Gegenwart
Kapitel 6 — Johnson Space Center, Houston, Texas Sechs Monate zuvor
Kapitel 7 — Spitzbergen, Norwegen Gegenwart
Kapitel 8
Kapitel 9
Epilog — Jet Propulsion Lab, Pasadena, Kalifornien Neun Monate später
Bonuskapitel — Eine Weile danach
Liam
Erik
Ian
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Under One Roof
Liebe unter einem Dach
Für Becca, die einfach die Beste ist und das beste Stichwort hatte
Prolog
Gegenwart
Beim Anblick des dreckigen Geschirrs in der Spüle gelange ich zu einer schmerzhaften Erkenntnis: Es hat mich übel erwischt.
Nein, eigentlich stimmt das nicht. Ich wusste auch schon vorher, dass es mich übel erwischt hat. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre das der eindeutige Beweis: dass ich nicht einmal einen kurzen Blick auf ein Nudelsieb und zwölf dreckige Gabeln werfen kann, ohne Liams dunkle Augen vor mir zu sehen, wenn er mit verschränkten Armen an der Küchentheke lehnt, und seine strenge, dabei spöttische Stimme zu hören: »Ist das eine postmoderne Kunstinstallation? Oder haben wir einfach kein Spülmittel mehr?«
Und das, nachdem ich spät nach Hause gekommen bin und dabei nicht umhinkam, zur Kenntnis zu nehmen, dass er das Licht auf der Terrasse für mich angelassen hatte. Das … oh, das versetzt meinem Herzen einen Schluckauf, einen ebenso wunderbaren wie qualvollen. Was außerdem Herzschluckauf auslöst: Ich denke daran, das Licht auszuschalten, als ich reingehe. Was mir gar nicht ähnlich sieht – womöglich ein Beweis, dass der Chia-Samen-Brei, den er mir zum Frühstück macht, wenn ich morgens spät dran bin, mein Gehirn tatsächlich besser arbeiten lässt.
Es ist gut, dass ich beschlossen habe auszuziehen. Besser so. Dieser Herzschluckauf ist auf Dauer nicht tragbar, weder in kardiovaskulärer Hinsicht noch was meine geistige Gesundheit angeht. Zwar bin ich ein blutiger Anfänger in der Kunst des Schmachtens, aber ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass es alles andere als ein kluger Move ist, mit einem Typen zusammenzuwohnen, den man früher mal gehasst, in den man sich dann aber irgendwie Hals über Kopf verliebt hat. Vertraut mir, ich habe einen Doktor.
(Zwar in einem vollkommen anderen Fachgebiet, aber egal.)
Doch das Schmachten hat auch sein Gutes: Es ist ein konstanter Quell nervöser Energie. Es lässt mich beim Anblick dreckigen Geschirrs denken, dass es doch Spaß machen müsste, die Küche aufzuräumen. Als Liam hereinkommt, folge ich gerade dem unerwarteten Drang, die Spülmaschine einzuräumen. Ich blicke auf, sehe ihn im Türrahmen stehen und befehle meinem Herzen, keinen Schluckauf zu bekommen. Natürlich lässt es sich davon nicht abbringen – als Zugabe macht es noch einen Salto.
Mein Herz ist ein Arschloch.
»Wahrscheinlich fragst du dich, ob mich ein Einbrecher mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen hat, den Abwasch zu erledigen.« Ich lächle Liam strahlend an, ohne wirklich mit einer Reaktion zu rechnen, denn – er ist Liam. Seinen Gesichtsausdruck zu lesen ist so gut wie unmöglich, doch ich versuche schon lange nicht mehr, klare Hinweise bei ihm zu erkennen, ich fühle sie einfach. Seine Belustigung ist schön und warm, und ich will darin baden. Ich will ihn dazu bringen, den Kopf zu schütteln, auf diese unverkennbare Art »Mara« zu sagen und gegen seinen Willen zu lachen. Ich will mich auf die Zehenspitzen stellen, ihm die verirrte dunkle Strähne aus der Stirn streichen und mich an seine Brust schmiegen, um den frischen, herrlichen Duft seiner Haut einzuatmen.
Doch ich bezweifle, dass er irgendetwas davon will. Also wende ich mich ab und spüle eine Müslischüssel, die sich unter dem Nudelsieb versteckt hat.
»Ich dachte eher, dein Bewusstsein würde von den parasitären Sporen gesteuert, die wir in dieser Doku gesehen haben.« Seine Stimme klingt voll und tief. Sie wird mir so sehr fehlen.
»Das waren Seepocken – ich wusste doch, dass du mittendrin eingeschlafen bist.« Er antwortet nicht. Was völlig in Ordnung ist, denn – Liam. Ein Mann weniger Worte. »Du kennst doch unseren kleinen Nachbarshund, oder? Diese Französische Bulldogge? Er ist wohl bei einem Spaziergang abgehauen, denn er kam gerade mitten auf der Straße auf mich zugerannt. Mit loser Leine und so.« Als ich nach einem Geschirrtuch greife, stößt meine Hand gegen Liam. Nun steht er direkt hinter mir. »Ups. Sorry. Jedenfalls habe ich ihn nach Hause getragen, und er war so süß …«
Abrupt halte ich inne. Denn auf einmal steht Liam nicht nur hinter mir, ich werde gegen die Spüle gedrängt, die Kante der Arbeitsplatte drückt gegen meine Hüfte, und direkt hinter mir ragt eine Wand aus purer Hitze auf.
O mein Gott.
Ist er … Ist er gestolpert? Bestimmt ist er gestolpert. Das ist ein Versehen.
»Liam?«
»Ist das okay, Mara?«, fragt er, zieht sich jedoch nicht zurück. Er bleibt, wo er ist, seine Brust an meinen Rücken gepresst, die Hände zu beiden Seiten meiner Hüften auf die Arbeitsplatte gestützt, und … Träume ich? Ist das ein von Herzschluckauf ausgelöstes kardiovaskuläres Ereignis? Wandelt mein Gehirn meine schändlichsten nächtlichen Phantasien auf einmal in Halluzinationen um?
»Liam?«, keuche ich atemlos, als er sein Gesicht in meinen Haaren vergräbt. Direkt über meiner Schläfe, mit der Nase und vielleicht auch dem Mund, was mir wie Absicht vorkommt. Überhaupt nicht wie ein Versehen. Ist er …? Nein. Nein, sicher nicht.
Doch dann legen sich seine Hände auf meinen Bauch, und in diesem Moment wird mir klar, dass es diesmal anders ist. Das fühlt sich nicht an wie all die flüchtigen Berührungen im Flur, wenn sein Arm im Vorbeigehen den meinen gestreift hat, von denen ich seit Monaten besessen bin. Das fühlt sich nicht an wie jenes eine Mal, als ich über mein Computerkabel gestolpert und fast auf seinem Schoß gelandet bin, und auch nicht wie jener Moment, als er zärtlich mein Handgelenk hielt, um zu sehen, wie schlimm ich meinen Daumen an der Herdplatte verbrannt hatte. Das fühlt sich … »Liam?«
»Schhh.« Ich spüre seine Lippen an meiner Schläfe, warm und beruhigend. »Es ist alles gut, Mara.«
Meinen Bauch durchströmt eine feuchte Wärme.
Kapitel 1
Sechs Monate zuvor
»Ganz im Ernst, unter einem Dach leben ist die irreführendste und am meisten Harmonie vorgaukelnde Bezeichnung, die ich je gehört habe. Fehlerhafte Stromkabel? Missbrauch von Heizanlagen? Verdacht auf Brandstiftung? So was gibt es doch nicht bei zwei Leuten, die einigermaßen friedlich nebeneinanderher leben. Wisst ihr, woran ich bei unter einem Dach denken muss? Bazookas. Flammenwerfer. Sirenen, die in der Ferne heulen. Denn nichts setzt ein Dach größerer Gefahr aus als zwei Feinde, die die kostbaren Habseligkeiten des jeweils anderen abfackeln. Du willst eine Explosion herbeiführen? Das erreichst du nicht, indem du nett zu deinem Mitbewohner bist. Wenn du allerdings ein Streichholz über seiner mit Benzin getränkten, selbst gemachten Steppdecke anzündest …«
»Miss?«, unterbricht der Uber-Fahrer meine prä-apokalyptischen Phantasien mit schuldbewusstem Gesicht. »Nur zu Ihrer Information, in etwa fünf Minuten sind wir da.«
Zum Dank lächle ich ihm entschuldigend zu und richte den Blick dann wieder auf mein Handy. Die Gesichter meiner beiden besten Freundinnen nehmen das gesamte Display ein. Ganz klein oben in der Ecke bin ich zu sehen: noch grimmiger als üblich (na ja, verständlich), noch blasser als üblich (ist das überhaupt möglich?) noch rothaariger als üblich (das muss an irgendeinem Filter liegen, oder?).
»Das ist eine absolut nachvollziehbare Argumentation, Mara«, sagt Sadie, leicht irritiert, »und ich möchte dich ermutigen, deine, ähm, durchaus berechtigte Beschwerde an Madame Merriam-Webster oder Monsieur Duden zu senden, oder wer immer für solche Sachen zuständig ist, aber … ich hab dich eigentlich nur gefragt, wie die Beerdigung war.«
»Genau, Mara … wie war … Beerdigung?« Die Soundqualität an Hannahs Ende der Leitung ist grauenhaft, was jedoch nichts Neues ist.
So läuft es wohl, wenn man seine besten Freundinnen im Promotionsstudium kennenlernt: In einem Moment bist du noch überglücklich, hältst dein brandneues Diplom für Ingenieurwesen in Händen und kicherst dich durch die fünfte Runde Midori Sours. Im nächsten bist du in Tränen aufgelöst, weil ihr alle getrennte Wege gehen müsst. FaceTime wird so lebensnotwendig wie Sauerstoff. Und all das ohne neongrüne Cocktails. Deine irren Monologe finden nicht mehr in eurer gemeinsamen Wohnung statt, sondern auf dem Rücksitz eines Uber, auf dem Weg zu einer mehr als seltsamen Unterhaltung.
Das ist es, was ich am Erwachsenenleben am allermeisten hasse: Irgendwann muss man anfangen, sich wie eine Erwachsene zu benehmen. Sadie entwirft schicke ökologisch nachhaltige Gebäude in New York. Hannah friert sich in einer Forschungsstation der NASA in Norwegen den Arsch ab. Und ich …
Ich bin hier. Gerade nach Washington, D. C., gezogen, um meinen Traumjob anzutreten: Wissenschaftlerin bei der Environmental Protection Agency, der Umweltschutzbehörde. Auf dem Papier bin ich außer mir vor Freude. Aber Papier gerät so schnell in Flammen. Ebenso schnell wie ein Dach.
»Helenas Beerdigung war … interessant.« Ich lehne mich zurück. »Das ist wohl das Gute daran, wenn man weiß, dass man stirbt. Du kannst die Leute ein bisschen ärgern. Ihnen sagen, dein Geist werde ihre Nachfahren noch jahrhundertelang heimsuchen, sollten sie nicht Karma Chameleon laufen lassen, während dein Sarg in die Erde hinabgelassen wird.«
»Ich bin einfach froh, dass ihr in ihren letzten Tagen bei ihr sein konntet«, sagt Sadie.
Ich lächle wehmütig. »Sie war bis zum Schluss echt unmöglich. Bei unserer letzten Partie Schach hat sie geschummelt. Als hätte sie nicht sowieso gegen mich gewonnen.« Ich vermisse sie. So, so sehr. Helena Harding, meine Betreuerin und Mentorin der letzten acht Jahre, war meine Familie, wie es meine kalten, distanzierten Blutsverwandten niemals sein könnten – oder wollten. Aber sie war leider auch schon alt, hatte starke Schmerzen und war, wie sie es gern ausdrückte, »begierig darauf, sich größeren Projekten zuzuwenden«.
»Es war so lieb von ihr, dir ihr Haus in Washington zu vererben«, sagt Hannah. Anscheinend hat sie sich zu einem anderen Fjord begeben, denn ich kann sie tatsächlich verstehen. »Jetzt hast du eine feste Bleibe, was auch immer passieren mag.«
Das ist wahr. Alles davon ist wahr, und ich bin ihr unendlich dankbar. Helenas Geschenk war ebenso großzügig wie unerwartet und mit Abstand das Netteste, was je jemand für mich getan hat. Doch das Testament wurde vor einer Woche verlesen, und es gibt da etwas, das ich meinen Freundinnen noch nicht erzählt habe. Etwas, das direkt mit meiner Tirade über unter einem Dach zusammenhängt. »Wo wir gerade dabei sind …«
»Oh-oh.« Auf beiden Gesichtern zeigt sich ein Stirnrunzeln. »Was ist passiert?«
»Es ist … kompliziert.«
»Ich liebe kompliziert«, erwidert Sadie. »Ist es auch dramatisch? Moment, ich hole schnell Taschentücher.«
»Bin mir noch nicht ganz sicher.« Ich atme tief durch, um mich zu beruhigen. »Also, das Haus, das Helena mir vererbt hat, es … gehört nicht wirklich ihr.«
»Was?« Sadie bricht die Taschentuchmission ab und starrt mich verblüfft an.
»Na ja, es gehörte ihr schon. Aber nur zum Teil. Nur zur … Hälfte.«
»Und wem gehört die andere Hälfte?« Auf Hannah ist Verlass, wenn es darum geht, zum Kern des Problems vorzustoßen.
»Ursprünglich Helenas Bruder, der allerdings gestorben ist und es seinen Kindern hinterlassen hat. Dann hat der jüngste Sohn die anderen ausgekauft, und jetzt ist er der alleinige Eigentümer. Also, zusammen mit mir.« Ich räuspere mich. »Sein Name ist Liam. Liam Harding. Er ist Anwalt, Anfang dreißig. Und er wohnt zurzeit in dem Haus. Allein.«
Sadie macht große Augen. »Heilige Scheiße. Wusste Helena davon?«
»Ich habe keine Ahnung. Man sollte es annehmen, aber die Hardings sind so eine eigenartige Familie.« Ich zucke die Achseln. »Alter Geldadel. Wie die Vanderbilts. Oder die Kennedys. Worüber denken reiche Leute überhaupt den lieben langen Tag nach?«
»Monokel wahrscheinlich«, meint Hannah.
Ich nicke. »Oder Kunsthecken.«
»Kokain.«
»Poloturniere.«
»Manschetten.«
»Moment«, unterbricht uns Sadie. »Was hat Liam Vanderbilt Kennedy Harding auf der Beerdigung dazu gesagt?«
»Sehr gute Frage, aber: Er war nicht da.«
»Er war nicht bei der Beerdigung seiner Tante?«
»Er hat anscheinend kaum Kontakt zu seiner Familie. Großes Drama, nehme ich an.« Nachdenklich tippe ich mir ans Kinn. »Vielleicht sind sie weniger wie die Vanderbilts und mehr wie die Kardashians?«
»Heißt das, er weiß gar nicht, dass dir die Hälfte des Hauses gehört?«
»Jemand hat mir seine Nummer gegeben, und ich habe ihm gesagt, dass ich demnächst vorbeikomme.« Ich lege eine Pause ein, bevor ich hinzufüge: »Per Textnachricht. Wir haben noch nicht geredet.« Noch eine Pause. »Und er hat nicht wirklich … geantwortet.«
»Das gefällt mir nicht«, sagen Sadie und Hannah gleichzeitig. Zu jedem anderen Zeitpunkt würde ich über ihre Gedankenübertragung lachen, aber es gibt noch etwas, das ich ihnen nicht erzählt habe. Etwas, das ihnen noch viel weniger gefallen wird.
»Fun Fact über Liam Harding: Ihr wisst doch, wie Helena war, quasi die Oprah der Umweltwissenschaft.« Ich kaue nervös auf der Unterlippe. »Und sie hat immer Witze darüber gemacht, dass ihre Familie größtenteils aus liberalen Akademikern besteht, die die Welt vor den großen bösen Schurkenkonzernen retten wollen.«
»Ja, und?«
»Ihr Neffe ist Firmenanwalt bei FGP Corp.« Allein die Worte auszusprechen hinterlässt einen so widerlichen Nachgeschmack, dass ich mir am liebsten den Mund spülen würde. Und Zahnseide benutzen. Mein Zahnarzt wäre begeistert.
»FGP Corp? Diese Leute, die immer noch auf fossile Brennstoffe setzen?« Eine tiefe Falte erscheint zwischen Sadies Augenbrauen. »Diese Öllobbyisten? DER große böse Schurkenkonzern schlechthin?«
»Jepp.«
»O mein Gott. Weiß er, dass du Umweltwissenschaftlerin bist?«
»Na ja, ich habe ihm meinen Namen gesagt. Und mein LinkedIn-Profil ist nur eine Google-Suche entfernt. Meint ihr, dass reiche Leute LinkedIn benutzen?«
»Niemand benutzt mehr LinkedIn, Mara.« Sadie reibt sich die Schläfe. »Himmel, das ist echt übel.«
»So schlimm ist es auch wieder nicht.«
»Du kannst dich auf keinen Fall allein mit ihm treffen.«
»Ach komm, mir wird schon nichts passieren.«
»Er wird dich umbringen. Du wirst ihn umbringen. Ihr werdet euch gegenseitig umbringen.«
»Ich … vielleicht?« Ich schließe die Augen und lasse mich zurücksinken. Schon seit zweiundsiebzig Stunden kämpfe ich gegen die in mir aufsteigende Panik an – mit mäßigem Erfolg. Ich darf jetzt nicht nachlassen. »Er ist der letzte Mensch, mit dem ich mir ein Haus teilen möchte, das könnt ihr mir glauben. Aber Helena hat mir die Hälfte dieses Hauses hinterlassen, und ich brauche es ziemlich dringend. Ich muss eine Milliarde Dollar Studiengebühren zurückzahlen, und Washington ist verdammt teuer. Vielleicht kann ich wenigstens eine Weile dort wohnen. Mir die Miete sparen. Das wäre eine finanziell vernünftige Entscheidung, oder?«
Sadie schlägt die Hände vors Gesicht, während Hannah kämpferisch einwirft: »Mara, bis vor ungefähr zehn Minuten warst du noch an der Uni. Du bewegst dich dicht über der Armutsgrenze. Lass nicht zu, dass er dich aus deinem Haus rauswirft.«
»Vielleicht hat er ja gar nichts dagegen. Es überrascht mich sowieso, dass er dort wohnt. Versteht mich nicht falsch, das Haus ist schön, aber …« Ich verstumme, als ich an all die Bilder denke, all die Stunden, die ich auf Google Street View verbracht und zu begreifen versucht habe, dass Helena so viel an mir lag, dass sie mir ein Haus hinterlassen hat. Es ist ein wirklich schönes Haus. Aber eher das Heim einer Familie. Nichts, was ich von einem Staranwalt erwarten würde, der wahrscheinlich das gesamte Bruttoinlandsprodukt eines europäischen Landes als Stundenlohn verdient. »Wohnen einflussreiche Anwälte nicht in Luxus-Penthouse-Apartments mit goldenen Toiletten und Weinkellern und Statuen von sich selbst? Soweit ich weiß, verbringt er kaum Zeit in dem Haus. Also werde ich einfach ehrlich zu ihm sein. Ihm meine Situation erklären. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung, die …«
»Da sind wir«, informiert mich der Fahrer mit einem Lächeln, das ich etwas schwächlich erwidere.
»Wenn du uns nicht innerhalb einer halben Stunde schreibst«, sagt Hannah todernst, »gehe ich davon aus, dass Big-Oil-Liam dich in seinem Keller gefangen hält, und rufe die Polizei.«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Schon vergessen, dass ich in unserem dritten Jahr einen Kickboxing-Kurs gemacht habe? Und diesem Typen beim Erdbeerfest, der deinen Kuchen klauen wollte, ordentlich in den Hintern getreten habe?«
»Das war ein achtjähriger Junge, Mara. Und du hast ihm nicht in den Hintern getreten – du hast ihm deinen eigenen Kuchen und einen Kuss auf die Stirn gegeben. Eine Textnachricht in dreißig Minuten, sonst rufe ich die Polizei.«
Ich starre sie grimmig an. »Sofern du in der Zwischenzeit nicht von einem Eisbären gefressen wurdest.«
»Sadie ist in New York, und sie hat die DC-Polizei auf Kurzwahl.«
»Jepp.« Sadie nickt. »Hab sie schon bereit.«
Als ich aus dem Auto steige, beschleicht mich eine Nervosität, die immer weiter zunimmt, je näher ich dem Haus komme – ein großer Klumpen Angst, der sich unter meinem Brustbein festsetzt. Auf halbem Weg bleibe ich stehen und atme tief durch. Daran sind allein Hannah und Sadie schuld, ihre völlig unbegründete Sorge ist ansteckend. Mir wird nichts passieren. Alles wird gut. Liam Harding und ich werden ein nettes, ruhiges Gespräch führen und eine Lösung finden, die für uns beide …
Meine Sorgen verfliegen, als ich den herbstlichen Garten vor mir bemerke.
Es ist einfach nur ein Haus. Groß, aber ohne kunstvoll geschnittene Hecken oder Rokokopavillons oder diese grusligen Gartenzwerge. Nur ein gepflegter Rasen mit einer landschaftlich gestalteten Ecke hier und da, ein paar Bäume und eine große, mit bequem aussehenden Möbeln ausgestattete Terrasse. Im spätnachmittäglichen Sonnenlicht lassen die roten Ziegel das Haus sehr gemütlich und heimelig erscheinen. Und beinahe jeder Quadratzentimeter der Wiese ist mit warmgelben Ginkgoblättern bedeckt.
Ich atme den Duft von Gras, Borke und Sonnenschein tief ein, und als meine Lunge voll ist, stoße ich ein leises Lachen aus. Wie leicht könnte ich mich in diesen Ort verlieben. Ist es möglich, dass ich es bereits getan habe? Meine erste Liebe auf den ersten Blick?
Vielleicht hat mir Helena das Haus deshalb hinterlassen, weil sie wusste, wie verbunden ich mich sofort damit fühlen würde. Oder ist es vielleicht die Gewissheit, dass sie mich hier haben wollte, die mich diesem Haus mein Herz öffnen lässt? So oder so: Es fühlt sich schon jetzt wie ein Zuhause an, womit Helena sich wieder einmal auf die beste Art in mein Leben einmischt, diesmal aus dem Jenseits. Schließlich hat sie so oft betont, wie sehr sie mir wünscht, dass ich einen Ort finde, an den ich gehöre. »Mara, ich merke, dass du einsam bist«, sagte sie, wenn ich zu ihr ins Büro kam. »Woher weißt du das?« – »Weil Leute, die nicht einsam sind, in ihrer Freizeit keine The-Bachelor-Fanfiction schreiben.« – »Das ist keine Fanfiction. Eher eine Meta-Analyse der erkenntnistheoretischen Themen, die in jeder Folge aufkommen – und mein Blog hat eine Menge Leser!« – »Hör zu, du bist eine brillante junge Frau. Und jeder liebt rothaarige Frauen. Warum gehst du nicht mit einem der Nerds aus deinem Jahrgang aus? Am besten mit einem, der nicht nach Kompost riecht.« – »Weil sie alle Arschlöcher sind, die ständig fragen, wann ich endlich das Studium hinschmeiße und zurück an den Herd gehe.« – »Hmm, das könnte ein guter Grund sein.«
Vielleicht hat Helena erkannt, dass es verlorene Liebesmüh wäre, darauf zu hoffen, dass ich mich mit jemandem niederlassen werde, und mir deshalb zu diesem Haus verholfen, damit ich mich wenigstens irgendwo niederlassen kann. Ich kann sie fast vor mir sehen, wie sie sich diebisch über ihren genialen Einfall freut, was sie mich noch tausendmal mehr vermissen lässt.
Beruhigt von den schönen Erinnerungen lasse ich meinen Koffer vor der Terrasse stehen (den wird niemand stehlen, nicht mit all den nerdigen Keep-calm-and-recycle-on-, Gute-Planeten-sind-schwer-zu-finden- und Vertrau-mir-ich-bin-Umweltwissenschaftlerin-Stickern) und fahre mir durch meine langen Locken in der Hoffnung, dass sie nicht zu wirr aussehen (was sie wahrscheinlich tun). Noch ein letztes Mal versichere ich mir, dass Liam Harding sehr wahrscheinlich keine Bedrohung ist – nur ein reicher, verwöhnter Junge mit der emotionalen Tiefe eines Planschbeckens, der es wohl kaum vermag, mich einzuschüchtern –, und hebe die Hand, um auf die Klingel zu drücken. Nur geht die Tür auf, bevor ich sie erreiche, und ich stehe vor …
Einer Brust.
Einer breiten, wohldefinierten Brust unter einem Hemd. Und einem dunklen Jackett.
Die Brust ist mit anderen Körperteilen verbunden, aber sie ist so breit, dass ich für einen Moment nichts anderes sehe. Dann schweift mein Blick weiter, und ich nehme alles andere an ihm wahr: lange, muskulöse Beine, die den Rest des Anzugs ausfüllen. Schultern und Arme, die scheinbar meilenweit reichen. Ein kantiges Gesicht und volle Lippen. Kurze dunkle Haare und Augen, die noch eine Nuance dunkler sind.
Und sie sind direkt auf mich gerichtet. Betrachten mich mit demselben intensiven, verwirrten Interesse, das auch ich verspüre. Er scheint den Blick nicht abwenden zu können, als sei er auf elementarer, zutiefst körperlicher Ebene in den Bann geschlagen worden. Was eine Erleichterung ist, denn ich kann den Blick genauso wenig von ihm abwenden. Und will es auch gar nicht.
Es fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, wie attraktiv ich ihn finde. Es vernebelt mir den Kopf und lässt mich vergessen, dass ich vor einem Wildfremden stehe. Dass ich wahrscheinlich etwas sagen sollte. Dass die Hitze, die mich durchströmt, wahrscheinlich unangemessen ist.
Er räuspert sich und sieht dabei genauso verlegen aus, wie ich mich fühle.
Ich lächle. »Hi«, sage ich etwas atemlos.
»Hi.« Ihm geht es ganz genauso. Er fährt sich über die Lippen, als sei sein Mund plötzlich trocken, und wow, das steht ihm ausgezeichnet. »Kann ich … kann ich Ihnen helfen?« Seine Stimme ist wunderschön. Tief. Volltönend. Ein bisschen heiser. Ich könnte seine Stimme heiraten. Mich darin herumwälzen. Ich könnte ihm ewig zuhören und auf alle anderen Geräusche verzichten. Aber vielleicht sollte ich zuerst seine Frage beantworten.
»Ähm, ja. Wohnen Sie hier?«
»Ich glaube schon«, sagt er, als sei es ihm vor lauter Verwunderung entfallen. Was mich zum Lachen bringt.
»Super. Ich bin hier, weil …« Warum bin ich hier? Ach ja. »Ich suche nach Liam. Liam Harding? Wissen Sie, wo ich ihn finden kann?«
»Das bin ich. Ich bin er.« Er räuspert sich erneut. Wird er etwa rot? »Also ich bin Liam.«
»Oh.« O nein. Nein, nein, nein. Nein. »Ich bin Mara. Mara Floyd. Die … Eine Freundin von Helena. Ich bin hier wegen des Hauses.«
Liams Verhalten ändert sich schlagartig.
Kurz schließt er die Augen, als habe er tragische, unbegreifliche Neuigkeiten erhalten. Einen Moment wirkt er enttäuscht, wie betrogen, als habe ihm jemand ein kostbares Geschenk gegeben, nur um es ihm direkt nach dem Auspacken wieder wegzunehmen. »Sie sind das also«, sagt er, und in seiner schönen Stimme schwingt auf einmal ein bitterer Unterton mit.
Ohne ein weiteres Wort wendet er sich ab und geht den Flur hinunter. Ich zögere einen Moment – was soll ich jetzt machen? Er hat die Tür nicht zugezogen, also will er wohl, dass ich ihm folge … oder? Keine Ahnung. Wie dem auch sei, das Haus gehört zur Hälfte mir, also mache ich mich doch bestimmt nicht wegen unbefugten Betretens strafbar … oder doch? Schließlich zucke ich die Achseln und eile ihm nach. Mit seinen langen Beinen mitzuhalten erfordert meine höchste Konzentration, so dass ich kaum etwas von meiner Umgebung wahrnehme, bis wir das Wohnzimmer erreichen.
Das absolut atemberaubend ist. Dieses Haus besteht größtenteils aus großen Fenstern und Hartholzfußböden – o mein Gott, ist das ein Kamin? Ich will Marshmallows darin rösten. Ich will ein ganzes Schwein darin braten. Mit einem Apfel im Maul.
»Ich bin so froh, dass wir endlich persönlich miteinander reden können«, sage ich zu Liam, ein bisschen außer Atem. Allmählich erhole ich mich von … was auch immer gerade an der Tür passiert ist. Ich spiele an dem Armband an meinem Handgelenk herum und sehe zu, wie er etwas auf einen Zettel schreibt. »Mein herzliches Beileid. Ihre Tante war der tollste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin mir nicht sicher, warum sie entschieden hat, mir das Haus zu vererben, und ich verstehe, dass diese Hausbesitzer-Partnerschaft ziemlich unerwartet kommt, aber …«
Ich verstumme abrupt, als er den Zettel faltet und ihn mir reicht. Er ist so groß, dass ich den Kopf heben muss, um ihm ins Gesicht zu sehen. »Was ist das?« Ohne eine Antwort abzuwarten, falte ich den Zettel auseinander.
Darauf steht eine Zahl. Eine Zahl mit Nullen. Sehr vielen Nullen. Verwirrt blicke ich auf. »Was hat das zu bedeuten?«
Er sieht mir fest in die Augen. Keine Spur mehr von dem verlegenen, zögerlichen Mann, der mich erst vor wenigen Minuten begrüßt hat. Diese Version von Liam ist frostig schön und äußerst selbstbewusst. »Geld.«
»Geld?«
Er nickt.
»Ich verstehe nicht.«
»Für Ihre Hälfte des Hauses«, sagt er ungeduldig, und da dämmert es mir: Er will mich auskaufen.
Ich sehe auf den Zettel. Das ist mehr Geld, als ich in meinem Leben je hatte – und je haben werde. Umweltingenieurin ist nicht gerade die lukrativste Karrierewahl. Und ich weiß nicht viel über Immobilien, aber ich nehme an, diese Summe übersteigt den tatsächlichen Wert des Hauses bei Weitem. »Tut mir leid. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich werde nicht … ich …« Ich hole tief Luft. »Ich glaube nicht, dass ich verkaufen will.«
Liam starrt mich ausdruckslos an. »Sie glauben nicht?«
»Nein, tue ich nicht. Also, verkaufen wollen.«
Er nickt schroff. »Wie viel mehr?«
»Was?«
»Wie viel mehr wollen Sie dafür haben?«
»Nein, ich … ich habe kein Interesse daran, das Haus zu verkaufen«, wiederhole ich. »Das kann ich nicht. Helena …«
»Genügt das Doppelte?«
»Das Doppelte – wie können Sie überhaupt … Haben Sie Leichen unter den Blumenbeeten verscharrt?«
Seine Augen sind eiskalt. »Wie viel mehr?«
Hört er mir überhaupt zu? Warum ist er so verdammt hartnäckig? Was ist aus dem süßen, schüchtern errötenden Typen von vorhin geworden? An der Tür wirkte er so …
Egal. Ich habe mich eindeutig in ihm getäuscht. »Ich kann das Haus nicht verkaufen. Tut mir leid. Aber vielleicht können wir in den nächsten Tagen eine andere Lösung finden. Ich habe in Washington keine andere Bleibe, daher dachte ich, ich könnte eine Weile hier einziehen …«
Er lacht lautlos. Dann erkennt er, dass ich es ernst meine, und schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Nun«, ich versuche, vernünftig zu bleiben, »das Haus macht einen ziemlich großen Eindruck und …«
»Sie werden nicht bei mir einziehen.«
Ich atme tief durch. »Ich verstehe. Aber meine finanzielle Situation ist sehr heikel. Ich fange in zwei Tagen meinen neuen Job an, und meine Arbeitsstelle ist ganz in der Nähe. Gut zu Fuß erreichbar. Es wäre perfekt für mich, eine Weile hier zu wohnen, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin.«
»Ich habe Ihnen gerade die Lösung für Ihre finanziellen Probleme angeboten.«
Ich zucke zusammen. »So einfach ist das nicht.« Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht, denn ich kann nur an die von Ginkgoblättern bedeckten Hortensien denken, und wie das alles im Frühling aussehen würde. Vielleicht hätte Helena gewollt, dass ich den Garten in jeder Jahreszeit sehe. Wenn sie gewollt hätte, dass ich das Haus verkaufe, hätte sie mir einfach einen Batzen Geld hinterlassen. Oder? »Es hat Gründe, dass ich nicht verkaufen möchte. Aber wir können gemeinsam eine Lösung finden. Zum Beispiel könnte ich, ähm, Ihnen meinen Teil des Hauses zwischenzeitlich vermieten und von dem Geld woanders wohnen.« Auf diese Weise würde ich Helenas Geschenk bewahren. Ich würde Liam nicht in die Quere kommen, aber auch nicht in die Armut abrutschen. Wenn auch nur mit knapper Not. Und irgendwann, sobald Liam seine Freundin heiratet (wahrscheinlich die Geschäftsführerin eines der umsatzstärksten Unternehmen weltweit, die alle dreißig Aktien im Dow Jones nach ihren Börsenwerten sortiert aufzählen kann und ihre Lieblingsprodukte von der Lifestyle-Plattform Goop von Gwyneth Paltrow hat) und in eine Villa in Potomac, Maryland, zieht, um dort eine politökonomische Dynastie zu begründen, könnte ich wieder herkommen. Hier wohnen, wie Helena es wollte. Jedenfalls, wenn ich bis dahin genug verdiene, um die Wasserrechnung allein bezahlen zu können.
Ein faires Angebot, oder?
Anscheinend nicht. Denn Liams Antwort lautet:
»Nein.«
O Mann, er liebt dieses Wort.
»Aber warum? Sie haben eindeutig das nötige Geld …«
»Ich will das ein für alle Mal klären. Wer ist Ihr Anwalt?«
Ich will ihm gerade ins Gesicht lachen und einen Witz über meinen »gigantischen Rechtsbeistand« machen, als sein iPhone klingelt. Er wirft einen Blick aufs Display und flucht leise. »Da muss ich rangehen. Warten Sie hier«, befiehlt er mir, deutlich zu herrisch für meinen Geschmack. Bevor er das Wohnzimmer verlässt, taxiert er mich noch einmal mit kaltem, hartem Blick und sagt: »Dies ist nicht Ihr Haus, und das wird es auch nie sein.«
Und das ist, glaube ich, der Moment, in dem mir der Geduldsfaden reißt.
Der letzte Satz bringt das Fass zum Überlaufen. Na ja, das und der herablassende, gebieterische, überhebliche Ton, in dem er die letzten zwei Minuten mit mir geredet hat. Ich bin in dem Bestreben hergekommen, ein konstruktives Gespräch zu führen. Ich habe ihm mehrere Optionen angeboten, aber er hat mich einfach abblitzen lassen, und jetzt bin ich wütend. Ich habe genauso viel Rechtsanspruch auf dieses Haus wie er, und wenn er sich weigert, das anzuerkennen …
Tja, dann hat er wohl Pech gehabt.
Um meinem Ärger Luft zu machen, reiße ich den Zettel, den Liam mir gegeben hat, in vier Stücke und lasse sie auf den Couchtisch rieseln. Dann gehe ich auf die Terrasse, schnappe mir meinen Koffer und mache mich auf die Suche nach einem freien Schlafzimmer.
Tolle Neuigkeiten!, texte ich Sadie und Hannah. Doktor Mara Floyd ist gerade in ihr neues Haus eingezogen. Und unter diesem Dach ist ganz eindeutig die Hölle los.
Kapitel 2
Fünf Monate und zwei Wochen zuvor
Für so etwas habe ich keine Zeit.
Ich komme zu spät zur Arbeit. In einer halben Stunde habe ich ein Meeting, und ich muss mir noch die Zähne putzen und die Haare kämmen.
Für so etwas habe ich wirklich keine Zeit.
Und dennoch kann ich der Versuchung nicht widerstehen. Ich knalle die Kühlschranktür zu, lehne mich mit dem Rücken dagegen, verschränke die Arme so bedrohlich wie möglich und starre Liam quer durch die offene Küche an.
»Ich weiß, dass du meine Kaffeesahne benutzt hast.«
Es ist Energieverschwendung. Denn Liam steht auf der anderen Seite der Kochinsel, so gleichgültig wie der Granit der Arbeitsplatte, und streicht sich seelenruhig Butter auf eine Scheibe Toast. Er widerspricht mir nicht. Er sieht mich nicht an. Er macht einfach weiter, als wäre nichts passiert, und fragt: »Ach ja?«
»Du bist nicht so unauffällig, wie du denkst, Kumpel.« Ich taxiere ihn mit meinem besten bösen Blick. »Und falls das eine Einschüchterungstaktik sein soll, funktioniert sie nicht.«
Er nickt. Immer noch völlig ungerührt. »Hast du es der Polizei gemeldet?«
»Was?«
Er zuckt mit seinen dämlichen, breiten Schultern. Er trägt einen Anzug, weil er immer einen Anzug trägt. Einen dunkelgrauen Dreiteiler, der ihm perfekt passt – aber andererseits auch überhaupt nicht, denn er hat nicht die Statur eines niederträchtigen Erfüllungsgehilfen der großen bösen Schurkenkonzerne, der andere für sich schuften lässt. Ob er während seiner obligatorischen Tötet-die-Erde-Ausbildung ein Praktikum als Bauarbeiter auf einer Bohrinsel gemacht hat? »Der angebliche Diebstahl deiner Kaffeesahne scheint dich sehr zu belasten. Hast du ihn der Polizei gemeldet?«
Tief durchatmen. Ich muss tief durchatmen. In Washington, D. C., wird Mord mit bis zu dreißig Jahren Gefängnis bestraft. Was ich weiß, weil ich es direkt nach meinem Einzug gegoogelt habe. Andererseits würde mich keine Jury der Welt schuldig sprechen – nicht, wenn ich die Gräuel darlege, die ich in den letzten Wochen über mich ergehen lassen musste. Sie würden Liams Tod gewiss als Selbstverteidigung anerkennen, mir vielleicht sogar einen Pokal verleihen. »Liam, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, damit wir das irgendwie hinkriegen. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass du dich wie ein Arschloch verhältst?«
Diesmal sieht er auf. Seine Augen sind so kalt, dass ich am ganzen Körper fröstle. »Ich habe mich bemüht. Anfangs. Und gerade als ich kurz vor einem Durchbruch stand, hat jemand den Die-Eiskönigin-Soundtrack in voller Lautstärke gespielt.«
Ich erröte. »Ich hab mein Zimmer aufgeräumt. Ich hatte keine Ahnung, dass du zu Hause bist.«
»Mhmm.« Er nickt, und dann tut er etwas, womit ich nicht gerechnet habe: Er kommt näher. Mit wenigen gemächlichen Schritten durchquert er die mit einer Mischung aus ultramodernen Geräten und klassischen Möbeln ausgestattete Küche, bis er über mir aufragt und mich von oben herab anstarrt, als wäre ich ein Ameisenproblem, von dem er dachte, es längst beseitigt zu haben. Er riecht nach Shampoo und teurem Zeug, und er hält noch immer das Buttermesser in der Hand. Kann man damit jemanden erstechen? Ich weiß es nicht, aber Liam Harding sieht aus, als könne er jemanden (genauer: mich) selbst mit einem Wasserball ermorden. »Ist diese emotionale Abhängigkeit von Kaffeesahne nicht schlecht für die Umwelt, Mara?«, fragt er, seine Stimme tief und leise. »Denk nur an den negativen Einfluss der hochverarbeiteten Lebensmittel. Die giftigen Zutaten. Das ganze Plastik.«
Er ist so herablassend, dass ich ihn am liebsten beißen würde. Stattdessen straffe ich die Schultern und trete näher an ihn heran. »Ich praktiziere etwas, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast – es nennt sich recyceln.«
»Ach ja?« Er legt das Messer auf den Tresen und wirft einen Blick auf die Mülleimer neben mir, die ich besorgt habe, nachdem ich eingezogen bin. Sie sind überfüllt, was aber nur daran liegt, dass ich zu viel zu tun hatte, um den Müll zum richtigen Container zu bringen. Und das weiß er genau.
»Hier wird der Plastikmüll halt nicht abgeholt. Aber ich werde ihn zur … Was tust …?« Seine Hände legen sich um meine Taille, seine Finger so lang, dass sie sowohl auf meinem Rücken als auch über meinem Bauchnabel zusammentreffen. Mein Gehirn setzt aus. Was zur Hölle hat er …?
Er hebt mich hoch, so dass ich ein paar Zentimeter über dem Boden hänge, und befördert mich mühelos ein Stück neben den Kühlschrank. Als wäre ich so leicht wie ein Amazon-Paket – einer dieser riesigen Kartons, in die aus unerfindlichen Gründen nur ein einziges Deo eingepackt ist. Ohne meinem empörten Gestammel auch nur die geringste Beachtung zu schenken, setzt er mich ab, öffnet den Kühlschrank, nimmt sich ein Glas Himbeerkompott und murmelt mit einem letzten stechenden Blick: »Worauf wartest du dann noch?«
Damit widmet er sich wieder seinem Toast, und ich existiere in seinem Universum nicht mehr.
Reizend.
Mit einem Knurren verlasse ich die Küche, etwas verlegen und übermäßig mordlustig, und spüre dabei immer noch, wie sich seine Handballen in meine Haut gepresst haben. Im Schlaf. Ich schwöre, ich werde ihn im Schlaf ermorden. Wenn er am wenigsten damit rechnet. Und dann werde ich feiern, indem ich leere Kaffeesahnepackungen auf seine Leiche werfe.
Zehn Minuten später schwitze ich vor Wut, während ich auf dem Weg zur Arbeit einen Notfall-Auskotz-Videocall mit Sadie habe. Wovon es in den letzten Wochen viele gab. Sehr viele.
»… er trinkt nicht mal Kaffee. Also spült er die Kaffeesahne entweder die Toilette runter, um mir eins auszuwischen, oder er trinkt sie wie Wasser – und ich weiß nicht, welches Szenario ich schlimmer finden soll, denn einerseits hat eine einzige Packung sechshundertvierzig Kalorien, und Liam schafft es trotzdem, nur drei Prozent Körperfett zu haben, andererseits ist es eine Gemeinheit ohnegleichen, sich trotz des vollen Terminplans, den er hat, die Zeit zu nehmen, mir meine Kaffeesahne zu rauben, ohne sie auch nur …« Ich verstumme, als ich ihren amüsierten Gesichtsausdruck bemerke. »Was?«
»Nichts.«
Ich mustere sie argwöhnisch. »Siehst du mich komisch an?«
»Nein! Nein.« Sie schüttelt nachdrücklich den Kopf. »Es ist nur …«
»Nur was?«
»Du redest schon seit …« – sie wirft einen Blick auf die Uhr – »acht Minuten pausenlos von Liam.«
Meine Wangen glühen. »Es tut mir leid, ich …«
»Versteh mich nicht falsch, ich liebe es. Dir beim Ablästern zuzuhören ist voll mein Ding, zehn von zehn, würde es jederzeit weiterempfehlen. Aber so habe ich dich noch nie erlebt, und wir haben fünf Jahre zusammengewohnt. Normalerweise bist du so kompromissbereit und auf Harmonie bedacht und Imagine-all-the-people-mäßig drauf.«
Tatsächlich gebe ich mir Mühe, mein Leben nicht in einem Zustand andauernder explosiver Wutausbrüche zu verbringen. Meine Eltern waren die Sorte Mensch, die wahrscheinlich am besten gar keine Kinder kriegen sollte: distanziert, nicht liebevoll, ungeduldig darauf wartend, dass ich endlich auszog, damit sie mein Kinderzimmer in einen Schuhschrank verwandeln konnten. Ich weiß, wie man mit anderen zusammenlebt und Konflikte vermeidet, weil ich das schon tue, seit ich siebzehn war – seit zehn Jahren. Leben und leben lassen ist eine äußerst wichtige Fähigkeit in jeder gemeinschaftlichen Wohnsituation, und ich musste sie ausgesprochen schnell beherrschen. Und ich beherrsche sie immer noch. Wirklich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich Liam Harding leben lassen will.
»Ich bemühe mich ja, Sadie, aber ich bin nicht diejenige, die das Thermostat ständig auf arschkalt stellt. Er macht nicht mal das Licht aus, wenn er geht – unsere Stromrechnung ist unfassbar hoch! Als ich vorgestern von der Arbeit nach Hause gekommen bin, saß irgendein fremder Typ Cheez-Its futternd auf der Couch und hat mir meine eigenen Käsecracker angeboten. Ich dachte erst, er wäre ein Auftragskiller, den Liam geschickt hat, um mich zu töten!«
»O mein Gott. Und war er es?«
»Nein. Es war Calvin – Liams Freund, der tragischerweise tausendmal netter ist als Liam. Der Punkt ist, dass Liam ein beschissener Mitbewohner ist, der Leute einlädt, wenn er selbst nicht zu Hause ist, ohne mir Bescheid zu geben. Und warum kann er nicht wenigstens Hi sagen, wenn er mich sieht? Und kann es einen psychologischen Grund geben, warum er nicht fähig ist, Küchenschränke zu schließen? Hat er irgendein tiefsitzendes Trauma, das ihn dazu gebracht hat, das Haus ausschließlich mit Schwarz-Weiß-Fotos von Bäumen zu dekorieren? Und muss er unbedingt jedes Wochenende seine blöden Dudebro-Freunde einladen, um Videospiele im …« Als ich die andere Straßenseite erreiche, werfe ich einen Blick aufs Display. Sadie kaut nachdenklich auf ihrer Unterlippe. »Was ist los?«, frage ich.
»Du warst voll in Fahrt und brauchtest mich nicht wirklich, also hab ich was anderes erledigt.«
»Was anderes?«
»Ich hab Liam gegoogelt.«
»Was? Warum?«
»Weil ich mir gern ein Bild von den Leuten mache, über die ich mehrere Stunden die Woche rede.«
»Was immer du tust, geh nicht auf seine Seite auf der FGP-Corp-Website. Erhöhe nicht ihre Klickrate!«
»Zu spät. Er sieht eigentlich ziemlich …«
»Als hätten Klimawandel und Kapitalismus ein Kind in die Welt gesetzt, das eine Bodybuilder-Phase durchmacht.«
»Ähm … Ich hätte ihn süß genannt.«
Ich schnaube verächtlich. »Wenn ich ihn anschaue, ist alles, was ich vor mir sehe, der ganze Kaffee ohne Kaffeesahne, den ich trinken muss, seit ich bei ihm eingezogen bin.« Und vielleicht erinnere ich mich auch manchmal, ganz gelegentlich, an den schüchternen, verwunderten Gesichtsausdruck, mit dem er mich angesehen hat, bevor er wusste, wer ich bin. Dem ich ein bisschen hinterhertrauere. Aber wem mache ich etwas vor? Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet.
»Hat er noch mal angeboten, dich auszukaufen?«, fragt Sadie.
»Er erkennt nicht mal meine Existenz an. Na gut, hin und wieder starrt er mich an wie eine Kakerlake, die seinen makellosen Wohnraum verseucht. Es ist sein Anwalt, der mir jeden zweiten Tag ein neues lächerliches Angebot schickt.« Das Gebäude, in dem ich arbeite, kommt in Sicht, noch hundert Schritte entfernt. »Aber darauf lasse ich mich nicht ein. Ich werde nicht das Einzige, was mir von Helena geblieben ist, an den Meistbietenden verkaufen. Und wenn ich finanziell besser aufgestellt bin, ziehe ich einfach aus. Das sollte nicht lange dauern, höchstens ein paar Monate. Und in der Zwischenzeit …«
»Trinkst du schwarzen Kaffee?«
Ich seufze. »In der Zwischenzeit trinke ich bitteren, widerlichen Kaffee.«
Kapitel 3
Fünf Monate und eine Woche zuvor
Liebe Helena,
das ist seltsam.
Ist das seltsam?
Das ist wahrscheinlich seltsam.
Ich meine, Du bist tot. Und trotzdem sitze ich hier und schreibe Dir einen Brief. Dabei bin ich nicht einmal sicher, ob ich an ein Leben nach dem Tod glaube. Um ehrlich zu sein, denke ich schon seit der Highschool nicht mehr über solche Sachen nach, weil sie mir Angst machen und ich davon Ausschlag in der linken Achselhöhle bekomme (nie in der rechten – woran das wohl liegt?). Und es ist ja nicht so, als stünde ich kurz davor, ein Rätsel zu lösen, das selbst große Denker wie Foucault oder Derrida oder diesen Deutschen mit dem buschigen Schnurrbart und der Syphilis, dessen Namen kein Mensch schreiben kann, ratlos zurückgelassen hat.
Aber ich schweife ab.
Du bist nun seit über einem Monat tot, doch es ist alles beim Alten. Die Menschheit ist noch immer in den Fängen kapitalistischer Machenschaften; wir müssen noch immer einen Weg finden, jene bevorstehende Katastrophe namens menschengemachter Klimawandel aufzuhalten; ich trage beim Joggen noch immer mein Rettet-die-Bienen-und-besteuert-die-Reichen-T-Shirt. Das Übliche eben. Ich liebe die Arbeit bei der EPA (vielen, vielen Dank übrigens für das Empfehlungsschreiben, ich bin wirklich dankbar, dass Du nicht erwähnt hast, wie Du mich, Sadie und Hannah nach dieser Anti-Damm-Demo aus dem Gefängnis freikaufen musstest. Das hätte der Regierung bestimmt nicht gefallen). Ein kleines Problem gibt es allerdings: Ich bin die einzige Frau in einem sechsköpfigen Team, und die Typen, mit denen ich arbeite, scheinen zu glauben, dass weibliche Gehirne nicht fähig sind, so komplexe Konzepte zu begreifen wie … dass die Erde rund ist. Neulich hat Sean, der Teamleiter, eine halbe Stunde damit zugebracht, mir den Inhalt meiner eigenen Dissertation zu erklären. Ich habe mir sehr lebhaft vorgestellt, ihn zu erschlagen und den Boden unter meiner Badewanne mit seinem Kadaver zu fliesen, aber das weißt Du wahrscheinlich schon. Du sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag allwissend auf einer Wolke. Und mampfst Cracker. Und spielst ab und zu Harfe. Du Faulpelz.
Ich glaube, ich schreibe Dir diesen Brief, den Du nie lesen wirst, weil ich mir so sehr wünschte, mit Dir reden zu können. Wenn mein Leben ein Film wäre, würde ich zu Deinem Grab gehen und Dir mein Herz ausschütten, während im Hintergrund eine Symphonie in d-Moll läuft. Aber Du wurdest in Kalifornien beerdigt (ziemlich unpraktisch, findest Du nicht?), also bleibt mir nichts anderes übrig, als Dir einen Brief zu schreiben.
Was ich damit sagen will: Erstens, Du fehlst mir. Sehr. Verdammt, so sehr. Wie konntest Du mich ohne Dich zurücklassen? Schäm Dich, Helena. Schäm Dich.
Zweitens: Ich bin so unendlich dankbar, dass Du mir dieses Haus hinterlassen hast. Es ist das schönste, gemütlichste Zuhause, in dem ich je gewohnt habe. Am Wochenende lese ich gern im Wintergarten. Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Haus mit Foyer betreten würde, ohne dass mich der Sicherheitsdienst vom Gelände eskortiert. Es ist nur … Ich hatte noch nie ein eigenes Zuhause. Einen Ort, der immer da sein wird, egal, was passiert. Einen sicheren Hafen, wenn man so will. Ich fühle Deine Präsenz, wenn ich zu Hause bin, obwohl Du wahrscheinlich zum letzten Mal nach einem Freiheitsmarsch für die Rechte der Frauen in den Siebzigern hier warst. Und keine Sorge, ich erinnere mich gut an Deine Abneigung gegen Kitsch und kann Dich fast sagen hören: Spar dir das Gerede. Also werde ich genau das tun.
Drittens, und das ist eher eine Frage als eine Feststellung: Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich Deinen Neffen umbringe? Denn ich bin kurz davor. Sooo kurz davor. Ich ersteche ihn förmlich mit einem Kartoffelschäler, während ich diesen Brief schreibe. Aber womöglich ist das genau das, was Du wolltest. Schließlich hast Du Liam in all den Jahren, die wir uns kannten, kein einziges Mal erwähnt. Und er arbeitet für eine Firma, die eigentlich nichts anderes als Klimazerstörungsgase herstellt, also hast Du ihn vielleicht genauso verachtet wie ich. Vielleicht war unsere Freundschaft ein von langer Hand geplanter Trick, der damit enden sollte, dass ich Bremsflüssigkeit in den Tee Deines meistgehassten Verwandten gieße. Wenn dem so ist: Gut gemacht. Und ich hasse Dich.
Ich könnte Dir seine Schrecklichkeit in allen abgründigen Details darlegen (ich führe eine Liste in meiner Notizen-App), aber damit quäle ich lieber Sadie und Hannah via Zoom. Ich wollte nur … ich glaube, ich versuche zu verstehen, warum Du mich zu einem der arschlochigsten Arschlöcher der Welt geführt hast. Des gesamten Universums. Schon allein, wie er mich ansieht – oder besser gesagt, wie er mich nicht ansieht. Er hält sich offensichtlich für was Besseres, und …
* * *
Es klingelt. Ich halte mitten im Satz inne und renne zur Tür. Wofür ich mindestens zwei Minuten brauche, was eindeutig beweist, dass dieses Haus groß genug für zwei Menschen ist.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass Liam Harding einen beschissenen Dekogeschmack hat. Dass er ein Faible für Motivationsposter hat, Plastikobst bei IKEA kauft und überall Neon-Barlichter aufhängt. Leider weiß er entweder, wie man ein Haus schön einrichtet, oder er hat mit seinem FGP-Corp-Blutgeld jemanden eingestellt, der es weiß. Die Kombination aus traditionellen und modernen Stücken ist elegant und geschmackvoll, und ich bin mir fast sicher, dass, wer immer für die Einrichtung zuständig war, das Wort »Farbpalette« korrekt verwenden kann, und es kein Zufall ist, dass die tiefen Rot-, Waldgrün- und sanften Grautöne perfekt zu dem Holzboden passen. Außerdem wirkt alles so … schlicht. Bei einem so großen Haus wäre ich versucht, alles mit Tischen und Schränken und Teppichen vollzustopfen, aber Liam hat es irgendwie geschafft, sich auf das Nötigste zu beschränken. Sofas, ein paar bequeme Stühle und Sessel, Bücherregale. Und das war’s. Das Haus ist luftig, hell, in warmen Tönen spärlich dekoriert und dadurch umso schöner. »Minimalistisch«, urteilte Sadie, als ich ihr eine Videotour gab. »Richtig gut gemacht.« Ich glaube, meine Antwort war ein wütendes Knurren.
Und dann ist da noch die Kunst an den Wänden, die mir zu meinem Verdruss immer besser gefällt. Bilder von Seen bei Sonnenaufgang und Wasserfällen bei Sonnenuntergang, von dichten Wäldern und einsamen Bäumen, schneebedecktem Grund und blühenden Feldern. Hier und da ein Tier in freier Wildbahn, alles in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, warum, aber ich ertappe mich immer öfter dabei, wie ich sie anstarre. Die Rahmen sind schlicht, das Motiv nichts Besonderes, aber irgendetwas haben diese Bilder an sich. Als sei der Fotograf wirklich mit der Umgebung verbunden gewesen. Als habe er wirklich versucht, sie einzufangen, einen Teil davon mit nach Hause zu nehmen.
Ich frage mich, wer die Bilder gemacht hat, kann aber nirgends eine Signatur finden. Wahrscheinlich irgendein verhungernder Student mit einem Master in Fine Arts, der sein Herzblut in diese Fotos investiert hat in der Hoffnung, dass sie von jemandem gekauft werden, der Kunst zu schätzen weiß – und jetzt hängen sie hier. Im Besitz des weltgrößten Arschlochs. Ich wette, Liam hat sie nicht mal selbst ausgesucht. Ich wette, er hat sie nur gekauft, damit er sie von der Steuer absetzen kann. Vielleicht dachte er, auf lange Sicht sei eine schöne Kollektion genauso viel wert wie Aktiendividenden.
»Ich brauche eine Unterschrift«, sagt der UPS-Bote, als ich die Tür öffne. Er kaut Kaugummi und sieht aus, als wäre er ungefähr fünfzehn. Im Vergleich zu ihm fühle ich mich uralt. »Sie sind nicht William K. Harding, oder?«
William K. Das ist fast süß. Ich hasse es. »Nein.«
»Ist er zu Hause?«
»Nein.« Zum Glück.
»Ihr Ehemann?«
Ich lache. Dann lache ich noch mehr. Dann wird mir klar, dass mich der UPS-Bote anstarrt, als wäre ich eine böse Hexe. »Ähm, nein. Sorry. Er ist mein … Mitbewohner.«
»Verstehe. Können Sie für Ihren Mitbewohner unterschreiben?«
»Klar.« Ich greife nach dem Stift, doch meine Hand verharrt mitten in der Bewegung, als ich das FGP-Corp-Logo auf dem Umschlag sehe.
Ich hasse diese zerstörerische Bande. Noch mehr als Liam selbst. Als wäre es nicht schlimm genug, dass er mir zu Hause das Leben schwer macht, indem er am einzigen Tag in der Woche, an dem ich ausschlafen könnte, frühmorgens den Rasen mäht, arbeitet er auch noch für einen meiner beruflichen Erzfeinde. FGP Corp ist einer dieser Riesenkonzerne, die eine Umweltkatastrophe nach der nächsten verursachen – dieser Laden besteht aus einem Haufen überqualifizierter Kerle in schweineteuren Anzügen, die Biotoxine in der ganzen Welt verteilen, ohne sich auch nur im Mindesten um Braunpelikane zu scheren (oder die Zukunft der gesamten Menschheit, wobei mich persönlich die Pelikane mehr betroffen machen, die wirklich rein gar nichts dafür können).
Grimmig mustere ich den dicken Luftpolsterumschlag. Würde Liam für mich einen EPA-Brief in Empfang nehmen? Ich bezweifle es. Oder vielleicht würde er ihn annehmen, nur um ihn anschließend an einen roten Ballon zu hängen, den sein Kumpel, der Killer-Clown Pennywise, ihm geschenkt hat, und zuzusehen, wie er davonfliegt. Ich meine, ich bin mir zu dreiundsiebzig Prozent sicher, dass dieser Typ meine Socken versteckt. Ich habe nur noch vier zusammenpassende Paare!
»Also …« Lächelnd trete ich einen Schritt zurück und schwelge in meiner eigenen Gehässigkeit. Helena, du wärst stolz auf mich. »Ich denke nicht, dass ich für ihn unterschreiben sollte. Ich wette, das wäre ein schweres Verbrechen.«
Der UPS-Bote schüttelt den Kopf. »Nein, wäre es nicht.«
Ich zucke die Achseln. »Wer kann das schon sagen?«
»Ich. Das ist mein Job.«
»Und den machen Sie ausgezeichnet.« Ich lächle strahlend. »Aber ich werde nicht für diesen Brief unterschreiben. Kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Ein Glas Wein? Cheez-Its?«
Er runzelt die Stirn. »Sind Sie sicher? Das ist eine Expresssendung. Jemand hat eine Menge Geld für die Lieferung am selben Tag bezahlt. Das ist sehr wahrscheinlich etwas wirklich Dringendes, das William K. braucht, sobald er nach Hause kommt.«
»Verstehe. Tja, das klingt nach William K.s Problem.«
Der Bote stößt einen Pfiff aus. »Das ist verdammt kalt.« Er klingt beeindruckt. Oder schlicht entsetzt. »Also, was stimmt nicht mit William K.? Klappt er den Klositz nach dem Pinkeln nicht wieder runter?«
»Wir haben getrennte Badezimmer.« Ich überlege kurz. »Aber bestimmt würde er das tun. In dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ich sein Bad benutze.«
Er nickt verständnisvoll. »Meine Schwester hatte am College auch einen Mitbewohner, den sie nicht ausstehen konnte. Zwischen den beiden herrschte Krieg. Sie haben sich die ganze Zeit nur angeschrien. Einmal hat sie eine Liste all der Dinge erstellt, die sie an ihm hasst, und ihre Notizen-App ist abgestürzt. So lang war sie.«
Oh-oh. Das kommt mir bekannt vor. »Wie ist es ihr ergangen?«
Ich hoffe, die Antwort lautet nicht: Sie sitzt lebenslang im Gefängnis, weil sie ihm im Schlaf die Haare abrasiert und »Ich bin ein schlechter Mensch« in seine Kopfhaut eintätowiert hat. Doch was der UPS-Bote sagt, ist noch zehnmal verstörender.
»Sie heiraten nächsten Juni.« Er schüttelt den Kopf und winkt mir zum Abschied zu. »Unglaublich, oder?«
* * *
Ich träume von einem Konzert – einem schlechten.
Eher Krach als Musik. Genau die Art deutscher Elektro-Crap aus den Siebzigern, den Liam auf Vinyl hat und vorzugsweise auflegt, wenn seine Freunde zu Besuch kommen, um First-Person-Shooter zu zocken. Laut, nervig, und zu allem Überfluss dauert es gefühlt stundenlang. Bis ich aufwache und drei Dinge erkenne:
Erstens, ich habe grauenhafte Kopfschmerzen.
Zweitens, es ist mitten in der Nacht.
Drittens, die Krachmusik ist eigentlich nur Krach und kommt von unten.
Einbrecher, schießt es mir durch den Kopf. Sie wollen uns ausrauben. Sie versuchen gar nicht, leise zu sein – wahrscheinlich sind sie bewaffnet.
Ich muss aufstehen. Den Notruf wählen. Liam warnen und sicherstellen, dass er …
Abrupt setze ich mich im Bett auf. »Liam.« Aber klar doch.
Wutentbrannt wälze ich mich aus dem Bett und stürme aus meinem Zimmer. Auf halbem Weg die Treppe hinunter fällt mir auf, dass meine Locken in alle Himmelsrichtungen abstehen, ich keinen BH trage und meine Shorts schon vor fünfzehn Jahren zu klein waren, als ich sie in der Middle School als Lacrosse-Gratis-Uniform bekommen habe. Tja, Pech gehabt. Damit muss Liam sich wohl oder übel abfinden, wie auch mit meinem Es-gibt-keinen-Planeten-B-Shirt. Vielleicht lernt er sogar etwas draus.
Als ich die Küche erreiche, ziehe ich ernsthaft in Erwägung, jegliches Tracking zu deaktivieren, um mich die nächsten sechs Monate ungehindert an ihn anschleichen zu können, wenn er schläft. »Liam, hast du eine Ahnung, wie viel Uhr es ist?«, donnere ich los. »Was machst du überhaupt …«
Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet habe. Doch ganz bestimmt nicht, dass jeder Quadratzentimeter der Arbeitsfläche mit Sachen aus dem Kühlschrank überhäuft ist; ganz bestimmt nicht, dass Liam eine Selleriestange niedermetzelt, als hätte sie ihm den Parkplatz gestohlen; ganz bestimmt nicht, ihn von der Hüfte aufwärts nackt – sehr nackt – zu sehen. Seine karierte Schlafanzughose sitzt tief.
Sehr tief.
»Könntest du bitte etwas anziehen? Einen Babyrobbenpelz oder was man in deinen Kreisen sonst so trägt?«
Er hört nicht auf, den Sellerie zu hacken. Blickt nicht zu mir auf. »Nein.«
»Nein?«
»Mir ist nicht kalt. Und ich wohne hier.«
Ich wohne auch hier. Und meine eigene Küche sollte ein Wohlfühlort sein, an dem ich in Ruhe mein Essen verdauen kann, ohne diese Backsteinmauer, die er eine Brust nennt, anstarren zu müssen. Dennoch beschließe ich, die Sache auf sich beruhen zu lassen und sie vorerst zu verdrängen. Wenn ich ausziehe, werde ich ohnehin jede Menge Therapie brauchen. Was zählt da schon ein Trauma mehr, das ich überwinden muss? Im Moment will ich nur zurück ins Bett. »Was machst du da?«, frage ich.
»Meine Steuererklärung.«
Irritiert blinzle ich ihn an. »Ich … was?«
»Wonach sieht es denn aus?«
Jetzt werde ich doch wütend. »Ich weiß nicht, wonach es aussieht, aber es klingt, als würdest du einfach nur mit Pfannen scheppern.«
»Die Geräusche sind ein bedauerliches Nebenprodukt des Kochens.« Anscheinend ist er mit dem Sellerie fertig, denn er fängt an, eine Tomate zu schneiden – ist das meine Tomate? –, und ignoriert mich wieder.
»Oh, und das ist ja auch völlig normal – um ein Uhr siebenundzwanzig an einem Wochentag ein Fünf-Gänge-Menü zu kochen.«
Endlich sieht Liam zu mir auf, und in seinem Blick liegt etwas Beunruhigendes. Er wirkt gelassen, aber ich weiß, dass er es nicht ist. Er ist außer sich vor Wut, sage ich mir. Er ist sehr, sehr wütend. Bring dich in Sicherheit. »Brauchst du etwas?« Sein Ton ist trügerisch höflich, und mein Selbsterhaltungstrieb schläft offenbar tief und fest.
»Ja. Ich möchte, dass du mit dem Lärm aufhörst. Und ich hoffe, das ist nicht meine Tomate.«
Er wirft sich die Hälfte in den Mund. »Ob du es glaubst oder nicht«, sagt er ausdruckslos und schafft es selbst mit vollem Mund noch, wie der adlige Abkömmling einer schon seit Generationen wohlhabenden Familie zu wirken, »normalerweise bin ich um ein Uhr achtundzwanzig nicht mehr wach.«
»Was für ein Zufall. Ich auch nicht, bevor ich dich kennengelernt habe.«
»Aber heute – oder besser gesagt: gestern – musste das gesamte Anwaltsteam, das ich leite, bis nach Mitternacht arbeiten, weil uns ein paar sehr wichtige Dokumente fehlten.«
Ich erstarre. Er meint doch nicht etwa …?
»Keine Sorge, die Dokumente sind wieder aufgetaucht. Irgendwann. Nachdem mein Chef mir und meinem Team die Hölle heißgemacht hat. Anscheinend ist bei der Lieferung etwas schiefgegangen.« Wenn Blicke töten könnten, wäre ich nur noch ein Häufchen Asche. Offenbar weiß er von meinem kleinen Racheakt.
»Hör zu.« Ich atme tief durch. »Das war nicht mein bester Moment, aber ich bin nicht deine Sekretärin. Und das rechtfertigt ja wohl kaum, dass du mitten in der Nacht mit sämtlichen Töpfen im Haus klapperst. Ich habe morgen einen langen Tag und …«
»Ich auch. Und wie du dir vorstellen kannst, hatte ich gestern auch einen langen Tag. Und ich habe Hunger. Also werde ich nicht mit dem Lärm aufhören. Jedenfalls nicht, bis ich was gegessen habe.«
Bis vor etwa zehn Sekunden war ich wütend auf eine kühle, vernünftige Art. Doch plötzlich bin ich drauf und dran, ihm das Messer aus der Hand zu reißen und ihm die Kehle aufzuschlitzen. Nur ein bisschen. Nur um ihn bluten zu lassen. Natürlich werde ich es nicht tun, denn ich bin mir sicher, dass mir die Zeit im Gefängnis nicht sehr gut bekommen würde, aber genauso wenig werde ich klein beigeben. Ich habe versucht, angemessene Reaktionen zu zeigen, als er mir verboten hat, Solarzellen zu installieren, als er meinen gebratenen Brokkoli weggeworfen hat, weil er »sumpfig« roch, und als er mich ausgesperrt hat, während ich laufen war. Doch das hier geht eindeutig zu weit. Ich habe die Schnauze voll. »Soll das ein Witz sein?«
Liam gießt Olivenöl in die Pfanne, schlägt ein Ei auf und schaltet wieder in seinen Standardmodus: ignorieren, dass ich existiere.
»Liam, ob es dir gefällt oder nicht, ich wohne hier. Du kannst nicht einfach tun, was immer du willst!«
»Interessant. Wo das doch genau das ist, was du tust.«
»Wovon redest du? Du bist derjenige, der um zwei Uhr morgens ein Omelett macht, und ich bitte dich, es nicht zu tun.«
»Stimmt. Allerdings müsste ich bei Weitem nicht so laut abwaschen, wenn du diese Woche auch nur einen Teil deines Geschirrs gespült hättest.«
»Oh, das musst du gerade sagen. Als würdest du nicht ständig dein Zeug überall rumliegen lassen.«