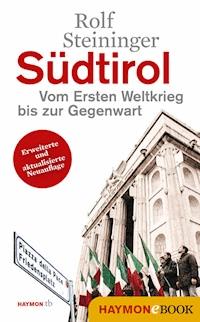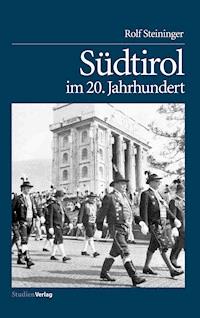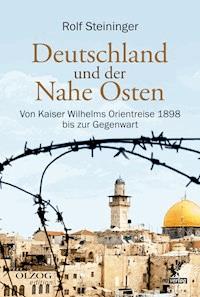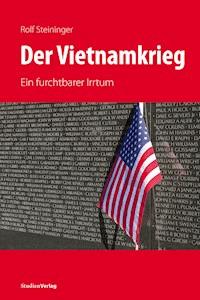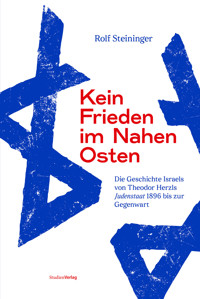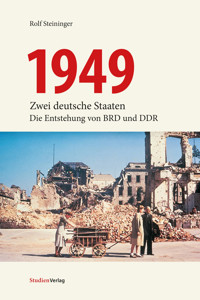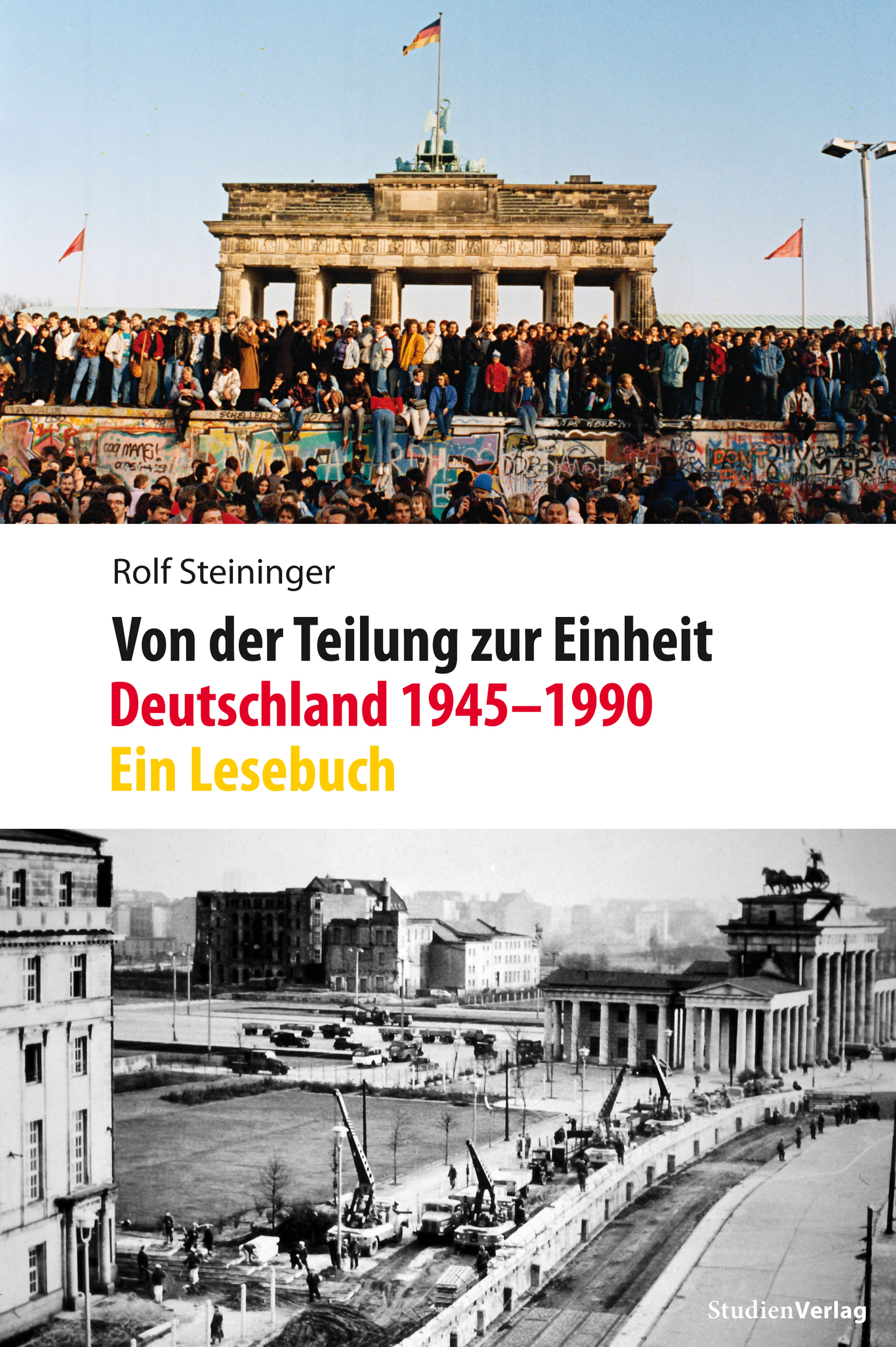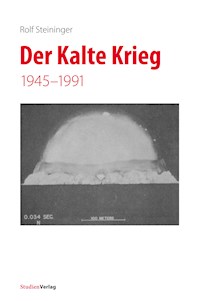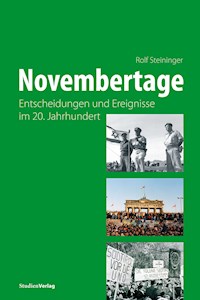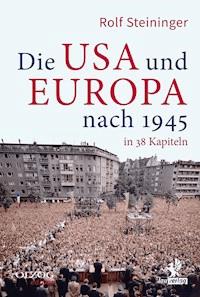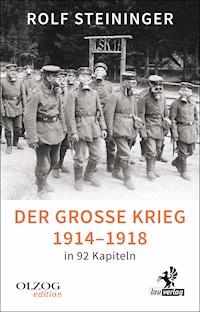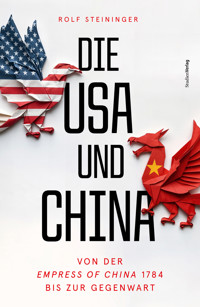
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Beziehungsgeflecht USA und China: Jahrhunderte im Fokus Die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung über die amerikanisch-chinesischen Beziehungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Die aktuelle Situation zwischen den USA und der Volksrepublik China ist dramatisch und voller Gefahren. Das kommunistische China fordert die USA als Weltmacht und die Nummer 1 im Pazifik heraus. Wie konnte es dazu kommen? Wie war es vorher? In seinem neuen Buch gibt Rolf Steininger Antworten auf diese Fragen. Alles begann 1784 mit der Fahrt eines Handelsschiffs von New York nach China. Ende des 19. Jahrhunderts waren die USA Schutzmacht für China. Im Zweiten Weltkrieg dann Verbündete gegen Japan. Nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg und dem Koreakrieg wird das "gottlose" Regime in Peking zwei Jahrzehnte isoliert. Mehrmals droht ein Atombombeneinsatz. Dann wird China Verbündeter der USA im Kampf gegen die Sowjetunion. Mit US-Hilfe wird aus dem Armenhaus China die Weltmacht, die sich am Ende des Kalten Krieges Russland zuwendet. Mit einer aggressiven Handels- und Außenpolitik und der Forderung nach Wiedervereinigung mit Taiwan – notfalls mit Gewalt – ist China inzwischen für die USA ein Problem geworden. 35 Fotos, davon 19 in Farbe, und zwei Faksimiles ergänzen den Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2025 by Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Internet: www.studienverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 42h UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7065-6468-7
Buchgestaltung nach Entwürfen von himmel. Studio für Design und Kommunikation, Innsbruck / Scheffau – www.himmel.ca.at
Satz: Studienverlag/Maria Strobl – www.gestro.at
Umschlaggestaltung: Studienverlag/Stefan Rasberger, www.labsal.at
Umschlagabbildungen: Stefan Rasberger unter Verwendung einer Vorlage von KREA
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.studienverlag.at
Inhalt
Einleitung
ERSTER TEIL
I:1784–1917.Von der Empress of China bis zum Ersten Weltkrieg
1. Die Empress of China
2. Vom Vertrag von Wanghia bis zum Ersten Weltkrieg
II:1917–1941.Vom Ersten Weltkrieg bis Pearl Harbor
1. Nationalist gegen Kommunist: Chiang Kai-shek gegen Mao Tse-tung
2. Japans Weg nach Pearl Harbor
ZWEITER TEIL
I:1941–1945.F. D. Roosevelt: Die Allianz mit Chiang Kai-shek
1. Japan nach dem Überfall auf Pearl Harbor
2. General gegen Generalissimo: Joseph Stilwell gegen Chiang Kai-shek
3. Konferenzen in Moskau, Kairo und Teheran
4. Zusammenarbeit mit Maos Kommunisten?
5. Die Konferenz von Jalta
II:1945–1953.Harry S. Truman: Der Verlust Chinas und der Krieg in Korea
1. Der Präsident
2. Stalins Vertrag mit Chiang und die Mandschurei
3. Mission impossible: George C. Marshall in China
4. China geht verloren
5. Der Koreakrieg
III:1953–1961.Dwight D. Eisenhower: Korea, Vietnam, Taiwan und die Atombombe
1. Der Präsident
2. Der Außenminister
3. Waffenstillstand in Korea oder Atombomben auf China
4. Vietnam
5. Die erste Taiwankrise 1954/55: Atombomben auf China?
6. Die zweite Taiwankrise 1958: Atombomben auf China?
7. Die CIA und Tibet
IV:1961–1963.John F. Kennedy: Taiwan, Laos, Vietnam und Chinas Atomanlagen
1. Taiwan
2 Laos
3. Vietnam
4. Zerstörung der chinesischen Atomanlagen?
V:1963–1969.Lyndon B. Johnson: Der Krieg in Vietnam und China
VI:1969–1974.Richard M. Nixon: Eine neue Beziehung zu China
1. „Only Nixon could go to China.“
2. Nixon und der Vietnamkrieg
3. Auf dem Weg nach China
4. Henry Kissinger in Peking
5. Nixon in China: „Eine Woche, die die Welt veränderte.“
6. Kommunistische Frühjahrsoffensive in Vietnam
7. Die USA und China als Verbündete (tacit allies)
VII:1974–1977.Gerald Ford: Kein Fortschritt in China
1. Der Präsident
2. Die Operation Mayaguez
3. Kissinger, Deng Xiaoping und Taiwan
4. Ford in Peking
VIII:1977–1981.Jimmy Carter: Die diplomatische Anerkennung Chinas
1. Der Präsident
2. Carters Initiative und Außenminister Vance in Peking
3. Carters Nationaler Sicherheitsberater Brzezinski in Peking
4. Deng Xiaoping in Amerika
5. Der Taiwan Relations Act
6. Brzezinski: „We are very sexy people.“
IX:1981–1989.Ronald Reagan: Taiwan und das „sogenannte“ kommunistische China
1. Der Präsident
2. Taiwan
3. Reagan in Peking
4. Die „goldene Ära“ in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen
X:1989–1993.George H. W. Bush: Das Tiananmen-Massaker
1. Der Präsident
2. Das Massaker und der Präsident
3. Taiwan
XI:1993–2001.Bill Clinton: Taiwankrise, Belgrad und die Welthandelsorganisation
1. Der Präsident
2. Menschenrechte und eine Fehlentscheidung
3. Die dritte Taiwankrise 1995/96
4. Clinton in Peking
5. Taiwan und Belgrad
6. China und die Welthandelsorganisation
XII:2001–2009.George W. Bush: Der „Krieg gegen den Terror“ und China
1. Der Präsident
2. Notlandung auf Hainan
3. Taiwan (1)
4. China als Partner im „Krieg gegen den Terror“
5. Taiwan (2)
XIII:2009–2017.Barack Obama: „Amerikas erster Pazifik-Präsident“
1. Enttäuschender Besuch in Peking
2. Taiwan und Tibet
3. Pivot to Asia
XIV:2017–2021.Donald Trump: Taiwan und der Handelskrieg
1. Der Präsident
2. Taiwan
3. Der Handelskrieg
XV:2021–2025.Joe Biden: Handelskrieg, neue Allianzen und Taiwan
1. Handelskrieg
2. Neue Allianzen
3. Taiwan
Schlussbetrachtung
Das Regime in Peking: Feind – Verbündeter – Rivale – Partner – Feind
Anmerkungen
ANHANG
Zeittafel
Abkürzungen
Bildnachweis
Literaturhinweise
Einleitung
„Deutschland. 3mal werden wir noch wach.“ So lautete die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 29. September 1990. In drei Tagen, in der Nacht zum 3. Oktober, würde die deutsche Wiedervereinigung Realität werden. Die Zeitung lag in der Abflughalle der Cathay Pacific im Flughafen von Hongkong, wo wir uns auf den Rückflug nach Frankfurt vorbereiteten. Wir, das war eine Gruppe von 15 Professoren und einer Kollegin, die vier Wochen die Volksrepublik China bereist hatten. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn hatte die Reise organisiert, nachdem die chinesischen Behörden zugestimmt hatten, dass wir auch Oppositionelle treffen konnten. Das war umso erstaunlicher, weil wir damit die erste internationale Gruppe waren, die nach dem Tiananmen-Massaker vom Juni 1989 China besuchen konnte.
Nach vier Wochen China: der Autor auf dem Flughafen von Hongkong.
Es war eine aufregende Reise. Unausgesprochen stand überall Tiananmen im Raum, jeder unserer Schritte wurde „unauffällig“ verfolgt; ging bei einem Taxi in Peking einmal ein Reifen kaputt, boten „spontan“ fünf Männer ihre Hilfe an. Bei allen Gesprächen war besonders hilfreich, dass einer der drei Begleiter der Bundeszentrale Chinesisch sprach und uns anschließend sagen konnte, was manchmal tatsächlich übersetzt worden war. Am letzten Tag der Reise sagten die Chinesen ein weiteres Treffen dann ab. Wir hatten offensichtlich zu viele kritische Fragen gestellt.
Das Sightseeing-Programm war überwältigend. Wir standen an jenem Ort (merkwürdigerweise bei Glenn-Miller-Musik), an dem Mao am 1. Oktober 1949 den Sieg der Kommunisten verkündet und die Volksrepublik China ausgerufen hatte. Und gleich daneben der Tiananmen-Platz mit seiner schrecklichen Vergangenheit – und daneben dann das Mausoleum, in dem der einbalsamierte Mao zu besichtigen war. Das Mausoleum war damals noch geschlossen, für uns wurde es geöffnet! Da lag er, den Henry Kissinger in seinen „Memoiren“ „eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der modernen Geschichte“ genannt hat.1 Ich muss gestehen, ich war nicht ganz so beeindruckt.
Dann die obligatorische Chinesische Mauer und die beeindruckende Terrakotta-Armee, die erst wenige Jahre vorher entdeckt und teilweise ausgegraben worden war. Auf dem riesigen Parkplatz stand nur ein Touristenbus – das war unser Bus. Die Souvenirverkäuferinnen waren zu bedauern, sie boten verzweifelt Terrakottakrieger für einen US-Dollar an. Einen Abendspaziergang in der nahegelegenen Stadt Xian mussten wir abbrechen und ins Hotel zurückgehen: Die Luftverschmutzung nahm uns den Atem.
Auch in Peking keine Touristen, fast leere Hotels. Kaum Autos, dafür viele Fahrräder. „Wenn die demnächst alle Auto fahren“, fragte fast schon prophetisch mein Kollege Christoph Kleßmann, mit dem ich vier Wochen in diversen Hotels freundschaftlich ein Zimmer geteilt hatte. Schanghais Uferpromenade – The Bund – hatte noch etwas von dem kolonialen Touch behalten. Nur 30 Jahre später kann man Schanghais Skyline leicht mit jener von Manhattan verwechseln. Christophs Frage beantworteten die Chinesen ziemlich schnell: 2023 waren allein 293 Millionen PKW gemeldet. China wurde Weltmacht. Und das mithilfe der USA, dessen Geschichte vielfach verbunden ist mit jener Chinas.
Dabei ist die aktuelle Lage voller Dramatik und voller Gefahren. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sind auf einem absoluten Tiefpunkt. China fordert die USA als Weltmacht und als die Nummer 1 im Pazifik heraus und ist für viele zum Feind der USA geworden.2 Wie konnte es so weit kommen? Und wie war es vorher? Das herauszufinden war ein Grund für mich, dieses Buch zu schreiben. Das Ergebnis ist die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung zur Geschichte dieser Beziehungen.
Alles begann vor 240 Jahren, genau im Jahr 1784. Wie so oft in der Geschichte war auch hier die Wirtschaft der Vorreiter der politischen Entwicklung. In diesem Fall war es die Empress of China, das erste amerikanische Segelschiff, das in jenem Jahr auf der Suche nach neuen Märkten von New York nach China fuhr. Dort gab es bereits seit Jahrhunderten ein Kaiserreich, während die USA selbst noch „Entwicklungsland“ waren. Die Amerikaner folgten daher der damaligen Weltmacht, dem British Empire, schlossen, wenn es ging, bessere Verträge mit China ab, nahmen 1796 erst konsularische, 1844 quasi-diplomatische, 1862 dann offizielle Beziehungen auf. Amerikanische Missionare brachten das Christentum nach China, Chinesen kamen nach Kalifornien, um Gold zu suchen, halfen nach dem amerikanischen Bürgerkrieg beim Bau der Transcontinental Railroad, waren aber dennoch nicht gern gesehen. Die Rede war von der „gelben Gefahr“.
1898 annektierten die USA Hawaii; im selben Jahr siegten sie in dem nur 112 Tage dauernden splendid little war gegen Spanien, eroberten Kuba, Guam und die Philippinen und wurden so Kolonialmacht mit Interessen in Asien – nachdem sie schon 1853 Japan „geöffnet“ hatten. Bis zum Ersten Weltkrieg erlebten die USA dann eine gewaltige Entwicklung. So wuchs die Einwohnerzahl von 75 Millionen im Jahr 1900 auf 92 Millionen im Jahr 1913; im selben Jahr stiegen sie zum größten Stahlproduzenten der Welt auf. Sie besaßen eine starke Flotte, vermittelten 1905 den Frieden zwischen Russland und Japan und 1906 auf Bitten Deutschlands im Streit zwischen Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Österreich-Ungarn wegen Marokko.
Die USA waren zur Großmacht geworden und wurden eine Art Schutzmacht für das chinesische Kaiserreich, das inzwischen schwächer und zum Spielball der imperialistischen Mächte geworden war. Besser als alles andere beschreibt eine Karikatur des amerikanischen Satiremagazins „Puck“ die damalige Situation (s. S. 27).
Das Kaiserreich zerfiel, die neue Republik China blieb schwach, Japan machte 1932 aus der Mandschurei einen Vasallenstaat und überfiel 1937 China, während die USA die außenpolitische Handlungsfähigkeit der eigenen Regierung mit Neutralitätsgesetzen einschränkten.
Mit Japans Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 begann in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen eine neue Phase. US-Präsident Roosevelt betrachtete China anstelle Japans als einen der großen Player für die Nachkriegszeit an der Seite des Westens und der Sowjetunion und formte die Kriegsallianz mit Chinas Führer Chiang Kai-shek.
Es kam anders: China ging 1949 an Mao Tse-tungs Kommunisten „verloren“. Es folgte die totale Isolierung der „gottlosen“ Volksrepublik China bis zum Besuch von US-Präsident Nixon in China 1972. China und die USA wurden zu „heimlichen Verbündeten“ (Kissinger: tacit allies) der USA im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Aus dem Armenhaus Asiens wurde mit amerikanischer Hilfe das Powerhouse Asiens: Produkte Made in China waren preiswert und beliebt in den USA. Aber China wurde keine Demokratie. Dafür steht u. a. das Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989.
Madeleine Albright, Außenministerin unter Bill Clinton, hat das China des Jahres 1999 in ihrer Autobiographie einmal so beschrieben: „China ist eine Kategorie für sich – das Land ist zu groß, um es zu ignorieren, zu repressiv, um es mit offenen Armen aufzunehmen, zu schwer zu beeinflussen, und sehr, sehr stolz.“3 Die Beziehungen der USA mit diesem Land waren nicht immer einfach, ihre Bedeutung für die USA – und nicht nur für die – ist allerdings unbestritten und inzwischen größer denn je.
Angesichts dieser Sachlage verwundert es nicht, dass die chinesischamerikanischen Beziehungen in der US-Historiographie schon immer ein sujet célèbre gewesen sind. Es gibt außerordentlich viele Arbeiten zu diesem Thema. Dong Wang listet in ihrem 2021 erschienenen Buch The United States and China. A History from the Eighteenth Century to the Present ca. 800 Titel auf.4
Es werden aber fast ausschließlich Titel zu Einzelaspekten genannt. Gesamtdarstellungen, und das ist schon etwas verwunderlich, sind Mangelware;5 sie zu schreiben ist offensichtlich eine Herausforderung; das Thema ist in der Tat sehr komplex.
Und da verwundert es dann auch nicht, dass es im deutschen Sprachraum gar keine Gesamtdarstellung über diese Beziehungen gibt,6 Beziehungen, die ja auch in vielfältiger Weise Einfluss auf Deutschland hatten und haben, denkt man nur an die Wirtschaft und da insbesondere an die Autoindustrie. China ist bekanntlich der zweitgrößte Handelspartner der Bundesrepublik. Diese Lücke zu schließen, war für mich ein weiterer Grund, dieses Buch zu schreiben.
Es gab allerdings noch einen weiteren Grund. In meiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich mich u. a. intensiv mit der Geschichte der USA beschäftigt und zahlreiche Arbeiten vorgelegt: über die USA und Deutschland, die USA im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, im Nahen Osten, in der Kubakrise, in Europa, im Kalten Krieg, schließlich über die USA als globale Führungsmacht.7 Mir fehlte bislang ein Aspekt, um dieses Bild zu vervollständigen: die USA und deren Blick nach China. Das wollte ich nachholen.
Als Weltmacht haben die USA immer global agiert, in ihrer Außenpolitik laufen viele Dinge parallel ab. Das wird schon deutlich, wenn man die Dokumenten-Editionen des Auswärtigen Amts mit jenen des State Department vergleicht, etwa über die Zeit 1969 bis 1974 – der Regierungszeit von Willy Brandt und Richard Nixon. Auf deutscher Seite gibt es fünf, auf amerikanischer Seite 66 Bände.
Ich fand es spannend herauszufinden, wie die Dinge mit dem Thema China zusammenhingen und wie die Präsidenten damit umgingen, wenn etwa Präsident Truman seit 1945 mit der Palästinafrage, dem Kalten Krieg, dem chinesischen Bürgerkrieg und dem Koreakrieg konfrontiert war. Oder Eisenhower mit dem Koreakrieg, Frankreichs Niederlage in Dien Bien Phu und den anschließenden Taiwan-Krisen, Kennedy, der um fast jeden Preis die israelische Atombombe verhindern wollte und gleichzeitig Überlegungen zur Vernichtung der chinesischen Atomanlagen anstellte, Nixon 1972 in Peking und zeitgleich die Vorbereitungen der nordkoreanischen Kommunisten auf ihre Frühjahrsoffensive, Kissinger 1973 in Peking und dem Yom Kippur-Krieg, Carter 1979 gleichzeitig mit dem NATODoppelbeschluss, Geheimverhandlungen zur Beilegung des Nahostkonflikts und zur diplomatischen Anerkennung Chinas und dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan beschäftigt ist, Clinton in Israel bei gleichzeitiger Taiwan-Krise etc. Wenn man diese parallel laufenden, manchmal sogar ineinandergreifenden Ereignisse vor Augen hat, lassen sich auch die Entscheidungen der jeweiligen Akteure in der konkreten Situation mit Blick auf China besser einordnen und das Gesamtbild der US-Außenpolitik wird etwas deutlicher.
Ein schönes Beispiel dafür sind etwa zwei Ereignisse im Jahr 1946: Am 4. März trifft Fünf-Sterne-General George Marshall Chinas Kommunistenführer Mao Tse-tung in dessen Hauptquartier Yenan; nur einen Tag später, am 5. März hält Winston Churchill auf der anderen Seite des Globus seine „Eiserner Vorhang“-Rede in Fulton, Missouri, in Anwesenheit von Präsident Truman. Kalter Krieg in Europa, Kalter Krieg in Asien: Und als Hauptakteur unausgesprochen mit dabei Sowjetdiktator Josef Stalin bzw. seine Nachfolger. Irgendwie hängen die Ereignisse zusammen.
Wichtig ist: Es geht in meiner Arbeit um die amerikanische Politik gegenüber China. Ich erzähle diese Geschichte aus der Sicht Washingtons!
Grundlage dafür waren zum einen eigene Arbeiten und die zahlreichen Arbeiten meiner US-Kollegen und -Kolleginnen, denen ich zutiefst zu Dank verpflichtet bin, zum anderen die vom State Department in Washington veröffentlichten Dokumente, die bis zur Carter-Präsidentschaft reichen, die „Papiere“ der jeweiligen US-Präsidenten, diverse Nachlässe, Tagebücher, Veröffentlichungen des National Security Archive in Washington auf der Basis des amerikanischen Freedom of Information Acts und natürlich die zahlreichen Erinnerungen der damaligen Akteure.
Solche Materialien stehen dem Historiker nur in einer freien, demokratischen Gesellschaft zur Verfügung. Auf chinesischer Seite gibt es für Außenstehende nichts Vergleichbares, keine Archivarbeit wie in Washington oder London, keine Dokumenten-Editionen des Außenministeriums, ganz zu schweigen von etwas Vergleichbarem wie dem Freedom of Information Act.Vor 25 Jahren waren nicht einmal Interviews möglich, wie der amerikanische Journalist James Mann erzählt. Der wollte für sein Buch einen Botschafter der Volksrepublik befragen und bekam mit einem Lächeln die Antwort: „Wollen Sie mich ins Gefängnis bringen?“8
Natürlich wäre es spannend, etwa Wortprotokolle von Gesprächen zwischen Mao und Tschou En-lai über Nixon oder Deng Xiaoping über Carter zu lesen, oder Berichte der chinesischen Botschafter in Washington etc. Aber das ist mit ganz wenigen Ausnahmen nicht möglich. Es bleibt primär die amerikanische Sicht der Dinge.
Der vorliegende Band gliedert sich in zwei Teile. Der erste ist eine knappe Einführung in das Thema, beginnt nach Gründung der USA mit der Fahrt der erwähnten Empress of China 1784 und reicht bis zum Überfall Japans auf Pearl Harbor. Dem folgt der umfangreiche zweite Teil, der bis zur Präsidentschaft von Joe Biden reicht. Wer über diese Darstellung hinaus tiefer in die Materie einsteigen möchte, sei auf die jeweils zu Beginn eines Kapitels genannte Literatur verwiesen. Nur für einen ersten Überblick sind daher die Literaturhinweise am Schluss des Bandes gedacht.
Und dann ist da noch etwas: Taiwan, jene Insel, die ca. 160 Kilometer östlich vom chinesischen Festland liegt, sich Republic of China (Taiwan) nennt, im 20. Jahrhundert beinahe einen Atomkrieg ausgelöst hätte und im 21. Jahrhundert immer noch zur größten Krise des Jahrhunderts werden könnte. Taiwan ist ein zentrales Thema in meinem Buch.
Auf der anfangs erwähnten Reise sind wir von den chinesischen Gesprächspartnern immer wieder auch auf die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung angesprochen worden. Man verband das mit dem Hinweis, es werde wohl bald auch bei ihnen eine Wiedervereinigung geben. Wir dachten, sie meinten Hongkong. Sie meinten allerdings etwas anderes und sagten es auch: Taiwan. Die „abtrünnige Provinz“ werde schon bald zum „Mutterland“ zurückkehren – so oder so, mit oder ohne Gewalt.
Eines ist klar: Die Taiwan-Straße ist seit 1954 der gefährlichste Ort der Welt. Damals hatten nur die USA Atombomben, seit 1964 stehen sich dort zwei Atommächte gegenüber. Dazu passt die Äußerung von Chinas starkem Mann, Xi Jinping, auf dem Volkskongress der kommunistischen Partei in Peking im März 2024: „Die Wiedervereinigung ist unverzichtbar. Notfalls auch militärisch.“9 Schon vorher hatte US-Präsident Joe Biden auf die Frage, ob die USA dann Taiwan militärisch verteidigen würden, eine knappe Antwort gegeben: „Ja.“10
Dazu passt auch die Warnung von Australiens Botschafter in den Vereinigten Staaten, Kevin Rudd. Der meinte am 6. Juni 2024 in einer Rede in Honolulu auf Hawaii: „Wir wären töricht, wenn wir die immer deutlicher werdenden militärischen Signale Chinas ignorieren würden, einschließlich der Verhaltensmuster seiner jüngsten Militärübungen.“ Wenn Xi Jinping, der im Juni 71 Jahre alt wird, die Wiedervereinigung Taiwans erreichen wolle, werde er wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt handeln, bevor er die 80 erreicht. Ob China handle, werde davon abhängen, wie es die Stärke der amerikanischen Abschreckung einschätze.11
35 Fotos und zwei Faksimiles runden den Band ab. Für ihre Hilfe bei deren Beschaffung danke ich besonders Ryan Pettigrew, Richard M. Nixon Presidential Library; Michael Pinckney, Ronald Reagan Presidential Library; Herbert Ragan, William J. Clinton Presidential Library; McKenzie Morse, George H. W. Bush Presidential Library; Leigh Gleason, Library of Congress; Alyssa, George W. Bush Presidential Library; Matthew Green und Thomas Hayes, National Archives; Melissa Davis, George C. Marshall Foundation; Mary Burtzloff, Dwight D. Eisenhower Presidential Library; Sean McConnell, Gerald R. Ford Presidential Library.
Danken möchte ich auch sehr herzlich Frau Hanna Rusch MA BA von der Projektleitung des Verlages für die professionelle Betreuung dieses Bandes.
Innsbruck, im September 2024
ERSTER TEIL
I:
1784–1917.Von der Empress of China bis zum Ersten Weltkrieg
1. Die Empress of China
2. Vom Vertrag von Wanghia bis zum Ersten Weltkrieg
1. Die Empress of China
Am 22. Februar 1784, George Washington feierte seinen 52. Geburtstag, verließ ein stattlicher Dreimast-Schoner den Hafen von New York: die Empress of China (im Folgenden Empress). Der Name des Schiffs war kein Zufall, die Empress war auf dem Weg nach China. Vor ihr lagen 18.000 Seemeilen, ca. 34.000 Kilometer. Es würde die erste Fahrt eines amerikanischen Schiffes nach China sein – und war mit viel Symbolik und Hoffnung verbunden: Für jeden sichtbar waren die Stars and Stripes gehisst, die Empress verabschiedete sich mit 13 Salutschüssen – für jeden der 13 Gründerstaaten der neuen Vereinigten Staaten von Amerika ein Schuss.
Nur wenige Monate zuvor hatten die Briten im Frieden von Paris die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika offiziell anerkannt. Die Freude in Amerika war groß, aber die während des Krieges aufgehäuften Schulden waren geblieben. Und es gab wirtschaftliche Probleme. Man hatte zwar die Bindungen zu Großbritannien gekappt, aber dafür Märkte verloren: Die Briten schlossen ihre Häfen im Mutterland und vor allem in den West Indies. Gleichzeitig kündigten Frankreich und Spanien die für die Dauer des Krieges gewährten Handelsprivilegien.
Dringend benötigt wurden daher neue Märkte. Mit der Empress war die Hoffnung verbunden, dass das China sein könnte.1
Die Initiative zu der Fahrt kam von Robert Morris (1734–1806). Morris war ein Unternehmer aus Philadelphia, hatte die Unabhängigkeitserklärung mitunterzeichnet, war dann Superintendent für Finanzen der USA (eine Art Finanzminister) gewesen und galt als der „Financier der Revolution“. Er besaß mehrere Kaperschiffe, die während des Krieges die Fracht englischer Schiffe beschlagnahmten. Morris gewann den New Yorker Daniel Parker als Partner für das China-Geschäft. Parker organisierte im Juli 1783 den Umbau eines Kaperschiffs in Boston zum Handelsschiff, angelehnt an die britische Bellisarin, damals das angeblich schnellste Schiff der britischen Navy.
Ende des Jahres war der Umbau abgeschlossen. Das ehemalige Kaperschiff hieß jetzt Empress of China, und es konnte mit der Ladung begonnen werden: 2.600 Otter-Felle, verschiedene Stoffe, Branntwein; vor allem aber 30 Tonnen Ginseng-Wurzeln, eine Wurzel, die westlich der Appalachen wild wuchs und in China als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten sehr beliebt war. Die Ladung hatte einen Wert von insgesamt 120.000 US-Dollar, für damalige Verhältnisse eine enorme Summe und für Morris und Partner ein riskantes Investment. Die Historikerin Dong Wang weist zum Vergleich auf das Eigenkapital der 1784 gegründeten Massachusetts Bank in Boston hin: gerade einmal 250.000 US-Dollar.
An Bord der Empress waren 46 Mann, u. a. ein Kanonier, ein Arzt, zwei Handwerker. Die wichtigsten Männer waren der 49-jährige John Green als Kapitän, der im Krieg britische Versorgungsschiffe gekapert hatte, und Samuel Shaw (1754–1794) aus Boston. Der war zwar erst 30 Jahre alt, galt aber bereits als „Held des Revolutionskrieges“ und war als Supercargo verantwortlich für die Ladung, vor allem für deren Verkauf in China.
Die Fahrt der Empress war etwas Außergewöhnliches. Die Mitglieder des Kontinentalkongresses standen hinter diesem Unternehmen, die Geldgeber waren sämtlich Founding Fathers der Republik. Kapitän Green und seine Crew wurden als Pioniere im Dienst für den neuen Staat gesehen. Entsprechend symbolisch mit 13 Salutschüssen war auch die Abfahrt des Schiffes, an der die Öffentlichkeit großen Anteil nahm. Die New Yorker „Independent Gazette“ wünschte dem Schiff nicht nur Erfolg, sondern erinnerte ihre Leser auch daran, dass jene, die „neue Wege für unseren Handel suchen, der Nation einen Dienst erweisen“.2
Samuel Shaw hat über die Fahrt der Empress und den Aufenthalt in China Tagebuch geführt. Es wurde 1847 veröffentlicht und ermöglicht einen faszinierenden Einblick in das damalige Geschehen.3
Der erste Zwischenstopp der Empress waren die Kapverden, wo Sklavenschiffe vor Anker lagen; dann wurde das Kap der Guten Hoffnung umfahren, in Jakarta die Vorräte ergänzt. Zwei französische Schiffe begleiteten die Empress durch das Südchinesische Meer. Am 24. August wurden in der portugiesischen Kolonie Macao die nötigen Papiere zur Weiterfahrt organisiert und Lotsen an Bord genommen, die die Empress auf dem Fluss Pearl am 30. August in den Hafen Whampoa navigierten, wo sie die übrigen Schiffe mit 13 Salutschüssen begrüßte. In Whampoa mussten damals alle Schiffe vor Anker gehen, während die Supercargos im 20 Kilometer stromaufwärts gelegene Kanton (dem heutigen Guangzhou) tätig waren. Dort mussten alle Geschäfte über Kaufleute, die sogenannte Cohong-Gilde, abgewickelt werden. Die Preise waren staatlich festgesetzt.
Die chinesischen Händler, so berichtet Shaw, hätten sie mit „großem Respekt als Bürger einer freien und unabhängigen Nation“ begrüßt und seien sehr verständnisvoll gewesen. Da die Empress das erste amerikanische Schiff war, das China besuchte, dauerte es eine ganze Weile, „bis sie uns von Engländern unterscheiden konnten. Sie nannten uns die Neuen. (,the New People‘) Und als wir ihnen anhand einer Karte die Größe unseres Landes demonstrierten, waren sie hocherfreut über einen neuen Markt für ihre Waren.“
Für den Verkauf der Ladung benötigte Shaw vier Monate. Am 27. Dezember 1784 lichtete die Empress die Anker und verließ mit neun Salutschüssen China wieder, an Bord mehrere Tonnen Tee, Stoffe, Zimt und etwa 64 Tonnen Porzellan. Die Ankunft in New York am 11. Mai 1785 war das Ereignis; Zei tungen feierten die glückliche Rückkehr; es gab Forderungen, einen öffentlichen Dankgottesdienst abzuhalten und die Glocken läuten zu lassen. Der Kongress wurde öffentlich aufgefordert, sich für den Handel mit China stark zu machen, „denn der Gewinn aus diesem einträglichen Geschäft bleibt bei uns“. Der Kongress selbst dankte der Besatzung und äußerte „größte Zufriedenheit für dieses erste Unternehmen amerikanischer Bürger, den Handel mit China zu beginnen“.
Die Ladung wurde relativ schnell mit einem Gewinn von 30 Prozent verkauft; etwa 30.000 US-Dollar (nach heutigem Wert etwa eine Million). Unter den Käufern war George Washington, ein begeisterter Porzellanfan. (Porzellan war damals als bürgerliches Kulturgut in, chinesisches Porzellan besonders beliebt.) Er erstand ein Set mit 302 Teilen; einige Stücke sind noch heute in Washingtons ehemaligem Haus Mount Vernon zu bewundern.4 Das Besondere an diesem Set war das Emblem der Society of the Cincinnati, deren Präsident Washington war. („Die Gesellschaft der Cincinnati“ war eine erbliche Organisation, deren Mitglieder auf diejenigen beschränkt waren, die während des Unabhängigkeitskrieges als Offiziere gedient hatten. Samuel Shaw hatte dem Künstler in Kanton die Embleme der Cincinnati geliefert.)
Samuel Shaw wurde der erste diplomatische Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika in China: Der Kongress ernannte ihn am 27. Januar 1786 zum Konsul in Kanton.
Mit Ginseng wurde in den folgenden Jahren im Chinahandel sehr viel Geld verdient. Das führte sogar zur Gründung verschiedener Städte im Staat New York. Bis 1790 hatten bereits 28 Schiffe die Fahrt nach Kanton gemacht. Nur die Briten waren dort nach wie vor stärker vertreten.
2. Vom Vertrag von Wanghia bis zum Ersten Weltkrieg5
Die Briten tranken Tee, die Chinesen rauchten Opium. Der Teeimport aus China gehörte zu den lukrativsten Geschäften der britischen East India Company. Sie hatte das entsprechende Monopol und finanzierte den größten Teil des britischen Haushalts. Der Tee wurde mit Opium aus Indien bezahlt. Das Problem war nur, dass der Konsum von Opium in China seit 1796 absolut verboten war. Da die Nachfrage allerdings groß war, blühte der illegale Handel, den britische Händler organisierten. Der Import stieg von 400 Kisten pro Jahr um 1750 auf 40.000 Kisten 1839. Im März desselben Jahres griffen die Chinesen allerdings durch. Der Gouverneur von Kanton konfiszierte 20.000 Kisten und vernichtete sie öffentlich. Erinnerungen an die Boston Tea Party aus dem Jahr 1773 wurden in London wach. Im Juli eskalierte die Situation weiter. Die Chinesen forderten von den Briten die Herausgabe eines britischen Seemanns, der wegen Totschlag eines Chinesen angeklagt war. Als die Briten sich weigerten, stoppten die Chinesen die Versorgung der britischen Schiffe in Macao. Die setzten sich in Richtung Hongkong ab, wo es am 4. September 1839 zu einem ersten Seegefecht zwischen chinesischen Kriegsdschunken und drei britischen Schiffen kam. Der sogenannte Erste Opiumkrieg hatte begonnen.
Das britische Parlament beschloss daraufhin drastische Maßnahmen gegen China: Im Mai begann mit 60 Kriegsschiffen, 540 Kanonen und 4.000 Soldaten die entscheidende Phase des Krieges. Die Briten eroberten die Insel Zhoushan, blockierten erst Kanton, dann Teile der gesamten Küste und damit die Transportwege nach Peking. Die Chinesen hatten keine Chance und mussten am 29. August 1842 an Bord des britischen Kriegsschiffs HMS Cornwall den Vertrag von Nanking unterschreiben.6 Das nannte man britische „Kanonendiplomatie“.
Dieser Vertrag gilt als der erste der sogenannten „ungleichen Verträge“ zwischen China und den westlichen Industriestaaten. China musste fünf Häfen für den britischen Handel öffnen, Hongkong abtreten, Wiedergutmachung zahlen, britische Staatsbeamte mit chinesischen gleichstellen. Das Thema Opium wurde nicht erwähnt. In einem weiteren Vertrag wurde die Meistbegünstigung für britische Waren festgeschrieben.
Was die Briten bekommen hatten, wollten die Amerikaner auch gerne – allerdings ohne Krieg. Präsident John Tyler ernannte im Mai 1843 den ehemaligen Kongressabgeordneten Caleb Cushing (1800–1879) aus Massachusetts zum diplomatischen Vertreter der USA in China. Cushing erreichte Macao im Februar 1844 und agierte erfolgreich. Diplomatische Beziehungen wurden am 14. Juni aufgenommen. Nach intensiven Verhandlungen wurde am 3. Juli 1844 der Vertrag von Wanghia im Kun-Iam-Tempel unterzeichnet, so genannt nach einem Dorf in der Nähe von Macao, wo der Tempel stand. Es war der erste Vertrag zwischen den USA und dem Kaiserreich China. Den Amerikanern wurden alle Rechte aus dem Vertrag von Nanking eingeräumt, darüber hinaus durften sie aber, wohl auch, weil sie keine Kolonialherren waren, eigene Häuser, Geschäfte, Kirchen, Krankenhäuser und Friedhöfe errichten. Das Thema Opium wurde allerdings ausdrücklich erwähnt: Gegen Schiffe und Händler würden die USA „Maßnahmen ergreifen“ – was später allerdings nicht geschah.7
Als allerdings in den folgenden Jahren China u. a. die im Vertrag von Nanking vorgesehene Öffnung der Häfen verzögerte und dadurch die britischen Exporte nach China geringer waren als vor dem Vertrag, war dies für Briten und Franzosen Grund genug, die eigenen Interessen gewaltsam durchzusetzen. Die Situation schien insofern günstig für sie, da das Kaiserreich durch den anhaltenden Taiping-Aufstand – seit 1851 kämpften Rebellen in der südlichen Provinz gegen die Mingh-Dynastie (am Ende mit 20–30 Millionen Toten) – geschwächt war.
Unmittelbarer Anlass war der sogenannte Arrow-Zwischenfall am 8. Oktober 1856 in Kanton. Die Arrow war ein chinesisches Schiff. Da es den Union Jack gehisst hatte, hätten chinesische Zollbeamte das Schiff laut Vertrag von Nanking nicht betreten dürfen. Sie taten es aber und holten darüber hinaus die britische Flagge vom Fahnenmast. Als die von London geforderte chinesische Entschuldigung ausblieb, eröffneten die Briten das Feuer auf die Forts von Kanton und auf den Sitz des chinesischen Gouverneurs. Frankreich schloss sich der Operation an. Der Anlass hier war der Tod eines französischen Missionars, der in Südchina zu Tode gefoltert worden war. Der Zweite Opiumkrieg hatte begonnen.8 Diesmal waren die USA – und Russland – mit dabei. Im Mai 1858 wurde Tientsin in der Nähe von Peking besetzt.
Am 26./27. Juni kam es dort zur Unterzeichnung eines vierfach ausgefertigten Vertrages Chinas mit Großbritannien, Frankreich, Russland und den USA. Das Kaiserreich musste u. a. zugestehen: permanente diplomatische Vertretungen in Peking, die englische Sprache maßgebend, Ausländer durften in offiziellen Dokumenten nicht mehr „Barbaren“ genannt werden, Eröffnung von Konsulaten, Meistbegünstigung, freie Betätigung von Missionaren, Öffnung von zehn weiteren Häfen, dort und in den Zollstationen sollten britische Standardgewichte und -maße von nun an gelten, Legalisierung des Opiumhandels, Zahlung einer hohen Entschädigung. Ein weiterer „ungleicher Vertrag“, mit dem die erste Phase dieses Krieges beendet wurde.
Als China die Umsetzung verzögerte, setzten die Alliierten ihre Truppen in Richtung Peking in Bewegung, das am 13. Oktober 1860 eingenommen wurde. Der Kaiser war in die Mandschurei geflohen, die Franzosen plünderten seinen Sommerpalast, den die Briten anschließend in Brand steckten. Am 18. Oktober 1860 bestätigte Prinz Gong in Vertretung des Kaisers den Vertrag von Tientsin, musste sogar noch zusätzliche Bedingungen akzeptieren: Öffnung des Hafens von Tientsin, weitere Reparationsleistungen und Gebietsabtretungen an Großbritannien und Russland.
Das Opium war für Briten und Franzosen am Ende nur Mittel zum Zweck. Es ging primär darum, das chinesische Reich gewaltsam für westliche Warenströme und westliche Ideen zu „öffnen“. In zwei Kriegen gelang das – und die USA machten mit und wurden Nutznießer der Privilegien, die die Briten erkämpft hatten.
Bei einer anderen Sache machten die Amerikaner nicht mit, obwohl es möglich gewesen wäre: bei der Aufteilung Chinas. Die europäischen Mächte reklamierten nach Belieben Teile Chinas für sich. Auf amerikanischer Seite gab es ähnliche Vorschläge. Objekt der Begierde war Formosa. Schon Commodore Matthew Perry, der 1853 Japan „geöffnet“ hatte, hatte die Annexion der Insel vorgeschlagen, genauso wie wenig später der bekannte Unternehmer und dann Vizekonsul in Kanton, Gideon Nye Jr. Washington hatte nicht reagiert. Dann machte Peter Parker 1857 den gleichen Vorschlag: Die Briten hatten Hongkong, warum nicht die Amerikaner Formosa als Handelsstützpunkt und Kohlestation für die Flotte? Parker war eine gewichtige Stimme: Er hatte als einer der ersten Missionare eine Augenklinik in China eröffnet und 1853 die diplomatische Vertretung übernommen. Zum ersten Mal in der Geschichte stand die Insel zwischen China und den USA. Angesichts der Aufgaben im eigenen Land (nach Aufnahme neuer Staaten, u. a. Kalifornien) lehnte US-Präsident Buchanan ab, Parker wurde abberufen.9
Die Beziehungen zwischen den USA und dem Kaiserreich China wurden jetzt offiziell. Präsident Lincoln ernannte 1862 Anson Burlingame (1820–1879), einen ehemaligen Abgeordneten aus Massachusetts, zum Botschafter in Peking. 1868 gewährten die USA dann China im sogenannten „Burlingame Vertrag“ den Status eines bevorzugten Außenhandelspartners im Sinne der Meistbegünstigung. 1875 zog China nach und schickte einen Botschafter nach Washington.
In jenen Jahren sahen Amerikaner auch erstmals Chinesen in ihrem Land, vornehmlich in Kalifornien, wo 1849 im Zuge des Goldrausches 100.000 gekommen waren. Nach dem Bürgerkrieg wurden sie zum Bau des Westteils der transkontinentalen Eisenbahn offiziell angeworben, wurden dann in der Landwirtschaft und in der Fischerei tätig. Diese ca. 300.000 Chinesen stießen bei den Amerikanern zunehmend auf Ablehnung; die Rede war von der „gelben Gefahr“. Es gab Zwangsansiedlungen von chinesischen Migranten in Chinatowns, Mischehenverbot, keine US-Staatsbürgerschaft. 1882 beschloss der Kongress den Chinese Exclusion Act, der für die nächsten zehn Jahre jede Einwanderung von Chinesen untersagte und jeweils verlängert wurde, 1904 auf unbefristete Zeit – und bis 1943 gültig war. (Im Immigration Act von 1924 wurde das Verbot auf alle Ostasiaten und Inder ausgedehnt.)10
Keine weitere Aufteilung Chinas: die Open-Door-Politik11
Am 6. September 1899 schickte US-Außenminister John Hay (1838–1905) an die Regierungen in London, Paris, Berlin, Rom, Tokio und Sankt Petersburg eine berühmt gewordene Note, die als Open-Door-Note in die Geschichte eingegangen ist. Tatsächlich benutzte Hay den Begriff allerdings nur einmal, und zwar in der Note an die britische Regierung.
Hay erkannte in der Note „Einflusszonen“ der einzelnen Länder in China an und bat die Regierungen gleichzeitig um die Zusicherung, dass
1. in diesen „Zonen“ die Interessen der übrigen Mächte nicht beeinträchtigt würden,
2. die chinesischen Zölle für alle gleichermaßen gelten und von Chinesen eingezogen würden, und
3. Hafengebühren und Eisenbahnfrachtsätze für alle Personen, ungeachtet ihrer Nationalität, auf gleichem Niveau gehalten werden sollten.12
Am 4. Januar 1900 verkündete Hay, dass sämtliche Mächte „einstimmig und sofort“ zugestimmt hätten. In den USA sprach man von einem großen diplomatischen Erfolg.
Was hatte Hay zu dieser Initiative veranlasst, und wie ist seine Note letztlich zu bewerten?13
Ende des 19. Jahrhunderts waren die USA auf dem Weg zur Weltmacht – mit wachsenden Ambitionen im Pazifik und in Ostasien. 1867 hatte man die Midway-Insel annektiert, 1875 wurde Hawaii praktisch zum Protektorat, 1878 waren die USA auf Samoa. Im „splendid little war“ wurde Spanien 1898 in 112 Tagen besiegt und die Philippinen besetzt, gleichzeitig Hawaii und Guam, ein Jahr später folgte Wake Island.
Karikatur von John S. Pughe im „Puck“ vom 23. August 1899 zur Open-Door-Politik: Uncle Sam steht auf einer Karte von China, die die europäischen Staatsoberhäupter zerschneiden wollen, und sagt: „Gentlemen, you may cut up this map as much as you like; but remember that I’m here to stay, and that you can’t divide me up into spheres of influence!“ („Meine Herren, Sie können diese Karte so oft zerschneiden, wie Sie möchten, aber denken Sie daran, dass ich hier bleiben will, und dass Sie mich nicht in Einflusssphären aufteilen können.“) Mit jeweils einer Schere in der Hand sind dabei (v. l.): Kaiser Wilhelm II, König Umberto I (Italien), John Bull (Großbritannien), Zar Nicholas II (Russland), Präsident Émile Loubet (Frankreich); im Hintergrund Kaiser Franz Joseph I. beim Schärfen seiner Schere.
Der „Wettlauf um China“ bzw. seine Aufteilung hatte da längst begonnen.
Taiwan wird japanisch
Den Anfang hatte Japan gemacht. Objekt der Begierde war Korea, das seit Beginn des Kolonialzeitalters Tributstaat des chinesischen Kaiserreichs war. Als ersten Schritt verfolgte Japan die Loslösung Koreas von China, zunächst mit friedlichen Mitteln. Nachdem China zugestimmt hatte, dass Korea über ein hohes Maß an faktischer Selbstbestimmung verfügen sollte, wurde das Land im japanisch-koreanischen Vertrag von Kanghwa 1876 als „unabhängiger und souveräner Staat“ bezeichnet. 1885 einigten sich China und Japan, ihre Streitkräfte innerhalb von vier Monaten aus Korea abzuziehen.
Zehn Jahre später entstand in Korea jene Krise, die zum auslösenden Moment des ersten modernen Krieges zwischen Japan und China wurde. Als die koreanische Regierung China um Hilfe bei der Niederwerfung eines gegen sie gerichteten Aufstandes bat, schlug Japan eine gemeinsame Reformpolitik für Korea vor. Das lehnte China ab, worauf japanische Truppen in den Königspalast eindrangen und China am 1. August 1894 die Kriegserklärung überreichte. China erlitt anschließend eine schwere militärische Niederlage. Am 17. April 1895 wurde in Shimonoseki ein Friedensvertrag unterzeichnet. China musste die „volle und umfassende Souveränität Koreas“ anerkennen und darüber Taiwan und die Pescadores-Inseln an Japan abtreten. Taiwan, von den Portugiesen Formosa genannt, war jene Insel, die ca. 160 Kilometer östlich vom chinesischen Festland liegt, halb so groß wie Bayern ist und seit 1684 zum chinesischen Kaiserreich gehört hatte. Von nun an war Japanisch die offizielle Sprache auf der Insel.
Neben Russland war Japan zur vorherrschenden Macht in jener Region Asiens geworden. Beide erhoben Ansprüche auf die Mandschurei und Korea.14
Russland erreichte 1898 die Verpachtung der Liaotung-Halbinsel mit den Häfen Port Arthur und Dairen und die Genehmigung zum Bau einer weiteren Eisenbahn in der Mandschurei, Großbritannien als Reaktion die Verpachtung der Bucht von Weihaiwei mitsamt der Insel Liukungtao und der Hongkong gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon für die Dauer von 99 Jahren. Deutschland nahm sich 1898 das Gebiet von Kiautschau mit der Hafenstadt Tsingtau, Frankreich die Kwangtschou-Bucht, die an Indochina angrenzte, Italien die Sanmönn-Bucht südlich des Jangtse. In dieser Situation schickte Außenminister Hay seine erste Note.
Die Kaiserin-Mutter formulierte es so:
„Die verschiedenen Mächte werfen auf unser Land begehrliche Blicke wie Tiger, die uns verschlingen wollen, und drängen sich untereinander in dem Bemühen, sich als [E]rste auf unsere innersten Gebiete zu stürzen.“15
Die Reaktion blieb nicht aus. Der Protest der Chinesen wurde als „Boxer-Aufstand“ bekannt und hatte das Ziel, die „ausländischen Teufel“ aus dem Land zu treiben. Missionare wurden massakriert, am 5. Juni 1900 die Bahnlinie von Tientsin nach Peking unterbrochen und die Ausländer in der Stadt belagert. Die Alliierten stellten eine multinationale Interventionstruppe auf (10.000 Japaner, 4.000 Russen, 3.000 Briten, 2.000 Amerikaner, 800 Italiener, 800 Franzosen, 200 Deutsche, 100 Österreicher und Ungarn), die den Aufstand mit einem Sieg über die „Boxer“ am 15. August beendeten.16
Die USA wollten damals die weitere Aufteilung Chinas verhindern. Schon am 3. Juli 1900 hatte daher Außenminister Hay in einer zweiten Open-Door-Note klargestellt:
„Die Politik der Vereinigten Staaten besteht darin, eine Lösung zu suchen, die China dauernde Sicherheit und dauernden Frieden bringt, die territoriale und verwaltungsmäßige Einheit Chinas wahrt, alle den befreundeten Mächten vertraglich und völkerrechtlich garantierten Rechte schützt und der Welt grundsätzlich gleiche und keine Diskriminierung unterworfene Handelsmöglichkeiten mit allen Teilen des chinesischen Reiches sichert.“
Etwa ein Jahr später, am 7. September 1901, unterzeichneten China und elf ausländische Mächte das „Boxer-Protokoll“, ein Diktat der Großmächte, dem China angesichts der eigenen militärischen Ohnmacht hilflos ausgeliefert war. Demnach konnten die ausländischen Regierungen weiterhin Truppen in Nordchina stationieren (die USA in der Nähe von Tientsin); China musste 335 Millionen Golddollar als Entschädigung zahlen (nach heutigem Wert etwa sieben Milliarden US-Dollar).
Die USA begnügten sich mit 25 Millionen und zahlten später 14 Millionen in Form von Stipendien und als Gründungskapital für die Tsinghua-Universität in Peking zurück.
Russland hielt auch nach Beendigung des Boxeraufstandes die Mandschurei besetzt und erhob weiter Ansprüche auf Korea.
1904/5 wurde das Problem gelöst. Im Februar 1904 eröffnete das „kleine“ Japan ohne Kriegserklärung den ersten großen Krieg des 20. Jahrhunderts mit einem Angriff gegen die Großmacht Russland. Im Laufe des Jahres erlitt Russland an allen Fronten schwere Niederlagen. Japans Sieg in der Seeschlacht von Tsushima am 27./28. Mai 1905 beendete den Krieg.
Zwei Dinge überraschten in dem Zusammenhang: Japan war die neue Großmacht, und die USA versuchten sich erfolgreich als die neue Ordnungsmacht in Ostasien, wie die Initiative von US-Präsident Theodore Roosevelt aller Welt vor Augen führte. In zähen Verhandlungen erreichte er im Frieden von Portsmouth in New Hampshire im September 1905 eine für beide Seiten akzeptable Lösung: Russland musste keine Kriegsentschädigung zahlen, trat nur den Süden der Insel Sachalin ab und behielt den nördlichen Teil der mandschurischen Eisenbahn. Port Arthur mitsamt seinem eisfreien Hafen und der Südteil der Eisenbahnlinie von Port Arthur 250 Kilometer nordwärts fielen an Japan, genauso wie Korea.17
Aus amerikanischer Sicht war auch wichtig, dass beide Mächte ihre Truppen aus der Mandschurei abziehen sollten (was Japan dann allerdings nicht tat). Russland blieb als Machtfaktor bestehen, aber der neue Partner und potentielle Rivale der USA hieß von nun an Japan. 1908 wurden denn auch die „Spielregeln“ definiert: Japans Botschafter in Washington, Takahira Kogoro, und US-Außenminister Elihu Root tauschten am 30. November entsprechende Noten aus. In dem sogenannten Root-Takahira-Abkommen erkannten die USA Japans Herrschaft in Korea und in der südlichen Mandschurei an, Japan im Gegenzug Amerikas Interessen in den Philippinen. Gleichzeitig wurde mit Blick auf China vom Erhalt des Status quo gesprochen und noch einmal die alte Formel von der „Unabhängigkeit und Integrität Chinas“ und den gleichen Möglichkeiten für Handel und Industrie wiederholt.
Was sich im 19. Jahrhundert mit den „ungleichen Verträgen“ angedeutet und zu einem schleichenden Ansehensverlust der chinesischen Monarchie geführt hatte, wurde 1911 Realität: In China brach eine Revolution aus, die zum Zusammenbruch des Kaiserreichs führte. Ein Jahr später wurde die Republik China gegründet, angeführt von Sun Yat-sen und dessen Nationaler Volkspartei, der Kuomintang (KMT). Nach einigen Wochen wurde Sun Yatsen allerdings von Militärführer Yuan Shikai abgelöst.
II:
1917–1941.Vom Ersten Weltkrieg bis Pearl Harbor
1. Nationalist gegen Kommunist: Chiang Kai-shek gegen Mao Tse-tung
2. Japans Weg nach Pearl Harbor
1. Nationalist gegen Kommunist: Chiang Kai-shek gegen Mao Tse-tung
1916 starb Yuan Shikai. Die Militärführer (warlords) hatten bereits die Macht im Land übernommen und demonstrierten damit für alle sichtbar die Schwäche der Republik, die Japan für sich auszunutzen suchte. In den berüchtigten „21 Forderungen“ hatte es schon 1915 weitreichende Konzessionen und Privilegien gefordert, die China wohl zu einem Protektorat Japans gemacht hätten. Das geschah allerdings – noch – nicht, dank amerikanischer Vermittlung.
1917 kam es zu einem bemerkenswerten Abkommen zwischen den USA und Japan. Am 2. November 1917 unterzeichneten US-Außenminister Robert Lansing und der japanische Sonderbeauftragte Ishii Kikujiro in Washington ein Abkommen, in dem sich Japan noch einmal zur „Offenen-Tür-Politik“ bekannte. Die USA erkannten Japans Herrschaft in Korea und der südlichen Mandschurei und „Sonderinteressen“ in China an. Im Gegenzug sicherte Tokio zu, nicht gegen amerikanische Interessen auf den Philippinen zu agieren.
Im Gefolge der amerikanischen Kriegserklärung an Deutschland 19171 hatte auch China Deutschland den Krieg erklärt, sah sich aber von der Pariser Friedenskonferenz getäuscht, da ihre Forderung als Siegermacht das deutsche Kolonialgebiet Shandong, das Japan bereits nach Beginn des Krieges besetzt hatte, zurückzuerhalten, nicht erfüllt wurde. Das Gebiet blieb bei Japan. Daraufhin kam es am 4. Mai 1919 zu massiven Protesten von etwa 3.000 Studierenden in Peking, erst gegen Japan, dann gegen die eigene Regierung (die sog. „4. Mai-Bewegung“, an die im Sommer 1989 bei den Protesten auf dem Tian’anmen-Platz erinnert wurde).
China gehörte zu den Verlierern von Paris, Japan zu den Gewinnern. Von den schon während des Krieges getroffenen Geheimabsprachen mit Großbritannien, Frankreich, Russland und Italien hatte US-Präsident Wilson erst in Paris erfahren.2
1921/22 wurden die USA – außerhalb des Völkerbundes – außenpolitisch aktiv und organisierten in Washington eine internationale Konferenz – mit erstaunlichen Ergebnissen. Im sogenannten Flottenvertrag einigten sich die fünf führenden Mächte auf die Festlegung ihrer Flotten im Verhältnis USA und Großbritannien je fünf, Japan drei, Frankreich und Italien je 1,75 Einheiten. Es ging hier ansatzweise um die „Eindämmung“ Japans, das sich außerdem zur Rückgabe Shandongs an China bereit erklärte.3
Was danach von den USA außenpolitisch kam, fällt unter das Stichwort Isolationismus. Internationale Aktivität blieb auf die Finanzmärkte beschränkt. Während des Krieges war das Land zur größten Gläubigernation geworden, mit Frankreich und Großbritannien als die größten Schuldner. Mit amerikanischen Anleihen wurden jetzt auch deutsche Reparationen bezahlt. Hier ist der Dawes-Plan aus dem Jahr 1924 zu nennen (benannt nach dem US-Finanzexperten Charles G. Dawes). Es war der Versuch, aus einem politischen Problem ein wirtschaftliches zu machen; der Plan regelte die deutschen Reparationszahlungen und eröffnete dem amerikanischen Kapital gleichzeitig Möglichkeiten zur Einflussnahme in Deutschland, etwa durch Ankauf von Unternehmen (Opel). Gleichzeitig wurde der eigene Markt durch extrem hohe Zölle abgeschottet.
1928 wurden die USA noch einmal außenpolitisch aktiv. Am 17. August wurde in Paris der sogenannte Briand-Kellog-Vertrag unterschrieben (benannt nach US-Außenminister Frank B. Kellogg und dem französischen Außenminister Aristide Briand), in dem auf Krieg als Werkzeug der Politik verzichtet werden sollte. In den folgenden Jahren traten dem Vertrag zwar 63 Staaten bei, da aber keinerlei Sanktionen vorgesehen waren, blieb er realpolitisch völlig wertlos.4
In den 1920er-Jahren wurde Japans wachsender Einfluss in China in Washington mit zunehmendem Misstrauen beobachtet, ohne einzugreifen, während China selbst zu schwach war, sich der steigenden japanischen Penetration entgegenzustellen. Es gab zwar seit 1912 die Republik China, aber das Land war nach wie vor nicht geeint. Im Norden herrschten nach wie vor Militärführer (warlords), im Süden die Kuomintang unter Sun Yat-sen mit dem erklärten Ziel, das Land zu vereinen.
Ihm zur Seite stand Chiang Kai-shek, der die Geschichte Chinas für die nächsten 50 Jahre mitbestimmen sollte. Geboren 1878 bestärkte Chiang der militärische Erfolg Japans gegen Russland in der Überzeugung, die militärische Laufbahn einzuschlagen. Er studierte in Tokio an der japanischen Militärakademie, wurde Offizier und Militärberater Sun Yat-sens und beteiligte sich während der Yuan-Herrschaft an mehreren erfolglosen Umsturzversuchen der Kuomintang.5
1923 bot Moskau der Kuomintang finanzielle und militärische Hilfe und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Einheit Chinas an. Als Gegenleistung sollte sie eine Einheitsfront mit der 1921 gegründeten kommunistischen Partei Chinas (KPC) bilden, die damals gerade einmal 400 Mitglieder hatte. Sun Yat-sen nahm an und schickte Chiang als seinen Stellvertreter für drei Monate nach Moskau.
1924 entstand mit Hilfe der Sowjets in der Nähe von Kanton die Whampoa-Akademie, die zur bedeutendsten Ausbildungsstätte für revolutionäre Offiziere wurde. Sun übertrug Chiang die Leitung der Akademie. Dort wirkten Seite an Seite neben ihm Mao Tse-tung und Tschou En-lai (sowie Vietnams Kommunistenführer Ho Chi Minh).
1925 starb Sun Yat-sen. Im folgenden Jahr wurde Chiang zum Oberbefehlshaber der revolutionären Armee ernannt, nachdem er zuvor in einer Art Staatsstreich die Häuser der sowjetischen Militärberater umstellen und zahlreiche kommunistische Führer verhaften ließ. In sein Tagebuch notierte er: „Die revolutionäre Macht darf nicht in die Hände von Ausländern fallen. Selbst in der Zusammenarbeit mit der Dritten Internationale müssen Grenzen gezogen werden, wenn wir nicht unsere Unabhängigkeit verlieren wollen.“6
Josef Stalin blieb trotz allem bei der Unterstützung Chiangs und dessen Forderung zur Teilnahme der KPC am Nordfeldzug gegen einen warlord in Peking mit dem Ziel der Einigung Chinas, hatte er doch schon zu viel in die nationalrevolutionäre Bewegung in China investiert.
Der Feldzug mit einer 100.000 Mann starken Armee gegen einen der warlords im Norden war zwar erfolgreich, aber Chiangs Misstrauen gegenüber den Kommunisten in der „Einheitsfront“ wuchs dennoch. Und das zu Recht. Stalin hatte es so formuliert: „Wir werden Chiang wie eine Zitrone auspressen und dann wegwerfen.“7 Chiang kam ihnen zuvor und wandte sich in einer „Säuberungsaktion“ mit Tausenden Toten gegen sie. Tschou konnte nur mit Mühe entkommen; auf seine Ergreifung war eine unglaublich hohe Belohnung gesetzt: 80.000 US-Dollar. Mao zog sich mit seinen Anhängern in die südchinesische Provinz Kiangsi zurück und baute dort eine erste Räterepublik auf – und sollte wie Chiang die Geschichte Chinas für die nächsten 50 Jahre bestimmen.
Mao war sechs Jahre jünger als Chiang. Als Sohn eines reichen Bauern hatte er eine konfuzianische Schule besucht, 1914 bis 1918 Lehramt studiert und arbeitete 1918/19 als Hilfskraft in einer Bibliothek in Peking, wo er sich an marxistischen Diskussionskreisen beteiligte. Anschließend arbeitete er als Direktor einer Grundschule in seiner Heimatprovinz Hunan und nahm an den Vorbereitungen für die Gründung der kommunistischen Partei 1921 in Schanghai teil, wo er als Delegierter dabei war. Nach Gründung der Einheitspartei war er an der Whampoa-Akademie tätig, gemeinsam mit Tschou En-lai.8
Tschou stammte aus einer wohlhabenden Familie. Er studierte 1917–1919 in Japan, anschließend in Frankreich, England und Deutschland. In Paris gründete er 1921 eine europäische Zelle der KPC und machte nach seiner Rückkehr nach China 1924 schnell Karriere in der Partei. In der Akademie Whampoa leitete er die politische Abteilung. Er war bis zu seinem Tod im Jahr 1976 der treueste Weggefährte Mao Tse-tungs.9
Für Chiang war das Jahr 1927 ein wichtiger Einschnitt in seinem Leben: Er heiratete in die Soong-Familie ein, eine der reichsten christlichen Familien. Charley Soong kannte Amerika, war Methodist geworden und hatte als Banker und dem Drucken von Bibeln ein Vermögen in China gemacht. Chiang heiratete dessen Tochter Meiling, die zuerst das Wesleyan College in Macon, Georgia, und anschließend das berühmte Wellesley College in Massachusetts besuchte und perfekt Englisch sprach. Nicht genug damit: Soongs zweite Tochter Quinling heiratete Sun Yat-sen. Chiang war jetzt auch mit dem Gründungsvater der Republik verwandt, wurde dann auch noch Katholik.
Im Oktober 1928 wurde Chiang zum Vorsitzenden der neuen Nationalregierung in Nanking ernannt; er bestimmte anschließend die Stadt zur neuen Hauptstadt Chinas. Reiche Chinesen und ausländische Diplomaten hielten ihn von nun an für den besten Schutz gegen den Kommunismus in China. Chiangs oberstes Ziel war nach wie vor die Vernichtung Maos.
2. Japans Weg nach Pearl Harbor
Am 18. April 1931 kam es zum folgenschweren „mandschurischen Zwischenfall“ an der südmandschurischen Eisenbahn bei Mukden. Diese Bahn war seit 1906 von Port Arthur aus unter japanischer Aufsicht 1.100 Kilometer ins Innere der Mandschurei getrieben worden. Die beim Boxer-Aufstand von Japan entsandte Kwantung-Armee war seither nicht zurückgezogen worden und hatte im Gegenteil ihren Einfluss in der Mandschurei ständig erweitert, mit dem Ziel, die gesamte Mandschurei für Japan zu gewinnen. Die Armee fingierte den o. g. „Zwischenfall“, einen Sprengstoffanschlag auf die Eisenbahn, bei dem ein Japaner getötet wurde, und nahm das zum Vorwand, die gesamte Mandschurei zu erobern. Das war eine klare Verletzung der internationalen Abkommen, die Japan mit den Westmächten geschlossen hatte.
In dieser Situation reagierten die USA mit der sog. „Stimson-Doktrin“. US-Außenminister Henry Stimson erklärte am 7. Januar 1932, dass die USA keine gewaltsame und vertragswidrige Veränderung des Status quo anerkennen würden.10 Nur drei Wochen später, am 28. Januar 1932, bombardierten japanische Flugzeuge Schanghai und töteten mehrere Hundert Zivilisten. Und am 18. Februar 1932 demonstrierte Japan öffentlich seine Herrschaft in der Mandschurei durch die Schaffung des Vasallenstaates Mandschukuo. Als Japans Aggression Thema im Völkerbund wurde, trat Japan am 27. März 1933 aus dem Völkerbund aus. Im State Department wurde dem neuen Außenminister Cordell Hull empfohlen, für die USA wäre es das Beste, Tokio nicht zu provozieren.
Das war und blieb die Position Washingtons. Sie beschränkte sich auf diplomatische Noten. Die japanische Hegemonie im Fernen Osten schien unbestritten. Samuel Eliot Morison und Henry Steele Commager nennen denn auch in ihrem 1942 erschienenen Standardwerk zur amerikanischen Geschichte das entsprechende Kapitel treffend „Rückzug aus dem Fernen Osten“, der noch, so die Autoren, „einen dramatischeren Ausdruck durch die freiwillige Aufgabe der Philippinen im Jahr 1934 fand. [Rückgabe nach zehn Jahren] Die Vereinigten Staaten waren nicht mehr bereit, ihrer Fernostpolitik Geltung zu verschaffen, und gaben sie in der Praxis auf.“11
Wobei die Autoren im selben Atemzug betonen, dass die amerikanischen Interessen im Fernen Osten ein aggressiveres Vorgehen nicht gerechtfertigt und die amerikanische öffentliche Meinung es nicht geduldet hätte.
Aber auch für Chiang war Japan nicht der Gegner Nummer 1, sondern nach wie vor Mao und dessen Kommunisten, die er weiter gnadenlos bekämpfte. Ihr Ende betrachtete er als Voraussetzung für die innere Einigung und auswärtige Widerstandsfähigkeit Chinas. Er vertrieb Mao aus der Provinz Kiangsi. Um der Umzingelung durch Chiangs Armee zu entgehen, entschloss sich Mao zum Rückzug mit seinen 100.000 Mann starken Streitkräften nach Yenan im Nordwesten Chinas, wo sie dann in den berühmten Höhlen lebten. Diesen legendären „Langen Marsch“ von Oktober 1934 bis Oktober 1935 überlebten 30.000 Mann; er wurde zu einer Gründungslegende der Volksrepublik China und begründete den Mao-Kult. (Dazu hatte nicht zuletzt der Journalist Edgar Snow mit seinem Buch Red Star over China beigetragen, in dem Snow ein ausgesprochen positives Bild der chinesischen Kommunisten und vor allem Maos zeichnete; auf Einladung Maos hatte Snow im Sommer 1936 drei Monate in Yenan gelebt; Mao hatte gut vorbereitete Interviews gegeben.)12
Der Kampf gegen die Kommunisten hatte nicht bei allen chinesischen Nationalisten Priorität, zum Beispiel nicht bei den von Japan bei der Eroberung der Mandschurei vertriebenen militärischen Verbänden der Generäle Chang Hsueh-liang und Yang Hu-cheng. Die hatten sich auf chinesisches Gebiet zurückgezogen und von Chiang den Befehl erhalten, gegen die Kommunisten zu kämpfen. Sie weigerten sich und forderten ein Bündnis mit den Kommunisten im Kampf gegen Japan. Als Chiang daraufhin in deren Hauptquartier nach Sian flog, um das Kommando persönlich zu übernehmen, wurde er in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1936 auf Befehl Changs verhaftet. Einige der Chang-Anhänger hätten ihn am liebsten getötet, aber Chiang hatte Glück. Sowohl Stalin wie auch der neue US-Präsident Roosevelt setzten sich für ihn ein und retteten ihm so das Leben. Beide waren davon überzeugt, dass China ohne ihn wieder auseinanderbrechen und Japan den Weg zur weiteren Expansion ebnen würde. Roosevelt ließ Botschafter Nelson Johnson wissen, Chiangs Überleben sei „für die ganze Welt wichtig“; Stalin ließ Mao wissen, dass nur Chiang der Mann für eine Einheitsfront von KPC und KMT im Kampf gegen die Japaner sei. Am 26. Dezember 1936 wurde Chiang wieder freigelassen, nachdem er eine Vereinbarung zur Neuauflage einer Einheitsfront der beiden Parteien unterschrieben hatte.
Tokio sah in der neugebildeten Einheitsfront eine Gefahr für seine weiteren Expansionspläne und handelte. Am 7. Juli 1937 provozierten die Japaner einen Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke über den Yungting südlich von Peking. Es kam zu Schießereien, die sich im Laufe des Monats zu einem militärischen Konflikt ausweiteten. Am 30. Juli eroberten die Japaner die für Nordchina wichtige Hafenstadt Tientsin und besetzten das Gebiet östlich von Peking bis zur Küste. Von dort stießen sie entlang der Küste nach Süden vor; am 10. November fiel Schanghai, damals die fünftgrößte Hafenstadt der Welt und Umschlagplatz für 67 Prozent der chinesischen Einfuhr. Damit kontrollierten die Japaner weite Teile Chinas. Am 13. Dezember wurde die Hauptstadt Nanking eingenommen; dabei kam es zu furchtbaren Exzessen der japanischen Truppen mit mehr als 200.000 Toten; dies ist als „Nanking-Massaker“ in die Geschichte eingegangen. Die chinesische Regierung hatte zuvor die Stadt verlassen und die Hauptstadt nach Chungking verlegt.
Die USA protestierten. Am 5. Oktober 1937 hielt Roosevelt die sogenannte „Quarantäne-Rede“, in der er forderte, die Staaten Deutschland, Italien und Japan, ohne sie explizit zu nennen, unter politische „Quarantäne“ zu stellen. Wenn Gesetzlosigkeit und Gewalt uneingeschränkt tobten, so warnte er, „dann soll sich niemand einbilden, dass Amerika all dem entgehen wird, dass Amerika erwarten kann, diese westliche Hemisphäre werde nicht angegriffen.“ Die Reaktion war typisch für die Stimmung in Amerika in jenen Jahren; Roosevelts Rede wurde als Kriegstreiberei kritisiert, um China war es sehr schade, aber da ließ sich eben nichts machen, und schließlich war China groß genug, für sich selbst zu sorgen.13
Außenpolitisch waren dem Internationalisten Roosevelt die Hände gebunden. Der Kongress hatte seine Handlungsfreiheit extrem eingeschränkt. Isolationismus hieß das Stichwort. Von 1935 bis 1939 gab es vier Neutralitätsgesetze. Sie waren dazu bestimmt, die USA aus jedem Krieg herauszuhalten, und zwar fast um jeden Preis. Die Gesetze verboten Anleihen, Kredite und Waffenverkäufe an Kriegführende, Bürgern das Reisen auf Schiffen der Kriegführenden, die Bewaffnung von Handelsschiffen. Dabei machten die Gesetze keinen Unterschied zwischen Angreifern und ihren Opfern.
Japans expansive Politik bedrohte zwei fundamentale Interessen der amerikanischen Fernostpolitik, nämlich 1. das Prinzip der offenen Tür, d. h. freier Handel für alle, und 2. die Erhaltung eines Gleichgewichts der Kräfte im Fernen Osten. Mit anderen Worten: Es durfte keine Hegemonie einer Großmacht geben. Aber das war genau das Ziel Japans, das wenig später die Schaffung einer großasiatischen Wohlstandssphäre unter seiner Führung und unter Ausschluss westlicher Mächte verkündete. Dabei war von Anfang an klar: Die Abhängigkeit Japans von Rohstoffen, insbesondere von Öl, war die Achillesferse Japans.
Bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 in Europa wurde die vorherrschende politische Stimmung in den USA mehr denn je von Isolationismus bestimmt. Der Kongress wollte unter allen Umständen eine Beteiligung der USA am Krieg der Europäer vermeiden. Vielleicht lag es auch daran, dass die eigene Armee damals völlig unzureichend bewaffnet war. Der bekannte US-Historiker Stephen E. Ambrose hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die USA noch im Juni 1939 gerade einmal eine Armee von 187.000 Mann hatten. In der Welt lag man da an 19. Stelle, hinter Belgien – und hatte nicht einmal für jeden Soldaten ein Gewehr. Damit war man keine Weltmacht, trotz enormen wirtschaftlichen Potentials.
Inzwischen stieß die Politik des Kongresses allerdings nicht mehr nur auf Zustimmung. Im Januar 1940 kündigte Washington als Zeichen des Protests den Handelsvertrag mit Japan aus dem Jahr 1911. Damit gab es ein Embargo für Flugbenzin und Stahl.
Am 20. Mai 1940 wurde das Committee to Defend America by Aiding the Allies (CDAAA) gegründet. Als die USA am 3. September 1940 Großbritannien 50 Zerstörer aus dem Ersten Weltkrieg überließen und dafür Stützpunkte in Neufundland, den Bahamas und in der Karibik zur Pacht erhielten, gründete sich am nächsten Tag allerdings das America First Committee (AFC) mit dem Ziel, die USA aus dem Krieg herauszuhalten. Das AFC hatte schon bald 800.000, z. T. sehr prominente Mitglieder (etwa Charles Lindbergh).
Entscheidend für die weitere Entwicklung wurde die Präsidentenwahl in den USA am 5. November 1940. Es standen sich die sogenannten Internationalisten und die Isolationisten gegenüber. Die einen unter Führung von Roosevelt wollten in den Krieg eingreifen, die anderen sich raushalten. Die Wahl fiel äußerst knapp aus: 27 Millionen Stimmen gegen 22 Millionen. Roosevelt wurde wiedergewählt, allerdings mit der geringsten prozentualen Mehrheit seit 1916 – Ausdruck der Anti-Kriegsstimmung in den USA.
Mit Roosevelts Wiederwahl begann ein neuer Abschnitt in den amerikanischen Kriegsvorbereitungen.
Am 6. Januar 1941 verkündete Roosevelt einer kriegsunwilligen Nation in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress die vielzitierten vier Freiheiten: Redefreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Mangel und Freiheit von Furcht – quasi als Ziel der amerikanischen Politik.14 Am 18. Februar 1941 verabschiedete der US-Kongress mit Unterstützung des CDAAA das Leih- und Pachtgesetz (Lend-Lease) zur Versorgung der Alliierten mit Kriegsmaterial, gegen das das AFC „mit allen verfügbaren Mitteln“ opponierte. Ohne Bezahlung wurde Großbritannien beliefert (später auch die Sowjetunion).
Dazu gab es seit November 1940 geheime Überlegungen für Luftangriffe gegen Japans Städte vom chinesischen Festland aus, durchgeführt von amerikanischen Piloten im Dienste einer chinesischen Firma. Die Idee stammte von dem ehemaligen Piloten Claire L. Chennault, der inzwischen als Chiangs Militärberater tätig war. Die Rede war von 500 Bombern, die allerdings nach Auffassung von Henry Stimson, inzwischen Kriegsminister, und dem Stabschef der Armee, George Marshall, in dieser Größenordnung nicht zur Verfügung standen. Roosevelt schlug als Kompromiss den Einsatz von 100 Jagdflugzeugen gegen die Japaner in China vor (allerdings nicht gegen die japanischen Inseln). Eine Executive Order würde amerikanischen Piloten den Austritt aus der Armee und den Eintritt in die Chinese Central Aircraft Manufacturing Corporation ermöglichen. Die Piloten würden als amerikanische Freiwillige agieren.15
Am 5. Mai 1941 wurde China in das Lend-Lease-Programm aufgenommen. Diese Situation führte am 2. Juli 1941 zur ersten sogenannten kaiserlichen Konferenz in Tokio – im Beisein von Kaiser Hirohito –, auf der beschlossen wurde, einen Angriff auf die Sowjetunion zu verschieben – seit zehn Tagen lief dort die Operation „Barbarossa“, der Überfall der Deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion – und zur Sicherung von Rohstoffen zunächst weiter nach Südostasien vorzustoßen. Und dies auch auf die Gefahr hin eines Krieges mit den USA und Großbritannien.
Nach der Besetzung des südlichen Indochina durch Japan sperrte Washington am 26. Juli 1941 sämtliche japanischen Vermögenswerte in den USA. Für den amerikanischen Botschafter in Tokio, Joseph Grew, stand damit fest: „Dies bringt Japan an den Rand des wirtschaftlichen Bankrotts.“ (Am 26. Juli genehmigte Roosevelt auch die Bildung der Fliegertruppe, die als Flying Tigers bekannt wurde und die u. a. Chinas Hauptstadt gegen japanische Angriffe verteidigte.)
In der zweiten Augustwoche trafen Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill vor Neufundland zusammen. Roosevelt war mit dem US-Kreuzer Augusta gekommen, Churchill mit dem berühmten Schlachtschiff Prinz of Wales, dem Stolz der britischen Marine (das drei Monate später von Japanern versenkt wurde). An Bord der Augusta einigten sie sich am 12. August auf eine gemeinsame Prinzipienerklärung für die Nachkriegspolitik ihrer Länder, die am 14. August als Atlantikcharta veröffentlicht wurde. Es ging um gewisse allgemeine Grundsätze der nationalen Politik der beiden Länder, und zwar:
• Beide Länder strebten nach keiner Vergrößerung, weder auf territorialem Gebiet noch anderswo;
• sie wünschten keine territorialen Änderungen, die nicht mit dem frei zum Ausdruck gebrachten Wunsch der betreffenden Völker übereinstimmten;
• sie wünschten, die obersten Rechte und die Selbstregierung der Völker wiederhergestellt zu sehen, denen sie mit Gewalt genommen wurden;
• alle Staaten sollten gleichermaßen Zugang zum Handel und den Rohstoffen der Welt haben, die sie für das Gedeihen ihrer Wirtschaft benötigten;
• sie wünschten die engste Zusammenarbeit mit allen Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet nach Vernichtung der Nazityrannei;
• sie hofften auf einen Frieden, der allen Nationen die Möglichkeit biete, innerhalb der eigenen Grenzen zusammenzuleben; ein solcher Frieden würde allen Menschen gestatten, ungehindert die Meere und Ozeane zu überqueren;
• alle Nationen der Welt sollten auf Gewaltanwendung verzichten;
• Nationen, die ihre Waffen zum Angriff außerhalb der Grenzen einsetzen, müssten entwaffnet werden.16
Auch wenn Japan nicht direkt erwähnt wurde, jeder wusste, dass nicht nur die Nazityrannei, sondern auch die Tyrannei Japans in China gemeint war. Und Japan reagierte.