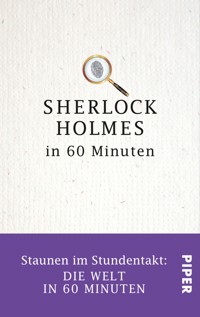2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Saga der Germanen
- Sprache: Deutsch
Der Kampf der Germanen geht in eine neue Runde. In Ravenna gelangt Thorag endlich in die Nähe der beiden entführten Frauen Auja und Thusnelda. Aber ehe er die beiden befreien kann, wird er in ein finsteres Komplott verstrickt und muss durch die Sümpfe fliehen. In der Wasserburg, dem Stützpunkt der berüchtigten Sumpfschlangen, findet er zwar Aufnahme, aber keine Ruhe. Denn eine römische Flotte, angeführt von Flavus dem Einäugigen, greift die Wasserburg an. Thorag kämpft um sein Leben und um das seiner geliebten Auja ... Der zehnte Band der zwölfteiligen Romanserie »Die Saga der Germanen« von Jörg Kastner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jörg Kastner
Die Verschwörer von Ravenna
Folge 10 der 12-teiligen Romanserie Die Saga der Germanen
Historischer Roman
Kapitel 1 – Alte Feinde
Im Hafen von Ravenna lagen zwei Männer, der Cherusker Thorag und der junge Vogelhändler Titus, auf einem Holzstapel und beobachteten von ihrem Versteck aus die feierliche Ankunft des Prätorianerpräfekten Lucius Aelius Sejanus und des gestürzten Markomannenkönigs Marbod. Aber noch jemand, der Thorags Aufmerksamkeit auf sich zog, ging nach den beiden an Land, ein blonder Offizier mit vernarbtem Gesicht und nur einem Auge.
„Was hast du?“ Titus starrte den erregten Thorag entgeistert an. „Was für einen Namen rufst du da ständig aus?“
„Flavus!“
„Der Blonde?“
Thorag nickte, während sein Blick an Armins Bruder klebte. Dessen Züge schienen seit ihrem letzten Zusammentreffen noch härter geworden zu sein. War es mit solchen Mühen verbunden, seine Herkunft zu vergessen und ein Römer zu werden?
„Wen meinst du?“, riss Titus ihn aus seinen Gedanken.
„Den Einäugigen. Ich glaubte, ihn von früher zu kennen.“
„Ach so.“
Titus bedachte Thorag mit einem milden Lächeln. Vermutlich hielt er den Cherusker für einen Aufschneider, weil er sich zuvor schon gerühmt hatte, den Flottenpräfekt Foedus zu kennen. Thorag war es nur recht so, ersparte ihm das doch unangenehme Fragen des Vogelhändlers.
Endlich verstummten die Bläser des Musikzugs und setzten ihre Instrumente ab. Einige wischten verstohlen den Schweiß aus ihren Gesichtern. Gnaeus Equus Foedus betrat mit seinen beiden hohen Gästen ein aus Holz erbautes und mit teuren Teppichen ausgelegtes Podium, das von einem kleinen Sonnensegel geschützt wurde. Sie genossen den Schatten, während die Soldaten weiterhin in der heißen Sonne standen und unter ihren Helmen und Panzern schwitzten. Der Präfekt der Reichsflotte hielt eine Ansprache, um Sejanus und Marbod in Ravenna willkommen zu heißen.
Foedus erwähnte die Herkunft des Prätorianers aus einer in Volsinii ansässigen und höchst angesehenen Ritterfamilie, die mit vielen bedeutenden Patrizierfamilien Roms verwandt sei und schon mehrere Konsuln hervorgebracht habe. Er sprach über Sejanus’ ehrwürdigen Vater Lucius Sejus Strabo, der zusammen mit seinem Sohn die Prätorianergarde befehligt hatte, bis die ehrenvolle Aufgabe dem Sohn allein zufiel. Foedus nannte Sejanus einen engen Freund und Vertrauten des Kaisers, schilderte, wie der Prätorianerpräfekt dem Kaisersohn Drusus im Illyricum zur Seite gestanden und wie er geholfen hatte, im Markomannenreich für Ordnung zu sorgen.
Den letzten Teil der Rede nahm Marbod mit versteinertem Gesicht auf. Seine Züge wirkten noch verkniffener als sonst, seine dunklen Augen, zumeist ruhelos wie eine zwischen der dies- und der jenseitigen Welt verirrte Seele, waren starr auf den Sprecher gerichtet. Es schien, als hätte Marbod den Römer am liebsten erwürgt, hielte sich aber mit eisernem Willen zurück, um sich nicht Roms Wohlwollen zu verscherzen.
Sein Gesicht hellte sich auch nicht auf, als Foedus ihn als Gast in Ravenna begrüßte und ihm versicherte, sein Ruhm eile ihm stets voraus. Marbod war nicht dumm und verstand sehr wohl die Anspielung, dass ihm nichts geblieben sei außer dem Ruhm vergangener Tage. Er bedankte sich mit knappen, kalten Worten bei Foedus, bei Sejanus sowie bei Tiberius und seinem Sohn Drusus für die erwiesene Freundschaft, ihm das Gastrecht zu gewähren.
Marbods gutes Latein verriet seine römische Erziehung. Vor vielen Wintern war er, wie so viele junge germanische Edelinge, am Hof des Augustus unterrichtet worden. Jung und leicht beeinflussbar, ließen sie sich leicht von römischer Lebensart und von römischem Denken beeindrucken. Auf diese Art innerlich zu Römern geworden und nur noch der Abstammung nach Germanen, waren sie die geeignetsten Vertreter römischer Interessen in ihren Heimatländern. Von den Ihrigen als Fürsten und Könige aus eigenem Blut begrüßt, regierten sie in Wahrheit von Roms Gnaden und nach römischen Anweisungen.
Doch Marbod hatte den Plan des Augustus durchkreuzt. Von römischem Prunk und römischer Macht zwar geblendet, aber doch vom festen Willen zur selbstbestimmten Herrschaft beseelt, hatte er das erworbene Wissen genutzt, um ein riesiges Reich aufzubauen, das mehr dem römischen Vorbild folgte als germanischen Traditionen und sich doch von Rom nichts vorschreiben ließ. Er hatte sich als dem römischen Kaiser gleichgestellt empfunden und hatte sich mit seinem starken Heer unangreifbar gefühlt. Letztlich hatte er das Spiel um die Macht verloren, hatte sich das wahre Rom dem nachgeahmten als überlegen gezeigt. Wie viel Bitterkeit mochte der gestürzte König empfinden?
Ein anderer Gedanke schoss durch Thorags Kopf: War Armin ebenfalls der Untergang bestimmt? Auch der Cheruskerherzog hatte sein in Rom erworbenes Wissen, besonders auf dem Gebiet der Kriegsführung, benutzt, um sein Volk vom römischen Joch zu befreien. Hätte Marbod nach dem Sieg über Varus nicht Armins Bündnisangebot ausgeschlagen, hätten die beiden einflussreichen germanischen Führer eine Bedrohung für Rom bilden können, die Augustus und seine Nachfolger für alle Zeiten von einem Angriff auf Germanien abgeschreckt hätte. Marbods hochmütige Einstellung, er könne allein gegen Rom bestehen, hatte ihn um den Thron gebracht. Wie lange würde Armin, der immer wieder von Neidingen aus dem eigenen Stamm angefeindet wurde, seine Herzogswürde und die Freiheit der Seinen verteidigen können?
Wären im Krieg gegen Marbod nicht so viele tapfere Donarsöhne gefallen, darunter Thorags treuer Kriegerführer Argast, hätte der Cherusker vielleicht Mitleid mit dem Markomannenkönig empfunden. Seine große Gestalt wirkte nicht mehr so beeindruckend wie früher; die Schultern waren, wie unter schwerer Last, nach vorn gekrümmt. Erst hatte er sein Reich verloren, und jetzt musste er sich von den Einwohnern Ravennas bestaunen lassen wie ein gefangenes Fabeltier. Marbod blickte starr zu Boden und tat es auch noch, als Sejanus auf dem Podium zwei Schritte vortrat und zu seiner Dankesrede ansetzte. Er sprach in den üblichen Lobpreisungen über Tiberius und Drusus, die Ravenna bald durch ihren Besuch ehren würden, und über Marbods Ruhmestaten.
Doch einmal blickte der Markomanne auf, nur ganz kurz. Gleichwohl glaubte Thorag zu bemerken, dass die Blicke von Marbod und Sejanus sich in einem seltsamen Einverständnis trafen, wie zu einer stummen Verabredung. Er hatte den Eindruck, zwei Schauspielern zuzuschauen, die sich auf offener Bühne durch geheime Gesten über den nächsten Auftritt verständigten.
Ein beunruhigender Gedanke durchfuhr Thorag: „Ist das Ganze in Wahrheit nur ein Schauspiel?“
„Ich verstehe nicht, was du meinst.“
Erst Titus’ Worte machten Thorag bewusst, dass er den plötzlichen, ungeheuerlichen Verdacht laut ausgesprochen hatte.
„Ich finde es merkwürdig, dass Sejanus mit Maroboduus eine Woche vor Tiberius und Drusus in Ravenna erscheinen“, beschrieb Thorag seinen Verdacht; Titus war ein einfacher Geist, aber vielleicht gerade deshalb geeignet, komplizierte Fragen auf den Punkt zu bringen. „Wäre es nicht ausreichend gewesen, zusammen mit dem Princeps hier anzukommen?“
Titus machte eine Gebärde der Ratlosigkeit. „Was weiß ich? Vielleicht waren die Schiffe des Kaisers nicht so schnell bereit wie die des Prätorianerpräfekten.“
„Mag sein“, sagte Thorag ohne innere Überzeugung, während er dem Gedanken weiter nachhing.
Bedurfte es eines so hochgestellten Mannes wie Sejanus, um den Markomannenkönig in seinem Exil abzuliefern? Doch nur dann, wenn Marbod ein Gast gewesen wäre, dem man aus politischen Gründen hätte schmeicheln müssen. Aber der Markomanne befand sich in den Händen der Römer, war ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und durfte sich über nichts beschweren, ohne Gefahr zu laufen, die Gunst des Tiberius zu verlieren. Also musste es einen anderen Grund für die frühe Ankunft des Sejanus geben. Einen, der mit Marbod in Zusammenhang stand, wie die heimlich gewechselten Blicke zu verraten schienen.
Sejanus war ein geübter Redner, der gewiss bei einem guten und teuren Lehrer aus einer griechischen Rhetorenschule studiert hatte. Er schmeichelte in süßen Worten den Bürgern der ‚reichen und berühmten Stadt Ravenna‘, die seit Kurzem in Gnaeus Equus Foedus einen Präfekten hätten, wie sie ihn sich besser nicht wünschen könnten.
„Nur ein Schatten verdunkelt den weithin strahlenden Glanz Ravennas“, fuhr Sejanus fort und fügte nach einer bedeutungsvollen Pause hinzu: „Die Sumpfschlangen! Das elende Banditengezücht, das Recht und Ordnung genauso wenig achtet wie Leib und Leben, wie Freiheit und Eigentum der gesetzestreuen Bürger. Die Rechtlosen haben sich zu einer Plage entwickelt, teilte mir mein Freund Foedus mit, zu einer regelrechten Gefahr für Ravenna. Des Nachts, wenn die Straßen im Dunkel und ehrbare Bürger in ihren Betten liegen, verlassen sie sogar ihre schmutzigen Sümpfe und sickern in die Stadt ein, um zu stehlen, zu rauben und zu morden.“
Nach einer Pause, die den Zuhörern Zeit ließ, sich ihre allnächtliche Angst zu vergegenwärtigen, verkündete er mit erhobenen Armen und geballten Fäusten: „Um all dem ein Ende zu bereiten, habe ich einen Mann nach Ravenna gebracht, der schon überall im Römischen Reich seinen Mut und seine Härte unter Beweis gestellt hat. Der Flottenpräfekt Foedus wird ihn mit besonderen Vollmachten zur Jagd auf die Sumpfschlangen ausstatten und ihn zum Praefectus Arcendibus Latronibus ernennen.“
Auf ein Zeichen des Sejanus erstieg der neue ‚Präfekt zur Abwehr von Banditen‘ das Podium und gesellte sich zu dem Prätorianer. Schon als Sejanus begonnen hatte, von den Sumpfschlangen zu sprechen, hatte Thorag ihm mit erhöhter Aufmerksamkeit zugehört. Seit er nach Ravenna gekommen war, ging es immer wieder um diese Sumpfbanditen; das konnte kaum ein Zufall sein. Und er war seltsamerweise auch nicht überrascht, als der Banditenpräfekt kein anderer war als Flavus. Die Fäden verknoteten sich, die Schemen nahmen Gestalt an, das Gestern und das Morgen trafen sich im Heute.
„Dies ist Gaius Julius Flavus“, rief Sejanus aus. „Er stammt aus dem fernen Germanien und ist ein Bruder des Fürsten Arminius.“
Schon das genügte, um unter den Zuhörern für erstaunte Ausrufe zu sorgen. Marbod warf Flavus einen finsteren Blick zu. Armin hatte den Markomannen bezwungen, und ein Bruder des Cheruskerherzogs, mochte er auch auf römischer Seite stehen, war für Marbod eine unliebsame Erinnerung an seine Niederlage, ein glühender Dorn in seinem Fleisch.
„Im Gegensatz zu seinem aufrührerischen Bruder steht Flavus treu zu Rom“, fuhr Sejanus fort und begann, die Feldzüge aufzuzählen, an denen der Cherusker teilgenommen hatte.
Thorag hörte nur mit einem Ohr zu. Ein bestimmter Gedanke beschäftigte ihn: Hatte Sejanus den Einäugigen wirklich nach Ravenna gebracht, um dem Treiben der Sumpfschlangen ein Ende zu bereiten?
Erst Foedus und jetzt Flavus, das hielt Thorag für mehr als ein zufälliges Zusammentreffen. Zwei alte Bekannte des Donarsohnes. Zwei Feinde Thorags, der eine aus verblendetem Hass, der andere aus Überzeugung. Sie würden Thorag erkennen, sollte er ihnen bei dem Versuch auffallen, Auja, Thusnelda und Thumelikar zu befreien. Sejanus kannte Thorags Absicht, nach Ravenna zu kommen. Der Skorpion öffnete seine Fangscheren und wartete auf die Beute.
Erst nach einer Weile bemerkte Thorag, dass Titus aufgeregt am Ärmel seiner Tunika zupfte und sagte: „Er heißt wirklich Flavus! Du kennst ihn ja doch. Der Kerl sieht ziemlich gefährlich aus. Wo hast du ihn getroffen?“
„Ich sah ihn einmal in der Provinz Germanien.“
„Du bist einer Menge berühmter Männer begegnet, scheint mir.“
Täuschte sich Thorag, oder schwang in Titus’ Worten ein unterschwelliges Misstrauen mit? War der Vogelhändler doch nicht so einfachen Geistes, wie der Cherusker angenommen hatte?
„Reisen bildet, und ich bin viel herumgekommen“, sagte der Cherusker, um ihn zu beruhigen. „Und auch du kannst in einer Woche behaupten, nicht nur den gefürchteten Maroboduus und den berühmten Präfekten Aelius Sejanus mit eigenen Augen gesehen zu haben, sondern selbst den Princeps und seinen Sohn.“
„Das ist wahr.“ Titus nickte mit glänzenden Augen, als gehe allein durch den Anblick der hochgestellten Persönlichkeiten ein Teil ihres Ruhms auf ihn über.
Sejanus hatte seine Ansprache beendet. Prätorianerabteilungen marschierten unter Hörnerklang von den Schiffen und nahmen am Kai Aufstellung. Die Prätorianer und die Kohorte des Foedus schienen sich zum Abmarsch vorzubereiten.
„Wohin werden sie gehen?“, überlegte Thorag.
„Vermutlich nach Germania minor, falls sie Maroboduus zu seinem neuen Heim begleiten.“
„Germania minor?“, wiederholte Thorag verständnislos. „Klein-Germanien?“
Titus ließ ein kurzes Lachen hören. „Das ist keine offizielle Bezeichnung. Die Einwohner von Ravenna nennen so die Insel, auf der Tiberius seine germanischen Gäste, wie er es bezeichnet, ansiedelt. Andere sprechen von der Germaneninsel.“
Thorag verbarg seine starke Erregung und fragte wie beiläufig: „Was für eine Insel ist das?“
„Ein kleines Stück Land zwischen Ravenna und dem Hafen, das durch teils versumpfte Gewässer vom Rest der Stadt abgetrennt ist. Man braucht nur die beiden einzigen Brücken mit Soldaten zu besetzen, und schon werden aus Gästen gut bewachte Gefangene.“
„Sehr schlau“, sagte Thorag. „Auf dieser Insel könnte man Sejanus und Maroboduus bestimmt ganz aus der Nähe betrachten, wenn man vor ihnen dort wäre, nicht wahr?“
Er spielte den Neugierigen, den Schaulustigen, um vor Titus sein wahres Interesse an der Insel zu verbergen. Wenn die Germanen von Ravenna auf ihr lebten, musste er dort auch Thusnelda mit ihrem Sohn finden. Und Auja!
„Das könnte man“, bestätigte Titus. „Aber die Wachen würden uns nicht über die Brücken lassen.“
Thorag sah Titus fest in die Augen. „Ein findiger Bursche wie du kennt doch bestimmt einen anderen Weg.“
„Vielleicht, aber es ist gefährlich. Wenn wir erwischt werden...“ Titus griff an seine Kehle und tat, als würde er sie zusammendrücken. „Equus Foedus ist dafür bekannt, dass er keinen Spaß versteht.“
„Ich habe nicht vor, mich erwischen zu lassen. Ich möchte nur ein kleines Abenteuer erleben, um damit ein wenig anzugeben. Schließlich komme ich aus Germanien. Wenn ich daheim erzählen könnte, ich hätte ganz aus der Nähe die berühmten Germanen von Ravenna gesehen! Heißt es nicht, selbst die Gemahlin des berühmten Arminius lebe hier?“
„Ja, sie und ihr kleiner Sohn. Und auch ihr Vater Segestes mit seiner Sippe. Bald gibt es hier mehr Germanen als in Germanien.“
„Fürwahr ein hübsches Abenteuer“, sagte Thorag und drückte Titus drei Denare in die Hand. „Beflügelt das deinen Unternehmungsgeist?“
Titus steckte lächelnd die Münzen ein und kletterte flink den Holzstapel hinab. „Komm schon, Germane, auf nach Germania minor!“
Kapitel 2 – Die Germaneninsel
„Donars Blitze mögen alles verbrennen, was Flügel hat!“, fluchte Thorag, als er einen stechenden Schmerz am Hals verspürte. Seine Rechte klatschte gegen die betreffende Stelle, und ein zermanschtes Insekt klebte blutverschmiert an seinen Fingern. Er wischte die Hand an der Tunika ab und wünschte sich, eine germanische Hose zu tragen, statt nach Römerart mit nackten Beinen durch den Sumpf zu gehen. Fast gleichzeitig bohrten sich winzige Stachel in den linken Unterschenkel und in den rechten Fuß. Thorag trug nur offene Sandalen, weil er es bei seinem eiligen Aufbruch im Haus des Apicius versäumt hatte, sie gegen festes Schuhwerk einzutauschen.
Der vorausgehende Titus, der über das unschätzbare Glück fester, bis zu den Waden reichender Lederschuhe verfügte, blickte ihn über die Schulter an. „Was sagst du?“
Thorag hatte den Fluch in seiner Muttersprache ausgestoßen und übersetzte ihn ins Lateinische.
Titus blieb stehen und runzelte die Stirn, was seinem jugendlichen Antlitz einen ungewöhnlichen Faltenreichtum bescherte. „Nimm den Fluch zurück, Germane!“
„Weshalb?“
„Wenn alles stirbt, was Flügel hat, wovon soll ich dann leben?“
Eine Stechmücke in der Luft abfangend und in der zusammengepressten Faust erdrückend, erwiderte Thorag mit einem gequälten Lächeln: „Also gut, ich bitte Donar, die Vögel zu verschonen.“
„Und hört er auf dich, dein Donar?“
„Manchmal wünschte ich es mir.“
„Ist er wenigstens mächtig?“
„Nicht weniger als dein Mars.“
„Dann ist er sehr mächtig“, befand Titus und folgte weiter dem unsichtbaren Weg durch das öde Sumpfland.
Weit verästelte und oft nur mit wenig Blattwerk geschmückte Bäume standen auf winzigen Inseln, verlorene Vorposten festen Landes im mal grünlich, mal bräunlich schimmerndem Morast. Die Bäume wirkten auf Thorag wie sterbende Krieger, die ihre Arme zu den Walküren emporreckten und hofften, von Wodans Jungfrauen erhört zu werden, bevor die gierige Hel sie in ihr freudloses Reich zog.
Wenn er sich umsah, gewann Thorag den Eindruck, dem Land der Hel hier um einiges näher zu sein als dem der Walküren. Obwohl reichlich Sonnenlicht durch das spärliche Blattwerk fiel, was die beiden Männer ins Schwitzen brachte, machte die Landschaft einen vom Leben verlassenen, düsteren Eindruck.
Einst war hier ein Nebenarm des Padus oder ein anderer Fluss entlanggeflossen, um sich ins nahe Meer zu ergießen. Mit jedem Winter und jedem Sommer trug der Fluss mehr Erdreich und Gestein aus dem Landesinnern herbei. Es türmte sich auf und bildete neues Land, wo einst Wasser gewesen war. Jetzt war das Wasser größtenteils verdunstet oder im Erdreich versickert, der einstige Fluss nur mehr zu erahnen. Aber noch hatte das Land keine ausreichende Festigkeit gefunden, und ein falscher Schritt bedeutete den Tod, das unweigerliche Versinken im Sumpf. Titus hatte den Cherusker eingehend gewarnt und ihn ermahnt, nur in die Fußstapfen des Römers zu treten.
„Woher kennst du den Weg, Titus?“
„Als mein Vater noch lebte, wanderte er schon über diesen Pfad zur Insel.“
„Aber warum?“
„Um Vögel zu fangen. Auf der Insel gibt es viele seltene Vögel, die man sonst nirgends in dieser Gegend findet. Schade, dass ich weder Leimrute noch Käfig bei mir habe.“
Angesichts der Ödnis rings um sie konnte Thorag kaum glauben, was der Römer erzählte. Doch wünschte er sich, statt von unzähligen Stechmücken lieber von Vogelschwärmen umschwirrt zu werden.
An die Mücken zu denken, steigerte nur die Pein der vielen kleinen Wunden. Um sich abzulenken, sagte Thorag: „Dein Vater lebt nicht mehr. Was wurde aus ihm?“
„Der Sumpf hat ihn gefressen. Eines Tages, es war im zweiten Jahr von Tiberius’ Prinzipat, ging er wieder auf die Insel zur Vogeljagd und kam nicht zurück.“
„Aber er kannte doch den geheimen Pfad.“
„Vielleicht war er unvorsichtig und kam bei dem Versuch, einen besonders schönen Vogel zu fangen, vom Weg ab. Vielleicht haben die Wachen, die Germania minor abschirmen, ihn entdeckt und in den Sumpf getrieben. Oder der Nebenpfad, dem er folgte, war auf einmal verschwunden. Auch das kommt vor. Der Sumpf ist wie ein Weib, stets schwankend und veränderlich.“
Wie zum Beweis seiner Worte rutschte Titus mit einem Fuß zur Seite und geriet ins Straucheln. Gerade noch rechtzeitig, bevor er das Gleichgewicht verlor, hielt er sich mit einer Hand an den Ästen einer krumm gewachsenen Moorbirke fest. Thorag sprang hinzu und zog ihn auf den Pfad zurück.
„Bist du sicher, dass wir auf diesem Weg vor Sejanus und Maroboduus auf der Insel ankommen?“
Titus strich das in die Stirn fallende Haar zurück und trocknete mit einem Zipfel seiner Tunika den Schweiß in seinem Gesicht. „Ja, falls wir nicht in den verfluchten Sumpf fallen. Wir nähern uns der Insel auf geradem Weg, gehen genau auf die Südspitze zu. Die anderen müssen über eine der beiden Brücken kommen, und die führen von der Insel aus nach Norden und Westen.“
„Wenn dies ein gerader Weg ist, mögen wir vor ungeraden verschont bleiben!“, seufzte Thorag und ging weiter hinter Titus her.
Er stellte seinem Führer keine weiteren Fragen. Die Hitze dörrte Mund und Kehle aus. Seine Zunge fühlte sich ledrig und schwer an wie nach langem Fieberschlaf. Mit jedem Wort verstärkte sich sein unbändiger Durst. Hätte er nicht gewusst, dass das Wasser im Sumpf nicht weniger giftig war als der Biss einer Viper, hätte er sich über eines der zahlreichen Wasserlöcher gebeugt und das brackige Nass in vollen Zügen genossen, als sei es der süßeste Met.
Der Sumpf schien jedes Leben abzutöten, auch das im Donarsohn. Bald stapfte Thorag wie ein willenloser Sklave hinter Titus drein, von Hitze, Durst und den unablässigen Angriffen der Mückenschwärme geplagt und von nichts angetrieben außer dem Wissen, dass er den Vordermann nicht aus den Augen verlieren durfte, wollte er hier nicht elendig verrecken.
„Glaubst du mir jetzt, dass dies ein Paradies für Vogelsteller ist?“
Erst die Worte des Römers machten Thorag auf den vielfältigen Vogelgesang aufmerksam. Er atmete tief durch und dankte laut den Göttern, dass die Luft, die jetzt reiner war und nicht länger nach Fäulnis stank, endlich von Vögeln und nicht mehr von blutrünstigen Mücken beherrscht wurde.
„Wie hält der Lockenkopf diese Plage bloß aus?“, brummte der Donarsohn, mehr zu sich selbst als zu seinem Begleiter.
„Ich glaube, ich habe deine Worte verstanden, wenn du auch wieder in deiner fremden Sprache gesprochen hast.“ Titus grinste. „Und ich gebe dir recht. Wenn ich die Insel zur Vogeljagd aufsuche, reibe ich mich mit einer von meiner Mutter hergestellten Paste ein, die mich vor den Mücken schützt. Leider habe ich sie heute nicht dabei.“
„Leider, in der Tat“, sagte Thorag, während er seine zerstochenen Gliedmaßen betrachtete.
Der Wald rings um die beiden Männer war ein weitaus erfreulicherer Anblick. Keine halb toten Sumpfgewächse, sondern gesunde Bäume, wenn auch ein wenig von der Sommersonne ausgedörrt. In ihrem Schatten tummelten sich zahlreiche bunte Vögel und pickten in den grasbewachsenen Boden.
„Der Sumpf und seine Tücken liegen hinter uns, jedenfalls so lange, bis wir den Rückweg antreten“, erklärte Titus. „Jetzt droht uns eine andere Gefahr.“
„Die Wachen.“
„So ist es, Germane.“
So sicher, wie der Römer Thorag durch den Sumpf geführt hatte, geleitete er ihn auch durch den Wald. Bäume und Strauchwerk wichen mehr und mehr zurück, und bald sah der Donarsohn ein weißliches Schimmern durch das Blattwerk: die Mauern von Germania minor.
Titus zeigte auf eine alte Schwarzpappel mit starken Ästen, die ihre mehrteilige, ausladende Krone in Richtung der Mauern neigte. „Klettern wir da hinauf, und du hast eine gute Übersicht.“
Sie stiegen hoch genug, um fast die ganze Insel zu überblicken. Eine richtige Insel war es eigentlich nicht, dachte Thorag. Der verlandende Sumpf und die festen Wege, die hindurchführten, ließen den Namen unpassend erscheinen. Andererseits lebten die Menschen hier – Roms Gäste oder Geiseln, es blieb sich gleich – von den übrigen Einwohnern Ravennas ebenso isoliert wie vom Rest der Welt. Insofern konnte man durchaus von einer Insel sprechen.
Nach Norden hin durchmaß Germania minor eine knappe römische Meile, von Osten nach Westen ungefähr das Doppelte. Man konnte es nicht eine Festung nennen und auch nicht einen Kerker, und doch hatte der weitläufige Gebäudekomplex, der etwa drei Stadien vor dem Waldrand begann, etwas von beidem an sich. Neben Häusern im römischen Villenstil mit weitläufigen Gärten gab es kasernenartige Gebäude und Wachtürme, über deren Zinnen federbuschbesetzte Helme im Sonnenlicht blinkten.
„Die Mauern sind nur niedrig, wie bei normalen römischen Landhäusern“, stellte Thorag fest. „Warum baut man sie nicht höher? Dann wäre die Gefahr einer Flucht geringer.“
„Die Germanen sollen sich wie Gäste fühlen, nicht wie Gefangene. Außerdem kennt kaum jemand die Sumpfpfade, und die Brücken werden Tag und Nacht bewacht. Rund um die Insel patrouillieren Wachen, und bei Nacht führen sie scharfe Hunde mit sich. Wer sollte da entkommen?“
Auja, dachte Thorag, Thusnelda und Thumelikar!
Laut aber fragte er: „Heißt das, niemand von denen, die hier leben, verlässt jemals die Insel?“
„Ganz und gar nicht. Oft sieht man welche von den germanischen Gästen in der Stadt. Zumindest die, die mehr Gäste als Gefangene sind. Aber genau weiß ich nicht, wer von den Germanen das Vertrauen des Stadtpräfekten genießt.“
„Sprichst du von Foedus?“
„Ja, als Flottenpräfekt ist er auch Stadtpräfekt und als solcher wiederum auch für Germania minor verantwortlich.“
„Wie stark sind die hier stationierten Wachen?“
Titus, der auf einem etwas niedrigeren Ast hockte, sah erstaunt zu Thorag auf. „Du willst es aber genau wissen! Wahrscheinlich genauer, als ich selbst es weiß.“
„Ich denke, jemand, der oft zum heimlichen Vogelfang auf die Insel kommt, wird sich gut mit der Stärke und den Gepflogenheiten der Wachen auskennen.“
„Verursacht so viel Klugheit nicht zuweilen Kopfschmerz?“ Titus fasste in seine Locken und rieb seinen Schädel, als leide er selbst unter der Krankheit. „Wenn sich nichts geändert hat, sind hier zwei Zenturien und eine Turme Reiter stationiert.“
„Also rund zweihundert Mann“, sagte Thorag und fand, dass es angesichts der wenigen Fluchtwege ausreichend war. Zumal in Ravenna und Classis weitere Truppen lagen, die man im Notfall schnell heranführen konnte, um die ganze Insel abzuriegeln. Er zeigte auf den großen, düster wirkenden Gebäudekomplex im Nordwesten. „Liegen dort die Unterkünfte der Wachen?“
„Ganz recht, Germane. Wie hast du das erkannt?“
„Nach gemütlichen Wohnhäusern sieht mir das nicht aus. Außerdem ist die Lage für die Truppenunterkünfte gut gewählt, genau zwischen den beiden Brücken.“
Titus nickte bedächtig, wie zu einer inneren Bestätigung, und murmelte: „Du musst oft unter Kopfschmerzen leiden.“
Thorag achtete kaum auf seine Worte. Andere Laute, die noch sehr fern klangen, wie heranrauschende Brandungswellen, beanspruchten seine Aufmerksamkeit. Als er sich konzentrierte, identifizierte er es als ein Gemisch aus Marschmusik und dem harten Tritt Hunderter nägelbeschlagener Soldatenstiefel.
Auch Titus hörte es jetzt. „Das muss der Festzug mit Sejanus und Maroboduus sein. Er marschiert auf der Via Porta, die Classis im Westen von Germania minor mit Ravenna verbindet, jenseits der Sümpfe und des Flusses, über den die Inselbrücken führen. Die Musik wird immer lauter. Ich schätze, bald kommen die ersten über die westliche Brücke. Tja, freigebiger Freund aus dem fernen Germanien, viel mehr von den hohen Gästen Ravennas wirst du von diesem Baum aus auch nicht sehen.“
„Eben darum müssen wir näher heran. Los, nach unten!“
Thorag hatte es eilig und Titus merkte das. Er kletterte flink zu Boden und lief, gefolgt von dem Cherusker, ein Stück in den Wald zurück, um nicht von den Wachen bemerkt zu werden. Sobald sie vor den Blicken der Soldaten sicher waren, wandten sie sich nach Norden.
Thorag fiel auf, wie willig Titus alles mitmachte. Tat er es nur für die von Thorag erhaltenen Denare? Der Donarsohn glaubte, es besser zu wissen, den wahren Grund zu kennen, weshalb der Vogelhändler sein Leben in Gefahr brachte. Falls Thorag recht hatte, tat Titus es nicht für ihn.
Die Brücke war an einer schmalen Stelle des Flusses errichtet worden und daher nicht besonders groß. Ein steinerner Wölbbogen ohne Stützpfeiler, vielleicht etwas über fünfzig Fuß lang, reichte aus, um das schwerfällig dahinplätschernde Gewässer zu überspannen. Titus erklärte Thorag, dass der Fluss an der Nordseite der Insel breiter und die Strömung dort stärker sei. Im Norden ergoss der Fluss, ein Nebenarm des Padus, sich ins Meer. Dies hier war gleichsam ein Nebenarm des Nebenarms, der weiter südlich im Sumpfland versickerte.
Zwischen dem Waldrand und der Brücke lag ein hundert Fuß breiter Wiesenstreifen, den Thorag und Titus nicht betreten konnten, ohne den römischen Wachen aufzufallen. Auf jeder Seite der Brücke stand ein halb offenes Wachhäuschen. Vor jedem Häuschen nahmen fünf Soldaten Aufstellung, um den herannahenden Festzug empfangen.
Aber nicht die Soldaten auf der Brücke und auch nicht der jetzt laut und deutlich hörbare Umzug beanspruchten Thorags Interesse. Er beugte sich weit in dem stark und unangenehm riechenden Schwarzbeerenstrauch vor, der ihm und Titus als Versteck diente, und blickte nach Osten, zum Rand der germanischen Kolonie.
Aus der Kaserne rückten die Wachzenturien aus und marschierten auf das freie Feld zwischen den Gebäuden und der Brücke. In ihrer Mitte gingen Männer und Frauen in ziviler Kleidung, die Männer zumeist in teuren Tuniken, einige, die sich des römischen Bürgerrechts rühmten, obwohl sie Germanen waren, auch in der hellen Toga. Einer der Germanen in römischer Bürgertracht war...
„Segestes!“
„Du hast schon wieder jemanden von deinen germanischen Brüdern erkannt“, stellte Titus im Flüsterton fest. „Reisen bildet offenbar wirklich. Doch solltest du deine Erregung zügeln, willst du uns nicht an die Wachen ausliefern. Nur ein bisschen lauter, und wir sähen uns jetzt von eisernen Pilenspitzen umkreist.“
Thorag biss auf seine Unterlippe und richtete die Augen auf den Mann, der einst ein Cherusker und der Fürst des Stiergaus gewesen war: Segestes, der nach dem Tod des Herzogs Segimar mit Armin um die Nachfolge gestritten hatte.
Der Donarsohn sah die beiden Rivalen vor sich, wie sie auf dem Stammesthing im Schatten der Heiligen Steine versuchten, den stolzen Schimmel, eines der heiligen Rosse, zu besteigen. Wem es gelang, dem gehörten die Gunst der Götter und die Würde des Herzogs. Schließlich war es Armin gewesen, der den weißen Hengst bezwungen hatte. Seit jenem Tag, als Segestes den Jüngeren als seinen Herzog hatte anerkennen müssen, war sein Hass auf Armin stetig gewachsen.
Zu dem persönlichen Neid hatte sich politischer Zwist gesellt. Während Armin versucht hatte, die Cherusker und die benachbarten Stämme zum Aufstand gegen Rom zu einen, übte der überzeugte Römling Segestes Verrat und weihte Publius Quintilius Varus in Armins Pläne ein. Wohl nur mit der Hilfe der Götter war es Armin im Sommerlager des Varus gelungen, den römischen Statthalter weiter in falscher Sicherheit zu wiegen. Die Voraussetzung dafür, ihn und seine Legionen in den Teutoburger Wald zu locken – in den tödlichen Hinterhalt.
Ausgerechnet die Tochter des Segestes, Thusnelda, musste es sein, die Armin sich zum Weib erkor. Natürlich verweigerte Segestes seine Einwilligung zu der Verbindung, und so raubte Armin die Geliebte nach altem Brauch. Erst dann, halb unter Zwang, willigte der Stierfürst in die Hochzeit ein. Doch Segestes rächte sich, indem er Armins Burg überfiel und sich die Tochter, die in ihrem Leib schon die Frucht der Liebe trug, zurückholte. Damals geriet auch Auja in seine Hände. Als Armin und Thorag die Burg des Segestes belagerten, rief der Stierfürst Germanicus zu Hilfe. Der Römling ging endgültig zu den Römern über, und mit ihm gingen gezwungenermaßen die gefangenen Frauen.
Auja und Thusnelda! Thorag hielt nach ihnen Ausschau. Am liebsten wäre er aus dem Gebüsch gesprungen und zu der großen Menschengruppe gelaufen, um seine Auja zu suchen und sie endlich wieder in die Arme zu schließen.
Nur mit Mühe konnte er sich zurückhalten. Er hatte einen langen Weg zurückgelegt und manche Gefahr überstanden, um nach Ravenna zu gelangen. Hier, so kurz vor dem Ziel, durfte er all das nicht durch unüberlegtes Handeln aufs Spiel setzen. Wenn er versagte, gab es für die Verschleppten keine Aussicht auf Rettung. Und Ragnar würde nie wieder mit Vater und Mutter vereint sein.
An die hundert Germanen scharten sich um Segestes. Dicht bei dem ehemaligen Stierfürsten standen sein Sohn Segimund, sein Bruder Segimer und dessen Sohn Sesithar. Von ihnen trug nur einer die Toga: Segimund, der einmal römischer Priester in der Ubierstadt gewesen war.
Segimer und Sesithar hatten während der Germanicus-Feldzüge versucht, zu den freien Germanen überzulaufen. Aber war deshalb Hilfe von ihnen zu erwarten? Sie schienen freiwillig neben Segestes zu stehen, keine Kette hielt sie fest.
Einen Schritt hinter Sesithar ging eine Frau mit rötlichem Haar und dunklen Augen, sehr schön anzusehen, wenn auch ihre Züge eine seltsame Kälte ausstrahlten. Das musste Rhamis sein, die Thorag nur vom Hörensagen kannte: die Tochter des Chattenfürsten Ukromir und Gemahlin des Sesithar.
Sie drehte sich halb zur Seite und sprach zu einer anderen Frau, die in der zweiten Reihe stand und bislang hinter den Rücken von Segestes und Sesithar verborgen gewesen war. Diese Frau war von großem, geradem Wuchs und trug keine römische Kleidung wie die meisten anderen, sondern ein ärmelloses, bis zu den Füßen reichendes Gewand, das nach germanischer Sitte von Schulterfibeln zusammengehalten wurde. Zwei rote Gürtel unter der Brust und um die Hüften sorgten für eine üppige Bauschung des Stoffes. Das Gesicht war schön und ernst, wenn die Nase auch ein wenig zu lang und leicht gebogen war. Wie bei Segestes, dessen Antlitz es ähnelte, wenngleich der Frau die bedrohliche Schärfe abging, die den Zügen des Römlings anhaftete. Thusneldas Gesicht schien in den Wintern und Sommern ihrer Gefangenschaft verschlossener geworden zu sein, sonst hatte es sich nicht verändert.
Wo Thusnelda war, musste doch auch Auja zu finden sein! Erneut suchte Thorag die Gruppe der Germanen nach seiner Gemahlin ab. Aber wenn Auja sich unter ihnen befand, musste sie so weit hinten stehen, dass sie von seinem Versteck aus nicht zu erkennen war.
Sein unruhig umherirrender Blick kehrte zu Thusnelda und Rhamis zurück, die über irgendetwas stritten. Der Vergleich beider Frauen fiel eindeutig zugunsten von Armins Gemahlin aus. Rhamis mochte mit ihren vollen, sinnlichen Lippen und den hochstehenden Wangenknochen in den Augen der meisten Männer die begehrenswertere Frau sein, aber nur, wenn man den Blick auf das Offensichtliche beschränkte. Sah man tiefer in die Gesichter beider Frauen, erkannte man die stille, innere Würde und Schönheit Thusneldas, einen Stolz, der nichts mit falschem Hochmut zu tun hatte. Die Züge der schönen Rhamis hingegen zeigten jene ungnädige Schärfe, die man eher bei der Tochter des Segestes gesucht hätte. Vielleicht tat Thorag der Chattin unrecht. Ihr Gezänk mit Thusnelda und die offensichtliche Verärgerung mochten das Antlitz entstellen. Und doch, sprach es nicht für Thusnelda, dass die Cheruskerin ihre Ruhe und ihre Würde bewahrte?
Die Ursache für Rhamis’ Entrüstung schien Thusneldas germanisches Gewand zu sein, mit dem Armins Gemahlin ihre antirömische Gesinnung zeigte. Die Chattin, die nach der Art der Römerinnen eine knöchellange Tunika trug, von leuchtendem Purpur und verziert mit breiten Goldborten, zupfte an Thusneldas Kleid herum und hätte es ihr am liebsten vom Leib gerissen.
Thusnelda drehte ihr einfach den Rücken zu und bückte sich, um ein kleines blondes Kind auf den Arm zu nehmen. Das konnte niemand anderes als Thumelikar sein, Armins Sohn. Für einen vierjährigen Knaben war er groß und kräftig, doch er schien verschreckt und weinte in den Armen der Mutter. Vermutlich hatte Rhamis’ Gekeife ihm Angst eingejagt.