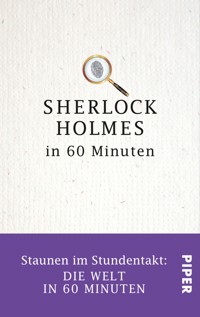3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
London, Baker Street 221 B, die Adresse von Sherlock Holmes in London. An die Haustür des Meisterdetektivs Sherlock Holmes klopft eines Abends ein sterbenskranker Besucher. Er warnt den Detektiv und seinen Freund Dr. Watson vor einer schrecklichen Bedrohung für die Menschheit, die mit der Entführung eines französischen Wissenschaftlers in Verbindung steht. Holmes nimmt sofort die Ermittlungen auf, die Spur führt ihn und Watson in den Dschungel Sumatras, in dessen undurchdringlichem Dickicht der zwielichtige Baron Maupertuis dubiose Experimente durchführt. Der Dschungel stellt die beiden Freunde vor etliche Gefahren, bevor sie das Rätsel in den nebelverhangenen Straßen Londons lösen können – zusammen mit einem jungen, hoffnungsvollen Schriftsteller namens H.G. Wells …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jörg Kastner (Hrsg.)
Sherlock Holmes und der Schrecken von Sumatra
Ein Bericht von Dr. John H. Watson
Kriminalroman
Zur Erinnerung an Kathrin Jaeck, deren Spezialgebiete die Nagetiere und Mr. Holmes waren, und zum Dank dafür, dass sie mich an meine Maus abgetreten hat. Und für meine Maus, die den Computer mit Dr. Watsons Aufzeichnungen gefüttert hat.
„... die Anzahl der Aufzeichnungen, die er (Sherlock Holmes) hinterlassen hat, oder die der Erinnerungen im Kopf seines Biografen ist unbegrenzt.“Sir Arthur Conan Doyle
Vorwort des Herausgebers
Es war während eines Londonaufenthalts im Sommer 1984, als ich auf einem Flohmarkt nahe der Carnaby Street eine Holztruhe mit den bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen des uns wohlbekannten Dr. John H. Watson erstand. Mein Erstaunen und mein Herzpochen waren anfangs ebenso groß wie mein Unglauben. Aber dann siegten folgende Überlegungen über die Zweifel: Wer sollte sich die umfangreiche Arbeit der Fälschung so vieler Manuskripte gemacht haben? Und zu welchem Zweck?
Während meines im Anschluss an die Londonreise beginnenden Studiums an der Universität Bielefeld ließ ich die Aufzeichnungen dort chemischen Tests unterziehen und erhielt die Bestätigung, dass sowohl das Papier als auch die Tinte, mit der die anfangs gewöhnungsbedürftige Handschrift (unverkennbar die eines Arztes!) niedergebracht war, den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts entstammen.
Dass die von mir gefundenen Papiere inhaltlich manchmal dem widersprechen, was Sir Arthur Conan Doyle uns überliefert hat, spricht auch nicht gegen die Echtheit meines Fundes, eher dafür: Watson sagt es unten selbst, zu seinen Lebzeiten musste er einiges verschweigen, was er in seinen nachgelassenen Aufzeichnungen enthüllt.
Der vorliegende Bericht schildert mit Sicherheit eines der fantastischsten, gefährlichsten und aufregendsten Abenteuer aus der langen Karriere des berühmten Detektivs Sherlock Holmes. Und es gab gute Gründe, ihn damals der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Selbst – oder gerade – in unseren Tagen wirft er einen großen Schatten auf einen Zweig der Wissenschaft, dem wir unheilbar Fortschrittsgläubige immer größere Bedeutung beimessen.
Ich habe dem Text dort erklärende Fußnoten angefügt, wo ich es aus unterschiedlichen Gründen für angebracht erhielt. Wegen eines Wasserschadens an den Papieren, der ein paar Bearbeitungen und Ergänzungen erforderte, sind alle Fehler, Unklarheiten und Ungereimtheiten mir anzulasten. Wer jedoch an diesem erregenden Abenteuer Gefallen findet, möge sich bei Dr. Watson bedanken.
Jörg Kastner
Einführung von Dr. John H. Watson
Mein Freund Sherlock Holmes, der berühmte Privatdetektiv, betreute einen Klientenkreis, zu dem einfache Stubenmädchen ebenso gehörten wie viele gekrönte Häupter. Manche seiner Fälle waren bizarr, andere von hochgradiger Brisanz und geeignet, internationale Krisen heraufzubeschwören, die nur durch Holmes’ überragende Intelligenz und sein ebenso ungewöhnliches Fingerspitzengefühl in bestimmten Angelegenheiten vermieden wurden. Einige dieser Abenteuer habe ich zu Papier gebracht und dadurch entschärft, dass ich Namen und Angaben derart änderte, dass niemand kompromittiert werden konnte. Dazu verpflichtete mich schon die Diskretion, die der Detektiv seinen Klienten versprach und schuldete. Andere Fälle habe ich niemals veröffentlicht, obgleich einige von ihnen zu den interessantesten in Holmes’ Laufbahn zählen, weil eine Änderung der Daten entweder nicht möglich oder nicht Erfolg versprechend gewesen wäre. Und so manche Affäre durfte in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden, da ihr Bekanntwerden eine unverantwortliche Beunruhigung der Bevölkerung oder sogar eine Gefährdung der Sicherheit unserer Nation bedeutet hätte.
Zu diesen brisanten (und gleichzeitig bizarren) Fällen gehört auch die Angelegenheit mit der Holland-Sumatra-Gesellschaft, deren Aspekte in der Presse nur unter falschen Blickpunkten behandelt wurden. Schuld daran war eine Anweisung der Regierung, die eine exakte Aufdeckung der Fakten verbot. Zwar murrte ich damals über das Verbot, da ich diesen Fall, in dem Sherlock Holmes so Hervorragendes geleistet hat und vielleicht die Welt vor einer Katastrophe größten Ausmaßes bewahrte, nur zu gern für die Allgemeinheit festgehalten hätte, aber ich sah ein, dass es für die Welt das beste war, den Mantel des Schweigens über die erschreckenden Geschehnisse auszubreiten, deren Zeugen Holmes und ich damals wurden.
Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen, und die Menschheit ist mit Riesenschritten voranmarschiert, nicht immer zu ihrem Besten, wie der große, alles verzehrende Krieg von 1914 bis 1918, in dem mein Freund und ich dem Vaterland noch einmal von Nutzen sein durften[1], bewiesen hat. Wie dem auch sei, heutzutage ist der menschliche Geist in der Lage, so schreckliche Waffen und Mittel zu erfinden, dass die Aufdeckung des folgenden Falles die Welt nicht mehr erschüttern wird – oder doch?
Mir ist zu Ohren gekommen, dass viele Menschen Sherlock Holmes aufgrund meiner Veröffentlichungen über seine Abenteuer für eine fiktive Gestalt halten, seit er sich ins Privatleben zurückgezogen hat; vielleicht werden sie die Geschehnisse, über die ich nun berichten will, auch für erfunden halten. Mir ist es, ehrlich gesagt, gleichgültig. Ich schreibe alles so nieder, wie ich es erlebt habe, in jenen fernen Tagen, als ich mit dem großen Sherlock Holmes noch in der Baker Street 221 B lebte und als die Schritte, die wir auf den siebzehn Stufen zu unserer Wohnung hörten, so oft die Vorboten rätselhafter und auch gefährlicher Erlebnisse waren.
John H. Watson, M.D.London, 1923
Erster Teil: Der Tod des Franzosen
1. Kapitel – Der Tod in der Baker Street
„Ich bin der Meinung ...“
„In der Tat, Watson“, unterbrach mich Sherlock Holmes, „der Ansicht bin ich auch.“
„Aber, Holmes“, protestierte ich, „Sie können unmöglich wissen, was ich sagen wollte!“
„Natürlich weiß ich es. Wie hätte ich Ihnen sonst zustimmen können?“
Holmes besaß eine gewisse perfide Vorliebe dafür, durch eine genaue Bobachtung meiner Person in meinen Gedanken zu lesen, wie man seine Fähigkeit vielleicht bezeichnen kann. Eine Angewohnheit, die mich zuweilen zur Weißglut trieb.
Ich beherrschte mich mühsam und sagte: „Also gut, Holmes. Wenn Sie mir wirklich sagen können, woran ich dachte, als Sie mir ins Wort fielen, lade ich Sie für heute Abend zum Essen bei Simpson’s ein.“
„Ich nehme dankend an, Doktor“, meinte Holmes, indem er sich in seinem Lehnsessel aufrichtete und den Rauch aus seiner alten Bruyèrepfeife ausstieß. „Die Vorstellung, die wir gestern Abend im Oxford Theater miterlebten, war, gelinde ausgedrückt, enttäuschend. Darüber sind wir uns einig. Als Ihr Blick eben durchs Zimmer schweifte, blieb er auf dem Shakespeareband haften, in dem Sie gestern lasen, und Ihre Miene verfinsterte sich dabei zusehends. Da ich weiß, dass Sie unserem großen Dichter aus Stratford-upon-Avon gegenüber keinen Groll hegen, konnte Ihr Missmut sich nur auf die Aufführung im Oxford Theater beziehen. Daraus schließe ich, dass Sie die Meinung äußern wollten, Shakespeare hätte sich das Schreiben seiner Werke noch mal gründlich überlegt, wenn er gewusst hätte, was die Nachwelt aus ihnen machen würde.“
Holmes’ langes, asketisches Gesicht war unbewegt, aber im Blick seiner grauen Augen lag ein Zeichen seines inneren Triumphes.
„Na schön, mein Freund, Sie haben wieder einmal gewonnen“, gab ich zu und drückte ärgerlich meine Zigarette in dem Kristallaschenbecher auf dem runden Beistelltisch aus, obwohl ich sie noch nicht aufgeraucht hatte. „Wir könnten einen Spaziergang zum Strand machen. Das Wetter ist recht angenehm.“
Der Februar des Jahres 1887 hatte seine Mitte erreicht und den Winter ungewohnt früh vertrieben. Ein warmer Wind wehte über die große Insel und betätigte sich als Vorbote des kommenden Frühlings. Sherlock Holmes hatte in letzter Zeit viel zu tun gehabt und seinen ohnehin schon beachtlichen Ruf dabei noch vergrößert. Da er in Zeiten der beruflichen Beanspruchung die Bedürfnisse seines Körpers häufig sträflich zu vernachlässigen pflegte, gönnte er sich auf mein Anraten eine Ruhepause und lehnte seit ein paar Tagen alle Aufträge ab, an denen zurzeit kein Mangel herrschte. Ein Spaziergang bei dem angenehmen Klima war für meinen Freund jetzt genau richtig.
„Einverstanden“, sagte Holmes und klopfte seine Pfeife aus. „Ziehen wir uns an, und gehen wir zum Strand. Die Vorfreude auf die kulinarischen Genüsse bei Simpson’s versetzt meine Speicheldrüsen schon jetzt in rege Tätigkeit.“
In diesem Augenblick hörten wir Schritte auf der Treppe, die die Regelmäßigkeit des normalen Gehens vermissen ließen.
„Wer kann das um diese Zeit nur sein?“, wunderte ich mich laut.
„Ihre Neugier wird in wenigen Sekunden befriedigt werden“, meinte Holmes lakonisch.
Der unangemeldete Besucher hatte den oberen Treppenabsatz erreicht, und wir hörten heftige Atemgeräusche, als habe ihn das Treppensteigen sehr mitgenommen. Ich schloss daraus, dass es sich um einen recht alten Menschen handelte, und wartete auf sein Klopfen. Aber das kam nicht. Stattdessen wurde die Tür langsam geöffnet und herein taumelte etwas, dessen Anblick sich ebenso schwer beschreiben lässt wie das Entsetzen, das Holmes und mich befiel. Es war die Gestalt eines Menschen – oder was davon übrig war. Der Mann war zu einer grauenhaften Karikatur seiner selbst verkommen. Er war Europäer, und doch war seine Haut unnatürlich dunkel, fast schwarz, soweit man sie noch erkennen konnte. Denn überall, wo die schmutzige, abgerissene Kleidung den Mann nicht bedeckte, entstellten seine Haut große Beulen, die zum Teil aufgeplatzt waren, sodass eine Mischung aus Blut und Eiter austrat. Auch das Gesicht war von den Entstellungen nicht verschont worden. Es war nur mehr eine grässliche Fratze, die auf den ersten Blick den Masken ähnelte, die wilde Naturvölker als Abbilder ihrer schrecklichen Gottheiten anfertigten. Und doch gehörte das Gesicht einem Menschen, und wenn man genauer hinsah, drückte es Schmerzen und eine ungeheure Qual aus. Die aufgesprungenen Lippen öffneten sich, und der Gepeinigte sprach mit verzerrter Stimme und langsam, denn jede mühsam hervorgebrachte Silbe schien neue Schmerzen für ihn zu bedeuten.
„Holmes ... helfen ... Sie ...“
Die Kraft, die ihn bis hierher gebracht hatte, verließ ihn, und er stürzte auf den Boden unseres Wohnzimmers, wo er wie tot liegen blieb. Aber ein Röcheln und ein Zittern seines entkräfteten Körpers verrieten uns, dass noch Leben in ihm war. Wie versteinert saßen wir bislang in unseren Sesseln. Jetzt sprangen wir fast gleichzeitig auf und näherten uns dem sonderbaren Besucher.
„Nicht ... zu nahe ...“, röchelte er. „Vielleicht ... ansteckend!“
Wir standen über der gebeutelten Kreatur und sahen in ein Paar hellblauer Augen, die noch das Menschlichste an ihr waren. Aus ihnen sprach die Erkenntnis über die hoffnungslose Situation dieses armen Menschen und die Trauer darüber.
„Mein Gott! Es ist le Villard!“, stieß Sherlock Holmes erregt hervor.
„Wer?“, fragte ich.
„François le Villard, der französische Kriminalist! Ich habe Ihnen von ihm erzählt, Watson, als ich ihm letztes Jahr bei dem Testamentsfall behilflich war.“
Ich erinnerte mich an das Gespräch[2] und auch daran, wie sehr mein Freund le Villards kriminalistische Fähigkeiten gelobt hatte, denn in solchen Angelegenheiten ging Holmes mit seinem Lob eher sparsam um. Er hatte mir auch erzählt, dass le Villard damit beschäftigt sei, die von Holmes verfassten Monografien, wie zum Beispiel Über die Unterscheidung verschiedener Tabaksorten nach ihrer Asche, ins Französische zu übersetzen.
Holmes kniete sich neben den Franzosen. Niemals zuvor hatte ich meinen sonst so gefühlskalten Freund derart ergriffen gesehen.
„François, was ist mit Ihnen geschehen?“, fragte er eindringlich und mitfühlend zugleich. „Wer hat Ihnen das angetan?“
Die entstellte Fratze, die einmal ein menschliches Antlitz gewesen war, verzerrte sich noch mehr, als le Villard sich um eine Antwort bemühte.
„Holmes ...“, brachte er schließlich hervor, „... große Gefahr ... nur Sie können helfen ...“
Die nur schwer verständlichen Worte gingen in einem heftigen, stoßweisen Keuchen unter. Ich versuchte mir vorzustellen, wie dieses Gesicht ausgesehen haben mochte, bevor die schreckliche Entstellung von ihm Besitz ergriffen hatte, aber es gelang mir nur schwer. Le Villard war jung gewesen, jünger als Holmes oder ich selbst, doch war das nun kaum noch zu erkennen.
„Wie kann ich Ihnen helfen, François?“, drang Holmes weiter in ihn. „Was soll ich tun?“
Wieder bemühte sich der Franzose krampfhaft um eine Antwort, für die er scheinbar seine letzten Kräfte mobilisierte.
„Retten Sie ... Professor Chalonge!“
Bei diesen Worten klärte sich le Villards Blick noch einmal, und seine Stimme klang fester als zuvor. Sein Körper bäumte sich auf, um im nächsten Moment in sich zusammenzufallen. Der Kopf rollte zur Seite, und dann machte François le Villard keine Bewegung mehr. Ich hatte in meinem Leben als Arzt und Soldat schon viele Tote gesehen (wenn auch keiner auf so entsetzliche Weise gestorben war) und konnte sie nicht mehr zählen. Als ich in le Villards starre Augen sah, wusste ich, dass es gerade einer mehr geworden war. Trotzdem machte ich mich gleich daran, ihn genau zu untersuchen.
„Seien Sie vorsichtig, Doktor!“, ermahnte mich Holmes. „Wie le Villard schon sagte, es könnte ansteckend sein.“
„So sieht es auch aus“, erwiderte ich, während ich das zerschlissene Hemd aufknöpfte. „Aber ich bin Arzt!“
Da hörten wir die Stimme einer Frau, aufgeregt und erschrocken: „Oh, Mr. Holmes, es war schrecklich! Ich öffnete die Haustür, nachdem es geläutet hatte, und dann sah ich diesen ... diesen ... was immer es war.“
Mrs. Hudson, unsere Hauswirtin, stand in der noch immer offenen Zimmertür, das Gesicht kreidebleich und die Hände vor der weißen Schürze ineinander verkrampft. Sie starrte mit Abscheu und Angst auf den am Boden liegenden Toten.
„Mrs. Hudson, hat der Mann Sie berührt?“, fragte Holmes im Tonfall eines Schiffskapitäns, der nach einem schweren Sturm die Schadensmeldungen einholt.
„Wie meinen Sie das, Sir?“
„Haben Sie Körperkontakt zu dem Mann gehabt? Oder haben Sie seine Kleidung berührt?“
„Nein, Mr. Holmes. Als ich den Mann sah, wich ich vor Entsetzen zurück, soweit ich konnte. Er taumelte, ohne etwas zu sagen, an mir vorbei und erstieg die Treppe. Es war grauenhaft!“
Seit Holmes und ich die Wohnung in Mrs. Hudsons Haus bezogen hatten, hatte die Frau einiges Ungewöhnliches durchgemacht. Nur zu gut erinnerte ich mich an ihren Gefühlsausbruch, als sie bemerkte, wie Holmes im Zimmer Schießübungen mit seinem Revolver veranstaltete und, in seinem Sessel sitzend, die gegenüberliegende Wand mit den aus Einschusslöchern bestehenden Insignien unserer Königin versah. Doch was die für gewöhnlich herzensgute Frau heute erlebt hatte, stellte wohl alles andere in den Schatten.
Holmes fragte weiter: „Haben Sie seinen Atem zu spüren bekommen?“
„Nein, er hat mich ja gar nicht beachtet.“
„Gut!“ Holmes wirkte erleichtert. „Kommen Sie nicht näher, Mrs. Hudson, und berühren Sie das Treppengeländer nicht. Sie dürfen niemandem erzählen, was Sie gesehen haben. Seien Sie so gut, uns eine Droschke zu besorgen, aber keinen Hansom, sondern etwas Größeres. Wir müssen den armen Kerl wegbringen. Haben Sie Desinfektionsmittel im Haus? Fein. Dann reinigen Sie anschließend das Treppengeländer, die Treppe, die Klingelschnur und den Boden, mit dem dieser Mann in Berührung gekommen ist, damit. Gehen Sie gründlich vor und reinigen sich selbst auch. Das ist sehr wichtig!“
„Ich habe verstanden, Mr. Holmes“, nickte sie und eilte die Treppe hinunter.
Ich hatte den unglücklichen le Villard größtenteils seiner Kleidung entledigt und erwartungsgemäß festgestellt, dass sein gesamter Körper ein Opfer der Entstellungen geworden und gleichsam eine einzige von Blut und Eiter bedeckte Wunde war.
„Woran ist er gestorben, Watson?“, fragte mein Freund. „Was ist das für eine entsetzliche Krankheit?“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich weiß es nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ähnlichkeiten zur Pest sind vorhanden, aber sie ist es nicht. Ich halte es für eine tropische Infektion. Mehr kann ich nicht sagen.“
„François le Villard war ein hoffnungsvoller Mann in der Kriminalistik“, sagte Holmes und sah dabei den Toten an. „In einigen Jahren hätte er mich vielleicht sogar überrundet. Jetzt war er bereits der fähigste Detektiv auf dem Kontinent. Er hat sich mit letzter Kraft in die Baker Street geschleppt, um mich um Hilfe zu bitten. Wer immer le Villard auf dem Gewissen hat, ich werde ihn finden!“
Das klang fast wie ein Schwur, und so etwas war es wohl auch. Gesicht und Stimme meines Freundes drückten einen Grimm aus, den ich bislang an ihm nicht gekannt hatte. Dies war keiner der üblichen Fälle für Sherlock Holmes. Ihn trieb ein persönliches Motiv an. Konnte man es Rache nennen?
„Helfen Sie mir, Watson“, sagte der Detektiv, der aufgestanden war und damit begonnen hatte, die Möbelstücke beiseite zu rücken.
„Was haben Sie vor?“
„Wir werden le Villard in den Teppich, auf dem er liegt, einwickeln. Wir müssen das Stück sowieso verbrennen.“
„Das wird Mrs. Hudson aber nicht erfreuen“, meinte ich und half ihm bei seiner Tätigkeit.
„Es ist unumgänglich.“
Unsere Vermieterin kam die Treppe herauf und meldete, dass eine Droschke vor dem Haus wartete. Sie war sichtlich erstaunt über unsere Tätigkeit, erkundigte sich jedoch nicht nach deren Sinn. Ich hatte mir zwischenzeitlich Handschuhe angezogen, weil meine Hände den toten Körper berührt hatten. Wir rollten die Leiche in den Teppich ein und banden ihn an beiden Enden zu. Obgleich ich als Arzt einiges gewöhnt war, bedeutete es eine Erleichterung für mich, le Villards Anblick nicht länger ertragen zu müssen.
„Wo bringen wir ihn hin, Holmes?“, fragte ich.
„Sie äußerten den Verdacht einer tropischen Infektion. Daher halte ich es für angebracht, ihn zu Dr. Ainstree zu bringen. Er ist wohl die größte Kapazität für Tropenkrankheiten und zurzeit in London, wie ich neulich im Nachrichtenteil des Daily Chronicle gelesen habe. Sein Haus steht in der Cromwell Road.“
Ich hatte auch schon von Dr. Holcroft G. Ainstree gehört und seine Beiträge im Lancet[3] mit Gewinn gelesen. Er hatte über zwei Drittel seines Lebens in den Tropen verbracht und sich der Erforschung der dortigen Krankheiten gewidmet. Ich stimmte Holmes’ Plan zu, und wir trugen unsere ungewöhnliche Last die Treppe hinunter. Ich kam mir dabei vor wie ein Leichendieb in einer dieser Schauergeschichten. Der Fahrer der vierrädrigen Droschke wunderte sich nicht wenig über uns.
„Ein seltener Teppich für einen Sammler“, beruhigte ihn Holmes. „Sie wissen ja, wie diese versponnenen Geldsäcke sind. Können nicht mal bis zum nächsten Tag auf ihr geliebtes Objekt warten.“
Der Kutscher nickte verständnisvoll und trieb sein Pferd an, nachdem mein Freund die Cromwell Road als Ziel genannt hatte. Während wir durch das dunkle London fuhren, hatte ich zum ersten Mal, seit der Franzose in unser Zimmer gewankt war, Zeit, mir Gedanken über den rätselhaften Vorfall zu machen. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Fragen türmten sich vor mir auf: Was machte ein französischer Detektiv in London? Welche merkwürdige Krankheit hatte ihm das Leben genommen? Wo hatte er sich angesteckt? Und wer war jener Professor Chalonge, dem le Villards letzte Worte gegolten hatten? Holmes sollte ihn retten, aber aus welcher Gefahr?
„Sie haben recht, Watson“, unterbrach der Detektiv das bedrückende Schweigen. „Es gilt, eine Menge Antworten zu finden. Wer zum Beispiel ist Professor Chalonge? Kennen Sie ihn?“
„Leider nicht. Und Sie wussten nicht, dass le Villard sich in London aufhielt, Holmes?“
„Nein, das wusste ich nicht. Ich hatte zuletzt Anfang des Jahres von ihm gehört, als er brieflich einige Fragen an mich richtete, die sich auf die Übertragung meiner Werke in seine Muttersprache bezogen.“
In der Cromwell Road schüttete Holmes dem Fahrer ein paar Münzen aus seiner Börse in die Hand, wobei er darauf achtete, den Mann nicht zu berühren. Dr. Ainstree bewohnte ein großes, von Efeuranken überwuchertes Haus mit einem ebenfalls großen Vorgarten, der wiederum von einer Steinmauer umschlossen war. Wir trugen den armen le Villard den gepflasterten Weg zum Haupteingang entlang, wo ich an der Klingelschnur zog. Ein Hausmädchen öffnete und fragte nach unserem Begehr.
„Wir bringen einen seltenen Teppich für Dr. Ainstree“, sagte Holmes. „Ihr Herr möchte ihn bitte persönlich in Empfang nehmen.“
Das Mädchen verschwand, um kurz darauf mit der Mitteilung wiederzukehren, Dr. Ainstree könne sich nicht entsinnen, einen Teppich bestellt zu haben. Sie wollte die Haustür schließen, aber Holmes verhinderte das, indem er wie ein windiger Hausierer seinen Fuß zwischen Tür und Rahmen schob.
„Sie werden uns nicht los, bevor wir mit Dr. Ainstree gesprochen haben“, sagte er mit Nachdruck.
Wieder ging das Mädchen ins Haus. Nach wenigen Minuten trat der Hausherr uns entgegen, ein mittelgroßer, hagerer Endfünfziger mit grauem Haar und grauem Kinnbart. Seine für einen Europäer sehr dunkle Haut verriet den langen Aufenthalt in den Tropen. Er war offensichtlich erregt über die Störung, und seine Augen musterten uns mit nicht gerade freundlichen Blicken. Sie lagen über einer gekrümmten Nase tief in den Höhlen und wurden von buschigen, ebenfalls ergrauten Brauen überschattet.
„Sie müssen sich in der Adresse irren“, sagte er scharf. „Ich benötige keinen Teppich. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich habe noch zu arbeiten.“
„In dem Teppich befindet sich eine Leiche“, sagte Holmes und sah Ainstree offen an.
„Was sagen Sie?“
„Sie haben richtig verstanden, Dr. Ainstree. Die Leiche eines Mannes, der vor kurzer Zeit in unserer Wohnung starb. Ihr Kollege Dr. Watson, der mich begleitet, hält die Ursache für eine Tropenkrankheit, die ihm jedoch unbekannt ist. Möglicherweise besteht eine große Ansteckungsgefahr. Deshalb sind wir zu Ihnen gekommen.“
„Und wer sind Sie, Sir?“
„Mein Name ist Sherlock Holmes.“
Ainstree sann ein paar Sekunden nach, bis ein Ausdruck des Erkennens sein Gesicht überzog.
„Sherlock Holmes, ja, ich habe von Ihnen gehört. Auf Ihrem Gebiet sollen Sie ebenso befähigt sein wie ich auf dem meinen. Also gut, kommen Sie herein. Ich führe Sie in mein Labor, das in einem Anbau liegt.“
Holmes und ich nahmen den Teppich mit le Villards Leiche wieder auf und gingen ins Haus. Als Ainstree die Tür hinter uns schloss, kam das Mädchen und erkundigte sich besorgt, ob alles in Ordnung sei. Unser entschlossenes Auftreten hatte sie offenbar aufgebracht. Der Hausherr beruhigte sie und schickte sie an ihre Arbeit zurück.
Ich geriet ins Schwitzen, denn im Haus war es unangenehm warm. Menschen wie Ainstree, die einen großen Teil ihres Lebens in den Tropen verbracht haben, sind an das heiße Klima so gewöhnt, dass sie bei Temperaturen frieren, die ein normaler Europäer als ausreichend warm empfindet. Ich selbst hatte diese Erfahrung auch gemacht, als ich aus Afghanistan zurückkehrte. Da ich dort aber nur eine verhältnismäßig kurze Zeit gelebt hatte, war diese Erscheinung bei mir eine vorübergehende gewesen.
Die Inneneinrichtung ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass Ainstree in den fremden Ländern eine zweite Heimat gefunden hatte. Ausgestopfte exotische Vögel und Gebrauchsgegenstände fremder Völker und Kulturen schmückten in so großer Zahl die Wände, dass es schon überladen wirkte. Mannshohe Palmen, in große indische Tonkrüge eingepflanzt, säumten in regelmäßigen Abständen auf beiden Seiten den Korridor, durch den wir gingen. Unsere Schritte wurden durch einen reich gemusterten orientalischen Läufer gedämpft. Der Korridor endete vor einer schweren Eichenholztür, die Ainstree mit einem großen Schlüssel öffnete, den er aus seiner Westentasche zog.
„Das ist sozusagen mein Heiligtum“, erklärte der Spezialist für Tropenkrankheiten, „in dem ich meine Forschungen betreibe. Niemand hat hier Zutritt, wenn ich nicht dabei bin.“
Der große Raum erschien mir als eine ins Riesenhafte vergrößerte Ausgabe von Holmes’ Laborecke in unserem Wohnzimmer. Tische und Regale waren mit Reagenzgläsern, Retorten, Büretten, Messzylindern, Spritzflaschen, Tiegeln, Erlenmeyerkolben, Bechergläsern und dergleichen mehr geradezu übersät. Einige der Geräte waren zu komplizierten Versuchsaufbauten angeordnet, die wohl niemand außer Ainstree durchschauen konnte. Auf einem Regal standen Käfige mit Meerschweinchen, Ratten, Mäusen und südamerikanischen Kapuziner-Affen; vor jedem Käfig hing eine Tafel, die über alle wichtigen Daten des jeweiligen Versuches Auskunft gab. Drei geschlossene Türen führten in andere Räume. Die unangenehme Wirkung der großen Wärme wurde hier noch durch die strengen Gerüche der unzähligen Chemikalien verstärkt.
Ainstree, der bemerkt hatte, wie ich mich für die Versuchstiere interessierte, sagte: „Ich habe in einem anderen Raum noch mehr davon, ein regelrechter kleiner Zoo. Die Tiere sind für meine Arbeit unerlässlich. – Legen Sie Ihr Mitbringsel auf diesen Tisch.“
Wir ließen den Teppich zu Boden gleiten, und Holmes schnitt die Schnüre an den Enden mit seinem Taschenmesser auf. Der Anblick von le Villards Leiche verfehlte seine Wirkung auch auf Dr. Ainstree nicht.
„Das ist ja unglaublich!“, rief er aus.
Wir legten den Toten, von dem ein widerlicher süßlicher Geruch ausströmte, auf den von Ainstree bezeichneten Tisch.
„Kennen Sie die Krankheit, Doktor?“, fragte Holmes.
„Ich kenne ähnliche Symptome, aber keine, die diesen gleichen. Jedenfalls war es richtig, dass Sie zu mir gekommen sind. Wissen Sie, in welchen Breiten der Mann sich infiziert haben könnte?“
„Er war Franzose“, antwortete mein Freund, „und hat sich meines Wissens in letzter Zeit nur in Europa aufgehalten.“
„Die Inkubationszeit ist nur eines der Probleme, die wir lösen müssen“, sagte Ainstree. „Bezüglich der Ansteckungsgefahr lässt sich auch noch nichts sagen, da wir die Übertragungsweise der Erreger nicht kennen. Natürlich müssen wir alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sie beide werden gründlich desinfiziert, und Ihre Kleidung sowie die des Toten wird verbrannt.“
„Zuvor muss ich den Toten und seine Kleidung untersuchen“, entgegnete Holmes.
„Weshalb das?“, fragte Ainstree verdutzt.
„Sie tun Ihre Arbeit als Arzt, Dr. Ainstree, und ich meine als Detektiv.“
„Ich verstehe.“
„Watson, helfen Sie mir bitte, le Villard zu entkleiden.“
Wir nahmen dem Toten Hemd, Hose, Schuhe, Strümpfe und Leibwäsche ab. Rock, Mantel oder Hut hatte er nicht getragen. Wir fanden keinerlei Papiere oder persönliche Gegenstände.
„Der arme le Villard hat viel ertragen müssen“, schloss Holmes seine Untersuchung ab. „Er wurde seit mehreren Tagen in London gefangen gehalten, und erst heute Abend gelang ihm die Flucht, als er seine Fesseln mit den Scherben einer Petroleumlampe zerschneiden konnte, die er zu dem Zweck zerbrochen hatte. Die tiefen Hauteinschnitte an den Hand- und Fußgelenken stammen von den Fesseln und sind so eklatant, dass sie nur von einer mehrtägigen Gefangenschaft herrühren können. Als le Villard die Fesseln mit den Scherben durchtrennte, schnitt er sich mehrmals in die Hände, wie Sie an diesen frischen Wunden sehen. Dass die Scherben zu einer Petroleumlampe gehörten, riecht man. Der Ort, an dem er gefangen gehalten wurde, muss in London liegen, denn le Villard hat bei seinem Aussehen sicher kein Verkehrsmittel benutzt, um in die Baker Street zu kommen. Der Fußmarsch hat ihn seiner letzten Kräfte beraubt.“
„Hervorragend, Mr. Holmes“, lobte Ainstree. „Sie haben einen Blick für das Wesentliche. Schade, dass Sie Ihre Fähigkeiten nicht in den Dienst der Medizin gestellt haben.“
„Ich habe das in Erwägung gezogen, mich aber aus bestimmten Gründen anders entschieden. Grundkenntnisse in der Medizin sind mir bei meiner Tätigkeit von Nutzen, und für die vertrackteren Fälle habe ich Dr. Watson.“ Holmes hielt ein Büschel rotbrauner Haare hoch. „Ich brauche ein kleines Behältnis hierfür, Dr. Ainstree, und ein größeres für einen von le Villards Schuhen.“
„Was sind das für Haare?“, fragte ich.
„Sie hatten sich in le Villards Kleidern verfangen.“
Ainstree gab Holmes eine kleine Schachtel für die Haare.
„Den Schuh werde ich Ihnen einpacken, sobald er desinfiziert ist.“
„Bloß nicht!“, entgegnete mein Freund. „Nach einer Desinfektion wäre er nutzlos für mich. Ich brauche ihn so, wie er ist. Keine Angst, Doktor, ich werde sorgsam mit ihm umgehen und ihn wohl noch heute Nacht verbrennen.“
Ainstree fand einen passenden Kasten für den Schuh. Dann mussten Holmes und ich uns sämtlicher Kleider entledigen, weil Ainstree sie ins Feuer werfen wollte. Als wir im Adamskostüm dastanden, war mir die unnatürliche Wärme in Ainstrees Haus auf einmal sehr willkommen. Durch eine der Türen gelangten wir in eine Art Waschraum, dessen Wände, Decke und Boden mit weißen Kacheln ausgelegt waren. Dort rieben wir uns sehr gründlich mit Karbol und Alkohol ab und wuschen uns anschließend. Das Mädchen hatte inzwischen Kleider von Ainstree gebracht, die natürlich zu klein waren. Besonders der hochgewachsene Sherlock Holmes sah darin aus wie eine Vogelscheuche.
„Auch meine Sachen werden ein Opfer der reinigenden Flammen werden“, sagte Ainstree, vielleicht um uns zu trösten.
Holmes kritzelte etwas auf ein Stück Papier und sagte, es sei ein Telegramm, das sofort abgeschickt werden müsse. Ainstree gab es dem Mädchen, die es zum nächsten Telegrafenamt bringen sollte.
„Außerdem müssen Sie noch die Behörden informieren“, sagte Holmes. „Dr. Watson und ich haben jetzt viel zu tun. Auf bald und vielen Dank für die Hilfe!“
Wir fanden eine Droschke, die uns zurück in die Baker Street brachte. Unsere zu kurzen Kleider veranlassten den Fahrer zu erstaunten Blicken. Schon an der Haustür rochen wir das Desinfektionsmittel, mit dem Mrs. Hudson zu ungewohnter Zeit einen Hausputz durchgeführt hatte. Holmes sprach noch einmal mit ihr, um sich zu vergewissern, dass sie nichts übersehen hatte. In unserer Wohnung zog er sich schweigsam, wie er es auch in der Droschke gewesen war, in sein Zimmer zurück, wo er sich umzog. Ich tat es ihm gleich. Auf die Dauer waren Ainstrees Sachen zu eng. Als ich zurück ins Wohnzimmer kam, saß mein Freund bereits an seinem Labortisch und führte eine Untersuchung durch.
„Was haben Sie da, Holmes?“
„Die Haare natürlich“, sagte er und beugte sich über das Mikroskop. Seine schlanken Finger drehten an den Einstellrädern. Schon nach wenigen Minuten verkündete er das Ergebnis: „Die Haare stammen nicht von einem Menschen, Watson.“
„Schade“, sagte ich.
„Warum finden Sie das schade?“, fragte er irritiert.
„Die Suche nach einem rothaarigen Schurken wäre relativ einfach gewesen. So wissen wir nicht, was die Haare zu bedeuten haben.“
„Sie gehörten einem Säugetier, soviel lässt sich sagen.“
„Dann müssen wir also nach jemandem Ausschau halten, der ein Haustier mit rotbraunem Fell hat.“
Holmes sah von dem Mikroskop auf, und in seinem Gesicht drückte sich Überraschung aus. Er schnippte mit den Fingern und rief: „Bravo, Watson! Sie haben es erfasst. Manchmal sehe ich die Dinge wohl zu kompliziert, wo Ihre einfachen Gedankengänge angebrachter wären. Ein Haustier mit rotbraunem Fell, sehr gut!“ Abrupt sah er auf seine Uhr und murmelte: „Wo bleibt er bloß? Die Zeit drängt!“
„Auf wen warten Sie, Holmes?“
„Auf den Mann, dem mein Telegramm gegolten hat: Sherman.“
„Mr. Sherman aus der Pinchin Lane?“
„Richtig, Watson. Dies ist ein Fall für den unvergleichlichen Toby!“
2. Kapitel – Ein Fall für Toby
Toby war ein Hund, dessen ausgezeichneten Geruchssinn Sherlock Holmes höher einschätzte als die Fähigkeiten gewisser Herren von Scotland Yard. Er gehörte dem Tierhändler und -präparator Mr. Sherman aus Lambeth, der sich Holmes aufgrund einer Gefälligkeit verpflichtet fühlte, die der Detektiv ihm erwiesen hatte. Deshalb stand Toby meinem Freund zur Verfügung, wann immer er es wünschte. Vor kurzer Zeit erst hatte ich Tobys Vorzüge zu schätzen gelernt, als er uns bei der Aufklärung der rätselhaften Geschehnisse half, die sich um den Agraschatz rankten. Ein Fall, der mir auch aus persönlichen Gründen stets unvergesslich bleiben wird, hatte ich dabei doch die Bekanntschaft von Miss Mary Morstan gemacht, jener reizenden jungen Dame, die eingewilligt hatte, in Kürze Mrs. Watson zu werden. Ich habe die Affäre unter dem Titel Das Zeichen der Vier aufgezeichnet. Meine Tage in der Baker Street waren also gezählt, als ich mich mit Holmes aufmachte, den Tod des unglücklichen François le Villard aufzuklären.[4]
Keine fünf Minuten, nachdem mein Freund ungeduldig auf die Uhr gesehen hatte, stand Mr. Sherman in unserem Zimmer, das wegen der vorangegangenen Umräumaktion einen noch unordentlicheren Eindruck erweckte, als es normalerweise schon der Fall war. Er war ein schmächtiger, gebeugt gehender alter Mann, dessen Augen hinter dunklen Brillengläsern versteckt waren. Er lebte sehr zurückgezogen, und seine eigenbrötlerische Art ließ ihn zum Gespött der Kinder werden, was ihn wiederum für seine Mitmenschen nicht gerade aufgeschlossen machte. Als ich damals in jener Nacht das erste Mal bei ihm klopfte, um Toby abzuholen, wollte er seine gesamte Hundemeute auf mich hetzen. Erst die Erwähnung von Holmes’ Namen beruhigte ihn. An meinem Freund hatte er einen Narren gefressen.
Holmes begrüßte ihn erfreut. „Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als Störung, dass ich Sie mit Toby herbeordert habe, aber es ist wirklich eine wichtige Angelegenheit. Wo haben Sie Toby gelassen?“
„Vor der Haustür angebunden, Sir. Drinnen riecht’s so stark nach Karbol, dass ich Angst um Tobys Nase bekommen habe.“
„Gut gemacht, Sherman. Ich weiß noch nicht, für wie lange ich ihn benötige.“
„Er steht Ihnen zur Verfügung, solange Sie wollen.“
Sherman verabschiedete sich, und wir zogen unsere Mäntel an.
„Vergessen Sie Ihren Revolver nicht, Watson“, ermahnte mich Holmes. „Es könnte gefährlich werden!“
Ich nahm den Armeerevolver, der mir in Afghanistan gute Dienste geleistet hatte, aus der Schublade und überzeugte mich davon, dass in allen Kammern Patronen steckten. Dann schob ich ihn in die rechte Manteltasche. Holmes hatte seinen Revolver auch eingesteckt und nahm den Kasten mit le Villards Schuh auf. Wir gingen hinunter, und Toby begrüßte uns vor der Haustür mit lautem Gebell und heftigem Schwanzwedeln. Eine undefinierbare Mischung, zur Hälfte Spaniel und zur Hälfte Spürhund, war das langhaarige, schlappohrige Tier mit dem braun-weiß gefleckten Fell nicht gerade ein hübscher Anblick. Aber auf eine reine Rasse und auf einen erstklassigen Stammbaum kam es bei Toby nicht an, seine unübertroffene Qualität lag in seiner Nase. Holmes nahm ein Stück Zucker aus der Tasche und hielt es vor die Schnauze von Toby, der es ohne Zögern annahm. Damit war der Pakt besiegelt.
„Guter Toby“, sagte Holmes und streichelte den strubbeligen Nacken des Tieres. „Jetzt zeige uns, was in dir steckt!“
Er öffnete den Kasten und ließ Toby an der Schuhsohle schnüffeln.
„Es ist das Petroleum aus der Lampe, von der Sie sprachen, nicht wahr, Holmes?“, fragte ich. „Das rieche ich sogar.“
„So ist es, Watson. Und wenn sogar Sie es riechen, sollte für unseren Toby das Verfolgen der Spur keine Schwierigkeit darstellen. Als le Villard die Lampe zerschlug, um sich mit den Scherben zu befreien, ist das Petroleum ausgelaufen, und er ist in die Pfütze getreten.“
„Wenn wir den Ort auch finden, an dem er gefangen gehalten wurde, meinen Sie, seine Widersacher sind noch dort?“
„Das hängt davon ab, ob sie die Flucht bereits bemerkt haben. Deshalb haben wir es so eilig. Schauen Sie, Doktor, Toby hat die Witterung aufgenommen!“
Der Hund schnüffelte am Boden, bellte aufgeregt und zerrte an der Leine, die ihn an den Hauseingang fesselte.
„Warten Sie hier“, sagte mein Freund. „Ich bringe rasch den Schuh zurück nach oben und werfe ihn in den Kamin.“
Er nahm drei Stufen auf einmal, als er die Treppe hinaufsprang, und war in weniger als einer Minute wieder unten, um Toby loszubinden. Die Schnauze dicht am Boden, den Schwanz zum Ausgleich in die Höhe gestreckt, lief unser Spürhund los und zog dabei so kräftig an der Leine, dass Holmes beinahe das Gleichgewicht verloren hätte.
Während er Toby folgte, drehte er seinen Kopf zu mir herum und rief: „Kommen Sie, Watson! Das Spiel hat begonnen!“
Toby, Holmes und ich; in dieser Reihenfolge liefen wir in einem raschen Tempo durch die von Gaslaternen erleuchteten Straßen. Der Hund folgte unbeirrbar der Fährte und ließ sich auch von entgegenkommenden Fußgängern nicht davon abbringen. Sie mussten, manchmal in letzter Sekunde, zur Seite weichen, wenn sie nicht überrannt werden wollten. Zwei- oder dreimal rief man uns Schimpfworte hinterher. Es ging nach Osten, und wir überquerten die Marylebone High Street.
„Obgleich le Villard erschöpft war, hat er nicht immer den kürzesten Weg benutzt“, stellte ich fest. „Zumeist sind es Nebenstraßen, deren Beleuchtung häufig nicht die beste ist.“
„Er wollte mit seinen Entstellungen nicht gesehen werden“, erklärte Holmes. „Und er wollte zugleich eventuellen Verfolgern die Arbeit erschweren. Uns braucht das nicht zu stören, denn Tobys Nase ist die Beleuchtung gleichgültig.“
So streiften wir also durch das nächtliche London an jenem Februarabend, der so geruhsam begonnen hatte. Mit einem Schlag war alles weggewischt: die schlechte Aufführung im Oxford Theater, das geplante Essen bei Simpson’s und die Ruheperiode, die ich Sherlock Holmes verordnet hatte. Der große Detektiv war wieder auf der Jagd, und ich wusste, dass er nicht eher ruhen würde, bis er den grauenhaften Tod des Franzosen gerächt hatte.
Ich verstand, dass er diesen Fall als persönliche Herausforderung betrachtete. Aber noch lag so gut wie alles im Dunkeln, doch war es nicht nur das Dunkel der Unwissenheit, sondern ich meinte, den Schatten einer noch nie da gewesenen Bedrohung zu spüren, der seine Finger nach uns ausstreckte. Ich erinnerte mich an die Worte, die François le Villard mit letzter Kraft in der Baker Street gesprochen hatte: „Holmes ... große Gefahr ... nur Sie können helfen...“
Große Gefahr! Welcher Art war sie? Von wem ging sie aus? Wen bedrohte sie?
Wir brachten Meile um Meile hinter uns, durchquerten Bloomsbury und Holborn und kamen am St. Bartholomew’s Hospital vorbei. Hier hatte ich Sherlock Holmes kennengelernt an jenem schicksalsträchtigen Tag vor nunmehr sechs Jahren. Der gute Stamford, ein gemeinsamer Bekannter, der wusste, dass wir beide auf Zimmersuche waren, brachte uns zusammen, und kurz darauf bezogen wir unser neues gemeinsames Domizil in der Nr. 221 B der Baker Street.[5]
Das Hospital blieb hinter uns zurück, als wir Barbican erreichten. Zuweilen bog Toby in Einfahrten und Hinterhöfe ein, schnüffelte dort unschlüssig herum und nahm dann die alte Fährte wieder auf.
„Le Villard hat sich mehrmals versteckt, um herauszufinden, ob er verfolgt wurde“, sagte Holmes. „Er war ein guter Detektiv.“
Bei diesen Worten hatte ich den Eindruck, der Franzose sei für Holmes mehr als ein Kollege gewesen, so etwas wie ein Sohn, wenn diese Zuneigung meines Freundes – falls man das Gefühl so nennen kann – auch auf le Villards kriminalistischen Fähigkeiten basiert hatte.
Allmählich machte sich mein schlimmes Bein bemerkbar, in das im Krieg eine Jezail-Kugel gefahren war. Ich biss die Zähne zusammen, doch Holmes war es bereits aufgefallen.
„Sie haben Schmerzen im Bein“, stellte er fest. „Ich weiß, wie weh so eine alte Wunde tun kann. Möchten Sie lieber zurückbleiben, mein Freund?“
„Nicht um alles in der Welt, Holmes! Wenn wir das Versteck der Schurken, die den armen le Villard so schändlich misshandelt haben, aufspüren, dann Seite an Seite, soviel ist sicher.“
„Braver Watson! Als wir vorhin das St. Bartholomew’s Hospital passierten, dachte ich an den Tag zurück, an dem der alte Stamford Sie zu mir führte. Er wollte uns bloß gefällig sein und ahnte nicht, welchen unschätzbaren Dienst er mir damit erwies.“
„Auch ich habe eben daran gedacht“, sagte ich, gerührt über die Worte, die für den sonst so kalten Holmes eine Art Gefühlsausbruch darstellten.
Holmes’ unerwarteter Zuspruch war ein weiterer Grund für mich, das heftige Stechen in meinem Bein zu ignorieren. Wir erreichten die Liverpool Street, links von uns der Bahnhof. Gerade musste ein Zug angekommen sein, denn viele Menschen strömten heraus, durch die Toby sich hindurchwühlte wie ein Maulwurf durch einen Erdhaufen. Noch immer lief er geradewegs nach Osten.
„Unser Ziel kann nicht mehr allzu weit entfernt sein“, sagte der Detektiv, „sonst hätte le Villard es in seinem entkräfteten Zustand nicht bis in die Baker Street geschafft. Was ich zunächst nur vermutet habe, wird damit zur Gewissheit: Der Ort seiner Gefangenschaft liegt im East End.“
Holmes hatte recht, und ich war jetzt doppelt froh darüber, dass wir unsere Revolver mitgenommen hatten. Das East End war ein Sammelbecken für den Abschaum Londons. Ein zweifelhaftes Etablissement reihte sich dort an das andere: Spielklubs, Tanzlokale, Spelunken, Opiumhöhlen und was es an anrüchigen Vergnügungsstätten sonst noch gab. Nahe an der Themse gelegen, war das East End Umschlagplatz für Schmuggelware aller Art. Von den vielen kleinen Läden dort diente ein großer Teil gewieften Hehlern als Tarnfassade. Auf den Straßen wurde man von Dieben, Dirnen, Bettlern und Gassenjungs belästigt. In manche Gegenden wagten sich selbst Polizisten nur, wenn sie mindestens zu zweit waren. Für viele der Menschen, die dort hausten, war Mitleid angebracht, denn große Armut zwang sie zu ihren oft schändlichen Handlungen. Aber wenn man, besonders nachts, mittendrinsteckte, tat man am besten daran, auf seine eigene Haut achtzugeben.
Toby führte uns nach Spitalfields hinein. Vielleicht lag es an unserem entschlossen wirkenden Spürhund, dass wir verhältnismäßig selten belästigt wurden. Unser langer Marsch endete in einer engen Gasse an der Chicksand Street, deren Namen ich auf einem kaum mehr lesbaren Schild als Gibson Way entzifferte. Die zwei, drei Straßenlaternen, die hier verloren standen, verstärkten den düsteren Eindruck eher noch. Mich wunderte, dass Tobys empfindliche Nase bei all dem Schmutz und Unrat nicht rebellierte. Die Häuser befanden sich größtenteils in einem abbruchreifen Zustand. Vor einem zweistöckigen Gebäude, dessen ursprünglicher Anstrich längst nicht mehr zu erkennen war, hielt Toby endlich an, kläffte plötzlich los und sprang an einem Fenster hoch.
„Beruhige dich, Toby“, sagte Holmes und hielt ihm die Schnauze zu. „Du hast deine Sache gut gemacht, aber jetzt darfst du uns nicht verraten!“
Er gab dem Hund noch ein Stück Zucker. Toby sah ein, dass seine Arbeit erledigt war, und blieb ruhig, zufrieden damit, an unseren Händen herumzulecken. Ich zog meinen Revolver hervor und sah mich um, doch Tobys Gebell schien niemanden auf uns aufmerksam gemacht zu haben. Mein Freund untersuchte derweil das Fenster, das den Hund so erregt hatte.
„Petroleumspuren auf dem Fenstersims“, teilte er mir mit. „Man muss nicht Toby sein, um es wahrzunehmen. Hier ist le Villard herausgeklettert, und dieses Haus war sein Gefängnis.“
„Die Rollläden sind heruntergelassen, und man sieht nirgends Licht“, sagte ich. „Ob die Vögel bereits ausgeflogen sind?“
„Wäre gut möglich. Lassen Sie uns trotzdem vorsichtig sein, während wir das nachprüfen.“
Holmes stellte fest, dass die Haustür verschlossen war.
„Das ist in dieser Gegend auch ratsam“, meinte ich. „Vielleicht gibt es einen Hintereingang.“
„Nicht nötig“, sagte der Detektiv und zog einen Bund mit verschiedenen Nachschlüsseln aus der Manteltasche. „Ich habe vorgesorgt.“
Als Einbrecher hätte Holmes eine ebenso große Karriere gemacht wie als Detektiv. Welch ein Glück für die Wohlhabenden, dass er sich für diese Seite des Gesetzes entschied. Er benötigte keine halbe Minute, und die Holztür schwang knarrend zurück.
„Voilà!“, sagte er mit dem unterwürfigen Lächeln eines Türstehers. „Monsieur, entrez, s’il-vous-plaît!“
Ich nahm Toby an die kurze Leine, und wir traten ein. Auch Holmes hielt jetzt seinen Revolver in der Hand.
„Die können wir gut gebrauchen“, sagte Holmes und zeigte auf eine Blendlaterne, die auf einem kleinen Tisch stand; er befühlte sie mit der Hand. „Sie ist noch warm, wurde also vor Kurzem erst benutzt. Ich glaube nicht, dass wir hier noch jemanden finden.“
Er zündete die Laterne an, und wir sahen, dass wir in einem schmalen Gang standen, mit schmutzigem Fußboden und Tapeten, die in Fetzen von den Wänden hingen. Eine Treppe führte ins obere Stockwerk. Die Türen hier unten waren sämtlich geschlossen. Holmes öffnete die Tür zu dem Zimmer, durch dessen Fenster le Villard entkommen war. Es war ein Wohnzimmer, wenn auch in einem miserablen Zustand, spärlich mit uralten Möbelstücken ausgestattet. Hinweise auf irgendwelche Bewohner gab es nicht. Holmes ging zum Fenster und untersuchte es kurz.
„Es ist von innen verriegelt worden, Watson. Da das nach le Villards Flucht geschehen sein muss, können wir daraus schließen, dass sein Entkommen entdeckt wurde. Wahrscheinlich sind die Vögel ausgeflogen, wie Sie es ausdrückten. Nach der Flucht waren sie hier nicht länger sicher. Am Fensterrahmen kleben übrigens Blutspuren, die wohl von den Schnittwunden an le Villards Händen herrühren. Durchsuchen wir die übrigen Räume.“
Toby, der die Petroleumwitterung wieder aufgenommen hatte, beschnüffelte aufgeregt den Boden und ließ sich von mir nur mühsam beruhigen. Das andere Zimmer, das zur Straße hinausging, ähnelte dem ersten und war ebenfalls menschenleer. Zur Ausstattung gehörte hier noch ein Bett mit einem verbogenen Metallgestell. Das Bettzeug war zerwühlt, und Holmes stellte einen Rest von Körperwärme fest.
„Was haben wir denn hier? Ein Büschel rotbrauner Haare, das sich am Bettgestell verfangen hat. Ihr Haustier mit dem rotbraunen Fell war hier, Watson!“
Er steckte seinen Fund in eine kleine Schachtel und widmete sich dem übrigen Zimmer. Plötzlich richtete er den Lichtschein der Laterne auf eine bestimmte Stelle des Holzfußbodens.
„Schauen Sie sich das einmal an, Doktor! Der gesamte Boden ist von einer Staubschicht bedeckt, bis auf dieses Rechteck. Es misst drei Fuß und vier Zoll in der Länge und zweieinhalb Fuß in der Breite“, stellte Holmes fest und steckte sein Maßband wieder ein.
„Eine große Kiste“, vermutete ich.
„Oder ein Käfig für ein großes Tier.“
Als wir uns an die Durchsuchung der hinteren Räume machten, zog es Toby zu einer bestimmten Tür. Der Raum war kleiner als die vorderen, ein Stuhl und ein kleiner Tisch bildeten die wenigen Einrichtungsgegenstände. Das einzige Fenster führte zu einem mit Gerümpel übersäten Hinterhof hinaus, und fingerdicke Gitterstäbe verhinderten, dass jemand hindurchstieg. Starker Petroleumgeruch beleidigte unsere Nasen, und wir sahen auf dem Boden eine ölige Lache, Glasscherben und das Gehäuse einer zerbrochenen Lampe sowie zerschnittene Stricke und Blutflecken. Ich überlegte, wie lange dieser Ort le Villards Gefängnis gewesen sein mochte.
Nach einer Küche, in der wir einige Lebensmittelvorräte fanden, und einem noch schmutzigeren Waschraum gelangten wir in ein kleines Zimmer, das le Villards Gefängnis glich. Nur gab es hier zusätzlich ein Bett, das, wie das Bett in dem vorderen Raum, kürzlich benutzt worden war. Ich spürte etwas unter meinen Schuhen und hob einen zerschnittenen Strick auf.
„Gut gemacht, Watson“, lobte Holmes meinen Zufallstreffer. „Damit wissen wir, dass sich in diesem Raum ein weiterer Gefangener aufhielt, möglicherweise jener Professor Chalonge, von dem le Villard sprach. Bemerken Sie die schwarze Verfärbung an dem Strick? Sie scheint von Schuhcreme zu stammen. Als man le Villards Flucht bemerkte und das Haus überstürzt verließ, schnitt man dem zweiten Gefangenen die Fußfesseln durch, um ihn mitzunehmen. Mehr ist hier offenbar nicht zu entdecken. Gehen wir nach oben.“