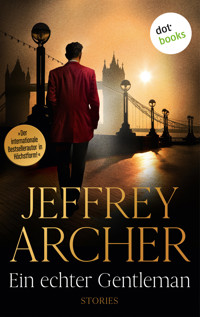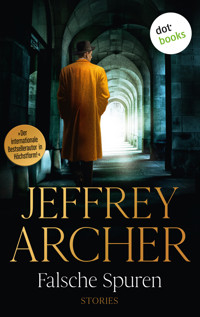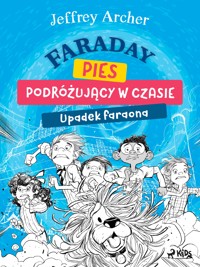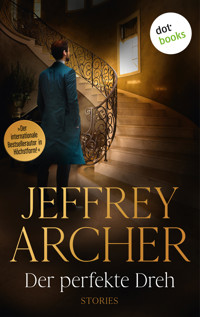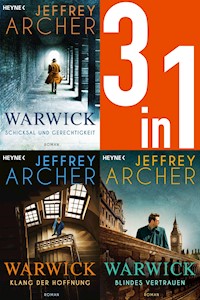
Die Warwick-Saga Band 1-3: Schicksal und Gerechtigkeit / Klang der Hoffnung / Blindes Vertrauen (3in1-Bundle) E-Book
Jeffrey Archer
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die ersten drei Romane der Warwick-Saga von Weltbestsellerautor Jeffrey Archer in einem Band
SCHICKSAL UND GERECHTIGKEIT
London 1979: William Warwick, Sohn des einflussreichen Anwalts Sir Julian, hat seit Kindheitstagen einen Traum: Er möchte sich den Weg vom Streifenpolizisten zum Commissioner erkämpfen. Im September 1982 tritt William Warwick seinen Dienst an. Aufgrund seiner Kenntnisse wird der Kunstliebhaber William zum Dezernat für Kunstfälschung versetzt und gerät in den Bannkreis eines der größten Gemäldefälscher seiner Zeit. Im Zuge der Recherchen lernt William die hübsche und schlagfertige Beth Rainsford kennen. Zwischen beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze und William fühlt, dass Beth die Frau seines Lebens ist. Doch ein Geheimnis umgibt sie und wirft Schatten auf die junge Liebe. William sieht sich vor die schwerste Aufgabe seines Lebens gestellt …
KLANG DER HOFFNUNG
Mittlerweile ist William zum Drogendezernat versetzt worden und muss erleben, dass die Drogenkriminalität auf Londons Straßen von höchsten Kreisen aus Macht und Politik regiert wird. Gleichzeitig genießt William seine junge Liebe zu Beth, während seine Schwester Grace als Anwältin Karriere macht. Doch bald schon ziehen düstere Schatten auf. Die Intrigen eines alten Feindes zwingen William dazu, um seine Karriere und Berufung zu kämpfen - und dann erhält er eine Nachricht, die sein und Beths Leben von Grund auf ändern wird ...
BLINDES VERTRAUEN
William Warwick hat es weit gebracht, seit er vor wenigen Jahren als einfacher Streifenbeamter seinen Dienst bei der Londoner Polizei antrat. Er ist stolzer Vater von Zwillingen, und bei der Jagd auf Kunstfälscher und Drogenbarone hat er sich als fähiger Ermittler erwiesen. Doch nun lauert Unrecht in den eigenen Reihen: Der junge Detective Jerry Summers wird der Bestechlichkeit verdächtigt. Williams Team ermittelt Undercover gegen die eigene Behörde – eine gefährliche Aufgabe, die höchstes Fingerspitzengefühl erfordert. Erst recht als sich eine von Williams Kolleginnen Hals über Kopf in Summers verliebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1392
Sammlungen
Ähnliche
Die Reihe
William Warwick hat seit Kindheitstagen einen Traum: In seinem Streben nach Gerechtigkeit möchte er die gesamte Karriereleiter des britischen Polizeiapparats durchlaufen – vom einfachen Streifenbeamten bis zum Commissioner der Londoner Polizei.
Die ersten drei Romane der Warwick-Saga von Weltbestsellerautor Jeffrey Archer in einem Band
Der Autor
Jeffrey Archer zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Welt. Seine Bücher sind in 97 Ländern erschienen und erreichen eine Gesamtauflage von 275 Millionen Exemplaren. Archer ist ein akribischer Arbeiter, der von einem einzigen Roman bis zu vierzehn Fassungen zu Papier bringt. Dabei schöpft er aus einem ungeheuren Erfahrungsschatz – seine bewegte Karriere in der Politik kommt ihm ebenso zugute wie seine Begeisterung für die Künste und sein langjähriges Netzwerk an Freunden mit außergewöhnlichen Biografien. Seit über fünfzig Jahren ist er mit Dame Mary Archer verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder. Archer lebt abwechselnd in London, Grantchester in Cambridge und auf Mallorca, wo die erste Fassung jedes seiner Romane entsteht.
Mehr Informationen zum Autor auf heyne.de/archer
Jeffrey Archer
WARWICK
Schicksal und Gerechtigkeit Klang der Hoffnung Blindes Vertrauen
Drei Romane in einem Band
Aus dem Englischen übersetzt von Martin Ruf
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright© by 2019, 2020, 2021 by Jeffrey Archer
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung t.mutzenbach design unter Verwendung folgender Motive:
Schicksal und Gerechtigkeit: © Trevillion Images (Ilona Wellmann, Stuart Brill), Shutterstock.com (55th)
Klang der Hoffnung: © Trevillion Images (Dorota Gorecka, CollaborationJS), Shutterstock.com (55th)
Blindes Vertrauen: © Trevillion Images (Laurence Winram, CollaborationJS), Shutterstock.com (Willy Barton, Ollyy, 55th)
Satz: KCFG–Medienagentur, Neuss
ISBN: 978-3-641-30480-5V001
www.heyne.de
Jeffrey Archer
WARWICK
Schicksal und Gerechtigkeit
Teil 1 der Warwick Saga
Für Commander William Hucklesby QPM
Dies ist keine Polizeigeschichte,
sondern eine Geschichte über einen Polizisten.
Lieber Leser,
nachdem ich den letzten Band der Clifton-Saga beendet hatte, schrieben mir mehrere Leser und meinten, dass sie gerne mehr über William Warwick erfahren würden, den Titelhelden der Romane von Harry Clifton.
Ich muss gestehen, dass ich über diese Idee bereits nachgedacht hatte, bevor ich schließlich an »Schicksal und Gerechtigkeit« zu arbeiten begann, dem ersten Band in der Reihe der Romane um William Warwick.
»Schicksal und Gerechtigkeit« beginnt, als William die Schule verlässt und zum großen Missfallen seines Vaters beschließt, der Metropolitan Police beizutreten, anstatt Anwalt wie sein Vater zu werden. William behauptet sich, und in diesem ersten Roman folgen wir ihm, wie er auf Streife geht und anderen Figuren begegnet, einige gut, die anderen nicht ganz so gut, während er versucht, Detective zu werden, um schließlich für Scotland Yard zu arbeiten.
Im Laufe der Reihe werden Sie die Abenteuer verfolgen, die William erlebt, während er seinen Weg vom Detective Constable zum Commissioner der Metropolitan Police macht.
Im Augenblick arbeite ich am zweiten Roman der Reihe, der Williams Zeit als junger Detective Sergeant in einer Eliteeinheit der Drogenfahndung behandelt.
Sollte er es jemals bis zum Commissioner bringen, hängt das genauso sehr von William Warwicks Entschlossenheit und seinen Fähigkeiten ab wie von der Tatsache, ob mir ein langes Leben geschenkt sein wird.
Jeffrey Archer
September 2019
1
14. Juli 1979
»Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Es gibt nichts, womit es mir jemals ernster gewesen wäre, wie du längst wissen könntest, wenn du mir in den letzten zehn Jahren auch nur ein einziges Mal zugehört hättest.«
»Aber man hat dir einen Platz an meinem alten College in Oxford angeboten. Du kannst Jura studieren, und wenn du deinen Abschluss hast, kannst du als Anwalt arbeiten, genau wie ich. Was könnte ein junger Mann denn noch verlangen?«
»Dass man es ihm überlässt, welchen Beruf er wählen will, und nicht von ihm erwartet, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt.«
»Wäre das denn so schlimm? Schließlich habe ich eine faszinierende Karriere, die vielerlei Nutzen bringt. Und ich darf sogar behaupten, dass ich bisher einigermaßen erfolgreich war.«
»Du warst sogar ganz außerordentlich erfolgreich, Vater, aber es geht hier nicht um deine berufliche Laufbahn, sondern um meine. Vielleicht möchte ich ja kein führender Barrister dieses Landes werden, der sein Leben damit verbringt, einen Haufen Kriminelle vor Gericht zu verteidigen, die er niemals zum Lunch in seinen Club einladen würde.«
»Du hast anscheinend vergessen, dass einige dieser Kriminellen deine Schule bezahlt und dir das Leben ermöglicht haben, das du im Augenblick führst.«
»So etwas kann ich unmöglich vergessen, Vater. Und genau deshalb will ich dafür sorgen, dass diese Kriminellen für lange Zeit hinter Gitter kommen. Ich will verhindern, dass sie sich nur deshalb, weil du als Anwalt so brillant bist, in Freiheit ein Leben aufbauen können, das auf nichts als Verbrechen gründet.«
William war es endlich gelungen, seinen Vater zum Schweigen zu bringen, doch nur für einen kurzen Augenblick.
»Vielleicht könnten wir uns auf einen Kompromiss einigen, mein Junge.«
»Ganz sicher nicht«, sagte William nachdrücklich. »Du hörst dich an wie ein Anwalt, der für eine geringere Strafe eintritt, weil er weiß, dass sein Fall auf wackligen Füßen steht. Doch in dieser Sache trifft deine Eloquenz auf taube Ohren.«
»Willst du mir nicht einmal gestatten, mein Plädoyer vorzutragen, bevor du es beiseitewischst?«, erwiderte Williams Vater.
»Nein, weil ich tatsächlich nicht schuldig im Sinne der Anklage bin. Und es gibt auch keine Geschworenen, denen du, nur weil es dir selbst Vergnügen macht, beweisen wirst, dass ich unschuldig bin.«
»Aber bist du möglicherweise bereit, etwas mir zuliebe zu tun, Liebling?«
Im Eifer des Gefechts hatte William fast vergessen, dass seine Mutter schon die ganze Zeit über am anderen Ende des Tisches saß und die Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vater genau verfolgt hatte. Es fiel ihm nicht schwer, es mit seinem Vater aufzunehmen, aber er wusste, dass er gegen seine Mutter keine Chance hatte. Er schwieg, und sein Vater nutzte dieses Schweigen.
»Woran haben Eure Lordschaft gedacht?«, fragte Sir Julian, indem er die Aufschläge seiner Jacke umfasste und sich an seine Frau wandte, als sei sie ein Richter am Obersten Gerichtshof.
»William soll das Recht haben, eine Universität seiner Wahl zu besuchen«, sagte Marjorie. »Er soll das Fach studieren, das er studieren möchte, und wenn er seinen Abschluss gemacht hat, soll er sich für den Beruf entscheiden, der ihm liegt. Und was noch wichtiger ist: Wenn er das tut, wirst du großmütig nachgeben und nie wieder auf das Thema zu sprechen kommen.«
»Ich muss gestehen«, sagte Sir Julian, »dass ich dein kluges Urteil akzeptiere, obwohl es mir schwerfällt.«
Mutter und Sohn brachen in Gelächter aus.
»Dürfte ich vielleicht auf eine Abmilderung der Bedingungen plädieren?«, fragte Sir Julian in unschuldigem Ton.
»Nein«, sagte William, »weil ich nur dann auf Mutters Vorschlag eingehen werde, wenn du in drei Jahren ohne Wenn und Aber meine Entscheidung, zur Metropolitan Police Force zu gehen, unterstützen wirst.«
Kronanwalt Baronet Sir Julian Warwick erhob sich von seinem Platz am Kopfende des Tisches, deutete seiner Frau gegenüber eine Verbeugung an und sagte widerstrebend: »Wenn das der Wunsch Eurer Lordschaft ist.«
William Warwick hatte seit seinem achten Lebensjahr Detective werden wollen; damals hatte er den »Fall der verschwundenen Mars-Riegel« gelöst. Das Papier war der Schlüssel, hatte er dem für seine Hausgruppe verantwortlichen Lehrer an seiner Schule erklärt. Man brauchte dazu nicht einmal ein Vergrößerungsglas.
Die Beweismittel – die Verpackungen der fraglichen Schokoriegel – waren im Papierkorb des Verdächtigen gefunden worden, und Adrian Meath, der unglücklicherweise ein Freund Williams gewesen war, hatte nicht nachweisen können, dass er in jenem Schuljahr überhaupt irgendetwas von seinem Taschengeld im nahe gelegenen Süßwarenladen ausgegeben hatte. Seine Mitschüler, die davon träumten, Ärzte, Anwälte, Lehrer und Buchhalter zu werden, hatten ihn zwar verspottet, doch der für die Berufsberatung zuständige Lehrer war nicht überrascht gewesen, als William ihm mitgeteilt hatte, dass er Detective werden wollte. Schließlich hatten ihm die anderen Jungen noch vor dem Ende des ersten Schuljahres den Spitznamen »Sherlock« gegeben.
Williams Vater, Barrister Sir Julian Warwick, wollte, dass sein Sohn in Oxford Jura studierte, genau wie er selbst es dreißig Jahre zuvor getan hatte. Doch trotz aller Bemühungen seines Vaters war William entschlossen, unmittelbar nach seinem Schulabschluss zur Polizei zu gehen. Die beiden Dickköpfe erreichten schließlich einen Kompromiss: William würde die London University besuchen und Kunstgeschichte studieren – sein Vater weigerte sich, dieses Fach ernst zu nehmen –, und sollte der Sohn nach drei Jahren noch immer Polizist werden wollen, so würde Sir Julian ohne zu murren einwilligen. William wusste jedoch, dass das nie geschehen würde.
William genoss die drei Jahre am King’s College in London, wo er sich mehrmals verliebte. Zuerst in Hannah und Rembrandt, dann in Judy und Turner und danach in Rachel und Hockney. Am Ende jedoch fiel seine Wahl auf Caravaggio, eine Affäre, die sein ganzes Leben lang bestehen sollte, obwohl sein Vater ihn darauf hinwies, dass der große italienische Künstler ein Mörder war, den man hätte hängen sollen. Ein gutes Argument für die Abschaffung der Todesstrafe, hatte William gemeint. Wieder einmal waren Vater und Sohn nicht einer Meinung.
Nachdem William die Schule beendet hatte, war er im Sommer nach Rom, Paris, Berlin und sogar St. Petersburg gefahren, wo er sich in die langen Warteschlangen anderer Kunstbegeisterter einreihte, die den Meistern der Vergangenheit die Ehre erweisen wollten. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, fragte ihn sein Professor, ob er nicht über die dunklere Seite Caravaggios promovieren wolle. Genau diese dunklere Seite, erwiderte William, wolle er erforschen, doch dabei habe er die Absicht, mehr über Kriminelle des zwanzigsten Jahrhunderts zu erfahren und weniger über die des sechzehnten.
Am Sonntag, dem fünften September 1982, um fünf Minuten vor drei Uhr nachmittags, meldete sich William im Hendon Police College in North London. Von dem Moment an, in dem er den Treueeid auf die Königin ablegte, bis zur Abschlussparade sechzehn Wochen später genoss er fast jede Minute seines Ausbildungskurses.
Am Tag darauf erhielt er eine Uniform aus marineblauer Serge, einen Helm und einen Schlagstock; jedes Mal, wenn er an einem Schaufenster vorbeikam, konnte er nicht widerstehen, einen Blick auf sein Spiegelbild zu werfen. Eine Uniform, warnte ihn sein Kommandant am ersten Tag seiner Ausbildung, konnte den Charakter eines Menschen verändern, und das nicht immer zum Besseren.
Der Unterricht in Hendon hatte am zweiten Tag begonnen und fand teils in Schulungsräumen, teils in der Sporthalle statt. William lernte ganze Abschnitte von Gesetzestexten auswendig, sodass er sie wortwörtlich wiederholen konnte. Forensische Untersuchungen und Tatortanalysen lagen ihm ganz besonders, auch wenn er schnell herausfinden sollte, dass seine Fähigkeiten allenfalls rudimentär waren, als man ihn im Umgang mit Polizeifahrzeugen schulte.
Nachdem er sich jahrelang hitzige Debatten mit seinem Vater am Frühstückstisch geliefert hatte, fiel es ihm leicht, von seinen Vorgesetzten ins Kreuzfeuer genommen zu werden, als er in einer fingierten Gerichtsverhandlung in den Zeugenstand treten musste. Und er behauptete sich sogar im Selbstverteidigungsunterricht, wo er lernte, wie man einen viel größeren Gegner entwaffnete, ihm Handschellen anlegte und mit Gewalt festhielt. Ebenso unterrichtete man ihn in den Rechten eines Constables im Hinblick auf Festnahmen, Durchsuchungen und das Betreten einer Wohnung sowie im Hinblick auf den Gebrauch angemessener Gewalt. Und vor allem brachte man ihm das Wichtigste bei: Diskretion. »Sie sollten sich nicht immer an Ihr Lehrbuch halten«, empfahl ihm sein Ausbilder. »Manchmal sollten Sie Ihren gesunden Menschenverstand benutzen, der, wie Sie noch herausfinden werden, wenn Sie mit der Öffentlichkeit zu tun haben, nicht allzu verbreitet ist.«
Es gab genauso viele Prüfungen wie während seiner Zeit an der Universität, und er war nicht überrascht, dass einige Kandidaten auf der Stecke blieben, bevor der Kurs zu Ende war.
Nach einer schier endlosen Pause von zwei Wochen nach seiner Abschlussparade erhielt William einen Brief, der ihn aufforderte, sich am folgenden Montag um acht Uhr vormittags im Polizeirevier Brixton zu melden. In dieser Gegend Londons war er noch nie zuvor gewesen.
Police Constable 565LD besaß zwar einen Universitätsabschluss, als er in die Metropolitan Police Force eingetreten war, doch er hatte beschlossen, auf die für Hochschulabsolventen vorgesehenen rascheren Beförderungsmöglichkeiten zu verzichten, denn er wollte seinen Dienst auf gleicher Ebene wie seine Kollegen beginnen. Er war bereit, als Anfänger im Polizeidienst wenigstens zwei Jahre lang Streife zu gehen, bevor er darauf hoffen konnte, Detective zu werden, und konnte es in Wahrheit gar nicht abwarten, ganz unten anzufangen.
Von seinem ersten Tag als Polizist an wurde William von seinem Mentor Constable Fred Yates angeleitet, der achtundzwanzig Jahre Polizeidienst auf dem Rücken und vom zuständigen Inspector die Anweisung erhalten hatte, »sich um den Jungen zu kümmern«. Beide Männer hatten kaum etwas gemeinsam bis auf die Tatsache, dass sie schon in frühester Jugend Polizisten werden wollten und der Vater des einen wie des anderen alles in seiner Macht Stehende getan hatte, seinen Sohn von dessen angestrebtem Beruf abzubringen.
»ABC«, war das Erste, was Fred sagte, als ihm der junge Mann vorgestellt wurde, der noch grün hinter den Ohren war. Er wartete nicht ab, bis William nach der Bedeutung fragte.
»Akzeptiere nichts. Besser, du glaubst niemandem. Check erst, ob’s auch stimmt. Das ist die einzige Regel, an die ich mich halte.«
Während der nächsten Monate führte Fred William in die Welt der Einbrecher, Drogendealer und Zuhälter ein – und er konfrontierte ihn mit dessen erster Leiche. Mit dem Eifer eines Sir Galahad wollte William jeden, der sich ein Vergehen zuschulden kommen ließ, hinter Gitter bringen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Fred war da realistischer, aber er versuchte kein einziges Mal, das Feuer von Williams jugendlichem Enthusiasmus zu löschen. Der Neuling im Dienst fand schnell heraus, dass die Menschen nicht wissen können, ob ein Polizist erst ein paar Tage oder schon seit Jahren bei der Truppe ist.
»Es wird Zeit, dass du deinen ersten Wagen anhältst«, sagte Fred und blieb bei einer Reihe von Ampeln stehen. »Wir bleiben hier, bis jemand ein rotes Licht überfährt, und dann gehst du auf die Straße und winkst ihn raus.« William wirkte besorgt. »Überlass mir den Rest. Siehst du den Baum dort drüben, etwa dreihundert Meter entfernt? Versteck dich dahinter und warte, bis ich dir ein Zeichen gebe.«
William konnte hören, wie sein Herz hämmerte, als er hinter den Baum trat. Er musste nicht lange warten, bis Fred rief: »Der blaue Hillman! Schnapp ihn dir!«
William trat auf die Straße und wies den Fahrer mit erhobenem Arm an, an den Straßenrand zu fahren.
»Sag nichts«, forderte Fred seinen jungen Kollegen auf, als er neben ihn trat. »Pass auf und sieh genau zu.« Sie gingen zum Wagen, während der Fahrer das Fenster herunterkurbelte.
»Guten Morgen, Sir«, sagte Fred. »Ist Ihnen bewusst, dass Sie gerade eine rote Ampel überfahren haben?«
Der Mann nickte stumm.
»Könnte ich Ihren Führerschein sehen?«
Der Mann öffnete das Handschuhfach, nahm seinen Führerschein heraus und reichte ihn Fred. Nachdem Fred den Führerschein eine Weile lang gemustert hatte, sagte er: »Um diese Zeit am Vormittag ist das besonders gefährlich, Sir, denn hier in der Nähe gibt es zwei Schulen.«
»Es tut mir leid«, sagte der Mann. »Es wird nicht wieder vorkommen.«
Fred gab ihm den Führerschein zurück. »Diesmal werde ich Sie nur verwarnen«, sagte er, während William die Autonummer des Mannes in sein Notizbuch eintrug. »Aber vielleicht könnten Sie in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein.«
»Danke, Officer«, sagte der Mann.
»Warum nur eine Verwarnung?«, fragte William, als der Wagen langsam davonfuhr. »Sie hätten ihm einen Strafzettel verpassen können.«
»Einstellungssache«, erklärte Fred. »Der Herr war höflich, hat seinen Fehler eingesehen und sich entschuldigt. Warum sollte ich einem ansonsten gesetzestreuen Bürger den Tag verderben?«
»Und wann hätten Sie ihm einen Strafzettel verpasst?«
»Wenn er gesagt hätte: ›Haben Sie denn nichts Besseres zu tun, Officer?‹ Oder, schlimmer noch: ›Sollten Sie nicht ein paar richtige Kriminelle verhaften?‹ Oder meine Lieblingsantwort: ›Ist Ihnen klar, dass ich Ihr Gehalt bezahle?‹ Wenn eine dieser Reaktionen gekommen wäre, hätte ich ihm ohne zu zögern einen Strafzettel verpasst. Tatsächlich gab es da mal einen Typen, den ich aufs Revier schaffen und für ein paar Stunden hinter Gitter bringen musste.«
»Ist er gewalttätig geworden?«
»Nein, viel schlimmer. Er sagte zu mir, er sei ein Freund des Commissioners und ich würde von ihm hören. Also habe ich ihm erklärt, er könne ihn vom Telefon im Revier aus anrufen.« William musste laut lachen. »Genau«, sagte Fred. »Und jetzt verschwinde wieder hinter deinem Baum. Beim nächsten Mal führst du das Gespräch, und ich schaue zu.«
Kronanwalt Sir Julian Warwick saß am einen Ende des Tisches und hatte seinen Kopf in den Daily Telegraph vergraben. Gelegentlich gab er ein »Tss-tss-tss« von sich, während seine Frau, die am anderen Tischende saß, ihren täglichen Kampf mit dem Kreuzworträtsel der Times zu Ende brachte. An guten Tagen schaffte Marjorie die letzte Frage, bevor ihr Mann nach Lincoln’s Inn aufbrach. An schlechten musste sie seinen Rat in Anspruch nehmen – einen Dienst, für den er üblicherweise einhundert Pfund pro Stunde verlangte. Regelmäßig erinnerte er sie daran, dass sie ihm bisher über 20.000 Pfund schuldete.
Sir Julian hatte den Leitartikel erreicht, während sich seine Frau mit der letzten Frage abmühte. Er war immer noch nicht davon überzeugt, dass die Abschaffung der Todesstrafe sinnvoll war, besonders in Fällen, in denen ein Polizist oder ein Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes das Opfer war, und der Telegraph sah die Sache genauso. Sir Julian wandte sich der letzten Seite zu und erfuhr, wie der Blackheath Rugby Club beim jährlichen Derby der beiden Mannschaften gegen Richmond gespielt hatte. Nachdem er den Spielbericht gelesen hatte, ignorierte er die übrigen Sportseiten, denn er fand, dass die Zeitung Fußball viel zu viel Platz einräumte. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Nation vor die Hunde ging.
»In der Times ist ein hübsches Bild von Charles und Diana«, sagte Marjorie.
»Das hält nie«, sagte Sir Julian, stand auf und ging zum anderen Ende des Tisches, wo er wie jeden Morgen seine Frau auf die Stirn küsste. Dann tauschten sie die Zeitungen aus, damit er auf seiner Zugfahrt nach London die Gerichtsreportagen lesen konnte.
»Vergiss nicht, dass die Kinder am Sonntag zum Lunch kommen«, erinnerte ihn Marjorie.
»Hat William inzwischen seine Prüfung zum Detective gemacht?«, fragte er.
»Wie du sehr wohl weißt, Liebling, geht das erst, wenn er seine zwei Jahre Streifendienst abgeschlossen hat, und das dauert mindestens noch weitere sechs Monate.«
»Wenn er auf mich gehört hätte, wäre er jetzt Anwalt.«
»Und wenn du auf ihn gehört hättest, wüsstest du, dass ihm viel mehr daran liegt, Kriminelle hinter Gitter zu bringen, als eine Möglichkeit zu finden, wie sie in Freiheit bleiben können.«
»Ich habe noch nicht aufgegeben«, sagte Sir Julian.
»Dann sei wenigstens dankbar dafür, dass unsere Tochter in deine Fußstapfen tritt.«
»Grace tut nichts dergleichen«, schnaubte Sir Julian. »Dieses Mädchen verteidigt jeden hoffnungslosen Fall, der ihr über den Weg läuft, auch wenn der Betreffende keinen Penny in der Tasche hat.«
»Sie hat ein Herz aus Gold.«
»Dann kommt sie ganz nach dir«, sagte Sir Julian und las die letzte Frage, die seine Frau noch nicht beantwortet hatte: Schlanker Gefreiter, der einen Stab bekam. Vier Buchstaben.
»Feldmarschall SLIM«, sagte Sir Julian triumphierend. »Der einzige Mann, der jemals als einfacher Gefreiter in der Armee begonnen und sie bei seiner Verabschiedung als Feldmarschall verlassen hat.«
»Hört sich nach William an«, sagte Marjorie. Aber erst, nachdem sich die Tür geschlossen hatte.
2
William und Fred verließen das Revier kurz nach acht, um ihre morgendliche Runde zu beginnen. »Um diese Tageszeit gibt es nicht allzu viele Verbrechen«, versicherte Fred seinem jungen Kollegen. »Kriminelle sind wie die Reichen. Sie stehen nur selten vor zehn Uhr auf.« Während der zurückliegenden achtzehn Monate hatte sich William an Freds oft wiederholte Perlen der Weisheit gewöhnt; sie hatten sich als weitaus wichtiger erwiesen als irgendetwas, das im Met-Handbuch über die Pflichten eines Polizeibeamten stand.
»Wann ist deine Prüfung zum Detective?«, fragte Fred, als sie entspannten Schrittes dem Lambeth Walk folgten.
»Erst in einem Jahr«, sagte William. »Aber ich glaube nicht, dass du mich so schnell loswerden wirst«, fügte er hinzu, als sie sich dem lokalen Zeitungshändler näherten. Er warf einen Blick auf die Schlagzeile eines der Blätter: »Police Constable Yvonne Fletcher vor libyscher Botschaft umgebracht«.
»Es sollte wohl eher ›ermordet‹ heißen«, sagte Fred. »Armes Ding.« Er schwieg lange. »Ich war mein ganzes Leben lang Constable«, fuhr er schließlich fort. »Für mich ist das ganz in Ordnung. Aber für dich …«
»Wenn ich es schaffe«, sagte William, »habe ich das dir zu verdanken.«
»Ich bin nicht wie du, Chorknabe«, sagte Fred. William fürchtete, der Spitzname würde ihm für den Rest seines Lebens bleiben. »Sherlock« wäre ihm lieber gewesen. Er hatte seinen Kollegen auf dem Revier niemals davon erzählt, dass er als Schüler tatsächlich im Kirchenchor gesungen und sich immer gewünscht hatte, älter auszusehen, obwohl seine Mutter zu ihm gesagt hatte: »Kaum dass es so weit ist, wirst du dir wünschen, jünger auszusehen.« Gibt es irgendjemanden, der jemals mit seinem Alter zufrieden ist?, fragte er sich. »Wenn du Commissioner bist«, fuhr Fred fort, werde ich im Altersheim sein, und du wirst meinen Namen vergessen haben.«
William hatte sich noch nie darüber Gedanken gemacht, ob er eines Tages Commissioner sein würde, aber er war sich schon jetzt sicher, dass er Constable Fred Yates nie vergessen würde.
Fred sah den Jungen, als er aus dem Laden des Zeitungshändlers stürmte. Schon einen Augenblick später erschien Mr. Patel, doch er würde den Jungen niemals einholen. William nahm die Verfolgung auf, und Fred folgte ihm mit nur zwei Schritten Abstand. Beide überholten Mr. Patel, als der Junge um die nächste Straßenecke bog, aber es dauerte weitere einhundert Meter, bis William ihn zu fassen bekam. Die beiden Polizisten führten den Jungen zurück in den Laden, wo er Mr. Patel ein Päckchen Capstan zurückgab.
»Möchten Sie Anzeige erstatten?«, fragte William, der Notizbuch und Bleistift bereits in der Hand hatte.
»Welchen Sinn hätte das?«, fragte der Ladenbesitzer, während er die Zigarettenpackung zurück ins Regal stellte. »Wenn Sie ihn einsperren, wird sein jüngerer Bruder an seine Stelle treten.«
»Heute ist dein Glückstag, Tomkins«, sagte Fred und gab ihm eine Ohrfeige. »Wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen, solltest du in der Schule sein. Wenn nicht, müsste ich deinem alten Herrn vielleicht erzählen, was du hier vorhattest. Wahrscheinlich«, fügte er hinzu, indem er sich an William wandte, »waren die Zigaretten für seinen Vater.«
Tomkins rannte davon. Als er das Ende der Straße erreicht hatte, blieb er stehen, drehte sich um und schrie: »Polizeiabschaum!« Dazu machte er das Victory-Zeichen.
»Vielleicht hättest du seine Ohren irgendwo festmachen sollen.«
»Was soll das denn heißen?«, fragte Fred.
»Wenn im sechzehnten Jahrhundert ein Junge beim Stehlen erwischt wurde, nagelte man ihn mit einem seiner Ohren an einen Pfahl, und es gab nur eine Möglichkeit, wie er wieder freikam: Er musste sich losreißen.«
»Keine schlechte Idee«, sagte Fred. »Ich muss zugeben, dass ich mich nie an das moderne Auftreten der Polizei gewöhnen werde. Wenn du in Pension gehst, wirst du die Kriminellen wahrscheinlich mit ›Sir‹ ansprechen müssen. Aber sei’s drum. Ich habe nur noch achtzehn Monate, bevor der Dienst für mich zu Ende ist, und bis dahin bist du bei Scotland Yard. Als ich vor fast dreißig Jahren zur Polizei kam«, fuhr er fort, um die tägliche Ration seiner Weisheiten zu verkünden, »haben wir solche Typen mit Handschellen an die Heizung gefesselt, das Ding voll aufgedreht und sie erst wieder gehen lassen, nachdem sie ein Geständnis unterschrieben hatten.«
William lachte.
»Das war kein Witz«, sagte Fred.
»Was meinst du, wie lange wird es wohl dauern, bis Tomkins im Gefängnis landet?«
»Bevor er endgültig einfährt, wird er wahrscheinlich erst noch eine gewisse Zeit in einer Besserungsanstalt verbringen. Was einen wirklich verrückt machen kann, ist die Tatsache, dass er dann seine eigene Zelle und drei Mahlzeiten am Tag bekommen wird, während er von Berufsverbrechern umgeben ist, die ihn nur allzu gerne in ihr Metier einführen werden, bevor er an der Universität des Verbrechens seinen Abschluss machen wird.«
Jeden Tag gab es Dinge, die William daran erinnerten, wie viel Glück er gehabt hatte, in eine Familie der gehobenen Mittelschicht hineingeboren zu werden, mit liebevollen Eltern und einer älteren Schwester, die geradezu vernarrt in ihn war. Obwohl er gegenüber seinen Kollegen natürlich niemals erwähnte, dass er eine der führenden Privatschulen Englands besucht und dann einen Abschluss in Kunstgeschichte am King’s College in London gemacht hatte. Und ebenso wenig sprach er darüber, dass sein Vater regelmäßig üppige Honorare von einigen der berüchtigtsten Kriminellen des Landes erhielt.
Während sie ihre Runde fortsetzten, trafen sie immer wieder Menschen, die Fred grüßten, und einige sagten sogar »Guten Morgen« zu William.
Als sie ein paar Stunden später aufs Revier zurückkehrten, verzichtete Fred darauf, den jungen Tomkins dem diensthabenden Sergeant zu melden, denn gegenüber dem Papierkram hatte er dieselbe Einstellung wie gegenüber dem modernen Auftreten der Polizei.
»Wie wär’s jetzt mit ’ner Tasse Tee?«, fragte Fred und wandte sich in Richtung Kantine.
»Warwick!«, rief eine Stimme hinter ihm.
William drehte sich um und sah, wie der diensthabende Sergeant mit einem Umschlag in der Hand auf ihn deutete. »Ein Gefangener ist in seiner Zelle zusammengebrochen. Bringen Sie dieses Rezept in die nächste Apotheke, und lassen Sie sich das Medikament aushändigen. Und beeilen Sie sich.«
»Ja, Sarge«, sagte William. Er nahm den Umschlag und rannte zum nächsten Boots in der High Street, wo er sah, dass eine kleine Gruppe Kunden geduldig am Ausgabeschalter wartete. Er entschuldigte sich bei der älteren Dame an der Spitze der Schlange und reichte der Apothekerin den Umschlag.
Die junge Frau öffnete den Umschlag und las die Anweisungen sorgfältig. Dann sagte sie: »Das macht dann ein Pfund sechzig, Constable.«
William kramte in seiner Tasche nach etwas Kleingeld und gab es ihr. Die Apothekerin legte das Geld in die Kasse, drehte sich um, nahm eine Schachtel Kondome aus dem Regal hinter sich und reichte sie ihm. Williams Mund klappte auf, doch es kam kein Wort heraus. Verlegen wurde er sich bewusst, wie mehrere Kunden in der Schlange grinsten. Er wollte gerade so schnell wie möglich aus der Apotheke verschwinden, als die junge Frau sagte: »Vergessen Sie Ihr Rezept nicht, Constable«, und ihm den Umschlag zurückgab.
Mehrere amüsierte Blicke folgten ihm, als er wieder auf die Straße trat. Er wartete, bis er außer Sichtweite war, bevor er den Umschlag öffnete und die Notiz darin las.
Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame,
ich bin ein schüchterner junger Constable, der es endlich geschafft hat, dass ein Mädchen mit ihm ausgeht, und ich hoffe, heute Nacht bei der Dame Erfolg zu haben. Aber ich möchte nicht, dass sie schwanger wird. Können Sie mir helfen?
William musste laut lachen. Er steckte die Schachtel Kondome in die Tasche und machte sich auf den Weg zurück aufs Revier. Sein erster Gedanke war: Ich wünschte, ich hätte eine Freundin.
3
Constable Warwick schraubte die Kappe wieder auf seinen Füllfederhalter. Er war sich sicher, dass er die Prüfung zum Detective mit, wie sein Vater das nannte, fliegenden Fahnen bestanden hatte.
Als er an jenem Abend in sein Zimmer im Trenchard House zurückkehrte, waren diese Fahnen auf halbmast gesunken, und als er seine Nachttischlampe ausschaltete, war er sicher, dass er mindestens noch ein Jahr seine jetzige Uniform tragen und auf Streife gehen würde.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte der diensthabende Beamte, als William sich am nächsten Morgen wieder zum Dienst meldete.
»Ich hab’s hoffnungslos vermurkst«, antwortete William und warf einen Blick in das Dienstbuch. Er und Fred waren zur Streife in Barton Estate eingeteilt, und sei es auch nur, um die Kriminellen vor Ort daran zu erinnern, dass in London immer noch ein paar Bobbys ihre Runden drehten.
»Dann werden Sie es nächstes Jahr eben wieder versuchen«, sagte der Sergeant, der nicht gewillt war, sich vom trübsinnigen Ton des jungen Mannes anstecken zu lassen. Wenn Constable Warwick sich in Selbstzweifeln suhlen wollte, so hatte sein Vorgesetzter nicht die Absicht, den jungen Mann da rauszuholen.
Sir Julian fuhr fort, das Tranchiermesser zu wetzen, bis er davon überzeugt war, dass Blut fließen würde. »Eine oder zwei Scheiben, mein Junge?«, fragte er.
»Zwei bitte, Vater.«
Mit dem Geschick eines erfahrenen Tranchierers schnitt Sir Julian den Braten an.
»Und, hast du deine Prüfung zum Detective bestanden?«, fragte er William, indem er ihm den Teller reichte.
»Das werde ich erst in ein paar Wochen wissen«, antwortete William, während er die Schale mit dem Rosenkohl an seine Mutter weitergab. »Aber ich bin nicht besonders optimistisch. Du wirst jedoch erfreut sein zu hören, dass ich im Finale der Billard-Meisterschaft unseres Reviers stehe.«
»Wirst du gewinnen?«, fragte sein Vater.
»Unwahrscheinlich. Mein Gegner ist der Favorit, der während der letzten sechs Jahre den Pokal geholt hat.«
»Das heißt also, du bist durch deine Prüfung zum Detective gefallen und stehst kurz davor, Zweiter im …«
»Ich habe mich immer gefragt, warum das, was in anderen Ländern ›Rosenkohl‹ heißt, bei uns Brussels sprouts genannt wird. Was hat das denn mit Brüssel zu tun? Es gibt ja auch keine Brüsseler Karotten oder Brüsseler Kartoffeln bei uns«, sagte Marjorie, womit sie versuchte, ein weiteres Duell zwischen Vater und Sohn zu verhindern.
»Anfangs hießen sie tatsächlich so wie die Stadt Brüssel – Brussels sprouts«, erklärte Grace. »Über die Jahre hinweg jedoch wurde aus dem großen ›B‹ ein kleines ›b‹, und dann verschwand das ›s‹, und heute glaubt jeder, dass ›brussel‹ ein richtiges Wort ist. Außer natürlich den Pedantischeren unter uns.«
»Wozu immerhin das Oxford English Dictionary zählt«, sagte Marjorie und lächelte ihre Tochter an.
»Und wenn du doch bestanden hast«, sagte Sir Julian, der sich weigerte, sich von der Etymologie englischen Rosenkohls aus dem Konzept bringen zu lassen, »wie lange wird es dann dauern, bis du wirklich Detective bist?«
»Sechs Monate, möglicherweise auch ein Jahr. Ich muss abwarten, bis sich in irgendeinem Revier eine freie Stelle ergibt.«
»Vielleicht solltest du ja direkt zu Scotland Yard gehen«, sagte sein Vater und hob eine Augenbraue.
»Das geht nicht. Ich muss mich in einem anderen Revier beweisen, bevor man mich auch nur zur Bewerbung um eine Stelle beim Heiligen Gral zulassen würde. Obwohl ich morgen zum ersten Mal im Yard sein werde.«
Sir Julian hielt mit dem Tranchieren des Bratens inne. »Warum?«
»Das weiß ich selbst nicht«, gestand William. »Der Superintendent hat mich am Freitag zu sich rufen lassen und mir mitgeteilt, dass ich mich am Montagmorgen um neun bei einem gewissen Commander Hawksby zu melden habe, aber er hat keinen Grund dafür genannt.«
»Hawksby … Hawksby …«, sagte Sir Julian, während die Falten auf seiner Stirn immer tiefer wurden. »Warum kommt mir dieser Name nur so bekannt vor? Ah ja, ich weiß. Bei einem Betrugsfall haben wir einmal die Klingen gekreuzt, als er noch Chief Inspector war. Ein beeindruckender Zeuge. Er hatte seine Hausaufgaben gemacht und war so gut vorbereitet, dass für mich einfach nichts rausgesprungen ist bei ihm. Er ist jemand, den man nicht unterschätzen sollte.«
»Erzähl mir mehr«, sagte William.
»Er ist ungewöhnlich klein für einen Polizisten. Vor denen sollte man sich hüten. Meistens haben sie mehr im Kopf als die anderen. Man kennt ihn auch als ›the Hawk‹, den Falken. Zuerst schwebt er über einem, und dann lässt er sich plötzlich im Sturzflug nach unten fallen und jagt den Leuten seine Krallen in den Leib.«
»Einschließlich dir, wie es scheint«, sagte Marjorie.
»Wie kommst du darauf?«, fragte Sir Julian, während er sich ein Glas Wein einschenkte.
»Du erinnerst dich immer nur an die Zeugen, die sich von dir nicht haben unterkriegen lassen.«
»Touché«, sagte Sir Julian und lächelte seine Frau an, während Grace und William in spontanen Beifall ausbrachen.
»Grüße Commander Hawksby bitte von mir«, sagte Sir Julian, wobei er die Gefühlsbekundungen seiner Kinder ignorierte.
»Das werde ich ganz sicher nicht tun«, sagte William. »Ich habe vor, einen guten Eindruck zu hinterlassen, und nicht, mir einen Feind fürs Leben zu machen.«
»Ist mein Ruf denn so schlecht?«, fragte Sir Julian mit einem gequälten Seufzer, der einem abgewiesenen Liebhaber alle Ehre gemacht hätte.
»Ich fürchte, dein Ruf ist so gut«, antwortete William. »Die bloße Erwähnung deines Namens führt in meinem Revier jedes Mal zu einem verzweifelten Aufstöhnen angesichts der Erkenntnis, dass schon wieder ein Krimineller auf freien Fuß gesetzt werden muss, obwohl er es verdient hätte, sein Leben hinter Gittern zu verbringen.«
»Wer bin ich denn, dass ich mich dem Urteil von zwölf guten und aufrichtigen Männern widersetzen würde?«
»Es mag dir noch nicht aufgefallen sein, Dad«, sagte Grace, »aber seit 1920 sitzen in diesem Land auch Frauen auf den Bänken der Geschworenen.«
»Was umso schlimmer ist«, sagte Sir Julian. »Wenn es nach mir ginge, hätte man ihnen nie das Wahlrecht gewährt.«
»Diesen Köder solltest du ignorieren, Grace«, sagte ihre Mutter. »Er will dich nur provozieren.«
»Was ist der nächste hoffnungslose Fall, für den du dich einsetzen wirst?«, fragte Sir Julian seine Tochter, als wolle er das Messer noch tiefer in die Wunde drücken.
»Das Recht auf das Erbe von Adelstiteln«, sagte Grace und nahm einen Schluck von ihrem Wein.
»Wessen Recht im Besonderen, wenn ich fragen darf?«
»Mein Recht. Du magst zwar Baronet Sir Julian Warwick sein, aber wenn du stirbst …«
»Was hoffentlich noch lange nicht der Fall sein wird«, sagte Marjorie.
»Wird William deinen Titel erben«, beendete Grace ihren Satz, indem sie den Einwurf ignorierte. »Obwohl ich die Erstgeborene bin.«
»Welch schändliche Lage der Dinge«, spottete Sir Julian.
»Das ist nicht zum Lachen, Dad. Und außerdem prophezeie ich, dass das Gesetz noch zu deinen Lebzeiten geändert werden wird.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lordschaften deinen Vorschlag so einfach gutheißen werden.«
»Weil ihnen die alte Regelung unmittelbar zugutekommt. Denn wenn das Unterhaus begriffen hat, dass damit Wählerstimmen zu holen sind, wird eine weitere heilige Festung unter dem Gewicht ihrer eigenen Absurdität zusammenbrechen.«
»Wie willst du dabei vorgehen?«, fragte Marjorie.
»Wir fangen ganz oben an, mit der königlichen Familie. Wir haben bereits einen Peer, der bereit ist, im Parlament einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Erstgeburtsrechts einzubringen, der es einer Frau erlauben würde, Monarchin zu werden, sofern sie die Erstgeborene ist, ohne dass ein jüngerer Bruder sie ins Abseits drängen könnte. Niemand hat je behauptet, Prinzessin Anne wäre nicht in der Lage, dieser Aufgabe ebenso gerecht zu werden wie Prinz Charles. Und wir werden Königin Elizabeth die Erste, Königin Victoria und Königin Elizabeth die Zweite als Beispiele für unsere Sache heranziehen.«
»Dazu wird es nie kommen.«
»Noch zu deinen Lebzeiten«, wiederholte Grace.
»Aber ich dachte, du hältst grundsätzlich nichts von Titeln, Grace«, sagte William.
»Allerdings. Aber in diesem Fall geht es ums Prinzip.«
»Nun, ich werde dich unterstützen. Ich wollte ohnehin nie ›Sir William‹ sein.«
»Aber was ist, wenn du dir diesen Titel selbst erwerben würdest?«, fragte sein Vater. William zögerte so lange, bis sein Vater schließlich mit den Schultern zuckte.
»Ist diese arme Frau, die du letzte Woche verteidigt hast, freigekommen?«, fragte Marjorie Grace, in der Hoffnung, einer weiteren Auseinandersetzung vorzubeugen.
»Nein. Sie hat sechs Monate bekommen.«
»Und ist in drei Monaten wieder draußen«, sagte ihr Vater. »Woraufhin sie zweifellos sofort wieder auf der Straße zu finden sein wird.«
»Bei diesem Thema solltest du dich lieber nicht mit mir anlegen, Dad.«
»Was ist mit ihrem Zuhälter?«, fragte William. »Er ist doch derjenige, der hinter Schloss und Riegel gehört.«
»Ihn würde ich liebend gerne in Öl kochen«, sagte Grace. »Aber er wurde nicht einmal angeklagt.«
»Wir warten immer noch darauf, dass du endlich die Konservativen wählst«, sagte ihr Vater.
»Niemals«, erwiderte Grace.
Sir Julian griff nach dem Tranchiermesser. »Möchte irgendjemand Nachschlag?«
»Darf ich fragen, ob du in letzter Zeit jemanden kennengelernt hast?«, fragte Marjorie, indem sie sich an ihren Sohn wandte.
»Ja, sogar mehrere Menschen«, sagte William, der sich über den Euphemismus seiner Mutter amüsierte.
»Du weißt genau, was ich meine«, sagte sie vorwurfsvoll.
»Wie sollte das denn gehen? Letzten Monat hatte ich Nachtschicht, jeweils sieben Nächte am Stück. Am letzten Tag war meine Schicht morgens um sechs Uhr zu Ende. Zu dem Zeitpunkt wollte ich nur noch schlafen. Und zwei Tage später musste ich mich wieder zur Frühschicht melden. Machen wir uns nichts vor, Mum, Police Constable Warwick ist nicht gerade das, was man eine besonders gute Partie nennen würde.«
»Hättest du meinen Rat beherzigt«, sagte sein Vater, »dann wärst du jetzt ein begehrter Barrister, und ich muss dir sagen, dass es mehrere attraktive junge Frauen in den Anwaltsbüros gibt.«
»Ich habe jemanden kennengelernt«, sagte Grace, was ihren Vater zum ersten Mal zum Schweigen brachte. Er legte sein Besteck nieder und hörte aufmerksam zu.
»Sie ist Solicitor in der City, aber ich fürchte, Dad wäre nicht gerade überzeugt von ihr, da sie sich auf Scheidungen spezialisiert hat.«
»Ich bin ganz gespannt darauf, sie kennenzulernen«, sagte Marjorie.
»Wann immer du möchtest, Mutter. Aber ich muss dich warnen. Ich habe ihr nicht gesagt, wer mein Vater ist.«
»Bin ich etwa eine Kreuzung zwischen Rasputin und Judge Jeffreys?«, fragte Sir Julian und richtete die Spitze des Tranchiermessers auf sein Herz.
»So nett bist du nicht«, sagte seine Frau. »Aber manchmal kannst du ganz nützlich sein.«
»Nenn mir eine Gelegenheit«, sagte Grace.
»Im Kreuzworträtsel gestern gab es eine Frage, die mich immer noch verwirrt.«
»Ich stehe für eine Konsultation zur Verfügung«, sagte Sir Julian.
»Da ist noch eine Menge Arbeit in so einer Familie, dreizehn Buchstaben. Der dritte Buchstabe ist ein ›s‹, der zehnte ein ›o‹.«
»Dysfunktional!«, riefen die anderen drei gleichzeitig und lachten.
»Möchte irgendjemand Obstkuchen?«, fragte Sir Julian.
William hatte seinem Vater zwar gesagt, dass er wohl kaum gewinnen würde, aber jetzt hatte er den Sieg so gut wie in der Tasche – oder besser gesagt: die letzte Kugel im Eckloch. Er würde die letzte Kugel vom Tisch fegen, die Lambeth-Billard-Meisterschaft gewinnen und im siebten Jahr der Siegesserie von Fred Yates ein Ende bereiten.
Darin lag eine gewisse Ironie, dachte William, denn es war Fred gewesen, der ihm das Spiel beigebracht hatte. William hätte es nicht einmal gewagt, das Billardzimmer zu betreten, wenn Fred ihm gegenüber nicht angedeutet hätte, dass es ihm helfen könnte, einige der Kollegen kennenzulernen, die bisher noch nicht wussten, was sie von dem Chorknaben halten sollten.
Fred hatte dem jungen Mann mit genauso viel Eifer das Billardspiel beigebracht, wie er ihm zeigte, wie er seine Runden im Viertel zu drehen hatte, und jetzt würde William seinen Mentor zum ersten Mal auf dessen eigenem Gebiet schlagen.
In der Schule war William im Winter ein ausgezeichneter Rugbyspieler auf der Außendreiviertelposition gewesen und im Sommer ein exzellenter Sprinter auf der Aschenbahn. In seinem letzten Jahr auf der London University hatte man ihm die begehrte Siegestrophäe verliehen, nachdem er die College-Meisterschaften gewonnen hatte. Sogar sein Vater rang sich ein schiefes Lächeln ab, als sein Sohn nach einem Einhundert-Yard-Rennen das Band auf der Ziellinie zerriss, obwohl William vermutete, dass »re-rack«, »maximum break« und »in off« nicht zu seinem Vokabular gehörten.
William warf einen Blick auf die Punkteanzeige. Drei Durchgänge insgesamt, und vom letzten Spiel hing alles ab. Er hatte recht gut mit einem Break von 42 angefangen, doch Fred hatte sich Zeit gelassen und Williams Vorsprung immer weiter verringert, bis schließlich alles möglich war. Obwohl William noch immer mit 26 Punkten führte, waren jetzt alle Farben an den passenden Stellen, sodass Fred, als er wieder an den Tisch trat, nichts weiter tun musste, als die letzten sieben Kugeln einzulochen, um erneut die Trophäe zu gewinnen.
Im Raum im Untergeschoss drängten sich Polizeibeamte aller Ränge. Einige hockten auf den Heizungen, andere saßen auf den Treppenstufen. Schweigen senkte sich über die versammelten Männer, als Fred sich über den Tisch beugte und die gelbe Kugel ins Visier nahm. William begann sich damit abzufinden, dass er seine Chance verspielt hatte, der neue Champion zu werden, denn er musste mit ansehen, wie Gelb, Grün, Braun und Blau in den Löchern verschwanden. Fred musste nur noch die rosafarbene und die schwarze Kugel vom Tisch stoßen, um das Spiel zu gewinnen.
Fred fixierte die rosafarbene Kugel, bevor er die weiße auf den Weg schickte. Doch er hatte diese etwas zu heftig getroffen, und obwohl die rosafarbene Kugel auf das Seitenloch zuschoss und darin verschwand, blieb die weiße direkt an der Bande liegen. In dieser Position war sie sogar für einen Profi schwer zu spielen. Die Zuschauer hielten den Atem an, als Fred sich vorbeugte. Er ließ sich Zeit damit, die letzte Kugel ins Visier zu nehmen. Sollte er sie versenken, würde ihm das einen Vorsprung von 73 zu 72 bringen, wodurch er der erste Spieler wäre, der den Titel sieben Jahre in Folge gewonnen hätte.
Sichtlich nervös richtete er sich auf, rieb die Spitze seines Queues noch einmal mit Kreide ein und versuchte, seine Ruhe wiederzufinden, bevor er erneut an den Tisch trat. Dann beugte er sich nach vorn, spreizte die Finger, konzentrierte sich und versetzte der weißen Kugel einen Stoß. Unruhig sah er zu, wie die schwarze Kugel auf das Eckloch zurollte. Mehrere seiner Anhänger versuchten, sie gleichsam mit der bloßen Kraft ihrer Gedanken auf den richtigen Weg zu lenken, doch zu ihrer Enttäuschung blieb sie wenige Zentimeter vor dem Loch liegen. Ein Stöhnen der Verzweiflung erhob sich unter den Zuschauern, die erkannten, dass William nur noch einen Stoß zu machen brauchte, mit dem auch ein Anfänger die Kugel hätte einlochen können, und sie bereiteten sich darauf vor, dass ein neuer Name auf der Ehrentafel eingetragen werden würde.
Der Herausforderer holte tief Luft und sah dann selbst auf die Ehrentafel, auf der Freds Name in den Jahren 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 und 1982 in Goldbuchstaben stand. Aber nicht 1983, dachte William und rieb die Spitze seines Queues mit Kreide ein. Er fühlte sich, wie Steve Davis sich wenige Augenblicke vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft gefühlt haben mochte.
William wollte gerade die schwarze Kugel versenken, als er sah, dass Fred resigniert und niedergeschlagen am anderen Ende des Tisches stand.
William beugte sich über den Tisch, fixierte die beiden Kugeln und versetzte der weißen einen perfekten Stoß. Er sah zu, wie die schwarze Kugel die Kante der Bandenöffnung streifte, gefährlich nahe vor dem Loch hin und her schwankte, aber auf geradezu provozierende Art auf der Lochkante liegen blieb und sich weigerte, in die Tiefe zu fallen. Die benommenen Zuschauer schnappten ungläubig nach Luft. Der Junge hatte dem Druck nicht standgehalten.
Fred verstand es, seine zweite Chance zu nutzen, und die Zuschauer brachen in lauten Jubel aus, als er das Spiel und damit die Meisterschaft schließlich mit 73 zu 72 Punkten gewann.
Die beiden Männer gaben einander die Hand, während mehrere Kollegen zu ihnen traten, ihnen auf die Schulter klopften und »Gut gemacht«, »Hätte nicht knapper sein können« und »Wirklich Pech, William« sagten. William trat zur Seite, als der Superintendent Fred den Pokal überreichte, den der Champion unter noch lauterem Jubel als zuvor hoch in die Luft hob.
Ein schon etwas älterer Mann, der einen eleganten Zweireiher trug und den keiner der beiden Spieler bemerkt hatte, zog sich unauffällig aus dem Billardzimmer zurück, verließ das Gebäude und bat seinen Fahrer, ihn nach Hause zu bringen.
Alles, was ihm über den jungen Mann gesagt worden war, hatte sich als wahr herausgestellt. Er konnte es gar nicht erwarten, Constable Warwick in sein Team bei Scotland Yard aufzunehmen.
4
Als Constable Warwick aus der U-Bahn-Station St. James’s Park trat, war das Erste, was ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite auffiel, das sich drehende dreieckige Zeichen von New Scotland Yard. Voller Ehrfurcht betrachtete er das Gebäude. Etwa so mochte sich ein aufstrebender Schauspieler fühlen, der zum ersten Mal das National Theatre sieht, oder ein Künstler, der zum ersten Mal in den Innenhof der Royal Academy tritt. Er zog den Kragen hoch, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen, und schloss sich dem Strom seiner Mitmenschen an, die sich frühmorgens auf den Weg zur Arbeit machten.
William überquerte den Broadway und ging dann direkt auf das Hauptquartier der Metropolitan Police Force zu, ein neunzehnstöckiges Gebäude, an dem nicht nur die Zeit, sondern, so mochte man fast glauben, auch das Verbrechen selbst seine Spuren hinterlassen hatte. Er zeigte dem Polizisten an der Tür seine Dienstmarke und ging weiter zum Empfangstresen. Eine junge Frau lächelte ihn an.
»Mein Name ist Constable Warwick. Ich habe einen Termin bei Commander Hawksby.«
Sie fuhr mit dem Finger über eine Liste mit den offiziellen Besprechungen.
»Ah ja. Das Büro des Commanders befindet sich im fünften Stock, am anderen Ende des Flurs.«
William bedankte sich und ging auf die Aufzüge zu, doch als er sah, wie viele Menschen dort warteten, beschloss er, die Treppe zu nehmen. Er betrat den ersten Stock, DROGEN, passierte im zweiten die Abteilung für BETRUG, sah im dritten diejenige für MORD und erreichte schließlich den fünften Stock, wo ihn GELDWÄSCHE, KUNST UND ANTIQUITÄTEN erwarteten.
Er schob eine Tür auf, die ihn in einen langen, strahlend hell erleuchteten Flur führte. Dann ging er langsam weiter, denn er war sich bewusst, dass ihm immer noch ein wenig Zeit blieb: Besser ein paar Minuten zu früh als eine Minute zu spät, lautete das Evangelium nach St. Julian zu diesem Thema. In jedem Raum, an dem er vorbeikam, brannte Licht. Der Kampf gegen das Verbrechen kannte keine Pausen. Eine Tür stand halb offen, und William hielt den Atem an, als er ein Gemälde sah, das dort an einer der Wände lehnte.
Zwei junge Männer und eine junge Frau betrachteten das Bild sorgfältig.
»Gut gemacht, Jackie«, sagte der ältere Mann mit ausgeprägt schottischem Akzent. »Ein persönlicher Triumph.«
»Danke, Chef«, erwiderte sie.
»Hoffen wir«, sagte der jüngere Mann, »dass das Faulkner für wenigstens sechs Jahre hinter Gitter bringt. Weiß Gott, wir haben lange genug gebraucht, um diesen Bastard festzunageln.«
»Sehe ich auch so«, sagte der ältere. Er wandte sich um und sah, dass William in der Tür stand. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er in scharfem Ton.
»Nein, danke, Sir.«
»Solange du noch ein Constable bist, solltest du besser alles, was sich bewegt, ›Sir‹ nennen. Dann kannst du nicht viel falsch machen«, hatte Fred ihn gewarnt. »Ich habe nur das Bild bewundert.« Der ältere Mann wollte eben die Tür schließen, als William hinzufügte: »Ich habe das Original gesehen.«
Nun wandten sich auch die Frau und der jüngere Mann dem Eindringling zu, um sich ihn genauer anzusehen.
»Das ist das Original«, sagte die junge Frau. Sie klang verärgert.
»Das ist nicht möglich«, erwiderte William.
»Was macht Sie da so sicher?«, wollte ihr Kollege wissen.
»Das Original hing im Fitzmolean Museum in Kensington, bis es vor einigen Jahren gestohlen wurde. Ein Verbrechen, das man bis heute noch nicht aufgeklärt hat.«
»Wir haben es soeben aufgeklärt«, sagte die Frau entschieden.
»Das glaube ich nicht«, entgegnete William. »Das Original wurde von Rembrandt in der rechten unteren Ecke mit seinen Initialen RvR signiert.«
Die drei Polizisten warfen einen Blick auf die rechte untere Ecke der Leinwand, aber dort befanden sich keine Initialen.
»Tim Knox, der Direktor des Fitzmolean, wird in wenigen Minuten zu uns stoßen, mein Junge«, sagte der ältere Mann. »Ich denke, ich werde mich eher auf sein Urteil verlassen als auf das Ihrige.«
»Gewiss, Sir«, sagte William.
»Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie viel dieses Bild wert ist?«, fragte die junge Frau.
William ging in das Zimmer, um sich das Gemälde genauer anzusehen. Er hielt es für klüger, der jungen Frau gegenüber Oscar Wildes Bemerkung über den Unterschied von Preis und Wert unerwähnt zu lassen.
»Ich bin kein Experte, aber ich würde schätzen, irgendetwas zwischen zwei- und dreitausend Pfund.«
»Und das Original?«, fragte die junge Frau, die inzwischen nicht mehr ganz so sicher klang.
»Keine Ahnung, aber jede bedeutende Galerie auf der Welt würde ein solches Meisterwerk nur zu gerne ihrer Sammlung hinzufügen, ganz zu schweigen von mehreren führenden Privatsammlern, für die Geld keine Rolle spielt.«
»Dann können Sie also überhaupt nichts zu seinem Wert sagen?«, fragte der junge Beamte.
»Nein, Sir. Einen Rembrandt von dieser Qualität findet man nur selten auf dem freien Markt. Sotheby Parke Bernet in New York haben den letzten unter den Hammer gebracht.«
»Wir wissen, wo Sotheby Parke Bernet ihren Sitz haben«, sagte der ältere Mann. Er unternahm keinen Versuch, seinen Sarkasmus zu verbergen.
»Dann wissen Sie sicher auch, dass der Käufer für dreiundzwanzig Millionen Dollar den Zuschlag erhielt«, sagte William, doch er bereute seine Worte sofort.
»Wir alle sind Ihnen dankbar für Ihre Einschätzung, aber wir wollen Sie nicht länger aufhalten«, sagte der Mann und nickte in Richtung Tür.
William versuchte, sich so elegant wie möglich zurückzuziehen, doch als er auf den Flur trat, hörte er nichts weiter, als dass die Tür energisch hinter ihm geschlossen wurde. Er sah auf seine Uhr. Es war drei Minuten vor acht, und er eilte den Flur hinab, denn er wollte nicht zu spät zu seinem Termin kommen.
Er klopfte an die Tür, auf der in Goldbuchstaben »Commander Jack Hawksby« stand. Hinter seinen Namen waren die Buchstaben »OBE« angefügt, was William verriet, dass der Polizist Träger eines hohen britischen Verdienstordens war. Er trat ein und sah sich einer Sekretärin gegenüber, die hinter einem Schreibtisch saß. Sie hörte auf zu tippen, sah auf und fragte: »Police Constable Warwick?«
»Ja«, sagte William nervös.
»Der Commander erwartet Sie. Gehen Sie einfach durch«, sagte sie und deutete auf eine weitere Tür.
Wieder klopfte William an, und diesmal wartete er, bis er das Wort »Herein!« hörte.
Ein elegant gekleideter Mann mittleren Alters mit durchdringenden blauen Augen und Stirnfalten, die ihn älter aussehen ließen, als er war, erhob sich hinter seinem Schreibtisch. Hawksby schüttelte Williams ausgestreckte Hand, deutete auf einen Stuhl und setzte sich wieder. Er schlug eine Akte auf und musterte sie für einige Augenblicke, bevor er sprach. »Zuerst würde ich Sie gerne fragen, ob Sie zufällig mit Kronanwalt Sir Julian Warwick verwandt sind.«
Williams Herz sank. »Er ist mein Vater«, sagte er und nahm an, dass das Gespräch damit ein abruptes Ende finden würde.
»Ein Mann, den ich sehr bewundere«, sagte Hawksby. »Er bricht nie die Regeln, beugt nie das Gesetz, und trotzdem verteidigt er die dubiosesten Scharlatane, als seien sie Heilige. Ich glaube nicht, dass ich in seinem Gewerbe vielen Menschen seiner Art begegnet bin.« William lachte nervös.
»Ich wollte Sie persönlich kennenlernen«, fuhr Hawksby fort, der offensichtlich niemand war, der viel Zeit mit Smalltalk verschwendete, »denn Sie haben Ihre Prüfung zum Detective nicht nur als Bester, sondern überdies mit weitem Abstand zu Ihren Mitbewerbern bestanden.«
William wusste nicht einmal, dass er bestanden hatte.
»Herzlichen Glückwunsch«, fügte der Commander hinzu. »Ebenso ist mir aufgefallen, dass Sie über einen Universitätsabschluss verfügen und dennoch auf eine schnellere Beförderungsmöglichkeit, wie wir sie solchen Mitarbeitern bieten, verzichtet haben.«
»Das stimmt, Sir. Ich wollte …«
»Sie wollten sich beweisen. Genau wie ich damals. Nun, Warwick, wie Sie wissen, wird man Sie in ein anderes Revier versetzen, wenn Sie die Möglichkeit bekommen sollen, als Detective zu arbeiten. In Anbetracht dieses Umstandes habe ich beschlossen, Sie nach Peckham zu schicken, wo man Ihnen alles Notwendige beibringen wird. Wenn Sie etwas taugen, sehen wir uns in ein paar Jahren wieder, und dann werde ich entscheiden, ob Sie bereit sind, zu uns zu Scotland Yard zu kommen, um es mit unseren ganz besonderen Kriminellen aufzunehmen, oder ob Sie besser noch ein wenig draußen in einem der Reviere bleiben, um noch ein wenig mehr zu lernen.«
William gestattete sich ein Lächeln und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Doch bereits Hawksbys nächste Frage ließ ihn wieder hochschrecken.
»Sind Sie wirklich sicher, dass Sie Detective werden wollen?«
»Ja, Sir. Ich war es schon mit acht.«
»Wir haben es hier nicht mit Kriminellen zu tun, wie Sie sie aus der Welt Ihres Vaters kennen, sondern mit dem übelsten Abschaum. Man wird von Ihnen erwarten, dass Sie mit allem zurechtkommen, vom Selbstmord einer jungen Mutter, die es nicht mehr erträgt, von ihrem Partner misshandelt zu werden, bis zum Auffinden eines jungen Drogensüchtigen, dem die Nadel noch im Arm steckt und der nicht viel älter ist als Sie. Offen gestanden, werden Sie nachts nicht schlafen können, und man wird Ihnen weniger bezahlen als einem Filialleiter bei Tesco.«
»Sie hören sich an wie mein Vater, und er hat es nicht geschafft, mich davon abzubringen.«
Der Commander erhob sich. »Dann soll es wohl so sein, Warwick. Ich sehe Sie in zwei Jahren.« Wieder gaben sie einander die Hand. Das obligatorische Gespräch war beendet.
»Danke, Sir«, sagte William. Nachdem er die Tür leise hinter sich geschlossen hatte, hätte er am liebsten einen Luftsprung gemacht und »Halleluja« gerufen, doch dann sah er drei Gestalten im Vorzimmer des Büros stehen. Sie wirkten, als erwarteten sie ihn.
»Name und Rang?«, sagte der ältere Mann, dem er zuvor bereits begegnet war.
»Warwick, Sir. Constable William Warwick.«
»Sorgen Sie dafür, dass sich Constable Warwick nicht von der Stelle rührt, Sergeant«, sagte er zu der jungen Frau. Dann klopfte er an die Tür des Commanders und trat ein.
»Guten Morgen, Bruce«, sagte Hawksby. »Wie ich höre, steht ihr kurz davor, Miles Faulkner zu verhaften. Nicht einen Augenblick zu früh.«
»Ich fürchte, nicht, Sir. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Sie sprechen wollte«, war alles, was William hören konnte, bevor sich die Tür schloss.
»Wer ist er?«, fragte William die junge Frau.
»Detective Chief Inspector Lamont. Er ist Leiter der Abteilung Kunst und Antiquitäten und untersteht Commander Hawksby direkt.«
»Arbeiten Sie auch für die Kunstabteilung?«
»Ja. Ich bin Detective Sergeant Roycroft, und der Chief ist mein unmittelbarer Vorgesetzter.«
»Stecke ich in Schwierigkeiten?«
»Bis zum Hals, Constable. Sagen wir einfach, ich bin froh, nicht an Ihrer Stelle zu sein.«
»Aber ich habe doch nur versucht, zu helfen.«
»Und mit Ihrer Hilfe haben Sie es geschafft, eine sechsmonatige Undercover-Operation an die Wand zu fahren.«
»Wie denn nur?«
»Vermutlich werden Sie das gleich selbst herausfinden«, sagte DS Roycroft, als die Tür aufschwang und Detective Chief Inspector Lamont wieder erschien. Er starrte William grimmig an.
»Kommen Sie rein, Warwick«, sagte er. »Der Commander möchte noch einmal mit Ihnen sprechen.«
Zögernd betrat William Hawksbys Büro. Er nahm an, dass man ihn wieder auf Streife schicken würde. Der Commander lächelte nicht mehr, sondern musterte ihn mit düsterem Blick.
»Sie machen nichts als Ärger, Warwick«, sagte er. »Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie nicht nach Peckham gehen werden.«
5
»Dein letzter Tag in Uniform«, sagte Fred, als sie das Polizeirevier verließen und ihre abendliche Runde antraten.
»Es sei denn, ich bin doch nicht zum Detective gemacht«, erwiderte William. »Dann werde ich in kürzester Zeit wieder auf Streife gehen.«
»Schwachsinn. Jeder weiß, dass du dir einen Namen machen wirst.«
»Das habe ich ausschließlich dir zu verdanken, Fred. Du hast mir mehr über die wirkliche Welt beigebracht, als ich jemals auf der Universität gelernt habe.«
»Was einzig und allein daran liegt, dass du zuvor so ein behütetes Leben geführt hast, Chorknabe. Ganz im Gegensatz zu mir. Also, in welche Einheit wirst du denn kommen?«
»Kunst und Antiquitäten.«
»Ich dachte immer, das sei nur ein Hobby für Leute mit zu viel Freizeit und zu viel Geld, aber kein Verbrechen.«
»Für jemanden, der einen Weg um das Gesetz herum gefunden hat, kann es sogar ein sehr lukratives Verbrechen sein.«
»Klär mich auf.«
»Zurzeit läuft eine riesige Betrugssache ab«, sagte William. »Berufskriminelle stehlen Gemälde, ohne dass sie die Absicht hätten, sie zu verkaufen.«
»Kapier ich nicht«, sagte Fred. »Warum sollte man etwas stehlen, das man nicht selbst verkaufen oder über einen Hehler losschlagen will?«
»Versicherungen sind manchmal bereit, sich mit einem Vermittler zu einigen, wenn sie dadurch vermeiden können, die volle Summe ausbezahlen zu müssen.«
»An Hehler in einem Armani-Anzug?«, fragte Fred. »Wie schnappst du solche Typen?«
»Man muss warten, bis sie zu gierig werden und die Versicherung sich weigert, zu zahlen.«
»Hört sich für mich nach jeder Menge Papierkram an. Unter den Umständen wäre es ganz sicher nichts für mich, Detective zu werden.«
»Welche Strecke nehmen wir heute Abend?«, fragte William, der inzwischen gelernt hatte, dass Fred die Anweisungen des Tages gelegentlich eher großzügig auslegte.
»Heute ist Samstag. Wir sehen uns besser Barton Estate an und sorgen dafür, dass die Suttons und die Tuckers keinen Ärger machen. Dann gehen wir zurück in die Luscombe Road, bevor die Pubs schließen. Könnte gut sein, dass du bei deinem letzten Tag auf Streife einen randalierenden Besoffenen festnehmen musst.«
Obwohl William zwei Jahre mit Fred zusammengearbeitet hatte, wusste er fast nichts über dessen Privatleben. Er konnte sich nicht darüber beklagen, denn er selbst war genauso zurückhaltend. Aber da es ihre letzte gemeinsame Streife war, beschloss er, Fred etwas zu fragen, das er schon immer rätselhaft gefunden hatte.
»Warum bist du eigentlich zur Polizei gegangen?«
Fast war es, als hätte Fred die Frage nicht gehört, denn es dauerte einige Zeit, bis er antwortete. »Da ich dich nie wiedersehen werde, Chorknabe«, antwortete er schließlich, »werde ich es dir sagen. Zunächst einmal, ich hatte es gar nicht vor. Es war mehr Zufall als Absicht.«
William schwieg, als sie in eine Gasse bogen, die zur Rückseite von Barton Estate führte.
»Ich wurde in einer Mietskaserne in Glasgow geboren. Mein Vater hat von der Wohlfahrt gelebt, weshalb meine Mutter die Einzige in unserer Familie mit einem echten Einkommen war.«
»Was hat sie gemacht?«
»Sie war Bardame. Schon bald hat sie herausgefunden, dass sie mit ein paar Gefälligkeiten nebenher sehr viel mehr verdienen konnte. Das Problem ist nur, dass ich bis heute nicht sicher bin, ob ich nicht das Ergebnis einer dieser Gefälligkeiten war.«
William äußerte sich nicht dazu.
»Doch das Geld strömte nicht mehr so üppig, als sie nach und nach ihr gutes Aussehen verlor, und es war auch keine große Hilfe, dass mein Vater ihr regelmäßig ein blaues Auge verpasste, wenn sie Samstagnacht mit so wenig zurückkam, dass es nicht für seine nächste Flasche Whisky und seinen Einsatz auf irgendeinen Gaul beim Pferderennen reichte.«
Fred schwieg, und William dachte über seine eigenen Eltern nach, die am Samstagabend regelmäßig im Restaurant aßen und ins Theater gingen. Noch immer fiel es ihm schwer zu verstehen, welch großen Einfluss häusliche Gewalt hatte. Er hatte nie erlebt, dass sein Vater gegenüber seiner Mutter auch nur laut geworden wäre.
»Es ist ein weiter Weg von Glasgow bis London«, sagte William, indem er versuchte, Fred ein neues Stichwort zu geben, um mehr von ihm zu erfahren.
»Für mich war er nicht weit genug«, sagte Fred. Er schaltete seine Taschenlampe ein, leuchtete in die Gasse und grinste, als er sah, wie ein junges Liebespaar davoneilte.
»Ich war vierzehn, als ich von zu Hause wegging. Ich nahm das erste Schiff, das mich haben wollte, und als ich mit achtzehn in London gelandet bin, hatte ich bereits die halbe Welt gesehen.«
»Bist du dann zur Polizei gegangen?«
»Nein. Damals war die Polizei für mich noch immer der Feind. Ich habe ein paar Monate damit verbracht, Regale im Supermarkt aufzufüllen, bevor ich Busschaffner wurde. Aber das hat mich bald gelangweilt, und deshalb habe ich beschlossen, entweder zur Armee oder zur Polizei zu gehen. Die Polizei hat mir schneller ein Vorstellungsgespräch angeboten. Wenn es andersherum gekommen wäre, wäre ich heute vielleicht General.«
»Oder tot«, sagte William, als sie das Viertel betraten.
»Bei unserem Job ist das Risiko, umgebracht zu werden, genauso hoch wie in einer modernen Armee«, sagte Fred. »Ich habe in den letzten zwanzig Jahren sieben Kollegen verloren, und viel zu viele sind mit schweren Verletzungen oder als Invaliden aus der Truppe ausgeschieden. In der Armee weißt du wenigstens, wer dein Feind ist, und du hast das Recht, ihn umzubringen. Wir sollen mit Drogendealern, Messerangriffen und Bandenkriminalität umgehen, von denen die meisten Leute lieber nichts wissen wollen.«
»Warum bist du dann dabeigeblieben, wenn du ein viel einfacheres Leben hättest haben können?«
»Du und ich, wir kommen vielleicht in vielerlei Hinsicht aus verschiedenen Gegenden dieses Landes, Chorknabe«, sagte Fred, »aber wir haben eines gemeinsam: Wir sind nicht ganz dicht, und wir beide tun genau das, was unsere Bestimmung ist. Und machen wir uns nichts vor, ich hatte noch nie einen Job, der auch nur halb so aufregend und halb so lohnend gewesen wäre, wie Polizist bei der Met zu sein.«
»Lohnend?«
»Ich meine nicht finanziell. Obwohl die Bezahlung so schlecht nun auch wieder nicht ist, wenn man die Überstunden einrechnet. Deprehendo deprehensio vitum«, sagte Fred. »Überstunden klären Verbrechen auf.«