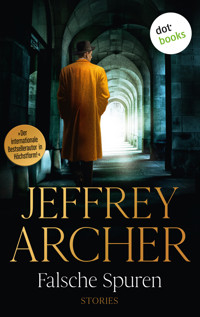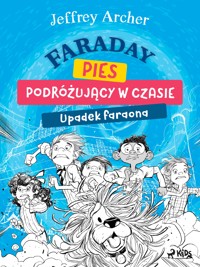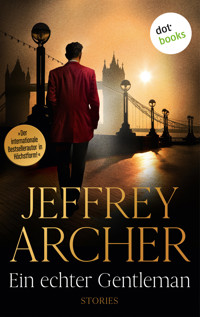
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Elf brillante Geschichten des Bestsellerautors voll meisterhafter Wendungen und stilistischem Glanz: »Einer der zehn besten Geschichtenerzähler der Welt«, urteilt die Los Angeles Times. Ein notorischer Spieler bringt aus Geldnot eine chinesisches Familienerbstück unter den Hammer. Es ist das Geschäft seines Lebens … Ein Backgammon-Ass tritt gegen einen allseits bekannten Pechvogel an – und wird von ihm geschlagen … In den Wirren eines Staatsstreichs treffen zwei rivalisierende Geschäftsmänner aufeinander. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit werden sie zu Freunden … Von London bis China, von New York bis Nigeria – Jeffrey Archer nimmt uns in seinen Erzählungen mit auf eine Reise in die Welt der großen Coups und knallharten Geschäfte, wo Vermögen gewonnen und wieder verschwendet werden, der Ruf verloren und wiederhergestellt, und alte Bündnisse verraten und neu geschmiedet. Mit schriftstellerischer Brillanz und Liebe zum Detail zeichnet Archer ein packendes Bild der Reichen und Schönen mit all seinen Licht- und Schattenseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein notorischer Spieler bringt aus Geldnot eine chinesisches Familienerbstück unter den Hammer. Es ist das Geschäft seines Lebens … Ein Backgammon-Ass tritt gegen einen allseits bekannten Pechvogel an – und wird von ihm geschlagen … In den Wirren eines Staatsstreichs treffen zwei rivalisierende Geschäftsmänner aufeinander. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit werden sie zu Freunden …
Von London bis China, von New York bis Nigeria – Jeffrey Archer nimmt uns in seinen Erzählungen mit auf eine Reise in die Welt der großen Coups und knallharten Geschäfte, wo Vermögen gewonnen und wieder verschwendet werden, der Ruf verloren und wiederhergestellt, und alte Bündnisse verraten und neu geschmiedet. Mit schriftstellerischer Brillanz und Liebe zum Detail zeichnet Archer ein packendes Bild der Reichen und Schönen mit all seinen Licht- und Schattenseiten.
Über den Autor:
Jeffrey Archer (geboren 1940 in London) ist ein britischer Bestsellerautor und gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Nach seinem Studium in Oxford schlug er eine bewegte unternehmerische und politische Karriere, die in einem Skandal endete. Nachdem er 2001 wegen Meineids inhaftiert wurde, wandte er sich voll und ganz der Schriftstellerei zu und hat seitdem zahlreiche internationale Bestseller geschrieben. Jeffrey Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in abwechselnd in London, Cambridge und auf Mallorca.
Bei dotbooks als eBook erhältlich sind seine hochkarätigen Anthologien »Der perfekte Dreh«, »Falsche Spuren«, »Ein echter Gentleman«, »Der gefälschte König« und »Verbrechen lohnt sich«. »Der perfekte Dreh« und »Falsche Spuren« sind auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem erscheinen bei dotbooks der Thriller »Die Stunde der Fälscher« und der Kurzroman »Das Evangelium nach Judas«.
Die Website des Autors: www.jeffreyarcher.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/JeffreyArcherAuthor/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/jeffrey_archer_author/
***
eBook-Ausgabe Dezember 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1980 unter dem Originaltitel »A Quiver Full of Arrows« bei HarperCollins. Die deutsche Erstausgabe erschien 1984 unter dem Titel »Die chinesische Statue« im Paul Zsolnay Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1980 by Jeffrey Archer
Copyright © der deutschen Erstausgabe Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H., Wien/Hamburg 1984
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/ana und Shutterstock/Magdanatk
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-574-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jeffrey Archer
Ein echter Gentleman
Stories
Aus dem Englischen von Hans W. Polak, Alexandra Auer, Gertie Polak, Elisabeth Roth, Marietta Torberg und Margarete Vanjakob
dotbooks.
Die chinesische Statue
Die kleine chinesische Statue war der nächste Gegenstand, der unter den Hammer kam. Posten No. 103 rief jenes leise Gemurmel hervor, das der Versteigerung eines Meisterwerks jeweils vorausgeht. Der Gehilfe des Auktionators hielt den elfenbeinernen Gegenstand in die Höhe, damit ihn jeder in der dichtgedrängten Menge sehen konnte; der Auktionator seinerseits ließ seine Blicke durch den Saal schweifen, um festzustellen, wo die ernstzunehmenden Käufer platziert waren. Ich studierte meinen Katalog, der eine exakte Beschreibung sowie Angaben über die Herkunft dieser Figurine enthielt.
Sie war im Jahre 1871 in Ha Li Chuan gekauft worden und stammte – laut der seltsamen Formulierung des Auktionshauses Sotheby – »aus dem Besitz eines Gentleman«. Eine derartige Feststellung deutet im allgemeinen darauf hin, daß ein Mitglied des Adels in die mißliche Lage geraten ist, sich von einem Erbstück trennen zu müssen.
Ich fragte mich nun, ob das im vorliegenden Fall wohl zutraf, und beschloß, der Sache nachzugehen, um herauszufinden, auf welchem Wege der kleine Elfenbeinchinese – hundert Jahre nach seinem Ankauf – in die Auktion an diesem Donnerstagmorgen geraten war.
»Posten No. 103«, verkündete der Sensal. »Wer bietet für dieses einmalige Stück aus ...?«
Sir Alexander Heathcote war nicht nur ein Gentleman, sondern vor allem ein sehr genauer Herr. Er war genau einen Meter einundneunzig groß, stand jeden Morgen um punkt sieben Uhr auf, gesellte sich dann zu seiner Gemahlin an den Frühstückstisch, aß ein genau vier Minuten lang gekochtes Ei und zwei Stück Toast mit je einem Löffel Coopers Orangenmarmelade und trank dazu eine Tasse chinesischen Tee. Danach verließ er um genau acht Uhr und zwanzig Minuten sein Haus in Cadogan Gardens und bestieg eine Mietdroschke, um Schlag acht Uhr neunundfünfzig im Foreign Office einzutreffen; punkt sechs Uhr abends war er wieder zu Hause.
Sir Alexander war seit frühester Jugend ein Muster an Genauigkeit, wie es sich für den Sohn eines Generals geziemte. Im Gegensatz zu seinem militaristischen Vater beschloß er, seiner Königin als Diplomat zu dienen, ein Beruf, der ebenfalls große Genauigkeit erforderte. Seine Laufbahn begann er an einem Gemeinschaftsschreibtisch im Foreign Office, wurde anschließend Dritter Sekretär an der Botschaft in Kalkutta, dann Zweiter Sekretär in Wien, Erster Sekretär in Rom, Gesandter in Washington und schließlich Botschafter in Peking. Sir Alexander war William Gladstone sehr zu Dank verpflichtet, daß er seine Regierung just in China vertreten durfte, denn er hegte schon seit langem ein mehr als nur oberflächliches Interesse für die Kunst der Ming-Dynastie. Nun, am Höhepunkt seiner Laufbahn, würde es ihm möglich sein, an Ort und Stelle die herrlichen Statuen, Gemälde und Zeichnungen zu bewundern, die er bislang nur aus Büchern kannte.
Nach einer fast zwei Monate dauernden Reise zu Wasser und zu Lande in Peking angelangt, überreichte Sir Alexander der Kaiserin Tzu-Hsi sein Beglaubigungsschreiben nebst einem persönlichen Brief von Königin Victoria. Die Kaiserin, von Kopf bis Fuß in Weiß und Gold gekleidet, empfing den neuen Botschafter im Thronsaal des kaiserlichen Palastes. Während sie den Brief der britischen Monarchin las, verharrte Sir Alexander in Habt-Acht-Stellung. Ihre Kaiserliche Hoheit verriet jedoch nichts von dessen Inhalt, sondern wünschte dem neuen Botschafter hur viel Erfolg für seine Mission. Darauf verzog sie ihre Mundwinkel ganz leicht nach oben, womit, wie Sir Alexander richtig erfaßte, die Audienz beendet war. Auf dem Rückweg durch die Säle des kaiserlichen Palastes in Begleitung eines Mandarins in der schwarzgoldenen Hoftracht ging Sir Alexander so langsam wie möglich, um einen Blick auf die beeindruckende Sammlung von Elfenbein- und Jadestatuen werfen zu können, die scheinbar wahllos über den ganzen Palast verstreut waren – ähnlich wie heutzutage in Florenz die Cellinis und Michelangelos kunterbunt durcheinander stehen.
Da seine Bestellung als Botschafter in Peking auf nur drei Jahre befristet war, beschloß Sir Alexander, keinen Heimaturlaub zu nehmen, sondern in seiner Freizeit China zu Pferd zu durchstreifen, um mehr über Land und Leute zu erfahren. Auf diesen Reisen wurde er von einem Mandarin des kaiserlichen Hofes begleitet, der ihm als Reiseführer und Dolmetscher diente.
Einmal, sie waren etwa fünfzig Meilen von Peking entfernt, ritten sie durch die schlammigen Gassen eines winzigen Dorfes namens Ha Li Chuan. Dort stießen sie auf die Hütte eines alten Handwerkers. Sir Alexander stieg vom Pferd, ließ seine Dienerschaft zurück und betrat die baufällige Werkstatt, deren Regale mit den zartesten Figuren aus Jade und Elfenbein vollgeräumt waren. Zwar waren sie jüngsten Datums, jedoch offensichtlich von der Hand eines Künstlers gefertigt, und so beschloß der Botschafter, eines der Stücke als Erinnerung an diese Reise zu erwerben. Die Hütte war sichtlich nicht für einen Besucher seiner Körpergröße gebaut, und aus Angst, eine der kleinen Figuren von den Regalen zu stoßen, blieb er wie angewurzelt stehen und sog wie verzaubert den zarten Jasminduft ein, der den Raum erfüllte.
Der alte Meister eilte herbei, um den Gast zu begrüßen; er trug ein langes, blaues Kuli-Gewand und einen flachen, schwarzen Hut, unter dem ein pechschwarzer Zopf auf seinen Rücken hinabbaumelte. Er verneigte sich zunächst tief und blickte dann zu dem Riesen aus England empor. Dieser verneigte sich seinerseits, während der Mandarin dem Meister erklärte, wer der hohe Besucher sei und daß er wünsche, die Kunstwerke besichtigen zu dürfen. Der Alte nickte zum Zeichen des Einverständnisses, noch ehe der Mandarin zu Ende gesprochen hatte. Eine gute Stunde lang betrachtete Sir Alexander die kleinen Meisterwerke mit wohlgefälligem Lächeln; danach wandte er sich an den Alten und pries dessen Kunstfertigkeit. Dieser verbeugte sich abermals, sein scheues, zahnloses Lächeln verriet tiefempfundene Freude über des Botschafters Lob. Er deutete mit ausgestrecktem Finger in die Tiefe seiner Werkstatt und gab den beiden ehrwürdigen Gästen einen Wink, ihm zu folgen. Sie betraten eine wahre Schatzkammer voll mit exquisiten Miniaturkaisern und anderen klassischen Figuren. Wie gerne hätte Sir Alexander hier in diesem Elfenbeinreich viele, viele Tage verbracht! Dank dem sprachgewandten Mandarin führte er mit dem alten Meister ein sehr angeregtes Gespräch, in dessen Verlauf Sir Alexanders große Liebe und profunde Kenntnis der Ming-Dynastie offenbar wurde. Plötzlich leuchtete das Antlitz des kleinen Mannes auf, und flüsternd wandte er sich an den Mandarin. Dieser nickte zum Zeichen des Einverständnisses und übersetzte sodann: »Exzellenz, ich besitze ein Stück aus der Ming-Dynastie, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Eine Figur, die sich seit mehr als sieben Generationen im Besitz meiner Familie befindet.«
»Es wird mir eine Ehre sein«, antwortete der Botschafter.
»Die Ehre ist meinerseits, Exzellenz«, sagte das Männchen und schlurfte durch den Hinterausgang, wo es beinahe über einen streunenden Hund gestolpert wäre, zu einem alten Bauernhaus, das nur wenige Meter von der Werkstatt entfernt war. Der Botschafter und der Mandarin warteten. Es verging einige Zeit, bis der Alte zurückgestapft kam – der Zopf hüpfte auf seinen Schultern auf und nieder, und in seinen Händen hielt er einen kleinen Gegenstand. An der Art, wie er ihn umklammert hielt, konnte man unschwer ermessen, wie wertvoll er ihm sein mußte. Ehrfürchtig überreichte er ihn dann Sir Alexander, der mit offenem Mund dastand und seiner Erregung kaum Herr werden konnte. Die kleine Statue war nicht höher als fünfzehn Zentimeter, stellte den Kaiser Kung dar und war zweifellos eines der besten Stücke aus der Ming-Zeit, die Sir Alexander je untergekommen waren. Er war sicher, daß es sich um eine Arbeit des großen Pen Q handeln müsse, eines hervorragenden Künstlers und Günstlings jenes Kaisers aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Der einzige Makel des Kunstwerkes bestand darin, daß das Elfenbeinpodest, auf dem solche Statuen zu stehen pflegen, fehlte: unter den kaiserlichen Gewändern kam ein Stück Holz zum Vorschein. Doch das konnte die Wirkung, die dieses Wunderwerk auf Sir Alexander machte, nicht beeinträchtigen! Die Augen des Alten strahlten. »Meinen Exzellenz, daß das eine gute Arbeit ist?« fragte er.
»Eine außerordentliche«, sagte der Botschafter. »Ganz außerordentlich.«
»Meine eigenen Arbeiten nehmen sich daneben recht armselig aus«, fügte der Alte bescheiden hinzu.
»Nein, ganz und gar nicht«, erwiderte der Botschafter. Aber der Alte merkte sehr wohl, daß sein Gast ihn nur nicht hatte kränken wollen. Er konnte es allein daran erkennen, daß dieser die Figur schon mit ebenso liebevoller Behutsamkeit in Händen hielt wie er selbst.
Lächelnd gab Sir Alexander sie dem Meister zurück, und dabei ließ er die wahrscheinlich einzige undiplomatische Äußerung seiner fünfunddreißigjährigen beruflichen Laufbahn fallen, indem er sagte: »Was gäbe ich darum, dieses Kunstwerk mein eigen zu nennen!«
Als der Mandarin seine Worte übersetzt, bereute er schön, seine Gedanken laut geäußert zu haben. Denn er wußte sehr wohl, daß es alte chinesische Sitte war, den Wunsch eines Ehrengastes zu erfüllen, um so Ruhm und Ansehen in den Augen seiner Mitmenschen zu erwerben.
Mit einem traurigen Blick überreichte der Alte seinem Gast die Figur.
»Nein, nein, ich habe doch nur gescherzt«, sagte Sir Alexander und versuchte, den kostbaren Gegenstand seinem Besitzer zurückzugeben.
»Exzellenz würden mein bescheidenes Haus entehren, wenn Sie das Geschenk nicht annähmen«, entgegnete der Alte in großer Aufregung, und der Mandarin nickte dazu ernst. Sir Alexander schwieg ein paar Augenblicke lang. »Ich habe mein eigenes Haus entehrt«, sprach er dann an den Mandarin gewandt, der jedoch keine Miene verzog.
Der Meister verneigte sich tief und sagte: »Ich muß mich nach einem Sockel umschauen, damit Exzellenz die Figur auch aufstellen können.«
Und er öffnete eine hölzerne Truhe, in der Hunderte Sockel durcheinander lagen. Nach längerem Stöbern entschied er sich für ein Stück, das mit kleinen schwarzen Figuren verziert war. Sir Alexander gefiel der Sockel nicht sonderlich, er mußte aber zugeben, daß er zu der kleinen Statue trefflich paßte. Der alte Mann beteuerte, daß es sich – obgleich er selbst die Herkunft des Sockels nicht angeben könne – um eine äußerst gediegene Arbeit handle.
Beschämt und verlegen empfing der Botschafter das kostbare Geschenk aus den Händen des Alten, der alle Dankesworte des hohen Gastes still über sich ergehen ließ. Dann verbeugte er sich nochmals tief zum Abschied, und Sir Alexander verließ mit dem Mandarin, der keinerlei Regung zeigte, die Werkstatt.
Sie machten sich auf den Rückweg nach Peking. Der Botschafter befand sich in einem so erbärmlichen Zustand, daß sein aufmerksamer Begleiter nicht umhin konnte, die Regeln des Anstands einmal zu mißachten und als erster das Wort zu ergreifen:
»Exzellenz kennen zweifellos die alte chinesische Sitte, welche besagt, daß man die Großmut, die ein Fremder einem zuteilwerden ließ, erwidern muß, noch ehe das Jahr um ist.«
Mit einem Lächeln dankte der Botschafter dem Mandarin für diesen Hinweis, über den er lange nachdachte.
Nach Peking zurückgekehrt, suchte Sir Alexander unverzüglich die reichhaltige Bibliothek seiner Residenz auf, in der Hoffnung, den Wert der kleinen Statue ermitteln zu können. Nach emsiger Suche entdeckte er die Abbildung einer Figur, die der seinen beinahe aufs Haar glich; mit Hilfe des Mandarins gelang es, ihren Wert festzustellen: dieser belief sich auf etwa drei Jahreseinkommen eines Botschafters im Dienste Ihrer Majestät, der Königin von England. Sir Alexander erörterte das Problem mit Lady Heathcote, die ihn nicht im Zweifel darüber ließ, was er zu tun hätte.
So sandte er denn ein Schreiben an seine Bank in London, darin er Auftrag gab, ihm sogleich den Großteil seines Vermögens nach Peking zu überweisen.
Nach knapp neun Wochen war das Geld in seinen Händen, und Sir Alexander wandte sich wieder um Rat an den Mandarin, der in der Zwischenzeit das Folgende herausgefunden hatte:
Unser kleiner Meister mit Namen Young Lee entstammte der alten und ehrbaren Familie der Young Shan, deren Mitglieder seit etwa fünfhundert Jahren das Handwerk des Elfenbeinschnitzens ausübten. Nun, da Young Lee alt geworden war, verspürte er den Wunsch, sich in die Berge oberhalb seines Dorfes zurückzuziehen, um dort, nach Vätersitte, seinem Tode entgegenzusehen. Der Sohn war bereit, die Werkstatt von seinem Vater zu übernehmen.
Der Botschafter dankte dem Mandarin für die Auskunft und unterbreitete ihm noch eine Bitte, die jener freundlich aufnahm; sodann verfügte er sich in den kaiserlichen Palast. Wenige Tage danach kam aus dem Palast die Nachricht, daß die Kaiserin Sir Alexanders Ersuchen ein williges Ohr geliehen habe.
Noch, ehe das Jahr abgelaufen war, machte sich Sir Alexander, wiederum in Begleitung des Mandarins, auf die Reise von Peking in das Dorf Ha Li Chuan. Dort angelangt, stieg er vom Pferd und betrat die ihm wohlvertraute Hütte. Den flachen Hut ein wenig schief auf dem Kopfe saß der alte Meister an seiner Werkbank, ein Stück unbehauenen Elfenbeins behutsam in den Händen haltend. Er erhob sich, und als er ganz nahe an den Fremden herangekommen war, erkannte er ihn wieder und verneigte sich tief vor dem hohen Gast. Dieser aber sprach:
»Noch ehe das Jahr abgelaufen ist, bin ich zurückgekehrt, um meine Schuld zu begleichen.«
»Das war nicht nötig, Exzellenz. Es gereicht meiner Familie zur Ehre, den kleinen Kaiser in einer großen Botschaft zu wissen; und wer weiß, eines Tages werden ihn vielleicht auch die Menschen Ihres Heimatlandes bewundern können.«
Der Botschafter wußte nicht, was er darauf antworten sollte. Deshalb bat er den Alten nur, ihn auf eine kurze Reise zu begleiten. Der Meister willigte ein, ohne zu fragen, wohin die Reise denn ginge.
Sie ritten auf Eseln gen Norden, auf steilem, engem Pfad den Hügel hinan. Als sie das Dorf Ma Tien erreichten, wurden sie von einem anderen Mandarin in Empfang genommen, der sich vor Sir Alexander verneigte und ihn bat, er und der Meister mögen ihm von hier an zu Fuß folgen. Schweigend gingen sie zum anderen Ende des Dorfes, bis zu einer kleinen Senke, von der aus man einen wunderbaren Blick auf das Dorf Ha Li Chuan hatte. In der Senke aber stand ein nagelneues, wunderhübsches weißes Häuschen, dessen Eingang zwei steinerne Palasthunde bewachten. Der Botschafter wandte sich nun an den alten Mann, der während der ganzen Reise kein Wort gesprochen hatte:
»Dieses kleine, unzulängliche Geschenk ist nichts als der bescheidene Versuch, Ihnen meine Dankbarkeit zu erweisen.«
Der Meister fiel auf die Knie und bat den Mandarin um Vergebung, denn es war einem Handwerker untersagt, Geschenke von Fremden anzunehmen. Der Mandarin half dem Zitternden wieder auf die Beine und versicherte ihm, daß die Kaiserin höchstselbst der Bitte des Botschafters stattgegeben hätte. Da leuchtete ein glückseliges Lächeln im Antlitz des Alten auf. Langsamen Schrittes ging er auf das Häuschen zu und konnte nicht umhin, seine Hand liebevoll über die Köpfe der zwei steinernen Palasthunde gleiten zu lassen.
Mehr als eine Stunde bewunderten die drei Reisenden noch das schmucke kleine Anwesen, ehe sie schweigsam und glücklich nach Ha Li Chuan zurückkehrten. Dort schied man voneinander, nachdem der Ehre Genüge getan worden war, und Sir Alexander war darüber hinaus höchst befriedigt, daß sein Werk den Beifall sowohl des Mandarins als auch Lady Heathcotes gefunden hatte.
Nach Beendigung seiner Mission in Peking verlieh die Kaiserin dem britischen Botschafter den Silbernen Löwen von China, und die englische Königin fügte seiner ohnedies langen Reihe von Auszeichnungen noch die eines Groß-Offiziers des Victoria-Ordens hinzu.
Wenige Wochen nach seiner Rückkehr aus China trat Sir Alexander in den Ruhestand und zog sich ins heimatliche Yorkshire zurück. Er verbrachte seinen Lebensabend im Haus seiner Väter, in Gesellschaft seiner Gemahlin und des kleinen Ming-Kaisers. Dieser prangte auf dem Kaminsims des Wohnzimmers, für jedermann sichtbar und von jedermann bewundert.
Da – wir wissen es schon – Sir Alexander ein Muster an Genauigkeit war, verfaßte er ein ausführliches Testament, in dem auch genau festgelegt war, was nach seinem Hinscheiden mit Kaiser Kung zu geschehen habe: Er vermachte ihn seinem ältesten Sohn, der ihn wiederum seinem Erstgeborenen vererben sollte und so weiter. Ausdrücklich bestimmte er außerdem, daß die Statue niemals veräußert werden dürfe – es sei denn, die Ehre der Familie stünde auf dem Spiel. An seinem siebzigsten Geburtstag Schlag Mitternacht verstarb Sir Alexander.
Zu dem Zeitpunkt, als er in den Besitz des Ming-Kaisers kam, stand Major James Heathcote, der Erbe, im Dienste Ihrer Majestät der Königin, mitten im Burenkrieg. Er diente im Regiment des Herzogs von Wellington und war mit Leib und Seele Soldat. Für Kultur hatte er wenig übrig, war sich aber bewußt, daß das Erbstück aus China nicht irgendein beliebiger Kunstgegenstand war. Deshalb stellte er die Figur als Leihgabe in die Offiziersmesse von Halifax, damit seine Kameraden sich am Anblick des Kaisers ergötzen könnten. Während der Feierlichkeiten anläßlich der Beförderung von James Heathcote zum Oberst stand der kleine Kaiser stolz inmitten der Siegestrophäen von Waterloo, Sebastopol, der Krim und Madrid – und dort blieb er auch bis zur Pensionierung von Oberst Heathcote. Danach kehrte er auf den Kaminsims im Wohnzimmer zurück. Der Oberst hielt sich streng an die testamentarische Verfügung seines Vaters und vermachte das Erbstück wiederum seinem Erstgeborenen, und wiederum mit der Verpflichtung, es an dessen Erstgeborenen weiterzugeben und nur dann zu veräußern, wenn die Familienehre auf dem Spiel stünde. Oberst James Heathcote, Inhaber des Military Cross, starb nicht den Heldentod; er schlief eines Abends, am Kamin sitzend, sanft hinüber, die Yorkshire Post auf den Knien.
Alexander Heathcote, der älteste Sohn des Oberst, war Geistlicher und stand als solcher der kleinen Gemeinde von Much Hadam in der Grafschaft Hertfordshire vor. Nachdem er seinen Vater mit allen militärischen Ehren beigesetzt hatte, stellte er den Kaiser auf den Kaminsims im Pfarrhaus; aber nur wenige seiner Schäflein wußten mit dem Chinesen et was anzufangen, von einigen älteren Damen abgesehen, die die feine Schnitzereiarbeit bewunderten. Erst als der Pfarrer zum Bischof avanciert war und der Kaiser im bischöflichen Palais vor die Öffentlichkeit treten durfte, erfuhr er wieder die ihm gebührende Bewunderung. Die Geschichte, wie der Großvater des Bischofs in den Besitz der wertvollen Figur gekommen war, und wie der Sockel eigentlich nicht recht dazupaßte, ergab zudem immer wieder ein anregendes Tischgespräch.
Gott ruft selbst seine irdischen Vertreter, wenn deren Zeit abgelaufen ist, zu sich; das galt auch für Bischof Heathcote. Der aber hatte zuvor gewissenhaft in seinem Testament alle Verfügungen bezüglich des kleinen Kaisers getroffen, die sein Vater ihm einst aufgetragen hatte.
Der Sohn des Bischofs, Hauptmann James Heathcote, diente in demselben Regiment wie sein Großvater, und die Ming-Statue kehrte in die Offiziersmesse nach Halifax zurück. Während des kleinen Kaisers Abwesenheit hatte sich die Trophäensammlung des Regiments um die Siegestrophäen von Ypres, Marne und Verdun vermehrt. Wieder einmal war das Regiment in einem Krieg gegen Deutschland eingesetzt, und der junge Hauptmann Heathcote fiel bei der Landung in Dünkirchen – ohne ein Testament zu hinterlassen. Da der Wunsch seines Urgroßvaters allgemein bekannt war, bestand nach englischem Recht kein Zweifel daran, daß die Statue in den Besitz seines zweijährigen Sohnes überzugehen hatte.
Alexander Heathcote war leider nicht aus demselben Holz geschnitzt wie seine Vorfahren und entwickelte im Laufe der Jahre keinerlei Verlangen, irgend jemandem anderen als sich selbst zu dienen. Nach dem tragischen Tod seines Vaters las ihm die Mutter jeden Wunsch von den Augen ab und überschüttete ihn – soweit es ihre karge Witwenpension zuließ – mit allerlei Geschenken. Sie erntete wenig Dank dafür; doch es war nicht die Schuld des Knaben allein, daß er sich – nach den Worten seiner Großmutter – zu einem selbstsüchtigen und unausstehlichen Bengel entwickelte. Er verließ die Schule kurz vor seinem Hinauswurf und versuchte es in diesem und jenem Job, aber er hielt es nirgendwo länger als ein paar Wochen aus. Auch gab er gern mehr Geld aus, als er oder seine Mutter sich leisten konnten. Als Mrs. Heathcote dieses Leben nicht länger ertragen konnte, schied sie kurzerhand aus demselben.
In den flotten sechziger Jahren kamen in England die Spielkasinos in Mode, und Jung-Alex war überzeugt, hierin endlich ein arbeitsloses Einkommen gefunden zu haben. Er entwickelte ein System, nach welchem man im Roulette nur gewinnen konnte. Dennoch verlor er, verbesserte sein System – und verlor wieder. Er baute das System daraufhin weiter aus, was dazu führte, daß er Geld leihen mußte, um seine Spielschulden zu begleichen. Warum auch nicht? Wenn alle Stricke rissen, konnte er immer noch auf den Ming-Kaiser zurückgreifen. Und in der Tat – alle Stricke rissen.
Eines schönen Montagmorgens erhielt Alex den Besuch zweier Herren, die fest entschlossen schienen, achttausend Pfund von ihm einzuheben; die Sache müsse innerhalb von vierzehn Tagen in Ordnung gebracht sein, widrigenfalls ...
Da gab Alex auf. Schließlich hieß es unmißverständlich im Testament seines Ur-Urgroßvaters: wenn die Ehre der Familie auf dem Spiel stand, sollte die Ming-Statue verkauft werden.
Alex holte den kleinen Kaiser vom Kaminsims, warf einen kurzen Blick auf die kostbare Figur, und hatte immerhin so viel Anstand, ein wenig Trauer dabei zu empfinden. Dann trug er das Erbstück zum Auktionshaus Sotheby und gab Auftrag, die Statue ehebaldigst unter den Hammer zu bringen.
Der Leiter der Orient-Abteilung, ein blasser, magerer Mann, nicht unähnlich der Statue, die er liebevoll streichelte, meinte:
»Wir werden wohl einige Tage benötigen, um den genauen Wert der Figur festzustellen, aber so auf den ersten Blick würde ich wagen zu behaupten, daß dies eine Arbeit des großen Meisters Pen Q ist.«
»Lassen Sie sich ruhig Zeit«, antwortete Alex, »es genügt, wenn Sie mir innerhalb von vierzehn Tagen Bescheid geben.«
»Ich bin sicher, daß ich Ihnen bis Freitag den Rufpreis nennen kann«, sagte der Fachmann.
»Um so besser.«
Im Laufe der Woche verständigte Alex seine Gläubiger; sie erklärten sich bereit, das Gutachten von Sotheby abzuwarten. Am Freitag begab er sich frohgemut in die Bond Street. Schließlich wußte er, was sein Ur-Urgroßvater für die Statue bezahlt hatte; er war sicher, daß sie heute mehr als zehntausend Pfund wert war. Mit diesem Betrag konnte er sich aller seiner Schulden entledigen, und mit dem Rest sein neuestes und endgültig unfehlbares System ausprobieren. Als er die Stufen zu Sotheby’s erklomm, sandte er ein stilles Dankgebet zu seinem Urahn im Himmel. Oben angelangt verlangte er den Leiter der Orient-Abteilung zu sprechen. Dieser erschien alsbald – mit düsterer Miene, die Stirn umwölkt. Alex rutschte das Herz in die Hosen.
»Ihr Kaiser ist eine nette, kleine Arbeit – aber leider Gottes eine Fälschung. Er ist etwa zweihundert bis zweihundertfünfzig Jahre alt und eine Kopie des Originals. Damals wurden öfters Kopien angefertigt, weil ...«
»Was ist die Figur wert?« stammelte Alex.
»Siebenhundert, allerhöchstens achthundert Pfund.«
Genug, um einen Revolver samt Munition zu erstehen, dachte Alex voll Bitterkeit, als er sich erhob um zu gehen.
»Mein Herr, was soll ich ...«, fragte der Orient-Experte.
»Ach was, verkaufen Sie das Zeug«, sagte Alex ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Und was soll mit dem Sockel geschehen?«
»Mit dem Sockel?«
»Ja, mit dem Sockel. Er ist allerbestes fünfzehntes Jahrhundert, zweifellos die Arbeit eines ganz großen Meisters; ich kann mir nicht erklären, wie ...«
»Posten No. 103«, verkündete der Auktionator. »Wer bietet für dieses einmalige Stück aus ...«
Der blasse Fachmann hatte richtig geschätzt. An diesem Donnerstagmorgen erstand ich bei Sotheby den kleinen Kaiser um siebenhundertzwanzig Guineas. Und der Sockel? Den Sockel ersteigerte ein amerikanischer Sammler um zweiundzwanzigtausend Guineas.
Der Coup
Die blau-silberne Boeing 707 mit dem mächtigen P an der Höhenflosse kam am Nordende des internationalen Flughafens von Lagos zum Stillstand. Eine Flotte von sechs schwarzen Mercedes fuhr neben dem Flugzeug auf und wartete in einer Formation, die einem ans Ufer strebenden Krokodil glich. Sechs schwitzende uniformierte Chauffeure sprangen heraus und standen habtacht. Als der Fahrer des vordersten Wagens die Tür zum Fond öffnete, stieg Oberst Usman von der Bundeswacht aus und schritt eilig zur Gangway, die von vier Mann des Flughafenpersonals rasch an die richtige Stelle gerückt worden war.
Die vordere Kabinentür wurde nach innen gezogen, und der Oberst starrte auf die Öffnung. Vor dem Hintergrund des dunklen Flugzeuginneren sah er eine schlanke, attraktive Hostess in blauem Kostüm mit silbernen Biesen. Den Aufschlag ihrer Jacke zierte ein großes P. Sie wandte sich um und nickte jemandem im Kabineninneren zu. Wenige Sekunden später trat sie zurück, um einem untadelig gekleideten, hochgewachsenen Mann mit dichtem schwarzem Haar und dunklen Augen Platz zu machen. Der Mann besaß jenes Flair zwangsloser Eleganz, für das Selfmade-Millionäre einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens gegeben hätten. Der Oberst salutierte, als Senhor Eduardo Francisco de Silveira, Chef des Prentino-Imperiums, ihn mit einem kurzen Nicken grüßte.
De Silveira trat aus der Kühle seiner vollklimatisierten 707 in die sengende nigerianische Sonne, ohne das leiseste Anzeichen von Unbehagen zu zeigen. Der Oberst geleitete den großen, eleganten Brasilianer, der nur von seinem Privatsekretär begleitet wurde, zu dem vordersten Mercedes, während die übrigen Mitglieder der Prentino-Mannschaft einer nach dem anderen die Maschine über die hintere Gangway verließen und in den restlichen fünf Autos Platz nahmen. Der Chauffeur, ein Korporal, der dem Ehrengast rund um die Uhr zur Verfügung stehen sollte, riß den hinteren Wagenschlag auf und salutierte. Er lächelte nervös und entblößte dabei das gewaltigste weiße Gebiß, das der Brasilianer je gesehen hatte.
»Willkommen in Lagos«, sagte der Korporal ehrerbietig. »Hoffe, Sie werden machen sehr großes Geschäft in Nigeria.«
Eduardo antwortete nicht; er lehnte sich in seinem Sitz zurück und starrte durch die getönte Scheibe, um einige Passagiere einer Boeing 707 der British Airways zu beobachten, die unmittelbar vor ihm gelandet waren. Sie standen in einer langen Schlange auf der heißen Rollbahn und warteten geduldig auf die Zollabfertigung. Der Fahrer legte den ersten Gang ein, und das schwarze Krokodil setzte sich in Bewegung. Oberst Usman, der nun vorne neben dem Korporal saß, entdeckte bald, daß der brasilianische Gast keinen Wert auf Smalltalk legte, und der Sekretär der neben seinem Chef saß, machte kein einziges Mal den Mund auf. Der Oberst, gewöhnt, sich an Vorbilder zu halten, schwieg also und überließ de Silveira seinen Gedanken an die geplante Aktion.
Eduardo Francisco de Silveira war in dem kleinen Dorf Rebeti, etwa hundertsechzig Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, zur Welt gekommen, und Erbe eines der beiden größten Familienvermögen Brasiliens. Er war in Schweizer Privatschulen erzogen worden, ehe er an die University of California in Los Angeles kam, um seine Ausbildung dann an der Harvard Business School abzuschließen. Danach kehrte er aus Nordamerika nach Brasilien zurück, wo er in der familieneigenen Firma weder ganz oben noch ganz unten in der Firma, sondern in einer mittleren Stellung, als Manager der Bergwerke von Minas Gerais, zu arbeiten begann. Binnen kürzester Zeit stieg er in eine Spitzenposition auf, sogar noch rascher, als sein Vater es geplant hatte, doch inzwischen hatte sich herausgestellt, daß der Junge nicht bloß ein Zweiglein, sondern ein regelrechter Hauptast vom alten Stamm war. Mit neunundzwanzig heiratete er Maria, die älteste Tochter des besten Freundes seines Vaters, und als sein Vater zwölf Jahre später starb, folgte ihm Eduardo auf dem Thron des Prentino-Imperiums nach. Insgesamt gab es sieben Söhne: der zweite, Alfredo, übernahm nun die Bankangelegenheiten; João kümmerte sich um das Transportwesen; Carlos organisierte die Bauvorhaben; Manoel übernahm den Nahrungs- und Versorgungssektor; Jaime leitete den Zeitungskonzern der Familie, und der kleine Antonio, der letzte – und das war er in jeder Hinsicht –, führte die landwirtschaftlichen Betriebe. Bevor sie irgendeine bedeutendere Entscheidung trafen, kamen alle Brüder zu Eduardo, denn er war immer noch der Chef des größten Privatunternehmens in Brasilien, trotz der überheblichen Behauptungen des alten Erzfeindes der Familie, Manuel Rodrigues.
Als 1964 durch General Castelo Brancos Militärregime die Zivilregierung gestürzt wurde, waren sich die Generäle einig, daß sie nicht sämtliche Silveiras oder Rodrigues umbringen konnten, und daher versuchen mußten, mit den beiden rivalisierenden Familien auszukommen. Die de Silveira ihrerseits waren immer vernünftig genug gewesen, sich nie in die Politik hineinziehen zu lassen, außer durch Zahlungen an Regierungsbeamte (gleichgültig, ob sie einer zivilen oder einer Militärregierung angehörten), wobei die Höhe des Betrages sich nach dem Rang des jeweiligen Politikers richtete. Diese Methode garantierte, daß das Prentino-Imperium wuchs und gedieh, unabhängig davon, welche Partei an die Macht gelangte. Einer der Gründe, warum Eduardo de Silveira in seinem übervollen Terminkalender drei Tage für den Besuch in Lagos frei gehalten hatte, war der Umstand, daß das nigerianische Regierungssystem dem brasilianischen so ähnlich zu sein schien, und zumindest bei diesem Projekt hatte er Manuel Rodrigues erfolgreich den Boden unter den Füßen weggezogen – was eine mehr als angemessene Entschädigung dafür war, daß er das Flughafen-Projekt von Rio an ihn verloren hatte. Eduardo lächelte bei dem Gedanken an Rodrigues, der keine Ahnung hatte, daß er sich in Nigeria aufhielt, um einen Handel abzuschließen, der ihn zweimal so groß machen konnte wie seinen Rivalen.