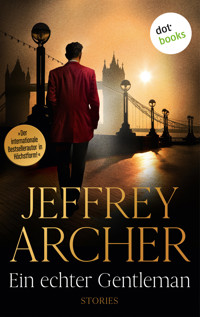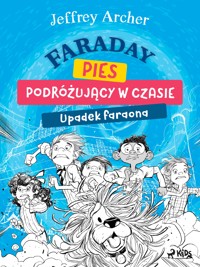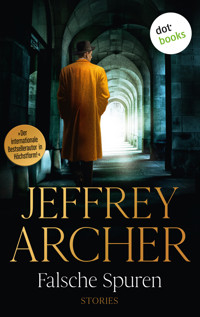
5,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwölf meisterhafte Erzählungen des Sensationsautors voll dunkler Geheimnisse und stilistischem Glanz: »Jeffrey Archer erweist sich als der geborene Geschichtenerzähler!«, urteilt die Times. Eine Frau fährt den Highway entlang – und bemerkt, dass sie verfolgt wird. Dann hört sie die Meldung, dass auf ihrer Route ein Frauenmörder sein Unwesen treibt … Einen Flüchtling führt eine bittere Fügung des Schicksals in sein Heimatland zurück – das Land, in dem er auf der Todesliste steht … Eine Mutter sitzt für den Mord an ihrem Ehemann auf der Anklagebank. Auch wenn alle Indizien gegen sie sprechen, beharrt sie, unschuldig zu sein. Aus gutem Grund … Von persönlichen Tragödien bis zu heimtückischem Mord, von Ehepartnern bis zu Serienmördern – Jeffrey Archer erkundet in seinen fesselnden Erzählungen die persönlichen Abgründe des Menschen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der brillante Kurzgeschichten-Sammelband »Der perfekte Dreh« von Jeffrey Archer – hochkarätige Unterhaltung, die seinen Weltbestsellern in nichts nachsteht! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Frau fährt den Highway entlang – und bemerkt, dass sie verfolgt wird. Dann hört sie die Meldung, dass auf ihrer Route ein Frauenmörder sein Unwesen treibt … Einen Flüchtling führt eine bittere Fügung des Schicksals in sein Heimatland zurück – das Land, in dem er auf der Todesliste steht … Eine Mutter sitzt für den Mord an ihrem Ehemann auf der Anklagebank. Auch wenn alle Indizien gegen sie sprechen, beharrt sie, unschuldig zu sein. Aus gutem Grund …
Von persönlichen Tragödien bis zu heimtückischem Mord, von Ehepartnern bis zu Serienmördern – Jeffrey Archer erkundet in seinen fesselnden Erzählungen die persönlichen Abgründe des Menschen!
»Falsche Spuren« erscheint außerdem als Hörbuch bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über den Autor:
Jeffrey Archer (geboren 1940 in London) ist ein britischer Bestsellerautor und gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Nach seinem Studium in Oxford schlug er eine bewegte unternehmerische und politische Karriere ein, die in einem Skandal endete. Nachdem er 2001 wegen Meineids inhaftiert wurde, wandte er sich voll und ganz der Schriftstellerei zu und hat seitdem zahlreiche internationale Bestseller geschrieben. Jeffrey Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in abwechselnd in London, Cambridge und auf Mallorca.
Bei dotbooks als eBook erhältlich sind seine hochkarätigen Anthologien »Der perfekte Dreh«, »Falsche Spuren«, »Ein echter Gentleman«, »Der gefälschte König« und »Verbrechen lohnt sich«. »Der perfekte Dreh« und »Falsche Spuren« sind auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem erscheinen bei dotbooks der Thriller »Die Stunde der Fälscher« und der Kurzroman »Das Evangelium nach Judas«.
Die Website des Autors: www.jeffreyarcher.com/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/JeffreyArcherAuthor/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/jeffrey_archer_author/
***
eBook-Ausgabe Oktober 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »Twelve Red Herrings« bei HarperCollins, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe Jeffrey Archer, 1994
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/MedYarTak, stokkete und AdobeStock/ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-270-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jeffrey Archer
Falsche Spuren
Stories
Aus dem Englischen von Lore Straßl
dotbooks.
EINE FRAGE DER ERFAHRUNG
Ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Aber vielleicht sollte ich als erstes erklären, weshalb ich im Gefängnis bin.
Der Prozeß hatte achtzehn Tage gedauert, und vom ersten Augenblick an war der Gerichtssaal bis zum letzten Sitz voll gewesen. Die Geschworenen vom Leeds Crown Court waren nahezu zwei volle Tage in Klausur und — wie sich herumgesprochen hatte — hoffnungslos unterschiedlicher Meinung gewesen. Unter den Anwälten und Richtern sprach man schon von einem möglichen Austausch sämtlicher Geschworenen und einem neuen Verfahren, denn immerhin waren bereits acht Stunden vergangen, seit Seine Ehren, Richter Cartwright, dem Sprecher der Geschworenen erklärt hatte, daß ihr Urteilsspruch nicht mehr einstimmig sein müsse. Eine Mehrheit von zehn zu zwei würde in diesem Fall genügen.
Plötzlich wurde es laut auf den Korridoren. Presse und Publikum eilten in den Gerichtssaal zurück, denn die Geschworenen hatten wieder auf ihren Sitzen Platz genommen. Aller Augen richteten sich aufgeregt auf ihren Sprecher, einen dicken kleinen Mann mit verschmitzten, freundlichen Augen, in Doppelreiher, gestreiftem Hemd und bunter Fliege, der sich sehr bemühte, ein ernstes Gesicht zu machen. Er sah wie die Art von Kumpel aus, mit der ich unter normalen Umständen gern ein Glas Bier in einem Pub getrunken hätte. Aber leider waren die Umstände nicht normal.
Als ich wieder die Stufen zur Anklagebank hinunterging, richtete sich mein Blick unwillkürlich auf die hübsche Blondine, die seit Beginn der Verhandlung jeden Tag in der vordersten Zuschauerreihe saß. Ich fragte mich, ob sie zu allen sensationellen Mordprozessen kam oder nur von diesem besonders fasziniert war. Sie zeigte absolut kein Interesse an mir, und richtete, wie alle anderen jetzt auch, ihre Aufmerksamkeit auf den Sprecher der Geschworenen.
Ein Gerichtsbeamter in weißer Perücke und langer schwarzer Robe erhob sich und las von einer Karte die Worte, die er bestimmt auswendig kannte.
»Würde der Sprecher der Geschworenen bitte aufstehen.«
Der kleine dicke Mann mit den verschmitzten Augen richtete sich bedächtig auf.
»Bitte beantworten Sie meine nächste Frage mit ja oder nein. Sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen, für das wenigstens zehn von Ihnen gestimmt haben?«
»Jawohl.«
»Geschworene, befinden Sie den Angeklagten im Sinne der Anklage für schuldig oder nicht schuldig?«
Im Gerichtssaal hätte man nun eine Feder fallen hören.
Meine Augen hafteten an dem Sprecher mit der bunten Fliege. Er räusperte sich und antwortete ...
Ich lernte Jeremy Alexander 1978 bei einem Ausbildungsseminar des britischen Industrieverbands, kurz CBI, in Bristol kennen. Sechsundfünfzig britische Firmen, die Möglichkeiten für eine Expansion ins übrige Europa suchten, waren zusammengekommen, um sich in die komplizierten Regeln des EG-Gemeinschaftsrechts zu vertiefen. Als ich mich für das Seminar meldete, betrieb Cooper’s, die Firma, deren Chef ich war, einhundertsiebenundzwanzig Fahrzeugarten verschiedenster Gewichts- und Größenklassen, und befand sich auf bestem Weg, eines der größten privaten Transportunternehmen zu werden.
Mein Vater hatte die Firma 1931 gegründet und mit drei Fahrzeugen angefangen — zwei davon Pferdefuhrwerke —, und einem Kontokorrentkredit von zehn Pfund bei der örtlichen Filiale der Martinsbank. Als wir 1967 »Cooper & Son« wurden, verfügte unsere Firma über siebzehn Fahrzeuge mit vier oder mehr Rädern, und transportierte Güter im gesamten Norden Englands. Aber mein alter Herr weigerte sich immer noch, seine 10-Pfund-Kreditlinie zu überschreiten.
Einmal, während eines Konjunkturrückgangs, schlug ich vor, uns auch außerhalb unseres bisherigen Bereichs nach Aufträgen umzusehen, vielleicht sogar auf dem Kontinent. Doch davon wollte mein Vater nichts hören. »Ist das Risiko nicht wert«, wehrte er ab. Er mißtraute jedem, der südlich des Humbers geboren war, und erst recht allen, die auf der anderen Seite des Kanals wohnten. »Wenn Gott einen Streifen Wasser zwischen uns gelegt hat, muß er einen guten Grund dafür gehabt haben«, beendete er dieses Thema ein für allemal. Ich hätte über diese Worte bestimmt gelacht, wäre mir nicht klargewesen, daß er das wirklich glaubte.
Als er 1977 mit siebzig Jahren — widerstrebend — in den Ruhestand ging, übernahm ich die Firmenleitung. Ich machte mich daran, einige der Ideen in die Tat umzusetzen, die ich mir während der vergangenen zehn Jahre hatte durch den Kopf gehen lassen, obwohl mir klar war, daß mein Vater sie nicht billigte. Europa war nur der Anfang für die Expansion der Firma; innerhalb der nächsten fünf Jahre beabsichtigte ich, sie in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Mir wurde bewußt, daß wir dann ein Kreditlimit von mindestens einer Million Pfund bräuchten, was bedeutete, daß wir mit einer anderen Bank arbeiten mußten, einer, für die die Welt weiter reichte als nur bis zur Grafschaftsgrenze von Yorkshire.
Etwa zu jener Zeit hörte ich von dem CBI-Seminar in Bristol und meldete mich dafür an.
Es begann am Freitag. Der Leiter des europäischen Direktoriums des CBI hielt die Eröffnungsansprache. Danach wurden die Teilnehmer in acht kleine Arbeitsgruppen unter der Führung eines Experten im EG-Gemeinschaftsrecht aufgeteilt. Der Leiter meiner Gruppe war Jeremy Alexander. Ich bewunderte ihn von dem Augenblick an, da er zu reden begann — ja, bewundern ist vielleicht noch zuwenig, er beeindruckte mich zutiefst! Er war absolut selbstsicher, und wie sich bald herausstellte, konnte er überzeugend argumentieren, egal, ob es nun um die Überlegenheit des Code Napoléon ging oder um die Schwächen gewisser Schlagmänner bestimmter Kricketmannschaften.
Er hielt uns einen einstündigen Vortrag über die grundlegenden Unterschiede in der Praxis und im Verfahren zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft; dann beantwortete er unsere sämtlichen Fragen über Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, ja fand sogar noch die Zeit, uns die Bedeutsamkeit der Uruguay-Runde zu erklären. Genau wie ich hörten die anderen Teilnehmer unserer Gruppe nie auf, sich Notizen zu machen.
Kurz vor dreizehn Uhr machten wir Mittagspause, und es gelang mir, einen Platz an Jeremys Tisch zu bekommen. Mir ging der Gedanke nicht aus dem Kopf, daß er genau der Richtige sei, der mich beraten könnte, wie sich meine Europa-Ambitionen konkret umwandeln ließen.
Während ich ihm über einer Fleischpastete mit rotem Paprika zuhörte, dachte ich, daß wir zwar in etwa gleich alt waren, aber aus gar nicht unterschiedlicheren Kreisen kommen könnten. Jeremys Vater, einem Bankier, war es gerade noch, nur Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, gelungen, aus Osteuropa zu fliehen. Er hatte in England ein neues Zuhause gefunden, seinen Namen anglisiert, und seinen Sohn nach Westminster gesandt. Von dort war Jeremy zum King’s College in London gegangen, wo er Jura studierte und summa cum laude promovierte.
Mein Vater war ein Selfmademan aus den Yorkshire Dales. Er war dagegen gewesen, daß ich studierte, und hatte darauf bestanden, daß ich gleich nach der mittleren Reife in seiner Firma anfinge, um mich von ganz unten nach oben zu arbeiten. »Ich werde dir in einem Monat mehr über die wirkliche Welt beibringen, als es die Universitätsfritzen in Jahren könnten«, pflegte er zu sagen. Ich stellte diese Philosophie nicht in Frage. Drei Wochen nach meinem sechzehnten Geburtstag schloß ich die Realschule ab, und schon am nächsten Morgen fing ich bei Cooper’s als Lehrling an. Die ersten drei Jahre arbeitete ich im Fahrzeugpark unter den wachsamen Augen von Buster Jackson, dem Depotleiter, der mich lehrte, die Firmenwagen auseinanderzunehmen und, was wichtiger war, sie wieder zusammenzubauen.
Nach Beendigung meiner Lehre in der Werkstatt durfte ich meine Ausbildung zwei Jahre lang in der Buchhaltung fortsetzen, wo ich die Rechnungslegung lernte und die Anmahnung säumiger Schuldner. Ein paar Wochen vor meinem einundzwanzigsten Geburtstag bestand ich meine Prüfung für den Schwerlasttransport und erhielt den Führerschein ausgehändigt.
Die nächsten drei Jahre fuhr ich kreuz und quer durch den Norden Englands und lieferte für unsere weitverstreuten Kunden von Geflügel bis Ananas alles nur Erdenkliche aus. Jeremy studierte zur selben Zeit an der Sorbonne und machte seinen Magister im schwierigen, fünf Gesetzbücher umfassenden Code Napoléon.
Als Buster Jackson in den Ruhestand ging, übertrug Vater mir die Leitung des Fahrzeugparks. Zu dem Zeitpunkt schrieb Jeremy in Hamburg seine Dissertation über Vor- und Nachteile internationaler Handelsembargos. Bis er schließlich sein Studium beendet und seine erste richtige Stellung — als Partner einer auf Wirtschafts- und Handelsrecht spezialisierten großen Anwaltsfirma in der City annahm, arbeitete ich bereits seit acht Jahren und bekam Lohn dafür.
Ich war im Seminar zwar ehrlich beeindruckt von Jeremy, aber ich spürte, daß unter seiner zur Schau gestellten Leutseligkeit eine kräftige Mischung aus Ambition und Snobismus steckte, der mein Vater mißtraut hätte. Ich hatte das Gefühl, er gab sich nur auf die vage Möglichkeit hin mit uns ab, daß wir irgendwann in Zukunft für Butter auf seine Brötchen sorgen würden. Jetzt erst ist mir bewußt, daß er sich in meinem Fall bereits bei unserer ersten Begegnung Honig erhoffte.
Es änderte nichts an meiner Meinung über diesen Mann, daß er gut fünf Zentimeter größer war als ich und seine Taille um etwa ebensoviel schmäler. Ganz zu schweigen von der Tatsache, daß die attraktivste Frau unseres Kurses Samstag nacht sein Bett mit ihm teilte.
Für Sonntagvormittag hatten wir uns zum Squashspielen verabredet. Er machte mich fertig, offensichtlich ohne selbst ins Schwitzen zu kommen. »Wir sollten das mal wieder tun«, meinte er, als wir unter die Duschen gingen. »Wenn Sie tatsächlich vorhaben, aufs europäische Festland zu expandieren, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein.«
Vater hatte mich gelehrt, nie den Fehler zu begehen und anzunehmen, daß Kollegen und Freunde dasselbe sind (als Beispiel nahm er da gern das Kabinett, also die Regierungsmannschaft). So kam es, daß ich, auch wenn ich Jeremy nicht sonderlich mochte, seine zahlreichen Telefon- und Faxnummern hatte, als ich nach Beendigung des Seminars Bristol verließ.
Am Sonntagabend fuhr ich nach Leeds zurück, und kaum zu Hause angekommen, rannte ich die Treppe hoch zum Schlafzimmer, setzte mich auf die Bettkante und erzählte meiner schläfrigen Frau ausführlich, weshalb sich das Wochenende als so überaus lohnend erwiesen hatte.
Rosemary war meine zweite Frau. Helen, meine erste, ging zur selben Zeit, als ich die in der Nähe liegende Realschule besuchte, auf die Leeds High-School für Mädchen. Die zwei Schulen teilten sich eine Sporthalle. Ich verliebte mich mit dreizehn in Helen, während ich zuschaute, wie sie Korbball spielte. Von da ab fand ich immer irgendeine Ausrede, mich in der Sporthalle aufzuhalten, in der Hoffnung, sie in ihrer blauen Turnhose zu sehen, wie sie sprang und den Ball zielsicher in den Korb warf. Unsere beiden Schulen hatten einige gemeinsame Projekte. Das nutzte ich und meldete mich zur Teilnahme an einer Aufführung, obwohl ich kein Talent zum Schauspielern hatte. Ich nahm an gemeinsamen Diskussionen teil, allerdings ohne auch nur ein einziges Mal den Mund aufzumachen. Ich wurde sogar Mitglied des von beiden Schulen betriebenen Orchesters und übte mich im Triangelschlagen. Selbst nachdem ich die Realschule abgeschlossen hatte und anfing, im Fahrzeugpark zu arbeiten, trieb es mich zu Helen, die weiter zur Schule ging, um ihre mittlere Reife zu machen. Trotz meiner Gefühle für sie kam es nicht zum Sex, ehe wir beide achtzehn waren, und selbst dann war ich mir nicht sicher, ob wir alles richtig gemacht hatten. Sechs Wochen später gestand sie mir, aufgelöst vor Tränen, daß sie in anderen Umständen sei. Obwohl ihre Eltern nicht sehr erfreut darüber waren — sie hatten gehofft, Helen würde ihr Abitur machen und dann auf die Uni gehen —, heirateten wir in aller Eile. Ich war insgeheim hocherfreut über die Folgen unseres jugendlichen Leichtsinns, denn ich wollte mein ganzes Leben lang nur Helen lieben.
Aber Helen starb in der Nacht zum 14. September 1964 bei der Geburt unseres Sohnes Tom, der nur eine Woche alt wurde. Nach ihrem Tod interessierte ich mich jahrelang für keine andere Frau und steckte meine ganze Energie in die Firma.
Nach der Beerdigung meiner Frau und meines Sohnes lernte ich an meinem Vater, der weder ein weicher noch sentimentaler Mann war — von der Art findet man in Yorkshire nicht viele —, eine völlig neue Seite kennen. Er rief mich abends häufig an, um festzustellen, wie es mir ging, und bestand darauf, daß ich ihn samstagnachmittags regelmäßig zum Fußballspiel begleitete. Jetzt erst verstand ich, weshalb meine Mutter ihn nach über zwanzigjähriger Ehe immer noch so liebte.
Rosemary lernte ich etwa vier Jahre später bei einem Ball zur Eröffnung des Leeds’ Musikfestival kennen. Üblicherweise nahm ich an solchen Veranstaltungen nicht teil, aber da Cooper’s eine ganzseitige Werbung im Programmheft bezahlt hatte, lud Brigadier Kershaw, der High Sheriff der Grafschaft und Vorsitzender des Ballkomitees uns ein. Ich hatte keine andere Wahl, als in meinen selten benutzten Smoking zu schlüpfen und meine Eltern zu diesem Ball zu begleiten.
Mein Platz war an Tisch 17, neben einer Miss Kershaw, die, wie ich im Lauf des Abends erfuhr, die Tochter des High Sheriff war. Sie war sehr elegant in einem schulterfreien blauen Abendkleid, das ihre gute Figur betonte, hatte einen roten Wuschelkopf und ein Lächeln, das mir das Gefühl gab, wir wären alte Freunde. Bei etwas, das die Karte als »Avokado mit Dill« beschrieb, erzählte sie mir, daß sie eben ihr Englischstudium auf der Durham-Universität beendet hatte und nicht so recht wußte, was sie mit ihrem weiteren Leben anfangen sollte.
»Lehrerin möchte ich nicht werden«, gestand sie mir, »und bestimmt bin ich nicht als Sekretärin geeignet.« Wir plauderten auch den zweiten und dritten Gang hindurch, ohne unsere anderen Tischnachbarn zu beachten.
Ich fühlte mich geschmeichelt, daß die Tochter des High Sheriff sich überhaupt für mich interessierte, und ich muß ehrlich sein, ich nahm es nicht ernst. Ich war ziemlich überrascht, als sie mir am Ende des Abends zuflüsterte: »Wir sollten in Verbindung bleiben.«
Schon zwei Tage später rief sie mich an und lud mich zum Mittagessen mit ihren Eltern in ihrem Landhaus ein. »Danach könnten wir ein bißchen Tennis spielen. Sie spielen doch Tennis?«
So fuhr ich am Sonntag nach Church Fenton. Das Landhaus der Kershaws sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte — groß und ein wenig verfallen, was, wenn ich es recht bedenke, auch auf ihren Vater zutraf. Aber er schien sehr nett zu sein. Ihre Mutter dagegen war nicht so leicht zufriedenzustellen. Sie stammte von irgendwoher aus Hampshire, und es gelang ihr nicht, zu verbergen, daß sie mich zwar vielleicht für gut genug hielt, hin und wieder etwas für wohltätige Zwecke zu spenden, doch nicht für jemanden, den sie unbedingt bei ihrem Sonntagsmahl dabeihaben wollte. Rosemary ignorierte ihre vereinzelten spitzen Bemerkungen und plauderte angeregt über meine Arbeit mit mir.
Da es den ganzen Nachmittag regnete, fiel das Tennisspiel aus. So nutzte Rosemary die Zeit, mich in dem kleinen Pavillon hinter dem Tennisplatz zu verführen. Anfangs war ich etwas nervös, mit der Tochter des High Sheriff Liebe zu machen, aber schon bald dachte ich mir nichts mehr dabei. Im Lauf der nächsten Wochen begann ich mich jedoch zu fragen, ob ich ihr mehr bedeutete, als eine vorübergehende romantische Abwechslung mit einem Mann der Arbeiterklasse. Das heißt, bis sie anfing über eine Heirat zu reden. Mrs. Kershaw konnte ihre Geringschätzung schon bei dem Gedanken nicht verbergen, daß jemand wie ich ihr Schwiegersohn werden könnte. Doch ihre Meinung sollte bedeutungslos bleiben, da Rosemary es sich nicht ausreden ließ, meine Frau zu werden. Achtzehn Monate später heirateten wir.
Über zweihundert Gäste waren zu dieser etwas protzigen Hochzeit in der Pfarrkirche St. Mary geladen. Aber ich muß gestehen, als ich mich umdrehte, um Rosemary entgegenzublicken, wie sie am Arm ihres Vaters den Mittelgang auf mich zukam, konnte ich nur an meine erste Hochzeitszeremonie denken.
Etwa zwei Jahre lang tat Rosemary ihr Bestes, mir eine gute Frau zu sein. Sie befaßte sich mit unserer Firma, merkte sich die Namen aller Angestellten, ja freundete sich sogar oberflächlich mit den Frauen der oberen Führungskräfte an. Aber ich fürchte, da ich manchmal zu fast allen Tag- und Nachtstunden arbeitete, widmete ich ihr nicht immer die nötige Aufmerksamkeit, derer sie bedurfte. Rosemary sehnte sich nach einem Leben, zu dem die regelmäßigen Besuche des Grand Theatre for Opera North gehörten, nach bis zum frühen Morgen dauernden Dinnerpartys mit ihren alten Freunden und Bekannten; während ich vorzog, auch an Wochenenden zu arbeiten und üblicherweise vor Mitternacht im Bett zu liegen. Für Rosemary erwies ich mich nicht als »ein idealer Gatte«, wie das Stück von Oscar Wilde hieß, in das sie mich kürzlich geschleppt hatte — und es trug auch nicht zur Verbesserung unserer Beziehung bei, daß ich während des zweiten Akts einschlief.
Nach vier Jahren ohne Kindersegen — nicht, daß Rosemary im Bett nicht alles dafür getan hätte —, begannen wir, getrennte Wege zu gehen. Falls sie irgendwelche Affären hatte (so wie ich, wenn ich die Zeit dafür erübrigen konnte), ging sie sehr diskret vor. Und dann lernte sie Jeremy Alexander kennen.
Es dürfte sechs Wochen nach dem Seminar in Bristol gewesen sein, als ich Jeremy anrief und ihn um Rat bat. Ich wollte einen Vertrag mit einer großen französischen Käserei abschließen, der mir das Exklusivrecht einräumen sollte, ihre Produkte an britische Supermärkte zu liefern. Ein Jahr zuvor hatte ich bei einem ähnlichen Geschäft mit einer deutschen Brauerei ziemlich draufbezahlt, und ich konnte es mir nicht leisten, den gleichen Fehler noch einmal zu machen.
»Geben Sie mir alles schriftlich mit sämtlichen Einzelheiten«, hatte Jeremy gesagt. »Ich werde mir den ganzen Papierkram übers Wochenende ansehen und Sie Montag morgen anrufen.«
Er hielt sein Versprechen, und als er anrief, erwähnte er, daß er am folgenden Donnerstag einen Klienten in York besuchen würde, und schlug vor, uns am Tag darauf zu treffen, um den Vertrag gemeinsam durchzugehen. Das war mir recht, und wir verbrachten fast den ganzen Freitag im Cooperschen Versammlungsraum und überprüften jeden Punkt und jedes Komma des Vertrags. Es war ein Vergnügen, einem solchen Profi bei der Arbeit zuzusehen, auch wenn Jeremy die ärgerliche Angewohnheit hatte, mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte zu trommeln, wenn ich nicht sofort verstand, worauf er aus war.
Jeremy hatte sich sogar schon mit dem Anwalt der Käserei in Toulouse über den Vorgang unterhalten. Monsieur Sisley sprach zwar kein Englisch, trotzdem war es Jeremy gelungen, wie er mir versicherte, ihm unsere Probleme klarzumachen, Mir fiel auf, daß er das Wort »unsere« benutzte.
Nachdem wir auch mit der letzten Seite des Vertrags fertig waren, wurde mir bewußt, daß alle anderen in der Firma bereits fürs Wochenende heimgegangen waren, deshalb fragte ich Jeremy, ob er Lust hätte, mit Rosemary und mir zu Abend zu essen. Er blickte auf die Uhr und überlegte kurz, ehe er antwortete: »Gern. Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Auf dem Heimweg setzte ich ihn in seinem Hotel ab, damit er sich umziehen konnte.
Rosemary war alles andere als erfreut, als ich ihr in letzter Minute gestand, daß ich einen ihr völlig Fremden zum Abendessen eingeladen hatte, ohne vorher Bescheid zu geben, obwohl ich ihr versicherte, sie würde sich bestimmt gut mit ihm verstehen.
Ein paar Minuten vor acht klopfte Jeremy an der Haustür. Als ich ihn mit Rosemary bekannt machte, verbeugte er sich knapp und küßte ihr die Hand. Danach nahmen sie den ganzen Abend kaum noch den Blick voneinander. Nur ein Blinder hätte übersehen können, was als nächstes geschehen würde. Meine Bewunderung für Jeremy hatte mich vielleicht nicht gerade blind gemacht, mir aber doch Scheuklappen aufgesetzt.
Jeremy fand bald eine Ausrede nach der anderen, immer mehr Zeit in Leeds zu verbringen, und ich muß gestehen, daß seine plötzliche Begeisterung für den Norden Englands meine Ambitionen für Cooper’s viel mehr förderte, als ich mir ursprünglich auch nur hätte träumen lassen. Schon geraume Zeit hatte ich mit dem Gedanken gespielt, für Cooper’s einen Hausjuristen zu engagieren, und innerhalb eines Jahres nach unserer ersten Begegnung bot ich Jeremy einen Sitz im Vorstand an, mit dem Auftrag, die Firma auf eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft vorzubereiten.
Während dieser Zeit war ich viel unterwegs, um in Madrid, Amsterdam und Brüssel neue Verträge zu schließen, und Rosemary versuchte gar nicht, mich zu Haus zu halten. Inzwischen dirigierte Jeremy die Firma geschickt durch ein wahres Dickicht rechtlicher und finanzieller Probleme. Dank seines Fleißes und Sachverstands konnten wir am 12. Februar 1980 bekanntgeben, daß Cooper’s zu einem etwas späteren Zeitpunkt in diesem Jahr eine Börsenzulassung beantragen würde. Zu diesem Zeitpunkt beging ich meinen ersten großen Fehler: ich schlug Jeremy vor, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft zu werden.
Bei der Finanzierung wurde vereinbart, daß Rosemary und ich einundfünfzig Prozent der Anteile hielten. Jeremy erklärte mir, daß sie aus steuerlichen Gründen in gleicher Höhe zwischen uns aufgeteilt werden sollten. Meine Buchhalter pflichteten ihm bei, und zu der Zeit dachte ich nicht weiter darüber nach. Die übrigen vier Millionen neunhunderttausend Einpfundanteilscheine wurden rasch von Firmen und Privatleuten erstanden, und bereits wenige Tage nach der Börsenzulassung stieg ihr Wert auf zwei Pfund achtzig.
Mein Vater, der im vergangenen Jahr gestorben war, hätte diese geschäftlichen Transaktionen niemals gebilligt, da er noch im Sterbebett davon überzeugt war, daß ein Kontokorrent von zehn Pfund durchaus genüge, ein gutgehendes Geschäft zu führen.
Während der achtziger Jahre florierte die britische Wirtschaft. Im März 1984 überschritten die Cooper’s-Aktien, nach Pressespekulationen über eine mögliche Übernahme, den Fünfpfundpegel. Jerry hatte mir geraten, eines der Angebote anzunehmen, aber ich sagte ihm, ich würde nie zulassen, daß jemand außerhalb der Familie die Kontrolle über Cooper’s übernähme. Danach mußten wir dreimal einen Aktiensplit vornehmen. 1989 schätzte die Sunday Times Rosemarys und mein gemeinsames Kapital auf rund dreißig Millionen Pfund.
Ich selbst hatte mich nie für reich gehalten — schließlich, soweit es mich betraf, waren die Anteile nichts weiter als Blätter aus Papier, die unser Hausjurist verwaltete. Ich wohnte nach wie vor im Haus meines Vaters, fuhr einen fünf Jahre alten Jaguar und arbeitete vierzehn Stunden am Tag. Aus Urlauben hatte ich mir nie etwas gemacht, und ich war von Natur aus sparsam. Irgendwie war Reichtum für mich irrelevant. Ich hätte auch gern so weitergelebt wie bisher, wäre ich nicht eines Nachts unerwartet nach Hause gekommen.
Nach besonders langen und aufreibenden Verhandlungen in Köln hatte ich gerade noch den letzten Flieger nach Heathrow bekommen und ursprünglich beabsichtigt, in London zu übernachten. Doch inzwischen hatte ich genug von Hotels und wollte ganz einfach nichts als nach Hause, trotz der langen Fahrt. Als ich kurz nach ein Uhr in Leeds ankam, sah ich Jeremys weißen BMW in unserer Einfahrt abgestellt.
Hätte ich Rosemary am Nachmittag angerufen, wäre mir die so nahe Bekanntschaft mit dem Gefängnis vielleicht erspart geblieben.
Ich parkte meinen Wagen ebenfalls in der Einfahrt und ging zur Haustür. Da erst wurde mir bewußt, daß nur ein Licht im Haus brannte — im Schlafzimmer im ersten Stock. Ich brauchte keinen Sherlock Holmes, der mir sagen konnte, was dort vorging.
Ich blieb abrupt stehen und starrte eine Zeitlang auf die zugezogenen Vorhänge. Nichts rührte sich. Sie hatten offenbar den Wagen nicht gehört und keine Ahnung, daß ich hier war. Ich kehrte zum Wagen zurück, versuchte so leise wie möglich zu starten und fuhr ins Stadtzentrum. Im Queen’s Hotel fragte ich den Nachtportier, ob Mr. Jeremy Alexander ein Zimmer für diese Nacht gebucht habe. Er schaute nach und bestätigte es.
»Dann werde ich es nehmen«, erklärte ich ihm. »Mr. Alexander übernachtet heute woanders.« Mein Vater wäre stolz gewesen, wie sparsam ich mit Firmengeldern umging.
Ich lag auf dem Hotelbett, konnte jedoch einfach nicht einschlafen. Mein Zorn wuchs mit jeder Stunde. Obwohl ich nicht mehr viel für Rosemary übrig hatte, ja mir sogar eingestand, daß das nie wirklich der Fall gewesen war, verachtete ich Jeremy jetzt. Aber erst am nächsten Tag erkannte ich, wie sehr!
Am folgenden Morgen rief ich meine Sekretärin an und sagte ihr, ich würde von London aus direkt ins Büro kommen. Sie erinnerte mich, daß für vierzehn Uhr eine Vorstandssitzung angesetzt war. Den Vorsitz sollte Mr. Jeremy Alexander übernehmen. Ich war froh, daß sie mein schadenfrohes Lächeln nicht sehen konnte. Ein rascher Blick beim Frühstück auf die Agenda machte unmißverständlich klar, weshalb Jeremy den Vorsitz hatte übernehmen wollen. Doch seine Pläne spielten keine Rolle mehr. Ich hatte bereits beschlossen, die Vorstandsmitglieder darüber aufzuklären, was genau Jeremy beabsichtigt hatte, und dafür zu sorgen, daß er so schnell wie möglich aus dem Vorstand abberufen wurde.
Kurz nach dreizehn Uhr dreißig kam ich in der Firma an und parkte auf dem für den Vorsitzenden reservierten Platz. Vor Beginn der Sitzung war mir gerade noch genug Zeit geblieben, meine Unterlagen durchzusehen, und mir war schmerzhaft bewußt geworden, wie viele der Gesellschaftsanteile von Jeremy kontrolliert wurden und was er und Rosemary zweifellos bereits seit geraumer Zeit geplant hatten.
Jeremy überließ mir wortlos den Platz des Vorsitzenden und bewies kein sonderliches Interesse an den Einzelheiten der Agenda, bis wir zu einem Punkt kamen, der sich mit einer künftigen Aktienemission befaßte. Da versuchte er, einen scheinbar unbedeutenden Antrag durchzusetzen, der schließlich dazu geführt hätte, daß Rosemary und ich die Gesamtkontrolle über die Gesellschaft verloren und nichts gegen ein künftiges Übernahmeangebot hätten unternehmen können. Ich wäre vielleicht darauf hereingefallen, hätte ich nicht in der vergangenen Nacht seinen Wagen in meiner Einfahrt und das gedämpfte Licht hinter dem Schlafzimmerfenster gesehen. Gerade als er glaubte, es wäre ihm gelungen, den Antrag durchzukriegen, bat ich die Gesellschaftsbuchhalter, einen vollständigen Bericht für die nächste Vorstandssitzung anzufertigen, ehe wir eine Entscheidung trafen. Jeremy ließ sich nichts anmerken, außer daß er mit den Fingerknöcheln auf den Sitzungstisch trommelte. Ich war entschlossen, mit dem Bericht seine Absicht zu beweisen und dafür zu sorgen, daß er hier nichts mehr mitzureden haben würde. Wäre nicht meine Ungeduld gewesen, hätte ich, mit der nötigen Zeit, bestimmt eine vernünftigere Möglichkeit gefunden, ihn auszuschalten.
Da niemand mehr etwas vorzubringen hatte, schloß ich die Sitzung um siebzehn Uhr vierzig und lud Jeremy ein, mit Rosemary und mir zu Abend zu essen. Ich wollte sie beisammen sehen. Jeremy schien nicht sehr erbaut davon zu sein. Aber nach einigem Bluffen, daß ich seinen neuen Aktienantrag nicht so ganz verstünde und gern hätte, daß gleichzeitig auch meine Frau damit vertraut gemacht würde, erklärte er sich schließlich einverstanden. Ich rief Rosemary an, daß Jeremy zum Dinner kommen würde, und sie schien noch weniger davon begeistert zu sein als er.
»Du solltest lieber mit ihm in ein Restaurant essen gehen«, meinte sie. »Dort kann Jeremy dich über alles informieren, was sich inzwischen getan hat.« Ich bemühte mich, nicht zu lachen. »Wir haben nicht sehr viel zu essen zu Hause«, fügte sie hinzu. Ich versicherte ihr, daß es nicht das Essen war, worüber ich mir Gedanken machte.
Jeremy traf ungewohnt unpünktlich ein, aber ich hatte seinen üblichen Whisky mit Soda in dem Augenblick bereit, als er durch die Tür trat. Ich muß zugeben, er zog während des Dinners eine brillante Show ab. Rosemary war allerdings weniger überzeugend.
Beim Kaffee im Wohnzimmer gelang es mir, die Konfrontation zu provozieren, der Jeremy während der Vorstandssitzung so geschickt ausgewichen war.
»Warum sind Sie scharf darauf, diese neue Aktienzuteilung mit dieser Hast durchzukriegen?« fragte ich, als er bei seinem zweiten Cognac war. »Es ist Ihnen doch zweifellos bewußt, daß Rosemary und ich dann keine Kontrolle mehr über die Gesellschaft hätten. Sehen Sie denn nicht, daß wir im Handumdrehen übernommen werden könnten?«
Er versuchte ein paar gut einstudierte Phrasen. »Es ist nur zum Nutzen der Gesellschaft, Richard. Sie wissen doch selbst, wie schnell Cooper’s expandiert. Es ist kein Familienunternehmen mehr. Auf lange Sicht ist es der beste Weg für Sie beide, von den Aktionären gar nicht zu reden.« Ich fragte mich, welche Aktionäre er damit im besonderen meinte.
Ich staunte ein wenig, daß Rosemary ihn nicht nur unterstützte, sondern beachtlich viel, selbst von den geringsten Einzelheiten einer Aktienumlegung, verstand. Sie hatte nicht einmal auf den warnenden Blick Jeremys geachtet. Sie war bestens in den Argumenten versiert, die er vorgebracht hatte, und das, obwohl sie bisher keinerlei Interesse an den Transaktionen der Gesellschaft gezeigt hatte. Als sie sich mir zuwandte und sagte: »Wir müssen an unsere Zukunft denken, Darling«, verlor ich schließlich die Beherrschung.
Die Leute aus Yorkshire sind für ihre schonungslose Offenheit bekannt, und meine nächste Frage machte dem Ruf unserer Grafschaft alle Ehre.
»Habt ihr zwei etwa was miteinander?«
Rosemary wurde knallrot. Jeremy lachte etwas zu laut, ehe er sagte: »Ich glaube, Sie haben einen Cognac zuviel getrunken, Richard.«
»Nicht einen Tropfen!« entgegnete ich. »Ich bin so nüchtern wie ein Richter — genau wie vergangene Nacht, als ich heimkam und Ihren Wagen in unserer Einfahrt stehen sah!«
Zum ersten Mal seit ich ihn kannte, hatte ich Jeremy in Verlegenheit gebracht, wenngleich nur einen Augenblick lang. Er begann auf die Glasplatte des Beistelltischchens zu trommeln.
»Ich habe Rosemary lediglich die neue Aktienemission erklärt«, behauptete er fast ohne zu stocken, »Laut Börsenverordnung bin ich dazu verpflichtet.«
»Und es gibt eine Börsenverordnung, die verlangt, daß dergleichen Erklärungen im Bett vorgenommen werden?«
»Machen Sie sich doch nicht lächerlich!« entrüstete sich Jeremy gekonnt. »Ich habe im Queen’s Hotel übernachtet. Rufen Sie doch den Geschäftsführer an!« fügte er hinzu. Er griff nach dem Telefon und reichte es mir. »Er wird bestätigen, daß ich mein übliches Zimmer gebucht habe.«
»Das wird er sicher.« Ich nickte. »Aber er wird auch bestätigen, daß ich in Ihrem üblichen Bett geschlafen habe.«
Im plötzlich einsetzenden Schweigen zog ich den Hotelzimmerschlüssel aus meiner Jackentasche und schwenkte ihn vor den beiden. Jeremy sprang sofort auf.
Ich erhob mich etwas langsamer aus meinem Sessel, fragte mich, was er sich wohl jetzt einfallen lassen würde, und stellte mich vor ihn.
»Es ist Ihre eigene Schuld, Sie verdammter Narr!« stammelte er schließlich. »Sie hätten sich mehr um Rosemary kümmern sollen und nicht nur die ganze Zeit in Europa herumkutschieren! Kein Wunder, daß Sie nahe daran sind, die Firma zu verlieren.«
Komischerweise brachte es mich weniger auf, daß dieser Kerl mit meiner Frau geschlafen hatte, als daß er die Nerven hatte, sich einzubilden, er könne mir auch meine Firma wegnehmen! Ich antwortete nicht, sondern ging einen Schritt auf ihn zu und versetzte ihm einen Kinnhaken. Ich mochte ja fünf Zentimeter kleiner sein als er, aber nach zwanzigjährigem Umgang mit Lastwagenfahrern konnte ich durchaus noch richtig zuschlagen. Jeremy taumelte erst rückwärts, dann vorwärts, ehe er direkt vor meinen Füßen zusammensackte. Im Fallen schlug er sich die rechte Schläfe an der Ecke der Glasplatte an, und sein Cognac schwappte auf den Boden. Er lag reglos vor mir, und Blut sickerte auf den Teppich.
Ich muß zugeben, ich war recht zufrieden mit mir, erst recht, als Rosemary an seine Seite eilte und mir Obszönitäten ins Gesicht schrie.
»Spar dir den Atem für deinen Liebhaber«, riet ich ihr. »Und wenn er zu sich kommt, dann sag ihm, er braucht gar nicht zum Queen’s Hotel fahren, weil ich auch heute nacht wieder in seinem Bett schlafen werde.«
Ich eilte aus dem Haus, fuhr zurück ins Stadtzentrum und stellte den Jaguar auf dem Hotelparkplatz ab. Als ich das Queen’s betrat, war der Empfang leer, und ich fuhr sofort mit dem Lift hinauf und begab mich in Jeremys Zimmer. Ich legte mich aufs Bett, war jedoch viel zu aufgewühlt, als daß ich hätte schlafen können.
Ich war gerade dabei, einzudösen, als vier Polizisten in mein Zimmer stürmten und mich vom Bett zerrten. Einer erklärte mir, ich sei verhaftet, und las mir meine Rechte vor. Ohne weitere Erklärung brachten sie mich zum Millgarth-Revier, wo ich wenige Minuten nach fünf Uhr inhaftiert wurde, nachdem man mir meine Wertsachen abgenommen, in einen braunen Umschlag gesteckt und mir gesagt hatte, daß ich das Recht habe, einen Anruf zu machen. Also rief ich bei Joe Ramsbottom an, weckte seine Frau auf, erklärte ihr, wo ich war, und bat sie, Joe so bald wie möglich zu mir zu schicken. Dann steckte man mich in eine kleine Zelle und ließ mich allein.
Ich setzte mich auf die hölzerne Bank und zermarterte mir den Kopf, weshalb man mich verhaftet hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß Jeremy so dumm war, mich wegen tätlicher Bedrohung anzuzeigen. Als Joe vierzig Minuten später ankam, erzählte ich ihm genau, was am frühen Abend vorgefallen war. Er hörte mir ernst zu, äußerte jedoch keine Meinung und sagte lediglich, daß er versuchen würde, herauszufinden, wessen man mich beschuldigte.
Nachdem Joe gegangen war, befiel mich die Befürchtung, ein Herzanfall oder der Schlag auf die Schläfe, als er gegen die Tischecke geprallt war, könnte zu Jeremys Tod geführt haben. Meine Phantasie lief Amok, während mir die schlimmsten Möglichkeiten durch den Kopf gingen, und ich hielt diese Ungewißheit kaum noch aus, als die Zellentür aufschwang und zwei Kriminalbeamte hereinkamen, mit Joe in ihrem Gefolge.
»Ich bin Chefinspektor Bainbridge«, stellte sich der größere der zwei vor, »und das ist mein Kollege, Sergeant Harris.« Beide hatten müde Augen und zerknitterte Anzüge. Sie sahen aus, als wären sie die ganze Nacht auf den Beinen gewesen, und beide hatten eine Rasur nötig. Ich betastete mein Kinn und stellte fest, das das gleiche auch für mich galt.
»Wir möchten Ihnen ein paar Fragen darüber stellen, was am vergangenen Abend bei Ihnen zu Hause vorgefallen ist«, sagte der Chefinspektor. Ich blickte Joe an, der den Kopf schüttelte. »Wir möchten Sie ersuchen, uns bei den Ermittlungen weiterzuhelfen«, fuhr der Chefinspektor fort. »Wären Sie zu einer schriftlichen Aussage bereit oder einer, die wir auf Band aufnehmen dürfen?«
»Ich fürchte, mein Klient wird im Augenblick gar nichts sagen, Chefinspektor«, warf Joe ein. »Und wird auch keine Aussage machen, ehe ich Näheres weiß.«
Ich war ziemlich beeindruckt. Noch nie zuvor hatte ich Joe so entschlossen erlebt, außer mit seinen Kindern.
»Wir möchten nur gern seine Aussage aufnehmen, Mr. Ramsbottom«, wandte sich Chefinspektor Bainbridge an Joe, als wäre ich gar nicht vorhanden. »Wir sind jedoch durchaus mit Ihrer Anwesenheit während der gesamten Befragung einverstanden.«
»Nein«, lehnte Joe fest ab. »Entweder, Sie stellen meinen Mandanten unter Anklage, oder Sie gehen jetzt besser — sofort.«
Der Chefinspektor zögerte kurz, dann nickte er seinem Kollegen zu. Ohne ein weiteres Wort verließen sie uns.
»Unter Anklage stellen?« rief ich, sobald die Tür hinter ihnen wieder verschlossen worden war. »Unter welche, um Himmels willen?«
»Mord, vermute ich«, antwortete Joe. »Nach allem, was Rosemary ihnen erzählt hat.«
»Mord?« Ich brachte das Wort kaum hervor. »Aber ...« Ungläubig hörte ich zu, als Joe mir berichtete, soviel er von der Aussage hatte erfahren können, die meine Frau den Polizeibeamten in den frühen Morgenstunden gemacht hatte.
»Aber es war doch gar nicht so!« protestierte ich. »Es würde doch bestimmt niemand eine so unerhörte Geschichte glauben!«
»Vielleicht doch, wenn sie erfahren, daß die Polizei eine Blutspur vom Wohnzimmer bis zu der Stelle gefunden hat, wo du deinen Wagen in der Einfahrt geparkt hattest.«
»Das ist unmöglich!« Ich schüttelte den Kopf. »Als ich ging, lag Jeremy noch bewußtlos auf dem Boden!«
»Die Polizei hat auch Blutspuren im Kofferraum deines Wagens gefunden«, erklärte Joe. »Sie sind überzeugt, die Untersuchung wird ergeben, daß es sich um Jeremys Blut handelt.«
»O mein Gott!« stöhnte ich. »Er ist gerissen! Und wie gerissen! Kannst du denn nicht sehen, was sie sich da so fein ausgedacht haben?«
»Nein, ehrlich gesagt, das kann ich nicht«, gestand Joe. »So etwas fällt eigentlich nicht unter die normalen Pflichten eines Hausjuristen. Aber es gelang mir, Sir Matthew Roberts gleich in der Frühe telefonisch zu erreichen, ehe er zum Gericht fuhr. Er ist der beste Strafverteidiger des Nordostbezirks. Er hat heute einen Fall im York Crown Court, versprach jedoch herzukommen, sobald die Verhandlung zu Ende ist. Wenn du wirklich unschuldig bist, Richard, und Sir Matthew dich verteidigt, hast du nichts zu befürchten. Darauf kannst du Gift nehmen.«
Am Nachmittag wurde Anklage gegen mich erhoben, wegen Mordes an Jeremy Anatole Alexander. Die Polizei gab gegenüber meinem Anwalt zu, daß sie die Leiche noch nicht hatten finden können, sie jedoch überzeugt wären, daß es sich nur noch um Stunden handeln könne. Ich wußte, daß sie vergeblich danach suchten. Joe erzählte mir am nächsten Vormittag, daß sie gründlicher in meinem Garten gegraben hatten, als ich während der letzten zwanzig Jahre.
Gegen neunzehn Uhr an diesem Abend schwang die Zellentür wieder auf, und Joe kam in Begleitung eines stattlichen, distinguiert aussehenden Mannes herein. Sir Matthew Roberts war etwa von meiner Größe, aber um ein Beachtliches schwerer. Seine roten Backen und sein warmes Lächeln verrieten, daß er eine gute Flasche Wein ebenso genoß wie die Gesellschaft amüsanter Leute. Er hatte dichtes, gepflegtes schwarzes Haar und trug einen gediegenen dunklen Anzug mit Weste und silbergrauem Binder. Ich mochte ihn vom ersten Augenblick an, als er sich vorstellte und mir versicherte, er wünschte sich, wir hätten uns unter angenehmeren Umständen kennengelernt.
Ich verbrachte den Rest des Abends mit Sir Matthew und ging mit ihm meine Geschichte immer wieder durch. Es entging mir nicht, daß er mir kein Wort glaubte, aber er freute sich offenbar trotzdem, mich zu vertreten. Er und Joe verließen mich kurz nach dreiundzwanzig Uhr, und ich legte mich auf die Pritsche, um die Nacht hinter Gittern zu schlafen.
Ich mußte in Untersuchungshaft bleiben, bis die Polizei sämtliche Unterlagen über den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hatte. Am folgenden Tag wurde ich zum Untersuchungsrichter des Leeds Crown Court gebracht, doch trotz Sir Matthews eloquenter Einwände wurde ich nicht gegen Kaution freigelassen.
Vierzig Minuten später überführte man mich ins Armley-Gefängnis.
Die Stunden wurden zu Tagen, die Tage zu Wochen und die Wochen zu Monaten. Fast wurde ich es müde, noch irgend jemandem, der mir zugehört hätte, zu versichern, daß Jeremys Leiche ganz einfach deshalb nicht gefunden werden konnte, weil er gar nicht tot war.
Als der Fall schließlich neun Monate später im Leeds Crown Court zur Verhandlung anstand, strömten die Reporter nur so herbei und verfolgten den Prozeß mit wahrer Begeisterung. Ein Multimillionär, eine mögliche ehebrecherische Beziehung und eine nichtauffindbare Leiche — das durften sie sich einfach nicht entgehen lassen. Die Sensationspresse übertraf sich schier selbst, indem sie Jeremy als den Evangelisten Lukas von Leeds beschrieb und aus mir einen sexbesessenen Trucker machte. Ich hätte jede Silbe genossen, wäre ich nicht der Angeklagte gewesen.
Mit seiner Eröffnungsrede focht Sir Matthew einen bewundernswerten Kampf für mich. Wie könnte sein Klient ohne eine Leiche überhaupt des Mordes angeklagt werden? Wie hätte ich mich einer Leiche entledigen können, da ich doch die ganze Nacht in einem Zimmer des Queen’s Hotels zugebracht hatte? Wie sehr ich jetzt bedauerte, daß ich in dieser zweiten Nacht nicht noch einmal eincheckte, sondern direkt in Jeremys Zimmer ging. Es sprach auch nicht für mich, daß die Polizei mich noch vollbekleidet auf dem Bett vorgefunden hatte.
Dann hielt der Ankläger seine Rede. Dabei beobachtete ich die Gesichter der Geschworenen. Sie waren verwirrt und hatten offenbar ihre Zweifel über meine Schuld. Dieser Zweifel blieb, bis Rosemary in den Zeugenstand gerufen wurde. Ich ertrug es nicht, sie anzusehen, und ließ meinen Blick deshalb zu der aufregenden Blondine schweifen, die seit Beginn des Prozesses jeden Tag in der vordersten Zuschauerreihe saß.
Etwa eine Stunde lang führte der Staatsanwalt meine Frau behutsam durch die Ereignisse jenes Abends bis zu dem Punkt, da ich Jeremy den Kinnhaken verpaßt hatte. Bis dahin konnte ich jedes ihrer Worte nur bestätigen.
»Und was ist dann geschehen, Mrs. Cooper?« fragte der Staatsanwalt.
»Mein Mann beugte sich über Mr. Alexander und fühlte seinen Puls«, flüsterte Rosemary. »Dann wurde er kreidebleich und sagte: ›Er ist tot! Ich hab’ ihn umgebracht!‹«
»Was hat Mr. Cooper dann getan?«
»Er hat die Leiche auf seine Schulter gehoben und ist damit zur Tür gegangen. Ich habe ihm nachgerufen: ›Was machst du da, Richard?‹«
»Und was hat er geantwortet?«
»Daß er beabsichtige, sich der Leiche zu entledigen, solange es noch dunkel war, und ich sollte alle Spuren von Jeremys Besuch bei uns beseitigen. Da niemand mehr in der Firma gewesen war, als die beiden gingen, würde man annehmen, Jeremy sei noch am gleichen Abend nach London zurückgekehrt. ›Sorg dafür, daß auch nicht die geringsten Blutspuren mehr zu sehen sind‹, lauteten die letzten Worte meines Mannes, als er mit Jeremys Leiche über der Schulter das Zimmer verließ. Da muß ich dann wohl in Ohnmacht gefallen sein.«
Sir Matthew blickte fragend zu mir auf der Anklagebank. Ich schüttelte heftig den Kopf. Er machte ein grimmiges Gesicht, als der Staatsanwalt sich wieder setzte.
»Möchten Sie diese Zeugin ins Kreuzverhör nehmen, Sir Matthew?« fragte der Richter.
Sir Matthew erhob sich bedächtig. »Allerdings, M’lord«, erwiderte er. Er richtete sich zur vollen Größe auf, zupfte an seiner Robe und warf einen Blick auf den Ankläger, ehe er sich der Zeugin zuwandte.
»Mrs. Cooper, würden Sie Mr. Alexander als Freund bezeichnen?«
»Ja, doch nur insoweit, als er ein Kollege meines Mannes war«, antwortete Rosemary ruhig.
»Sie haben sich also nie getroffen, wenn Ihr Mann nicht in Leeds oder etwa geschäftlich außer Landes war?«
»Nur bei gesellschaftlichen Anlässen in Begleitung meines Mannes oder wenn ich in sein Büro ging, um seine Post abzuholen.«
»Sind sie sicher, das waren die einzigen Male, daß Sie sich begegneten, Mrs. Cooper? Gab es nicht andere Gelegenheiten, bei denen Sie längere Zeit mit Mr. Alexander zusammen waren? Beispielsweise in der Nacht vom 17. September 1989, als Ihr Mann unerwartet von einer Reise aufs Festland zurückkam? Hat Mr. Alexander Sie damals nicht mehrere Stunden besucht, als Sie allein zu Haus waren?«
»Nein. Er kam nach der Arbeit kurz vorbei, um mir ein Dokument zu bringen, in das ich Einblick nehmen sollte, aber er hatte nicht einmal Zeit, auf einen Drink zu bleiben.«
»Aber Ihr Mann sagt ...«, begann Sir Matthew.
»Ich weiß, was mein Mann sagt«, unterbrach ihn Rosemary, als hätte sie diese Zeile hundertmal geprobt.
»Ich verstehe.« Sir Matthew nickte. »Dann wollen wir zur Sache kommen, Mrs. Cooper. Hatten Sie zur Zeit seines Verschwindens ein Verhältnis mit Jeremy Alexander?«
»Ist das relevant, Sir Matthew?« unterbrach ihn nun der Richter.
»Allerdings, M’lord. Es betrifft den Kern der Sache«, antwortete mein Anwalt ruhig.
Aller Blicke hafteten nun auf Rosemary. Wenn ich sie doch nur mit meinen Gedanken beeinflussen könnte, die Wahrheit zu sagen.
Sie zögerte keine Sekunde. »Selbstverständlich nicht. Obgleich das nicht das einzige Mal war, daß mein Mann mir das in seiner Eifersucht vorwarf.«
»Ich verstehe«, sagte Sir Matthew erneut. Er machte eine Pause. »Lieben Sie Ihren Mann, Mrs. Cooper?«
»Also wirklich, Sir Matthew!« Der Richter konnte seinen Ärger nicht ganz verbergen. »Wieder muß ich fragen, ob das relevant ist.«
Sir Matthew brauste auf. »Relevant? Es ist von entscheidender Bedeutung, M’lord. Und Euer Lordschaft kaum verhohlene Sympathie für diese Zeugin ist nicht gerade eine Hilfe für mich!«
Der Richter wollte entrüstet etwas erwidern, als Rosemary ruhig sagte: »Ich war immer eine gute und treue Gattin, aber Mord kann ich unter keinen Umständen billigen.«
Die Geschworenen blickten nun alle auf mich, ich hatte das Gefühl, die meisten hätten gern die Todesstrafe wieder eingeführt.
»Wenn das der Fall ist, sehe ich mich gezwungen, Sie zu fragen, weshalb Sie zweieinhalb Stunden gewartet haben, ehe Sie die Polizei verständigten«, sagte Sir Matthew. »Vor allem, da Sie glaubten, wie Sie behaupten, Ihr Mann hätte einen Mord begangen und wäre dabei, sich der Leiche zu entledigen.«
»Wie ich bereits sagte, fiel ich in Ohnmacht, nachdem er das Zimmer verlassen hatte. Ich rief die Polizei sofort, nachdem ich wieder zu mir gekommen war.«
»Wie praktisch«, sagte Sir Matthew. »Vielleicht ist die Wahrheit jedoch, daß Sie die Zeit nutzten, ihrem Mann eine Falle zu stellen, und gleichzeitig Ihrem Liebhaber die Gelegenheit gaben, sich unbemerkt zu entfernen!« Ein Murmeln breitete sich im Gerichtssaal aus.
Wieder intervenierte der Richter. »Sir Matthew, Sie gehen zu weit!«
»Keineswegs, M’lord, mit allem Respekt, ja, nicht einmal weit genug!« Er schwang wieder zu meiner Frau herum.
»Ich sage Ihnen ins Gesicht, Mrs. Cooper, daß Jeremy Alexander Ihr Liebhaber war und immer noch ist und Sie sehr wohl wissen, daß er lebt und sich bester Gesundheit erfreut!«
Trotz des empörten Stammelns des Richters und des Tumults im Gerichtssaal, hatte Rosemary ihre Antwort parat.
»Ich wünschte, er wäre es, damit er vor diesem Gericht bestätigen könnte, daß ich die Wahrheit sage.« Ihre Stimme war sanft und eindringlich.
»Aber Sie kennen die Wahrheit bereits, Mrs. Cooper.« Sir Matthews Stimme hob sich allmählich. »Die Wahrheit ist, daß Ihr Mann das Haus allein, ohne Leiche, verließ und zum Queen’s Hotel fuhr, wo er die restliche Nacht verbrachte, während Sie und Ihr Liebhaber diese Zeit nutzten, quer durch Leeds Spuren zu legen — Spuren, wie ich hinzufügen möchte, die Ihren Mann belasten sollten. Doch was Sie ihm nicht unterschieben konnten, war eine Leiche, da Sie sehr genau wissen, daß Mr. Jeremy Alexander noch lebt. Er und Sie haben sich diese Geschichte ausgedacht und die Indizien fabriziert, um zu profitieren. Stimmt das etwa nicht, Mrs. Cooper?«
»Nein, nein!« schrie Rosemary, und ihre Stimme überschlug sich, ehe sie schließlich in Tränen ausbrach.
»Tun Sie nicht so, Mrs. Cooper! Das sind Krokodilstränen, nicht wahr?« sagte Sir Matthew ruhig. »Nun, da Sie durchschaut sind, mögen die Geschworenen entscheiden, ob Ihr Leid echt ist oder nicht.«
Ich blickte zu den Geschworenen. Sie waren nicht nur auf Rosemarys Vorstellung hereingefallen, sie verabscheuten mich nun, weil ich zuließ, daß mein gefühlloser Macho von Anwalt eine so sanfte, geduldig ihr Leid tragende Frau so grob angriff. Rosemary erwies sich jedoch als sehr wohl fähig, alle von Sir Matthews Fragen scharf zu kontern, was mir verriet, daß sie des Experten Jeremy Alexanders gelehrige Schülerin war.
Als ich an der Reihe war, mich in den Zeugenstand zu begeben, saß die attraktive Blondine wieder in der vordersten Zuschauerreihe und beobachtete mich. Es sah ganz so aus, als genösse sie jeden Augenblick meiner seelischen Qualen.
Noch während Sir Matthew mich befragte, hatte ich das Gefühl, daß meine Version des Tatherganges viel weniger glaubwürdig klang als Rosemarys Aussage, obwohl sie die Wahrheit war.
Das Plädoyer des Staatsanwalts war todlangweilig, aber trotzdem tödlich. Sir Matthews dagegen war subtil und dramatisch, aber ich fürchte, weniger überzeugend.
Nach einer weiteren Nacht im Armley-Gefängnis wurde ich für das Resümee des Richters wieder in den Gerichtssaal gebracht. Es war offensichtlich, daß er von meiner Schuld überzeugt war. Seine Zusammenstellung der Beweise war unausgewogen und unfair, und als er damit endete, die Geschworenen zu belehren, daß seine Meinung die Wahrheitsfindung nicht beeinflussen dürfte, fügte er seinem Vorurteil auch noch Heuchelei hinzu.
Nach ihrem ersten ganzen Tag in Klausur mußten die Geschworenen über Nacht in einem Hotel untergebracht werden — ironischerweise im Queen’s —, und als der kleine dicke Mann mit den verschmitzten Augen und der bunten Fliege schließlich gefragt wurde: Geschworene, befinden Sie den Angeklagten im Sinne der Anklage für schuldig oder nicht schuldig, überraschte es mich nicht, als er laut und deutlich antwortete:
»Schuldig, Mylord.«
Tatsächlich wunderte es mich, daß die Geschworenen nicht zu einer einstimmigen Entscheidung gekommen waren. Ich habe mich seither oft gefragt, wer die zwei Geschworenen gewesen waren, die so von meiner Unschuld überzeugt waren, daß sie auf ihrer Ansicht beharrten. Ich hätte ihnen gern gedankt.
Der Richter starrte auf mich herab. »Richard Wilfred Cooper, Sie wurden des Mordes an Jeremy Anatole Alexander für schuldig befunden ...«
»Ich habe ihn nicht getötet, Mylord!« unterbrach ich ihn mit ruhiger Stimme. »Er ist gar nicht tot. Ich kann nur hoffen, daß Sie lange genug leben, um die Wahrheit zu erkennen.« Sir Matthew wirkte besorgt, als ein Tumult im Gerichtssaal ausbrach.
Der Richter gebot Schweigen, und seine Stimme wurde noch barscher, als er das Urteil verkündete. »Lebenslängliche Haft. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Höchststrafe. Bringen Sie ihn fort!«
Zwei Wärter kamen auf mich zu, faßten mich an den Armen und führten mich die Stufen an der Rückseite der Anklagebank hinunter und zurück in die Zelle, in der ich achtzehn Morgen lang auf den Beginn des Prozesses gewartet hatte.
»Tut mir leid, alter Junge«, sagte der Polizist, der seit Beginn des Verfahrens für mein Wohlergehen zuständig gewesen war. »Wenn Ihre Frau, dieses Luder, nicht gewesen wäre, hätten Sie eine Chance gehabt.« Er schmetterte die Zellentür zu und drehte den Schlüssel, ehe ich ihm beipflichten konnte. Doch Augenblicke später wurde die Tür wieder geöffnet, und Sir Matthew trat ein.
Er blickte mich eine Weile an, bevor er ein Wort herausbrachte. »Ein schreckliches Unrecht, Mr. Cooper!« sagte er schließlich. »Wir werden sofort Berufung einlegen. Ich versichere Ihnen, ich werde keine Ruhe geben, bis wir Jeremy Alexander gefunden und vor Gericht gebracht haben!«
Da wurde mir zum ersten Mal bewußt, daß Sir Matthew an meine Unschuld glaubte.
Man steckte mich in eine Zelle zu einem kleinen Gauner namens Jenkins, der darauf bestand, »Fingers« genannt zu werden. Nicht zu glauben, daß dieser Ganovenausdruck für Taschendiebe selbst an der Schwelle des einundzwanzigsten Jahrhunderts immer noch in zu sein schien. Aber für meinen Zellengenossen war es ein wohlverdienter Name. Ich war noch keine Minute mit ihm allein, da trug er bereits meine Armbanduhr. Er gab sie mir allerdings sofort zurück, als er sah, daß sie mir abging. »Entschuldige«, bat er, »reine Gewohn’eit.«
Die Haft hätte sich als viel schlimmer erweisen können, wenn sich unter meinen Mithäftlingen nicht herumgesprochen hätte, daß ich Millionär war und für gewisse Privilegien gern etwas bezahlen würde. So bekam ich jeden Morgen die Financial Times und dadurch die Chance, mich auf dem laufenden zu halten, was in der City vorging. Es machte mich fast krank, als ich von dem Übernahmeangebot für Cooper’s las. Krank nicht wegen des Angebots von £ 12,50 pro Anteil, was mich nur noch reicher machte, sondern weil mir Jeremys und Rosemarys Absicht schmerzhaft bewußt wurde. Jeremys Aktien dürften jetzt mehrere Millionen Pfund wert sein — Geld, das er nie bekommen hätte, wäre ich zur Stelle gewesen und hätte eine Übernahme verhindern können.
Tag für Tag lag ich Stunden auf meiner Pritsche und nahm jedes Wort der Financial Times in mir auf. Wann immer Cooper’s erwähnt wurde, las ich die Zeilen so oft, bis ich sie auswendig kannte. Die Gesellschaft wurde schließlich übernommen, doch nicht, ehe der Anteil auf £ 13,43 gestiegen war. Ich verfolgte Cooper’s Aktivitäten weiterhin mit größtem Interesse, und meine Befürchtungen wuchsen, was die Fähigkeiten der neuen Firmenleitung betraf, als einige meiner erfahrensten Mitarbeiter entlassen wurden, unter ihnen Joe Ramsbottom. Eine Woche später wies ich meine Makler an, meine Anteile zu verkaufen, sobald sie die Gelegenheit dazu gekommen sahen.
Zu Anfang meines vierten Monats in der Strafanstalt ersuchte ich um Schreibzeug. Ich fand, daß es an der Zeit war, alle Ereignisse aufzuzeichnen, seit jener Nacht, als ich unerwartet nach Hause gekommen war. Jeden Tag brachte mir der Wärter neue Blätter blaulinierten Papiers, und ich schrieb die Chronik, die Sie jetzt lesen. Ein damit verbundener Vorteil war, daß es mir half, meinen nächsten Zug zu planen.