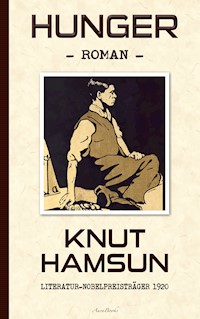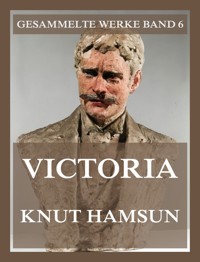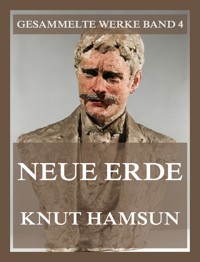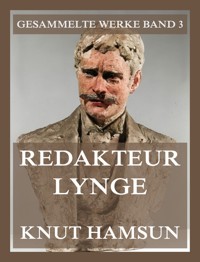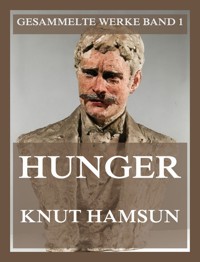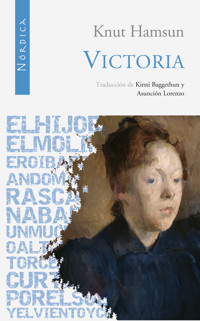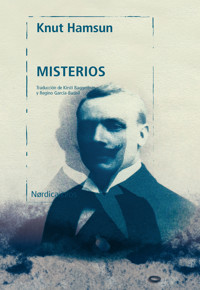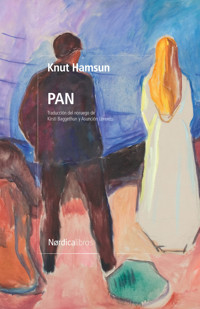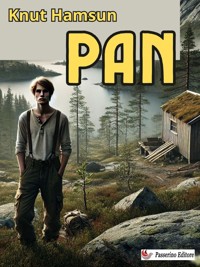Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Weiber am Brunnen: Roman Knut Hamsun - Thomas Mann sagte über den 1920 erschienenen Roman Knut Hamsuns, der im selben Jahr den Literaturnobelpreis erhielt: »Im ganzen: die 400 Seiten sind gedrängt voll von allen Reizen, technischen Verschlagenheiten, dichterischen Intensitäten und intimen Erschütterungen«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Die Weiber am Brunnen
Roman
von
Knut Hamsun
Einzige berechtigte Übersetzung aus dem Norwegischen
von
Pauline Klaiber-Gottschau
11. bis 15. Tausend
Albert Langen, München 1922
Copyright 1921 by Albert Langen, Munich Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, auch für Rußland, vorbehalten
1
Großstadtmenschen haben kein Verständnis für die Maße und Größenverhältnisse der Kleinstadt. Sie meinen, sie dürften nur daherkommen, sich auf den Marktplatz aufstellen und sich überlegen lächelnd umschauen, dürften sich über die Häuser und das Straßenpflaster lustig machen, ja, das denken sie oftmals. Aber können sich nicht die älteren Leute in der Kleinstadt noch an die Zeit erinnern, wo die Häuser noch kleiner und das Pflaster noch schlechter gewesen waren? Sie haben es erlebt, daß der Ort vorwärtskam. Und jedenfalls hat Johnsen am Landungsplatz ein mächtiges Haus bekommen, ein geradezu herrschaftliches Haus; es hat eine Veranda unten und einen Altan darüber und Schnitzwerk das ganze Dach entlang. Viele andere kostspielige Gebäude sind auch entstanden: die Schule, der Speicher am Landungsplatz, verschiedene Kaufmannshäuser, das Zollhaus, die Sparkasse, nein, man braucht nicht über die Kleinstadt zu lächeln. Es ist sogar eine Art Vorstadt da: auf den Felsenhügeln nach der Werft zu wohnen wohl etliche zwanzig Familien; die hübschen kleinen Häuser sind je nach dem Geschmack des Besitzers rot oder weiß angestrichen. Und im übrigen fehlt es auch für Großstädte nicht an Zeiten des Auf- und Niedergangs, das ist ganz gewiß; aber hatte man je gehört, daß Johnsen am Landungsplatz einmal mit leeren Händen dagestanden und sich nicht zu helfen gewußt hätte?
So haben also auch die kleinen Städte ihre Größen, ihre festgegründeten Häuser mit vornehmen Söhnen und Töchtern, ihre Unveränderlichkeit und ihr Ansehen. Und die Kleinstadt ist von ihren Großen hingenommen und verfolgt alles mit reger Teilnahme; die guten Kleinstädter sorgen eigentlich gerade dadurch für das eigene Wohl und Wehe ihres Lebens, sie leben im Schutze der Macht und gedeihen dabei. Und so soll es auch sein. Die Leute entsinnen sich des Tages, wo Johnsen am Landungsplatz Konsul wurde; da gab es Getränke und Kuchen für jeden, der in seinen Laden kam, und verschiedene hatten auch gar keine Scham im Leibe und ließen zweimal ihre Gläser füllen.
An jenem Morgen war der Fischer Jörgen genau wie jetzt auch draußen auf See und holte Fische zu einem großen Gastmahl. Es war ein glänzender, festlicher Tag; der neue Konsul war noch so jung, daß er die Arme weit ausbreitete, außerdem war er so natürlich und so leutselig, daß er Wein, Weiber und Gesang liebte, die ganze Stadt war bei ihm eingeladen. Jawohl, und alles ging ausgezeichnet. Das Ganze wurde in der Zeitung besprochen; auch daran erinnern sich die Leute heute noch, und die Weiber redeten sogar am Brunnen miteinander darüber. Manchmal keiften sie um ganze Kleinigkeiten. Lydia konnte sagen: „Sollte ich das nicht wissen, wo ich doch den ganzen Tag in der Küche dabei gewesen bin!” — Die andere Frau aber bleibt bei ihrer Behauptung: „Du kannst ja hingehen und Johnsen selbst fragen!” — „Das hab' ich für mein Teil gar nicht nötig,” versetzt eine dritte, „denn ich hab' die Zeitung aufgehoben.”
Aber seit jenem großen Tage sind nun wohl sechs bis acht Jahre vergangen.
Und ebensogut wie die Weiber konnte sich auch noch der Schmied Carlsen an jenen Tag erinnern. Er war ein sehr geachteter Mann, ja sogar Witwer mit erwachsenen Kindern, also kein junger Wildfang — nein, er stand in aller Stille in seiner Schmiede und dankte Gott für diesen Festtag ebenso wie für alle andern Tage, die er erleben durfte. So war er, ein frommer Mann war er. Er merkte wohl auf und dachte bei jedem großen, freudigen Ereignis im Ort, daß nun er und alle andern Menschen Gott dafür danken müßten. Viel Worte machte er nicht darüber, und die Leute hätten wohl auch nicht viel auf seine Worte gegeben, aber sie schätzten und achteten ihn. Die Menschen waren zwar zäh und undankbar wie sonst auch, aber der Schmied Carlsen war jedenfalls eine Merkwürdigkeit im Städtchen.
Es gab da auch viele andere Gestalten und Persönlichkeiten: Olaus am Wiesenrain, den Fischer Jörgen, den Schreiner Mattis, den Doktor, den Postmeister, o, es waren gar viele. Der Zahn der Zeit nagt nicht an allen in gleichem Maße, manche sind unveränderlich, sie reden und reden gar viel. Auch der Postmeister ist in seiner Art ein frommer Mann, er und der Schmied Carlsen also sind fromm; aber sonst ist die ganze Stadt weltlich gesinnt und wenig tief angelegt. Es ist, als gebe es gar keinen Pfarrer in der Gemeinde; er tauft, konfirmiert, kopuliert und begräbt zwar die Leute, sonst aber haben sie keine Verwendung für ihn, und es wird nicht von ihm gesprochen.
O, der kleine Ameisenhaufen! Alle Menschen sind von ihrem Eigenen hingenommen, sie begegnen einander auf den Wegen, einer pufft den andern auf die Seite, manchmal schreiten sie übereinander weg. Es geht gar nicht anders, manchmal schreiten sie übereinander weg. —
Jetzt ist der Fischer Jörgen draußen auf See und fängt Fische zu einem großen Gastmahl, genau wie vor sechs bis acht Jahren. Obgleich es Sonntagmorgen ist, sitzt er noch in seinem Boot und möchte so gerne eine ordentliche Menge Fische mit heimnehmen. Drüben am Lande wird es nun allmählich lebendig. Die Morgenbrise setzt ein, Jörgens Boot treibt ab, er muß ordentlich rückwärts rudern, um sich nach den Seezeichen am Ufer richten zu können. Ach was, nun gibt er es auf, er hat seit zwei Uhr draußen gesessen!
Im Ort ist noch niemand auf. Jörgen zieht die Fische auf eine Schnur und trägt sie so durch die Straßen. Er stapft in schweren Stiefeln einher, und im ganzen genommen ist er ein schwerfälliger Mann in einem isländischen Wams und den Südwester auf dem Kopf; sonst aber ist er nicht von hohem Wuchs, eher mager und dazu etwas kurz im unteren Körper. Aber Jörgen ist zäh und ausdauernd, niemals bettlägerig, niemals niedergedrückt; eine Erkältung kuriert er dadurch, daß er sich nicht um sie kümmert.
Er geht nach dem großen Hause von C. A. Johnsen, hängt das Fischbündel da an die Küchentür und stapft nach Hause.
Ja, jetzt raucht es aus seinem Schornstein, Lydia ist also auf; sie hat wohl auf sein Boot acht gegeben und den Kaffee zu rechter Zeit aufgesetzt. Lydia ist seine Frau, sie hat dunkles, lockiges Haar und ist zwar von zorniger Gemütsart, aber außerordentlich tüchtig, eine Frau für sein Haus.
Jörgen stapft hinein. „Nicht so laut!” flüstert Lydia grimmig und sieht mit allen Zeichen des Schreckens nach den Kindern hin, einem Jungen und zwei Mädchen, die sich im Schlafe bewegen. Jörgen zieht Stiefel und Wams aus, trinkt Kaffee, ißt auch dazu, geht dann in die Kammer, um zu schlafen. „Laß die Tür nicht krachen!” zischt Lydia zwischen den Zähnen hervor.
Aber jetzt muß natürlich das älteste von den kleinen Mädchen erwachen und sich aufrichten. Das ist das Gewöhnliche. Und dann wacht auch das andere Mädel auf, das daneben liegt. Die Mutter wird wütend, sie reißt die Kammertür auf und schreit dem Manne nach:
„So, jetzt hast du mir alle miteinander aufgeweckt!” Und sie schrie so lange, bis auch der Junge aufwachte.
Jähzornig war Lydia, aber ihr Zorn war immer schnell wieder verraucht; während die Kinder sich ein wenig unterhielten, räumte sie im Zimmer auf und fing gleich an, ein Liedchen vor sich hinzusummen. Dann öffnete sie die Kammertür äußerst vorsichtig und fragte:
„So, du hast nicht geschlafen? Was ich hab' sagen wollen, du hast doch wohl genügend Fische gefangen? Hast du gehört, was für eine Gesellschaft es sein wird?”
„Nein, sie waren noch nicht auf.”
„Ja, jetzt schweig nur und schlaf' dich aus,” sagt Lydia und macht die Tür wieder zu. Und dann schalt sie die Kinder mit lauter Stimme ordentlich aus, damit sie sich ruhig verhalten sollten.
Sie räumt auf und trällert dazu, sie überlegt, die Gesellschaft ist ihr sehr wichtig. In früheren Jahren, da wurden bei Johnsens am Landungsplatz auch schon Gesellschaften gegeben; man bereitete sich tagelang darauf vor und mußte Hilfe in der Küche haben. Auch Lydia wurde herbeigeholt; diesmal hatte sie keine Aufforderung bekommen, aber vielleicht war es keine große Gesellschaft; wahrscheinlich wollte nur der Sohn, Scheldrup Johnsen, ein paar Altersgenossen bei sich sehen.
Etwas später am Vormittag, als die Leute allmählich unterwegs waren, hieß es, C. A. Johnsens Schiff werde an diesem Tag in See stechen. Da grübelte Lydia nicht mehr; es würde also ein donnerndes Fest für den Kapitän und die Honoratioren der Stadt sein, aber sie wollten in der Küche ohne sie fertig werden. Gut Glück auf die Reise! Sie zog die Kinder hübsch an, wusch ihnen die Flecken heraus, rieb die Schuhe mit Fett und Ruß ein und legte auch für sich ein anständiges Kleid bereit.
Am Nachmittag war eine richtige Wallfahrt nach dem Bollwerk. Man war schon mitten im Frühling, und die Leute trugen demgemäß helle, leichte Kleider; das war ein hübscher Anblick. Der Dampfer Fia hatte geladen und war zur Abfahrt bereit.
Dieses Schiff war nicht mehr neu, es war zu der Zeit gebaut worden, wo ein vernünftiges Frachtboot ein paar hundert Tausend kosten konnte, aber nicht mehr; jetzt hatte es Johnsen am Landungsplatz in Göteborg gekauft. Er hatte es aufputzen lassen und dann nach seinem Töchterchen „Fia” umgetauft. Was das gekostet haben mochte, ein solches Schiff zu kaufen, es herrichten zu lassen und es ganz neu zu machen! Es wurde erzählt, das Umtaufen allein habe einen Haufen Geld gekostet. Aber was war ein Haufen Geld für Johnsen am Landungsplatz! Und jetzt lag die Fia als der einzige Dampfer der Stadt und als ein wahres Wunder drunten am Bollwerk.
Natürlich war die kleine Fia in dem Augenblick, wo ihr Schiff abfahren sollte, selbst an Bord, und sie saß mit ihren Eltern und dem Kapitän in der Kajüte. Und natürlich kam auch ihr Bruder, der junge Scheldrup, an Bord. Er war schon groß und fast erwachsen, in einem hellen Anzug mit einem schwarzen Samtkragen auf der Joppe, was eben Mode war. Ein flotter Bursche, der Sohn des Hauses Johnsen, braunäugig wie der Vater, mit einem leichten Bartflaum auf den Wangen! Die Hüte wurden vor ihm gelüftet, und er grüßte wieder, fast den ganzen Weg nach der Kajüte ging er auf diese Weise barhäuptig.
Das Schiff hatte Dampf auf und stieß Rauch aus. Auf Deck war alles ruhig, der Steuermann und die Mannschaft standen an der Reling, spuckten ins Wasser und schwatzten ein wenig mit den Bekannten am Land. Oliver Andersen wußte, wo sein Platz war, und hielt sich ganz vorne; er war mehrere Jahre lang mit einem Segelschiff gefahren und war Matrose, ein gewöhnlicher blauäugiger Sohn aus dem Volke, aber dazu ein Waghals und Kraftmensch, der Sohn einer Witwe. Er war unter Mittelgröße, aber fest und gut gebaut, hatte früher mit den Bildern von Napoleon Ähnlichkeit gehabt, jetzt aber trug er einen Vollbart und war etwas für sich. Gerade in jenem Jahr hatte er die Möglichkeit gesehen, sein Häuschen mit roten Ziegeln zu decken und es durch einen Ausbau am Giebel zu erweitern. Er dachte wohl an die Zukunft.
„Ja ja,” sagt er zu seiner Mutter, der Witfrau, die mit den Händen unter dem Umschlagetuch am Bollwerk steht. „Ja ja, dann schreib ich dir vom Mittelmeer aus.”
Flott gesagt, sehr erwachsen gesprochen. Und so spricht er auch noch mit mehreren am Land, mit den Mädchen, mit Petra, die er nun verlassen muß.
„Und vergiß nicht, im Garten zu gießen!” sagt er weiter. Aber das war wohl nur ein Scherz von Oliver, und er meinte nichts damit, denn Gott und alle Welt wußten ja, daß er keinen Garten hatte, sondern die Mutter säete nur ein wenig Karotten und Rüben die Hausmauer entlang.
Ein schwaches Lächeln flog über das Gesicht der Mutter, sie kannte ihren Sohn. Böse gemeint? Gott bewahre! So ein Scherz war nicht böse gemeint. Die Mutter wußte nur Gutes von dem Sohne zu sagen, er hatte gute Anlagen und gebrauchte sie in netter Weise.
Der zweite Steuermann kommt einen Augenblick nach vorne; auch er hat wohl ein Mädchen am Ufer stehen. „Schieß die dort auf!” sagt er übertrieben befehlshaberisch, indem er auf eine Leine deutet.
Oliver schießt die Leine auf. Er wäre übrigens gerne eine Minute an Land gegangen, nur eine halbe Minute, um seinem Mädchen eine Tüte Rosinen, die er in der Tasche hat, zu geben. Ganz notwendig hätte er an Land gehen sollen. Aber er will sich jedenfalls auch von da, wo er steht, geltend machen.
„Carlsen!” ruft er, und damit meint er den Schmied Carlsen. „Gut, daß ich Sie sehe! Ich bin Ihnen die Bügel für meine Dachrinne noch schuldig.”
Carlsen ist in Verlegenheit, weil aller Augen auf ihn gerichtet sind, und er sagt:
„Laß das nur, du brauchst dich nicht aufzuhalten, es hat Zeit, bis du wiederkommst.”
Aber Oliver hat schon den Geldbeutel gezogen und reicht das Geld über die Reling weg. „So viel war es wohl?” fragt er.
Oliver fühlte sich wohl recht ehrenhaft und überlegen, als er sich in Gegenwart einer ganzen Volksmenge so zahlungsfähig zeigen konnte. Wer stand da und war Zeuge seiner Handlungsweise? Petra und alle Welt. Und dort stand ja auch Lydia mit ihren Kindern, und ihr entging nichts, sie war die richtige „kluge Else”. Ihr Mann, der Fischer Jörgen, stand auch weiter drüben, aber als sich nun die Honoratioren der Stadt allmählich einfanden und gerade an seiner Ecke vorüberkamen, zog er sich etwas weiter vom Bollwerk zurück und suchte sich einen sichereren Platz.
Nun kamen die Großen, die Schiffsreeder, der Doktor, die geachtetsten Kaufleute; einige waren ganz aufgekratzt von dem Mahl beim Konsul; sie trugen eine Blume im Knopfloch und hatten den hohen Hut auf. Da kam der Rechtsanwalt Fredriksen; der Augenblick war noch nicht gekommen, aber Rechtsanwalt Fredriksen würde sicherlich die Gelegenheit wahrnehmen und einige feierliche Worte sprechen. Er war das Reden gewohnt, er war der in der Stadt, der Versammlungen zusammenbrachte und Reden hielt.
Die Familie Johnsen taucht aus der Kajüte auf, Herr C. A. Johnsen, selbst mit lebhaften braunen Augen und dem runden Bäuchlein des Lebemanns. Frau Johnsen führt die kleine Fia an der Hand. Als sie an Land gingen, machten alle Platz, nicht ein Kind stand im Wege. Leute, die ein Dampfschiff besitzen, müssen einen breiten Weg auf ihrem eigenen Bollwerk haben, das ist nicht mehr als recht und billig.
Der Kapitän stieg rasch hinauf auf die Brücke und klingelte der Maschine. „Fertig! Los!” ruft er. Die Trossen werden hereingezogen. Der Kapitän schwingt die Mütze, seine Familie und Freunde grüßen wieder, das Schiff zittert und weicht zurück. Oliver wirft im letzten Augenblick seine Tüte ans Land, er sieht wohl, daß sie ungefähr da niederfällt, wo sie soll.
Jetzt ist der Augenblick da: Rechtsanwalt Fredriksen tritt vor, lüftet den Seidenhut hoch in die Höhe und erfleht Heil und Glück für das Schiff, die Reeder und die Mannschaft. „Hurra!” ertönt es vom Bollwerk.
Dann fuhr die Fia nach dem Mittelmeer.
Die Tüte traf, jawohl, aber es war eine unwillkommene Tüte und eine schändliche Tüte, sie zerplatzte, als sie niederfiel, und die Rosinen lagen zerstreut auf den Planken des Bollwerks. Das war ein Zustand! Petra lächelte gekränkt und war dem Weinen nahe. Olivers Mutter las die Rosinen in ihr Tuch zusammen, sie hatte ihre liebe Not, die Kinder zurückzuhalten, und ermahnte sie eifrig, doch nicht auf die guten Gaben Gottes zu treten. Die Honoratioren, ja auch die Familie Johnsen kamen an diesem kleinen Walplatz vorüber, insbesondere kam auch der junge Scheldrup Johnsen vorüber. Er lächelte und sagte leise zu Petra: „Heb' deine Rosinen auf!” Petra war wie mit Blut übergossen; sie ließ den Kopf hängen und wäre sicherlich am liebsten in die Erde versunken ...
Die Weiber am Brunnen redeten noch lange von diesem Tag. Sie konnten wohl in der und jener Kleinigkeit uneinig sein, aber Frau Johnsen war jedenfalls in schwarze vornehme Seide gekleidet gewesen und hatte einen Überwurf mit seidenen Fransen über den Schultern getragen. Ihr Hut war sogar von ganz besonderer Art, mit einem dünnen, breiten Rand, der beim Gehen etwas auf und ab wogte, und mit einer einzigen, großen Feder geschmückt.
Dagegen hatte sich niemand weiter um das gekümmert, was nun folgte, denn jetzt kam das tägliche Leben an die Reihe. Oliver kam im Herbst wieder heim, aber ohne die Fia. Ach ja, er hatte einen Schaden davongetragen, war fast erschlagen worden. Er war ein Krüppel. Da war nichts zu machen. Wenn man aus dem Takelwerk herabstürzt und sich die Rippen bricht, so kann man es ja wohl überstehen, aber es ist jedenfalls ein Ereignis, das man im Gedächtnis behält. Aber Oliver — er geriet unter eine Trantonne und brach sich die Leiste und einen Schenkel er wurde verstümmelt und überstand es. Dann lag er im Krankenhaus in einer kleinen italienischen Küstenstadt, wo er nicht ordentlich verpflegt wurde, und das Bein mußte abgenommen werden. Sieben Monate vergingen, bis er in seine Heimat zurückkehren konnte.
Petra, sein Mädchen, zeigte sich recht gut und hielt sich unter dieser ungeheuren Prüfung aufrecht. Sie war in jeder Weise ebenso gewöhnlich wie andere Mädchen, aber sie hatte auch gute Eigenschaften, daran fehlte es wirklich nicht.
Mattis, der bei einem Schreiner in der Lehre gewesen und jetzt Geselle war, Mattis mit der großen Nase, dieser Mann ging zu Petra und sagte: „Das ist ein großes Unglück.”
„Welches Unglück?” fragte sie.
„Daß der Oliver so heimkommt. Weißt du es nicht?”
Petra antwortete gekränkt und ganz treu: „Soll ich es nicht wissen? Hab' ich nicht einen Brief um den andern bekommen?”
„Er ist verunglückt,” sagte Mattis.
„Jawohl,” erwidert Petra.
„Ja, nun gehört er zu denen, die sich nicht allein durchbringen können, und wie soll es dann gehen?”
Petra antwortete kurz: „Darum brauchst du dich nicht zu kümmern.”
Sie zeigte keinen auffallenden Kummer, legte kein Mitleid mit sich selbst an den Tag, nein, vielleicht hatte sie nicht einmal nennenswertes Mitleid mit ihrem Liebsten.
„Willkommen daheim!” sagte sie zu ihm.
Oliver selbst war schweigsam, aber seine Mutter ergriff das Wort. „Ja ja,” sagte sie, „du siehst nun, wie er heimgekommen ist.”
„Ach so, du hast einen Stelzfuß,” sagte Petra.
Oliver sah nach der andern Seite und erwiderte: „Ja, das versteht sich.”
Die Mutter fügte hinzu: „Und auch eine Krücke.”
„Das ist nur für den Anfang, während ich noch nicht fest und sicher bin.”
„Tut es weh?” erkundigte sich Petra nach dem Bein.
„Kein bißchen!”
„Na, das ist nur gut.” Damit schickte sich Petra zum Gehen an. „Ja, ich wollte nur einmal hereinsehen,” fügte sie hinzu.
Da konnte er ihr ja nicht die zwei Geschenke übergeben, die er mitgebracht hatte, eine weiße Engelsfigur und ein mit verschiedenen Holzarten eingelegtes Kaffeebrett. Warum war sie so trocken und kurz angebunden? Sie wußte ja, daß er ihr immer etwas mitbrachte, wenn er aus fernen Landen heimkehrte, und er hatte sie auch diesmal nicht vergessen. Was den Stelzfuß betraf, so hatte dieser sicher einen recht unvorteilhaften Eindruck auf sie gemacht, das war nicht anders zu erwarten gewesen, aber kalt und kurz angebunden — war Petra kalt? Alles andere als das. O, hört nur den Mattis, der immer anfing, zu jedermann, wer es nur immer hören wollte, zu sagen: „Die Petra, ich möchte sie nicht haben! Denn wenn ein Mädchen zu denen gehört, die schwer schnaufen und mit zitternden Nasenflügeln dastehen, dann bedanke ich mich!”
Oliver mußte allmählich daran denken, sich nach einer Beschäftigung umzutun. Solange es etwas daheim zu essen gab, verzehrte er seine Mahlzeiten und wurde stark und kräftig; er erlangte seinen gesunden Oberkörper wieder wie früher und auch ordentliche Kräfte, aber als die Mutter nichts mehr von seiner Heuer abheben konnte, nahm das Mehl und Fleisch im Hause bedenklich ab. Vielleicht wäre Oliver noch nicht zu alt zum Erlernen eines Handwerks gewesen, er konnte Uhrmacher oder Schneider werden, oder er könnte aufs Seminar kommen und Schullehrer werden. Aber was wäre so eine Frauenbeschäftigung für seine Hände? Und wovon sollte seine Mutter während der Lehrjahre leben? Außerdem war ja das Meer sein Element, das Meer und nichts anderes.
Er war jung und seiner plötzlichen Hilflosigkeit höchst ungewohnt. So saß er meist ruhig da, aß, und wenn er sich in der Stube herumbewegen wollte, half er sich mit den Händen und warf sich von Stuhl zu Stuhl. Er war eifrig damit beschäftigt, sich eine neue Lebensstellung auszudenken; das war eine sonderbare Beschäftigung für den geborenen Matrosen, ja bisweilen hielt er vor lauter Sonderbarkeit mitten in einem Gedanken inne. Er hinfällig, er ein Krüppel! Vorläufig mußte er sich ein Boot verschaffen und fürs Haus etwas fischen. Er hatte einen schlimmen Schaden davongetragen, einen unbestreitbaren, glaubwürdigen Leibesschaden, aber als er das brandige Bein abgeworfen und die Folgen davon überwunden hatte, blieb ihm immer noch ein guter Rest übrig, eine Nettokraft.
Es ging nicht gerade großartig mit dem Fischfang, Frostwetter setzte ein und die Bucht war bis zum offenen Meer hinaus mit Eis bedeckt, nicht einmal das Postschiff konnte die Rinne offen halten, sondern mußte sich jedesmal durchs Eis vorwärtsstoßen. Oliver hätte es wie die andern Fischer machen können, ein Loch ins Eis hacken und da fischen, zu Fuß — sozusagen vom Land aus, das tat Jörgen, das tat auch der alte Martin vom Hügel. Aber Oliver war zu jung in diesem Fach und wollte übrigens auch nicht zu solchen äußersten Mitteln greifen. Die Leute sollten nicht den Eindruck bekommen, er fische aus Not, nein, sondern aus Lust, um sich die Zeit zu verkürzen.
Ernste Tage kamen, eine unbehagliche Weihnachtszeit. Aber zu Neujahr änderte sich das Wetter, ein Sturm setzte ein, und das Eis in der Bucht brach wieder auf. Da ruderte Oliver hinaus und fischte einen Tag um den andern; er blieb immer länger fort, manchmal bis zum Abend, und er brachte auch Fische mit heim. Aber er fischte nicht aus Not, o weit entfernt!
Die Mutter sagte in gleichgültigem Ton: „Es ist wahr, Johnsens am Landungsplatz haben mich gefragt, ob du ihnen nicht Fische bringen könntest.”
„Ich?” sagte Oliver. „So, das sagten sie. Aber ich fische nicht für andere.”
„Ja, das dacht' ich auch,” stimmte die Mutter bei. Sie ließ die Frage fallen, ließ sie ganz und gar fallen und tat, als könne Johnsen am Landungsplatz seine Fische wohl selbst fangen. Schließlich sagte sie: „Ja ja, sie haben eine gute Bezahlung dafür versprochen.”
Schweigen. Oliver grübelte nach. „Der Johnsen am Landungsplatz soll mir zuerst meinen Fuß bezahlen,” sagte er dann.
In dieser ganzen Zeit war nur wenig von Petra zu sehen gewesen, sie hatte wohl ein paarmal einen kurzen Besuch gemacht, hatte ihre Geschenke in Empfang genommen, ein paar gleichgültige Redensarten gewechselt und war wieder gegangen. Sie trug noch immer Olivers Ring und machte auch keine Miene, das Verhältnis abzubrechen, nein, das tat sie nicht; aber Oliver hatte doch so seine ängstlichen Gedanken über dies und jenes. Richtig abgewogen, war er ja auch nicht mehr viel wert, ein halber Mensch, eine Art Mißgestalt, die nichts besaß, selbst sein Anzug fing schon an schäbig zu werden. Ja, er war in seinen Matrosentagen zu leichtsinnig gewesen, er genau wie die andern, und hatte nicht viel auf die Seite gelegt. Das einzige, was er für die Zukunft getan und worauf er vor seinem Fall stolz gewesen war, galt jetzt vielleicht gar nichts: der Anbau am Hause, die neue Stube und die Kammer auf der andern Seite des Flurs. Gott mochte wissen, ob diese Herrlichkeit nun benützt wurde!
Der Winter wollte kein Ende nehmen, das drückte auf die Gemüter und machte die Leute verdrossen.
An einem Sonntag gegen Abend kam Petra und war freundlicher als sonst. „Ich hab' deine Mutter in die Stadt gehen sehen,” sagte sie zu Oliver, „da wollt' ich ein wenig zu dir hereinschauen.”
Oliver ahnte Unrat, sein Mädchen war so fremdartig; sie sagte zärtlich: „Armer Oliver!” und sie äußerte, Gott habe sie beide schwer heimgesucht.
„Ja,” stimmte Oliver bei.
„Das ist nun eben unser Schicksal,” murmelte sie und seufzte.
„Was meinst du?” fragte er.
„Was meinst du selbst?” versetzte sie.
Da gab er sofort nach, teils aus altem Hochmut, teils weil er einsah, daß sie eigentlich recht hatte. Man konnte vor der nackten Tatsache unmöglich die Augen verschließen.
Sie besprachen die Sache miteinander, und sie gebrauchte lauter schonende Worte, aber die Absicht war deutlich.
„Ich verwundere mich nicht über dich,” sagte er mit niedergeschlagenen Augen.
Als sie gehen wollte, schien sie das Schwerste immer noch nicht gesagt zu haben, zuerst ging sie nach der Tür, kam aber dann wieder zu ihm zurück, strich ihm über beide Wangen und hob seinen Kopf auf.
„Jetzt sei nicht gegen uns beide, indem du nein sagst. Ich hab' mir's überlegt. Du hast ja nicht allein dich selbst, sondern auch noch deine Mutter zu versorgen. Das ist nicht so leicht für dich.”
Er sah sie verständnislos an: das hatten sie schon besprochen, nun wollte er nichts mehr davon hören.
„Das weiß ich,” sagte er.
„Und ohne gesunde Glieder und allem andern —”
„Das weiß ich auch,” unterbrach er sie gereizt.
„Nein, so darfst du nicht sein, Oliver!” lockte sie.
Aber als sie merkte, daß er noch mehr Bissiges sagen wollte, runzelte auch sie die Stirn und ging nun plötzlich ohne Umschweife los. „Es nützt nichts, was du sagst, es steht jetzt nicht sehr gut für dich, aber es wird wohl besser werden. Jetzt lege ich ihn hierher, du kannst ihn in etwas verwandeln, es nützt nichts, was du auch sagst, ich lege ihn hier auf den Tisch. Er ist schwer und teuer, ich bin überzeugt, es werden ihn viele kaufen wollen.”
„Was ist es denn? Ach so, der Ring! Ja, leg ihn nur dorthin,” sagte er und nickte.
Sie hätte sich alle Umschweife sparen können, in diesem Augenblick schien er gar nichts dagegen zu haben, den Ring wieder zu bekommen, er war jedenfalls ein Wertgegenstand. Als Petra gegangen war, steckte er ihn sich auf das äußerste Gelenk seines kleinen Fingers und drehte und wendete ihn.
Aber dann wurde er von Rührung übermannt. Ihn verkaufen, den Ring in etwas anderes verwandeln? Nimmermehr! Eher wird er ihn in die Meereswogen versenken. Er wird dieses Andenken sein Leben lang behalten, es an den Sonntagen herausnehmen und es betrachten. Im übrigen dauerte es ja nicht so lange, bis das Leben verging. —
2
Dann ruderte Oliver nicht mehr hinaus und fing nicht mehr jeden Tag Fische. Nein, nicht jeden Tag. Es kam wohl daher, daß die Auseinandersetzung mit Petra ihn etwas mitgenommen hatte, er sah sich nicht nach Arbeit um, faßte keinen Entschluß. Die Mutter konnte fragen: „Fährst du heut nicht hinaus? Nein, wohl nicht?” — Und Oliver konnte erwidern: „Hast du keine Fische mehr?” — „O doch, deshalb hab' ich nicht gefragt,” antwortete die Mutter und schwieg.
Ach, aber sie hätte etwas Mehl und allerlei anderes haben sollen: Seife, Kaffee, Lampenöl, Brennholz, Butter, Zündhölzer, Sirup, lauter notwendige Dinge. —
Mattis, der Schreinergeselle, war eifrig dabei, sich ein Haus zu bauen, er dachte wohl an die Zukunft. Eines Tages humpelte Oliver zu ihm hin und ließ den Ring auf seinem kleinen Finger spielen. Die beiden hatten nichts gegeneinander.
Oliver sagte: „Ich hab' für meinen Anbau zwei Türen machen lassen, sie sind bei deinem Meister gemacht worden.”
„Jawohl,” sagte Mattis, „es war im Winter vorm Jahr.”
„Du könntest mir die Türen abkaufen und sie hier einsetzen.”
„Willst du sie verkaufen?”
„Ja. Da ich sie nicht mehr brauche. Ich hab' mich anders entschlossen.”
„Ich kenne die Türen wohl, denn ich hab' sie selbst verfertigt,” sagt Mattis. „So, du hast dich also anders entschlossen? Du willst dich nicht verändern?”
„Vorerst nicht.”
„Was willst du für die Türen haben?”
Sie wurden bald handelseinig; es waren also gebrauchte Türen und nicht einmal angestrichen; aber Oliver hatte Schlösser und Angeln dazu gekauft, der Preis war demnach gegeben.
Jetzt hatte Oliver nichts mehr zu verkaufen, er konnte doch die Treppe nicht verkaufen. Er und die Mutter lebten eine Zeitlang recht gut von dem Gelde für die Türen; aber nun war der Frühling wieder im Anzug, Oliver war jung und hatte abgetragene Kleider, er könnte sich in neuen besser zur Geltung bringen, und da er nun leider für immer eine Landratte geworden war, hätte er auch gern einen Strohhut gehabt. Die Mutter sah immer weniger hoffnungsvoll in die Zukunft, und meinte, sie hätten ja den Anbau vermieten können, wenn —
Ja, Oliver sagte, er hätte nichts dagegen.
„Aber es sind ja jetzt keine Türen dafür da.”
Nach einem Augenblick der Überlegung sagte Oliver sorglos:
„Türen? Dann kann ich doch wohl zwei Türen machen lassen.”
Die Mutter schüttelte den Kopf.
„Aber es sind auch keine Öfen drin.”
„Öfen? Was sollen die Leute mit Öfen jetzt im Sommer?” fragte er.
„Sollen sie sich nicht kochen? Sollen sie keinen Herd haben?” versetzte sie.
Olivers Kopf hatte sicherlich einen Stoß erlitten, er war im Denken nicht mehr so frisch wie früher.
Er schleppte sich wieder zu Mattis hinüber, sprach eine gute Weile mit ihm und sagte dann: „Ja, du baust dir ein Haus und streichst es an und setzt Türen und Fenster ein, dann hast du wohl im Sinn, dich zu verändern?”
„Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll,” erwiderte Mattis. „Aber es ist nun so, daß ich mir's nicht geradezu aus dem Sinn geschlagen habe.”
„Das versteh' ich!” stimmte Oliver bei und sah dem Schreiner eine Weile bei seiner Arbeit zu. — Sie hatten noch immer nichts gegeneinander. Oliver fuhr fort: „Und wer es nun auch ist, oder wer es nun wird, so bekommt sie bei dir ihr gutes Auskommen. Doch was ich sagen wollte: Hast du schon einen goldenen Ring gekauft?”
„Einen goldenen Ring? Nein.”
„So. Nun, wenn es soweit ist, dann hab' ich einen.”
„Laß mich ihn sehen!” sagt Mattis. „Aber dein Name steht wohl drin.”
„Ja, aber den kannst du herauskratzen lassen.”
Mattis sah sich den Ring an, wog ihn in der Hand und schätzte ihn ab. Sie wurden handelseinig, Mattis kaufte ihn. „Wenn er nur auch paßt,” sagt er.
Oliver antwortete vielsagend: „Das ist das wenigste, was mir Sorge macht. Soweit ich verstehe ...”
Da sah Mattis den andern gerade an und fragte: „Ja, was sagst du dazu?”
„Was ich dazu sage?” erwiderte Oliver. „Das geht mich nichts mehr an. Es wird sich wohl auch für mich Rat schaffen lassen, ich bin noch nicht tot.”
„Nein, das ist sicher und gewiß,” sagte auch Mattis beipflichtend.
„Ja, was meinst du?” fragte Oliver geschmeichelt. „Gibt es keine Aussichten mehr für mich?”
„Du machst nur Spaß, Oliver, du hast dieselben Aussichten wie ich.”
Mattis war sichtlich erleichtert. Sie traktierten sich mit schmeichelhaften Redensarten, ohne Zurückhaltung, aber auch ohne Vertraulichkeit.
„Wie ging es zu, als du zu Schaden kamst?” fragte Mattis. „Mit dem Herunterfallen?”
„Ich?” rief Oliver beleidigt. „Ich bin zuviel draußen gewesen, um herunterzufallen.”
„Ich dachte, du seiest heruntergefallen.”
„Nein, es war eine hereinstürzende Woge.”
„Na, das muß eine ordentliche Woge gewesen sein, die dich kaputt gemacht hat.”
„Jawohl, es war eine Teufelswoge,” versetzte Oliver prahlerisch. „Sie riß die ganze Decklast mit sich, schleuderte mir eine Trantonne gerade in die Arme; sie flog durch die Luft daher, wie eine Kanonenkugel sauste sie auf mich zu.”
„Durch die Luft?”
„Da hörte ich einen Warnungsruf von den andern.”
„Hast du nicht selbst geschrien?”
„Warum hätte ich schreien sollen? Was hätte es mir genützt?”
Mattis schüttelte lächelnd den Kopf und sagte: „Ja, du bist doch immer derselbe!”
Jawohl, Mattis war sichtlich erleichtert, mit Oliver konnte man sehr gut verkehren. Könnte man umgänglicher sein als dieser Mann? Den halben Unterkörper verloren, alles verloren, aber trotzdem — Napoleon! Wenn man ihn in einen Wagen setzte, mit dem Spritzleder vor, dann war er ohne Fehl. —
Oliver und seine Mutter lebten nun wieder eine Zeitlang gut, dazwischen ging er fischen, so daß sie genügend Fische für sich und für die Katze hatten; von dem Geld für den Ring wurden Mehl und Lampenöl gekauft. Aber jetzt hatte Oliver nichts mehr zum Verkaufen, er konnte doch nicht den Kamin auf dem Dache verkaufen.
Die Mutter wurde ängstlicher, so konnte es nicht weitergehen! Sie ließ Andeutungen fallen, daß etwas getan werden müsse, später wagte sie es, sich etwas unzufrieden zu zeigen. Die Krippe war leer. „Du könntest wohl etwas stricken. Kannst du nicht stricken?” fragte sie. Aber Oliver konnte nichts, hatte nichts gelernt, sich keine Mühe gegeben, etwas zu lernen; als er etwas lernen sollte, war er auf See gegangen.
„Ich sollte so notwendig einen Quirl haben,” sagte die Mutter. „Du könntest mir einen Quirl machen, wenn du ein wenig Handgeschick hättest.”
Oliver mußte das von seiten seiner Mutter als unzeitgemäßen Spaß auffassen, und er erwiderte: „Soll ich vielleicht auch Fausthandschuhe stricken?”
Er überlegte, überlegte alle Gründe für und wider, jawohl, etwas mußte getan werden. Immerfort wurde überlegt.
Auf das Wohnhaus konnte nicht mehr aufgenommen werden, als schon darauf stand; das war schon seit lange dem Rechtsanwalt Fredriksen verpfändet. Auf den Anbau war allerdings nichts aufgenommen, und Oliver hatte sich gleich nach seiner Heimkehr wegen einer Anleihe an Fredriksen gewendet, war aber abgewiesen worden. Der Anbau? Den hielt Fredriksen nur für eine ordentliche Instandhaltung des Hauses. „Und das neue Ziegeldach?” fragte Oliver — „Instandhaltung,” sagte Fredriksen. Als Oliver andeutete, er könne anderweitig auf den Anbau Geld aufnehmen, drohte ihm der Rechtsanwalt mit Kündigung seines Geldes und mit einer sofortigen Versteigerung des Hauses. Sie redeten hin und her, und der Rechtsanwalt fragte verwundert: „Bist du wirklich so abgebrannt?” — „Ich?” sagte Oliver und warf sich in die Brust. Ja, das hatte der Rechtsanwalt wirklich geglaubt. Und da er nun durch den Anbau und das neue Ziegeldach erst eine ordentliche Sicherheit für sein Geld hatte, sollte Oliver eine Erklärung unterschreiben, daß alles neue am Haus mit zum Pfandobjekt gehöre — ob er das als anständiger Mensch tun wolle? Und Oliver, eben erst heimgekehrt, von den Seehäfen her an ein flottes Auftreten gewöhnt, außerdem von Natur gutmütig, Oliver unterschrieb. — Er trennte sich von dem Rechtsanwalt in höchst freundschaftlicher Weise.
Das war damals gewesen.
Gar oft bereute er nachher seine Dummheit, aber da war nun nichts mehr daran zu ändern. Oder wie? Könnte er das Haus ohne weiteres verkaufen, den Rechtsanwalt ausbezahlen und ihn los sein? Würde das Geld dazu reichen? Ach, das einzig Sichere dabei wäre jedenfalls, daß er selbst obdachlos dastünde!
Oliver überlegt hin und her. Bisweilen überlegte er, ob er nicht fromm werden, sich einen kleinen Rollwagen anschaffen und in den Dörfern herumfahren sollte.
Die Mutter konnte ihm dies und jenes aus dem Ort berichten, sie hörte mehr als er, sie schnappte manches auf der Straße und am Brunnen auf: Klatschereien, Ereignisse, Lüge und Wahrheit, alles nahm sie mit und brachte es heim. Bisweilen lag es nur in ihrem Kopf und verschwand wieder, aber bisweilen brachte so ein zufälliges Wissen Nutzen. Zum Beispiel, als sie Oliver von Adolf, dem Sohn des Schmieds Carlsen erzählte; Adolf war ein junger Bursche, der sich hatte anheuern lassen und nun zur See ging.
„Wo hat er sich verheuert?” fragte Oliver.
„Auf Heibergs Barke. Es hieß, er wolle sich eine Schiffskiste machen lassen.”
Nach einer kleinen Weile nickt Oliver und sagt: „Er kann mir meine Kiste abkaufen.”
„Die auch?” seufzt die Mutter.
„Was soll ich mit ihr? Ich hab' sie einmal ums andere hinaus- und wieder heimgefahren. Jetzt steht sie da. Nun, sag' du nur dem Adolf, er soll meine Kiste kaufen, ich kann sie nicht mehr sehen.”
Er war auch ganz überzeugt, daß Adolf gern seine Kiste haben wollte. Diese hatte viele Reisen mitgemacht und war seetüchtig, also eine gebrauchte Schiffskiste, die Glück hatte. Oliver hatte sich ja jedesmal, wenn er wieder abreiste, geradezu nach seiner Kiste gesehnt. Lebendig war sie allerdings nicht, nein, aber sie war ein Kamerad, und ein treuer, o ein zärtlicher Freund! Aber Glück auf die Reise, nun mochte sie gehen! Auf der letzten Reise von Italien nach Hause war sie ihm eine richtige Last gewesen; er war ein Krüppel geworden und konnte sie nicht mehr so handhaben wie zuvor, und sie hatte Übergewicht auf der Eisenbahn, er hatte für sie bezahlen müssen. Es war fast, als stehe sie bei ihm in Dienst und zehre an ihm, das Ungetüm — fort mit ihm!
O, aber so ganz gleichgültig war Oliver nun doch nicht, als die Mutter mit Adolf ankam. Da stand nun seine Schiffskiste, und sie war eigentlich häßlich und schwerfällig, aber eben doch nützlich. Sie hatte Fußtritte und Stöße hingenommen, war seit mehreren Jahren grün angestrichen, ja, man hatte sogar Tabak auf dem Deckel klein geschnitten, aber was für ein gutes Stück war sie trotzdem!
„Sie ist, wie du sie hier siehst,” sagte Oliver zu Adolf. „Sie hat sich weder aus feinen Kapitänen oder Maklern oder aus Konsuln etwas gemacht, sondern stand da, wie sie immer gestanden hatte, ist nie von der Stelle gewichen, außer mit Gewalt.”
Adolf kaufte die Kiste und mußte noch allerlei gute Lehren von Oliver anhören. Der abgedankte Matrose konnte dem jungen von dem Leben erzählen, das seiner nun wartete: O ja, ein freies, gesundes Leben, aber nicht eines, mit dem man in jeder Beziehung prahlen konnte. Gottlosigkeit und Schlechtigkeit und erfahrungsreicher Landurlaub, in ausländischen Städten und Hainen verbracht. Ach was, er selbst habe Glück gehabt und jederzeit in den Städten nette Liebchen gefunden, prahlte Oliver, aber es sei nicht immer ohne Streit und Schlägereien abgelaufen. Aber es handle sich nur darum: dem andern eine Hand in den Nacken, die andere in den Rücken, ein Loch mit ihm ins Fenster geschlagen, eins, zwei, drei, hinaus in den Rinnstein! O, man habe nicht immer als Krüppel auf einem Stuhl sitzen müssen!
Oliver fing an zu philosophieren; sein Matrosengeschwätz war leer und abgedroschen, weder besser noch schlimmer, als das anderer Matrosen: Wahrheit und großsprecherische Drohungen, Prahlerei, Frömmigkeit und Notlügen. Er verbreitete sich über die Versuchungen, mischte englische Wörter hinein, warnte vor der Trunksucht: „Du siehst nun, Adolf, wie ich heimgekommen bin. Aber meinst du, es komme vom Zechen und von Ausschweifungen? O nein, immer so nüchtern, wie du jetzt bist! Ach, du lieber Gott, es war auf dem wilden Meere draußen, und was hatte ich verbrochen? Deshalb darfst du dich nie dem Trunke ergeben, wie so mancher andere, dann kann unser Herrgott mit dir tun, was er will, du kannst es nicht ändern. Und wenn sie sehen, daß du Geld bei dir hast, und ziehst englische Pfund heraus, dann sind sie hinter dir her, wie die Möwe hinter einem Rotauge, deshalb mußt du dir, ehe du abfährst, eine Tasche innen in deine Weste nähen lassen.”
„Hast du eine gehabt?” fragte die Mutter.
„Ob ich eine gehabt habe?” Oliver knöpft auf und hat keine Innentasche an seiner Weste. „Sie muß in meinem andern Anzug sein, in meinem Landurlaubsanzug,” sagt er.
„Landurlaubsanzug?” fragt die Mutter.
Oliver überhört die Frage und fährt fort:
„Wie es nun auch ist, Adolf soll sich eine Lehre aus dem Richtigen ziehen und nicht aus dem Unrichtigen. Ja, nun sollst du an das denken, was ich dir gesagt habe, Adolf, und Gott vor Augen haben, wenn du bei Nacht auf Wache bist und am Steuer stehst! Und dann lernst du englisch sprechen und du kannst dich in dieser Sprache, wo du auch hinkommst, ja überall auf der Welt verständlich machen. Sie verstehen dich, ob du dich in einen Salon begibst und ein Glas Bier trinkst oder in die Kirche oder auf ein Konsulat gehst. Aber nimm jetzt nur meine Kiste und schlage dich damit redlich durchs Leben, sie ist an nichts anderes gewöhnt.”
„Was ist denn das für ein Landurlaubsanzug?” fragt die Mutter wieder. „Hast du noch einen andern Anzug als den hier, den du auf dem Leibe trägst?”
„Ob ich noch einen andern Anzug hab'!” versetzt Oliver. „Er kommt von Italien. Was red'st du denn da?”
Aber die Mutter war in Gegenwart eines Dritten mutiger und lächelte nur ein wenig spöttisch. Ach, die Krippe war ganz leer geworden!
Jetzt hatte Oliver nichts mehr zu verkaufen, die Schiffskiste war das letzte gewesen, und es blieb nichts übrig für einen neuen Anzug und einen Strohhut. Aber der eine Tag verging wie der andere, und eines Tages schien Oliver etwas aufzuwachen; er ließ eine Bemerkung fallen, daß er das Boot verkaufen wolle.
„Das Boot!” schrie die Mutter.
Er verbesserte sich und drehte es herum: „Nein, es sei kein Boot zum Verkaufen da, er würde nichts dafür bekommen, es sei ein alter Kasten, der nur noch durch den Teer, mit dem er angestrichen sei, zusammenhänge, er habe es selbst um ein Spottgeld gekauft.”
„Ich muß wohl selbst einmal die Probe machen und hinausfahren,” drohte die Mutter. „Denn du hast es ja aufgegeben.”
Aber mit dem höchsten Grad von Gleichgültigkeit und Geringschätzung für die Worte der Mutter ergriff Oliver seine Krücke und hinkte auf die Straße hinaus.
Feines Wetter! Er schnupperte und spürte die Seeluft. Ein Taubenschwarm ließ sich auf der Straße nieder, Kinder vergnügten sich mit Seilhüpfen. Auch Oliver war einstmals Seil gehüpft.
Er wanderte von einem Laden in den andern. „Ei, da kommt Besuch!” sagten die Leute überall wohlwollend und trugen für den Krüppel eine Sitzgelegenheit herbei. Er mußte einmal ums andere erzählen, wie es zugegangen war, als er zu Schaden kam; dadurch bekam er Übung im Erzählen, und er schmückte die Geschichte immer mehr aus, besonders machte er interessante Zusätze: von dem Krankenlager, von dem Aufenthalt im Hospital, da konnte ihn ja keiner der von der Fia heimkehrenden Kameraden kontrollieren. „Eine der Krankenpflegerinnen ist nicht abgeneigt gewesen, mich zu heiraten —”
„Warum bist du denn nicht darauf eingegangen?”
„Hätt' ich katholisch werden sollen?”
Aber mit der Zeit machte man nicht mehr viel Aufhebens von ihm in den Läden. Er war den Leuten nun nichts Neues mehr, nun mußte er sich selbst eine Sitzgelegenheit verschaffen, oder er mußte mit dem Ellbogen auf dem Ladentisch stehen bleiben, und niemand fragte ihn mehr nach der Krankenpflegerin.
So verging einige Zeit, dann hörten die Besuche in den Läden von selbst auf, er legte sich wieder mehr auf den Fischfang. Johnsen am Landungsplatz hatte ihn persönlich gebeten, ihm das wenige, was er von seinem Fang entbehren könne, zu verkaufen. „Jawohl,” antwortete Oliver, um nicht geradezu nein zu sagen. Dieser Johnsen am Landungsplatz wußte wohl, was er tat, er war der Reeder, der einen verstümmelten Menschen von seinem Schiff daheim hatte, in einem Boot konnte er ihn auch ferner gebrauchen. Aber nein, danke, Oliver aß seine Fische selbst!
Draußen auf dem Wasser traf er den Fischer Jörgen; sie legten ihre Boote zusammen und schwatzten miteinander. Wovon sollten sie übrigens schwatzen? Vom Wetter, vom Fischfang und vom Verdienst. Jörgen war ein Sklave der Arbeit.
„Du liegst hier in der Bucht,” sagte Oliver. „Wenn ich dein Boot hätte, würde ich weiter hinausfahren. Was verdienst du denn am Tag?”
Das sei sehr verschieden. Bisweilen sei es viel, es gebe gute und schlechte Tage, bisweilen sei es wenig.
„Nein, das kann ich dir sagen, Jörgen, daß du hier in der Bucht liegst, gerade wie wir andern Vergnügungsfischer. Von mir will ich nun gar nicht reden, denn ich bin marode und zu nichts nütze. Aber wenn du draußen auf dem Meere wärest, dann könntest du Heilbutten und große Fische fangen.”
„O ja,” stimmte Jörgen bei, „dann könnte ich Walfische fangen.”
Beide lachten, denn dieser Vorschlag von Oliver war ja der reine Spaß und nur so ein Gerede. Dazu hatte Jörgen ja gar nicht das Boot und die nötigen Fischgeräte, und er war ja auch nur ein einzelner Mann.
„Wenn wir uns nun aber zusammentäten und uns ein seetüchtiges Boot anschafften,” sagte Oliver immer noch im Scherz.
Jörgen, der, wie alle andern, geduldig mit dem Krüppel war und sich über die verschiedensten Dinge in ein Gespräch mit ihm einließ, sagte: „Ein seetüchtiges Boot, jawohl, und eine große Fischerei, Tiefmeerleinen, wir könnten den ganzen Fischmarkt an uns ziehen.” Oliver hatte die Ideen, sie kamen ihm nur so zugeflogen und waren nicht viel wert, er war in fremden Landen gewesen, hatte Unglaubliches gesehen und gehört, er hatte Grütze im Kopfe.
„Hier sitze ich und rede,” sagte er, „aber es wird schließlich damit enden, daß ich mich um eine Stelle beim Leuchtturm bewerbe.”
„Ja, das wäre wohl nicht das Schlimmste, was du tun könntest,” meinte Jörgen auch.
„Ich weiß es nicht, aber etwas muß so ein maroder Mann wie ich doch tun.”
„Die Lampe versorgen, das Journal führen, den Seefahrenden in dunkeln Nächten den Weg zeigen. Wenn du nur jemand hättest, der dich empfiehlt,” sagte Jörgen.
„Ich glaube, daß ich Johnsen am Landungsplatz wohl dazu bringen kann, sich für mich zu verwenden. Nun, wollen wir jetzt heimrudern?”
„Nein, ich muß noch eine Weile fischen, denn ich hab' dem Schreiber ein Gericht Fische versprochen und hab' erst ein paar Stück.”
„Was bekommst du für ein Gericht Fische vom Schreiber?”
Jörgen nannte einen mittleren Preis.
Oliver schüttelte den Kopf über die geringe Bezahlung, dann ruderte er weiter und fing auch an, für sich noch zu fischen. Er fischte noch eine Stunde, dann ruderte er mit seiner Beute heim.
Er ruderte und legte sich tüchtig ins Zeug. Es kann ja sein, daß er sich zeigen und Jörgen mit seinen Kräften überraschen wollte, und das erreichte er auch. Oliver war eigentlich wie geschaffen, ja, wie umgeschaffen für ein Leben im Fischerboot; da saß er mit den Rudern, die wie ein schweres Gewicht hin und her gingen, die Glieder, die er brauchte, ja, die hatte er. Diese Wahrheit war es vielleicht auch, die Oliver nach einigen Tagen aufging: Oliver wurde fleißig, fuhr schon bei Tagesgrauen hinaus und fischte den ganzen Tag; er ruderte weiter und weiter hinaus und suchte andere Fischgründe auf, kam dann mit zwei und drei Fischkippen am Tag heim, von denen er einen großen Teil in der Stadt absetzte. Das Geld legte er zurück.
„Du ruderst ja wie ein Dampfschiff daher,” sagte Jörgen. Und dasselbe sagte auch Martin vom Hügel, und der war der älteste Fischer im Ort.
„Meint Ihr? O ja. Ich bin nun eben auch auf den verschiedensten Meeren der Welt gefahren und habe vielerlei gesehen,” versetzte Oliver selbstbewußt.
Jörgen antwortete darauf mit seiner gewohnten sprichwörtlichen Rede! Es sei vieles in der Natur verborgen, von dem wir lernen könnten.
Oliver sagte nicht, wohin er wollte, es war kein ganz einwandfreies Unternehmen, das er vorhatte: er wollte Eier auf den Inseln sammeln. Vielleicht konnte er bei derselben Gelegenheit auch etwas Treibholz für daheim ergattern. Es war eine doppelte Spekulation. Und das erlaubte Unternehmen, Treibholz zu sammeln, mußte das unerlaubte des Eiersammelns verbergen.
3
Nein, der Fischer Jörgen war ganz und gar kein Spekulant, er war Fischer, und es hatte sich für ihn gelohnt, sich mit kleinem Verdienst zu begnügen und seine Bedürfnisse danach einzurichten. Er hatte sein eigenes Haus und sogar noch etwas darüber, seine drei Kinder waren gut und wohlgenährt, Jörgen ging es in jeder Beziehung gut.
Lydia ihrerseits war heftig und jähzornig, aber sie war tüchtig, oho, ein Schermesser und ein Reibeisen, ja eine Säge, ein Hobel und eine Kratzbürste, jawohl, aber unersetzlich für Mann und Kinder. Die Leute hatten sie im geheimen ein wenig zum besten, ihre Eitelkeit war sehr groß, sie putzte sich gerne, es ging fast ins Närrische über, ihre Kinder waren hübscher als die anderer Leute, sie selbst war hübscher als die Frauen in ihrer Nachbarschaft. Es war eine Seuche, die ihr von ihren Mädchentagen her noch anhaftete, sie hatte, als sie noch jung war, in lauter vornehmen Häusern gedient, zuerst bei Kaufmann Heiberg, dann mehrere Jahre bei Johnsen am Landungsplatz, gehörte sie da nicht zu den besseren Leuten! Hatte nicht sogar C. A. Johnsen in jüngeren Jahren eine Auge auf sie geworfen gehabt! Sie entsann sich dessen ganz genau, er hatte nichts bei ihr ausgerichtet, o nein, aber das war nicht seine Schuld gewesen.
Dann hatte sie Jörgen kennen gelernt, und sie hatte ihn drei Jahre lang hingehalten, ihn aber dann doch geheiratet. Er war nicht gerade malerisch fürs Auge, hatte kleine, gewöhnliche Züge und ein harmloses Gesicht, sein dunkler weicher Vollbart war sogar etwas Besonderes. Allerdings war er ziemlich schwerfällig, war auch kein guter Tänzer, Gott und jedermann hörte ihn von weitem, wenn er kam und wenn er ging, das stillsitzende Leben in seinem Boot trug auch nicht zu seiner Leichtfüßigkeit bei. Aber Jörgen war ein zuverlässiger, ruhiger Mann, Lydia hatte noch keinen Tag bereut, daß sie ihn genommen hatte.
Jörgen arbeitete; es ging so weit, daß es ihm nicht wohl war, wenn er des Wetters wegen nicht hinausrudern konnte, und der Frühling und Frühsommer waren widerwärtige Zeiten mit ihren endlosen Festtagen, die man feiern mußte, Ostern und Pfingsten waren ihm eine wahrhaftige Prüfung. Es wäre noch angegangen, wenn er keinen Absatz für seine Fische gehabt hätte, aber wenn die Stadt auch nur klein war, so litt sie doch immer an Fischmangel, und die Fischpreise stiegen mit jedem Jahre. Oliver konnte über den Verdienst spotten, soviel er wollte, der Fischfang im kleinen war eine gute Versorgung, eine ausgezeichnete Versorgung. Und Jörgen hatte überdies in einer Zeitung gelesen, daß der Fischfang von ebenso gesegneter Art sei wie der Ackerbau: es sei ein Einheimsen des Jahresertrags. Auch er stand im Dienste der Erde.
Aber jetzt mußte man an Land liegen. Endlich waren die großen Festtage vorbei, sowie auch Christi Himmelfahrt, der siebzehnte Mai und der Buß- und Bettag, aber Gott schickte Sturm und Unwetter, und das Meer raste, Gott wollte eine dreiwöchentliche Ruhe im Einheimsen des Meeresertrags eintreten lassen; wozu das nun gut sein sollte! Jörgen wanderte mit seinem kleinen Jungen umher, sie wanderten oft, bis sie tropfnaß waren, sie stiegen auch noch auf die Berge, betrachteten das Meer und zählten die Dampfschiffe draußen; dann gingen sie zum Boot hinunter, sahen nach, ob es sicher lag, ob es nicht ausgeschöpft werden mußte. Es war Jörgen wind und weh bei diesem Müßiggängerleben.
Er begegnete Oliver. Da sie nichts anderes zu tun hatten, setzten sie sich unter Dach und hielten einen Schwatz miteinander. Oliver war es nicht wind und weh, ihm ging's körperlich gut, das schlechte Wetter erlaubte ihm müßig zu gehen, der Fleiß war ihm abhanden gekommen. Es war eine Lenkung des Schicksals: kaum hatte er sich vorgenommen gehabt, sich das Geld zu einem neuen Anzug zu verdienen, als auch schon diese langandauernde, gezwungene Untätigkeit einsetzte und sein guter Vorsatz wieder dahinsiechte. Das einzige, worüber er sich jetzt grämte, war, daß er nicht weit hinausfahren und fortbleiben konnte, nun mußte er gezwungenerweise Tag für Tag daheim sein und sich mit seiner Mutter herumstreiten.
Im Philosophieren hatte es Oliver allmählich zu einer ganzen Meisterschaft gebracht. Er war jung, und zuzeiten konnte er eindringlich und heftig über sein Dasein Reden halten. „Seht nun einmal, geht denn alles so hübsch und perlenbestickt, wie man uns aus der Schrift lehrt! Der Olaus vom Wiesenrain hat in einem Jahr einen Minenschuß ins Gesicht bekommen, und es ist davon ganz blau geblieben. Im nächsten Jahr, als er auf der Werft Arbeit gefunden hatte, kam ein Schwengel daher und riß ihm die eine Hand weg. Jetzt trinkt er wie ein Loch und prügelt sich mit seiner Frau. — Nimm, wen du willst, Jörgen, das Unglück kann uns alle verändern und verderben, und wenn wir noch so sehr Gottes Geschöpfe sind.”
„Ja,” sagte Jörgen.
„Ja, ist es nicht wahr? Und wenn du eine noch so gutmütige Seele bist und du bekommst eine Kanonenkugel in den Rücken, so wirst du nicht besser dadurch. Nein, weit entfernt, du wirst gar nicht besser dadurch. Vielleicht meinst du, du werdest besser, wie?”
„Ach, das ist das, was man eine Züchtigung nennt,” sagt Jörgen sanftmütig.
„Du bist ein Schaf, Jörgen. Züchtigung? Das kannst du dir selbst vorsagen, wenn du in ein Unglück gerätst!” — Oliver war plötzlich ganz kreideweiß vor Erregung geworden; aber als Jörgen Miene machte, zu gehen, bereute er seine Heftigkeit, griff in die Tasche und zog eine Tonpfeife heraus: „Willst du sie haben? Ich hab' sie für dich mitgebracht.”
„Hast du das Rauchen aufgegeben?”
„Schon lange. Schon seit dem Krankenhaus. Ich hab' sie einmal im Ausland gekauft. Wenn du sie also gern haben möchtest —”
„Nein. Du mußt sie aufheben.”
Sie gingen heimwärts.
„O, gib dir keine Mühe, dich fromm zu stellen und die Mundwinkel hängen zu lassen, Jörgen. Nein, du brauchst dir keine Mühe zu geben,” sagte Oliver in neu aufflammender Heftigkeit. „Mir geht es genau so, wie du sagst, da hast du also das deine, ich das meine zu tragen. Sieh' nun zum Beispiel, daß du nicht aufs Wasser hinauskannst, kommt es am Ende daher, weil du nun so vermöglich bist, daß du gar nicht mehr ertragen könntest. Ich sag' dir, unser Herrgott rechnet genau — es ist fast, als stehle er dir etwas, jawohl.”
Jörgen runzelte die Stirne und öffnete den Mund, wie wenn er antworten wollte, was auch ihm in diesem Augenblick Ähnlichkeit mit einem heftigen Menschen verlieh. Aber es blieb bei den Vorbereitungen, und er sagte kein Wort.
Oliver beruhigte sich und schlug wieder um: „Aber alles steht in seiner Hand, das weiß ich wohl. Und wenn wir versuchen, nach seinen Vorschriften zu wandeln, dann haben wir nichts dabei zu tun. Du willst also meine Pfeife nicht?”
„Du sollst sie nicht weggeben,” sagte Jörgen ausweichend. Aber als er des Krüppels flehende Miene sah, änderte er seinen Entschluß und sagte:
„Warum soll ich die teure Pfeife haben?”
„Du sollst sie haben!” erklärte Oliver. „Ich gönn' sie dir, ich hab' die ganze Zeit an dich gedacht. In vieler Beziehung kannst du mir auch wieder einen Gefallen tun, ich weiß, daß du es tun wirst.”
Das Haus Oliver hatte sich in der letzten Zeit auch mehrere Male an gefällige Nachbarn um Hilfe gewandt. Oliver selbst hatte sich zurückgehalten, aber die Mutter ging am Abend, wenn die Läden geschlossen waren, hin und entlehnte eine Tasse Kaffeebohnen oder einen tiefen Teller Roggenmehl „bis morgen”. Was konnte die alte Frau alles entlehnen; an einem Abend mußte sie bei Fischer Martin einen kleinen Dorsch entlehnen.
Sie hatte öfters Zwistigkeiten mit dem Sohne: „Aber was in aller Welt hast du denn mit dem Geld angefangen, das du vor dem Sturm verdient hast?” fragte sie.
„Das solltest du nur wissen!” entgegnete er.
Aber die Mutter war zäh, sie gab nicht nach, bis sie ihn eines Tages ordentlich gereizt hatte, da kam er und warf das Geld auf den Tisch; das einzige, was er sich von dem ganzen gerettet hatte, war ein blauer Schlips. Es war übrigens keine große Summe, o nein, es waren mühsam zusammengebrachte Sparpfennige von Fisch zu Fisch; aber viel oder wenig, es war Geld zu einem Anzug und einem Strohhut, nun mußte es springen. Natürlich hätte er es nicht ausgeliefert, wenn nicht Gott selbst mit seinem Unwetter dazwischen gekommen wäre und ihn mitten in seinem guten Vorsatz aufgehalten hätte; mochte das Ganze nun draufgehen! Er richtete sich keck auf und sagte zu seiner Mutter: „Laß mich jetzt eine Weile in Frieden!”
Die Mutter war nicht überwältigt: war das alles? „Ja, ich werde dich sicherlich in Ruhe lassen,” sagte sie. „Aber wenn ich unsere Schulden bezahlen soll, so weißt du, daß das nicht weit reicht.”
Da äußerte er etwas, was schon lange in seinem Kopfe geglimmt hatte. „Für mich selbst hab' ich keine Angst, das mußt du nicht glauben. Kannst du dich durchbringen, dann kann ich's auch.”
„Was meinst du damit?” fragte sie.
„Was ich meine? Ich meine genau das, daß ich ein maroder Mensch bin, und daß ich nicht meine volle Kraft habe. Hast du denn nicht Augen im Kopf?”
„Soll ich betteln gehen?”
„Nicht gerade betteln — nein. Aber könntest du nicht ein klein wenig Hilfe von der Unterstützungskasse bekommen?”
„Ach so!” erwiderte sie und preßte die Lippen zusammen.
„Sollte das so undenkbar sein? Wo ich doch so marode bin.”
„Marode?” schrie sie rasend. „Jetzt will ich dir etwas sagen. Du willst nichts tun, du willst nicht das allergeringste leisten. Warum hast du nicht aufgepaßt und bist gestern hinausgerudert, wo ruhige See war? Heut' ist wieder hoher Seegang.”
„O, es war auch gestern hoher Seegang.”
„So. Aber kannst du mir sagen, warum Jörgen draußen war?”
„War Jörgen draußen? O, für Jörgen ist das nicht schwer, er hat ein neues, gutes Boot,” seufzte Oliver.
Schweigen. Aber die Mutter war jetzt sehr aufgeregt und verbarg das nicht.
„Du verkaufst die Türen vom Haus weg,” sagte sie; „es ist schon viel, daß du nicht auch die Wände verkaufst! Ich wär' froh, wenn ich unter der Erde läge!”
„Ja und ich erst!”
„Du!” höhnte sie. „Nein, du liegst im Hause. Ich bin ganz gewiß, wenn ich von der Kasse etwas bekäme, dann müßte ich dich auch noch ernähren.”
Da brach Oliver über die unvernünftige Rede seiner Mutter in ein lautes Gelächter aus. „Nein, jetzt schweig nur! Hahaha, beim wahrhaftigen Gott. Das übrige kannst du jetzt zu dir selber sagen!”
Nach einiger Zeit waren wieder keine Fische zu den Kartoffeln und kein Holz für den Herd da. Man hatte nur ab und zu einen Tag hinausrudern können; aber Oliver verpaßte die Gelegenheit, und am nächsten Tag war die Bucht schon wieder voller Gischt, ja, der Sturm nahm eher zu, als daß er nachließ. Was sollte nun das bedeuten? Der Himmel war ohne Gnade, noch nie war der Donner so furchtbar über die Stadt hingerollt.
Oliver warf sich in der Stube von einem Stuhl auf den andern, döste dann stundenlang vor sich hin, schlief am Tisch, das Gesicht auf den Armen. Ab und zu griff er mit seinem Stelzfuß nach der Katze aus. Eines Tages kletterte er aufs Dach hinauf. Oliver war ein alter Matrose, er wollte wieder in die Höhe hinauf, er machte sich am Blitzableiter zu schaffen, legte ein paar Ziegel zurecht und stieg wieder hinunter.
Er war jetzt in tiefer Not, regelmäßige Mahlzeiten gab es nicht mehr. Eines Morgens ging die Mutter fort und kam den ganzen Tag nicht wieder; als sie auch am nächsten nicht wieder kam, ging Oliver zu einem kundigen Mann und sagte: „Du mußt mir einen Gefallen tun und nach meinem Blitzableiter sehen, ich fürchte, ich hab' ihn verdorben, als ich die Dachziegel richtig legte.” — „Meinst du, es eile?” fragte der Mann. — „Ja, du müßtest schon so gut sein und gleich mitkommen,” versetzte Oliver. „Es gewittert ja in einem fort, und ich hab' Angst, der Blitz könnte einschlagen.”
Der Mann ging mit, wie alle andern mußte auch er sich dem Krüppel hilfreich erweisen.
Oliver blieb unten, und der Mann stieg aufs Dach hinauf. Er redete zu ihm herunter: „Ja, wenn hier ein Unglück geschehen wäre, dann hättest du dich bei dir selbst bedanken können!”
„Wieso?”
„Himmel, die Leitung ist ja entzwei! Sie geht bis zum Dach, dann hört sie auf. Sie leitet ja den Blitz geradeswegs in den Herd drunten hinein.”
„Ich überlege mir eben, wie gut es ist, daß meine Mutter in dieser Zeit gerade auswärts zu Besuch ist. Das Unglück hätte dann nur mich allein getroffen.”
Der Mann setzt eine neue Leitung ein, und als er fertig ist, fragt Oliver, was es koste. — „Nichts.” — „Doch, ich will dafür bezahlen.” — „Ja ja, aber es hat Zeit. Wenn du einmal einen kleinen Dorsch übrig hast, dann kannst du ihn mir geben.” — „O, dann sollst du ein ganzes Bündel haben,” sagt Oliver.
O, Oliver redete laut und flott, jemand, der eben vorüberging, sollte es hören; Petra war's, die eben vorüberging. Man sollte hören, daß er eben Bezahlung angeboten hatte und daß er gut bezahlen wollte. Ja, wahrhaftig, Petra ging vorüber, sie ging wohl hinüber nach des Mattis neuem Haus, seinem eigenen neuen Haus. Oliver stand da. Er hätte jedenfalls einen neuen Strohhut haben müssen, um ordentlich grüßen zu können. Nichts hatte er.
Die Mutter kam nicht zurück. Was sie wohl mit sich angefangen hatte, ob sie wirklich herumwanderte und bettelte? Oliver nahm seine Wanderungen in die Kramläden wieder auf; er hatte sich nun eine Zeitlang ferngehalten, es fand sich auch wieder eine Kiste, auf der er ausruhen konnte, und ab und zu auch ein Schiffszwieback zum Knabbern. Seht, er aß ja diese steinharten Zwiebacke nur zum Vergnügen, rein des Spaßes wegen, niemand verwunderte sich wohl darüber, der alte Matrose hatte noch Geschmack an der Schiffskost, und er hatte prächtige Zähne.