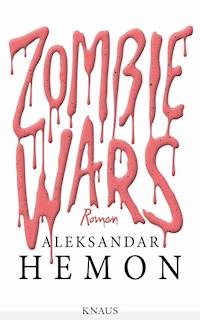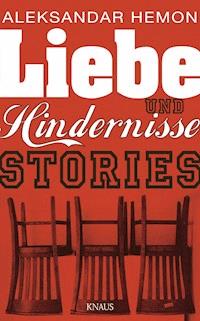20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der lang erwartete neue Roman von Aleksandar Hemon Als Erzherzog Franz Ferdinand an einem Junitag des Jahres 1914 in Sarajevo eintrifft, ist Rafael Pinto damit beschäftigt, hinter dem Tresen der Apotheke, die er von seinem Vater geerbt hat, Kräuter zu zerkleinern. Es ist nicht ganz das Leben, das er sich während seiner Studententage im libertären Wien vorgestellt hatte, aber es ist nichts, was ein Schuss Laudanum, ein Spaziergang und Tagträumereien nicht in Wohlgefallen auflösen könnten. »Als Schriftsteller ist sich Hemon bewusst, wie trickreich man Erinnerungen verfälschen kann, damit sie literaturtauglich werden. Für die Leser sind sie ein Geschenk.« NZZ Und dann explodiert die Welt. Der Krieg verschlingt alles, was er kannte, und das Einzige, worauf Pinto hinlebt, ist die Zuneigung von Osman, einem Kameraden, einem Mann der Tat, der Pintos poetische Seele komplementiert. Ein charismatischer Geschichtenerzähler und Pintos Beschützer und Liebhaber. Gemeinsam entkommen Pinto und Osman den Schützengräben und geraten in die Fänge von Spionen und Bolschewiken. Während sie über Berge und durch Wüsten reisen, von einer Welt in die andere, bis nach Shanghai, ist es einzig Pintos Liebe zu Osman, die überleben wird. Die große, zärtliche, mitreißende Geschichte umspannt Jahrzehnte und Kontinente – und wird Sie erschüttern, wie es die Bücher von Hanya Yanagihara und Douglas Stuart vermögen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Welt und alles, was sie enthält
ALEKSANDAR HEMON wurde 1964 in Sarajevo geboren. 1992 hielt er sich im Rahmen eines Kulturaustauschs in den USA auf, als er von der Belagerung seiner Heimatstadt erfuhr. Er beschloss, im Exil zu bleiben. Seit 1995 schreibt er auf Englisch. Spätestens seit seinem international gefeierten Roman » Das Lazarus-Projekt «, der in Deutschland auf der Shortlist des Internationalen Literaturpreises 2009 stand, gehört er zu den meistbeachteten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur.HENNING AHRENS veröffentlicht als Autor Lyrik und Prosa; zuletzt erschien sein Roman » Mitgift « bei Klett-Cotta. Er übersetzte Lyrik, Kinder- und Jugendbücher sowie zahlreiche Romane aus dem Englischen, darunter solche von Saul Bellow, Jonathan Saran Foer, Richard Powers und Hanif Kureishi.
Krieg hat einen eigenen Geruch und einen eigenen Klang, beide legen sich unwiderruflich über die Menschen, umgeben sie für die Ewigkeit. Die Nackenhaare sträuben sich, die Luft wird knapper, und was noch da ist, stinkt nach Blut und Todesschweiß, und die Angst ist ein Schmerz, sie ist da und auch wieder nicht da, gleich der Erinnerung an ein früheres Leben.»Ein atemberaubender Roman von ebenso großer Schönheit wie Brutalität.«Douglas Stuart»Die Welt und alles, was sie enthält wäre ein gewagter Titel für ein Buch von irgendjemandem außer Gott – oder Aleksandar Hemon. [...] Hemon erzählt eine Geschichte überdie Unverwüstlichkeit wahrer Liebe, ganz gleich, was er sonst noch vorhat.«Ron Charles, The Washington Post
Aleksandar Hemon
Die Welt und alles, was sie enthält
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel The World and All That It Holds bei Farrar, Straus and Giroux, New York, USA.
claassen ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbHwww.ullstein.de
ISBN 978-3-546-10047-2
© 2024 by Aleksandar Hemon, Farrar, Straus and Giroux, New York© der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, MünchenUmschlagmotiv: © Anzinger und Rasp / MidjourneyAutorenfoto: © Velibor BozovicE-Book powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Die Welt
Erster Teil
Sarajevo, 1914
Galizien, 1916
Zweiter Teil
Taschkent, 1918
Taschkent, 1919
Burchmulla, 1920
Ferghanatal, 1921
Dritter Teil
Korla, 1922
Taklamakan-Wüste, 1926
Vierter Teil
Schanghai, 1932
Schanghai 1937
Schanghai, 1949
Epilog
Jerusalem, 2001
Anhang
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Die Welt
Widmung
Für meine Töchter, Ella, Isabel (†) und Esther.Für die Flüchtenden dieser Welt.Motto
Drei Arten von Träumen gehen in Erfüllung: ein Morgentraum, der Traum, den ein Freund über dich träumt, und der Traum, der im Traume selbst gedeutet wird. Manche sagen: auch ein Traum, der sich wiederholt.DER TALMUD:TRAKTAT BERACHOTWenn er mein ist, warum ist er mit anderen?Da er nicht hier ist, wohin ist er entschwunden?DSCHALĀL AD-DĪN MUHAMMAD RŪMĪ:WHERE DID THR HANDSOME BELOVED GODie Welt
Erster Teil
Sarajevo, 1914
Der Geheiligte erschuf Welten und vernichtete sie, erschuf Welten und vernichtete sie, und zu guter Letzt, Er wollte schon aufgeben, erschuf Er diese. Und sie könnte schlechter sein, diese Welt und alles, was sie enthält – immerhin weiß ich, wo die interessanten Substanzen stehen. Mal schauen: Lapis infernalis, Laudanum, direkt daneben Lavendel.
Pinto nahm das Laudanum vom Regal, wobei die Lavendel-Dose zu Boden fiel, wundersamerweise sprang sie nicht auf. Er tropfte etwas Laudanum auf einen Zuckerwürfel, beobachtete, wie dieser bräunlich anlief, und schob ihn sich in den Mund. Während die bittersüße Mixtur auf seiner Zunge zerging, öffnete er die Dose mit Lavendel und sog den Duft in sich auf – in seinem Inneren dehnten sich mediterrane Blumenfelder, das blaue Meer, überwölbt von einem türkisblauen Himmel voller Schwalben, schwappte an seine Seele, das Laudanum segelte auf seinem Blut den ganzen weiten Weg bis zu seinem Geist und darüber hinaus. In seiner Weisheit hatte der Herr alles, was Er bis in die Dämmerung am Vorabend des Schabbats erschuf, durch Laudanum bereichert, auf dass es noch schöner und erträglicher sei.
Rafael Pinto war nun weit besser vorbereitet auf Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger des Habsburgerreichs und Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, und damit auf das Spektakel, das sich in Sarajevo anbahnte, weil sich der Erlauchte nach unserem Befinden erkundigen will. Wir befinden uns wohl, Eure Hoheit, durchaus, vorausgesetzt, es gibt genügend Laudanum und Lavendel, untertänigsten Dank für Eure gnädige Anteilnahme. Dieses Geschäft bietet Arzneien sowohl für den Körper als auch für die Seele, alles, was wir benötigen, ist also reichlich vorhanden, lang lebe der Kaiser, gelobet sei Gott, und möget auch Ihr gesegnet sein.
Dies war der erste sonnige Morgen nach einer grauen, verregneten Woche, endlich fiel wieder Licht durch die Fenster und arrangierte das Schachbrettmuster des Fußbodens immer wieder überraschend neu. Der Zucker hatte sich aufgelöst, doch der bittere Nachgeschmack ließ seine Zunge kribbeln. Gott hüllte sich in weiße Gewänder, die Herrlichkeit Seiner Majestät ließ die Welt erstrahlen, und just hier, auf dem Fußboden der Apotheke Pinto, gewahren wir nun einen Ausschnitt eines dieser weißen Gewänder. Dieses Spiel des Lichts, das alles Sichtbare verändert, wäre ein Gedicht wert. Der Titel könnte »Gottes Gewänder« lauten. Nur stellt sich die Frage, für wen ein solches Gedicht von Interesse wäre. Niemand schert sich um das Licht und dessen Wirkung auf die Seele, nicht hier, in diesem Kuhkaff in Gottes Windschatten.
Seit seiner Zeit in Wien dichtete Pinto auf Deutsch; wenn er auf Bosnisch schrieb, dann nur über Sarajevo. Er versuchte es sogar auf Ladino, nur fühlte sich das stets an, als stammten die Verse von seinem Nono, sie klangen nach abgedroschenen Sprichwörtern wie Bonita de mijel, koransiko de fijel; Kazati i veras al anijo mi lo diras. Im Gegensatz dazu ist das Licht überall und nirgends. Es existiert nicht um seiner selbst willen, wird erst als Gewand manifest, wie auch Gott sich nur in den Makeln Seiner Schöpfung offenbart. Sogar die Finsternis ist in Licht gewandet; in seiner Abwesenheit ist es präsent. Bei unserem Tod geben wir die Finsternis, die wir in uns tragen, dem Licht zurück.
Er stellte Laudanum und Lavendel wieder ins Regal. Auf dem Fußboden waren die Schatten der Schaufensterbeschriftung zu sehen, »Apotheke Pinto«, und während er sie betrachtete, wurde er von zuversichtlicher Leichtigkeit erfüllt wie Lungen von frischem Sauerstoff. Er musste unbedingt die Sammlung alberner Kräuter aussortieren, die Padri Avram über Jahrzehnte auf dem Land erworben hatte. Padri hatte darauf bestanden, den ganzen Mist aus der ehemaligen drogerija in der čaršija mitzunehmen und hier neben den richtigen Arzneien einzuordnen, die er stets als patranjas verächtlich gemacht hatte. All diese vorsintflutlichen, obskuren Kräuter waren inzwischen strohtrocken und wirkungslos, ihre sperrigen türkischen Namen, etwa Amber Kabugi, Bejturan oder Logla-ruhi, Fremdkörper in Pintos penibler alphabetischer Ordnung. Welche Wirkung diesen Zauberkräutern zugeschrieben wurde, entzog sich seiner Kenntnis. Im ehemaligen Laden hatte nur Padri das Klassifizierungssystem gekannt und gewusst, wo sich was befand. Die drogerija war die Manifestierung dessen gewesen, was sich in Padris Kopf befunden hatte – all die Bücher und prikantes, die segula und basme in den Regalen, das nach angebranntem Zucker riechende Halva, das er stets zum Kaffee aß, dazu die unter der Decke wabernden Tabakschwaden, kompakt wie seine Gedanken. Bis heute verirrten sich manche von Padris Landleuten in die Apotheke, sie trugen Kleidung aus stinkendem Schaffell und grobe Lederstiefel, litten an überreifen Furunkeln, die ihre kernigen Gesichter entstellten, an obskuren Gebrechen, deformierten Knochen und fauligen Zähnen. Nach dem Eintreten sahen sie sich um, als wären sie einer schrottreifen Zeitmaschine entstiegen, verwirrt durch den Kampfergeruch, die heitere medizinische Stille und den Marmorfußboden, eingeschüchtert vom barocken Backenbart von Kaiser Franz Joseph, dessen Konterfei sofort ins Auge stach. Einzig das aus dem vergangenen Jahrhundert stammende Porträtfoto Nono Solomons, das gegenüber an der Wand hing, gab ihnen die Gewissheit, am richtigen Ort zu sein: Sie erkannten Nonos Fez, seine gefurchte Stirn, seinen weißen Rauschebart und den Kaftan mit dem Orden, der ihm von keinem Geringeren als Sultan Abdul Hamid an die Brust geheftet worden war. Die Landleute erkundigten sich jedes Mal nach dem alten hećim, und Pinto musste stets erklären, der alte hećim sei tot und begraben und er – Doktor Rafo für sie – der legitime Erbe dieses kleinen Arznei-Imperiums, und er werde ihnen nur eine einzige Pflanze abkaufen, nämlich Lavendel. In den unwirtlichen Bergen rings um Sarajevo gedieh dieser aber kaum, also kehrten die Provinzler ohne Erlös in die dichten, uralten Wälder zurück, in denen sie hausten und mit wilden Tieren kopulierten, und suchten die Apotheke Pinto nie mehr auf, aber das war ihm nur recht. Denn dies war ein nagelneues Jahrhundert, der Fortschritt hielt überall Einzug, und die Zukunft schien so endlos weit zu sein wie ein Meer – niemand vermochte ihr Ende abzusehen. Niemand interessierte sich mehr für Bejturan. Amber Kabugi diente vermutlich dazu, Geister zu beschwören, eine Hexe oder Vila zu bannen, jemandem die Zähne ausfallen zu lassen oder für eine anhaltende Erektion zu sorgen. Letzteres wäre gewiss das kleinere Übel.
Gleich morgens war ein Salut von Kanonenschüssen ertönt, der den Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger des Habsburgerreichs und Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, sowie Ihre Hoheit, die Herzogin, in unserer geliebten, von Gott verlassenen Stadt begrüßte. Nun ertönte ein weiteres Krachen, ein zusätzlicher Willkommensgruß für Ihre Hoheiten. (Pinto sollte erst im späteren Verlauf des Tages erfahren, dass es die Explosion einer Handgranate gewesen war, die ein glückloser, junger Attentäter auf den Wagen des Erzherzogs geschleudert hatte. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass wir den Zäsuren unserer Gegenwart stets hinterherhinken.) Gegenüber hatte Hadži-Besim, wie vom Gouverneur befohlen, die kaiserliche Fahne über seinem Tabakladen gehisst und stand nun darunter, die Daumen in die Westentaschen gehakt. Sein bordeauxroter Fez streifte fast den schwarz-gelben Lumpen mit dem habsburgischen Doppeladler, aber die Farben harmonierten freundlich, und ebenso freundlich war der Anblick seines wohlgerundeten Bauchs. Laudanum sorgt dafür, dass Gottes Gewänder der Welt wie angegossen passen. Pinto fiel siedend heiß ein, dass auch er die Fahne hätte hissen müssen; er hatte es vorgehabt, war jedoch nicht dazu gekommen, aber wem fiele das schon auf, in der Stadt hingen so viele Fahnen. Nono Solomon und der Kaiser starrten ihn stirnrunzelnd an, als wollten sie ihn für das Versäumnis und vieles andere mehr rügen; die zwei altersweisen Greise ließen ihn nicht aus den Augen. Dies war das Jahrhundert des Fortschritts; Großes kündigte sich an. Gedenket der Zukunft! Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger des Habsburgerreichs, erschien höchstselbst in Sarajevo, um sich ein Bild davon zu machen, wie wir leben, um uns zu erläutern, wie wir noch besser leben können.
Und da stand er nun, der Erzherzog, wie ein Prinz, einem Märchen entsprungen, und pochte gegen die Tür der Apotheke, genauer: gegen das A des Schriftzugs »Apotheke Pinto«, obwohl ein Schild darauf hinwies, dass geschlossen war. Man gewahre das berühmte Stahlblau seiner Augen und den gezwirbelten Husarenschnurrbart, den Er, hineinspähend, gegen die Scheibe presst! Was mag Seine Hoheit vom nichtswürdigen Pinto wollen? Was hätte Rafael Pinto dem Thronfolger, abgesehen von immerwährender, unbegrenzter Loyalität oder der Freude, die ihn beim Anblick des hoheitlichen Antlitzes erfüllte, schon zu bieten? Er eilte zur Tür, verlangsamte seine Schritte und umging – vorsichtshalber – das abstruse Spiel von Licht und Schatten. Das Licht verändert die Welt, dennoch bleibt sie gleich, auf ewig warm unter Gottes Gewändern.
Wie sich zeigte, war der Erzherzog nicht der Erzherzog, obwohl er eintrat wie dieser, als würde ihm alles gehören, in der ehrwürdig nach Mottenkugeln riechenden Paradeuniform eines Rittmeisters, mit einer Brustschärpe, straff wie ein vorbildlich gemachtes Bett, mit makellos rasiertem, gepudertem Gesicht, symmetrisch gezwirbeltem, gewichstem Schnurrbart und einem prächtigen Helm mit parfümiertem Rossschweif. Er verströmte einen dezenten Schweißgeruch, roch alles in allem wie das Wien, das Pinto so vertraut gewesen war, wie der erste Tag dieses Jahrhunderts des Fortschritts. Die Ausdünstungen hatten zur Folge, dass sich Pintos Puls beschleunigte, seine Hände feucht wurden. Er wischte sie an der Hose ab.
Der Säbel des Rittmeisters stieß auf der Treppe klackernd gegen die Stufen. Unten angekommen, nahm er den Helm ab, um dann wie auf Kommando herumzufahren. Pinto hielt noch die Tür auf, wieso, wusste er selbst nicht. Hitze und der Lärm eines aufgescheuchten Taubenschwarms, einer aufgeregten Menge schwappten herein. Bitte!, sagte Pinto und schloss die Tür, schloss sie obendrein ab. Bleib, mein schlagendes Herz.
Scheußliche Hitze, sagte der Rittmeister, indem er seine Stirn mit einem blütenweißen Taschentuch abtupfte; furchtbar, unerträglich. Er brauche, ergänzte er, ein Pulver gegen seine rasenden Kopfschmerzen. Dann wollte er wissen, warum keine Fahne über der Tür hing. Er sprach ein barsches Wienerisch; mitten auf dem Bauch zeichnete sich auf seiner Schärpe der Schatten eines A ab, Sterne glitzerten auf dem Uniformkragen. Seine Augen glänzten melancholisch, schwindsüchtig, und Pinto studierte unwillkürlich die geweiteten Pupillen, bis der Rittmeister seinen Blick abwandte, wenn auch einen Atemzug zu spät. Seine Lippen waren rissig, er leckte über die obere. Die Zungenspitze streifte den Schnurrbart.
Was die Fahne angehe, erklärte Pinto, indem er sich verbeugte, so bitte er demütigst um Vergebung – über die Aufregung dieses glorreichen Tages habe er sie vergessen. Er werde sie umgehend und mit Freuden hissen, aber das Pulver, das die Kopfschmerzen des Herrn Rittmeister lindern werde, habe gewiss Vorrang. Der Rittmeister schlug die Hacken zusammen und nickte zustimmend. Er stand aufrecht mitten im Lichtkegel, als wäre es alltäglich für ihn, bewundert zu werden.
In Pinto erwachten schlagartig alle Erinnerungen an die seligen Wiener Jahre, als sein Yetzer Hara die Oberhand hatte: die auf der Promenade an der Donau, in vollen Studentencafés gewechselten Blicke; die heimlichen, erregenden Berührungen in den Volkstheatern; die mit Begehren aufgeladenen Gedichtzeilen, eingestreut in bemüht unschuldige Gespräche; die spitzbübischen Grübchen, die sich auf eines gewissen Hauptmann Freunds Gesicht bildeten, wenn er seine ebenso energischen wie irrigen Meinungen über Frauen, über Sachertorte, über Schubert, über Liebe, über Laudanum, über Oberst Redl, ja sogar – sehr gewagt – über Herrn Pintos exotische Gesichtszüge zum Besten gab, die, so erklärte er, auf ein sehr leidenschaftliches Wesen hindeuteten. Rafael verschloss ihm mit einem Kuss den Mund. Gute Nacht und bis morgen, Hauptmann Freund!
Ach, wir könnten so viel besser leben!
Hinter dem Tresen mörsert Pinto mit bebenden Händen die Ingredienzien des Pulvers und schwelgt dabei in der Vorstellung, die Hand des Rittmeisters scheinbar versehentlich zu streicheln und so sein Verlangen zu übertragen. Der Rittmeister steht vor der Fotografie Nono Solomons, er reckt verwundert das Kinn, als hätte er noch nie einen Sepharden gesehen, was vermutlich zutrifft. Er kann Pinto – ohne Fez, mit Anzug und Krawatte, goldener Uhrkette über dem Bauch und trotz des dunklen Teints durch und durch europäisch – wahrscheinlich nicht mit den Sepiatönen der osmanischen Vergangenheit oder mit Nonos biblischem Stirnrunzeln in Einklang bringen. Wer erschuf den Himmel und die Erde, wer pflanzte dieses hämmernde Herz in meine Brust?
Pinto malt sich aus, wie er die Hand des Rittmeisters ergreift und diesen nach hinten zieht, sein hanino Gesicht mit den Händen umschließt, ihn küsst, einem Impuls nachgibt: die Schärpe wegschieben, die männliche Brust, die infernalischen Abgründe des Körpers, die Berührung seines steifen pata, das vor Lust zerspringende Herz. Es wäre ungefährlich – niemand würde eintreten, die Apotheke hat zu, die Tür ist verriegelt, es ist Sonntag, und alle Welt ist damit beschäftigt, vor Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger des Habsburgerreichs und Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, den Kotau zu machen. Wer sollte da im halbdunklen Hinterzimmer der Apotheke Zeuge eines Kusses werden? Sogar der Geheiligte, überall und nirgendwo zugleich, würde wohl den Blick abwenden, wenn ich meine Lippen auf die seinen drückte. Was du für einen Mitmenschen empfindest, empfindet dieser auch für dich. Schalom, Yetzer Hara!
Pinto stellt das Pulver fertig und kippt es fahrig auf ein Blatt Papier, fegt es zu einem Häufchen, faltet das Blatt dann so gemächlich, als wollte er einen Zaubertrick vorführen. Den dreieckigen Umschlag reicht er dem Rittmeister, der Pintos Zittern vielleicht bemerkt hat. Ihre Finger streifen einander, ihre Blicke begegnen sich.
Selbstverständlich geschieht nichts.
Könnte ich ein Glas Wasser haben?, fragt der Rittmeister.
Rosenwasser?, schlägt Pinto vor.
Der Rittmeister schüttelt sich das Pulver in den Mund; sein Adamsapfel ruckelt auf und ab, als er das Rosenwasser trinkt. Sein Kinn ist leicht gespalten, der Schnurrbart tadellos. Beim Trinken blickt er zur Decke, leert das Glas bis zur Neige, seufzt dann, wie es scheint, vor Behagen. In einer möglichen Zukunft steht der Rittmeister vor einem Spiegel, betörend, in Unterhemd und Reithose, deren Träger längs der Oberschenkel bis auf die Knie hängen. Pinto stellt sich einen Morgen in einem Wiener Zimmer vor – Rasierseife, Zigarettenrauch und eine Rose im Glas neben dem Bett, sie ist noch frisch; zerknittertes Bettzeug; an der Wand das Gemälde eines in einen dunklen Wald führenden Wegs. Kaspar ist sein Name, beschließt Pinto. Kaspar von Kurtzenberger. Guten Morgen, Kaspar, wird er sagen. Guten Morgen, Rafael, wird Kaspar erwidern. Gut geschlafen? Nein, gar nicht, mein Lieber, ich habe die ganze Nacht deinem pochenden Herzen gelauscht.
Vielen Dank, sagt Kaspar. Er reicht Pinto das leere Glas, tupft seine Lippen mit dem blütenweißen Taschentuch ab.
Bitte!, haucht Rafael mit trockener, zugeschnürter Kehle.
Er will losgehen, um die Tür aufzuschließen, doch der Rittmeister, eine Hand auf dem Säbelknauf, steht da und mustert ihn fragend. Er bleibt stumm, sein Blick ist so fest und forschend, als würde er ein Ereignis oder eine Enthüllung erwarten. Höchste Zeit, denkt Rafael, ihm einen Abschiedskuss zu geben. Ihre Blicke treffen sich. Der Rittmeister hat wahrhaftig grüne Augen, er lächelt mit geschlossenen Lippen, neben den Spitzen seines gewichsten Schnurrbarts bilden sich Grübchen.
Bevor der Rittmeister irgendetwas tun oder sagen kann, stellt sich Pinto auf die Zehenspitzen und küsst ihn auf den Ansatz seines Schnurrbarts über der Oberlippe. Er schmeckt Rosenwasser und Tabak, Schnurrbartwichse und Zucker. Der Rittmeister zieht den Kopf zurück; er wirkt nicht erbost, sondern betrachtet sein Gegenüber mit belustigter Überraschung. Pinto wirft einen Blick zur Tür, um zu schauen, ob man sie beobachtet, aber auf der Straße starren alle in die Richtung, aus der der Erzherzog kommen soll; er hört nur fernes Jubeln. Yetzer Hara hat die Oberhand gewonnen, und Pinto kann keinen Gedanken fassen, der nicht dizeu wäre; sein pata wird hart. Er hält noch das Glas und ist sich der Welt außerhalb der Apotheke noch bewusst, aber sie entrückt immer weiter. Pinto küsst den Rittmeister ein zweites Mal, und nun öffnet Kaspar die Lippen, entlässt seinen Rosenatem. Dergleichen hat Pinto noch nie getan, es ist verrückt, ja riskant, das weiß er, und trotzdem kann er sich nicht bremsen. Die Lippen des Mannes sind weich; der Kuss ist flüchtig, aber sanft, und für diesen einen Moment, die muskulöse Brust des Rittmeisters spannt sich, scheint sich ein ganzes zukünftiges Leben aufzutun.
Kaspar, sagt Pinto, seine Wange an dessen Brust schmiegend. Kaspar.
Erst da weicht der Rittmeister einen Schritt zurück, als wäre das, was geschehen ist, nie passiert, und fragt: Was soll das? Und der Zauber zerbricht. Pinto weiß nicht, was er antworten soll, ihm fehlen die Worte, und er weicht ebenfalls einen Schritt zurück, der Tanz ist zu Ende. Er verbeugt sich vor Kaspar, der sich den Mund abwischt, die Hacken zusammenschlägt, die Tür eigenhändig aufschließt und geht, ohne sie hinter sich zuzuziehen.
Pinto steht da wie festgenagelt, er ringt um Atem, der Irrsinn des vorangegangenen Augenblicks scheint ihm erst jetzt aufzugehen. Nun verzehrt er sich, verzehrt sich nach dem, was ihm versagt ist. Das Licht verändert die Welt, und dennoch bleibt sie gleich, es lässt Staubflocken durch die Luft wirbeln, flirrt über den schwarzen und weißen Quadraten des Fußbodens, buchstabiert jede Bedeutung neu, als hätte sich Pintos Geist tief in sich selbst zurückgezogen und eine Leere hinterlassen, bereit für alles, was geschehen möge. Ihn schwindelt, er hat weiche Knie; draußen rückt der Jubel immer näher. Was nun?
Er könnte die Tür abschließen und erneut in den hinteren Bereich der Apotheke fliehen, in sein Leben und seine Vergangenheit, und sich selbst befriedigen, Kaspar vor Augen, der sich so in eine Geschichte verwandeln würde, mitsamt allen Details, die Pinto erinnern kann, eine Geschichte, die er sich immer wieder selbst erzählen würde: der Duft, die grünen Augen, die Küsse, der Geschmack der Lippen. Oder er könnte Kaspar folgen und ihn, nachdem das Trara um den Erzherzog zu Ende wäre, durch die Stadt führen, ihm die čaršija mit den alten Läden und Synagogen zeigen und Rahat Lokum kaufen, dessen Zucker den rittmeisterlichen Schnurrbart pudern würde. Sie würden schlendernd Geheimnisse austauschen, und Pinto würde ihn in Hadži-Šabans Kahvana in ein Hinterzimmer führen, um in Ruhe trinken und plaudern zu können. Doch bevor sich Pinto für das eine oder das andere entscheidet, benötigt er einen Tropfen Laudanum, um seinen rasenden Puls zu beruhigen. Laudanum bringt alles wieder ins Lot.
Als Pinto die Tür hinter sich abschloss, stellte er fest, dass er nicht nur die schwarz-gelbe Fahne aufgehängt hatte, sondern auch die rot-weiße Bosniens; nur hatten sich beide ineinander verheddert – er reckte sich, um sie zu trennen, danach strömten ihre Farben auf ihn herab. Ein strahlender Tag, der Kuss kribbelte noch auf seinen Lippen, alle Farben formierten sich zu Spalieren, und der Schein der Sommersonne hüllte alles ein. Er folgte dem Rittmeister auf der Franz-Josef-Straße bis zum Appel-Kai, ohne zu wissen, was er täte, falls sich Herr Rittmeister Kaspar von Kurtzenberger tatsächlich nach ihm umdrehen, ihm in die Augen schauen und erklären würde: Ich folge Ihnen, wohin Sie auch gehen, Herr Apotheker!
Die Rückkehr in den Lauf der Welt war dennoch ein Genuss, diese herrlichen Schritte in die Zukunft, im Einklang mit seinem Herzen und seinen Sehnsüchten, immer weiter weg von seinem Dasein – oder auch tiefer hinein –, immer voran in ein leuchtendes Netz latent folgenreicher Begebenheiten, immer in Richtung Kaspar. Meine Füße tragen mich an den Ort, den mein Herz noch zu lieben lernen muss. Er sah den Rossschweif über die Köpfe der Menge tanzen – Kaspar war sehr groß – und verharrte an einer Ecke. Könnte er sich bis zu ihm durchschlagen, dann würde er sagen: Herr Rittmeister, zu meiner unbändigen Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass die kaiserliche Fahne stolz über der Tür der Apotheke Pinto weht. Und sollten Sie an einer Führung durch unsere bescheidene Stadt und ihre čaršija interessiert sein – nur ein Wort und ich wäre ganz der Ihre. Ich könnte Ihnen aber auch in meiner Apotheke, in aller Stille, ganz ungestört, einen bosnischen Kaffee kochen. Ihr Wunsch wäre mir Befehl. In diesem Moment wurden Rufe in der Menge laut, es schien sich etwas anzubahnen, doch Pinto drängelte sich durch, bis er nicht mehr weiterkam.
Zwei Männer trennten ihn noch vom Rittmeister, mindestens einer von ihnen stank nach verbranntem Holz. Außerdem trieb sich ein auffällig räudiger Köter zwischen den Leuten herum, als hätte er eine Mission. Die prachtvolle Uniform des Rittmeisters stach in der Menge hervor, seine heroische Schönheit schien ihn von innen heraus erstrahlen zu lassen. Pinto betete, er möge sich nach ihm umdrehen, selbst ganz dizeu. Pinto konnte Kaspars glänzende, glatt rasierte Wange sehen, den Ort des Grübchens und den waagerechten Haaransatz im Nacken. Er legte sich zwei Schritte zurecht – erstens zwischen den beiden Männern durchzwängen, zweitens den Rittmeister ansprechen, diesem so nahe sein, dass der Rosenduft zu riechen wäre; stattdessen stieg ihm der ranzige Gestank von Schweiß und Rauch in die Nase, den die beiden Männer vor ihm ausdünsteten. Einer war eindeutig ein edepsiz, unter dessen schmuddeligem, weitem Kragen lange Haare hervorragten. Wahrscheinlich war es sein Köter. Über der Schulter des anderen hing ein Akkordeon wie ein erlegtes Tier, der Tastatur fehlte eine Taste.
Ein Auto, groß wie eine Lokomotive, bog scharf um die Kurve des Appel-Kais und hielt direkt vor dem Rittmeister, und Pinto erkannte den echten Erzherzog auf dem Rücksitz auf Anhieb: ein Helm, bekrönt von Pfauenfedern, ein goldener Kragen mit drei silbernen Sternen. Das Kleid der Herzogin war so weiß wie aus Gottes Gewändern geschneidert, sie trug einen noch weißeren Hut mit Schleier und hatte ein Bukett blauer, weißer und gelber Blumen in den Armen. (Das Geschenk eines muslimischen Mädchens, wie die Geschichtsschreibung weiß, was mir aus unerfindlichen Gründen stets Tränen in die Augen treibt.) Es schien ihm, als würde Ihre Majestät durch den Schleier Kaspar zulächeln, der wiederum den Kopf vor ihr neigte, und Pintos Herz preschte wieder los, er musste tief Luft holen, um nicht ohnmächtig zu werden.
Rechts von Pinto zog ein kleiner, junger Mann mit wirren Haaren, schmalem, schütterem Schnurrbart und kränklichen Augen eine Pistole. Für einen Augenblick waren alle wie gelähmt, sogar der Köter glotzte erstaunt, die Wirklichkeit schien komplett an dem Widersinn der auf Seine Kaiserliche Hoheit gerichteten Waffe zu verzweifeln. Das Gesicht des Rittmeisters erstarrte zu einer Maske der Ungläubigkeit, sein Mund, seine Augen und Augenbrauen zogen sich zusammen und dehnten sich zugleich aus. Der edepsiz wollte dem jungen Mann die Pistole entreißen – zwischen seinen Fingerknöcheln sprossen winzige Haarbüschel –, was er wohl auch geschafft hätte, wäre er von seinem Nebenmann mit dem Akkordeon nicht angerempelt worden, und dann krachten Schüsse, lauter als eine Kanonensalve, und die ganze Welt explodierte.
Rej muerte gera no fazi, sagten die Sepharden Sarajevos gern. Ein toter König führt keinen Krieg. Ein toter Erzherzog, obendrein Thronfolger des Habsburgerreichs und Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht, aber schon. Wenige Wochen später wurde Pinto zusammen mit Zehntausenden anderen Bosniern zur kaiserlichen und königlichen Armee eingezogen. Er erklomm den Hang der Zeit, indem er endlos für Mahlzeiten Schlange stand oder im Schweiße seines Angesichts sinnlos gedrillt wurde. Er musste ständig daran denken, wie sich das Jahrhundert des Fortschritts innerhalb eines Wimpernschlags in diese quälenden Tage aufgelöst hatte; dass anders alles gelaufen wäre, vor allem für Ihre Königlichen Hoheiten, wenn der Mann mit dem Akkordeon den edepsiz nicht angerempelt hätte, denn sonst wäre es diesem wohl gelungen, den jungen Attentäter zu stoppen. Dann wäre Pinto nicht hier, dann würde sein Gewehrkolben nicht immerfort gegen seine Schienbeine knallen, dann würde er weder die dummen Witze irgendwelcher Landeier über seinen dunklen, arabischen Teint oder gierige Juden erdulden noch das Sägewerksschnarchen des Osmanen ertragen müssen, der im Etagenbett über ihm schlief, dann hätte er seine Manuči nicht zurücklassen müssen, weinend und ihre Haare ausreißend, weil sie eine Zukunft vor Augen hatte, in der sie ihren einzigen Sohn nie wiedersähe. Wäre es dem edepsiz gelungen, dem Attentäter die Pistole zu entreißen, dachte Pinto in Endlosschleife, dann hätte er Kaspar nochmals geküsst und – wer weiß? – einige Tage mit ihm verbracht, Liebe machend und Tee trinkend, und schließlich, in einer goldenen Zukunft, hätten sie in Wien gewohnt, im Café Olimpia ihren Morgenkaffee getrunken, einander die Zeitung vorgelesen, sich um die politische Situation in Europa gesorgt und in einer Welt zusammengelebt, die sich weiterdrehte.
Dennoch, schon vor dem Ende der Grundausbildung, als sein Regiment sich bereit machte, in Serbien einzumarschieren, ging Pinto auf, wie sinnlos es war, sich vorzustellen, alles wäre anders verlaufen: Was geschieht, muss exakt so geschehen; alles, was vor einem gewissen Punkt geschehen war, führte unweigerlich auf diesen zu. Dennoch gedachte er zeitlebens des Rittmeisters, der ihn – Pinto schwor dies in späteren Jahren beim Leben seiner Tochter – mitten im Chaos angeschaut hatte, nicht in blinder Panik und auch nicht, weil er begriffen hätte, was geschah, sondern so unendlich betrübt, als ahnte er, dass die Verbindung zwischen ihnen für immer gekappt worden war. Der Rittmeister holte mit dem Säbel aus, der kurz in der Sonne aufblitzte, verschwand im Gedränge, das den jungen Attentäter verschluckte, und damit aus Pintos Leben.
Nach den Schüssen saßen der Erzherzog und die Herzogin zunächst so reglos da, als wären sie unversehrt, als wäre nichts geschehen, bis die Herzogin mit dem Gesicht voran auf ihren Gatten kippte. Pinto sollte später behaupten, dem Auto so nahe gewesen zu sein, dass er die blutigen Blasen auf den Lippen des Erzherzogs gesehen und dessen Worte vernommen habe: Es ist nichts … es ist nichts. Danach sei der Erzherzog verstummt. Pinto erzählte den wenigen Leuten, die gewillt waren, ihm zuzuhören, der Erzherzog habe tief verängstigt dreingeschaut, er habe wohl begriffen, dass ihm die große Leere drohte, das unendliche Nichts – la gran eskuridad, wie Manuči zu sagen pflegte –, für jeden lebendigen Geist sowohl unzugänglich als auch unvermeidbar; er sprach vom Röcheln des sterbenden Erzherzogs, von einer letzten, rosigen Blase, die aus seiner Kehle gequollen und dann, einfach so, zerplatzt sei.
Ich kenne jedoch die Zeugenaussage von Oberstleutnant Graf Harrach, der erklärte, das Auto, chauffiert von einem gewissen Leopold Šojka, habe keinen Rückwärtsgang gehabt (damalige Autos kannten nur den Vorwärtsgang, wie die Zeit), musste also wieder auf den Appel-Kai geschoben werden, von wo es sich rasant vom Attentäter und somit auch von Pinto entfernte. Ihre Hoheit glitt vom Sitz, das Gesicht zwischen den Knien ihres Gatten, und der Erzherzog rief: Sopherl, Sopherl, stirb nur nicht. Bleib mir für meine Kinder. Graf Harrach packte den Erzherzog beim Kragen, damit dessen Kopf nicht vornübersank, und fragte: Haben Eure Hoheit starke Schmerzen? Seine Hoheit wiederholte sechs oder sieben Mal: Es ist nichts … es ist nichts, und hauchte dann sein Leben aus, gerade als das Auto vor der Residenz des Gouverneurs vorfuhr.
Mit anderen Worten: Rafael Pinto konnte die Details, mit denen er seine Geschichte genüsslich würzte, gar nicht mitbekommen haben. Stattdessen hielt er aus erzählerischen Gründen die Zeit an und ließ das Auto nicht wieder auf den Appel-Kai gelangen; die Behauptung, Ihre Hoheiten seien vor seinen Augen in la gran eskuridad gesunken, entbehrte jeder Grundlage. Pinto schilderte die tragische Szene dennoch immer wieder anderen Bosniern in der Kaserne, meist zu später Stunde und im Flüsterton, denn die banale Art, auf die Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, Thronfolger des Habsburgerreichs, das Zeitliche gesegnet hatte, grenzte an Blasphemie. Pintos kleines Soldatenpublikum war stets wie gebannt, wenn er vom Heraufdämmern des Krieges erzählte, von der Mitternacht ihrer Leben, von dem Augenblick, nicht länger als die Pause zwischen zwei Herzschlägen, als die Welt in ein Zuvor und ein Danach zerbrach. Manche seiner bosnischen Zuhörer, durch ihre Gedanken an die düstere Zukunft vorzeitig zermürbt, vergossen gar Tränen.
Galizien, 1916
Der Geheiligte allein kennt den Geruch der Welt unmittelbar nach deren Erschaffung, aber dieser Gestank ist der ihres Untergangs, kurz bevor alles zuschanden geht: grabestiefer Lehm, zerfasernde Strümpfe, tote Nager, Kackeimer, Krankheit, Blut, Männer ohne Zuhause und Wasser, zusammengenommen das üppige Bukett des Schützengrabens. Pinto wälzte sich hin und her, jede Bewegung schien seine Unruhe weiter zu schüren. Dando bueltas por la kama, komo l’peše en la mar, ah komo l’peše en la mar.
Osman hielt sich wach für den Fall, dass Hauptmann Zuckermann seine Dienste brauchte. Dieser warf sich in der Deckung, die die Soldaten für ihn gegraben und mit dem raren Holz verstärkt hatten, auf seinem Lager hin und her. Der in den Unterstand gezwängte Osman unterhielt sich mit Drkenda und Smail Tokmak, die auf dem Rücken lagen und Tabakkrümel rauchten, die sie aus den Tiefen ihrer Taschen gekratzt hatten. Der Schein einer Kerze tanzte auf Osmans Gesicht, stets glatt, obwohl es kaum Wasser für eine ordentliche Rasur gab, sein Schnurrbart war penibel gestutzt. Er schien ein Mittel gegen den allumfassenden Verfall entdeckt zu haben.
Pinto sah Osman zum ersten Mal, als dieser einer Zuhörerschaft bosnischer Soldaten eine Geschichte erzählte; er saß oben auf dem Etagenbett und ließ die Füße baumeln, aus einem Loch in einem Strumpf lugte der große Zeh wie eine Kartoffel, die ihrem Sack entwischen wollte. Sie waren gerade mobilisiert worden; ihre Uniformen waren noch straff und rochen nach Lagerhaus und Mottenkugeln; trotzdem hatte Osmans Zeh den Strumpf bereits durchbohrt. Dieser vorwitzige Zeh folgte gewissermaßen seiner überschwänglichen Art, er gestikulierte wie wild, zeigte auf imaginäre Räume und Objekte seiner Geschichte. Pinto konnte nichts hören, beobachtete aber den Mund mit dem adretten Schnurrbart, die Turnübungen der Augenbrauen, die großen Augen, die Erstaunen mimten, das breite, offene Grinsen, mit dem er etwas unterstrich. Manchmal schaute er zu Pinto, der am Horizont seines erzählerischen Kosmos lungerte, und schenkte ihm ein Lächeln. Wenn er lachte, dann so schallend – aus vollem Herzen, wie es heißt –, dass die Soldaten angesteckt wurden und nicht mehr aufhören konnten. Pinto sollte dieses Lachen bis zum Schluss, als Osman verstummte, nie vergessen. Er sehnte sich danach, zu der Gruppe zu gehören, Osmans Geschichte und Stimme zu hören, die Lachsalven aus der Nähe mitzuerleben, traute sich aber nicht, die finstere Höhle seines unteren Bettes zu verlassen und mitten in die Geschichte zu platzen. Danach wurde Osman zum Dank ein Rakija gereicht, und er ging zu Pinto, um auch diesem einen Schluck anzubieten. Pinto akzeptierte in der Hoffnung, einen Hauch von Osmans Lippen auf dem Rand des Blechbechers zu schmecken. Er bedankte sich, und Osman meinte, er habe schon besseren Rakija getrunken, und doch sei keiner süßer als dieser. Bevor Pinto etwas erwidern konnte, wurde Osman von den Bosniern weggezerrt, die noch mehr von ihm hören wollten.
Und nun, im Schützengraben, gab Osman wieder eine Geschichte zum Besten, wie es seiner Art entsprach, und er tat dies, als wäre sie allen Zuhörenden neu. Osman erzählte sogar die Geschichten über seine Kindheit als Waise in der čaršija so, als wäre es das erste Mal, als hätte er sie selbst gerade erst gehört und könnte es nicht erwarten, sie weiterzuerzählen.
Vor langer, langer Zeit, sagte Osman leise und heiter, stand in den Hügeln oberhalb von Sarajevo die Bruchbude eines armen Hamal namens Husref, dessen ganzer Besitz in einer Frau, einem Fez und Löchern im Hosenboden bestand.
Drkenda und Smail Tokmak brummten, um zu signalisieren, dass sie Husref mit dem löcherigen Hosenboden und der Bruchbude vor sich sahen. Sie waren so begierig wie Kinder auf die Geschichte.
Eines Nachts, Husref liegt mit seiner Frau, Merima, im Bett, hören sie, wie in der Festung eine Kanone abgefeuert wird. Die verängstigte und erschrockene Merima schreit: Was war das? Warum kracht die Kanone mitten in der Nacht? Husref antwortet: In Sarajevo gab es einen Aufstand. Die aghas und beys und Reichen haben gegen den Sultan aufbegehrt, wurden aber festgenommen und in den Kerker geworfen. Gestern sind die Henker aus Istanbul eingetroffen, mit einer Tasche voller Seidenbänder, die der Sultan den Verurteilten zugedacht hat. Jeder soll mit einem eigenen Seidenband erdrosselt werden.
Drkenda und Smail Tokmak röchelten, als würden Seidenbänder ihren Nacken und ihre Kehle kitzeln. Drkenda war von einem russischen Scharfschützen am Arm verwundet worden und wäre wohl verblutet, wenn Pinto nicht sofort gehandelt hätte. Er hatte ein Seil um den Bizeps geschlungen, dieses mithilfe eines Stocks gestrafft und die Blutung gestoppt. Er half Smail Tokmak, Briefe nach Hause zu schreiben, mit blumigen Formulierungen, die dazu beitrugen, dass sich Smail in einem neuen, besseren Licht sah, wenngleich er nicht wusste, was die Worte genau bedeuteten und ob sie überhaupt jemand zu lesen bekommen würde. Smail kannte und liebte Osmans Geschichte; er hatte Pinto gedrängt, sie in einem Brief nachzuerzählen, weil er geglaubt hatte, seine Frau und der Vorleser im Dorf würden sie mögen.
Und nun, flüsterte Osman, werden sie der Reihe nach von den Henkern erdrosselt, und jedes Mal, wenn ein Verurteilter sein Leben aushaucht, wird in der Festung eine Kanone abgefeuert. Jeder Schuss steht für eine entwichene Seele. Merima fragt: Wer sind diese Leute, Allah möge ihren Müttern gnädig sein? Husref, der Hamal, antwortet: Die führenden Persönlichkeiten Sarajevos – die Gebrüder Morići; Pascha Hadži und sein Bruder Ibrahim; der mächtige Pascha Hajdar; und viele andere mehr. Die Reichen und Mächtigen aus der čaršija. Nacheinander mit einem Seidenband erdrosselt.
Osman verstummte kurz vor dem Ende seiner Geschichte – er hatte sie Drkenda und Smail Tokmak oft erzählt, in der Bukowina und zuvor in Serbien, vielleicht schon bei der Gelegenheit, als Pinto ihn zum ersten Mal erblickt hatte –, denn er wusste, dass die Pause ihr Vergnügen erhöhte. Er schien die Worte zu hauchen, und Pinto sah seine Lippen im flackernden Kerzenschein glitzern.
Merima schweigt, dann deckt sie sich und ihren Mann mit dem jorgan zu und sagt: Dank sei dem guten Allah dafür, dass du ein Nichts und ein Niemand bist.
Drkenda und Smail Tokmak lachen leise, nicht nur, weil sie die Geschichte mögen, sondern weil sie wie erwartet zu Ende ging – alles war, wie es sich gehörte. Dank sei dem guten Allah dafür, dass du ein Nichts und ein Niemand bist, wiederholte Osman, und alle lachten, weil sie sich, bedeutungslos, wie sie waren, in Sicherheit wähnten. Anschließend senkte Osman die Stimme noch weiter und sagte etwas, das Drkenda und Smail Tokmak verstummen ließ. Pinto blieb reglos; er hätte Osmans Worte gern gehört, konnte ihn aber nicht mehr verstehen. Osman war anwesend und zugleich nicht anwesend, seine Stimme war gleichsam körperlos, und die Laute, die er von sich gab, hatten Gestalt und Bedeutung verloren.
Padri Avram blieb oft lange auf und las laut in der Thora. Simha, Pintos ältere Schwester, hatte ihr eigenes Zimmer, sein Bett stand im elterlichen Schlafzimmer hinter einer als Vorhang dienenden Decke. Auf dieser hatte sich der zuckende Schatten seines auf Hebräisch vor sich hin murmelnden Vaters abgezeichnet: Sie gelangten an den Ort, an den sie von Gottes Stimme geführt worden waren. Dort errichtete Abraham einen Altar. Der entsetzte Pinto stellte sich vor, wie Abraham Holz aufschichtete, seinen Sohn Isaak band und auf den Altar legte. Er spürte die sengende Hitze Israels und das dornige Holz, die Angst und die rauen Stricke, die an seinen Handgelenken rieben. Im Zimmer roch es nach dem allmählich erlöschenden Feuer und schmelzendem Wachs, nach den wollenen Läufern und den Kräutern aus der drogerija, deren Duft in Padri Avrams Kleidern hing. Als Abraham das Messer hob, um seinen Sohn zu töten, verkrampfte sich Pintos Herz, seine Angst war so groß wie die Isaaks vor Abraham, und er verkniff sich jeden Laut und nagte an den Knöcheln, schluckte die Tränen hinunter und wartete auf die erlösende Stelle, den Moment, wenn der Herr in seiner Gnade einschreitet und es Abraham erlässt, seinen eigenen Sohn zu töten. Während der restlichen schlaflosen Nacht zerbrach sich Pinto ketzerisch den Kopf darüber, wieso Gott straflos ein Kind quälen durfte und warum die Thora nicht von Isaaks Furcht sprach, von seinen Tränen oder der Angst, die er nun für immer vor seinem Vater hätte. Mit der Zeit lernte er, die Worte von ihrer Bedeutung abzulösen und sich auf ihren beschwörenden Singsang zu konzentrieren, als würde Padri einen Gesang intonieren, der ihn in den Schlaf wiegte.
An manchen Tagen las Padri Avram die Thora nicht leise, sondern donnerte seinem Sohn Fragen an den Kopf: Gott erschuf für alles einen Widerpart. Was heißt das? Der ratlose, kleine Rafo zerbrach sich wimmernd und verzweifelt den Kopf über die korrekte Deutung, fand aber keine Worte. Stattdessen kamen ihm die Tränen, was seinen Vater noch weiter erzürnte. Für alles, was Gott erschuf, erschuf er auch einen Widerpart: Er erschuf die Berge, Er erschuf die Hügel! Er erschuf die Meere, Er erschuf die Flüsse! Er erschuf mich, Er erschuf dich! Dich! Dich – einen Schafskopf, einen pišabaljandu! Durch welche Sünden habe ich dich verdient! Welche Sünden habe ich begangen? Sag’s mir!
Als Rafo mit einem Diplom unter dem Arm aus Wien zurückkehrte, im flotten studentischen Anzug, mit keckem Filzhut statt Fez, seine Rede mit lateinischen und deutschen Wörtern garnierend, schloss Padri Avram ihn jedoch in die Arme, hieß ihn, sich neben ihn zu setzen, und drückte seine Schulter voller Stolz, bis es wehtat. Er präsentierte ihn der ehrwürdigen Runde alter, Kaftan tragender Teos, die erschienen waren, um das in der fernen Reichshauptstadt ausgebildete Sohneswunder zu bestaunen. Rafo parlierte mit ihnen wie ein weltgewandter Gelehrter, wie der Doktor der Pharmazie, der er war, ließ sich mit demonstrativer Lässigkeit über Themen aus, die – was sie nicht zu gestehen wagten – böhmische Dörfer für sie waren. Sie schlürften Kaffee aus ihren fildžani und warfen Padri Avram neidische und bewundernde Blicke zu. In diesem fremden Mann konnten sie den Rafo, der Bilave als schlaksiges Bürschchen verlassen hatte, nicht wiedererkennen, und sie wussten, er hatte Zugang zu einer Welt, die sie nur vom Hörensagen kannten, die unerhört neu und unermesslich groß war. Da gab es eine Welt, die sie sich partout nicht vorstellen konnten, und hätten sie es gekonnt, dann wären sie vor Entsetzen zu Stein erstarrt. Währenddessen zauberte Manuči weiter Süßgebäck, sie erschöpfte ihre gesamte Palette, und Simha brachte eine gewaltige dževa mit Kaffee nach der anderen. Sie stellte die Rosenblattkonfitüre auf den Tisch, nach der er sich während seiner Kindheit die Finger geleckt hatte, vergeblich, sie hatte hoch oben auf einem Schrank gestanden. Für Rafo fand sogar ein konvite statt, auf dessen Höhepunkt Padri Avram doch tatsächlich sang, begleitet vom angeschickerten Sinjor Papučo, der auf der Saz einen schiefen Ton nach dem anderen anschlug. Nočes, nočes, buenas nočes, sang Sinjor Padri mit einem herrlichen, biblischen Bariton, der gewiss gegen diverse eherne Grundsätze verstieß, ein leidenschaftliches Beben, das so ganz ohne jedes Donnern auskam. Nočes son d’enamorar, ah, nočes son d’enamorar.
Die Strafe des Herrn folgte auf dem Fuße: Am nächsten Morgen erwachte Padri Avram nicht mehr, seine Lippen waren schmal und bleich, als hätte er sich die ganze Nacht ein Zorneswort verkniffen. Niemand wusste, wann sein ohrenbetäubend lautes Schnarchen verstummt war; man fragte sich zerknirscht, was wäre, wenn man ihn gleich nach dem Verstummen geweckt hätte; man ergänzte das eigene, dicke Sündenregister um weitere Seiten. Es dauerte nicht lange, da vergoss ganz Bilave bittere Tränen, Manuči und viele andere Tijas klagten im Nebenzimmer, sie klatschten in die Hände, während Rafo auf dem Sofa saß und in eine Trance verfiel, welche weit über die šiva hinaus andauern sollte. Die Tijas sorgten für das gleiche Süßgebäck und die gleichen dževas mit Kaffee wie am Vortag, und dieselben Männer im Kaftan erschienen zur šiva, verschmähten jedoch Süßgebäck und Kaffee. Sie boten schwammig Unterstützung an und zeigten Mitgefühl mit dem sprachlosen Rafo, dessen eleganter Anzug vorübergehend in einer Truhe ruhte. Allen war klar, dass seine Zukunft in der großen, neuen Welt auf die unabsehbar lange Bank geschoben worden war, weil er die Pflicht hatte, die väterliche drogerija zu übernehmen. Sie rieben ihm unbarmherzig unter die Nase, dass sein neunmalkluges Wiener Gelehrtendasein das Sterben nicht verlangsamen oder gar aufhalten konnte, der Herr halte das Schicksal eines jeden Einzelnen in Seiner allmächtigen Hand. Sie wollten ihm das Eingeständnis abringen, dass seine Kenntnisse über erlesene Öle und Puder weit hinter den Mysterien des wahren Lebens und des wahren Todes zurückblieben, von Himmel und Erde ganz zu schweigen. Während sie an ihren čibuks nuckelten, riefen sie sich in Erinnerung, dass, nachdem unser Vater Abraham im hohen Alter verstorben war, alle Könige und Weisen Aufstellung genommen und geklagt hatten: Oh, Jammer und Not, die Welt hat ihr Oberhaupt verloren! Und sie priesen den Herrn, der Abrahams Sohn Isaak gesegnet hatte. Rafo wiederum war sich schmerzhaft bewusst, nie gesegnet worden zu sein, und weinte stumme Tränen, die feuchten Hände im Schoß. Padri mio, komo lo voj a dešar.
Nach Padri Avrams Tod begann Pinto, eine Stimme zu hören, die ihn entweder verfluchte oder bezichtigte, die Schuld an Padris plötzlichem Tod zu tragen, ihn gar warnte, Yetzer Hara könne ihn während der Trauer übermannen und dazu verleiten, sich an der Natur zu versündigen. Also dachte er an alles zurück, was zwischen ihm und Padri Avram gesagt und nicht gesagt worden war, alles, was hätte ausgesprochen werden können, im Laufe der Jahre jedoch im Schweigen versickert war. Padri Avram musste Rafos abscheuliche Neigung, die sein Verstand nicht wahrhaben wollte, irgendwann im Herzen gespürt haben, zu einem Zeitpunkt, als diese nicht mehr zu unterdrücken war. Er begann zu toben und zu donnern, um das Krumme geradezubiegen, um Yetzer Hara auszulöschen. Die gleiche Stimme erklärte, Padris Tod sei nicht von Übel, weil Pintos Schande mit ihm stürbe, weil Padri wegen Pintos abscheulicher Neigung keine Höllenqualen mehr leiden müsse. Und er würde Osman nie kennenlernen.