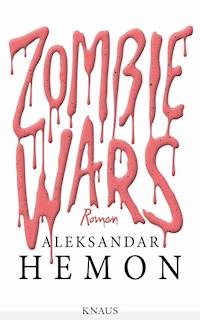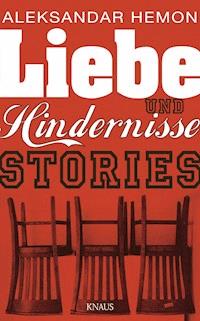19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
«Aleksandar Hemon ist, ziemlich sicher, der Größte seiner Autoren-Generation.» Colum McCann Hemons neuer Band sind eigentlich zwei in einem, zusammengebracht in einem Wendebuch: Die Geschichte von Hemons Eltern, ihrer Immigration von Sarajewo nach Kanada und ein Buch mit kurzen Erinnerungen an die Familiengeschichte des Autors, an Freunde und eine wilde, unbeschwerte Kindheit in seiner Heimatstadt. Im Band über seine Eltern erzählt er nahbar, genau, zärtlich und poetisch von ihren Anstrengungen, von den stillen Versuchen seiner Mutter (Mama), die Familie zusammenzuhalten, von der fanatischen Imkerei seines Vaters (Tata) und bemisst beinahe beiläufig die Verluste, die die Hemons und ihre Landsleute erlitten haben. Hemon zeichnet das herzzerreißende Porträt eines untergegangenen Landes, das allzu oft Spielball war. «Alles nicht dein Eigen» ist die rauschhaftere, rauere und unkonventionellere Seite dieser Medaille: Vignetten über den jungen Hemon, seine Wildheit und Wut. Sie fügen Hemons Protagonisten Aleksandar eine bis dato unerwartete Facette hinzu – die des jungen, energiegeladenen (und eben oft wütenden) Sohnes, der nicht verstehen kann, was verdammt nochmal so schwer daran sein soll, irgendwo anzukommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen
Der Autor
ALEKSANDAR HEMON wurde 1964 in Sarajewo geboren. 1992 hielt er sich im Rahmen eines Kulturaustauschs in den USA auf, als er von der Belagerung seiner Heimatstadt erfuhr. Er beschloss, im Exil zu bleiben. Seit 1995 schreibt er auf Englisch. Sein Erzählband «Die Sache mit Bruno» erschien 2000, 2002 folgte der Roman «Nowhere Man», der für den «National Book Critics Circle Award» nominiert war. Die MacArthur Foundation zeichnete Hemon 2004 mit dem «Genius Grant» aus. Spätestens seit seinem international gefeierten Roman «Lazarus» gehört er zu den meist beachteten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Hemon lebt mit seiner Familie in Princeton, New Jersey.HENNING AHRENS, geboren 1964, lebt in Frankfurt a. M. Er übersetzte Lyrik, Kinder- und Jugendbücher sowie zahlreiche Romane aus dem Englischen, darunter solche von Saul Bellow, Jonathan Safran Foer, Richard Powers und Hanif Kureishi.
Das Buch
Hemons neuer Band sind eigentlich zwei in einem, zusammengebracht in einem Wendebuch: Die Geschichte von Hemons Eltern, ihrer Immigration von Sarajewo nach Kanada und ein Buch mit kurzen Erinnerungen an die Familiengeschichte des Autors, an Freunde und eine wilde, unbeschwerte Kindheit in seiner Heimatstadt.Im Band über seine Eltern erzählt er nahbar, genau, zärtlich und poetisch von ihren Anstrengungen, von den stillen Versuchen seiner Mutter (Mama), die Familie zusammenzuhalten, von der fanatischen Imkerei seines Vaters (Tata) und bemisst beinahe beiläufig die Verluste, die die Hemons und ihre Landsleute erlitten haben. Hemon zeichnet das herzzerreißende Porträt eines untergegangenen Landes, das allzu oft Spielball war.«Alles nicht dein Eigen» ist die rauschhaftere, rauere und unkonventionellere Seite dieser Medaille: Vignetten über den jungen Hemon, seine Wildheit und Wut. Sie fügen Hemons Protagonisten Aleksandar eine bis dato unerwartete Facette hinzu – die des jungen, energiegeladenen (und eben oft wütenden) Sohnes, der nicht verstehen kann, was verdammt nochmal so schwer daran sein soll, irgendwo anzukommen.«ALEKSANDAR HEMON IST, ZIEMLICH SICHER, DER GRÖßTE SEINER AUTOREN-GENERATION.»Colum McCann
Aleksandar Hemon
Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019unter dem Titel My Parents: An Introduction / This does notbelong to you bei MCD, einem Imprint von Farrar, Straus &Giroux, New York.Die englische Ausgabe erschien 2019 bei Picador, einemImprint von Pan Macmillan, London.www.panmacmillan.comclaassen ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbHwww.ullstein.de© Aleksandar Hemon 2019First published 2019 by MCD, an Imprint of Farrar, Straus &Giroux, New York, and 2019 by Picador, an Imprint of PanMacmillan, London.© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einerVorlage von © Rodrigo Corrall / Farrar, Straus & GirouxAutorenfoto: VeliborE-Book powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2605-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Meine Eltern
1 Lebensläufe
2 Heimatland
3 Katastrophe
4 Andere Lebewesen
5 Orte
6 Essen
7 Musik
8 Literatur
9 Ehe
10 Leben und Tod
Bildteil
Alles nicht dein Eigen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Meine Eltern
Meine Eltern
1 Lebensläufe
Laut einer Familienlegende war Živko, der Großvater meiner Mutter, eines Winterabends nach Trunk und Spiel mit seinem Pferdeschlitten auf dem Heimweg, als ihm mehrere schreckliche Riesen den Weg verstellten. Er war Großgrundbesitzer, betrieb ein Bevorratungsgeschäft, hatte sogar Diener; er war reich, also auch herrisch und schnöselig. Er war überzeugt, die Riesen würden ihn töten, wenn er anhielte, und deshalb erhob er sich in seinem Schlitten, trieb seine Pferde mit der Peitsche an und preschte auf die Ungeheuer zu, die auswichen und ihn durchließen.
Seine Tochter Ruža heiratete meinen Großvater Stjepan Živković, dem nie ein Riese über den Weg lief und dessen Familie ganz und gar nicht wohlhabend war. Es war keine arrangierte Ehe, was damals (um 1921) im Nordosten Bosniens1 eine Seltenheit war, denn der eheliche Segen war untrennbar mit dem Vermögen und dem Besitz der Familien von Braut und Bräutigam verknüpft. Mama vermutet eine Liebesheirat, und Ruža wurde von ihrem Vater verstoßen, weil sie seinem Willen zuwiderhandelte. Ruža und Stjepan sollten sieben Kinder bekommen; meine Mutter, Andja, geboren 1937, war das jüngste.
Als sie vier war, spielte ihr großer Bruder Živan mit Freunden ein Spiel, bei dem man mit einem Stock (klis) ein Stück Holz durch die Luft schlägt. Das Holz traf ihn in den Bauch, der noch voll vom Mittagessen war; seine Magenwand riss, und er starb. Die Geschichte leuchtet nicht ganz ein – so schwer kann das Holzstück nicht gewesen sein –, aber so wurde es meiner Mutter erzählt.2 Sorgen kommen nie als einsame Spione, sondern stets in Bataillonen: Als Živan starb, wurde Jugoslawien durch den Einmarsch der Deutschen vom Zweiten Weltkrieg erfasst. Mamas ältester Bruder, Bogdan, schloss sich mit neunzehn den Partisanen an. Wenn Mama mitten in der Nacht erwachte, so erinnert sie sich, wiegte sich Ruža aus Sorge um ihren Ältesten im Bett hin und her wie ein Chassid.
In Bosnien war der Krieg kompliziert, wie alle Kriege, die dort ausgefochten wurden, wie jeder Krieg. Titos Partisanen mussten nicht nur gegen die Deutschen kämpfen, sondern auch gegen die royalistischen serbischen Truppen – die četniks –, die offen mit den Besatzungstruppen kollaborierten und vor allem damit beschäftigt waren, Muslime zu massakrieren. Die Familie meiner Mutter ist serbischer Herkunft, und die Region, in der sie lebte – in einem Dorf namens Brodac in der Nähe der Stadt Bijeljina –, war fest in der Hand der četniks. Ein Großteil von Ružas Familie unterstützte die četniks, eine Dummheit, die wohl damit zu tun hatte, dass sie reich und schnöselig waren. Stjepan war anders eingestellt, und das nicht nur, weil sein ältester Sohn bei den Partisanen war – er war schlicht ein anständiger Mensch. Die četniks kamen gelegentlich vorbei, weil sie Bogdan suchten, und wenn sie ihn nicht fanden, tobten sie sich an Stjepan aus. Einmal verbarg er eine Kiste mit Munition, die von den Alliierten zur Unterstützung der Partisanen abgeworfen worden war, in einem Misthaufen. Irgendjemand verpfiff ihn bei den četniks, die ihn zusammenschlugen, um zu erfahren, wo sich die Munition befand. Er verriet nichts; sie steckten ihn in ein Lager und hätten ihm wohl die Kehle durchgeschnitten, wenn Ružas Familie nicht eingegriffen hätte; danach stand er sechs Monate unter Hausarrest. Bei einer anderen Gelegenheit, gegen Ende des Krieges, gab Stjepan sein einziges Pferd einem verwundeten jungen Partisanen, der auf der Flucht war. Der junge Partisan versprach, das Pferd zurückzubringen; das tat er zwar nie, aber Stjepan bereute es nicht, einem Mann in Not geholfen zu haben. Vermutlich stellte er sich vor, seinem Sohn könnte anderswo von jemandem auf die gleiche Art geholfen werden.
Mein Onkel Bogdan, dem es gelang, den Krieg zu überleben, kämpfte mit seiner Einheit an der Sremski-Front in der schweren Schlacht, die die Niederlage der Deutschen und ihrer Helfershelfer besiegelte und Belgrad befreite. Als Maschinengewehrschütze war er stets im Visier; einmal wurde er von einer Kugel in die Brust getroffen, und zwei seiner Männer starben neben ihm. Einer seiner Lungenflügel musste entfernt werden, und er hatte sein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen. Und auch Ruža tat nie wieder ein Auge zu, jedenfalls nicht bis zu ihrem Tod.
Mama war bei Kriegsende noch ein Kind, erwähnte aber nie, Angst gehabt zu haben oder traumatisiert worden zu sein. Sie erzählte nie Geschichten aus ihrer Kindheit: Sie hatte so gut wie keine Abenteuer erlebt, sie hatte wenige Freunde, ob Menschen oder Tiere, sie hatte nicht einmal Ärger mit ihren Geschwistern. Genau genommen hatte Mama gar keine Kindheit. Zuerst erlebte sie als Jüngste der Geschwister den Krieg, und anschließend, als das Leiden ein Ende hatte, tat sich eine verheißungsvolle, wenn auch nicht ganz einfache Zukunft auf und sie musste ihrer Kindheit Adieu sagen.
1948, sie war gerade einmal elf, verließ sie ihr Zuhause, um in Bijeljina, sieben endlos weite Kilometer von ihrem Dorf entfernt, die Mittelschule zu besuchen. Sie bewohnte ein gemietetes Zimmer3 und fuhr am Wochenende mit der Bahn nach Hause. Sie blieb während ihrer gesamten Gymnasialzeit in Bijeljina und machte 1957 mit guten Noten das Abitur am – ich schreibe dies nur wegen des Namens – Državna realna gimnazija Filip Višnjić.4 Sie war schon damals eine gewissenhafte, fleißige Schülerin.
1957 schrieb sie sich an der Universität von Belgrad ein, Hauptstadt und größte Stadt Jugoslawiens, gut einhundertzwanzig Kilometer und ein ganzes Jahrhundert von Brodac entfernt. Anfangs teilte sie sich mit drei Studentinnen ein Wohnheimzimmer in Studentski grad (Studentenstadt). Sie lebte von einem bescheiden dotierten Stipendium, hatte wenig Geld und kaum Besitz. Aber sie genoss es und schwelgt bis heute in Erinnerungen an ihre kameradschaftliche, herrliche Jugend, an das Ethos des Teilens – ob Essen, Kleidung oder Erfahrungen – und an das Gefühl, dass es trotz der eklatanten Armut an nichts mangelte.
In der Cafeteria der Universität gab es Tanzabende (igranka), unter anderem mit Sirko Šouc und dessen Rock’n’Roll-Band; manchmal ging sie abends zweimal tanzen. Die Kinos zeigten amerikanische Filme, wenn auch mit zig Jahren Verspätung. Esther Williams galt als Göttin;5 der Film Three Coins in the Fountain war ein Straßenfeger, und der gleichnamige Song wurde von der Jugend inbrünstig geträllert, wenn auch in, sagen wir mal, holperigem Englisch. Kaubojski filmovi (Western) im Allgemeinen und John Wayne im Besonderen wurden heiß geliebt. Bis heute bleibt Mama – die gern vor dem Fernseher einschläft – wach, wenn Filme wie Rio Grande oder Rio Bravo oder Red River6 laufen. Sowjetische Filme gab es auch: Die Kraniche ziehen,7 ein poststalinistischer Film über Liebe und Krieg (und Vergewaltigung), ließ das Publikum unisono schluchzen. Man sah auch jugoslawische Filme, denn das Kino des Landes erlebte gerade eine Blütezeit.
Die Handlung von Ljubav i moda (Liebe und Mode)8 etwa dreht sich um junge Leute, die eine Modenschau organisieren, um ihren Segelflugclub zu finanzieren. Der Film beginnt mit einer Szene, in der eine schicke junge Frau auf einer Vespa durch die recht stillen Straßen Belgrads kurvt; eine Schnulze (šlager) warnt die Zuschauer unterdessen vor dem Erscheinen eines jungen Mannes. Sie begegnet ihm erwartungsgemäß unter einer Straßenlaterne; er meint, sie solle besser in der Küche stehen, als Vespa zu fahren, und kanzelt sie als »motorisierte Schlampe« ab, und sie beschimpft ihn als Grobian. Es geht um Liebe, und es geht um Mode. Meine Mutter ähnelt auf vielen Fotos jener Zeit dem Mädchen auf der Vespa: Ballonrock, Bobbysocken und Beehive-Frisur. Sie erinnert sich sogar daran, die Dreharbeiten für Ljubav i moda beobachtet zu haben. Als ich den Film zum ersten Mal sah, suchte ich in der Menge nach ihrem Gesicht. In diesem Film treten nicht nur junge schicke Frauen und lachende Männer auf, die in Segelflugzeugen sitzen und einander als »Genosse« titulieren, sondern auch jugoslawische Popstars, die aus heiterem Himmel schlampig lippensynchronisierte Lieder trällern, darunter eines mit der unsterblichen Zeile: »Denn Mode ist die Schlagsahne und Liebe die Eiscreme« (Jer moda to je šlag, a ljubav sladoled). Zu diesen Liedern gehörte auch »Devojko mala«, das eine Generation später ganz unironisch von einer hippen Band gecovert wurde (VIS Idoli), die ich sehr gern hörte.
In den Achtzigern interessierte ich mich sehr für die Filme und die Musik aus der Studienzeit meiner Eltern und fand ihre Jugend so cool, dass es an Nostalgie grenzte. Mama hat sich sicher nie danach gesehnt, das Leben ihrer Eltern zu führen – als Liebe und Mode in die Kinos kam, war die Kluft zwischen den Generationen schon viel zu groß. Meine Entdeckung ihrer coolen Vergangenheit sorgte jedoch für eine kulturelle Kontinuität; von da an konnten wir auf einen gemeinsamen Referenzrahmen zurückgreifen. Ich hätte auch gern eine solche Jugend gehabt und beneidete sie um die Erfahrung eines ungebremsten Optimismus, um ihre Freude, die Liebe und die Mode. Mama wunderte sich oft darüber, dass ich die Musik ihrer Generation hörte, »unsere Musik«, wie sie stets sagte, aber ich war selbst als Jugendlicher nie so jung, wie sie es damals gewesen war.
Mein Vater wäre nicht, wer er ist, wenn es den großen Otto von Bismarck nicht gegeben hätte. Denn es war Herr Otto, der 1878, nach dem Russisch-Türkischen Krieg, den Berliner Kongress orchestrierte, bei dem die europäischen Großmächte die Grenzen neu zogen. In Berlin willigte das besiegte Osmanische Reich ein, die ferne Provinz Bosnien-Herzegowina, seit vierhundert Jahren in seinem Besitz, an Österreich-Ungarn abzutreten. Die Besetzung sollte vorübergehend sein, doch Herr Otto ging davon aus, dass sie dauerhaft sei, und so dachten auch fast alle anderen Beteiligten, darunter die Habsburger. Sobald die österreichisch-ungarischen Truppen in Bosnien und Herzegowina eingerückt waren, beeilte man sich also, Untertanen aus anderen Provinzen dort anzusiedeln, um den neuen Teil des Reiches zu kolonisieren. Als die Jungtürken 1908 gegen den Sultan putschten und im Anschluss die Monarchie abschafften, bot sich Österreich-Ungarn der ideale Vorwand, um Bosnien zu annektieren und die Kolonisierung zu intensivieren. Und hier kommt die Sippe meines Vaters ins Spiel.
Ihre wenigen Habseligkeiten mitschleppend, darunter ein oder zwei Bienenkörbe und ein stählerner Pflug, wanderten die Hemons 1912 aus Galizien aus (heute die westliche Ukraine). Mein Großvater Ivan war damals genauso alt wie das zwanzigste Jahrhundert. Zur gleichen Zeit verließ meine Großmutter Mihaljina die Bukowina, eine südlich an Galizien grenzende Provinz. Alle ließen sich in der Nähe der Stadt Prnjavor im Nordwesten Bosniens nieder, wo sie zunächst als Galizier bezeichnet wurden, weil das Konzept einer ukrainischen Identität noch nicht über elitäre, intellektuelle Kreise hinausgedrungen war. Die Region rund um Prnjavor wurde nicht nur für Galizier/Ukrainer zur neuen Heimat, sondern auch für viele andere Siedler: Polen, Böhmen (Tschechen), Deutsche und Italiener bereicherten die lokale Mixtur von Serben, Kroaten und Muslimen. Laut einer Familienlegende zogen meine Vorfahren nicht nur dorthin, um sich Ackerland zu sichern, sondern auch Wald, als sichere Quelle für Feuerholz, um besser durch die Winter zu kommen als in Galizien. Als Österreich-Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg zerschlagen wurde, kehrten manche Siedler in ihre nunmehr unabhängigen Ursprungsländer zurück, die meisten, darunter die Hemons, blieben jedoch in der Region, die später zu Jugoslawien werden (und als solches untergehen) sollte. Ein knappes Jahrhundert später, kurz vor dem letzten Krieg, ergab eine Volkszählung, dass in Bosnien und Herzegowina etwa fünftausend Ukrainisch sprechende Menschen lebten. Auf die eine oder andere Art war ich mit vielen von ihnen verwandt.
Ivan heiratete Mihaljina im Jahr 1925, und beide nahmen sofort die Fortpflanzung in Angriff; meine älteste Tante, Marija, wurde 1926 geboren. (Sie lebt nun in Edmonton, Kanada.) Im Jahr 1947 hatte meine Großmutter elf Schwangerschaften hinter sich, zehn Kinder und eine Fehlgeburt. Sie lebten allesamt auf einem Hügel namens Vučijak in einem kleinen Haus mit Strohdach, Lehmfußboden und Kamin, das sie im Winter mit ihrem Vieh und anderen Haustieren teilten.
Mein Vater, Petar, das sechste Kind, wurde 1936 geboren, rechtzeitig zum Zweiten Weltkrieg, der rund um Prnjavor besonders verworren und brutal war, denn die Mischung der Ethnien, sogar nach bosnischen Maßstäben hochgradig komplex, bot unzählige Gelegenheiten für Massaker an der Zivilbevölkerung und regelmäßige Scharmützel zwischen diversen paramilitärischen Verbänden, darunter die ebenso exotischen wie grausamen čerkezi, kriegsgefangene Rotarmisten, die aufseiten der Deutschen kämpften. Dass die Grenze zum faschistischen Marionettenstaat Kroatien (NDH)9 am nahe gelegenen Fluss Vijaka verlief, machte die Sache nicht besser, weil Flüchtlinge herüberkamen, wenn die kroatischen Ustascha-Milizen ihre Massaker verübten. Bewaffnete Trupps erschienen immer wieder vor dem Haus meiner Großeltern, um Nahrungsmittel zu beschlagnahmen oder zu plündern. Mindestens einmal wurde die Familie von Ivan und Mihaljina aufgereiht, um erschossen zu werden, doch man ließ im letzten Moment Gnade walten, weil ein Bekannter darauf hinwies, dass sie friedfertig und gütig waren und gewiss kein Unheil anrichten würden. Sie wären aber selbst dann nicht alle umgekommen, wenn man sie nicht begnadigt hätte. Die großen Schwestern meines Vaters, alt genug, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen, wussten sich zu verstecken; auch die Kinder hatten ihre Schlupfwinkel. Natürlich verhütete niemand, aber der tiefere Grund für die vielen Kinder bestand darin, dass wenigstens einige Krieg, Armut und Krankheiten überlebten. 1943 wurden die Hemons zu Flüchtlingen: Sie wurden aus ihrem Haus vertrieben und nahmen mit, was sie tragen konnten (mein Vater erinnert sich an eine Kaffeemühle), ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkehren würden. Sie fanden Unterschlupf bei Verwandten in der Region. Als sie Monate später heimkehrten, stellten sie fest, dass Nachbarn und durchziehende Soldaten ihr Haus komplett geplündert hatten.
Als ich klein war, erzählte mein Vater oft Geschichten aus dem Krieg. Es waren Erlebnisse von Lausbuben, die mit Waffen und Kriegsschrott spielten. Einmal, diese Geschichte finde ich am besten, warfen er und seine Freunde Munition ins Feuer und narrten auf diese Weise die čerkezi, die meinten, man würde sie beschießen, und deshalb davon absahen, das Gehöft der Hemons zu plündern. Manche Geschichten schmückte er aus, in anderen milderte er die Schrecken des Krieges ab, doch es gab eine, deren Tragik nie verringert oder aus der Welt geschafft werden konnte. Mein Vater war acht und sein Bruder Teodor zehn, da entdeckten sie eine Kiste mit fünf Stolperdrahtminen, die sie zwischen sich und drei anderen Dorfjungen aufteilten. Sie beschlossen, die Minen in die Zisterne hinter der Schule zu werfen, weil die Detonationen zwischen den Betonmauern besonders laut wären. Fatalerweise konnten sie Mine und Handgranate nicht unterscheiden. Sie wussten, dass man bei einer Handgranate nach dem Entschärfen bis drei zählt, ahnten aber nicht, dass eine Mine sofort explodiert. Teodor zog am Draht, und die Explosion riss ihm die Hand ab. Wenn ein Krieg tobt, ist er allgegenwärtig, dringt in jeden Winkel, lässt niemanden ungeschoren, nicht einmal Kinder. Mein Vater hat noch die Adern und Sehnen vor Augen, die aus dem Arm seines Bruders hingen, und sein Gesicht, das aussah wie eine zerquetschte Erdbeere. Onkel Teodor überlebte, verlor jedoch sein Augenlicht. Gut möglich, dass er den Zünder betätigte, weil er älter als mein Vater war. An jenem Tag veränderte sich das Leben der Familie, und niemand zog je in Betracht oder sprach darüber, dass es auch anders hätte kommen, das Leben je wieder sein können wie zuvor. Meine schriftstellerische Zwangsneurose hat mich jedoch veranlasst, mir Folgendes auszumalen: Wäre die Mine nicht in Onkel Teodors Hand explodiert, dann wäre wohl er derjenige gewesen, der fortging, um die Schule zu besuchen. Dann wäre mein Vater für immer zu Hause geblieben; dann wäre er nie meiner Mutter begegnet. So funktioniert Geschichte: willkürlich und unumkehrbar.
Also war es Tata, der mit elf Jahren Kindheit und Zuhause verließ, um in Banja Luka zur Schule zu gehen, einer etwa sechzig Kilometer von Vučijak entfernten Stadt. Als er bei der Cousine seiner Mutter eintraf, regnete es; er starrte in seinem Zimmer stundenlang aus dem Fenster und weinte; er weinte drei Tage lang. Als er zum ersten Mal hinausging, um mit den Jungen aus dem Viertel zu spielen, verprügelten sie ihn.
Drei Jahre später wechselte er auf eine Schule in Derventa, nur dreißig Kilometer von Vučijak entfernt. Am Wochenende radelte er zu seiner Familie. In einem Winter brach ein Pedal ab, und er schob sein Fahrrad stundenlang durch den Schnee, riskierte also sein Leben, um seinen kostbaren fahrbaren Untersatz nicht zu verlieren. 1952 kehrte er nach Banja Luka zurück, um auf das Gymnasium zu gehen. Dieses Mal kam er in einem Wohnheim unter. Das waren die Hungerjahre, weil eine Dürre in ganz Bosnien für eine Missernte gesorgt hatte. Im Wohnheim bekamen die Jungs zum Frühstück eine Scheibe Brot – ein Achtel eines 1000-Gramm-Brotes –, einen Klecks Marmelade und Tee. Ein Junge aus Drvar stahl einen Laib Brot und ein Glas Marmelade und flog daraufhin von der Schule.
Die Schule war kostenlos, aber Tatas arme Eltern mussten für seinen Lebensunterhalt aufkommen, und so lebte er noch frugaler als üblich. Wenn er im Sommer zu Hause war, musste er auf einem genossenschaftlichen landwirtschaftlichen Betrieb (zadruga) arbeiten, um Geld zu verdienen. Er bewarb sich ununterbrochen um ein Stipendium, insgesamt fünfundzwanzig Mal, bis er in der Oberstufe eine Zusage von Elektroprenos erhielt, dem staatlichen Energieversorger. Weil es rückwirkend ausgezahlt wurde, von Beginn des Schuljahres an, hatte er das Gefühl, in Geld zu schwimmen, und ließ sich einen teuren Anzug schneidern. Es war sein allererster Anzug, und er lief beim ersten Regen ein. Er paukte wie verrückt, spielte aber trotzdem Handball und übte mit Mädchen das Küssen. Das Gymnasium hatte Hunderte von Schülern, seine Klasse bestand aus zweiundzwanzig Jungs; wenn jemand ein Stipendium erhielt, kaufte er einen Teller Baklava, um sie mit den Klassenkameraden zu teilen. Tata blieb mit vielen dieser Jungs befreundet; er reiste 2016 zum Klassentreffen, bei dem sie nur zu sechst waren; alle anderen waren verstorben, vertrieben oder getötet worden.
Er schloss mit der besten Durchschnittsnote ab, durfte also sofort das Studium an der Fakultät für Elektrotechnik (Elektrotehnički fakultet) der Universität von Belgrad aufnehmen. Er war zu Hause, als er ein Schreiben von Elektroprenos öffnete, das ihm ein noch höher dotiertes Stipendium bewilligte. Die ganze Familie feierte; seine Mutter bereitete steranka zu – in Milch gekochte Mehlklöße –, sein Lieblingsessen. Vor dem Studium musste er aber zur Armee. Er ließ sich freiwillig zum Reserveoffizier ausbilden, um nur ein Jahr dienen zu müssen (als Mannschaftsdienstgrad wären es zwei gewesen), und wurde schließlich Hauptmann. Ich erinnere mich an die bräunliche Uniform, die er anzog, wenn er zum Manöver musste, an den Gürtel mit Brustriemen und die drei Sterne auf den Schulterstücken.
Da er nicht nur ein monatliches Stipendium erhielt, sondern auch den Verdienst der Sommerjobs bei Elektroprenos gespart hatte, konnte er sich in Belgrad amüsieren. Er hatte in Studentski grad zu jener Zeit drei Mitbewohner, und sie besuchten Fußballspiele und Konzerte und gingen ins Kino, und trotzdem studierte Tata wie besessen. Filme genoss er besonders – während der Gymnasialzeit hatte er die abgerissenen Eintrittskarten gesammelt und über die Filme Buch geführt.10 Wie alle anderen erfasste auch ihn das Esther-Williams-Fieber; er stand Schlange, um Zwölf Uhr mittags11 und Streifen mit John Wayne zu sehen. Zu seinen Lieblingsfilmen zählte Emilio Fernández’ Rührstück Un día de vida (1950).12 Der im Film erklingende traditionelle mexikanische Song »Las Mañanitas« wurde in Jugoslawien unter dem Titel »Mama Juanita« sagenhaft populär. Tata schmettert ihn bis heute auf Partys mit einem Vibrato, das direkt aus Mexiko und den Fünfzigerjahren zu stammen scheint. Dieser nahezu vergessene Film rief im Alleingang eine jugoslawisch-mexikanische Musikszene ins Leben, deren Stars, Montenegriner mit Sombrero, auf Serbokroatisch davon sangen, ihre Dörfer, Juanitas und Mamas zu verlassen, um in die große Stadt zu ziehen.
Meine Eltern lernten sich 1959 kennen. Mein Vater hatte einen Mitbewohner (cimer), Nidžo, dessen Schwester die Mitbewohnerin meiner Mutter war. Eines Tages wollte Nidžo seine Schwester Šiša besuchen und schleppte meinen Vater mit. Als Tata Mama zum ersten Mal sah, lag sie büffelnd auf dem Bett – mit angewinkelten Beinen, stelle ich mir vor, modisch hoher Frisur und dem klugen Gesicht, das sie beim Lesen macht. Worüber sie redeten, weiß ich nicht, aber mein Vater war ein Charmebolzen, meine Mutter eine fröhliche junge Frau, und sie gingen tanzen. Die Band spielte vermutlich Paul Anka, Adriano Celentano und Đorđe Marjanović, also die Hits des Festivals von San Remo. Sie gingen schon bald miteinander; sie unternahmen Spaziergänge und küssten sich zaghaft. Mein Vater, stets unverblümt, sagte zu meiner Mutter, sie küsse nicht gut, er dagegen habe das schon am Gymnasium mit einer gewissen Ružica geübt. Meine Mutter war stinksauer, und er musste ihr mächtig schmeicheln, um ihre Gunst wiederzuerlangen.
Die Liebe hinderte sie jedoch nicht am Lernen – beide hätten es nie riskiert, ihre Chance auf Bildung zu vertun, denn in ihren Familien waren sie die jeweils Ersten, die studierten. Meine Mutter stand mit zwei Kinokarten in seinem Wohnheimzimmer, um ihn zum Ausgehen (und wohl auch zum Knutschen) zu überreden, aber wenn er büffeln musste, lehnte er ab und bat seinen Mitbewohner, für ihn einzuspringen. Mama hatte einen Freund namens Boško, der Frauen gegenüber ritterlich war und sogar Blumen verschenkte. Mein Vater und Nidžo stellten den netten Boško schließlich zur Rede und drohten ihm, weil sie befürchteten, durch seine Ritterlichkeit in einem schlechten Licht zu erscheinen. Ich nehme an, dass Boško kuschte, denn der vergleichsweise raue Charme meines Vaters zeigte nach wie vor Wirkung bei meiner Mutter. Sie gingen weiter zusammen aus und sahen wie alle anderen irgendwann Liebe und Mode im Kino.
Mein Vater sang nicht nur, schlug in die Saiten der Gitarre oder spielte Volleyball, sondern erzählte allen, die ihm ihr Ohr liehen, permanent Geschichten – das konnte er gut und kann es bis heute. Die Geschichten drehten sich meist um seine Familie und ihre Nachbarn in Vučijak: Branko, Duja, Makivija, Savka Troglavka etwa gehörten zu seinem Standardpersonal. Einmal träumte er in Fortsetzungen: In mehreren aufeinanderfolgenden Nächten hatten seine Träume einen erzählerischen roten Faden – so jedenfalls stellt er es dar. Am ersten Morgen erzählte er seinen Mitbewohnern nach dem Erwachen von seinem Traum, der leider an der spannendsten Stelle abgebrochen war, und dann, in der nächsten Nacht, setzte sich der Traum fort, und am folgenden Morgen erzählte er, was weiter passiert war, nur endete auch dieser Traum dummerweise ohne zufriedenstellendes Ende. Er träumte weiter, und einige Tage später hatte sich herumgesprochen, dass er Cliffhanger-Träume hatte, und seine Mitbewohner und viele andere Leute im Wohnheim konnten es kaum erwarten, die nächste Traumfolge zu hören. Wie Tata behauptet, erwachte er schließlich in einem Zimmer voller Leute, die sich gegenseitig mit pst-pst-pst zum Schweigen brachten und darauf warteten, dass er das Ende des Traumes enthüllte. Er konnte sich leider nicht daran erinnern, also dachte er sich eines aus.
Viele Freundschaften, die damals geschlossen wurden, währten Jahrzehnte und erloschen erst durch Krieg und Tod. Šiša blieb in Belgrad, genau wie Nidžo, der sich in den frühen Neunzigern zu Tode soff. Als meine Eltern vor einigen Jahren in Belgrad waren, wollten sie Šiša besuchen, wurden aber nicht empfangen.
Meine Eltern erlebten ihr Studium als angenehm. Auf den Fotos sind sie stets schön, feiern und lachen, sind von Freunden umringt, strahlen Unbeschwertheit aus, ein Licht mit der Wellenlänge des Glücks. Als ich so alt war wie meine Eltern auf diesen Fotos, war ich ein mürrischer junger Mann, obwohl ich die Freiheit genoss, die mit einer offenen Zukunft einhergeht; ihr Glück dagegen schien ungetrübte Vorfreude auf all die Herrlichkeiten zu sein, die ihnen noch bevorstanden.
In jedem Sommer arbeitete mein Vater – eine Bedingung seines Elektroprenos-Stipendiums – in einem Umspannwerk in der Nähe des Dorfes Puračić in Zentralbosnien. 1961 beschlossen meine Eltern, an der Küste Sommerurlaub zu machen. Mama fragte ihren Vater, ob sie mit Petar, ihrem Freund, an die Küste fahren dürfe. Stjepan hatte Tata noch nicht kennengelernt, antwortete aber: »Wieso fragst du? Du bist klug genug, um zu wissen, was du tust.« Mama hielt auf dem Weg zur Küste beim Umspannwerk, um Tata abzuholen. Er hatte täglich 12-Stunden-Schichten geschoben, um einige Wochen Urlaub machen zu können. In Puračić schliefen sie laut meines Vaters zum ersten Mal miteinander, in der Schule, wo sie übernachteten. Am nächsten Morgen setzten sie ihre Reise zur Küste fort; keiner von beiden hatte je zuvor das Meer gesehen.
Im Januar 1962 starb Mamas Mutter mit sechsundsechzig an einer verschleppten Lungenentzündung. Obwohl Ružas Tod Mama niederschmetterte, machte sie im Februar ihren Universitätsabschluss und arbeitete ab März in der Stadtverwaltung von Bijeljina, die ihr das Stipendium gewährt hatte. Das war die schwerste Phase ihrer Jugend. Sie suchte immer wieder das Grab ihrer Mutter auf, um zu weinen, konnte sich aber nicht überwinden, ihren Vater zu besuchen – sie fand die Vorstellung unerträglich, dass ihre Mutter nicht dort sein würde –, und er schrieb ihr einen Brief, in dem er sie bat, ihn nicht zu vergessen. Als sie ihn endlich besuchte, brachte sie kein Wort heraus und weinte ohne Unterlass. Tata kam aus Belgrad, um sie zu trösten, und wie Mama sich erinnert, begannen sie um diese Zeit, miteinander zu schlafen.13
Im Mai jenes Jahres lernte sie die sagenumwobene Familie Hemon kennen. Das geschah anlässlich der Hochzeit meiner Tante Maljka. Die Feier fand auf dem Anwesen meiner Großeltern statt – genauer gesagt auf ihrem matschigen Hof. Meine Mutter trug hochhackige Schuhe, die ständig im Schlamm versanken. Kurz darauf, im Sommer 1962, ging Tata für eine Art Arbeitsaufenthalt (staž), der die Konstruktion eines Umspannwerks mit den entsprechenden Hochspannungsleitungen umfasste, nach Deutschland. Sein Gehalt belief sich auf 2880 D-Mark, und Herr Bittner, sein Boss, war so zufrieden, dass er ihm einen Job anbot.
Währenddessen ging es meiner Mutter nicht gut, denn sie trauerte um ihre Mutter und sehnte sich nach meinem Vater. Am Tag, an dem Tata zurückkehren sollte, erwartete sie ihn am Busbahnhof, vergeblich. Es dauerte mehrere Tage, bis eine Postkarte mit der Nachricht eintraf, er besuche seine Schwester Juljka im englischen Leicester.14 Sie war verärgert, weil er die Reise nicht angekündigt hatte; sie fühlte sich alleingelassen. Es sollte nicht das letzte Mal sein.
Mein Vater schlug das Angebot von Herrn Bittner aus. Er war Elektroprenos wegen des Stipendiums verpflichtet und vermisste Mama. Als er schließlich aus Leicester heimkehrte, schliefen sie miteinander; sie äußerte die Befürchtung, schwanger zu werden; wenn das passiere, meinte er, würden sie heiraten. Ein Vorschlag, der zu einem Antrag wurde; zwar bat er nicht auf den Knien um ihre Hand, doch sie willigte ein.
Sie heirateten am 11. November, dem Waffenstillstandstag, in Belgrad, im Standesamt des Bezirks Palilula. Es war eine kleine Zeremonie, zugegen waren nur ihr Freund Žarko als Trauzeuge (kum), Šiša als Trauzeugin (kuma) und ein paar Kommilitonen. Keiner ihrer Eltern war anwesend, und der einzige Familienangehörige war ein in der Nähe lebender Cousin. Sie machten keine Flitterwochen. Mein Vater beugte sich sofort wieder über seine Zwischenprüfungsarbeit. Meine Mutter kehrte nach Bijeljina zurück.
Während meiner Kindheit und Jugend hing ein Hochzeitsfoto über ihrem Bett. Darauf lächeln beide; Mama hält ein Blumenbukett; man sieht einen großen hellen Kreis, den ich jahrelang für einen Beleuchtungskörper (dies im konkreten Sinn) und einen Mond (dies im übertragenen Sinn) hielt, obwohl es in Wahrheit – wenn man genauer hinsah – eine Art Wappen mit Titos Reliefprofil war.
Mein Vater verteidigte seine Zwischenprüfungsarbeit mit großem Erfolg. Sie erhielt eine Auszeichnung (Kolubarska nagrada), die für Forschungsarbeiten im Bereich der Energieübertragung vergeben wurde; die Plakette hängt im Haus meiner Eltern in Hamilton, Ontario. In Sarajewo erwartete ihn ein Job bei Elektroprenos; meine Mutter gab ihre Stelle bei der Stadtverwaltung von Bijeljina auf. Im März 1963 zogen sie in die Stadt, in der sie bis zum jüngsten Krieg leben sollten. Als sie ankamen, besaßen sie nichts als ihr Gepäck. Beide waren noch nie in Sarajewo gewesen, die Stadt war ihnen fremd. Den ersten Tag verbrachten sie in der winzigen Wohnung von Tatas Cousine Olgica und deren Familie, zu der auch zwei kleine Kinder gehörten. Am nächsten Tag ging Tata, den Koffer in der Hand, zu Elektroprenos, und als man fragte, wo seine Frau sei, zeigte er aus dem Fenster nach draußen. Sie saß auf einer Parkbank, den Koffer vor ihren Füßen.
Sie erhielt eine Stelle als Buchhalterin bei Energoinvest, dem größten bosnischen Staatsunternehmen, wo sie bis zu ihrer Pensionierung tätig sein sollte. Sie fanden ein Zimmer in Marijin Dvor, in der Wohnung eines Paares mit zwei jugendlichen Kindern. Die beiden – Teta Jozefina und Čika Martin – sollten fortan wie Großeltern für mich sein, und für Mama und Tata waren sie wie Eltern, weil wir im Gegensatz zu Olgica in Sarajewo keine Familie hatten. Als Mama schwanger wurde, aber feststellen musste, dass die Schwangerschaft pathologisch war – siamesische Zwillinge – und abgebrochen werden musste, half ihr Jozefina durch eine schwere Phase der Trauer.
Mama wurde erneut schwanger, und ich kam am 9. September 1964 zur Welt. Damals wurden Männer im Kreißsaal nicht geduldet, aber mein Vater hätte sowieso nicht dabei sein können, weil er eine defekte Hochspannungsleitung außerhalb der Stadt reparieren musste. Als er die Neuigkeit auf dem Rückweg erfuhr, betrank er sich mit seinem Freund Duško – eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Tata betrunken war. Als er vor der Entbindungsstation im Park stand, zeigte Mama mich am Fenster. Er soll ausgerufen haben, ich sei so hässlich wie Tschombé.15
Einer der Vorzüge des Sozialismus bestand darin, dass Angestellten von dem Staatsunternehmen, für das sie tätig waren, eine Wohnung zugeteilt wurde. Nach zwei Jahren bei Jozefina und Martin erhielten meine Eltern eine Wohnung von Elektroprenos, und sie zogen nach Čenigić vila, eine neu errichtete Wohnsiedlung am Stadtrand. Sie mussten mich eine Weile täglich zu Teta Jozefina und Čika Martin bringen, weil ich andernfalls getobt hätte. Nach einigen Jahren bezogen wir eine größere Wohnung in einem Neubau nahe dem alten Bahnhof. Dort lebten wir bis zum Kriegsausbruch 1992.
Mein Großvater Stjepan starb im November 1967. Ich habe keine Erinnerungen an ihn, aber es gibt ein Foto, das Mama in Schwarz zeigt; ich stehe neben ihr und versuche, sie zu trösten. Im März 1969 wurde meine Schwester Kristina geboren. Tata war damals in Russland. Er hatte sich im Vorjahr um ein Forschungsstipendium in Moskau beworben, das bewilligt wurde, als Mama schwanger war. Er beschloss, es dennoch anzutreten, und kehrte zurück, als meine Schwester drei Monate alt war.
Nach einigen Jahren genossen wir das Leben einer jugoslawischen Mittelschichtfamilie: Wir hatten ein Auto (zuerst einen Austin, danach einen Ford Escort); wir verlebten den Sommerurlaub am Meer; wir hatten einen Farbfernseher. Wir besaßen auch ein Wochenendhäuschen (vikendica) auf dem Jahorina, einem Berg in der Nähe Sarajewos. Tata entwarf und baute es mehr oder weniger eigenhändig; Mama richtete es gemütlich ein. Während meiner Kindheit fuhren wir fast jedes Wochenende zum Jahorina; meine Schwester und ich verbrachten dort die vierwöchigen Winterferien und fuhren Ski. Wenn wir zu Hause bleiben wollten, um Party zu machen, fuhren unsere Eltern allein. »Es ist himmlisch hier oben«, erzählten sie uns dann am Telefon. Sie liebten den Ort; sie hatten vor, ihren Ruhestand dort zu verleben.
1980 starb Tito. Ganz Jugoslawien trauerte. Während eines Fußballspiels zwischen einer kroatischen und einer serbischen Mannschaft (Hajduk gegen Crvena zvezda) lagen sich die Spieler weinend in den Armen, als sie es erfuhren; die Fans auf den Rängen schluchzten auch. Die Zeitungen brachten Leitartikel mit Überschriften wie: »Sogar nach Tito – Tito« (»I poslije Tito – Tito«). Dies wurde zu einem gängigen Slogan, der besagen sollte, das größte Denkmal für Tito sei Jugoslawien selbst. Oslobođenje, die Tageszeitung Sarajewos, bot kostenlose Bilder von Tito an, die bald in Geschäften, Fenstern und den Windschutzscheiben von Taxis hingen. Fernsehen und Radio spielten tagelang ausschließlich klassische Musik. Staatsführer, Könige und Präsidenten aus aller Welt reisten zu Titos Begräbnis nach Belgrad; eine Million Menschen folgten der Prozession durch die Straßen. Das Land war in Trauer vereint, doch Emotionen und Mythen sind beschränkte, zeitlich begrenzte und tragisch unzuverlässige Garanten für den Zusammenhalt. Wir wussten es damals nicht, aber Titos Tod läutete den Verfall Jugoslawiens ein. Es sollte noch sieben Jahre dauern, bis das Land an sein blutiges Ende gelangte.
Kurz vor Titos Tod bekam Tata einen höheren, besseren Posten bei der Firma Energoinvest angeboten und wurde 1980 für drei Jahre nach Kinshasa geschickt, um die Energieversorgung in Zaire aufzubauen. Mama blieb mit zwei heranwachsenden Kindern, die – nur um es festzuhalten – Wildfänge waren, in Sarajewo. Tata kehrte alle sechs Monate heim, brachte Geschenke und Geschichten mit, schmuggelte sogar Elfenbein und aufgerollte Schlangenhäute ein. Mama, Kristina und ich besuchten ihn in Zaire und verlebten einen unvergesslichen Sommer.
Tata war in Kinshasa, als seine Mutter Mihaljina im Frühling 1982 starb. Er hatte sie vor ihrem Tod nicht mehr sehen können, kam auch nicht zu ihrer Beerdigung. Sein Vater Ivan war damals schon fast blind und versank immer tiefer in einer Demenz. Gegen Ende seines Lebens erhob sich Opa Ivan mühevoll vom Sofa und lief mit zitternden Trippelschritten durch das Zimmer, überzeugt, es bis in die Ukraine zu schaffen, wenn er nur lange genug ginge.
Nach Tatas Rückkehr aus Afrika, wo er gut verdient hatte, rückten wir in der sozialistischen Gesellschaft noch etwas höher, stiegen in das auf, was man höhere Mittelschicht nennen könnte; Kristina und ich trugen ausländische Markenklamotten und besaßen importierte LPs; Tata plante eine weitere vikendica auf dem Jahorina. Das Unternehmen war in vielen Ländern tätig, vor allem in jenen der sogenannten Dritten Welt, und mein Vater arbeitete in Afrika – zum Beispiel in Libyen, Äthiopien, Tansania und Zaire –, aber auch in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Mama begleitete ihn manchmal: Sie reisten gemeinsam nach Paris und Florenz. Er war viel im Ausland, und meine Schwester und ich vermissten ihn; er brachte uns coole Jeans, Schokolade und LPs mit. Wir hatten das Gefühl, in gesicherten Verhältnissen zu leben, zumal wir Ersparnisse hatten, die für das sozialistische Jugoslawien ansehnlich und zum Schutz vor der galoppierenden Inflation in Dollar angelegt waren. Außerhalb unseres Privatlebens allerdings war nichts mehr stabil, was mir gefiel, weil sich die sozialistischen Grundsätze und die Zensur lockerten. Man gewann den Eindruck, dass sich Politik, Wirtschaft und öffentlicher Raum liberalisierten. Man bekam zwar immer noch Ärger, wenn man gewisse Dinge dachte oder aussprach (was ich tat), aber der jugoslawische Sozialismus mitsamt all seinen Göttern und Mythen, Tito inklusive, war längst nicht mehr so sakrosankt wie früher. Für meine Eltern, vor allem für Mama, war das verwirrend.
1987, just als die Risse im Gewebe Jugoslawiens sichtbar wurden, floss ein Teil unseres Geldes aus Zaire in den Bau einer neuen vikendica, direkt neben der alten. Ich half Tata in jenem Sommer gegen Bezahlung, denn ich hatte damals eine Band, und wir brauchten eine Rhythmusmaschine. Er plante, die zweite Hütte an Touristen und Skifahrer zu vermieten, sodass sie sich selbst trug; wenn Mama und er nicht mehr wären, würden meine Schwester und ich je eine Hütte erben. Unseren Eltern war es wichtig, ihren Kindern etwas zu hinterlassen; sie stellten sich vor, dass Kristina und ich viele Jahre später mit unseren Familien hier, auf dem von ihnen errichteten Anwesen, Skiurlaub machen würden. Während der Arbeit an der zweiten Hütte erzählte Tata eines Tages, er habe schon vor Augen, wie ich mit meinen Freunden in dieser Hütte Karten spielen (preferans) und sagen würde: »Die haben wir noch zu Petars Lebzeiten erbaut.« Mit anderen Worten: Indem er etwas schuf, das er seinen Kindern hinterlassen konnte, errichtete er sich ein Denkmal. Wir stellten die Hütte fertig; sie war ein paar Jahre lang vermietet. Ich habe dort nie Karten gespielt und werde es auch nie tun, denn die Hütte brannte 1992, gleich zu Beginn des Krieges, nieder.
Jugoslawien war lange ein stabiles Land, in dem es sich gut leben ließ, vor allem weil Tito so klug war, sich von der übermächtigen Sowjetunion zu distanzieren. So entstand ein starkes, relativ offenes Jugoslawien, das für den Westen von Bedeutung war und mit üppigen internationalen Darlehen belohnt wurde. Ein Großteil dieses Geldes wurde in den Aufbau einer schlagkräftigen Armee investiert, die sich im Notfall sowohl gegen den Osten als auch gegen den Westen verteidigen konnte. Die politischen Strukturen jedoch, die Tito geschaffen hatte, um das ethnische und politische Gleichgewicht zu erhalten, wurden während der jahrzehntelangen Herrschaft einer Partei und des großen Führers ausgehöhlt. Die Lebensfähigkeit des Landes litt noch weiter, als es durch den Fall der Mauer und den Zerfall des Sowjetreiches seine strategische Bedeutung verlor. Als man die Rückzahlung der Darlehen forderte, begann die Wirtschaft zu kollabieren, und die privilegierte Kaste der Militärs – von Serben dominiert – sah sich nach neuen Anführern um.
1991 ging Mama in Frührente, quittierte also ihren Job bei Energoinvest, den sie bald nach der Ankunft in Sarajewo angetreten hatte. Folgenreicher war, dass die nationalistischen Parteien bei den ersten freien Wahlen in allen sechs Teilrepubliken den Sieg errangen. Slowenien und Kroatien erklärten ihre Unabhängigkeit, was den Zerfall Jugoslawiens bedeutete, und schließlich brachen Kriege aufgrund territorialer Ansprüche aus. Rasch wurde deutlich, dass diese Konflikte auch Bosnien erfassen würden. Im Januar 1992 ging ich in die Vereinigten Staaten, wo ich bis heute lebe. Ende Februar fand eine Volksabstimmung zur bosnischen Unabhängigkeit statt. Sie wurde von den Serben boykottiert, aber die übrige Bevölkerung stimmte mit überwältigender Mehrheit dafür. Bosnien wurde also unabhängig, doch die nationalistischen Serben handelten sofort und starteten, unterstützt von Milošević, eine gut geplante Militäroffensive, nahmen Städte und Dörfer mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung ein und säuberten sie von anderen Ethnien. Im April errichtete man Barrikaden in den Straßen Sarajewos – Tata und Kristina machten einen Spaziergang, um sie zu begutachten –, und die Serben bezogen in den Bergen rings um die Stadt Stellung. Bereits gegen Ende des Monats gab es regelmäßigen Beschuss, und meine Schwester folgte ihrem damaligen Freund zu dessen Familie nach Belgrad. Mein Vater wäre gern in das alte Haus seiner Familie in Vučijak gezogen, nahe Prnjavor, denn es war die Jahreszeit, in der er sich um die Bienen kümmern musste, doch Mama sträubte sich – sie wollte ihr Zuhause nicht verlassen, weil sie befürchtete, nie wieder zurückkehren zu können. Sie mussten die Nächte im Keller des Hauses verbringen, weil die Fenster der Wohnung leichte Ziele waren und die Stadt bereits beschossen wurde; nach einer Weile wollte sich mein Vater nicht mehr verkriechen und lag schnarchend im Bett, ohne sich vom Kriegslärm stören zu lassen, während meine Mutter nächtelang mit Nachbarn redete, von denen manche argwöhnisch waren, weil sie nicht glauben wollten, dass mein Vater in seinem Bett schlummerte. Tata konnte Mama schließlich überreden, und sie begaben sich mit Mek, unserem Irish Setter, zum Bahnhof von Sarajewo, um nach Prnjavor zu fahren, doch der Zug fuhr nicht ab. Tagelang gingen sie immer wieder zum Bahnhof und kehrten unverrichteter Dinge heim. Am 1. Mai erklärte Mama auf dem abermaligen Rückweg vom Bahnhof, sie habe die Nase voll. Am nächsten Morgen konnte mein Vater sie zu einem letzten Versuch überreden. Sie nahmen Mek mit, sonst aber wenig, weder warme Kleidung noch ihre Pässe, nicht einmal ihre Personalausweise. Der Zug fuhr um 12:30 Uhr ab. Am späten Nachmittag schloss sich der Belagerungsring um die Stadt, und der schwere Beschuss setzte ein. Der Zug, in den meine Eltern stiegen, war der letzte; danach fuhr jahrelang kein einziger mehr.
Meine Eltern erreichten Vučijak und blieben den ganzen Sommer. Tata kümmerte sich um seine Bienen, Mama um den Garten. Die Nachrichten aus Sarajewo – aus ganz Bosnien – waren entsetzlich. Lkws voller serbischer Soldaten, die Lieder grölten, in denen sie Mord und Totschlag schworen, brausten auf dem Weg zur Front am Familiengehöft vorbei. Der Hund wurde von einer Zecke gebissen und wäre fast gestorben. Dann bekam Mama eine extrem schmerzhafte Gallenblasenentzündung und musste für die Operation nach Subotica gebracht werden, eine Stadt an der serbisch-ungarischen Grenze, in der ihr Bruder Milisav lebte. Bald darauf stieß mein Vater zu ihr, und nachdem sich Mama erholt hatte, zogen sie nach Novi Sad, wo ein weiterer Bruder, Dimitrije, eine kleine Wohnung besaß, in der sie unterkommen konnten.
Zugleich brach in jener Zeit in Serbien und Montenegro – dem Rest, der von Jugoslawien übrig war – eine weltrekordträchtige Inflation aus. Meine Eltern waren nicht nur knapp bei Kasse (alle Ersparnisse waren dahin) – auch das, was sie noch hatten, verlor minütlich an Wert. Tata gelang es, in Ungarn gleich hinter der Grenze Arbeit zu finden, und er war oft fort. Da Kristina in Belgrad war, verbrachte Mama viel Zeit in der winzigen Wohnung und schüttete Mek ihr Herz aus. Einmal ging sie mit ihm in einen Park, wo er mit einem Rottweiler aneinandergeriet; sie wollte die Hunde trennen, der Rottweiler zerfetzte ihre Hand, und sie musste operiert werden.
Schließlich beantragten Mama, Tata und Kristina Einreisevisa nach Kanada, die bewilligt wurden. Im Dezember 1993 kamen alle drei in Hamilton, Ontario an. Sie fanden eine Wohnung im fünfzehnten Stock einer großen Wohnanlage. In ihrem neuen Zuhause gab es so viel Nichts, dass sie nicht wussten, wie sie damit beginnen sollten, es zu füllen.
2 Heimatland
Heute denkt man gern verächtlich über das untergegangene Jugoslawien oder hält es rückblickend für eine Art Frankenstein-Staat, zusammengestückelt aus unpassenden Einzelteilen, dessen Zerfall unausweichlich war und zwangsläufig blutig verlaufen musste. Doch wenn die üppig honorierten Historiker eines Thinktanks in einigen Jahrzehnten die Verheerungen untersuchen, die Trump und seine Truppen hinterlassen haben, dann werden sie womöglich eine ebensolche Fülle von Indizien für Jahrhunderte des Hasses und des inhärenten Rassismus entdecken und somit auch für die historische Unausweichlichkeit, mit der es schließlich zur Katastrophe kommen musste. Sie würden jedoch genauso falschliegen wie jene, die Jugoslawien schlechtmachen, denn in beiden Fällen haben wir es mit einer Geschichte widerstreitender Traditionen und Tendenzen zu tun, mit dem Ringen um eine bessere Politik und ein friedvolleres Land, wider die niedersten Instinkte des Menschen. In Jugoslawien siegten die Bösewichte und zerstörten, was sie nur konnten und sobald sie es konnten; in den Vereinigten Staaten gedeihen die Bösewichte derzeit ebenfalls prächtig. Doch nichts ist unausweichlich, bevor es sich vollzieht. Es gibt keine historische Bestimmung. Das Ringen ist alles.
Jugoslawien, Land der Südslawen, wurde am 1. Dezember 1918, im Nachklapp des Ersten Weltkriegs, als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet. Drei Großmächte hatten nach jahrhundertelanger wechselvoller Geschichte soeben aufgehört zu existieren, was die Gelegenheit zur Schaffung obskurer kleiner Staaten bot, deren Bewohner das postimperiale Chaos als Freiheit erlebten. Unter den Südslawen, die den Balkan bevölkerten, besaß die Vision eines staatlichen Verbunds eine lange Vorgeschichte und war von charismatischen Führern verfochten worden, die an die Vorzüge der Einheit geglaubt hatten. Das Königreich, das diese Einheit verwirklichen sollte, hatte von Beginn an mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil das Land von Menschen bevölkert war, die sich einerseits zu stark ähnelten und andererseits zu stark voneinander unterschieden. 1929 änderte König Aleksandar (nicht mit mir verwandt) die Verfassung, um mit absoluter Macht regieren zu können, und das Königreich wurde in Jugoslawien umbenannt. Er wurde 1934, während eines Besuches in Marseille, dann auch prompt ermordet. Die Propaganda wollte, dass des Königs letzte Worte »Erhaltet mir mein Jugoslawien!« gelautet hatten. Mein Großvater väterlicherseits, Ivan, reiste zu dem bombastischen Begräbnis nach Belgrad. Meine Eltern wurden als Untertanen des jugendlichen Königs Peter II.16 geboren, der 1941 vor der Invasion der Deutschen floh und ausgerechnet in Chicago landete. Dort sollte er auch sterben, aber so ergeht es wohl den meisten.
Der Zweite Weltkrieg verlief in Jugoslawien sehr blutig, aber wo in Europa war das nicht der Fall? Die Nazis fanden viele bereitwillige Helfer unter den lokalen Faschisten und Nationalisten, deren bevorzugte historische Vorgehensweise, ebenso wie bei ihren Besatzern, der Genozid war – ihre Nachfahren sollten es ihnen ein paar Generationen später gleichtun. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens jedoch, vor dem Krieg noch verboten, war im Widerstand und in der Organisation von Untergrundnetzwerken versiert und sorgte unter der Führung Josip Broz Titos für die Bildung einer nationalen Widerstandsbewegung, die sowohl die deutschen Besatzer als auch die »Verräter im Inneren« überlebte, obwohl diese immer wieder mit unaussprechlicher Grausamkeit gegen sie vorgingen.
Man kann gegen Tito und sein Nachkriegsregime, das so stark auf seine Person zugeschnitten war, dass es ihn nicht lange überlebte, sagen, was man will, doch unter seiner Führung organisierte die Partei den Widerstand und befreite Jugoslawien. Außerdem vermochte er sicheren Abstand zur Sowjetunion zu halten und entzog sich bereits 1948 Stalins absolutistischer Kontrolle. Tito war ein kluger, wenn auch autoritärer Herrscher, der Jugoslawien so geschickt zwischen Ost und West zu positionieren verstand, dass es – als blockfreies Land – sowohl von der Distanz als auch von den Kontakten zu beiden Seiten profitierte.