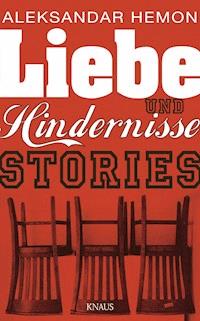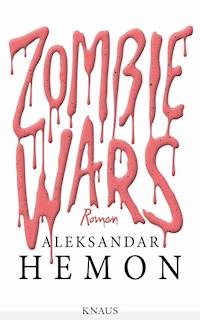
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
„Hemon kann einfach keinen langweiligen Satz schreiben.“ The New York Times Book Review
Chicago 2003. Joshua Levin, wohlstandsverwöhntes Kind einer orientierungslosen Generation, lässt sich durch seine Mittdreißiger treiben. Seine einzige Leidenschaft gilt dem Drehbuchschreiben. Mit einer Persiflage auf die Trashkultur und Allmachtsfantasien Amerikas, das sich gerade auf eine weitere Invasion des Irak vorbereitet, will er den Durchbruch schaffen. Doch gerade, als ihn die Inspiration zu einer vielversprechenden Skriptidee ereilt – „Zombie Wars“ – gerät sein Leben aus den Fugen: Nicht nur sein kriegstraumatisierter Vermieter, sondern auch ein eifersüchtiger Ehemann haben es plötzlich auf ihn abgesehen. Joshua hat alle Hände voll zu tun, um seinen Hals zu retten – und wird zu einem Antihelden, wie er ihn selbst nicht hätte besser erfinden können.
In seinem neuen turbulenten Roman dringt Aleksandar Hemon tief in die Seele seiner Wahlheimat Amerika und hält ihr provokant und erzählerisch brillant den Spiegel vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Sammlungen
Ähnliche
Über den Roman
Chicago 2003. Joshua Levin, wohlstandsverwöhntes Kind einer orientierungslosen Generation, lässt sich durch seine Mittdreißiger treiben. Seine einzige Leidenschaft gilt dem Drehbuchschreiben. Mit einer Persiflage auf die Trashkultur Amerikas, das sich gerade auf eine weitere Invasion des Irak vorbereitet, will er den Durchbruch schaffen. Doch gerade, als ihn die Inspiration zu einer vielversprechenden Skriptidee ereilt – »Zombie Wars« – gerät sein Leben aus den Fugen: Nicht nur sein kriegstraumatisierter Vermieter, sondern auch ein eifersüchtiger Ehemann haben es plötzlich auf ihn abgesehen. Joshua hat alle Hände voll zu tun, um seinen Hals zu retten – und wird zu einem Antihelden, wie er ihn selbst nicht hätte besser erfinden können.
In seinem neuen Roman dringt Aleksandar Hemon tief in die Seele seiner Wahlheimat Amerika und hält ihr provokant und erzählerisch brillant den Spiegel vor.
Über den Autor
Aleksandar Hemon wurde 1964 in Sarajevo geboren und lebt seit dem Bosnienkrieg in den USA. Spätestens seit seinem international gefeierten Roman »Lazarus«, der in Deutschland auf der Shortlist des Internationalen Buchpreises 2009 stand, gehört er zu den meist beachteten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Mit »Zombie Wars« legt er nun sein wohl provokantestes Werk vor. Hemon lebt mit seiner Familie in Chicago.
ALEKSANDAR HEMON
ZOMBIE WARS
Roman
Aus dem Amerikanischen von André Mumot
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Making of Zombie Wars«
bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Aleksandar Hemon
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die vom Autor adaptierten Zitate von Baruch de Spinoza basieren
im Deutschen auf der Übersetzung von Jakob Stern,
revidiert von Michael Czelinski-Uesbeck.
Bibelzitate entstammen, wo möglich, der Luther-Übersetzung.
Covergestaltung: Sabine Kwauka nach einer Vorlage von
Rodrigo Corral und Zak Tebbal.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17923-6V002
www.knaus-verlag.de
Der Geist kann nur, solange der Körper dauert, sich etwas vorstellen und sich der vergangenen Dinge erinnern.
Baruch de Spinoza
Als ich aufwuchs, war die Welt gefährlich, und man wusste genau, mit wem man es zu tun hatte. Es hieß: Wir gegen die anderen, und es war klar, wer diese anderen waren. Heute sind wir uns nicht so sicher, wer sie sind, aber wir wissen, dass sie da sind.
George W. Bush
Skript-Idee #2: Ein in die Jahre gekommener Auftragskiller mit Herzproblemen wird gezwungen, in den Ruhestand zu gehen, nachdem er bei seinem letzten Auftrag versagt hat. Es ist das erste Mal, dass er danebengeschossen hat, als er daher die Gelegenheit bekommt, es noch einmal zu versuchen und seine makellose Bilanz wiederherzustellen, kann er nicht ablehnen, auch wenn er einen Herzinfarkt riskiert. Dann aber verliebt er sich in die Teenagertochter seines potenziellen Opfers. Titel: Ein letztes Herz.
Skript-Idee #7: Ein blinder Mann und eine blinde Frau fühlen sich durch den Geruch des anderen zueinander hingezogen. Bei ihrer ersten Verabredung finden sie sich zufällig am Tatort eines Mordes wieder und schnappen den Geruch des Mörders auf. Niemand glaubt den beiden, aber der parfümierte Killer heftet sich an ihre Fersen. Titel: Where do we go from nowhere -Der süße Duft des Todes.
Skript-Idee #12: DJ Spinoza ist ein Außenseiter, den niemand versteht: weder seine Mitschüler noch seine Freunde, und seine Lehrer auch nicht. Sein großer Traum ist es, beim Abschlussball aufzulegen und die ganzen Vollidioten umzuhauen. Doch nach seiner radikalen DJ-Session auf einer Party bei dem Mädchen (Rise), das er unbedingt für sich gewinnen will, wird er zusammengeschlagen. Wie kann er es schaffen, alle zum tanzen und Rise dazu zu bringen, ihn zu lieben? Titel: DJ Spinoza– Tanz in den Abgrund.
Also, was könnte ich mit dem Jungen machen?, fragte sich Joshua. Alle menschlichen Gefühle lassen sich von Freude, Schmerz und Lust ableiten, aber vor allem – das könnte Spin zu Rise sagen – vom Beat. Er könnte aber auch einfach den Mund halten. Vielleicht war er ja eher der starke, schweigsame Typ? Warum so und nicht so? Schreiben bedeutete doch vor allem eines: die hoffnungslose Bürde von Entscheidungen tragen zu müssen, die keinerlei Folgen nach sich ziehen.
Der Nachmittag im Coffee Shoppe ging gerade in den Abend über, und Joshuas Koffeinpegel hatte längst den der Plantage in Ruanda erreicht, von der sein Getränk vermutlich stammte. Deshalb wollte er nun auch unbedingt Ruanda googeln und Wissenswertes über fremde Kulturen erfahren, in der Hoffnung, sein aktuelles kreatives Dilemma würde sich damit von selbst auflösen. Irgendwann einmal, vor der Erfindung des World Wide Web der Versuchung, hatte es doch diese sogenannte Inspiration gegeben. Dann aber war alles Nachdenken ersetzt worden durch die Suche nach Belanglosigkeiten. Zum Glück gab es kein W-Lan im Coffee Shoppe.
Also öffnete Joshua einen Unterordner mit einem anderen Skript, das sich bereits seit Ewigkeiten im Entwicklungsstadium befand (Titel: The Snakeman Blues– Rückkehr der Schlange). Ein fanatischer Comic-Nerd und ein abgedankter Superheld (der Snakeman), der sich widerwillig als Englischlehrer in einer öffentlichen Schule seinen Lebensunterhalt verdient, schließen sich darin zusammen, um gegen den heimtückischen Bürgermeister von Chicago zu kämpfen. Joshua konnte sich einfach nicht entscheiden, ob der Snakeman am Ende sterben oder überleben und in den Schuldienst zurückkehren sollte – was in Chicago die wirkliche Heldentat war –, und wenn ja, ob in menschlicher Form oder als Schlange. Ein Happy End wäre kitschig, sein Tod am Schluss deprimierend, und eine Zwischenlösung fiel Joshua nicht ein. Davon abgesehen: Wie sollte ein Reptil gegen das Chicago Police Department und den hinterhältigen Bürgermeister kämpfen?
Da er zu unterzuckert war, um auch nur ein Wort zu tippen, das dann vielleicht zum nächsten führen würde, blieb ihm nichts anderes übrig, als auf die leere Stelle unter der Zeile zu starren, die er als Letztes geschrieben hatte. (Snakeman: Warte! Zuerst kümmern wir uns um den Boss!) Der gute alte Baruch de Spinoza hatte recht: Die Unendlichkeit ist größer als alle Realität. Aber die Endlichkeit im Grunde auch. Joshua blickte zum Fußgängerübergang vor dem Coffee Shoppe hinüber, wo nichts passierte, bis er einen gewissen Trost darin fand, sich für ein imaginäres Publikum bei einer zukünftigen Dinner-Party clevere Witzchen auszudenken: Wie kam man eigentlich dazu, sein Café hochtrabend Shoppe zu nennen, statt Shop? Hatten etwa bereits die Helden aus Chaucers Canterbury Tales Chai-Lattes mit Sojamilch getrunken? Und stand dann nicht zu befürchten, dass Baristas mit einer Vorliebe für Mittelenglisch bald schon von der Schwarzen Pest dahingerafft würden? Et cetera.
Er wollte gerade eine weitere Datei öffnen, um seine gesammelten Shoppe-Pointen festzuhalten, als eine ganze Horde jugendlicher Kadetten wie in Zeitlupe am Horizont der Olive Street auftauchte, was Joshua an die Totale in Lawrence von Arabien erinnerte, in der sich auf der flachen Wüstenhorizontale ein winziger Fleck langsam in einen Reiter verwandelt. Die Kadetten kamen die Straße entlanggetrottet, versetzten einander kameradschaftliche Hiebe, klatschten sich auf die ausrasierten Nacken und kannten offenbar keinerlei Sorgen, abgesehen vielleicht von der Angst, aus dem Rudel ausgestoßen zu werden. Plötzlich sah er sie, dick mit Staub bedeckt, in der Wüste vor sich, sah, wie ihnen die Zungen vor Durst aus den Mündern hingen, während sie in eine Schlacht zogen, in der sie erwachsen werden und/oder heldenhaft zu Tode kommen würden, während ihnen die ruchlosen Eingeborenen pisswarmes kontaminiertes Wasser in zerbeulten Blechtassen reichten. Noch konnten sich die Kadetten ihre Sandsturmzukunft natürlich nicht vorstellen, sich höchstens schon mal ein wenig im Voraus bemitleiden. Genau genommen konnten sie kaum etwas erahnen, was über ihre nächste Mahlzeit hinausging oder über das Ausspielen ihrer kindischen Abgebrühtheit, über das neckische Pseudohandgefecht auf dem Weg zum Abendessen. Wer einen Geist hat, der zu sehr vielen Dingen befähigt ist, der hat auch, so in der Art hieß es doch bei Baruch, einen Körper, dessen größter Teil ewig ist. Und während Joshua über die traurige Gedankenlosigkeit der Kadetten sinnierte, kam ihm die Szene aus Dawn of the Dead in den Sinn, in der die Zombies um ein verlassenes Einkaufszentrum kreisen, unfähig, ihr Leben vor dem Untotendasein zu vergessen, da ihre befallenen Hirne noch immer die Überreste glücklicher Weihnachtserinnerungen mit sich herumschleppen. Ein pausbäckiger Kadett nahm Joshuas inspirierten Blick wahr, und während der Rest des Korps zum Sandwichladen nebenan weitertrottete, verschwand hinter der Scheibe das Grinsen auf seinem breiten Gesicht. Seine Wangen waren gerötet, die unterschiedlich großen Vorderzähne bildeten eine ungleichmäßige Skyline, und in seinen Augen leuchtete die arrogante Unschuld der Jugend. Ein segensreicher Lidschlag genügte, und Joshua sah die Landschaft seiner Geschichte in ihrer ganzen Vollkommenheit vor sich: all die endlosen Möglichkeiten, die Overhead-Shots und Totalen, all die grandiosen Figurenkonstellationen, die am Firmament aufflammten, die Freiräume, in die eine Liebesgeschichte eingebaut werden konnte – Joshua brauchte nur noch durch dieses maßgeschneiderte Paradies zu wandeln und alles niederzuschreiben. Dieses Mal, dazu war er fest entschlossen, würde seine Vision nicht zusammen mit den Gebeinen all der anderen Ideen im Speicher seines Computers verrotten. Noch an Ort und Stelle öffnete er eine neue Datei. Er verfasste die Titelseite und starrte sie dann mit großen Augen an:
Zombie Wars – Krieg der Untoten
Von Joshua Levin
Chicago, 31. März 2003
Und weiter starrte er sie an.
Zu schade, dass Schöpfung sich nicht erzwingen ließ – es sei denn vielleicht, man war Gott persönlich. Joshua musste erst einmal was essen, bevor er sich auf sein Werk stürzen konnte. Also stellte er sich in der Schlange hinter einem übertätowierten Arschloch an, das sich nicht zwischen Bananen- und Kürbisbrot entscheiden konnte, während der Barista mit der Che-Guevara-Baskenmütze (der vermutlich fließend das gottverdammte Mittelenglisch beherrschte) gleichgültig ins Leere blickte. Dank des Staus konnte Joshua sich in aller Ruhe ausmalen, wie ein Zombie in die Halstattoos des Arschlochs beißen würde, wie Blut über die bereitgestellten Latte-Becher spritzte und sie rosa färbte, während sich der Zombie vom hysterisch zischenden Espressoautomaten nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen ließ. Auch für sein kunstvolles Streben nach dem perfekten Schaum für Joshuas Cappuccino benötigte der an Chaucer geschulte Revolutions-Barista eine Ewigkeit und gab der Zombie-Apokalypse so Zeit genug, ihre kataklysmische Realität auszuhauchen und auf den Grund von Joshuas Geist abzusinken. Zurück an seinem wackligen Tisch kaute er an seinem Karottenbrot herum, bis er eine zenartige Stufe von geistiger Koffeinschock-Leere erreicht hatte. Er schloss die Datei, dann das Programm und schließlich den Laptop, um ihn in seiner Tasche zur Ruhe zu betten.
Schon früher hatte Joshua wesentliche Abschnitte seines Lebens verschwendet, ohne dass ihn dies besonders bedrückt oder traumatisiert hätte. Das Hauptproblem an diesem Montag war jedoch, dass er einige Seiten zu seinem Workshop(pe?) Drehbuchschreiben II mitbringen musste, der heute zum ersten Mal bei Graham, ihrem Kursleiter, zu Hause stattfinden sollte. Auch die Birkenstock-Schwanzlutscher des Film-Collectives waren Blutsauger. Einen schamlosen Anteil der Kursgebühr zweigten sie für die Raummiete ab und machten sich nicht mal die Mühe, für ausreichend Klopapier zu sorgen. Graham hatte das bisher aus eigener Tasche übernommen, nun aber entschieden, dass sich seine treuen Workshoppers ihre Hintern ebenso gut in seiner bescheidenen Behausung abwischen und er das ganze Geld für sich behalten könnte.
Ohne Seiten und nur mit den vagesten Erinnerungen an einschlägige Zombiefilme ausgestattet, machte es sich Joshua also auf einem lilafarbenen Sitzsack in Grahams Wohnzimmer bequem. Salzbrezeln und eine große Flasche kohlensäureloser Cola light standen auf dem Couchtisch. Während ihm von seiner verrutschten Unterhose die Hoden eingeklemmt wurden, vermied Joshua jeden Augenkontakt mit dem ganz in Flanell gewandeten Dillon, der gerade, hüfttief eingesunken in einem verblichenen Futon, für die Gruppe einige seiner Ideen umriss. Auch Bega war da, hockte in einem Motörhead-Shirt am Schreibtisch und ließ andächtig das verschwenderisch beleuchtete Wrigley-Field-Baseballstadion auf sich wirken, das man von Grahams Fenster aus sehen konnte. Die Zuschauer feierten lautstark einen Home Run, und Bega schnaufte wehmütig. Sein graues Haar, unordentlich gescheitelt, passte hervorragend zu den gräulichen Stoppeln auf seinem Gesicht. Graham unterbrach Dillons Litanei, um eine passende Stelle aus seinem soeben fertiggestellten eigenen Skript zum Besten zu geben.
»Gesegnet seien die Amateure!«, deklamierte er mit der großkotzigen Stimme seiner Klischeefigur. »Die, die sich bemühen, die scheitern, in der Scheiße schwimmen! Lasst uns diejenigen preisen, die von Großem träumen und nichts erreichen, die sich nicht verdrießen lassen vom Unmöglichen, während sie in der Falle des Möglichen festsitzen! Sie sind die Mistkäfer des amerikanischen Traums, sie düngen den amerikanischen Boden, und kein Lied wird ihnen gesungen.«
Graham strich sich nachdenklich mit dem Daumen über das Grübchen in seinem Kinn, während er zu seinem Publikum aufschaute und auf Reaktionen wartete: Dillon beugte sich über das aufgeschlagene Notizbuch in seinem Schoß und kritzelte wie wild etwas hinein; Bega nickte und zerkaute dabei seinen Kuli; Joshua wiederum starrte Graham direkt an, allerdings nur, weil seine eingeklemmten Eier begannen, schmerzhaft anzuschwellen. Eigentlich hätte er aufstehen, die Hand in die Hose schieben und seine Hoden aus dem Klammergriff der Unterwäsche befreien müssen. Zu solch einer hingebungsvollen Geste war er jedoch noch nicht bereit, also litt er weiter. Der Geist kann nur, solange der Körper dauert, sich etwas vorstellen.
»Nur damit ihr euch nicht fragt, wie die Sache ausgeht«, fuhr Graham fort, »mein Held kommt am Ende ganz groß raus. Zwischendurch ist er völlig am Ende, aber am Schluss startet er wieder voll durch und sackt einen Golden Globe ein.«
Joshua versuchte, an seinen Rucksack heranzukommen, aber der Schmerz in seiner Lende ließ ihn nur nach Luft schnappen und sich wieder zurücklehnen. Grahams Wohnzimmer war zum Bersten voll mit eingestaubten Taschenbüchern, in denen es um die Magie des Films und die Kunst des Drehbuchschreibens ging. Die einzige bücherfreie Wand zierte ein riesiges Poster von DerPate, Teil II, auf dem Al Pacino über ihnen aufragte wie Jesus auf einem Altarbild.
»Das basiert alles auf wahren Begebenheiten, Leute. Die Studiobosse haben Schlange gestanden bis zu den Hollywood Hills, um mit mir ’ne Cola Light zu trinken, aber für die hab ich nicht den Arsch hingehalten! No, Sir!« Graham reckte der Schlange aus Studiobossen noch einmal nachträglich den Mittelfinger entgegen. »Ihr könnt euch gern selber in den Arsch ficken, ihr Weinstein-Wichser!«
Während er seine Tiraden losließ und sich auf seinem kahlen Kopf, wie bei einer Lavalampe, einzelne rote Flecken bildeten, schaukelte Graham vor und zurück wie ein Chassid. Bega schien dieser Wutausbruch zu gefallen, da er den Verzehr seines Kulis für ein herzhaftes Gelächter unterbrach. Joshua rollte sich derweil vom Sitzsack, stand mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und beschloss, nicht auf Grahams unterschwelligen Antisemitismus einzugehen.
»Was ich damit eigentlich sagen will, ist Folgendes«, fuhr Graham fort. »Ihr seid bereit, etwas zu lernen, und das ist schon mal verdammt viel wert. Also Dillon, um mal vollkommen ehrlich und produktiv zu sein, was du uns hier präsentierst, ist nicht grade die beste Idee, die ich je gehört habe. Im Gegenteil. Aber wir werden den ganzen Tag dran arbeiten, und wir werden was Gutes daraus machen.«
Dillon schrieb etwas auf, blätterte dann die Seite um und schrieb noch mehr. Joshua ließ endlich die Hose herunter, um seine Eier zu befreien, und sein von einem Haarbüschel umkränzter Bauchnabel blinzelte allen fröhlich zu.
»Was zum Teufel machst du da?«, fragte Graham.
»Unbeabsichtigter Selbstkastrierungsunfall«, erklärte Joshua.
Graham klatschte in die Hände, was Dillon zusammenzucken ließ. »Hast du das gehört, Dillon? Unbeabsichtigter Selbstkastrierungsunfall! Schreib das auf! So was solltest du deine Figuren sagen lassen, nicht irgendwelchen nichtssagenden Scheiß über die Gier der Konzerne.«
Die Freude über das Befreien seiner Hoden wurde verstärkt durch Grahams Lob. Deshalb hatte Joshua nun auch keine Scheu mehr, Dillon zur Seite rutschen zu lassen, damit er ebenfalls auf dem Futon sitzen konnte. Er betrachtete die Nacht vor dem Fenster: das Funkeln des Baseballspiels über ganz Wrigleyville, der hell erleuchtete El-Train, der sich um die Kurve an der Sheridan Road herumkämpfte, die Lake-Shore-Wolkenkratzer am Horizont, die endlose Dunkelheit dahinter. Bega schüttelte am Schreibtisch den Kopf, als würde er versuchen, etwas aus seinen Haaren herauszubekommen. Womöglich Läuse?
Joshua war schon in Drehbuchschreiben I mit Bega zusammen gewesen; abgesehen von Kommentaren zu ihren unfertigen Skripts hatten sie jedoch nie viel miteinander gesprochen. Bega strahlte immer eine gehässige Überlegenheit aus, während er sich über die dümmlichen Plots in den Manuskripten der anderen Kursteilnehmer lustig machte. Seine Plots waren nicht viel besser, aber geschickterweise hielt er stets das Ende offen und behauptete, er wolle die anderen mit einbeziehen.
»Gibt es so was wie beabsichtigte Kastrationsunfälle überhaupt?«, fragte Dillon.
»Warum nicht? Lasst tausend Blumen blühen«, sagte Graham. »Was passiert denn nun bei dir als Nächstes?«
Dillon zog sein Notizbuch zurate. Joshua fiel auf, dass es nur hingekritzelte Muster enthielt.
»Also, sie sind halt in der Wüste«, sagte Dillon, »und da stoßen sie auf so ’ne Art Jahrmarkt oder so. Er bleibt vor der Angstkabine stehen und die Typen vom Jahrmarkt fragen ihn, wovor er am meisten Angst hat. Er sagt, vor Haien und Wellen. Und dann kommen diese Typen raus aus der Kabine und sind halt irgendwie als seine schlimmsten Ängste verkleidet. Sie folgen ihm dann auch die ganze Zeit und so. Und dann nimmt er Drogenpilze mit dem Gruftiemädchen, und sie haben den fantastischsten Trip ihres ganzen Lebens, und dann entschließt er sich halt, doch nicht zurück nach L.A. zu gehen und den Job anzunehmen, sondern lieber mit dem Gruftiemädchen in der Wüstenkommune zu leben.«
Graham schaute ihn eindringlich an, während er sich offenbar die Angstkabine und die Typen vorstellte, die als Haie und Wellen verkleidet waren. »Das wird ’nen Haufen Geld kosten«, sagte er.
Offensichtlich war Dillon der Gedanke an mögliche Kosten nie in den Sinn gekommen – er schrieb das Wort Geld in eine Lücke zwischen seinen Kritzeleien und unterstrich es zweimal.
»Fakt ist: Um ein Drehbuch zu schreiben, braucht man Geld, aber um einen Film zu machen, braucht man Unmengen davon. Fakt ist: Du wirst um Geld betteln müssen, das gehört zu deinem Job.« Graham begann erneut, mit dem Oberkörper vor und zurück zu schaukeln. »Und dann lassen die Weinsteins irgendeinen zwanzigjährigen Piranha auf dein Lebenswerk los, und der wird es an einem Nachmittag, an dem er sonst nichts zu tun hat, bis auf die Knochen abknabbern. Dann werfen sie dir ein paar Kröten vor die Füße – nicht mehr, als sie monatlich für ihre Brustenthaarung ausgeben – und erwarten von dir, dass du damit arbeitest. Du musst wissen, dass du für die ein Nichts bist! Eine Null! Ein verschissenes Nichts! Zero!«
Wieder lachte Bega – Grahams Hass auf die Weinsteins schien ihn maßlos zu amüsieren. Joshua fühlte, wie sich seine Brust schuldbewusst zusammenzog. Eigentlich sollte er protestieren, aber es ging nicht. Dillon blinzelte, und die Panik angesichts der Flecken, die über Grahams Schädel zogen, stand ihm überdeutlich ins Gesicht geschrieben. Dann wandte er sich wieder seinen Kritzeleien zu: Mit phänomenaler Geschwindigkeit verwandelte er Spiralen in ganze Tornados, die sich auf der oberen Hälfte der Seite auf biblische Weise mit der Kritzelfinsternis verbanden. Auf der gegenüberliegenden, tornadofreien Seite fand sich eine Szene mit Strichmännchen, die Sprechblasen über ihren Köpfen hatten und von denen einer mit seiner Strich-Hand ein Surfbrett umklammerte. Zombie Wars, dachte Joshua. Wohin führt uns der süße Duft des Todes?
»Die gute Nachricht ist, wenn du für deinen Surfer einen männlichen Hauptdarsteller findest, der so richtig sexy ist, kannst du vielleicht auch die Kohle auftreiben«, sagte Graham, nachdem er wieder eine Ruheposition eingenommen hatte. »Vielleicht diesen, wie heißt der noch … Hartnett?«
»Ich finde, du solltest aus dem Typen eher einen echten Menschen machen«, sagte Bega. Es war überraschend, ihn sprechen zu hören – den ganzen Abend hatte er nur am Rand gehockt und gelacht. »Der sollte normal sein, ’ne Art Philosoph oder so, vielleicht ein Loser. Wie unser Josh hier.«
In Drehbuchschreiben I hatte Bega auf geistreiche Weise und, wie Joshua fand, durchaus zu Recht auf einem Peruaner herumgehackt, in dessen Treatment es um Inkagötter ging, die gegen Seeungeheuer kämpften. Nun sagte Joshua: »Ich? Was hab ich denn jetzt auf einmal damit zu tun?«
Alle musterten Joshua, den Überlebenden einer unfreiwilligen Selbstkastration: Er hatte den Körper eines Leichtgewicht-Wrestlers, der nach der Mittelstufe mit dem Ringen aufgehört hat, Schlupflider, die seinen Blick in schmeichelhafter Beleuchtung auf nachdenkliche Weise betrübt wirken ließen, und einen leichten Überbiss, durch den er oft unangemessen verblüfft aussah.
»Um mal ganz ehrlich zu sein: Richtig sexy ist nicht das Erste, was mir zu Joshua einfällt«, sagte Graham. »Ich mach nur Spaß.«
Erleichtert darüber, dass Graham von ihm abgelassen hatte, lachte Dillon und verlegte sich auf das Zeichnen von Häuschen mit rauchenden Schornsteinen. Krematorien? War das Dillons subtile – oder, scheiß drauf, ganz und gar nicht subtile – Art, sich mit Grahams latentem Antisemitismus zu verbünden? Schon vor dem Krematorien-Tableau war Joshua Dillon mehr als merkwürdig vorgekommen, angefangen bei seiner Begeisterung für obskure Neunzigerjahre-Bands, die offenbar auch die entsprechende Uniform erforderlich machte: Flanellhemd, Costello-Brille, Trucker-Hut. Und wer zieht schon von L.A. nach Chicago, um an Drehbuch-Workshops teilzunehmen? Wahrscheinlich war er hierhergekommen, um halt irgendwie umsonst bei seiner Großmutter leben zu können oder so. Mrs. Alzheimer, gebürtige Schluckspecht.
»Tja, Josh, da er nun schon mal deinen Arsch ins Spiel gebracht hat«, sagte Graham, »was hast du denn dabei? Brandneue Seiten, die uns komplett umhauen? Eine Achterbahnfahrt aus Sex und Gewalt?«
Bega beugte sich vor, um Joshuas Antwort zu hören. Das Grau seiner Augenbrauen schimmerte im Licht der Schreibtischlampe.
»Also, fertige Seiten hab ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich hab eine neue Idee«, sagte Joshua. »Der Arbeitstitel lautet Zombie Wars.«
»Was ist denn mit DJ Spinoza passiert?«, fragte Graham.
»Da muss ich noch einiges klären. Da hör ich die Musik noch nicht.«
»Und was ist mit deinem Lehrer-Superheld?«
»Der kann warten, bis er an der Reihe ist«, sagte Joshua. »Superheldenfilme gibt’s wie Sand am Meer.«
»Das stimmt allerdings«, sagte Graham, »Zombiefilme dagegen sind ja im Moment die reinste Mangelware.«
Dillon kicherte. Joshua stellte sich vor, wie er ihm mit dem Handrücken schallend eine knallte. Auch als delikater Snack für einen Zombie wäre der Typ gut geeignet. Bega nickte, als habe er Joshuas Gedanken gelesen und sei ganz einverstanden mit seiner Vision.
»Okay«, sagte Graham übertrieben geduldig, »dann tun wir jetzt einfach mal so, als würdest du dich nicht jede Woche neu entscheiden. Tun wir einfach mal so, als wär uns das scheißegal. Okay. Es kommt eh nur darauf an, wie du im entscheidenden Moment performst. Also: Verkauf mir das verdammte Ding! Ich bin jetzt mal der fette Weinstein. Bring mich dazu, mich in dich und deine Story zu verlieben! Überzeug mich von deinem Zombie-Krieg! Ich hab, was du brauchst: nichts im Kopf, aber Geld wie Heu!«
Joshua atmete tief ein. Er stellte sich einen fetten Weinstein vor, der ihn hinter einem einschüchternden Schreibtisch böse anfunkelte; gleichzeitig spielte er ernsthaft mit dem Gedanken, aufzustehen und zu gehen, sich nie wieder mit Graham zu treffen, nie wieder seine reflexhafte Bigotterie auszuhalten und überhaupt niemals wieder auch nur eine Zeile Dialog zu schreiben. Wenn man als Drehbuchautor Karriere machen wollte, sprach viel dafür, die Weinsteins komplett zu meiden und überhaupt ein Leben jenseits aller Hoffnungen und Ambitionen zu führen. Doch Bega schaute Joshua an, als brenne er darauf, endlich zu hören, was er zu sagen hatte, also atmete Joshua aus. Wirklich alles kann der zufällige Grund sein für Hoffnung oder Angst.
»Okay, okay: Die amerikanische Regierung hat ein Geheimprogramm, um aus Einwanderern Sklaven zu machen«, improvisierte er. »Die Regierung erschafft einen Virus, der sie in Zombies verwandelt, die an Fließbänder gefesselt werden und in Fabriken schuften müssen.«
Nun schauten ihn alle interessiert an. Dillon hörte mit dem Kritzeln auf, die Flecken auf Grahams Stirn verschmolzen zu einer durchgehenden Fläche aus leuchtendem Zinnoberrot, und Bega nickte Joshua noch einmal zu, da ihm der Einwandereraspekt offenbar gut gefiel. Es war nicht leicht, sich im Rampenlicht ihrer Aufmerksamkeit irgendwas auszudenken, aber er war gesprungen, und nun blieb ihm nicht anderes übrig, als in die Tiefe zu stürzen.
»Das Ganze geht jedoch schief«, sagte Joshua. »Alles geht furchtbar schief.«
»Logisch«, sagte Graham.
»Und der Virus greift um sich?«, fragte Bega. »Nicht nur Einwanderer werden befallen?«
»Genau«, sagte Joshua. »Auf jeden Fall greift der Virus um sich. Jeder kann befallen werden.«
»Wer bleibt denn am Leben?«, fragte Graham. »Irgendwelche Ladys?«
»Da bin ich noch nicht sicher«, sagte Joshua. »Wahrscheinlich. Da wird sich noch einiges ergeben, während ich dran arbeite.«
»Der Virus greift um sich. Und dann?«, fragte Dillon.
»Tja«, sagte Joshua langsam, um Zeit zu gewinnen. »Also, die Regierung schickt das Militär. Um sie alle auszumerzen. Die Typen von der Armee schießen ihnen einfach den Kopf weg und jagen sie in die Luft und haben ihren Spaß. Es wäre das reinste Blutbad, wenn Zombies bluten würden. Aber es gibt inzwischen schon so viele untote Einwanderer, dass auch die Soldaten schließlich zu Zombies werden und anfangen, alle umzubringen, nicht bloß die Ausländer. Dann wird es ziemlich irre, Killer und Zombies überall, allgemeines Chaos, niemandem kann man trauen, kein Ort ist noch sicher. Ein Albtraum.«
Es sprudelte einfach aus ihm heraus, ohne Mühe, ohne dass er darüber nachdenken musste. Es kam ihm vor, als würde er sie anlügen, nur dass es besser war, weil er nicht erwischt werden konnte. Mitgerissen von seinem Strom aus hanebüchenem Quatsch hatten die anderen weder einen Grund noch die Zeit, ihm nicht zu glauben.
»Aber es gibt einen Militärarzt, Major Klopstock, der glaubt, den Virus bekämpfen zu können. Major Klopstock arbeitet an einem Impfsto…«
»Moment mal«, fiel Graham ihm ins Wort. »Was soll das denn für ein Name sein? Major Klopstock? Willst du mich verarschen? Da kannst du ihn ja gleich Major Crapshit nennen.«
»Mir gefällt Klopstock eigentlich ganz gut«, sagte Joshua. »Klopstock könnte der eigentliche Held des Films sein. Warum nicht?«
»Glaubst du wirklich, Bruce Willis wäre bereit, Klopstock zu heißen? Dafür könntest du ihm nie genug zahlen. Denk dir was anderes aus.«
Dies war Joshuas Chance, sich Graham entgegenzustellen und Major Klopstocks unausgesprochenes Jüdischsein zu verteidigen. Andererseits war die Figur noch gar nicht zum Leben erweckt. Joshua war auch nicht wirklich auf den Namen eingeschworen, und genau genommen hatte Graham ja gar nicht Anstoß daran genommen, dass Klopstock Jude war. Dies war weder der rechte Ort noch die rechte Zeit.
»Okay: Major Wie auch immer nimmt selbst den Impfstoff«, fuhr Joshua fort. »Anfangs wissen wir noch nicht, ob er durchkommt oder auch zu einer Art Zombie mutiert.«
»Und was passiert dann?«, fragte Dillon.
»Dann brechen seine inneren Konflikte auf«, sagte Joshua. »Genau darum geht es in der Story. Um die Konflikte des Majors.«
»Konflikte sind gut. Abgesehen von dem Problem mit dem Namen ist das schon mal ein Anfang«, sagte Graham. »Vielleicht kann die Armee ja auch gegen Terroristen-Zombies kämpfen, die sich wie verrückt gegenseitig in die Luft sprengen oder so. Das ist im Moment genau das richtige Thema, immerhin stehen wir gerade kurz davor, dem Irak ein neues Loch in den Arsch zu reißen.«
»Daran hatte ich jetzt eigentlich weniger gedacht«, sagte Joshua.
»Das könnte gut abgehen, glaub mir. Wir lassen die Zombie-Armee auf die Kamelficker los, und dann gerät das total außer Kontrolle, und unsere untoten Jungs kommen zurück, um sich an unserem Fleisch zu mästen. Ich find das echt verdammt gut. Ihr nicht auch? Da muss ich mir doch gleich mal selber auf die Schulter klopfen!«
Graham klopfte sich selber auf die Schulter.
»Ich weiß nicht«, sagte Joshua. »Ich möchte nicht, dass es zu politisch wird.«
»Warum nicht?«, wandte Bega ein. »Guck dir doch mal an, was heute so läuft. Überall feindliche Moslems – in jedem Film, überall im Fernsehen, alle freuen sich schon auf die nächste Invasion. Alles ist politisch. Jeder ist politisch.«
»Hey, die haben unsere Türme zum Einsturz gebracht«, sagte Graham. »Rache ist süß, vor allem als Flächenbombardierung.«
»Saddam hatte mit dem elften September doch gar nichts zu tun«, sagte Bega. »Überhaupt nichts.«
»Es gibt Leute, die behaupten, wir hätten das selber gemacht«, sagte Dillon, »damit wir halt irgendwie den Irak angreifen und uns ihr Öl unter den Nagel reißen können oder so.«
Ein neuer roter Fleck flammte auf Grahams Stirn auf, doch dann entschied er sich, nicht darauf zu reagieren, und der Fleck verschwand wieder.
»Ich würd ja liebend gern Scheiße quatschen und damit meinen Lebensunterhalt bestreiten, Freunde«, sagte er stattdessen, »aber ihr zahlt mir Unmengen Kohle dafür, dass ich euch beim Drehbuchschreiben helfe. Du hast zehn Minuten, Vega, wenn du über dein Zeug reden willst.«
»Ich mein ja bloß«, sagte Dillon.
»Bega«, sagte Bega. »Bega heiß ich. Übrigens schon die ganze Zeit.«
»Ist doch egal. Vega. Bega. Meinetwegen kannst du dich auch Klopstock nennen. Lasst tausend Blumen blühen«, sagte Graham. »Was hast du uns denn mitgebracht? Neue Seiten?«
»Keine Seiten. Seiten hab ich erst, wenn ich alles weiß.«
Bega fuhr sich energisch mit beiden Händen übers Gesicht, kratzte sich am Kopf und wuschelte sich schließlich durchs Haar, wobei er vermutlich erneut einige Läuse freisetzte. Er verzog das Gesicht, als hätte er gerade einen Krampf. Irgendwelche heiklen Geisteszustände zeichneten sich eigentlich immer darauf ab.
»Im Grunde ist es eine Liebesgeschichte«, sagte Bega. »Der Mann stammt aus Sarajevo. Da ist er glücklich gewesen. Er war jung, er hatte seine eigene Rockband und Frauen. Dann kam der Krieg. Jetzt ist er Flüchtling. Er geht nach Deutschland. Da gibt’s Nazis. Er arbeitet als Türsteher in ’ner Disko und spielt Gitarre, nur für seinen inneren Frieden. Er trinkt, erinnert sich an Sarajevo, schreibt Blues-Songs. 1997 haut er ab, weil ihm das zu viel wird mit den Nazis. Er geht zurück nach Sarajevo, aber nichts ist mehr wie früher. Ihm bricht das Herz.«
»Ja, ja … das haben wir letztes Mal schon gehört. Hast du noch irgendwas Neues?«
»Darf ich rauchen?«, fragte Bega.
»Ob du rauchen darfst? Ob du rauchen darfst? Nein, verdammt!«, sagte Graham. »Bei allem Respekt.«
»Okay«, sagte Bega und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Der Mann hat keine Freunde mehr in Sarajevo. Die Hälfte seiner Kumpels ist tot, die andern sind überall verstreut. Die Frauen haben Ehemänner. Alle reden die ganze Zeit nur über den Krieg. Er sagt: Scheiß drauf! Und geht nach Amerika – ins Land von Dylan und Nirvana und dem besten Basketball der Welt. Aber er hat seine Seele verloren. Und alle amerikanischen Frauen sind Feministinnen …«
»Aber echt«, sagte Graham.
»… also arbeitet er in einem Geschäft und verkauft Gitarren. Eines Tages kommt eine Mutter mit ihrer Tochter rein. Die Mutter ist ganz hübsch, aber die Tochter ist ’ne Sensation. Er spielt ihnen ein wunderschönes Lied aus Sarajevo vor. Die Tochter verliebt sich in ihn. Es ist wie im Liebesroman, nur dass die Mutter die Polizei ruft. Er ist ein Stalker. Das behauptet sie, weil sie eifersüchtig ist.«
»Wie alt ist die Tochter?«, fragte Dillon.
Bega ignorierte ihn. Irgendwann war sein Blick zum Der Pate Teil II-Plakat hinübergewandert, und er sprach, als würde er seine Story St. Pacino persönlich anbieten.
»Aber dann stirbt die Mutter an zu vielen Pillen, die sie gegen Depressionen nimmt. Die Tochter glaubt, er hätte sie umgebracht. Die Polizei hält ihn auch für den Täter. Er muss beweisen, dass er unschuldig ist. Er ist ja bloß ein Einwanderer, aber sein Bild ist jetzt an jeder Ecke zu sehen. Ganz Amerika hasst ihn. Großes Problem.«
»Gibt es denn einen Killer?«, fragte Joshua, um sich für die Aufmerksamkeit zu revanchieren, die ihm zuvor zuteilgeworden war.
»Vielleicht der Ehemann«, sagte Bega. »Vielleicht auch nicht.«
»Das ist ziemlich gut«, sagte Graham. »Einwanderer als Detektiv, das ist ziemlich cool. Ich meine: Er ist illegal im Land, muss aber trotzdem rumziehen, um Sachen rauszufinden. Allerdings wär ich vorsichtig mit den Detektivklischees. Und der Akzent des Helden könnte ein Problem sein.«
»Vielleicht kann die Tochter dabei helfen, seinen Namen reinzuwaschen«, sagte Joshua. »Das Ende könnte problematisch sein, glaub ich.«
»Amerikanische Filme haben immer ein Happy End«, sagte Bega. »Dabei ist das Leben Tragödie: Du wirst geboren, du lebst, du stirbst.«
»Das könnte so eine Art europäischer Art-House-Film werden. Was gut wäre, weil du dann nämlich Titten zeigen kannst«, sagte Graham und hielt kurz inne, um sich die Titten vorzustellen. »Na egal, wir müssen jetzt Schluss machen. Nächstes Mal würde ich gern ein paar fertige Seiten sehen. Wenn ihr was aufgeschrieben habt, ändert sich noch mal alles. Dann wird alles echt.«
»Echt ist echt gut«, sagte Dillon.
Joshua trat in die dichte Dunkelheit der Grace Street hinaus und war gerade dabei, sein Fahrrad aufzuschließen, als Bega sich auf ziemlich Film-noir-hafte Weise seine Zigarette anzündete. Er atmete den Rauch aus und rief Joshua zu: »Kommst du noch mit auf ein Bier? Du kannst bei mir mitfahren.« Joshua suchte fieberhaft nach einer Entschuldigung, um abzulehnen. Unvermittelt schoss ihm das Bild durch den Kopf, wie Bega ihm den Arm hinter dem Rücken verdrehte, aber er wollte kein Feigling sein und auch nicht wie einer dastehen. Bega musterte ihn mit einem Grinsen, das durchaus höhnisch gemeint sein konnte, vielleicht aber auch nur gespannte Erwartung ausdrückte. Dillon kam aus dem Haus und baute sich wie ein personifiziertes Freundschaftsangebot vor ihnen auf. Sie ignorierten es beide. »Dann euch halt noch ’nen schönen Abend, Leute«, sagte Dillon schließlich und stieg in seinen rostzerfressenen Wagen, der nur noch von Aufklebern zusammengehalten wurde, die Weisheiten anderer Leute zum Besten gaben: Wenn ihr Frieden wollt, müsst ihr an der Gerechtigkeit arbeiten und Ähnliches. Wenn Joshua einen Spruch auf sein Auto hätte kleben wollen (das er nicht besaß), wäre es folgender gewesen: Alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Wer würde je verstehen, was das zu bedeuten hatte? Und genau das wäre das Grandiose daran.
»Ok, lass uns noch was trinken«, sagte er.
Bega war, wie er Joshua stolz mitteilte, in der Westmoreland-Bar zu Hause: Er lebte praktisch dort, und alle kannten ihn. An diesem Abend aber war niemand anwesend, der ihn kannte, und überhaupt lag das Westmoreland größtenteils verlassen da: Eine kaputte Jukebox stand in der Ecke, die Cubs spielten Baseball auf einem Fernsehbildschirm über der Bar, und an einem Tisch ganz hinten speichelten sich ein Mann und eine Frau gegenseitig die Gesichter voll. Es war eine jener Chicagoer Kneipen, die ihre eigene Vernachlässigung wie ein Banner stolz vor sich hertrugen und dabei den Geruch von Hefe und Sägespänen ausdünsteten. Bei uns, verkündete das Westmoreland, haben die Leute ihre Leber in Alkohol eingelegt, ihre Ehen zerstört und sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Joshua setzte sich auf den Hocker neben Bega, der eine Reihe von Bierflaschen auf dem Tresen neu arrangierte, als löse er ein Schachproblem. Wortlos kam der Barkeeper zu ihnen herüber (Bega: »Hey, Paco!«), steckte seine Finger in die umgestellten Flaschen und nickte kaum wahrnehmbar, was wohl bedeuten sollte, dass er für Bestellungen zur Verfügung stand.
»Whiskey«, sagte Bega. »Und ein Bud.«
»Was für Wein haben Sie?«, fragte Joshua.
»Roten«, sagte Paco. »Und weißen.«
»Dann hätt ich gern ein Glas Roten«, entgegnete Joshua. Pacos Gesicht blieb ausdruckslos, aber Joshua war sich sicher, in seinen Augen zu erkennen, wie sehr er ihn dafür verachtete, es so unnötig kompliziert zu machen.
»Ich hab mich gefragt, Josh«, sagte Bega, »wozu Amerika grade diese ganzen Superhelden braucht. Warum reichen denn nicht einfach die normalen Helden? John Wayne ist plötzlich nicht mehr gut genug, jetzt muss es Batman sein? Was meinst du?«
»Also, genau genommen ist Batman gar kein Superheld«, sagte Joshua. »Eher ein überprivilegierter Kapitalist, der jede Menge technischen Schnickschnack kaufen kann. Er hat keine Superkräfte, er trainiert bloß wie ein Irrer.«
Paco brachte die Getränke. Joshuas Rotwein schwappte in einem Martiniglas. In diesem Laden Wein zu bestellen, war auch nichts anderes, als Milch zu ordern – er konnte von Glück sagen, dass keine echten (und auch sonst keine) Männer am Tresen saßen, um sich darüber lustig zu machen, was für ein Weichei er war. Wenn ihr Frieden wollt, bestellt euch ein Budweiser. Er starrte den Wein an; er würde ihn jetzt trinken müssen, auch wenn er nichts anderes erwartete als reinen Essig.
»John Wayne würde ein paar saftige rechte Haken austeilen, die Möbel zu Kleinholz hauen, und schon wären Recht und Ordnung wiederhergestellt«, fuhr Bega fort, wobei er seinen Whiskey in der Pause zwischen Recht und Ordnung kippte. »Heutzutage ist man ohne Special Effects ja völlig aufgeschmissen.«
Die Cubs hatten im achten Inning zehn Punkte Rückstand, aber Paco war ganz gebannt. Den Kopf hatte er so weit zurückgebeugt, dass es aussah, als könne er jeden Moment abbrechen und auf den Fußboden kullern. Es war schwer zu sagen, ob er ein Wunder erwartete oder einen Trancezustand erreicht hatte, in dem der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage keine Rolle mehr spielte. Seitlich an seinem Hals stach ein ungewöhnlich dicker Kropf hervor wie eine Krebsreklame. In Faustrecht der Prärie fragt Henry Fonda den Barkeeper des Saloons: »Waren Sie jemals verliebt?« Und er antwortet: »Ich war schon immer Barkeeper.«
»In Sarajevo kannte ich mal einen fetten Jungen«, sagte Bega, spülte den Whiskey mit Bier runter und winkte Paco für eine Nachbestellung zu. »Bei uns waren fette Kinder eine Seltenheit, nicht wie hier, also wurde er ständig fertiggemacht und verprügelt. Irgendwann kam er dann aber mit einer völlig abgedrehten Geschichte an: Er hätte mitten in der Nacht ein Raumschiff vor seinem Fenster gesehen und die Aliens hätten ihm Superkräfte verliehen. Seitdem könne er Autos hochheben und ganze Häuser plattmachen, deswegen würden die Schläger eine Geheimorganisation gegen ihn gründen. Angeblich wären sie hinter ihm her, immer bereit zum Angriff. Eines Tages zeigt er uns ein Gebäude und sagt: Sie beobachten mich, auch jetzt in diesem Moment. Wir schauen nach, da ist nichts. Aber er hat keine Angst mehr.«
»Das ist ’ne tolle Geschichte«, sagte Josh. »Könnte ein super Drehbuch abgeben.« Bega fegte das Kompliment mit einer kurzen Handbewegung beiseite. Abgesehen von Rauch und Herrenparfum dünstete er auch eine überdeutliche Verachtung für Schwäche aus. Es war gut möglich, dass er selber als Junge dick gewesen und später andere Kinder getrietzt hatte oder dass er erst ein Schläger und später fett geworden war – sein Körperumfang war jedenfalls noch immer beeindruckend.
Die Cubs hatten das Spiel endlich mit zwölf Runs verloren. Sämtliche Spieler machten einen absurd unfähigen Eindruck, als seien sie nur dazu da, um erniedrigt zu werden, hoffnungsvolle Existenzgründer in der Niederlagen-Branche. Paco kratzte sich an seinem Kropf, der dabei unter der Haut hin und her wackelte wie ein Fötus. Skript-Idee #11: Ein schwuler Pitcher verkauft seine Seele an den Teufel, um in der World Series mitspielen zu können. Der Preis: Er muss zum Hetero werden. Titel: Satans Bälle. Joshua nahm einen Schluck von seinem Wein, der ihm sofort die Eingeweide verätzte. Er war schlimmer als Essig, eher wie Reinigungslauge, ein bisschen zu authentisch für seinen Geschmack: Unter Realität und Vollkommenheit verstehe ich ein und dasselbe. Paco hielt die Fernbedienung Richtung Fernseher und schaltete zu den Nachrichten um. George W. Bush sprach in die Kamera, und seine Miene war so aufrichtig, dass es eindeutig war, dass er log, während seine Knopfaugen vor amateurhafter List leuchteten. Nur wahrhaft große Männer sind begabt im schamlosen Lügen, dachte Joshua. Dieser Typ aber überspannte den Bogen allzu deutlich.
»Eins musst du mir mal erklären«, sagte Bega. »Eure letzten acht Präsidenten hatten alle so schlichte Namen: Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Clinton und die zwei Bushs. Früher hattet ihr doch Washington, Roosevelt und Eisenhower, und dann ist irgendwas passiert. Ihr kriegt’s nicht mehr hin, Präsidenten mit komplizierten Namen zu wählen. Eure idiotischen Wähler müssen immer in der Lage sein, den verschissenen Namen problemlos zu buchstabieren.«
Joshua dachte über diese Hypothese nach, aber der authentische Wein funkte ihm gnadenlos dazwischen und löste jeden Gedanken auf wie eine Leiche im Säurebad. Bega kippte einen weiteren Whiskey und spülte mit Bier nach. Joshua konnte nicht begreifen, dass Bega das überhaupt interessierte. Warum gab er sich damit ab, diese amerikanischen Befindlichkeiten zu analysieren? Joshua selbst war es egal. Amerikaner würden sich niemals Gedanken über die Namen ausländischer Präsidenten machen – das war ja das Großartige an diesem Land. Und Bega war doch inzwischen Amerikaner genug, als dass ihm so was ebenfalls scheißegal sein konnte.
»Dukakis«, sagte Joshua.
»Genau«, sagte Bega. »Keine Chance.«
Im Fernseher deutete ein pensionierter, Humpty-Dumpty-förmiger General mit einem Zeigestock auf eine Karte vom Irak. Offensichtlich war er der Ansicht, alles liefe blendend, während sein Stock über die Karte flog, als würde er ihr ordentlich den Hintern versohlen.
»Rumsfeld – der hat auch nicht die geringste Chance«, sagte Joshua.
»Da bin ich mir nicht sicher«, sagte Bega. »Auch nur zwei Silben. Der könnte es schaffen.«
»Stimmt.«
Bega hob sein Bier, als wolle er ihre Übereinkunft besiegeln, und Joshua stieß mit seinem Laugen-Martiniglas darauf an.
Männer denken, Männer trinken, und Männer verbrüdern sich. Geben ausschweifende Monologe zum Besten, die aus spontan zusammenfabulierten Überzeugungen und unvollständigen Sätzen bestehen. Sie befühlen den Bizeps ihres Nebenmanns, boxen ihm liebevoll gegen die Schulter; ein paar blaue Flecken als Zeichen geteilter Männlichkeit, von guter, alkoholverstärkter Durchblutung. Männer ziehen sich gegenseitig ins Vertrauen, geben rhetorisch ihrer Geilheit Ausdruck und kopulieren schon mal hypothetisch mit den Frauen aus ihren Fantasien. Männer umreißen ihre Lebensgeschichte und ihre Lebensphilosophie, durchleben noch einmal Fuß- oder Baseballspiele und achten sorgsam darauf, dass es nie so aussieht, als würde ihnen irgendwas wirklich etwas bedeuten. Scheiße sagen sie, und das scheißoft. Dabei müssen Männer nicht einmal aus demselben Land stammen wie der Mann, der neben ihnen sitzt.
Paco hörte nicht auf, Alkohol nachzuschenken, während Bega und Joshua eng zusammenrückten. Schnauze an Schnauze teilten sie dem anderen mit, von welchen Dingen sie wirklich besessen waren, was sie wirklich liebten: The Wild Bunch! (Bega: »Der letzte echte Western überhaupt.«); Led Zepplin (Ja!); trinken (sie stießen an); Dylan (Joshua konnte die weinerliche Stimme nicht ausstehen); Frauen (Bega leckte sich wollüstig die Lippen); Conan, der Barbar (Joshua: »Ist der Film nicht doch ein bisschen faschistoid?«); Radiohead (Bega würgte); Pantera (Von denen hatte Joshua noch nie gehört) et cetera. In eine Bierpfütze auf der Bar zeichnete Bega eine Karte von Bosnien und dem ganzen kriegslüsternen Balkan, Zigarettenkippen mussten als Hauptstädte dienen. Stolz verkündete er: »In Katastrophen schwimmen wir wie die Fische im Wasser!« Joshua schreckte davor zurück, sich zu erkundigen, wer genau mit diesem wir gemeint war. Stattdessen listete er die Eckdaten seines eigenen, dramenfreien Lebens auf: seine Kindheit in Wilmette, die erträglich gewesen war, von der Scheidung seiner Eltern abgesehen; ein vollständiges Großeltern-Quartett, allesamt Holocaust-Überlebende mit Wohnsitz in Florida, wobei er Nana Elsa am liebsten hatte; College-Jahre an der Northwestern, drei Meilen entfernt vom Haus seiner Eltern. Ein Abschluss in Filmwissenschaft, Nebenfach Philosophie. Spinoza war der Größte, der erste weltliche Jude der Geschichte. »Mein Held Baruch hat schon im siebzehnten Jahrhundert Filme vorausgesagt, verdammte Scheiße!«, rief Joshua hingerissen. »Er hat gesagt: Mit je mehr anderen Bildern ein Bild verbunden ist, desto mehr lebt es auf.« Nana Elsa hatte alte Filme geliebt und sie mit Joshua angeschaut – »Gute Filme sind wie Wein«, hatte sie immer gesagt, »sie müssen reifen.« »Nicht wie diese Kacke heutzutage«, sagte Joshua und kippte sein Gesöff hinunter.
Anschließend ging er dazu über, das Bild seiner heißen japanisch-amerikanischen Freundin zu malen, seiner wunderschönen Zen-Meisterin mit dem entzückenden Namen Kimiko, bis Bega große Augen bekam. Und Joshua malte weiter, wenn auch mit weniger farbenfroher Palette: Er erzählte, wie er einem Haufen Russen und anderer Immigranten in einem jüdischen Institut für Erwachsenenbildung Englisch als Fremdsprache beibrachte. In zarten Aquarelltönen gestaltete er seinen Laptop, der übersprudelte vor Skriptideen, von denen keine auch nur nahe daran war, in die Tat umgesetzt zu werden. Schließlich skizzierte er noch eine strahlende Zukunft, in der er ein Skript für eimerweise Kohle an den Mann bringen und seinen Job kündigen würde, um mit Kimmy zusammenzuziehen, die, wie sie selbst eingestanden hatte, zumindest schon ein Mal in ihrem Leben an einem Dreier beteiligt gewesen war.
Eigentlich gäbe es ja keinen Grund, davon auszugehen, dass es überhaupt eine Zukunft geben würde, entgegnete Bega. »Wir erwarten sie immer nur, weil wir nicht wissen, wie wir uns keine Zukunft vorstellen sollen. Das ist ein menschliches Defizit, ständig Pläne für die Zukunft zu schmieden – daraus ist auch das Kino entstanden. Wenn man nicht gerade einen Film anschaut, ist es verrückt, zu erwarten, dass die Gegenwart weiter voranschreiten wird – jeder Augenblick könnte der letzte sein.« In Ermangelung von Beweisen für seine Behauptung zählte Bega die Höhepunkte seines früheren Lebens auf: die zwei Jahre an der Filmhochschule, seine Begeisterung für die Surrealisten, die übernatürlich schönen Frauen von Sarajevo, die orgiastische Euphorie am Vorabend der Kriegskatastrophe, der Alkohol, die Drogen, das Ende von allem. Schließlich der Krieg und die Absage an jede Zukunft, gerade als alle glaubten, das gute Leben würde für immer weitergehen. »Und hier bin ich nun!«, sagte Bega und kippte seinen Whisky auf ex.
Eine weitere Runde, noch mehr Gerede, noch mehr Bilder von unseren Truppen in Bagdad auf dem Fernsehschirm, die euphorischen Reporter, Paco, der die Biergläser in die Schaumwolke im Waschbecken tauchte, die Jukebox, die einen schwermütigen Song spielte, das Pärchen, das an ihnen vorbeistolperte, um in einer der Klokabinen zu vögeln; alles war, wie es sein sollte, weil es gar nicht anders sein konnte. Realität und Vollkommenheit sind definitiv dasselbe, verdammte Scheiße.
Noch eine Runde, und Bega und Joshua diskutierten darüber, was einen für den Titel eines Überlebenden qualifiziert. Bega verweigerte ihn Joshua hartnäckig, nahm ihn aber uneingeschränkt für sich selbst in Anspruch. Joshua war inzwischen zu betrunken, um die Sache für sich zu entscheiden, obwohl er von einer beachtenswerten Dynastie von Überlebenden abstammte und schließlich gerade dabei war, die Säure in seinem Glas zu überleben.
Zumindest aber nahmen sich die beiden Männer nichts, wenn es um das Maß ihrer Betrunkenheit ging, was immerhin zu einem einhelligen Konsens führte: Sie waren voll wie tausend Mann. »Scheiß drauf!«, riefen sie und stießen an. »Scheiß doch auf die verfickte Zukunft!«
INNEN: NORIKOS BADEZIMMER – NACHT
Captain Enrique streift seine Marineuniform ab, sodass die Tätowierungen auf seinem Bizeps und auf seiner Brust zum Vorschein kommen. Noriko lädt ihn ein, sich in der Dusche zu ihr zu gesellen. Das tut er, dicht gefolgt von Linda, und die drei haben intensiven Sex. Die Militärmarken am Hals von Captain Enrique klirren gleichförmig.
Plötzlich zerrt ein Zombie den Duschvorhang von der Stange, attackiert den Soldat, auf dessen Brust eine Karte von Mexiko abgebildet ist, und beißt ihm ein Stück Fleisch aus der Schulter. Während Noriko und Linda entsetzt aufschreien, ergreift Captain Enrique den Duschkopf und prügelt auf den unnachgiebigen Zombie ein. Beim Kampf um sein Leben reißt er dem Zombie erst ein Ohr ab, dann einen Arm. Der Untote jedoch hört nicht auf, ihn zu zerfleischen. Blutüberströmt unterliegt Captain Enrique schließlich dem Angriff. Der Zombie tut sich an seinem Körper gütlich. Noriko und Linda schreien, bis sie keine Stimme mehr haben, doch bald hören wir nur noch ihr hoffnungsloses Flehen.
John Wayne kommt nach Sarajevo. Man gibt ihm was zu essen, man macht ihn betrunken, man führt ihn herum. Hier sehen Sie das, da drüben dies, hier hat der Erste Weltkrieg begonnen, und das da ist eine alte Moschee. Aber John Wayne geht irgendwie komisch, und schließlich sagt er: Mann, jetzt muss ich aber wirklich mal pissen. Man führt ihn zu einer öffentlichen Toilette. Er geht rein, aber als er wieder rauskommt, ist sein ganzer Cowboyhut durchgeweicht von Pisse, und seine Stiefel sind auch voll bis obenhin. Was ist passiert?, fragt man ihn. Tja, sagt John Wayne. Ich geh auf die Herrentoilette, und da stehen diese ganzen Typen am Urinal und brüllen: John Wayne! Und dann drehen sie sich zu mir um und haben immer noch ihre Schwänze in der Hand.
Bega hatte angefangen, vor Lachen zu grunzen und, um den Urinstrahl anzudeuten, seinen Oberkörper auf dem Fahrersitz hin und her geschwungen, was die Plüschwürfel am Rückspiegel auf und ab wippen ließ. Nach der Pointe hatte er in die Hände geklatscht und seinen Mund beim Lachen so weit aufgerissen, dass Joshua seine Mandeln sehen konnte. Er fand es nach wie vor witzig: Jetzt, da Bega ihn abgesetzt hatte und er Richtung Magnolia Avenue spazierte, musste Joshua noch immer vor sich hin kichern. Er war so versessen darauf, jemanden mit diesem Witz zu erfreuen, dass er erst, als er vor Kimikos Haus stehen blieb, bemerkte, dass sein Fahrrad immer noch vor Grahams Tür stand.