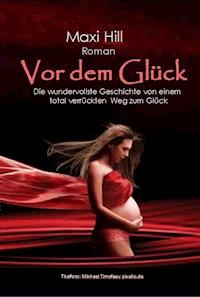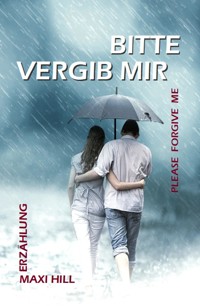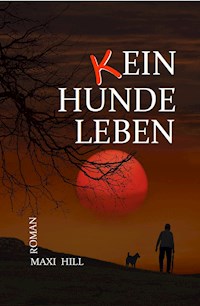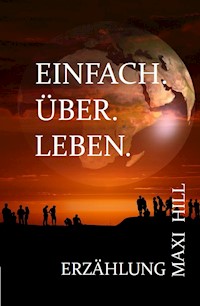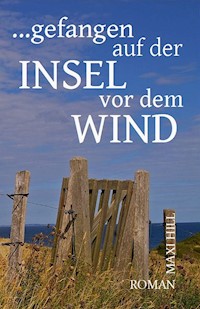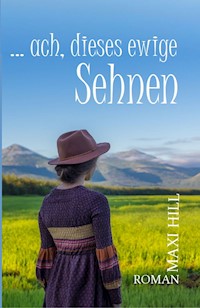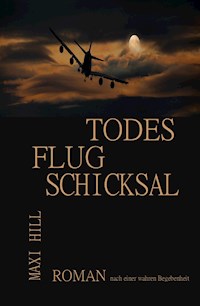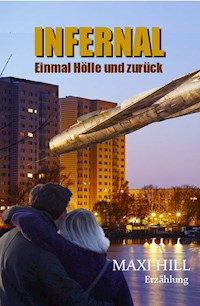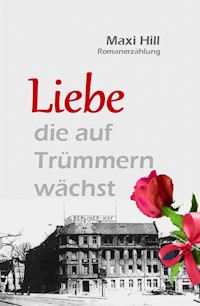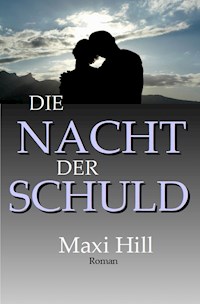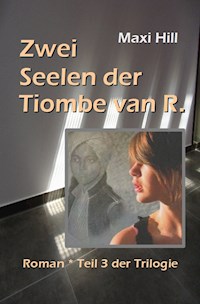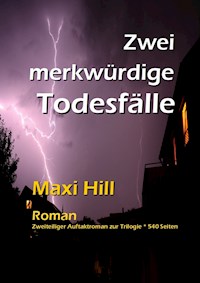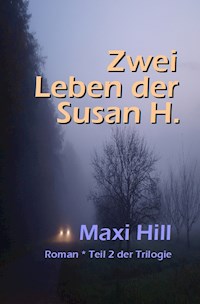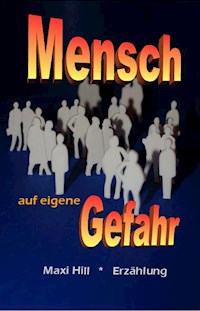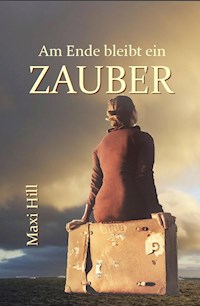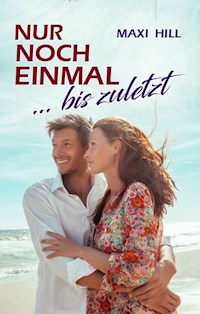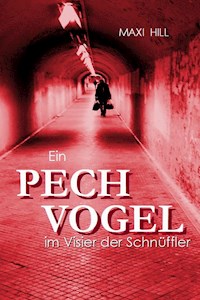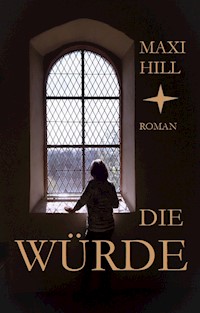
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als der angolanische Vertragsarbeiter Amadou in den Vor-Wendejahren auf Betty trifft, begehrt er sie aus reinem Heimweh, weil sie seiner Schwester Nsamba ähnelt. Für Betty, die Altenpflegerin, ist Amadou nur eine der willkommenen Abwechslungen zu ihrem freudlosen Job. Im Widerstreit der Kulturen trennen sich ihre Wege, bis Betty schwanger wird, und nicht weiß, von wem… Zu allem Übel hat Betty auch noch ein Problem mit der Heimbewohnerin Irma, deren Kinder gerade aus Angola zurückgekehrt sind, mit dem Versprechen an die Eltern, deren Sohn Amadou in der DDR zu unterstützen. Bald wird Piet und Toni Hein klar, dass mit Irmas wie mit Amadous Würde sträflich umgegangen wird. In der Wendezeit treten erstmals auf ostdeutschem Boden Kräfte in Erscheinung, die Amadous Schicksal fatal besiegeln, aber auch solche, die Irma verzweifeln lassen …Zum Glück gibt es auch mutige Menschen, wie den Journalisten Volker Brandt, die etwas bewirken können…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maxi Hill
Die Würde
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Betty
Amadou
Angola – Monate zuvor
Das Ausländerheim
Toni Hein
Die Disco
Irma Hein
Im Pflegeheim
Das Treffen
Heimkehr in ein fremdes Land
Vertracktes Verlangen
Wendegefühle
Die Regeln des Lebens
Ein Gespräch
Bei John
Alles ändert sich
Die Ordnung der Macht
Die Würde ist antastbar
Meine Würde – deine Würde
Ein schwerwiegender Fehler
Nur eine Zäsur ?
Es wächst zusammen, was zusammengehört
Wenn Menschlichkeit siegt
Schande einer Nation
Ehrliche Sorge
Nur eine ärgerliche Sache
Hilfe in der Not
Das Ungeheuerliche
Investigativ
Das Letztmögliche
Die Autorin
Impressum neobooks
Prolog
Die Pflicht gegen sich selbst besteht darin, dass der Mensch die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person bewahrt.
Immanuel Kant
Die Würde ist ein Roman über fatale Liebe und beschämendes Leid ganz dicht beieinander im menschlichen Wesen.
Als der angolanische Vertragsarbeiter Amadou in den Vor-Wendejahren auf Betty trifft, begehrt er sie aus reinem Heimweh, weil sie seiner Schwester Nsamba ähnelt. Für Betty, die Altenpflegerin, ist Amadou nur eine der willkommenen Abwechslungen zu ihrem freudlosen Job. Im Widerstreit der Kulturen trennen sich ihre Wege, bis Betty schwanger wird, und nicht weiß, von wem… Zu allem Übel hat Betty auch noch ein Problem mit der Heimbewohnerin Irma, deren Kinder gerade aus Angola zurückgekehrt sind, mit dem Versprechen an die Eltern, ihren Sohn Amadou zu unterstützen. Bald wird Piet und Toni Hein klar, dass mit Irmas wie mit Amadous Würde sträflich umgegangen wird. In der Wendezeit treten erstmals auf ostdeutschem Boden Kräfte in Erscheinung, die Amadous Schicksal fatal besiegeln, aber auch solche, die Irma verzweifeln lassen …
Die Story beschreibt zwar Menschen am Rande des politischen Umbruchs in der DDR, doch alles könnte auch heute passiert sein.
Betty
Von Minute zu Minute, und das am Ende eines langen, wütenden Wartens auf Amadou, wächst ihre Sorge. Es ist bereits 23 Uhr. Für diese Nacht hat man den ersten Frost angekündigt und er ist mit seiner hellen Jacke unterwegs. Noch ist ihr nicht klar, dass dieser Augenblick eine Wende anzeigt. Sie kann sich nicht erinnern, jemals um sein Wohlbefinden besorgt gewesen zu sein. Irgendwo tief in ihr keimt die Gewissheit, dass diese Sorge Liebe bedeuten könne. Wie oft schon hörte sie von Frauen jener Art, zu der sie selbst nicht gehört — und zu der sie nie gehören wollte —, wie treue Bindung die Selbstachtung fördert. Genau das scheint es zu sein, was Betty jetzt spürt. Allmählich glaubt sie, das wilde Kind in ihrem Bauch erzeugt erste Muttergefühle. Dann wieder meint sie, der beschwerliche Dienst im Pflegeheim habe sie ehrfurchtsvoll vor dem Leben gemacht. Doch von Selbstbetrug hält sie nicht viel. Gerade dort, zwischen den roten Mauern bei den Hinfälligen, wächst ihre tiefe Abscheu gegen das Leben.
Sie setzt sich zu Tisch, schweigsam und ohne ihren Hunger zu stillen, den sie ihrem Kind zuliebe stillen sollte. Noch vor einigen Monaten hat sie jeden Hunger gestillt. Noch vor einigen Monaten war es ein anderer Hunger, ein Hunger nach Leben in Wollust und Selbstaufgabe.
Ihre Hände streichen über die Wölbung des Bauches. Nie war ihr auch nur ein Gedanke gekommen, so, wie sie einst liebte, das konnte keine Liebe sein. Von ihren vielen Rechtfertigungen hat es nicht eine verdient, Rechtfertigung zu sein.
Sie lächelt seltsam, nicht bitter, nicht einmal unglücklich, eher listig:
Ob Amadou ein kleines Geheimnis hat? Vermutlich verbringt er diese Nacht mit einer anderen Frau. Mit einer schwarzen, wie er ein »Schwarzer« ist? Oder mit einer weißen wie sie selbst?
Betty bleibt erstaunlich ruhig. Keine Frau der Welt hat etwas wie sie, etwas, das Amadou Neuschöpfung genannt hat, etwas, das seinen größten Stolz entfacht hat.
Sie steht auf, schlendert schwerfällig in der Wohnung umher, kramt in einigen Papieren und sucht in Amadous Habseligkeiten nach einem winzigen Beweis seiner Untreue. Ein kleiner, abgegriffener Zettel steckt in der Brusttasche seines Hemds. Nicht der banale Zettel, wohl aber die in steiler Schrift geschriebene Adresse bekommt in Bettys Augen eine gewisse Bedeutung. Ihre fixe Idee über Amadous Liebschaft verliert sich im langen Grübeln. Professor Doktor Piet Hein …? Verdammt.
An den Namen der Frau, Toni, kann sie sich noch genau erinnern, nicht aber daran, ob dieser Mann, der Sohn von Irma Hein, Piet heißt. Eines aber weiß sie ganz bestimmt. Das Paar war lange Zeit außer Landes, und als sie kamen, waren sie braun wie die Neger. Und dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: Sie waren aus Angola zurückgekehrt und Amadou hatte diese Adresse bekommen. Die Adresse des Sohnes von Pissnudel Irma. Ein Aufschrei entweicht ihren Lippen: »Wie klein doch die Welt ist!«
Die Nacht war kalt, wie angekündigt. Drüben vom Fluss steigen Nebelbänke auf, grau und träge. Sie schwappen über die Unterstadt und ziehen in breiten Schleiern herauf. Hier oben entladen sie ihre feuchte Last an kahlen Ästen und blanken Fensterscheiben.
Betty erwacht aus einem ängstlichen Traum. Der Platz auf Amadous Schlafstatt ist unberührt. Ihre Blicke jagen durch das Zimmer, finden einen ärgerlichen Halt. Sein gestreiftes Hemd hängt noch immer über dem Stuhl, seine Arbeitsjacke baumelt am Haken im Flur. Sie betrachtet es mit einer gewissen Verachtung. Plötzlich sind das überflüssige Gegenstände, die nicht einmal dazu taugen, Amadou zu ihr zurück zu zwingen. Wer zum Teufel hält ihn davon ab? Sie fröstelt. Düster und schweigsam läuft sie von einem Fenster zum anderen. Irgendwann reißt sie in jähem Zorn am Riegel und zieht das Fenster auf. Er muss da unten stehen und sich nicht herauf trauen. Natürlich traut er sich nicht. Er ist nicht stark genug, um zu dem zu stehen, was er in dieser Nacht getrieben hat. Sie stellt sich vor, wie er die halbe Nacht um das Haus geschlichen ist, wie er sich gequält hat, nach oben zu kommen. Sie selbst hat nicht vergessen, wie sich Beschämung anfühlt. Sie ruft seinen Namen nach draußen in die Kälte, einmal, zweimal. Nichts, keine Antwort. Beim Hinunterschauen droht sie die Last ihres Leibes zu erdrücken. Lange wird das Balg nicht mehr brauchen, um reif für diese Welt zu sein. Diese Welt! Was für eine Welt wird es sein?
Sie muss raus, muss mit jemandem reden, wenn nicht mit Amadou, dann vielleicht über Amadou, der aus lauter Heimweh dem Abbild seiner Schwester Nsamba verfallen war.
Amadou
Es gab viele graue Tage in dieser kalten Welt. Heute war er besonders grau, besonders kalt. Den ganzen Tag schon konnte er an nichts anderes denken als an den hellen Morgen daheim und an Nsamba, und wie sie ihm aufgeregt entgegen gekommen war, ihn bei der Hand nahm und flüsterte: »Dein Antrag ist zurück. Komm, lies selbst!«
Dieser war ein glücklicher Tag und ein aufregender zugleich.
Seine Augen werden feucht, das Bild der fremden Welt verschwimmt.
Amadou steht an der Bushaltestelle und wartet auf den Linienbus. Er ist ein Farbtupfer in der grauen Stadt, die im Herbst noch um einiges liebloser, um einiges trister erscheint. Hier unten an der Neiße, die seit dem Krieg die Kreisstadt teilt, stehen die Häuser aus vergangenen Epochen, die Geschäfte und Kneipen, die Polizei und das Rathaus. Wie hat ihn alles begeistert, als er hierher kam in dieses Land, in diese Stadt — diese Häuser, die intakten Straßen mit ihren sauberen Gehwegen. Auch wenn der Krieg die Schätze vieler Epochen vernichtete, auch wenn der ehrwürdige Stadtkern geopfert wurde, um eine Grenze zu ziehen, eine Grenze zwischen Völkern — zwischen Menschen, die sich Brudervölker nennen. Das bewegt den Fremden nicht, so wie sein entzückter Blick das Bröckeln der Fassaden nicht wahrnimmt.
Der Vertragsarbeiter Amadou Ricardo Nginga wohnt nicht hier unten in der Stadt. Seit zwei Jahren haust er oben auf dem Hügel am Rande der Plattenbausiedlung, da, wohin ihn der Bus jetzt bringen wird, da, wo die Baracke steht. Ausländerheim nennen es die Leute, Vertragsarbeiterwohnheim hat man es korrekt zu nennen. Diese Baracke ist schlimmer, als sein Zuhause in Angola gewesen war. Nein, so hatte er sich das Leben im reichen Europa nicht vorgestellt. Seine Auffassung von Lebensglück bestand in erster Linie darin, als kluger und reicher Mann zurückzukehren. Er verabscheut seine Heimat nicht, aber alles dort behinderte sein Fortkommen, lähmte seinen Elan.
Ein angenehmer Kitzel überkommt ihn noch trotz allem bei dem Gedanken, er könne hier seinen Weg zu einem Leben in Wohlstand finden.
Im Konsum-Kaufhaus werden die Schaufenster dekoriert. Dicke blaue Vorhänge versperren den Blick auf die Auslagen, nur die Losungen auf rotem Fond sorgen schon dafür, dass die Dinge so gesehen werden, wie das Volk die Dinge zu sehen hat. Die DDR feiert in Kürze. Die Politik feiert ihr Dasein. Ob das Volk etwas zu feiern hat, wird sich zeigen.
Amadou versucht einen schrägen Blick durch den klaffenden Spalt auf die noch ungeordneten Waren, die man hier kunstvoller in Szene zu setzen versteht als irgendwo sonst in dieser Gegend. Für ein Paket in die Heimat ist immer etwas dabei, aber sonst ändert sich nichts an dem, was er seit Langem denkt: Die Alemaos haben den Vorteil der hellen Haut, klar, aber eigentlich sind sie graue Mäuse, nichts weiter. Anders sein eigenes Abbild, das die Scheibe vor dem blauen Vorhang widerspiegelt — groß, schlank und bunt wie die Vögel im Eukalyptushain seiner Heimatstadt Lubango, elftausend Kilometer von hier entfernt. Die tiefschwarze Haut hebt das Gelb seiner Jacke noch greller ab, schneeweiße, nagelneue Adidas blitzen unter den Aufschlägen seiner knallroten Hose hervor. Nicht einmal ADIDAS haben diese Deutschen Demokraten, und sie neiden sie ihm. Auch für ihn waren diese Schuhe wie ein winziger Befreiungsschlag; er hatte sie bei der Durchreise im Duty-free-Shop in Lissabon gekauft, genau wie seine geliebte, goldumrandete Spiegelbrille. Die trägt er selten. Es fehlt an Sonne in diesem Land und es fehlt an Wärme von diesen Menschen. Darüber zu grübeln hatte ihn zuweilen viel Kraft gekostet. Er grübelt nicht mehr, was nicht heißt, er versteht es. Man kann sich an alles gewöhnen, auch an das, was man nicht versteht, was man nicht verstehen kann. An den eintönigen Ablauf seiner Tage und an das Gefühl der Verlorenheit bei Nacht hat er sich längst gewöhnt, darüber zu lamentieren hat er sich abgewöhnt.
Amadou betrachtet sein Spiegelbild. Er streicht über den schmalen Rücken seiner Nase, über die sich sein Freund Eduardo zuweilen wundert, weil sie der schwarzen Rasse nicht adäquat sei, wie er es nennt. Amadou schmunzelt vor sich hin und denkt an die Worte seines Vaters Agostinho: Das schönste Erbe ist, sich selbst als das Erbe seiner Eltern zu begreifen. Amadous Nase ist vom Vater geerbt. Käme er nach Mama Mabele, hätte er auch eine breite Nase wie Eduardo und schaufelförmige Zähne und vielleicht eine großporige Haut…
Er entblößt seine geraden weißen Zähne, er streicht über die glatte Haut auf der steilen Stirn. Seine Eitelkeit hat ihn nicht verändert, doch zuweilen entlarvt sie seine heimlichen Götzen, weswegen Eduardo ihn rügt. Während Amadou rundum als schön gilt, hat Eduardo einen gedrungenen Körper und ein eher verquollenes Gesicht. Doch er fragt, was das in der Fremde gilt? Hier zählt nur die Farbe der Haut, sonst nichts.
Ein Weltverbesserer, dieser Eduardo. Zum Glück hat er in ihm wieder einen Freund gefunden, nachdem er von Mufua getrennt wurde. Mufua war sein bester Freund. Mit ihm hatte er den Entschluss gefasst, sein Glück in der Fremde zu suchen. Portugal wäre das Beste gewesen, der Sprache wegen, doch da gab es keine Chance auf eine Ausbildung. Das Angebot aus der DDR kam ihm gerade recht.
Hätte man ahnen müssen, dass enge Freundschaften unter Vertragsarbeitern nicht gelitten werden? Jetzt ist Mufua in einer anderen Gegend. Eine Ausbildung erhält auch er nicht. Er arbeitet in einem Schlachtbetrieb an der Oder, achtzig Kilometer nördlich von hier. Zum Glück gibt es hier Eduardo. Die beiden vereint so vieles und trennt so vieles. Ihre Liebe zu Angola, ihre Neugier auf das Leben in der entwickelten Gesellschaft und ihr Wissensdrang schmieden die Männer zusammen. Amadous Optimismus und Eduardos Hang zur Skepsis trennen sie dann und wann, genau wie ihre Meinung über Frauen.
Er stellt fest, er sieht gut aus, wirklich gut. Und das sagt er seinem Spiegelbild — natürlich auf Portugiesisch.
Kurze Schritte auf harten Absätzen schlagen hinter ihm über den bröckelnden Beton. Leute eilen vorbei, man kichert ungeniert. Amadou dreht sich um. Er sieht zwei Frauen in roten Schuhen mit superdünnen Absätzen. Es gibt kaum etwas, was ihn vom ersten Tag in diesem Land mehr verblüfft als solche Schuhe. Aber an diesem Tag fesseln nicht bleistiftdünne Absätze seinen Blick. An diesem Tag, zu dieser Stunde, in dieser Sekunde ist es ein Gesicht unter hellbraunen Haaren, das ihn erstarren lässt. Dieses Gesicht schaut zurück, kurz, doch ein Pfeil trifft genau und steckt tief. Wie sie den Haarschopf trägt, hochgesteckt und mit vielen kleinen Kringeln, wie sie die Hüften dreht, wie sie die Lippen formt, all das ist Nsamba, seine Schwester. Er steht wie versteinert und schaut hinterher, verblüfft klappt seine Lippe nach unten, weiter als normal, und er weiß, ein wenig dumm sieht sie immer aus, seine Verblüffung.
Dieses Brennen in der Kehle stellt sich ein und auch ohne den so verhassten kalten Wind treibt es ihm Wasser in die Augen - hemmungslos. Amadou kennt das gut, doch er begreift es nie. Er hatte sich so gefreut, diese Chance bekommen zu haben, und nun hat er wieder einmal Sehnsucht nach zu Hause. Dieses trabalho forcado im ätzenden Dunst passt nicht zu dem, was ihm versprochen wurde. Er denkt nach. Malochen nennt es Günther. Ja, malochen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte er sich abgefunden mit dem Leben hier, mit der Baracke, mit der Arbeit und mit all den kalten Lügen. Irgendetwas schwebt in seinem Hinterkopf, das er noch nicht ordnen kann. Irgendein Gespür, irgendein Glaube, es könne alles noch werden wie erhofft.
Wieder einmal hat er das Gefühl, von etwas Wichtigem ausgeschlossen zu sein, abgeschnitten, ausgegrenzt. Kälte überzieht seine Haut. Immer tiefer gräbt er sich in die Jacke, doch so verkrampft beginnt er noch mehr zu frieren.
Hier herrscht nicht nur ein eisiges Klima, hier herrscht das Gegenteil von allem, was er erwartet hat: das Gegenteil von Überfluss, von Reichtum und Freundschaft. Ja, auch Freundschaften hatte er erwartet, doch die jungen Leute sind skeptisch und die alten begaffen ihn wie ein Tier aus dem Zoo. Wenn er je mit den Menschen von hier zusammen gewesen war, so hatten sie ihn entweder wie ein Kind behandelt oder wie einen Aussätzigen.
Das mit den Menschen ist eine komplizierte Geschichte. Wie macht man das? Wie kommt man mit denen zusammen? Wie oft hat er schon mit Eduardo darüber gesprochen. Unzählige Male.
Seit dieser Minute bewegt ihn nur noch ein Gedanke und der macht ihn verrückt: Er muss diese fremde Nsamba treffen, muss mit ihr reden. Einmal wenigstens. Der wehende Rock und der wippende Haarschopf waren so rasch, wie sie aufgetaucht waren, wieder in der Menge der heimwärts Hastenden verschwunden. Allein, wie so oft, steht er da, verloren, und er denkt nach, wie er immer nachdenkt, ohne zu einem Schluss zu kommen.
Er war ausgezogen in die Fremde, um ein besseres Leben zu führen, ohne Krieg, ohne das ganze Elend um ihn herum. Hier herrscht ein anderes Elend, das Elend der Fremdheit, des Ausgeschlossenseins. Darüber helfen auch seine Freunde nicht hinweg. Einmal Mama Mabeles liebenden Blick, einmal an Vater Agostinhos Schulter anlehnen können, einmal Nsamba streicheln. Ach Nsamba!
Amadou bläst heißen Atem von sich. Diese hier wird nicht anders sein, als alle hier, denkt er, weil die alten Bilder in seinem Kopf drängen, die ihn kränken.
Eines Tages, er hatte sich Fisch und Pommes Frites an einer Imbissbude bestellt, da raunte jemand, er habe wohl keine Kinderstube genossen, nur weil er seine blitzsauberen Finger zum Essen benutzte. Wie war es doch schön zu Hause, wenn der Fisch über dem Feuer im Hof brutzelte und der Reis im Kessel brodelte. Und dann — alle aßen sie gemeinsam mit bloßen Händen aus einem Kessel, nahmen sich Fisch vom selben Grill. Nicht, dass sie keinen Hausstand hätten wie die Leute in den musseques, den Elendsvierteln. Es war das Ritual, ihr Ritual, das ihm umso wertvoller erscheint, je länger er diesem entsagen muss.
Der hell erleuchtete Bus kommt. Er setzt sich in eine freie Reihe, allein, wie er es inzwischen gelernt hat. Keiner soll seinetwegen aufstehen und einen anderen Platz einnehmen. Im Gegenlicht sieht er sein Spiegelbild und all die anderen Gesichter der Fahrgäste verschwimmen im kleinen Schmerz des Heimwehs. Er sieht Mutter Mabele, Vater Agostinho, Schwester Nsamba, Bruder Maka und die Zwillinge Ngunza und Nzua. Nur die kleine Avò sieht er nicht — kein Gesicht spiegelt diese gütige Greisin. Trotzdem. Er lacht allen zu, seine weißen Zähne blitzen aus der langsam einsetzenden Dämmerung zurück.
Warum dauert die Dämmerung hier so lange? Warum ist es so kalt? Warum hat man uns hierher geholt? Warum hat man gesagt, man kann hier viel lernen? Warum hat der Schöpfer Schwarze und Weiße geschaffen? Warum versteht er die Bücher noch so wenig?
Er will sie lesen, um alles zu wissen, was man von den Menschen wissen muss. Wenn man sie gelesen hat, versteht man die Menschwerdung, hatte Günther gesagt. Günther ist einer, der sich nicht zu schade ist, am Tisch der Schwarzen in der Kantine zu essen. Als sie einmal über die Rassen sprachen, hatte er sogar abgewinkt und gesagt:
»Vergiss es. Alle Menschen gehören derselben Art an, dem Jetztmenschen, dem Homo sapiens sapiens. Kein Gott, nein, der Mensch zergliedert den Menschen in edle und weniger edle Rassen. Der Mensch verantwortet den Rassenwahn und er schürt ihn des Erhebens wegen.«
Die verschiedenen Rassen interessieren Amadou nicht so brennend wie jene Dinge, die bei den Rassen gleich sind. Wörter wie Gene, Zellen, Chromosomen schwirren durch seinen Kopf. Er weiß, es hat etwas mit menschlichem Erbgut zu tun, doch es bleiben Menschen, trotz ungleicher Gene. Viel weiß er noch nicht, er ist neugierig und will es lernen. Das konnte er zu Hause nicht, dort fehlten ihm diese Bücher. Wenn er es genau bedenkt, ist das mit den Büchern ein phantastisches Ding. In jedem Dorf, so sagt Günther, gibt es eine kleine Bibliothek, wo die Menschen Bücher ausleihen können, kostenlos. Er muss die Zeit nutzen, er will schließlich klug und reich nach Hause zurück kommen.
»Ich komme zurück und ich komme als Amadou Rico«, murmelt sein weicher Mund in der Sprache seiner Väter. Ein Kind dreht sich nach ihm um, staunt, nimmt rasch den Kopf zurück in Fahrtrichtung, um immer wieder nach hinten zu schielen, heimlich. Ängstlich?
Er betrachtet sein eigenes Gesicht im Widerschein der dunklen Scheibe. Alles in Ordnung. Er betrachtet seine Hände, die schwer arbeiten müssen, schwerer als man es ihm versprochen hatte. Drei Schichten im Wechsel. Wenn er dieser Nsamba gegenübertreten will, müssen die Hände gepflegt sein. Nicht eckig und nicht dreckig dürfen die Nägel sein, wenn man einer so hellen Frau die Hand reicht. Seine Nägel sind nicht gepflegt, noch nicht — oder nicht mehr.
Langsam entsteht ein Plan in seinem Kopf, wie er es anstellen will, doch etwas widerstrebt ihm. Oscare. Oscare würde wissen, wo man diese Frau aufspüren kann. Doch dieser Oscare mag Amadou nicht, und Amadou mag Oscare nicht. Warum? Was geht es jemand an!
Angola – Monate zuvor
Die Luft ist noch kühl, der Tag noch jung. Nach dem Wetter braucht sie nicht zu schauen, es wird werden wie immer zu dieser Zeit auf diesem Kontinent, warm und trocken. Toni Hein geht prüfend durch die Wohnung in diesem Haus, wo die meisten deutschen Entwicklungshelfer wohnen. Ihre Augen sind klar, beinahe zufrieden. Der kleine Hausrat liegt ausgebreitet vor ihr, nützliche Dinge, die sie in den letzten Jahren Stück für Stück von zu Hause mitgebracht hatte, weil sie in diesem Land nicht zu beschaffen waren. Bald braucht sie all das nicht mehr. Bald wird es guten Freunden hilfreich sein, jenen Angolanern, die diesem misslichen Leben nicht einfach adieu sagen können, wie sie es jetzt kann. Die meisten Angolaner bleiben ihrer Heimat treu, trotzen dem Krieg und warten, bis der Brudermord in den unsäglichen Verirrungen dieses fremd gesteuerten Krieges endlich aufhört.
Weil Piet hier ist, ist auch sie hier; und weil es hier einen Beitrag zu leisten gilt, die Menschenwürde weltweit erhalten zu helfen. Die große Chance der Menschheit auf Einigkeit, auf Gleichheit, auf Brüderlichkeit, woran die Leute hier glauben, das war etwas, woran auch sie glaubte, wie die Christen an ihren Gott glauben. Erst hier wichen ihre Augen ab von der glühenden Hoffnung auf eine gerechtere Welt, um der grauen Wahrheit ins Auge zu blicken. Die Welt ist nicht gerecht, solange sich einer über den anderen erhebt, solange die Wahrung der Würde des Einzelnen von dessen Besitz, von dessen Hautfarbe, von dessen Religion abhängt, solange der Wohlstand des einen aus dem Elend des anderen entspringt.
Ein flaues Gefühl überkommt sie, wenn sie an die Heimreise denkt. Nicht, dass sie ihr schwer fällt, nicht dass sie ins Ungewisse reist.
Ihre Sicherheit ist nirgendwo so sicher wie in der Heimat, sagt Piet sehr gern. Natürlich gibt sie ihm Recht, vor allem, wenn donnernde Salven der schießwütigen Möchtegern-Krieger die Luft erzittern lassen.
Aber Tonis Vertrauen in die Heimat ist verletzt. Wogegen wird sie das aufwiegen können?
»Was nutzt all der Glauben an eine gerechte Welt, wenn die Menschheit die Würde der Menschen nicht achtet?«
Sie stemmt ihre Arme in die Hüften und atmet tief durch. Klar war sie bereit gewesen, dieses Opfer zu bringen. Klar wurde sie enttäuscht. Klar war sie einmal stolz darauf, auf der ehrbaren Seite zu stehen. Warum wurde ihre Einsicht so enttäuscht. Warum schnappen ausgerechnet hier im ärmsten Winkel der Welt listige Devisenbeschaffer nach deutschen Wohlstandsikonen?
Sie gibt sich einen Ruck aus der Starre ihrer ungeliebten Gedanken. Liebevoll streicht sie über eines der Bündel aus Decken, Textilien und Schuhen. Später werden noch die Lebensmittel dazukommen. Sie weiß, so Geschundenen wie Ntumba im bairro kann sie den Schmerz nicht nehmen. Der frühe Tod ihres Sohnes Enkembe, der Hunger und die Kälte der Nacht, der Mangel an sauberem Wasser, all das kann sie nicht wettmachen, aber für eine Weile konnte sie deren größte Not lindern helfen.
Etwas fährt durch ihre Glieder. Das blanke Metall des elektrischen Backgerätes, das mit Muttern und Nieten versehen ist, sieht aus wie das Teufelszeug in angolanischer Erde, das diesem unschuldigen Kind erst das Bein, dann das Leben gekostet hat. Das Zimmer vor ihren Augen verschwimmt, das letzte Bild des kraftlosen Jungen kehrt zurück. Sie beherrscht es nicht, einem Schütteln zu entgehen. Außerstande, das Gerät noch einmal zu prüfen, treibt es sie hinaus auf den Balkon, von dem sie Hunderte Male über die Hütten der Hoffnungslosen bis hinüber zu «ihrem» bairro geschaut hat. Das Getöse von der Straße nimmt sie nicht wahr, die Luft ist so klar, doch sie kann kaum etwas erkennen. Das erste, was sich stets einstellt bei diesen Gedanken, sind ihre feuchten Augen und ihr Zorn auf die Mächtigen dieser Welt, die den Kindern die Kindheit nehmen und den Müttern die Hoffnung. Keiner verdient den Tod durch eines Anderen Hand. Jedem steht ein würdevolles Leben zu. Toni weiß, es ist sentimental, über das eine Kind so stark zu trauern. Zu viele Kinder sind es, die in diesem Land keine Chance auf ein Leben in Würde haben. Wie so oft verfällt sie in eine traurige Mattigkeit, und wie so oft wird diese erst vergehen, wenn sie einen sehr guten Gedanken geboren hat.
Sie kneift ihre Augenlider zusammen. Die Hochebene liegt in starkem Licht, jenem Licht, das sie so sehr an die Namib erinnert. Dort schien es so friedlich und war doch lebensfeindlich.
Was wird sie zu Hause erwarten?
Wie aus dem Nichts kommt ihr der Gedanke, an den sie sich jetzt klammert. Vielleicht dieser Amadou, vielleicht ein anderer, zu Hause will sie denen helfen, die aus dem Elend kommen und im fremden Land ihr Glück versuchen. Es wäre auch in Mabeles Sinn.
Die ganzen Jahre über waren sie sich nicht begegnet, wie sollten sie auch. Sie hatte ja nur noch Augen für die Flüchtlinge im bairro. Wer dort leben muss, ist vergessen von der Welt. Und — wie Toni erleben musste — sogar vergessen von denen, die sich der Solidarität rühmen. Auch wenn sie selbst zu helfen versucht hatte — kleinlaut, aber mit volltönendem Herzen — ändern konnte sie deren Leben nicht. Ihr Herz war so voller Hoffnung, ihr Wille so ungebrochen, beides hat nicht viel bewirkt. Herz und Wille allein sind untauglich für Veränderung. Wer verändern will, muss beständig streiten.
Mabele und Agostinho Nginga wohnen nicht in einem der Elendsviertel. Sie wohnen in einem ansehnlichen Haus in einem Stadtteil, wo es kleine, gepflegte Gärten gibt, wo Obstbäume wachsen, wo Blumen und Kakteen wuchern und wo Kohlpflanzen aus der fruchtbaren Erde sprießen. So bescheiden die Menschen hier auch leben, um sie braucht man kaum Sorge zu haben.
Toni erinnert sich noch genau: Während des Besuches bei Luciano standen Agosthino und Mabele plötzlich hinter der niedrigen Mauer, die Lucianos Grundstück von dem der Ngingas trennt. Mit Abstand betrachtet ist es möglich, Luciano hatte dieses Zusammentreffen für seine Nachbarn arrangiert. In Mabeles hübschem Garten stand ein ähnlicher «Wunderbaum», wie Luciano einen opfern wollte, sobald Piets und Tonis Heimreisetermin endgültig feststehen würde.
»Die Ausfuhr von Pflanzen ist verboten«, sagte Piet.
»Keine Sorge«, meinte Luciano und verbarg eine diebische Freude hinter den kleinen, faltigen Augen: »Schnittblumen sind erlaubt.«
Er zählte das geschnittene Holz der Yucca-Palme einfach dazu, und man hatte den Anschein, er mache das nicht zum ersten Mal. Die Yucca, das wusste Toni, ist ein rechtes Wunderholz. Wenn man die Stammstücke einige Zeit ins Wasserglas stellte, grünte es unter der Rinde hervor und ein afrikanisches Wunder entfaltete seine lange verborgene Pracht.
Ein warmer Wind ging und Lucianos Nachbarn schauten schweigend herüber. Bei einer kleinen Böe schob Mabele ein Büschel ihres faden Kraushaares aus der Stirn und rief herüber:
»In Deutschland ist der Wind kälter.«
»Oh ja«, rief Piet zurück. »Waren Sie schon einmal da?«
»Mein Sohn Amadou arbeitet dort. Es ist ein gutes Land, reich und friedlich.«
Piet trat näher an die Mauer und reichte den beiden die Hand. Toni beobachtete erst die Gesichter, die Piets Mund folgten, trotzdem sie ihre Körper demütig nach vorn beugten. Dann trat auch sie an die flache Mauer: »Gott sei Dank ist es friedlich. Wo genau ist Ihr Sohn?«
Mabele wollte etwas erwidern, doch sie bekam nicht eines von den vielen Worten heraus, die zu sagen wären. Auf ihrer Stirn perlten kleine glitzernde Tropfen und Agostinho kippte seinen Kopf in Richtung Haus.
Mabele rannte los. Ihr feister Hintern wippte schwer, ihre rissigen Füße verloren die ausgetretenen Pantoffeln. Am Haus auf einem dicken Brett saß eine Greisin, starr, nach vorn gekrümmt, auf einen Stock gestützt. Sie sagte nichts, schaute nicht einmal auf, als Mabele ihr eilig das schützende Tuch auf das schüttere Haar legte.
Piet redete mit Agostinho derweil über die angolanische Erde, die viel fruchtbarer sei als die europäische. Er sprach das Portugiesisch gut, es war sein Handwerkszeug; damit verdiente er hier sein Geld. Dennoch holperten die Worte heute ein wenig, wie oft bei Vokabeln, die er nicht täglich brauchte. Wenn er zu Hause etwas vermissen werde, sagte er lächelnd zu Agostinho, dann sei es das Klima und die Vegetation. Beides würde er, wenn er könne, gerne mitnehmen. Agostinho lachte bei jedem Wort, das Piet sich mühte, korrekt herauszubekommen. Agostinho war ein anderer Typ als Mabele, kein rein negrider Typ, eher eine Mischung aus Portugiese und Afrikaner, wie viele, die in dieser Gegend wohnten. Die Völker hatten sich gemischt — in friedlicher Absicht. Der schmale Rücken seiner Nase verriet es. Sein krauses Haar leuchtete hell, es war nicht zu unterscheiden, ob es bereits ergraut oder ob es schon immer heller war als das seiner Frau. Wahrscheinlich aber war es ergraut, links und rechts zeichneten sich Geheimratsecken ab. Nur die dunkle Haut, die zwar ein wenig aschfarbener war als man es kannte, kennzeichnete Agostinho als einen von hier.
Keuchend kam Mabele mit einem winzigen, abgegriffenen Zettel zurück. Sie zitterte, während sie die Hand nach Piet und Toni ausstreckte.
Die steil nach links gerichtete Handschrift sah krakelig aus. Man spürte das Unbehagen des Schreibers, diese fremden Worte zu Papier bringen zu müssen.
Der Name des ersten Präsidenten in der Postanschrift war mit Abstand betrachtet nichts als lächerlich. Zu Hause waren sie es gewöhnt, aber diesen Menschen hier musste die Stadt, in der ihr Sohn jetzt lebte, unheimlich vorkommen. Unheimlich lang im Namen, unheimlich weit entfernt, unheimlich kalt im Winter. Unheimlich.
»Wir kennen die Stadt sehr gut.« Toni schielte auf Piet. »Seine Mutter und sein Bruder wohnen dort. Es ist eine Kreisstadt, direkt an der polnischen Grenze.«
»Ja, ja, Grenze, davon hat Amadou geschrieben.«
Vor lauter Erregung färbte sich Mabeles Gesicht und man konnte es getrost als ein Zeichen großer Erwartung werten. Welche Erwartung, darüber machten sich in dieser Minute weder Toni noch Piet Gedanken. Sie sahen nur Erleichterung in dem rundlichen, plötzlich mit unzähligen Schweißperlen übersäten Gesicht.
Tonis Atem zittert. Stoßweise saugt sie die schwülwarme Luft in ihre Lungen. Der Druck tief unter ihrer Haut lässt nicht nach. Diesen Amadou kennt sie nicht persönlich, aber sie kennt sich. Seit diesem Tag glaubt sie ganz fest daran, dem jungen Mann zu helfen, sofern er sie um Hilfe bittet. Piet indes meint, Mabeles Sohn sei klug genug gewesen, dem Krieg zu entkommen. Als Vertragsarbeiter in der DDR habe er eine reale Chance auf ein würdiges Leben. Ein Angolaner ist stolz. Er wird keine Hilfe erbitten.
Das Ausländerheim
Der Bus hat die Anhöhe erklommen. Nichts als Plattenbauten, riesige Fronten grauen Betons gähnen gen Himmel. Gleiche Türen, gleiche Fenster, gleiche Farben. Wie finden die Menschen ihr Heim?, denkt Amadou. Legen sie Duftspuren wie die Ameisen? Sind das Ameisen? Ja. Es sind fleißige Ameisen, die ihrer Königin zu dienen haben. Er grinst in sich hinein und läuft an den Häusern entlang, schaut nach oben. Die hell erleuchteten Fenster zieren zarte Stoffe; Gardinen nennen es die Frauen. Dahinter leben die Menschen in liebevollem Frieden. Familien mit Kindern, Alte, Junge. Für alle hat der Staat gesorgt. Alle haben eine Arbeit und eine Wohnung, und niemand ist da, der ihr Leben bedroht. Irgendwo knallt eine Tür ins Schloss. Amadou duckt sich. Warum er so leicht erschrickt, geht hier niemanden etwas an. Nur leise flucht er vor sich hin: »Verdammt!«
Er ist zu weit gelaufen. Ein paar Schritte muss er zurück, vorbei an knorrigen Bäumen und beinahe schon blattlosen Hecken, an denen der Wind zaust. Nichts flößt ihm mehr Furcht ein als kahle Bäume. Versteckt hinter einem Stück Mauer liegt das Ausländerheim; Vertragsarbeiter-Wohnheim habe man es zu nennen. Natürlich, dagegen ist nichts zu sagen.
Das gesprenkelte Sprelacard der Außentür ist schon mehrmals erneuert worden. Ob es die Fußtritte der Bewohner waren oder Dummejungenstreiche der Alemaos, das erfuhr man nie. Kraftvoll zieht er die Tür auf, laut knallt sie hinter ihm wieder ins Schloss. Diesmal duckt er sich nicht. Sein Freund Eduardo kommt von der kleinen Küche quer über den Flur gelaufen, der ebenso niedrig und hellhörig ist, wie die mit altmodischem Mobiliar ausgestatteten Räume. Aus der Wasserkanne in Eduardos Hand schwappen Spritzer auf das braune Linoleum, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Eduardos gelbe Augäpfel wirken krank, sein fleischiger Mund unter der sehr breiten Nase aber zeigt ein Lächeln: »Ich habe eine Überraschung.«
Amadou wundert sich nicht. Die Art, wie man ihm begegnet, wie man seine Klamotten betrachtet, wie man ihn einbezieht in alles, was man organisiert, mag Amadou. Auch wenn sie alle nur gelittene Hungerleider sind wie er selbst, es wäre zu schwer, sich in der großen, unbekannten Welt alleine zu behaupten. Sie waren von ganz unten gekommen, hatten sich auf ein Abenteuer eingelassen, dessen Ausgang keiner vorhersagen kann. Nun sind sie hier, angekommen sind sie noch lange nicht. Zwei wichtige Dinge haben sie dazugelernt: Der Intoleranz begegnen sie tolerant, ihre Ausgeschlossenheit ordnen sie dem notorischen Sicherheitsbedürfnisses ihres Gastlandes zu — pronto.
»Wir haben Karten für die Disco«, freut sich Eduardo.
»Disco? Im Kombinat?«
Eduardo streckt geheimnisvoll einen Finger aus und zieht den unteren Wimpernkranz seines linken Auges so tief herunter, dass einen sein gelblicher Augapfel das Fürchten lehren könnte. Dann grinst er ein wenig verkrampft über das glänzende Gesicht.
»Nein. In der Sichelkneipe.«
Sichelkneipe nennen sie die Wohngebietsgaststätte der Konsumgenossenschaft, an deren Fassade ein riesiges Firmenlogo prangt. Der Brigadier sagt, der Schornstein und die Sichel im Kreis stehen für die Einheit von Industrie und Landwirtschaft.
»Super!«, grinst Amadou. Dann rutscht seine Lippe wieder nach vorn. Diese fremde Frau, diese Nsamba dort zu treffen, hieße, einen Tropfen Regen in der Namib wieder zu finden. Angesichts der schlaffen Lippe, die Amadou den Ausdruck ständigen Staunens verleiht, schwindet bei Eduardo der Stolz auf das Lob, das er angesichts der Überraschung erwartet hatte. Es war nur Zufall, dass er gerade in der Nähe vom Brigadier war, als der den Anruf führte.
Seine Wangen werden schlaff, beinahe hilflos. Amadou nimmt die Worte als einen guten Witz, bis Eduardo andeutet, Amadou soll mitkommen und einen Tee mit ihm trinken. Eduardo wohnt am Ende des Ganges mit Oscare, Acácio und Silva in einem Zimmer. Es hatte nicht geklappt, gemeinsam in einem Zimmer zu wohnen. Amadou wollte einen anderen Job und hatte ihn bekommen. Nun arbeiten sie in verschiedenen Schichten und wohnen daher in verschiedenen Zimmern. Jetzt ist es zu spät, etwas zu ändern, alle Zimmer sind belegt.
Amadou schaut sich um. Alles ist unverändert. Rechts an der Wand stehen hintereinander zwei Doppelstockbetten, in der Mitte des Raumes ein brauner Holztisch und vier Stühle. An der linken Wand die Spinde — vier an der Zahl. Sie sind so schmal, dass die Männer den Großteil ihrer Kleidung an Haken links hinter dem Kachelofen über der Holzbank aufhängen. Nur an die Wand hat inzwischen jemand ein Gebet geschrieben und ein Kreuz dazu gemalt. Eduardo war es gewiss nicht.
Auch wenn der alte Kachelofen ausgedient hat, weil die Baracke irgendwann aus Sicherheit an das Fernwärmenetz angeschlossen worden war und auch eine kleine Küche eingerichtet wurde, so dient die Röhre mit der gusseisernen Tür als Abstellplatz für Teekanne und Wassertopf und manchmal wird das ganze Monstrum zum Trockenplatz für durchnässte Kleidung.
Im Zimmer nimmt es einen den Atem. Der Geruch von verschwitzter Wäsche, abgetragenen Schuhen und schwarzem Tee schlägt auf den Magen. Um sich nach der Arbeit für die Arbeit auszuruhen, reiche die Unterkunft allemal, hatte die Beauftragte gesagt, und sie entspräche der Norm. Immerhin liege die bei maximal fünf Quadratmetern für eine Person und viereinhalb seien immerhin erreicht.
Eduardo zieht einen Stuhl hervor und lässt seinen massigen Körper fallen, dann spricht er schleppend, gedämpft, nur in seinen Augen entzündet sich ein kleines Feuer:
»Der Brigadier hat uns die Eintrittskarten geschenkt. Wir sollen nur den Algeriern nichts sagen, mit denen gibt es zu viel Ärger.«
Er spricht in sehr kurzer Zeit über sehr viele Dinge, die mit den Algeriern passiert sind und irgendwann kommt er überraschend auf die deutschen Frauen zu sprechen, die mit den Algeriern schamlos herummachen würden. Eduardo ist keiner, der je darüber nachgedacht hätte, mit einer deutschen Frau etwas anzustellen, nicht laut und vielleicht auch nicht einmal leise.
»Die Frauen haben kein Schamgefühl. Hängen sich denen an den Hals, knutschen herum und liegen sogar nackt am See. Da spannt dir die Hose. Ich sag dir was, Amadou, hätte ich eine solche Frau, ich würde sie geteert und gefedert aus dem Haus jagen.«
Eduardo nennt man hier Professorchen. Er hat etwas, was Amadou fehlt — den klaren Blick von seinen Büchern auf das Leben. Eduardo liest andere Bücher als Amadou — über die herrschenden Weltsysteme und ihre Wirtschaft.
»Wenn du ein Haus hättest, Eduardo«, grinst Amadou. »Erst musst du eins haben. Wenn das hier so bleibt, werden wir es nicht weit bringen. Vielleicht hau ich bald ab, nach Berlin.«
Eduardo macht Augen wie ein Kalb und wiegt mit dem Kopf wie ein Wackelhund.
»Das ist schwierig.«
»Aber man kann es schaffen. Noch haben wir genug Zeit, bis unser Vertrag ausläuft.«
Amadou richtet seinen Körper kerzengerade und wartet. Eduardo stiert in sein Glas, pustet hinein, hält seine Stirn über den aufsteigenden Dampf und nuschelt monoton.
»Wenn du reich werden willst, musst du wahrscheinlich auf die andere Seite der Mauer. Der Brigadier hat gesagt…«
»Der Brigadier…«, motzt Amadou, und gibt seiner Stimme die gleiche Abfälligkeit, die er dem Brigadier entgegenbringt. Er mag ihn nicht, nicht weil der ihn zu gerne als Spinner betitelt. Er mag ihn nicht, weil der Brigadier ihn nicht mag. Pronto!
Eduardo kennt die Fehde der beiden und redet einfach weiter.
»Der Brigadier hat gesagt, hier wird sich bald alles ändern, und…«
»Und?«
»Oder eben nicht gut ist.«
»Die Russen lassen nicht zu, dass etwas Schlimmes passiert. Die Kubaner würden bei uns auch nicht zulassen, dass Savimbi siegt. Wozu sind die überhaupt im fremden Land, die Russen wie die Kubaner?«
»Der Brigadier sagt…«
»Der Brigadier, der Brigadier … Was sagt unser Professorchen?«, quiekt die erregte Stimme von Amadou. Mit einiger Wucht landet seine Faust auf der Schulter von Eduardo. Den rührt das nicht, der zuckt nicht einmal, schaut nur auf und sinniert ganz ruhig über die Zukunft dieser Welt.
»Alles hat seinen tiefen Sinn. Der Fortschritt braucht Schutz. Eine Weltgesellschaft, die nicht nur dem Profit erlegen ist, wäre ein Segen für Mutter Erde. So wie die Kapitalisten mit der Welt umgehen, ist sie in Gefahr.«
»Was soll das für eine Gefahr sein?«
»Die Gefahr der Rasanz. Wem soll diese Rasanz nützen? Die Erde blutet aus, die Ressourcen schwinden, die Natur stirbt, nur weil dem Menschen Bedürfnisse suggeriert werden, die er noch gar nicht kannte, die er aber haben sollte, um den Konzernen Profit einzufahren. Der Kapitalismus dient nicht der Menschheit, er dient der Macht einiger Menschen über viele. Nur wenn die Bedürfnisse der Menschen die Triebkraft der Entwicklung sind, kann diese Welt auf Dauer alle ernähren.« Eduardo lehnt seinen Körper weit zurück und schielt auf das Kopfende seiner Koje. »Das steht in den Büchern und das haben auch wir so gelernt…«,
Eduardo ist stolz auf sich, sehr stolz sogar. Keinen einzigen Satz hat er vergessen. Er hat sie in einem dieser Bücher gelesen und er hat die Sätze in Deutsch gelesen.
»Klingt plausibel, aber wer in der Scheiße sitzt, denkt nicht an morgen. Wir leben heute, Eduardo.«
»Wir leben heute Amadou«, lächelt nun auch Eduardo, ohne es zu merken, »und morgen gehen wir zur deutschen Disco.«
Toni Hein
Die afrikanische Sonne brennt erbarmungslos auf der Haut, ihr Gesicht ist braun gebrannt, ihre feuchten Augen rötlich, das dunkle Haar glänzt im Gegenlicht des ewigen Sommers. Sie spürt das alles nicht mehr. In Gedanken vertieft tritt sie vom Balkon zurück ins Zimmer. Drinnen erscheint es dunkler als es ist. Das Licht des grellen Tages hat die Pupillen verengt. Beinahe schrickt sie zusammen, als ein Schatten sich nähert. Es ist Piet. Mit einem zufriedenen Lächeln drückt er ein paar Briefe an seine Brust, als er Toni flüchtig umarmt. Längst hat er sich blitzschnell umgesehen, wie immer, wenn er nach Hause kommt.
»Gib nicht schon jetzt alles aus der Hand. Wer weiß, wie lange wir diesmal hier hängen bleiben.«
Gelegentlich hat sie den Eindruck, sie sei auch in den Augen ihres Mannes nur noch die Hausfrau. Wie konnte er anders denken? Es gab kaum eine Entscheidung, die sie allein traf, solange sie in diesem Land waren. Immer hatte sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, immer hatte sie sich seiner Meinung gebeugt, weil es etwas gab, das sie ums Verrecken nicht aufgeben wollte und das, wenn es publik geworden wäre, auch ihm Scherereien eingebracht hätte. Die heimlichen Besuche bei Ntumba waren verboten, der bairro war verbotenes Gebiet.
»Ich weiß«, entfährt es ihr ein wenig zu heftig. Seine Mahnung hatte etwas in ihr berührt, was sie seit langem verdrängt. Schon einmal waren sie hängen geblieben. Schon einmal sind Dina und Thom zu Hause beinahe verzweifelt, als die Eltern erst Wochen später ihren Urlaub antreten konnten, weil der Krieg sie gehindert hatte. Was würde sein, blieben sie diesmal ganz hängen. Es ist Krieg und der ist unberechenbar. Gerade an Dina wollte sie jetzt nicht denken, nicht so jedenfalls. Sie schaut Piet an und sieht sein Schmunzeln auf den Lippen und die Briefe in seiner Hand. Er nimmt ihr also den kratzigen Ton nicht übel, er weiß nur zu gut, wie sehr sie unter der Trennung von ihren Kindern gelitten hat, mehr als er. Doch er weiß auch, wie viel sie hier noch gerne erledigen würde für die Menschen, die sich an ihre Hilfe gewöhnt hatten. Er muss verstehen, dass sie es nicht erwarten kann, ihr Hab und Gut zu verteilen.
»Haben wir noch Zeit für die Post?«, fragt er.
»Klar«, sagt sie und greift rasch nach den Briefen, die, so lange wie sonst nie, unbeachtet geblieben sind. Für gewöhnlich wird die Post hastig geöffnet und hastig gelesen. Später lesen sie dann noch einmal Wort für Wort, Zeile für Zeile in Ruhe. Flink gleiten vier Briefe durch ihre Finger. Den einen von Dina schiebt sie auf ihren Schoß, einen anderen, den von Schwager John, reicht sie Piet. Die anderen haben Zeit. Dann herrscht gespannte Stille im Raum, nur das Hupen der donnernden Lastwagen auf der holprigen Straße vier Stockwerke unter ihnen hält Toni davon ab, ihre Gedanken locker zu lassen. Sie schließt die Balkontür und wirft einen Blick auf das Foto im Schrank, Dinas junges Gesicht, ihr Lächeln mit traurigem Blick. Sie ist entschlossen, ihre Nerven zu zügeln, der nächste Antwortbrief wird der letzte sein, für immer. Hoffentlich.
Neben ihr im Sessel atmet Piet beschwerlich. Seine Stirn glänzt feucht, er wischt mit dem Handrücken den Schweiß ab. Nein, müde sieht er nicht aus, eher zornig, allenfalls besorgt. Für eine Weile lehnt er sich zurück, doch mit einem Ruck reißt er sich hoch, seine Augen werden scharf, bitter. Mehr beiläufig als interessiert fragt sie ihn:
»Gibt’s was Besonderes?«
»Mutter liegt im Krankenhaus. Die Spritzenschwester hat sie gefunden… Morgens halb sechs lag sie auf dem Bettvorleger…«
Toni lässt den Brief ihrer Tochter auf den Schoß sinken. Die neue Zuversicht, die neue Vorfreude auf daheim weichen fragenden Augen. Sie wartet auf eine Erklärung, ein, zwei Worte mehr wenigstens. Dazu ist Piet nicht bereit, nicht in dieser Minute. Erst als Toni den Brief ihres Schwagers liest, wird ihr klar, was Piet bedrückt.
Seit sein Vater tot ist, würde Mutter Irma auch ihren Sohn Piet dringend brauchen. Er aber ist hier am 15. südlichen Breitengrad. Er kann ihr nicht helfen, noch nicht. Wie gut, dass John noch in der Heimatstadt lebt, und — wie er schreibt — opfert er sich auf, tut mehr als ein Mann ertragen kann. Seine Worte aber, »…es muss etwas passieren, ehe etwas passiert«, klingen wie ein Vorwurf, wie ein letztes Mahnen: Komm endlich nach Hause! Es gibt kaum einen Menschen, der dieses Gefühl besser kennt als Toni. Sie lebte ständig mit schlechtem Gewissen, weil sie ständig in der Fremde lebte. Sie war mit Piet in die Großstadt gezogen, hatte dort ihre Arbeit und ihre Familie und später das fünfjährige Studium. Für ihre Mutter war wenig Zeit. Die Reue war immer da, aber die traf sie doppelt, als Mutter früh starb.
»Hol sie zu dir. Du warst doch immer ihr Liebling.«
Tonis triumphierender Ton stört Piet, doch für Rechthaberei hat er nichts übrig. Seine Traurigkeit, so weit weg zu sein, würde Toni ihm sowieso nicht glauben. Für sie scheint er ein emotionaler Eiszapfen zu sein.
»Einen alten Baum verpflanzen? Das geht nicht gut«, sagte er wie zu sich selbst. Sein Kopf wiegt leise hin und her, doch der Blick bleibt starr. »John ist da und ihre Freundinnen.«
»Freundinnen«, wiederholt Toni und lässt ihre Stimme in der untersten Oktave der Abfälligkeit versinken. »Die kommen doch nur zum Kaffeeklatsch. Was Mutter braucht, ist nicht nur Unterhaltung. Sie braucht vor allem Hilfe, Pflege und natürlich auch Zuwendung.«
»Ich weiß, aber John kümmert sich und Lucie und Marga besuchen sie oft.«
Hat es Sinn, mit ihm über die Empfindung seiner Mutter zu reden? Über die Katastrophe, die Erwins Tod in ihr hinterlassen hat? Nie hat sie einen leisen Gedanken daran bei Piet gespürt, und nun mutiert er plötzlich zum Alterspsychologen?
»Heißt das, du lehnst es ab, dich um deine Mutter zu kümmern?«
Piet verharrt regungslos, nur seine Wangenmuskeln verhärten sich und hüpfen auf und nieder. Sie sieht genau, was ihr Tonfall in ihm auslöst. Er lässt seine Knie wippen und schnaubt verächtlich:
»Warum musst du immer so überziehen? Ich lehne es nicht ab, aber ich habe kein Recht, über sie zu bestimmen. John hat sich die letzten Jahre über um sie gekümmert. Er wird wissen, was das Beste für sie ist. Aber noch ist Mutter in der Lage, selbst zu bestimmen, was sie will. Nur das müssen wir respektieren und dann bin ich der Letzte, der etwas ablehnt.«
Plötzlich ist eine knisternde Spannung im Raum — lange Blicke, angespannte, starre Muskeln. Worte, die ungesagt bleiben und jeden Ansatz von Vernunft blockieren.
»Sie muss ja nicht direkt bei uns wohnen. Vielleicht in unserer Nähe. In unserem Block. Es gibt viele kleine Wohnungen. Irgendwann wird schon eine frei werden.«
Piet schaut weg, schüttelt den Kopf und schweigt. Solche Gespräche haben nie gut geendet. Noch vor zwei, drei Jahren hätte es solche Gespräche nicht einmal gegeben. Noch vor zwei, drei Jahren hätte Toni klein beigegeben, weil sie den Schlagabtausch, der immer einsetzte, wenn sie nicht nachgab, als Verrat an ihrer Ehe verstanden hätte. In diesem Land ist sie klüger geworden, spät, aber nicht zu spät. Hier hat sie das Aufbäumen gelernt, nicht gegen ihren Mann, beileibe nicht. Aber hier hat ihr das Aufbäumen geholfen, nicht die Selbstachtung zu verlieren. Freilich hatte ihr Eigensinn ihn erschreckt. Ihren heimlichen Gängen in den bairro hatte er aus gutem Grund nicht zugestimmt. Jetzt aber sieht sie nichts, was sie verstehen könnte.
»Es geht mich nichts an, es ist deine Mutter. Für meine Mutter musste ich immer alleine entscheiden.«
Sie ist überzeugt, dass es so war, aber genau weiß man ja nie, wie der andere handeln würde, wenn man ihn zu handeln aufforderte.
»Warum sagst du so etwas?«
»Weil ich es so empfunden habe. Darum. Und weil die Zeit einmal kommt, wo man zurückgeben muss. Aus Dankbarkeit…«
Der Satz bleibt in der Luft hängen. Die beiden schweigen eine Weile - im Raum ist nur ihr Atem ist zu hören.
Sie kann sein Gesicht nicht sehen und es macht ihr Mühe, den Überblick zu behalten, wenn sie sein Gesicht nicht sieht.
»Was weißt du von meiner Dankbarkeit für meine Mutter!«
Das war keine Frage, das war nicht einmal Schelte. Sie spürt genau, wie er sich in fernen Erinnerungen verliert und irgendwann, nach endlosem Nachdenken sagt er plötzlich in die Stille des Raumes hinein:
»Was habe ich zeitlebens die erwartete Dankbarkeit gehasst.«
Vor ihren erschrockenen Augen beginnt er irgendjemanden nachzuäffen und hebt seine Stimme höher als gewöhnlich: »Wir tun mehr für Euch, als Kinder verlangen dürfen!« Und dann senkt er die Stimme tiefer als gewöhnlich. »Ob wir uns über etwas gefreut haben oder nicht, wir mussten ihnen immer danken und wir haben ihnen immer gedankt.«
Inzwischen weiß Toni nicht mehr, was sie ihm eigentlich übel nimmt, die Art wie er spricht, die Worte, die er wählt. Manchmal kennt sie ihn nicht, kennt sich selbst nicht.
Toni erhebt sich ein wenig zu rasch. Sie reißt die Tischdecke aus der Schublade und befördert sie schwungvoll auf den großen Esstisch in der Ecke des Zimmers. Mit stampfendem Schritt eilt sie in die Küche. Erst an der Tür lässt sie die kratzigen Worte heraus:
»Dankbarkeit ist etwas anderes als das Wort Dankeschön.«
Wie stets will sie ihm nicht zu nahe treten und wie stets, wenn sie freiwillig das Feld räumt, will sie nicht mehr über ein Thema sprechen. Es ist eine Art Schutz, ehe sie die Achtung verliert.
Er hatte keine Chance, etwas zu erwidern. Sie bleibt länger als nötig in der Küche und kommt mit dem dampfenden Essen und erstaunlich fröhlicher ins Zimmer zurück.
»Was sagst du nun? «
Es war ein Glück, dieses Fleisch erstanden zu haben, und dieses Glück gilt es zu sehen, nichts sonst.
Erst am Abend, als ihre Gemüter sich wieder beruhigt haben und die Kerzen ihnen jene Hilflosigkeit erhellen, in die man schuldlos geraten kann, erst dann finden ihre Gedanken noch einmal zurück zu dem Brief von John und dem, was die Zukunft noch bringen kann.
Es ist amüsant, wie Piet sich müht, seine ganze Güte nach außen zu kehren, sieht er einen Fehler ein. Zu sagen, »Liebling, du hast Recht«, käme ihm nie über die Lippen. Wenigstens hätte er doch sagen können, man müsse darüber sprechen oder man könne es Mutter Irma vorschlagen. Stattdessen sagt er: »John hat seinen Nutzen davon. Jeden Gang, jede Fahrt mit dem Auto bezahlt sie ihm. Ein schönes Taschengeld, und wer weiß, vielleicht …«
»Er ist doch weiß Gott nicht darauf angewiesen«, fällt sie ihm ins Wort.
»Du weiß, wie Erwin uns immer etwas aufgedrängt hat. Jetzt wird sie es tun, und er wird es nehmen, so wie wir es genommen haben.«
Selbstverständlich nimmt Piet ihre Worte als Kritik:
»Kennst du einen Menschen, der kein Geld braucht?«
Hat er von Geld gesprochen? Geld, Geld! Alle reden nur von Geld und nun auch Piet. Liegt es daran, weil sein Bruder John denkt, sie kämen als Schwerreiche aus dem Armenhaus der Welt zurück? Was glauben die nur alle? Wegen der paar Forumschecks wird man schief angesehen.
Das alles geht ihr so ungeordnet durch den Kopf, dass sie beinahe den Faden verliert.