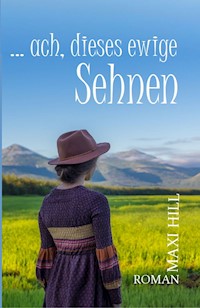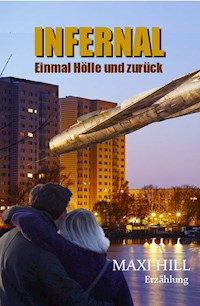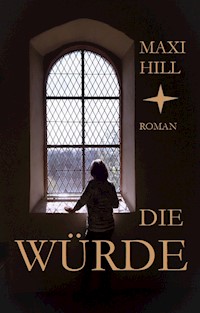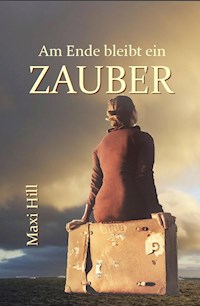Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten im Inferno erleben zwei junge Menschen ihre erste Liebe. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen der Last des gewöhnlichen Lebens und dem allgegenwärtigen Tod trotzen sie den Widrigkeiten ihrer Zeit. Als sich alles zum Guten zu wenden scheint, als der Lebenshunger den leeren Magen übertrumpft, geschieht doch noch das Unaussprechliche…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maxi Hill
Liebe, die auf Trümmern wächst
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DIE QUELLE MEINES WISSENS
EINE LIEBE IM VORHOF DER HÖLLE
ILSE
WERNER
EINE TRISTE ZEIT
LETZTE KRIEGSWEIHNACHT
EINE SCHÖNE BESCHERUNG
FRONTEINSATZ ?
EIN TREFFLICHER PLAN
MACHTLOS
AKTION DONNERSCHLAG
EINE UNHEIMLICHE BEGEGNUNG
DIE SCHWERE ZEIT
NOT-ZAMPERN
DIE RUSSEN KOMMEN
MAX
HOFFNUNG AUF LEBEN
LIEBE, BROT; TOT
QUELLEN
MAXI HILL
Impressum neobooks
DIE QUELLE MEINES WISSENS
Als absurd bezeichnen wir, was nicht möglich schien
und doch passiert ist.
Was aber möglich war und nicht passieren durfte,
schweigen wir zu Tode.
Während einer Bahnreise begegnet mir ein Mann russischer Herkunft. Zu meinem Erstaunen kennt er eine Geschichte aus meiner Stadt.
Noch folgen meine Gedanken dem Manne nicht. Ich versinke in Erinnerungen an meine Kindheit, als es die ersten Begegnungen mit den »Siegern« gab. Aber ich verliere mich auch in den Vorurteilen, die aus einer Zeit stammen, als die Sieger sich ungefragt nahmen, was sie sich zurecht erobert zu haben glaubten.
Ich möchte schamvoll versinken. Wie konnte ich angesichts eines amüsanten Plauderers daran denken? Diese Zeiten sind vorbei. Heute weiß man, es gab Grausamkeiten auf allen Seiten, das ist das Alphabet von Kriegen. Keine der Kriegsparteien hat je ein Recht, den anderen «das Böse» zu nennen. Leider lässt man auch heute überall dort, wo man vorgibt, den Frieden retten zu müssen, ausschließlich Waffen sprechen. Kein Frieden wird durch Krieg erreicht — jedenfalls nicht auf Dauer.
Der Mann erhebt sich — nicht kerzengerade, aber deutlich — reicht mir die Hand und sagt: »Ich heiße Sergeij. Deutsche Freunde sagen Serge zu mir … und meine Anja auch.« Serdsch spricht er.
Während der Mann redet, mustert er mich mit einem erwartungsvollen Blick. Und sofort erfahre ich, dass er gerade aus Bansin kommt, wo er mit seiner deutschen Frau eine Pension führt, die ihn in dieser Jahreszeit entbehren kann. Früher habe er ein gut florierendes Café direkt an der Promenade betrieben. Es musste einem bombastischen Hotelneubau weichen.
Ohne Übergang erzählt er in ruhigem Ton, dass er in Russland geboren ist — damals Sowjetunion, daran muss er vermutlich viele Deutsche erinnern. Er habe sein Land vor vielen Jahren verlassen, der Liebe wegen.
Vielleicht sei sein Großonkel Iwan Stepanowitsch schuld an dieser Entscheidung gewesen. Er habe der Familie oft von Deutschland erzählt, aber auch von der schweren Zeit, die die Völker — jedes auf seine Weise — durchgemacht haben. Die meisten Russen mögen Deutschland noch immer nicht.
Noch spricht er über die Deutschen von damals und was er über sie denkt. Er sagt, der Großonkel habe seiner Mutter von den «besseren Deutschen» berichtet, von Menschen, die sich weigerten, die hirnrissigen Befehle Hitlers oder dessen Vasallen zu befolgen.
Ich bleibe still, überdenke seine Worte, und mein Herz hämmert dabei sehr unangenehm. Es gelingt mir kaum, mich auf das Thema Krieg zu konzentrieren, das unausgesprochen über zwei völlig fremde Menschen hereingebrochen ist, wie die Sturzwelle, die ein kalbender Eisberg unvermittelt auslöst.
Sergeij redet inzwischen von etwas sehr Vertrautem, von etwas, wovon ich selbst vielleicht gesprochen hätte, wäre uns die überwundene Zeit nicht so ungestüm in den Sinn gekommen? Was gab den Ausschlag?
Ich denke nach, aber seine Worte sind stärker:
»Ihre Stadt hat schönes Theater. Jugendstil von altem Jahrhundert.«
»Oh, Sie kennen es?«
»Nein, nur Bild. Aber Iwan Stepanowitsch erzählt über Weigerung von Befehl: Vor Einzug von Rote Armee, Theater in Luft sprengen. War auch Munition dort gelagert.«
Ich sortiere die Worte in meinem Kopf und kann den Sinn kaum glauben. Ganz unverhofft kommt aus mir: »Oh, tut mir leid.« Ich hebe die Schultern, und es ist, als möchte ich die letzten drei Stunden wie lästigen Staub einfach abschütteln. Es ist beschämend, ich weiß davon nichts. »Ich sollte vielleicht dazu recherchieren.«
Er reicht mir die Visitenkarte von seiner Pension, und ich nicke schuldbewusst. Es ist nicht gesagt, dass man die alten Geschichten überhaupt aufbewahrt hat.
»Wenn Sie wissen mehr, ich habe Interesse.«
Wieder allein auf dem letzten Abschnitt meiner Reise sinne ich nach: Was mag einen fremden Menschen so sehr bewegen, dass er etwas aus seiner Erinnerung holt, wovon kaum ein Einheimischer etwas weiß.
Ich beschließe nachzuforschen, und vielleicht… ja, vielleicht schreibe ich auch darüber.
Nach Monate langer Recherche bin ich am Verzweifeln. Wohin ich auch gehe, was ich auch nutze, nirgendwo kann ich mehr über den Retter des Theaters erfahren als seinen Namen: Paul Geiseler.
War es eine Heldentat oder nur Zufall? In der Art, wie etwas zustande kommt, und in der Art, wie Menschen denken und warum sie so handeln, zeigt sich das Heldenhafte. Manchmal ist aber alleine das Gewissen schon ein Held. Und Geiselers Gewissen hatte ihn entscheiden lassen.
Meine Absicht, über den Mann zu schreiben, lege ich enttäuscht ein paar Jahre ad acta – bis…
Ja, bis mir der späte Zufall eine zierliche alte Dame mit silbernem Haar und graziler Gestalt zuführt. Sie sitzt in sich gekehrt, aber sehr aufrecht mir gegenüber. Ihre lichten Locken umspielen die Stirn und kräuseln sich über den Ohren. Ihr blaues Kostüm ist aus gutem Stoff, und die dunkelblauen Schuhe halten ihre Füße dicht beieinander. Sie sitzt da, als wartet sie darauf, dass der Fotograf kommt, um ein Porträt von ihr zu machen.
Ich kann nicht wegsehen und sie bemerkt mein Staunen. Wir lächeln uns zu, ehe sie sagt: »Heute geht es den Menschen so gut, und doch sind die Warteräume überfüllt.«
Wir kommen ins Gespräch über das Früher, das sie meint und an das die meisten alten Leute die stärksten Erinnerungen in sich tragen.
Wie durch göttliche Eingebung frage ich sie irgendwann nach der Sache mit dem Theater. Erst schaut sie mich merkwürdig an, dann legt sie ihren Kopf etwas schräg und besinnt sich: »Dieser Geiseler war sowas wie der Vorgesetzte von Werner.«
Und dann erzählt sie mir von diesem Werner, der mit dem Volkssturm im Theater Dienst zu tun hatte, bis es zu diesem Tage kam…
Ihre Stimme versagt für einen Moment. Aber dann erfahre ich eine Geschichte am Rande dessen, worum es mir ging. Es sollte Werners Geschichte sein, aber eigentlich ist es die Geschichte von Ilse Adams.
Ich werde jetzt ihre Geschichte erzählen. Stellvertretend für alle Menschen jener Zeit ist sie wert, aufgeschrieben zu werden. Es sind Schicksale, die Tausende Menschen erlebt haben könnten, die von der Welt längst vergessen sind.
EINE LIEBE IM VORHOF DER HÖLLE
Ich erzähle von einer jungen Liebe, von viel zu wenig Brot und ja, auch vom Tod. Der Retter des Theaters kommt nur am Rande drin vor.
Am Anfang stehen jene Worte, die Werner zu Ilse Adams gesagt hatte und die ich nach siebzig Jahren und mehreren Büchern über Menschen und Charaktere, über das Leben und das Dahinleben, mit gutem Gewissen niederschreiben kann:
»Die neue Welt wird nicht besser sein. Jeder wird wieder sein Recht behaupten. Und jeder wird Recht haben. «
ILSE
Der Vormittag war lang gewesen. Maria Adams war erschöpft und das Letzte, worauf sie jetzt Lust hatte, waren Fragen ihrer Chefin, warum sie niemals am Nachmittag länger bleiben konnte. Frau Heider stützte die Handballen in ihre Hüften und zeigte mit verbissenem Mund auf den Stapel unverpackter Kundenaufträge, die rechtzeitig vor Weihnachten an die Auftraggeber ausgeliefert werden mussten. Aus ihrem Gesicht war abzulesen, ob es Maria nicht selbst am Herzen läge, schließlich sei es ihre Arbeit.
Es war kein Problem für Maria, die vereinbarten Botengänge zu absolvieren. Nicht so, wie es schien.
Wenn Maria allerdings ihre Tochter Ilse nicht einspannen könnte, die täglich mit Kartons bepackt in alle Stadtteile lief und erledigte, was zu Marias Aufgabe als Modistin bei der Firma Heider gehörte, könnte sie das Zubrot aus dem nahen Trachtenladen nie und nimmer verdienen.
Wie würdest du mit dem schmalen Lohn der Heiders drei hungrige Mäuler stopfen können?
Maria erschrak bei ihrem Gedanken an drei Menschen. Niemals durfte sie auch nur so denken. Niemand durfte wissen, wo Max sich versteckte. Schon gar nicht, dass sie bisweilen für ihn sorgte. Kommunist zu sein war schlimmer als Sorbe oder Wende, und nicht arisch zu sein, war in dieser Zeit schlimm genug. Das wurde ihr nicht nur im Trachtenladen bewusst.
Max war vor zehn Jahren in einem Massen-Hochverrats-Prozess mit anderen Kommunisten zu beinahe zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie er sich aus der ständigen Polizeiaufsicht danach hatte befreien können, war Maria nicht klar, und Max sprach nicht darüber.
Ilse lief durch die Stadt, dem Markt entgegen. Es war kalt, aber noch trug sie ihre Spangenschuhe über dicken Wollsocken, die bis zu den Waden reichten und die ihre langbestrumpften Beine etwas mehr wärmten. Über ihr braunes, gescheiteltes Haar hatte sie eine Filzkappe gestülpt, eine, die fehlerhaft war, weshalb Frau Heider sie Ilse für einen Extra-Botengang geschenkt hatte. Wenn Frau Heider wüsste… Die meisten Kundengänge erledigte sie inzwischen für ihre Mutter — heimlich. Mutter sagte: »Die Heiders müssen ja nicht gleich misstrauisch werden.«
Ob es wegen dem Bissen Zubrot war, den Mutter im Trachtenladen verdiente, oder wegen Max? Oder wegen dem Trachtenladen als solchen? Schließlich kam Mutter aus dem Spreewald…
Was der Grund war, störte Ilse nicht. Sie hatte sich längst daran gewöhnt, alltäglich mit den Kartons und Tüten die Stadt zu durchstreifen. In dieser Zeit hatte sie keine andere Chance, als mit Hilfsarbeiten die Mutter zu unterstützen. Vielleicht, wenn der Endsieg endlich erreicht ist, kann sie ihren Wunschberuf erlernen — Frisörin.
Im Moment ginge das nicht, sagte die Mutter. Und irgendwie hatte sie vermutlich Recht. Die meisten Frauen trugen die Bunkerfrisur — eine von der Stirn nach oben aufgetürmte Haartolle, die mit Kämmchen zusammengehalten wurde. Für die modernen Brennscheren-Frisuren der feinen Damen reichten die Frisörinnen in den Salons der Stadt offenbar aus.
Ilse hüpfte fröhlich über die zugefrorenen Pfützen. Bald war sie an der Unterführung in der Dresdener Straße. Unter der Brücke stand ein Soldat, über die Brücke rollte ein Güterzug mit schwerer Fracht vollbeladen in Richtung Ost. Vermutlich Kriegsmaterial, um dem Rückzug der deutschen Truppen, den nur Max mit freudiger Genugtuung quittiert hatte, wieder Einhalt zu gebieten.
Von der Unterführung aus hatte sie nur noch die Hälfte des Weges vor sich. Vorerst, denn die Kunden, zu denen sie am Nachmittag die Waren bringen musste, wohnten überall in der Stadt verteilt. Einige sogar außerhalb. Seit ihr Fahrrad kaputt war, waren die Wege besonders lang und besonders beschwerlich. Max hatte versprochen, das klapprige Rad zu reparieren, aber es fehlte etwas an der Bremse, was sie dem Händler nicht erklären konnte. Und weil Max nicht selber gehen konnte …
Schon wieder Max. Mutter würde ihr zürnen, wenn sie auch nur den Anschein erweckte, Max gehöre zu ihnen… Sie wusste zwar, dass er nachts oft nicht in seinem Versteck war. Aber so richtig wusste sie nicht, wovor er sich versteckte und was er auf dem Kerbholz hatte. Wenn er aber nachts aus dem Keller verschwand, dann musste er schließlich Freunde haben, die auch mal etwas für ihn besorgen könnten.
Es half nichts, ohne ihr Fahrrad musste sie für unbestimmte Zeit zu Fuß gehen. Die Groschen für die Bahn sparte sie auf. Für das, was ihr die Botengänge zusätzlich einbrachten — sofern es nette Kundschaft war — konnte sie vielleicht mal wieder eine Kinokarte kaufen. Die Zeit war zum Versauern. Sogar das Theater hatte man kürzlich eingestellt. Auf den Tanzboden durfte sie noch nicht. Welche Freude blieb ihr also…?
Wenn die Oberen nicht wollten, dass die Jugend sich vergnügt, würden sie in dieser unsicheren Zeit keine teuren Filme drehen. Dann würden auch Filmschauspieler wie Heinz Rühmann, Hans Albers, Willi Fritsch und die vielen anderen zu einer Kriegsaufgabe verpflichtet werden.
In den Kammerspielen lief gerade «Wir machen Musik« mit Ilse Werner und Viktor de Kowa.
Ilse, was für ein schöner Name…Erst recht Ilse Werner. Und wie die pfeifen kann…
Manchmal, wenn Mutter es erlaubte, hörte sie Radio. Das war bald so wie Kino, wenn der Kopf nur genug Phantasie hatte. Sie musste den Film unbedingt sehen — allein ihres Namens Ilse wegen, und überhaupt. Musik brachte stets romantische Gefühle.
Wenn sie ihre Haare so wie Mutter kämmen würde, sähe sie vielleicht etwas älter aus, und niemand würde Anstoß daran nehmen, wenn sie, noch nicht achtzehnjährig, allein in einem Liebesfilm saß.
Sie trafen sich am Kaiser-Wilhelm-Platz. Die Mutter schaute sich mehrmals um, als gingen sie beide auf Diebestour. Ilse atmete auf. Es waren heute nur vier Pakete. Drei Hutschachteln und eine Tüte mit irgendwelchen Kragen oder anderen Modeaccessoires. Also würde es heute nicht bis zur Sperrstunde dauern. Auf der Liste standen vier Adressen, zwei in der Dresdener Straße. Die würde sie zuerst erledigen. Eine in der Promenade hinter der Stadtmauer — vermutlich eine der Villen, wo es durchaus mal wieder einen Groschen zusätzlich gab. Und eine im Hotel Berliner Hof direkt an der Bahnhofsbrücke. Die wollte sie zuletzt anlaufen und dann über den Bahnhofsberg zurück nach Hause gehen.
Das Haus sah genauso aus, wie Ilse es in der Erinnerung hatte. Eine weiße Villa, beinahe im griechischen Stil. Leider kannte sie sich nicht aus mit den architektonischen Epochen und Stilen. Jedenfalls wurde das Eingangsportal von Säulen gesäumt, die bis unters Dach reichten. Die Mutter hatte ihr eingebläut, bei den Villen in der Promenade und noch an anderen Orten niemals an den herrschaftlichen Türen zu läuten, immer zuerst danach zu schauen, ob es Boteneingänge gab. Und den leidigen Gruß sollte sie auch niemals vergessen…
Über die Stadt senkte sich kalter Dunst. Morgen früh könnte die Welt wie verzuckert aussehen, was Ilse normalerweise liebte. Nur eben jetzt nicht mehr, seit die Kohlen knapp waren und das Brennholz schwand. Die Leute rieben sich die Hände und stampften mit den kalten Füßen härter auf als gewöhnlich. Auch Flüche krochen aus den dampfenden Mündern. Der Park war jetzt trist. Die Bäume kahl und die Menschen, die zu anderen Zeiten hier flanierten, hatten sich vermutlich in die leidlich warmen Stuben zurückgezogen.
Ilse kam am Zaun an und blieb stehen. Alle Villen — aufgereiht wie eine Perlenkette — hatten Zäune und schmale Vorgärten, in denen sommers bunte Blumen und gut beschnittene Buchsbäume, aber auch übel riechender Wacholder den Prunk der Häuser umrahmten. Von einem Dienstboteneingang war nichts zu sehen. Es waren aber zwei Klingelknöpfe vorhanden. Ob der, den sie drückte, überhaupt funktionierte, konnte sie hier draußen nicht ausmachen. Es rührte sich nichts. Sie schaute die Promenade entlang. Was tun?
WERNER
Sie hatte seine Anwesenheit noch immer nicht bemerkt. Werner stand still seitlich hinter dem Verschlag, der den Dienstboteneingang vor Schnee und Regen schützte. So was Hübsches, dachte er. Dennoch hatte er das Gefühl, dass sich der junge Körper des Mädchens vor Kälte krümmte. Sie vergrub eine ihrer Hände in ihrer Manteltasche. Die andere, ohne Handschuh rotgefroren, trug zwei Pakete.
In einem Anflug von Mitleid lief Werner zum Tor, um nachzuschauen, warum sie nicht näher kam. Es war ihm, als fuhr sie wie in einem Schrecken zusammen.
»Heil Hitler«, stotterte sie verlegen. »Ich komme von Heiders Modeladen«, sagte bibbernd ihr Mund. »Bringe die Bestellung Ihrer Frau Mutter.«
»So, so«, erwiderte Werner und schluckte. Jetzt war er verlegen und wusste nicht recht, mit ihrer Vermutung umzugehen. »Dann wollen wir doch mal sehen…«, fiel ihm ein, nichts weiter.
Das Mädchen zögerte, den richtigen Karton auch nur anzudeuten. Vermutlich war sie an ein Botengeld gewöhnt, das er ihr freilich nicht geben konnte.
»Wenn du ein bisschen warten kannst…«, sagte er kühn, ohne zu wissen, was er damit bezweckte. Er wusste nur eines: Dieses Mädchen mit der feschen Kappe, die schräg über dem langen dunklen Haar saß, mit den dunklen Kulleraugen und den dunkelroten Socken, so rot, wie ihre Kappe, dieses Mädchen war das Abbild dessen, was er sich täglich anzuschauen vorstellen konnte.
In seinem Kopf wuchs blitzschnell ein kühner Plan.
»Sie wird gleich hier sein«, log er, genau wissend, wann die Frau des Hauses gedachte, zurück zu sein. Er gab ihr einen Wink und ging ein paar Schritte voraus. An der Ecke drehte er sich wieder um, ziemlich sicher, dass dieses schüchterne Kind ihm nicht so einfach folgen würde. Todsicher hat man ihr Gleiches eingeschärft wie ihm auch: Zurückhaltung.
»Du willst doch hier draußen nicht anfrieren?«
Ganz unbewusst zog er die rechte Braue hoch, was gewöhnlich wie eine freundliche Aufforderung wirkte. Sie schlug die Augen nieder, setzte aber einen Fuß vor den anderen, vorsichtig mit den Kartons jonglierend.
»Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir gleich den Hintereingang«, sagte er und gab seinem Gesicht einen hoffentlich verschlagenen Ausdruck. »Ist ja schließlich ein Botengang von dir, oder …?«
»Ich kann auch später noch einmal wiederkommen, wenn sie…«
»Nix da, es wird schon nicht so lange dauern wie der Endsieg.« Ob diese Bemerkung gut war? Er wusste es nicht, aber wenn er das Leben um ihn herum je richtig kapiert hat, dann waren diese Botengänger eher vorsichtig damit, auszuplaudern, was sie in herrschaftlichen Häusern erlebten. Auf jeden Fall musste er verhindern, dass sie doch noch einen Rückzieher machte. Er öffnete die Hintertür, ließ sie eintreten und ein paar Stufen tiefer steigen. Bei jeder Stufe zuckten ihre Füße, als wollte sie umkehren, doch die Wärme der Heizungsanlage, die er zu bedienen hatte, schlug ihnen gar zu wohlig entgegen. Ihm war, als entkrampfte sofort ihr Gesicht, und die Schultern streckten sich wieder jugendlich.
Werner griff beherzt nach den beiden Hutschachteln und ließ ihren Einwand nicht gelten. Sehr rasch führte er sie an der Tür vorbei, hinter der seine Bleibe war. Dann stieg er mutig die Treppe zum Vestibül hinauf.
Oben, noch ehe ihre Augen sich weiteten und wieder dieses Erstarren zu spüren war, reichte er ihr die Hand und sagte: »Ich bin Werner, und wer bist du?«
Und dann geschah das Unvorhersehbare. Beinahe prustete sie ihren Namen heraus, der doch gar keinen Grund zur Lächerlichkeit bot.
»Ich heiße Ilse.« Sie zupfte verlegen am Mantelkragen und gab ihrer Stimme einen belustigten Ton: »Ilse? Werner?« Ihm schien, als fragte sie etwas. Dass sie plötzlich aus ihrem kalt gefrorenen Gesicht strahlte wie der Morgenstern, kam keiner Frage gleich. »Da läuft gerade ein Film mit Ilse Werner, meinte ich…« Ihre Lippen bebten. »Verzeihung.«
»Gar nicht verziehen.« Werner fand immer mehr Gefallen an ihrer Natürlichkeit. »Wenn dir so viel an unseren beiden Namen liegt… Dann gehen wir gemeinsam in den Film…«
»Das darf ich nicht«, wiegelte sie ab. Vorerst musste er sich damit begnügen. Noch wollte er das süße Missverständnis, dem sie unterlag, nicht auflösen.
Im Vestibül angekommen, verschlug es Ilse den Atem. Das weiße Haus mit seinem Portal aus dorischen Säulen, mit schmückenden Kapitellen und Pilastern war nach der Meinung des jungen Herrn im Jugendstil errichtet, was Ilse schon wegen der Farbe nicht glauben konnte. Zeit, seine Weisheit anzuzweifeln, hatte sie nicht. Er erzählte gerade frei heraus, wie aufgeregt er war, als er in diesem Haus seine Bleibe bekommen habe — ein Glücksumstand in seiner Zwangslage. Etwas Besseres hätte er sich nie träumen lassen. Inzwischen wisse er, dass jeder Vorteil auch seinen Tribut fordere. Welchen Tribut einer wie er zu zahlen hatte, schien Ilse nicht klar zu sein. Und sie erfasste in ihrer Aufregung den Zweck nicht, den Werner verfolgt hatte.
Das Bild, das sich Ilse in der großen Vorhalle bot, verschlug ihr den Atem. Zwei prächtige Säulen am Treppenende strebten bis unters Dach und trugen eine Kuppel aus farbigem Glas, das jedem Licht den Schein der Sonne verlieh. Der Fußboden war — wie auch die Säulen — aus italienischem Marmor gearbeitet. Diese Pracht kannte Ilse nur von Bildern aus Schlössern und von Hotels, an denen sie immer verschämt vorbeigeschlendert war, wenn nicht, wie gerade heute, einmal ein Auftrag von dort kam. Die Treppe beschrieb einen Halbkreis, und die Stufen trugen dasselbe feine, rötliche Muster im sandfarbenen Marmor wie der Fußboden der Vorhalle. Hinter einer vorgelagerten Wand seitlich vom Portal auf einem Sockel drei kunstvolle Figuren aus weißem Porzellan.
»Ist das alles echt?«, platzte sie heraus und ärgert sich sofort über ihre naive Neugier.
»Ist es denn schön?«, fragte der junge Herr und lächelte verschlagen über Ilses Atemlosigkeit.
»Sehr!«
»Dann ist es auch echt.«
Sie drehte sich vor Bewunderung im Kreis und ihr wurde schwindelig davon. Dieses Haus ist ein Vermögen wert, dachte sie, und sie dachte, wie schön, dass sie so etwas auch einmal von innen sehen darf. »Es gehörte mal einem Juden«, sagte er so leise, dass sie kaum glaubte, richtig gehört zu haben. »Der ist jetzt über ’n Jordan…«
Für einen Moment war sie wie benommen. Jordan, wenn sie richtig gelernt hat bei Studienrat Wegener, floss der Jordan durch Indien. Aber so manch ein Zeitgenosse benutzte den heiligen Fluss als Sinnbild für Unwiederbringliches.
»Hier wohnt schließlich jetzt der Chef von den Focke-Wulf-Flugzeugwerken, draußen am Flugplatz. Weißt du, wo die FW190 montiert wird. Das ist ein Jagdflugzeug und Aufklärer für die Luftwaffe,... «
Seine Erklärung rührte Ilse nicht, das hatte er vermutlich aus ihren Augen lesen können oder wer weiß woher. Wohl deshalb fügte er vermutlich noch eine leidenschaftliche Verteidigung an: »Leuten mit so kriegswichtigen Aufgaben kann man nicht irgendeine Kaschemme anbieten…«
Hinter ihrer Stirn machte es klick. Sie musste schnell wieder gehen, durfte sich nicht zu lange allein mit dem jungen Herrn unterhalten. Was würde Mutter dazu sagen, oder gar Max? Was sollte man überhaupt von ihr denken?
Bevor sie das sagte, war er nach vorn gesprungen und hatte bereits die Tür zu einem der Räume geöffnet. Dabei war ihr aufgefallen, dass er leicht hinkte, nicht offensichtlich, vermutlich nur, wenn er einen Schmerz wahrnahm, aber seine Umwelt nicht.
Der Salon, wie Werner ihn nannte, war in jenem hellen Beige gehalten wie der Grundton des Marmors in der Vorhalle. Man spürte viel Geschmack und viel Geld hinter den Dingen. Mitten im Raum eine Polstergruppe aus feinstem Leder, mit Kissen bestückt. Die Accessoires des Raumes passten sich trefflich dem edlen Marmor an, aus dem auch der Tisch in der Mitte des Raumes bestand. Auch den Kamin zierte eine Kante aus farbigen Steinen. An der Wand links der Tür standen halbhohe Schränke mit Leuchtern. Zwischen den hohen Fenstern streckten sich schmale Vitrinen gefüllt mit Nippes und Büchern..