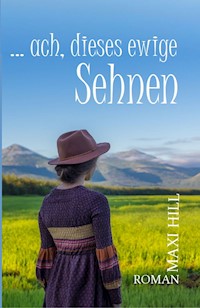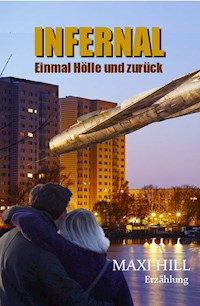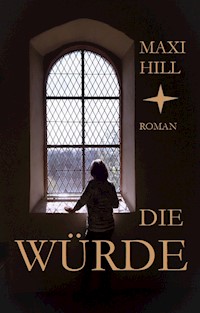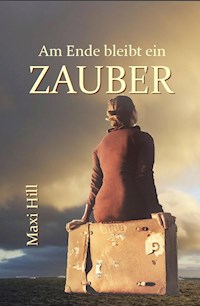Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Spreewald-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin und Buchautorin Rita Georgi macht in ihrer Wahlheimat – einem kleinen Dorf im Spreewald – kuriose, ernsthafte aber auch erschreckend beispiellose Erfahrungen. Stoff genug für eine Trilogie, deren autarke Teile so verschieden sind wie das Leben. Dieses Mal steht Rita vor einem seltenen Rätsel: Erlebt ein junges Mädchen tatsächlich ihre Wiedergeburt? Seit Susan Hellmann aus dem Koma erwacht und ins diesseitige Leben zurückgekehrt ist, spricht die aufgeklärte und weltoffene Journalistin und Buchautorin Rita Georgi trotz besseren Wissens bisweilen von Susans Wiedergeburt. Eine ganz andere Dimension bekommt dieses Wort in dem Moment, als Rita die junge Volontärin Tiombe zu betreuen hat – eine dunkelhäutige Schönheit Tiombe. , die Glänzende, die Strahlende, so heißt es in der Sprache ihrer Vorfahren. Und ebenso ist Tiombes Wesen, bis sie mit Rita einen Ausflug zum Schloss und Park des Fürsten Pückler unternimmt. Die schöne junge Frau mit der kupferbraunen Haut trägt ein Wissen in sich, wie es nur Machbuba, die blutjunge, abessinische Sklavin und Kinds-Geliebte des Fürsten vor 170 Jahren mit in ihr Grab in Muskau genommen haben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maxi Hill
Zwei Seelen der Tiombe van R.
Spreewald-Trilogie Teil 3: Roman über «Wiedergeburt»
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Die Rückführung
Die Vorladung zum Chef – Monate zuvor
Tiombe van Randhal
Impuls des Lebens
Heimisch?
Tee-ohm-bay
Schloss und Park des Fürsten Pückler
Ich war Bilié
Den Geist heilen
Ein geheimnisvolles Buch
Zurück in das frühere Leben
Sorge um Tiombe
Das Menschliche
Die Probe in Muskau
Die kleine Frau und die Wiedergeburt
Im Verlag
Ein Interview
Der besondere Termin bei Miriam
Streit der Experten
Eine TV-Dokumentation
Schädlicher Aktionismus
Der Vater
Die Aussprache
Die Wahrheit
Impressum neobooks
Prolog
Die junge Journalistin Rita Georgi macht in ihrer Wahlheimat – einem kleinen Dorf im Spreewald – kuriose, ernsthafte, aber auch erschreckend beispiellose Erfahrungen.
Dieses Mal steht sie vor einem seltenen Rätsel:
Erlebt ein junges Mädchen tatsächlich ihre Wiedergeburt?
Teil 3 der Trilogie: Zwei Seelen der Tiombe van R.
Seit Susan Hellmann aus dem Koma erwacht und ins diesseitige Leben zurückgekehrt ist, spricht die aufgeklärte und weltoffene Journalistin und Buchautorin Rita Georgi trotz besseren Wissens bisweilen von Susans Wiedergeburt.
Eine ganz andere Dimension bekommt dieses Wort in dem Moment, als Rita die junge Volontärin Tiombe zu betreuen hat – eine dunkelhäutige Schönheit. Tiombe, die Glänzende, die Strahlende, so heißt es in der Sprache ihrer Vorfahren. Und ebenso ist Tiombes Wesen, bis sie mit Rita einen Ausflug zum Schloss und Park des Fürsten Pückler unternimmt. Die schöne junge Frau mit der kupferbraunen Haut trägt ein Wissen in sich, wie es nur Machbuba, die blutjunge, abessinische Sklavin und Kinds-Geliebte des Fürsten vor 170 Jahren mit in ihr Grab in Muskau genommen haben kann.
Die Rückführung
Im kleinen Spreewaldhaus ist es still. Duftschwaden von Bergamotte wälzen sich durch die Räume der kleinen Frau, mischen den Geruch ölgetränkter Bohlen, die die Wände des uralten Fachwerks zusammenhalten. Durch die Butzenscheiben sieht man die Kante vom wulstigen Schilfdach. Feuchtigkeit perlt heraus, glitzert im Licht des Tages.
Drinnen das Abbild göttlicher Ungerechtigkeit: Das Mädchen Tiombe, vom Schöpfer üppig mit Schönheit bedacht. Ein Wesen wie Milch und Muskat, mit Lippen wie Orchideen und Wimpern so dicht, dass keine Träne den Weg über die Wange findet.
Und Miriam. Sie ist alt und klein. In ihrer scheinbaren Unscheinbarkeit von großem Wert für das Mädchen.
Miriam spricht leise, nachdrücklich, mit langen Pausen.
»Du gehst nun zurück in die Zeit, an die du dich erinnern willst. …
Du fühlst dich wohl und gehst den Weg von Anfang an. …Fange jetzt deine Reise an und erzähle mir laut und deutlich was du siehst und was du fühlst.«
Die Lider des Mädchens sind geschlossen, darunter rollen die Augäpfel hin und her. Der Körper des Mädchens glänzt kupfern. Es scheint zu schweben.
Langes Schweigen. Dann kommen die Worte schwer über die jungen Lippen.
»Ich trete in das Zimmer und sehe das Bild an der Wand. Ein Gefühl kommt über mich … ich sehe mich ... im Spiegel …
Dieser Spiegel …! Er hat ihn anbringen lassen. In meiner Badestube. Der Fürst erwartet mich gut gepflegt und wohlriechend…«
Zwischen schwerem Atem rollen an diesem Nachmittag viele unglaubliche Worte aus dem jungen Mund...
Die Journalistin Rita Georgi beobachtet still, was da vor sich geht. Sie hadert mit sich: Ist es Zufall? Oder hat Bestimmung dieses fremde Mädchen Tiombe hier her in die Lausitz gezogen?
Ausgerechnet Machbuba? Rita kennt die Geschichte der dunkelhäutigen Sklavin des Fürsten Pückler. Der Geliebten. Der Kindsfrau. Aber sie weiß nicht, was Wahrheit und was Dichtung ist.
Als die junge Stimme versagt, quillt Feuchte unter den dichten Wimpern heraus.
Zutiefst beeindruckt von dem, was sie gesehen und gehört hat, ist Rita gezwungen, sich Fragen zu stellen: Herrscht in dem Mädchen eine Mischung zwischen erinnern und vorstellen?
Ist es Wahn?
Ist es geniale Kreativität?
Kann die Trance zu Irrtümern führen?
Ein Abgleich mit der Realität ist ausgeschlossen. Das Bewusstsein ist wehrlos gemacht; das hat sie gelesen.
Gibt es unbewusste Erinnerungen tief in der Psyche des Menschen verborgen? Erinnerungen an ein früheres Leben? Wie schafft es Miriam, dass Tiombe in eine Zeit hineinschaut, die weit vor ihrer liegt?
In den letzten Wochen war Rita dem Mädchen zugetan, hat sich fast liebevoll in sie eingelebt. Nur ihr wacher Verstand versucht unaufhörlich zu erklären: Das Erlebte kann nach menschlichem Ermessen gar nicht sein.
Ist menschliches Ermessen der Weisheit letzter Schluss? Versucht nicht die Metaphysik seit Jahrhunderten zu entdecken, was unerkannt in uns liegt? Wenn Zugvögel auf geheimnisvolle Weise ihre Wanderrouten von Geburt an erkennen, warum sollte der Mensch nicht ähnliche Fähigkeiten in sich tragen?
Doch dann kommt Rita ein schlimmer Satz in den Sinn, den Tiombe zuweilen auf den Lippen trägt und in dem das uralte Wort Bastard zu hören ist. Rührt dieser Satz aus einem früheren Leben?
Die Vorladung zum Chef – Monate zuvor
Dieser Morgen kurz vor Ostern ist nicht gemacht für dolce far niente, fürs süße Nichtstun. Das Thermometer steht bei acht Grad über Null, doch es fühlt sich eisig an. Die Hoffnung auf einen lauen Frühlingstag erstarrt. Auf den Wiesen westlich vom Körber-Hof tragen die Jungen eifrig Holz und Gestrüpp heran. Das Osterfeuer soll hier lodern, weil am Hafen noch Land unter ist.
Gut, dass Timi schon für ein paar Stunden in die Kita gebracht werden kann. Lubina Kieschnick geht mit den Kindern täglich spazieren.
Wie ihr der Wind so entgegen bläst, kommt Rita der kühle Märztag in den Sinn, an dem Susan Hellmann ins Koma fiel. Es waren zwei aufregende Jahre. Und auch fruchtbringende. Ihren Roman: «2 Leben der Susan H.» hätte sie ohne diese Erfahrung niemals schreiben können. Das letzte Jahr war dann das wirklich gute für alle. In Rita ist Zuversicht, dass es so bleiben wird.
In ihrem Job hat sie ihr Auskommen und reichlich zu tun. Das Bücherschreiben leistet sie sich dennoch. Ihre Arbeit befruchtet das Hobby. »Hoffnung«, hat eine Leserin gesagt, »Hoffnung gibt mir Ihr Roman über die komatöse Susan, die – wiedergeboren - eine Wendung ihres Wesens genommen hat, zu sich selbst, zu einem sinnerfüllten Leben.«
Jens belächelt die Sache mit der Wiedergeburt bei Susans Schicksal, weil Wiedergeburt immer den Tod voraussetzt und zudem nicht vernünftig definiert sei.
Warum sollte sie die Rückkehr aus einer anderen Dimension des Lebens nicht als Wiedergeburt bezeichnen? Susans Horizont ist jetzt weiter als je zuvor, ihr Wesen sanfter, logischer, konsequenter.
Wer sagt gewiss, ob es noch ihr altes Wesen ist?
Im Haus ist es gemütlich warm. Jens arbeitet im oberen Stock am neuen Konzept für die touristische Vermarktung, und auf ihrem Laptop erscheint die Mail mit der Einladung zum Redaktions-Chef. Im Duktus eine Vorladung.
Der Tag hat so gut angefangen ... Sie weiß nicht, ob es Groll ist, was sie spürt.
Den Absprung vom Journalismus will sie nicht – noch nicht - obwohl ihr der herrische Ton wieder mal heftig an die Nieren geht.
Sie scrollt die Sätze der E-Mail nach oben und liest weiter. Eine junge Volontärin durchlaufe diverse Bereiche und soll nun auch das operative Geschäft im Umland kennen lernen.
Ich wette - ein Anhängsel des Chefs, mitgebracht aus den Hochburgen des Westadels, der Hautevolee, der Hautefinance, der Haute Couture? Hätte er sich für eine von hier persönlich ins Zeug gelegt?
Ungewöhnlich gereizt schließt sie die Datei und geht auf logout.
Für Volontärsbetreuung hat er schließlich gut bezahlte Festangestellte.
Schon hält sie den Hörer in der Hand, legt aber rasch wieder auf.
Mit einer Menge guten Willens und nach einer Phase des Nachdenkens kann sie sich zu dem Gespräch durchringen. Vielleicht sieht sie Mark dann wieder einmal. Inzwischen kann sie freier mit ihm umgehen, schließlich waren sie bis zum Zerwürfnis während Susans Koma einmal gute Kollegen.
Auch wenn es ihr widerstrebt, vor dem Westfalen die Befehlsempfängerin zu spielen, es gibt einen alten Grundsatz: Sage nie alles, was du weißt, aber zeige allen, was du kannst.
Vor der «Audienz» geht sie zur Kantine in der Hoffnung, dort auf ein paar Kollegen zu treffen. Freilich weiß sie, wie wenig Zeit für Pausen bleibt. Wie gewöhnlich wechselt man allgemeine Worte, wünscht sich nur Gutes und tut sich nicht weh. Mark sieht sie nicht. Später, als er im Mehrzweck-Büro aufkreuzt, das sie sich mit anderen Pauschalisten teilt, redet er beinahe wie früher. Das meiste weiß sie:
Mark wohnt inzwischen mit seiner Geliebten Inny im Haus In Lücke in Alt Zechau. Sie sehen einander kaum, einer geht wohl dem anderen aus dem Wege. Nach inneren Kämpfen brachte sie es irgendwann fertig, Mark nachzusehen, dass er Susans Zustand zwischen Leben und Tod beenden wollte. Verstehen kann sie es bis heute nicht. Marks Verhalten als Zwangslage zu begreifen, gelingt ihr besser. Irgendwann wollte sie mit ihm darüber reden. Beim bloßen Vorsatz ist es geblieben. Vielleicht, weil sie spürt, dass er mit Inny glücklicher ist. Seither haben zwei Menschen ihre Wiedergeburt in einem glücklicheren Leben erlebt. Auch in Susans Leben ist endlich echtes Glück gekommen..
Mark sitzt bei ihr. Sein ebenes Gesicht mit den hellblauen Augen unter exakt geschnittenem Haar lässt Rita die kleinen Scharmützel vergessen. Für menschliches Urteil ist der Ausgang entscheidend, nichts sonst.
»Audienz beim Chef also.« Marks Stimme klingt fremd, beinahe warnend. Einen Moment lang kann sie aus seinem Gesicht nichts erkennen. Selbst wenn das Lauern seiner Augen nur ihrer Einbildung geschuldet ist, muss sie jedem weiteren Wort zuvorkommen.
»Es ist eine dienstliche Vorladung. Marquardt ist nicht Hellmann.«
Es gibt viele Tage, an denen ihr zum Scherzen zumute ist. Heute ist es nur der Versuch, Mark das Gefühl von Vergeben erkennen zu lassen. In ihrem Inneren aber hat sie nie vergessen, wie Mark ihr damals deutliche Avancen gemacht hat. Irgendwie schaut er sie sofort um einiges verwegener an und genau so klingen seine Worte:
»Du kleines Miststück! Das ist so lange her …«
Für diesen Moment ist Rita froh, als kleines Miststück zu gelten. Das lenkt ihre Gedanken von dem Mann ab, den sie – zugegeben - einmal sehr mochte. Womöglich wäre es noch immer so, hätte sie nicht sein Bild des Erbarmungslosen überrannt. Ein Ausnahmezustand? Sie möchte es glauben. Susan war in ihrer Hinfälligkeit nicht mehr das, was er sich erträumt hatte.
Sie kann sehen, wie seine Nasenflügel aufblähen, wie seine Lippen ein Zittern unterdrücken und seine Fingerknöchel gegeneinander reiben. Würde sie ihn provozierten, käme es nicht zu jener Normalität, die sie anstrebt. Ihre Abreibung als Miststück hat sie weg. Was soll jetzt noch kommen?
»Wenn es um junge Frauen geht, weißt du doch bestens Bescheid. Was ist das für eine Volontärin, die der Chef…?«
»Ach, die kleine Randhal!« Sein überraschter Blick ist nicht zu übersehen. »Du verpasst da draußen eine Menge.« Seine alte Spielregel, den Tausendsassa zu mimen, funktioniert noch immer, das merkte sie jetzt. »Über die Randhal hält der Alte die Hände. Aber irgendetwas ist da am Laufen…«
In Marks Augen sieht sie kleine Funken, die sie nicht deuten kann. Begeisterung oder Warnung. Besser, wenn er schweigt. Die Begeisterung für junge Frauen sollte dem Schwerenöter endlich abhanden kommen, Inny zuliebe. Zudem soll es ja Mädchen geben, die die Chance ihrer Karriere mehr bedeuten als die Chance auf ein kurzes Abenteuer mit dem Schönling Mark Hellmann. Es wird sich zeigen, aus welchem Holz diese Tiombe ist.
Eines aber zeigt sich schon jetzt. Sie hat eine sensible Stelle berührt, das spürt sie, sobald sie Mark ansieht.
Eine halbe Stunde später wird ihr klar, was Mark gemeint haben könnte.
»Ich übertrage Ihnen die fachliche Anleitung«, sagt der Westfale.
»Wie soll das gehen? Mein Gebiet ist nicht diese Stadt.«
»Ihnen fällt schon etwas ein. Tiombe ist außerdem motorisiert. Sie ist eine gute Fahrerin. Großstadterprobt.«
Lapidare Argumente aus dem profanen Leben haben keine Chance bei Marquardt. Die Aufgabe ist ebenso schnell abgesteckt, dennoch wittert Rita, dass sie die Erwartung des Chefs überfordern könnte.
Interviewtechnik. Storytelling. Überschrift – Bildunterschrift – Vorspann. Auch - das Feature – Themen anschaulich zu machen, kann sie bei ihr lernen. Aber Nachrichtenauswahl oder das Redigieren und vieles andere wird im Verlagshaus gelehrt. Zuerst wird sie dem Mädchen die Grundlagen eines Porträts beibringen. Das gibt ihre momentane Arbeit her.
Als alles besprochen ist, bittet Marquardt die Sekretärin, das Mädchen zu rufen.
Tiombe Randhal ist eine exotische junge Frau, bei deren Anblick einem der Atem stockt. Sie ist das Abbild göttlicher Ungerechtigkeit, die der Schöpfer dem Rest der Frauen zumutet. Dieses Mädchen ist mit Schönheit überworfen. Ihre Haut glänzt kupfern und ihr Haar sieht nach Meisterschnitt aus. Rita schaut genau hin und muss zugeben: pure Anmut. Über alles andere kann sie sich noch kein Urteil erlauben.
Ist das Gesicht so starr vor Schönheit? Gewiss nicht. Froh über den Wechsel ist das junge Ding ganz bestimmt nicht.
Später im Wagen sieht sie die Sache wieder anders: Waren auch Marquardts Worte eine Warnung? Tiombe sei nicht nur reizvoll, sie sei auch sehr klug, mit großer Auffassungsgabe ausgestattet und sehr selbstsicher. Nur bisweilen verliere sie sich im Zorn, den man ihrer negriden Abstammung zuschreibe und deshalb auch hier wohlwollend übersehe. Zu alldem geselle sich aber eine ungewöhnliche Demut, sobald Tiombe spüre, einen guten Menschen enttäuscht oder gar verletzt zu haben.
Warnung oder Rechtfertigung?
C´est la vie: Rita hebt die Schultern und startet den Wagen. Wenigstens der Nachmittag braucht jetzt etwas Erfreuliches, wenn schon soviel Zeit unnütz dahin geflossen ist. Sie atmet tief durch und überträgt den Schub auf ihr rechtes Bein. Timi und Jens werden sie wieder aufmuntern.
Tiombe van Randhal
»Du solltest jetzt fahren«, sagt Jens. Leicht haben sie sich ihre Entscheidung nicht gemacht. Ein solcher Schritt ist gut zu überlegen. Beider gehören sie zu der Sorte Menschen, die ihre Arbeit quasi im Hause erledigen, nie wirklich Abstand finden. Mit einer Fremden wird das alles nicht leichter. Zum Glück ist Tiombe Randhal eine vom Fach.
Es ist kurz vor zwei Uhr am Mittag und Rita hat versprochen, gegen zwei Uhr dazusein.
Das Osterfest hat sein Tribut gefordert. Zum ersten Mal waren sie mit Timi auf die Insel Rügen gefahren, um die Eltern von Jens zu besuchen. Jetzt, wo das alte Schilfdach-Haus inmitten des Dorfes zum Museum geworden ist, mögen die beiden Alten nicht mehr in Alt Zechau übernachten. Nicht einmal die Gästezimmer im Körberhof lassen sie gelten.
Jens hat Timi aus der Kita geholt und nun schläft der Kleine. Es gibt keinen Grund mehr für Rita, noch länger zu zögern. Er zwinkert ihr zu. Ein unbekümmerter, fröhlicher Mensch, denkt sie und zieht die Wagentür zu. Auffallend gut aussehend, dazu sportlich und vielseitig wie kaum jemand in diesem Dorf, wie keiner unter ihren besten Freunden. Was hatte sie bloß für ein Glück. Er hätte auch sagen können: Mit der kleinen Mara war ihr Leben schon ein anderes geworden. Was soll ein erwachsener Mensch ihnen an Einschränkungen aufbürden.
Rita und Jens hatten es sich vor Jahren gegenseitig schwer gemacht, bis sie dahinter kamen, einander zu achten und zu lieben. Danach hatten sie eine unheimlich verliebte Zeit. Beide dachten, es könne nicht ewig so weiter gehen.
Ihre Verliebtheit ist noch immer Programm, obgleich ihre Stunden höchster körperlicher Lust langsam abnehmen; diametral zum ansteigen Lebensalter ihres Söhnchens Timi. Das liegt vielleicht an den offenen Türen im ganzen Haus. Feischliche Liebe ist nicht lautlos.
Die offenen Türen hatte keiner von beiden anzusprechen gewagt, als ihre Entscheidung für einen jungen Hausgast auf Zeit fiel. Ihre kleinen Zweifel verbot sie sich. Diese Tiombe ist sehr reizvoll für die Augen eines Mannes, da kann sie selbst für Jens nicht die Hand ins Feuer legen.
Die Atmosphäre ist noch immer gespannt, als Tiombe mit ihrem Koffer in den Wagen gestiegen ist. Nicht einmal Ritas wohlmeinende Geste, sie möge vorn Platz nehmen, weil es sich so angenehmer plaudern lässt, löst die Züge in Tiombes Gesicht. Man könnte meinen, sie fühlt sich auf dem Wege zum Schafott.
»Du hast richtig Glück«, sagt Rita. Der Blick des Mädchens ist unklar. Ablehnend? Staunend? Respektlos, wie ihre Worte:
»Ich glaube nicht daran, dass sich Menschen verbünden, um einen Bastard wie mich glücklich zu machen.«
Sie hat die Schrecklichkeit wohl gehört, geht aber nicht darauf ein. Die Jugend ist heute unberechenbar. Provokant und wenig dankbar. Der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Undank ist, dass sich Dankbarkeit in Grenzen hält, denkt Rita. Aber das wird sie dem halben Kind nicht sagen. Was sie betrifft, erwartet sie keine Dankbarkeit. Sie hat einen pragmatischen Grund, die Bürde eines Untermieters auf sich zu nehmen. Und der ist legitim. Aber sie wird einen Teufel tun, über diesen Grund zu reden.
»Ich meine, eine wesentliche Voraussetzung für ein Volontariat ist - zumeist jedenfalls - ein abgeschlossenes Studium. Du kommst vom Gymnasium. Das ist schon ein Glücksfall. Wo willst du denn danach studieren?«
»Berlin.«
»Die freie Journalistenschule?«
»Egal. Hauptsache studieren.«
»Weder Journalist noch Redakteur sind geschützte Berufsbezeichnungen. Und es gibt auch keine geregelte Berufsausbildung. Die einen machen es so, und die anderen so. Du hast eben das Glück, es so zu machen, wie du es offenbar willst. Aber stell dir das Volontariat nicht als Ausbildung vor. De facto bist du jetzt Jungredakteur …«, Rita lächelt, um die Schärfe, die in ihr steckt und gegen die sie nicht ankommt, aus der Stimme zu nehmen, »…mit ein bisschen Narrenfreiheit vielleicht, mit größerer Fehlertoleranz. Aber Jungredakteur.«
»Und warum bin ich dann … ich meine, warum musst du mich ausbilden.«
»Ich bilde dich nicht aus. Du bist von Anfang an in das Netzwerk des Verlages eingebunden. Du wirst weiterhin alle Bereiche durchlaufen. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Du wirst so viel leichter entscheiden können, in welcher Richtung du studieren willst. Allerdings kommen auf einen Studienplatz bis zu eintausend Bewerber.«
Tiombe zuckt mit der Schulter, als schnippe sie das Problem leichtfertig hinweg, bis sie ihren Irrtum erkennt.
»Was heißt denn: in welcher Richtung? Ich will Journalismus studieren. Nichts weiter.«
»Heute ist eine spezielle Ausbildung von großem Vorteil. Ein fachlich versierter Journalist wird den Anforderungen besser gerecht. Er hat auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Keine Frage. In den meisten Verlagen gibt es `ne Menge Freie - aus der Wirtschaft, der Politik, sogar der Medizin - die auf Journalismus umsattelten. Deren Fachkompetenz ist unschlagbar. Mark Hellmann zum Beispiel ist ausgebildeter Fotograf. Er hat im dualen System seinen Abschluss gemacht, um nebenbei Geld zu verdienen. Jetzt arbeitet er wie jeder andere Redakteur auch. Das richtige Schreiben gehört ohnehin zum Allgemeinwissen. Es muss nur geschliffen werden und auf das Medium abgestimmt. Aber das lernt man von denen die es können besser als in jeder Schule.«
Tiombe lehnt sich demonstrativ nach hinten: »Aha. Nun weiß ich `s ja.«
Die Pause fällt unmerklich länger aus als normal, bis Rita weiter spricht: »Die Zeit im Verlag wird dir helfen herauszufinden, welcher Neigung du entsprichst. Du hast noch Zeit, über deine Spezialisierung nachzudenken. Das ist der Vorteil, den ich Glück nannte.«
Normalerweise hätte Rita jeden anderen Menschen seine Grillen ausleben lassen, bei Tiombe geht es nicht. Entweder sie finden sich so zusammen, dass sie eine Zeit lang unter einem Dach leben können, oder einer von ihnen muss täglich zwei Stunden mehr Arbeitszeit opfern. Sie, um zum Verlag zu fahren, Tiombe, um zu Ritas Haupteinsatzgebiet hier im Spreewald zu kommen. Ein Mehr an Zeit wird sie ihrer Familie nicht zumuten.
Bei ihrem ersten gemeinsamen Arbeitstag im Verlag hat sie dummerweise eine Regel gebrochen, was ihr von Minute zu Minute immer bewusster wird. Sie hat dem Mädchen das Du angeboten, weil sie doch für einige Zeit in ihrem Hause wohnen wird. Es siezt sich so schlecht am Küchentisch.
Vielleicht aber war gerade das der Anlass für Tiombe gewesen, über ihre familiären Dinge zu reden. Nicht gerade ausführlich; es war auch so schon bedrückend genug. Rita weiß jetzt, dass Tiombe über Ostern zu Hause bei ihrem Vater war, und sie weiß, dass sie nur noch den Vater hat. Zwischen den Worten und in ihren Gesten konnte Rita erkennen, dass sie ihren Vater nicht sonderlich liebt.
Die Stadt liegt schon lange hinter ihnen und Rita denkt über das Gespräch nach, das sie mit Tiombe geführt hat. Es war ihr vorgekommen, als sei es kein so angespanntes gewesen wie dieses.
»Hast du zu deiner Mutter noch regelmäßig Kontakt?«, fragt sie irgendwann.
»Er lässt es nicht zu«, kommt kurz. Zu kurz.
Rita wirft ihren Kopf herum, muss sich disziplinieren und auf den fließenden Verkehr achten. Dennoch wird ihr sofort klar, warum das Mädchen seine Fröhlichkeit hinter dieser griesgrämigen Maske verbirgt. Und sie kann sehr fröhlich sein, das hat Rita schon im Verlag kennen gelernt. Wahrscheinlich war es kein schönes Osterfest für das Mädchen. Falls sie ihren Vater wirklich nicht liebt, dann gewiss nicht. Wenn Rita doch nur einen Schimmer davon gehabt hätte.
»Wenn du reden willst, wir haben vierzig Minuten Fahrzeit vor uns.«
»Ich habe nicht das Bedürfnis über meinen Vater zu reden, falls du das meinst.« Endlich lächelt sie so engelsgleich, dass Rita alle Bedenken über Bord werfen könnte, lägen nicht Tiombes Hände verkrampft in ihrem Schoß, färbten sich nicht die Knöchel hell und nehme der Stoff ihrer Jacke nicht schon tiefe Knitterfalten an.
»Darf ich?« Tiombe greift nach dem Knopf des Radios und Rita weiß, dass damit jede Unterhaltung stirbt. Wenn überhaupt, dann sprechen sie ab jetzt über irgendein Lied, das man dort abspielt, oder über einen dieser hirnlosen Straßen-Kommentare, wie sie von den letzten Tagen vor Ostern noch in ihrer Erinnerung sind:
»Was halten Sie vom Fasten?«
»Was gefällt Ihnen am Frühling?«
»Glauben Sie an die Wiedergeburt von Jesus Christus?«
Ohne ihre Stimme zu heben, beginnt sie zu erzählen, was ihr gerade einfällt. Zuerst dreht das Mädchen das Radio leiser, dann ganz aus. Auf geheimnisvolle Weise bessert sich Tiombes Laune. Sie lachen und scherzen über die komische Sage, die Rita über den Spreewald eingefallen ist, über die Ochsen des Teufels, die ihm nicht gehorchten und das Land mit dem Pflug schrecklich zerfurchten, dass fortan das Wasser der Spree in Tausenden Fließen verzweigt durch die Wälder und Auen floss. Ab Burg zählt Rita die kleinen Brücken, unter denen fast unbemerkt Wasseradern verlaufen. Achtzehn allein zwischen Burg und Byhleguhre.
Nie zuvor ist ein Mensch so rasant aus bitterer Griesgrämigkeit zu einem liebevollen, freundlichen Wesen mutiert, das sehr rücksichtsvoll nach diesem und jenem fragt, dessen Augen funkeln und dessen schneeweiße Zähne blitzen, so oft es sie anschaut.
Als sie den Körberhof erreichen wechselt der Film. Rita und Jens haben ein Ritual vorbereitet. Sie begrüßen ihren Gast mit Brot und Salz, wie es üblich ist. Dann zeigen sie Tiombe das Gästezimmer im oberen Stock. Aus dem strahlenden Gesicht flieht nach und nach jeder Glanz.
Rita erinnert sich wie es war, als sie für drei Jahre in ein Internat musste. Nicht, dass sie allzu sehr an ihren Eltern gehangen hätte. Nein. Es war die ungewohnte Fremde, die sie für ein paar Stunden depressiv machte.
Sie nimmt Tiombe bei den Schultern und schiebt sie behutsam vor sich her:
»Na komm. Mach dich frisch. Gegen achtzehn Uhr essen wir«, Rita hebt die Schultern, »Timi muss früh zu Bett.«
»Mach ich«, flötet Tiombe, als sei sie noch immer gut gelaunt. Aber Rita sieht das verzerrte Gesicht und sie spürt genau, wie missmutig das Mädchen alles macht, was es sieht. Sie sagt nichts, ihre Augen spiegeln etwas Abneigung und etwas von Wut. Wogegen, das erkennt Rita nicht. Für eine verwirrende Minute ist sie davon überzeugt, Tiombe könnte nicht die sein, die ihr beschrieben wurde. Was, wenn sie eine von denen ist, die aus dem Verlag abgeschoben wurde, weil sie unbequem ist. Aufsässig. Reaktionär? Ist es ein Fehler, das junge Ding mit in ihr Haus zu holen? Es ist vielleicht nicht logisch, wie sie denkt, aber seit ein paar Tagen ist ihre viel gepriesene Logik Stück für Stück abhanden gekommen. Irgendwie hat alles mit Tiombe zu tun und irgendwie auch nicht. Tiombe ist schon seit einiger Zeit im Verlag, und manch einer lobt ihre Offenheit, ihre klaren Worte. Auch ihren Frohsinn. Und sofern das kein Speichellecken für Marquardt ist, sollte es ihr recht sein.
Noch immer grübelt sie, warum ihr die Verantwortung für Tiombe übertragen wurde. Wenn auch auf Zeit. Dahinter kann genau genommen jeder stecken, der ihr den autarken Job weitab vom Verlag nicht gönnt. Wie viele Neider gibt es wohl?
Einen ihrer Denkfehler macht sie schnell aus: Tiombe ist aus fremder kultureller Herkunft. Also wird sie nicht aus einer privilegierten Schicht stammen. Geht das mit dem Satz vom Bastard zusammen? Aber Tiombe kennt Marquard, den alle den Westfalen nennen. Wenn auch erst seit sie hier ist. So hat sie es zumindest gesagt. Mehrfach. Wenn es eine Seilschaft mit der Hautevolee geben würde, Mark hätte sie gewittert und ihr längst eine Wink gegeben. War seine Andeutung ein Wink, der auf den Westfalen hinweisen könnte? Warum hofiert der so erhabene Chef ein so junges Ding?
Keine Ressentiments, bitte. So sagt es der Westfale stets. Und sie gibt ihm Recht. Bisweilen können auch Chefs einmal für kleine Lichter die großen Gönner sein. Wenn sie erst einmal anfängt, einen unlauteren Zweck hinter ihrem Auftrag zu suchen, wird sie bald die Lust verlieren.
Freilich ist sie nicht sicher, ob ein anderer Kollege die Aufgabe abgelehnt hat. Sie ist ja weit weg. Immerhin hat Marquardt sie wissen lassen, wie er Tiombe beurteilt. Das allein ist ein sicheres Pfand. Dieser Westfale gibt sich keine Blöße. Und sein Fehlurteil wäre eine.
Ritas Sorge trifft auch nicht Tiombe. Wenn sie über etwas nachdenkt, dann ist es die Ausnahme, die man Tiombe gewährt. Erst das Volontariat, dann das Hochschulstudium. Wäre Tiombes Weg nicht ohnehin der bessere? Damit gäbe man dem jungen Menschen eine echte Chance, sich für das richtige Studium zu entscheiden. Mag sein, man denkt so. Vielleicht aber sind es doch Auswirkungen irgendeines Klüngels?
Das geht sie nichts an. Sie hat einen Auftrag zu erfüllen und dazu steht sie. Basta.
Warum erschrickt sie plötzlich vor ihrem eigenen Wort: Basta?
Am vierten Tag ist etwas wie Normalität im Körberhof eingezogen, der jetzt vier Menschen ein Zuhause gibt. Die Wohnräume liegen im Erdgeschoss. Oben haben Jens und Rita jeder seinen Arbeitsraum. Das obere Gästezimmer mit kleinem Bad und einer winzigen Dachkammer zeigt nach Süden. Ein Dachfenster zeigt zum Hof. Rita hat mit Jens vereinbart, was sie an diesem Abend zu tun gedenkt.
Tiombes Geruch liegt neuerdings hier unterm Dach. Sie hatte die Freiheit, das Zimmer nach ihrer Vorstellung zu ordnen. Die Vorhänge sind zur Hälfte zugezogen, obwohl vom Süden her kein fremder Blick möglich ist. Nur der Friedhof liegt hinter den Kiefern in zweihundert Metern Entfernung. Kein Laut dringt von unten herauf. Wahrscheinlich spielt Jens noch ein Weilchen mit Timi, bis er letztendlich ins Bett gehört.
Freilich hat sie Jens’ Augen gesehen. Klar muss er begeistert sein. Für ihn ist Tiombe der Engel in Person, freundlich, sanft und seltsam dankbar. Sogar Timi hat sofort einen Draht zu ihr gefunden, wenngleich er verdutzt über ihre braunen Arme strich, um die Farbe abzuwischen, von der er wahrscheinlich glaubt, Tiombe habe sie aufgemalt.
Rita sitzt wartend im Besuchersessel und schließt für einen entspannenden Moment die Augen. Ihr Körper wird weich und warm, ihre Züge gefällig mild. Eigentlich kann sie zufrieden sein, doch so zu denken, wagt sie nicht oft in den letzten Jahren. Zufriedenheit macht träge.
In ihrer eigenbefohlenen Ruhe spürt sie den leichten Luftzug über die Dielen fliegen. Tiombe öffnete die Tür. Nicht gerade zaghaft aber doch mit Respekt. Rita gibt sich einen Ruck, steht auf, geht ihr drei Schritte entgegen und öffnet ihre Arme. Zuerst ist es, als will sich das Mädchen der Umarmung hingeben. Doch dann ist sie stocksteif, auch in den Worten:
»Hat dir heute schon jemand gesagt, wie gut du aussiehst?«
»Nein, nicht wirklich.«
»Das wird auch keiner tun.«
Nun hat sie so lange in kribbeliger Ungeduld auf diesen Moment gewartet, wo sie mit Tiombe ungestört sprechen kann, dass sie es nicht fertig bringt, sie zurechtzuweisen. Vorerst schaut sie selbst dahin, wohin das Mädchen schaut und muss zugeben: Ihre alten Treter mit den abgewetzten Riemchen geben keinen guten Fuß.
»Sind Kleider für dich so wichtig? « fragt sie mit scheinbar unbekümmerter Miene. »Sie sind doch beliebig austauschbar.« Rita kann spüren, wie sich die jungen Schultern krümmen, wie die frohmutige Haltung schlaffer wird. Und sie hört, wie die weichen Lippen murmeln: »Ja. Entschuldige.«
Tiombe ist nicht unsensibel, und wie es nun scheint, sogar traurig, dass sie mal wieder nicht die richtigen Worte gefunden hat. »Es ist nur … es sieht zu komisch aus.«
Rita hat keine Ahnung, ob Tiombe nur ihre Schuhe belächelt, die sie längst hätte austauschen sollen, oder ob sich bei Tiombe alles um Äußerlichkeit dreht. Was ihre Erscheinung betrifft, ist sie sehr selbstsicher. Und treffsicher in modischen Dingen sie allemal, das muss Rita neidlos zugeben. Weniger sicher steht es wohl um die inneren Werte.
»Ich hatte vor, mit dir über die Abläufe hier bei uns und über dein Volontariat zu reden.«
Noch während sie spricht, fällt ihr ein, was Tiombe am Nachmittag gesagt hatte. Irgendetwas über die Achtung, die sie von Menschen erwartet. Aber wie sie es sagte, meinte sie Beachtung.
Noch darf sie nicht näher nachfragen, die Zeit, wo sie nur Scheu zu spüren glaubte – die wie Abscheu wirkte – ist keine drei Tage her. Sie muss alles unterlassen, was ihrem Verhältnis mehr schadet. Rita deutet auf den Sessel neben ihr. Ob der Versuch gelingt, ihr Gesicht locker zu halten, weiß sie nicht.
»Wie fühlst du dich?«
»Wie immer.«
»Also fühlst du dich immer ungut?« Tiombes Staunen entgeht ihr nicht. Sie ringt mit sich, und spricht doch geradeheraus.
»Nein. Es ist nur … Es ist alles so weit weg hier.«
Es sollte wohl beiläufig klingen, aber es klang irgendwie gereizt. Sie hat weit weg ungewöhnlich betont.
»Was bedeuten schon Entfernungen. Die ganze Welt ist ein Dorf. Heute kommt man doch sehr rasch überall hin.«
Rita hat das Gefühl, Tiombe geht es, wie es ihr selbst einmal ging. Ihr fehlte die Stadt und ihr fehlten ihre Freunde. Aber sie war freiwillig hierher gekommen. Vielleicht trifft das für Tiombe gar nicht zu. Vielleicht war es eine Flucht vor irgendwem, genau wie damals bei ihr. Und nun, wo die Fremde noch fremder wird, schlägt sie über die Stränge.
»Ich wollte ja weit weg von zu Hause. Aber …?«
Und dann erzählt sie stockend, dass es bei Marquardt auch nicht eben schön war. Dass es Spannungen gab, die seine Frau nicht hinnehmen wollte. Deshalb sei sie auf Ritas Angebot eingegangen. Nur deshalb.
Hat Marquardt Ritas Entscheidung heraufbeschworen, weil er sie kennt?
Sie sehen sich an und Rita ahnt, da ist noch mehr, als nur Marquardt. Eine Wunde vielleicht, die noch blutet und die so leicht nicht zu heilen sein wird. Sie bedient sich ihrer Stimme, wie sie sich zuweilen ihrer Texte bedient, um sanft nach der Ursache eines Übels zu suchen.
»Du solltest dir über alles, was man von dir verlangt, vorher klar werden. Du bist erwachsen, soweit ich das beurteilen kann.«
»Erwachsen heißt noch lange nicht, allem gewachsen zu sein.«
»Und welchen Namen trägt dieses allem?«
Vielleicht ist es nur eine Sekunde, die Tiombe zögert, aber diese Sekunde braucht sie offenbar. Rita ist nicht so vermessen zu glauben, sie wird wirklich ihr Herz ausschütten, aber eine kleine Regung in ihrem Gesicht gibt es und die lässt darauf schließen, dass sie durchaus Momente von Eigenbetrachtung zeigt.
Rita fällt es schwer, sich zu einem Lächeln durchzuringen. Noch weiß sie nicht, ob die Anstrengung, die sie in Tiombe zu investieren gedenkt, einmal Früchte tragen kann, Früchte, die nicht ihr, die vor allem Tiombe selber schmecken. Der Blick in des Mädchens Augen reicht aus, versöhnlich zu sein. So wie sie Tiombes Hände nimmt, öffnen sich deren Lippen:
»Ich bin kein Kind mehr … Aber mein Vater bestimmt noch immer über mich. Grundsätzlich.«
So rasch hat Rita nicht mit Worten gerechnet, dieser Art schon gar nicht.
»Eltern meinen es meistens gut.«
»Eltern lieben ihre Kinder auch. Er liebt mich nicht und ich liebe ihn nicht.«
Es ist, als schlagen Flämmchen aus einer alten Glut. Ähnliche Worte hätte sie früher auch benutzt. Heute weiß sie, sie waren nicht gerecht. Ein Leben in Liebe und Eintracht wünscht sich ein jeder – vielleicht auch Tiombe. Bisweilen hat Rita gespürt, dieses Mädchen, das jedermann Aufmerksamkeit erweckt, braucht selbst sehr viel davon. Ungewöhnlich viel. Es gibt keinen Gang, den sie gehen, wo man dem Mädchen nicht hinterher schaut. Es gibt keinen Mund, der ihre Anmut nicht lobt. Für den Moment kann Rita ein bisschen Neid nicht verwinden. Zu viel an Schönheit in ihrem Haus, die selbst Jens zu ungewohnten Worten verleitet?
So, wie sie aussieht, stünden ihr ganzandere Wege offen.
Männergedanken. Aber ein solcher von Jens? Kopf oder Körper?
Die Köpfe sind jene Teile, die dem männlichen Körper bisweilen im Wege stehen. Das hat sie in einem Roman geschrieben und es war einer bestimmten Erfahrung geschuldet. Aber es war eine Erfahrung mit einem ganz anderen Menschen.
Tiombes Körper vibriert. Vielleicht begreift sie, wie unklug es war, so mit Rita zu reden. Und was sie dazu bewogen hat, weiß sie vermutlich noch weniger.
»Es tut mit Leid, Rita.« Das Mädchen schaut zu Boiden, womöglich auf die Galoschen an ihren Füßen. »Ich bin manchmal ungeschickt.«
Rita hat längst gespürt, wie gut Tiombes Ehrlichkeit über ihr modische Verirrung tat. Die leisen Schwingungen zwischen ihnen setzen in Gang, wofür die Zeit noch gar nicht gekommen ist. Sie drückt das Mädchen behutsam an sich, lässt es aber sofort wieder los.
»Das ist es nicht. Du warst ehrlich, wenn auch ungeschickt.«
Tiombe hält Ritas Blick stand. Beinahe aufsässig. Ob sie in ihrer Jugend die Botschaft verstanden hat, bleibt offen. Sie protestiert nicht, das ist ein gutes Zeichen, nur ihre Stimme bebt noch ein kleinwenig:
»Ist schon okay, Rita. Ich freue mich, erst einmal von Marquardt weg zu sein.«
Ritas will von Marquardt nichts hören. Längst begreift sie, dass er Tiombe abgeschoben hat, weil sie nervt. Die Pauschalistin weit weg vom Verlag passte ihm gut in den Kram.
»Erzähl mir lieber von dir«, haucht sie mit großer Vorsicht. Tiombe streicht mit einer Hand ihr Vorderhaar hinter das Ohr und wartet auf irgendeine Eingebung. Sie kommt nicht.
»Was es von mir zu erzählen gibt, weißt du bereits. Mehr gibt es nicht…«
»Irgendetwas gibt es immer. Nichts Bestimmtes. Nur, um als Gast auf dem Körberhof nicht ewig fremd zu bleiben.«
»Ich bin ein Meter fünfundsechzig, achtundvierzig Kilo und seit Geburt weiblich. Ich kann schwimmen, rauche nicht und in punkto Dorfleben bin ich strohdumm.«
»Und ein Komödiant ist auch an dir verloren gegangen.«
Rita hat Tiombes Augen lange beobachtet. Da liegt etwas im Argen. Die meisten Menschen wissen nicht genau, was in ihnen steckt – was sie bedrückt. Tiombe kann es ähnlich gehen. Sie wartet, und Tiombe wird unruhig:
»Ich bin nicht zum Beichten geboren. Wäre ich christlich, würde es mir vielleicht gelingen, aber so …«
Nach ihrer Konfession zu fragen ziemt sich nicht, Rita bleibt allgemein:
»Wo Bedrückung ist, steckt immer auch ein Quäntchen…«, Schuld sagt Rita nicht mehr, doch genau dieses Wort nutzt Tiombe blitzschnell, um sie zu unterbrechen. Es klingt ruppig, anders jedenfalls, als man es jetzt erwarten konnte. »Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, sagte der Herr.«
Aus Tiombes Augen blitzt etwas wie Hass. Ist in dieser jungen Seele etwas Dunkles, etwas sehr Dunkles vielleicht, etwas Undurchsichtiges? Sie senkt ihre Stimme und zwingt sich zur Ruhe:
»Das sagte der Herr, an den du nicht glaubst. Und was meint Tiombe Randhal?«
»Lieber Gott, was sind das für Fragen?«
»Der liebe Gott würde das niemals fragen. Er würde erwarten, dass du ihm ewig dankbar bist. Ich dagegen frage nur: Willst du mir etwas …«, Rita macht eine längere Pause. Bewusst. Doch umso eindringlicher fährt sie fort: » …von dir und deinem Vater erzählen, oder willst du es nicht?«
Das mit dem Vater ist gewagt, aber es scheint sich zu bestätigen, was sie herausgehört hat. Tiombe hat Mühe, ihre Verwunderung zu verbergen, doch es ist auch deutlich, wie geschmeidig sie wird.
»Bist du Hellseher?« Beinahe lächelt ihr Mund.
»Nein. Aber wer dem Fremden helfen will, muss seine Sprache verstehen. Deine ungesagten Worte sind beredter als du glaubst.«
»Das glaube ich nicht. Ich hoffe nur, dass du mich besser verstehst als Marquardt.«
»Dann erzähl mir etwas, was ich verstehen kann.«
Der Trotz in Tiombe ist noch nicht völlig verraucht, doch ihre Sprache wird sanfter. Erst recht, als Rita mit weicher Stimme versicherte, dass sie nur freimütig reden soll, oder gar nicht. Sie will sie um nichts auf der Welt bedrängen. Es dauert, und Rita will schon aufgeben, doch Tiombe besinnt sich anders.
»Ich war schon immer anders, als ich sein sollte. Ein Bastard eben. Schon als Kind habe ich mir nur ganz einfache Sachen gewünscht - Gesundheit, satt zu essen, ein Fahrrad unterm Hintern, ein schönes Himmelbett. Das meiste davon hatte ich …« Sie stockt, doch Rita lässt ihr Zeit, bis sie gesteht. »Mehr als das. Viel zu viel.«
Sie zieht ein Zellstoff aus der Tasche und zelebriert eine Geste, die überflüssig ist. »Gut. Die Gesundheit ist gelogen. Ich wünschte mir oft, krank zu sein, um beachtet zu werden. Meine Mutter hatte nicht viel Zeit für mich, hatte nicht einmal Zeit für sich … Aber wenn ich krank war, nahm sie sich Zeit.«
Den Schuldigen dafür zu benennen, vermeidet sie, das ist der Punkt.
»Und später?«
»Später war ich einmal sehr krank und Mutter wäre daran fast verzweifelt.«
Tiombes Blick wandert durch den Raum, aus dem kleinen Fenster, hinauf in das Stückchen Himmel, das es freigibt. Ihr Atem geht ruhig.
»Und noch später«, traut Rita sich, die Gedanken des Mädchens zurückzuholen.
»Später sind andere Wünsche geboren. Ein liebendes Elternhaus, das für mich da ist. Vertrauen und Gerechtigkeit«, schiebt sie allzu rasch nach. Auf eine vage Art glaubt Rita, etwas in Tiombe zu erkennen. Eine Bitternis? Eine Kränkung? Etwas Unerfülltes.
»Was hat sich für dich nicht erfüllt?«
Tiombe wirft ihren Körper herum, als streife sie die lästige Frage ab. Aber sie besinnt sich auch diesmal schneller als erwatet:
»Habe ich eine Familie, die mich liebt?«, die Stimme wird cholerisch. »Haben wir vielleicht Gerechtigkeit? Nicht einmal Vertrauen. Man weiß nie, wer neben einem steht, Freund oder Feind.«
Vertrauen also? Rita schaut sehr lange in feuchte, fiebrige Augen. Wie oft hat sie aus Kinderaugen Tränen weggeküsst, wie oft hat sie ihre Hand auf eine kleine, heiße Stirn gelegt und geflüstert: Mama ist bei dir. Und jedes Mal war die Mama froh, diese Augenblicke erleben zu dürfen. Doch da sitzt nicht ihr Kind. Da sitzt ein fremdes Wesen, das sich nicht unter die Haut schauen lässt, das sich vor jedem und allem schützen möchte. Obwohl nach außen hin alles von ihr abzuprallen scheint, ist sie im Herzen sehr verletzlich.
»Du bist wie die Reinkarnation einer Schildkröte«, sagt Rita leise und hat wohl nichts bedacht, außer ihrer eigenen Unfähigkeit, unter Tiombes Panzer zu gelangen.
Ein Zucken geht durch Tiombe. Doch dann lacht sie laut, beinahe hysterisch laut. Es gibt keinen Zweifel, sie hat einen Grund, etwas zu überspielen. Damit erklärt sich am leichtesten Tiombes Phase an Überdrehtheit, die oberflächlich gesehen als lebenslustig gedeutet werden kann. Inzwischen weiß Rita, Tiombe würde wahrscheinlich bei jeder Anschuldigung lachend weinen, aber sie würde nie verraten, wie es in ihr drin aussieht.
Lächelnd legt sie ihre Hand auf Tiombes Arm und lauscht ins Nichts. Sie genießt die Berührung, die nicht immer geeignet ist, Zugang zu einem Menschen zu finden. Tiombe atmete bleischwer.
»Es fällt dir schwer, über dein Leben zu reden. Gilt das auch für deine Gefühle?« Sie legt jetzt Wert auf Vertraulichkeit, die sich langsam auf Tiombe zu übertragen scheint. Wahrscheinlich ist es quälender Zweifel, der das Blut durch die jungen Adern treibt. Für einen Moment regt sich nichts, kein Muskel, keine Wimper. Nur schwerer Atem strömt aus der jungen Brust. Nach vielen Zügen beginnt Tiombe wieder zu reden, ohne Scheu, ohne Selbstanklage, ohne Schamgefühl, als hätte ein Engel ihre Zunge gelockert.
»Ich bin die Schmach meines Vaters. Nur darum bin ich hier, wo mich keiner kennt – wo ihn keiner kennt. Hier muss er sich nicht schämen für mich.«
»Kein Vater schämt sich für sein Kind.«
»Ich bin ein Bastard. Das Abbild der Frau, die ihn verlassen hat. Die ihrem Befehlshaber den Befehl verweigerte und die ihr Kind im Stich ließ. Ich weiß, Mutter hätte mich nie … Er war es … Er wollte es so.«
Sie hält inne, aber Rita ermuntert sie nicht. Der nüchterne Raum taucht ab im Dunkel des Abends mit der Gewissheit auf einen hellen, klaren Morgen. Unbewusst streicht Ritas Hand über Tiombes Arm. Sie verharrt, wie die Hand einer Mutter an der Stirn ihres fiebernden Kindes. In Tiombes Augen sammelt sich der Glanz einer reinen Seele, ein Glanz, den sie Tiombes Unschuld zugestehen möchte. Das schöne Gesicht vor ihren Augen verschwimmt, bis sich die kindlich suchende Hand fest um Ritas krallt, der junge Kopf sich anschmiegt. Diese Umklammerung spendet ihr Trost. Liebe. Hoffnung. Zuneigung. Vertrauen?
Wie konnte sie erwarten, dass dieser Abend etwas bringt, was sie nie wollte. Tiombe tut ihr leid. Was das Mädchen einst liebte, hatte man ihr genommen. Die Mutter. Man hat ihr den Menschen genommen, der sie zu lieben glaubte, was doch nur ein verdammter Irrtum war. Mit ihrer Mutter hat sie verloren, was sie ein Leben lang lieben wollte.
Vielleicht trägt sie nun selbst dazu bei, die Harmonie ihres Lebens zu zerstören, weil sie dem Vater alle Schuld gibt. Sieht sie die Zeit gekommen, wo sie zurückschlagen möchte?
»Herrgott. Du bist erwachsen und kannst deine eigenen Wege suchen. Wir haben keine Leibeigenschaft und wir schreiben nicht 1220, wir schreiben 2012!«
Tiombes Kehlkopf zuckt. Sie schluckt ein paar Mal den salzigen Geschmack ihrer Tränen herunter, die sie nicht losgelassen hat. Dann verharrt sie reglos; Es ist jetzt unheimlich still. Nur ein seidenes Knicken löste sich von Zeit zu Zeit aus den blassen Tapeten, die die alten Wände verjüngen. Rita wartet geduldig, doch Tiombe rührt sich nicht mehr. Ihr Atem geht ruhiger als zuvor.
Das Knistern der Tapete verliert sich und Rita hat den Wunsch, sich zurückzunehmen für diesen Tag. Zeit sich etwas zu überlegen. Genau betrachtet steckt hinter Tiombes Leben ein kleines Türchen zu einem ungewöhnlichen Schicksal, das es mal wieder zu erforschen und aufzuschreiben lohnt. Hassen wird sie sich für ihren eigennützigen Gedanken nicht. Die Neugier gehört zu ihr, zu ihrem Beruf wie zu ihrer Passion. Neugier ist der einzige Weg, Wunder aufzuspüren. Und heute muss man als Romanautor schon mit einem Wunder aufwarten, wenn man gelesen werden möchte.
Impuls des Lebens
Die Worte des Abends rücken am Morgen in ein besseres Licht. Zum ersten Mal gibt ihr jemand die Gewissheit, sie zu mögen, ohne familiären Hintergrund. Einfach so. Seit Langem hatte sie kein solches Gefühl mehr. Es beherrschte sie noch in der Nacht. Sie versuchte das Gefühl lange hinauszuzögern. In vollkommener Dunkelheit – und so sind alle Nächte hier in der Abgeschiedenheit – und allein im fremden Zimmer, war die Verzückung dann gestorben und sie hätte beinahe einen unverzeihlichen Fehler begangen. Sie war drauf und dran, nach dem Kästchen zu greifen, was sie seit Tagen zu vermeiden versucht, weil diese beiden Menschen ihr Denken und Fühlen verändern. Es war das nächtliche Geräusch in den unteren Räumen, das liebevolle Trösten, das leise Summen eines Kinderliedes, das sie vom Unweigerlichen abgehalten hat.
Ihr Körper streckt sich, ihre Muskeln spannen sich für Sekunden und lockern sich wieder. Dann schreitet sie dem Morgen entgegen, dem ganz normalen Morgen vor einem verdammt nervigen Tag im tiefsten Spreewald.
Vorsichtig öffnet sie die Küchentür und sieht es genau: Rita macht ein unglückliches Gesicht. Eine Spur zu euphorisch, wendet sie sich dem nett gedeckten Frühstückstisch zu.
»Ich habe einen Mordshunger.«
»Dann iss dich richtig satt. Wer weiß, wann wir die Zeit für die nächste Mahlzeit finden.«
»Wohin geht es heute?«
»Lübben«, sagt Rita und schiebt noch ein paar Sätze nach. Vor Jahren habe man die Ostflüchter in einer Serie bedacht, nun seien die Rückkehrer dran. Es gehe um eine junge Frau, die Tiombe zu interviewen habe.
Rita stellt die warmen Brötchen in die Mitte des Tisches und legt einen kleinen Merkzettel dazu, der Tiombe helfen soll, das Interview klug aufzubauen. Dann ruft sie nach nebenan:
»Der Kaffee ist fertig!«
Bis Jens sich mit Timi zu ihnen gesellt, nimmt Rita das Gespräch wieder auf, als habe sie es nie unterbrochen. »Lübben ist die Paul-Gerhardt-Stadt.« Dabei erscheint das gewisse Lächeln in Ritas Gesicht, das Tiombe immer sieht, wenn Rita versucht, ihr diese triste Gegend schmackhaft zu machen. Es gehört zu den Dingen, die sie so hinnimmt, wie sie sind, aber dieses Mal durchfährt sie ein anderes Gefühl. Ein vertrautes. Was weiß Rita? Sie kommt ihr zuvor:
»Paul Gerhardt? Gibt es mehrere davon?«
»Was heißt das, mehrere?«
Auf einmal glaubt Tiombe, nicht wirklich über das sprechen zu wollen, was ihr noch eben auf der Zunge brannte. Sie zieht ihre Schultern nach oben und schaut zu, wie Jens den Kleinen in sein Stühlchen hebt. Diese Ablenkung kommt ihr gerade recht, aber Rita lässt sie nicht zu.
»Paul Gerhardt ist überall bekannt. In vielen Städten gibt es Kirchengemeinden, Gotteshäuser, Diakonien. Sogar Schulen tragen seinen Namen. Er war neben Martin Luther der bedeutendste deutsche Kirchenliederdichter. Gut möglich, dass du seinen Namen schon einmal gehört hast.«
Warum sag’ ich es nicht. Es ist doch nichts dabei, denkt Tiombe. Aber zugleich weiß sie, wenn sie erst davon anfängt, wird sie auf etwas reduziert, was sie nicht will. Oder Rita würde - wie gestern Abend - erreichen, dass alles wie von selbst aus ihr heraussprudelt. Das darf es nicht noch einmal. Da gibt es dieses stumme Verbot, das sie sich selbst auferlegt hat und das sie längst bereut. Ihre Lippen öffnen sich, ganz ungewollt.
»Ich war ein paar Jahre in einem Jugendtreff. Der hieß Paul Gerhardt.«
»Jugendtreffs also auch? Sieh’ an. Wo war das?«
Warum zum Teufel muss sie dauernd reden. Vater hat recht. Wer leidige Dinge anspricht, muss leidigen Fragen gewachsen sein.
Ein profaner Jugendtreff - was ist das schon.
»In Frankfurt«, sagt sie. »Ich dachte der heißt so, weil der nicht weit vom Paul-Gerhardt-Ring liegt. Aber ehrlich, ich wusste nicht, dass das ein Pastor … ich meine, war der aus dem Spreewald?«