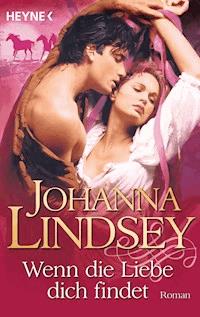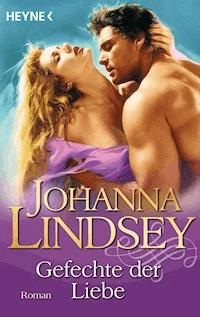4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gerissene Diebin und der arrogante Edelmann
Ein neuer historischer Liebesroman von New York Times-Bestsellerautorin Johanna Lindsey
Danny ist ohne Eltern aufgewachsen und muss sich schon ihr ganzes Leben lang mit Gelegenheitsdiebstählen durchschlagen. Als sie bei einem ihrer Raubzüge den attraktiven und reichen Jeremy Malory kennenlernt und er sie zwingt, bei einem Diebstahl zu helfen, wird Danny von ihrer Bande verstoßen.
Jeremy kommt es gerade recht, dass die schöne Diebin Danny wieder vor seiner Tür steht und von ihm fordert, ihr einen Job zu verschaffen. Als er sie als Dienstmädchen anstellt, hat er nichts anderes im Sinn, als sie zu verführen. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass Danny sich unter seiner Hand in eine Lady verwandeln würde – und wie gefährlich die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit sind …
Erste Leserstimmen
„Die historischen Liebesromane von Johanna Lindsey sind einfach zum Dahinschmelzen!“
„Vor allem die Charaktere in diesem Roman haben es mir angetan. Danny und Jeremy sind ein ungleiches, aber bezauberndes Paar.“
„Spannung und Leidenschaft auf jeder einzelnen Seite!“
„Es hat mir große Freude bereitet in die Welt der frechen Danny einzutauchen – ein tolles Ebook!“
„Gefühlvoll, lustvoll, fesselnd – und uneingeschränkt zu empfehlen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses E-Book
Danny ist ohne Eltern aufgewachsen und muss sich schon ihr ganzes Leben lang mit Gelegenheitsdiebstählen durchschlagen. Als sie bei einem ihrer Raubzüge den attraktiven und reichen Jeremy Malory kennenlernt und er sie zwingt, bei einem Diebstahl zu helfen, wird Danny von ihrer Bande verstoßen.
Jeremy kommt es gerade recht, dass die schöne Diebin Danny wieder vor seiner Tür steht und von ihm fordert, ihr einen Job zu verschaffen. Als er sie als Dienstmädchen anstellt, hat er nichts anderes im Sinn, als sie zu verführen. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass Danny sich unter seiner Hand in eine Lady verwandeln würde – und wie gefährlich die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit sind …
Impressum
Erstausgabe 2004 Überarbeitete Neuausgabe März 2021
Copyright © 2022 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-115-9
Copyright © 2004 by Johanna Lindsey Titel des englischen Originals: A Loving Scoundrel
Copyright © 2005, Katrin Marburger
Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2005 bei Heyne erschienenen Titels Zärtlicher Räuber (ISBN: 978-3-45349-013-0).
Copyright © 2005, Heyne Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2005 bei Heyne erschienenen Titels Zärtlicher Räuber (ISBN: 978-3-45349-013-0).
Übersetzt von: Katrin Marburger Covergestaltung: Rose & Chili Design unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © IMG Stock Studio, © Anastasiia Malinich periodimages.com: © VJ Dunraven Productions Korrektorat: Katrin Gönnewig
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
YouTube
Diebin meines Herzens
Prolog
Der Regen spülte weder den Gestank noch die Hitze fort, vielmehr schien er beides noch schlimmer zu machen. In der engen Gasse türmte sich der Müll auf – Schachteln, verdorbene Lebensmittel, Kisten, zerbrochenes Geschirr, eben alles, was weggeworfen wurde, weil niemand es noch haben wollte. Die Frau und das Mädchen waren in eine der größeren Kisten am Rand des Haufens gekrochen, um sich zu verstecken. Das Mädchen wusste nicht, warum sie sich verstecken mussten, doch es spürte die Angst der Frau.
Diese Angst war immer da gewesen, im Gesichtsausdruck der Frau, in ihrer Stimme, in der zitternden Hand, mit der sie die des Mädchens nahm und es von einer Gasse in die andere zerrte, stets in der Nacht, niemals am Tage, wenn sie anderen Leuten begegnen konnten.
„Miss Jane“ solle das Mädchen sie nennen, hatte die Frau gesagt. Die Kleine dachte, sie hätte den Namen der Frau eigentlich wissen müssen, aber das tat sie nicht. Sie wusste auch nicht, wie sie selbst hieß. Die Frau nannte sie „Danny-Schätzchen“, also war das wohl ihr Name.
Miss Jane war nicht ihre Mutter. Danny hatte gefragt und zur Antwort bekommen: „Ich bin deine Amme.“ Sie hatte nie daran gedacht zu fragen, was eine Amme war, denn aus dem Tonfall der Frau hatte sie entnommen, dass sie es wissen musste. Miss Jane war von Anfang an bei ihr gewesen, das heißt, solange sie zurückdenken konnte – das waren allerdings nur ein paar Tage. Als sie aufgewacht war, hatte sie neben der Frau in einer ähnlichen Gasse wie dieser gelegen, und sie waren beide blutbesudelt gewesen. Seitdem waren sie ständig durch immer neue Gassen gerannt und hatten sich wieder und wieder versteckt.
Das meiste Blut war von Miss Jane gewesen. In ihrer Brust hatte ein Messer gesteckt, und sie hatte noch verschiedene andere Wunden gehabt, da mehr als einmal auf sie eingestochen worden war. Es war ihr gelungen, das Messer selbst herauszuziehen, nachdem sie aufgewacht war. Aber sie hatte ihre Wunden nicht gepflegt. Ihre einzige Sorge war gewesen, wie es dem Mädchen ging und wie sie das Blut am Hinterkopf der Kleinen stillen sollte – und dass sie schleunigst von dem Platz verschwanden, an dem sie aufgewacht waren.
„Warum verstecken wir uns?“, hatte Danny einmal gefragt, als offensichtlich war, was sie taten.
„Damit er dich nicht findet.“
„Wer?“
„Ich weiß es nicht, Kind. Ich dachte, er wäre ein Dieb, der bei dem Einbruch wahllos alle Anwesenden umgebracht hat, um keine Zeugen zu hinterlassen. Inzwischen bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher. Er war zu entschlossen und zu sehr darauf aus, dich zu finden. Aber ich habe dich in Sicherheit gebracht und passe auch weiter auf dich auf. Er wird dir nichts mehr tun, das verspreche ich dir.“
„Ich weiß gar nichts mehr davon, dass er mir wehgetan hat.“
„Deine Erinnerungen werden wiederkommen, Danny-Schätzchen, da mach dir mal keine Sorgen. Aber hoffentlich nicht allzu bald. Es ist wirklich ein Segen, dass du erst einmal von nichts mehr weißt.“
Danny störte sich nicht daran, dass sie nicht mehr wusste, was vor dem Blut geschehen war. Sie war auch noch zu klein, um sich Sorgen zu machen, wie es nun weitergehen sollte. Ihre Bedürfnisse waren unmittelbarer: Sie hatte Hunger, es war ungemütlich, und Miss Jane war noch immer nicht aus dem Schlaf erwacht.
Ihre Amme hatte anscheinend gedacht, sie würden in den Bergen von Müll um sie herum etwas Nützliches finden, aber bisher war sie zu schwach gewesen, um nachzusehen. Mitten in der Nacht waren sie in die Kiste gekrabbelt, und Miss Jane hatte den ganzen Tag durchgeschlafen.
Jetzt war wieder Nacht, und sie schlief immer noch. Danny hatte sie geschüttelt, aber Miss Jane hatte sich nicht gerührt. Sie war ganz kalt und steif. Danny wusste nicht, was das bedeutete, nämlich, dass sie tot war und dass es daher auch so fürchterlich stank.
Schließlich kroch Danny aus der Kiste, damit der Regen etwas von dem getrockneten Blut abwusch. Sie fand es nicht schön, schmutzig zu sein, und schloss daraus, dass sie nicht daran gewöhnt war. Es war komisch, so einfache Dinge zu wissen, aber keine Erinnerungen zu haben, um das Wissen zu untermauern.
Danny beschloss, dass sie ebenso gut den Müll durchsuchen konnte, wie Miss Jane es vorgehabt hatte, auch wenn sie nicht genau wusste, wonach sie Ausschau halten sollte und was man „nützlich“ nennen sollte. Am Ende hatte sie ein paar Sachen aufgelesen, die sie interessant fand – eine dreckige Flickenpuppe, der ein Arm fehlte, einen Männerhut, der ihre Augen vor dem Regen schützen würde, einen angestoßenen Teller, von dem sie essen konnten, und den fehlenden Arm der Puppe.
Miss Jane hatte einen Ring, den sie gestern getragen hatte, gegen etwas zu essen eingetauscht. Es war das einzige Mal gewesen, dass sie sich bei Tage hinausgewagt hatte, eingehüllt in ihr Umhängetuch, um die schlimmsten Blutflecken zu verbergen.
Danny wusste nicht genau, ob Miss Jane noch mehr Ringe hatte, die man versetzen konnte; sie hatte nicht daran gedacht nachzusehen. Sie hatte bei dieser Gelegenheit zum letzten Mal etwas gegessen. In dem Müll lagen auch verdorbene Lebensmittel, aber obwohl Danny hungrig war, ließ sie die Finger davon. Nicht, weil sie gewusst hätte, dass sie nicht gut waren, sondern weil sie keine Vorstellung davon hatte, was es hieß, verzweifelt zu sein, und dieses Zeug roch widerlich.
Wahrscheinlich wäre sie irgendwann verhungert, während sie in der Kiste neben der toten Miss Jane kauerte und geduldig darauf wartete, dass die Amme aufwachte. Doch in der Nacht hörte sie, wie noch jemand draußen im Müll herumwühlte, und stieß auf eine junge Frau. Eigentlich war es ein Mädchen von höchstens zwölf Jahren, aber da es so viel größer war als sie, ordnete Danny es zunächst den Erwachsenen zu.
Entsprechend respektvoll und ein wenig zögernd sprach sie es an: „Guten Abend, Madam.“
Sie hatte das Mädchen erschreckt. „Was machst’n du bei dem Regen hier draußen, Schätzchen?“
„Woher wissen Sie, wie ich heiße?“
„Hä?“
„So heiße ich. Danny-Schätzchen.“
Gekicher. „Ziemlich sicher nur die Hälfte davon, Kleine. Wohnst du hier in der Gegend?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Wo ist deine Mama?“
„Ich glaube, ich habe keine mehr“, musste Danny eingestehen.
„Und deine Leute? Deine Familie? So eine hübsche Kleine lassen die doch nicht allein draußen rumlaufen. Wer ist bei dir?“
„Miss Jane.“
„Na siehst du“, sagte das Mädchen strahlend. „Und wo ist die hingegangen?“
Als Danny auf die Kiste hinter sich zeigte, runzelte das Mädchen skeptisch die Stirn. Trotzdem schaute sie nach, kroch dann in die Kiste hinein, um genauer hinzusehen. Danny wollte lieber nicht noch einmal in die Kiste krabbeln und blieb draußen. Bei dem Müll roch es viel besser.
Als das Mädchen zurückkam, atmete es tief durch und schauderte. Dann beugte es sich zu Danny hinunter und lächelte sie schwach an. „Armes Ding, du. Hattest du außer ihr keinen?“
„Sie war bei mir, als ich aufgewacht bin. Wir waren beide verletzt. Sie sagte, der Schmerz in meinem Kopf hat meine Erinnerungen weggenommen, aber sie werden eines Tages wiederkommen. Seitdem haben wir uns immer versteckt, damit der Mann, der uns verletzt hat, nicht findet.“
„Oje, was für ein Jammer. Ich kann dich mit nach Hause nehmen, schätze ich. Aber ein richtiges Zuhause ist das nicht; nur ein paar Kinder wie du, die keinen mehr haben, der sich um sie kümmert. Wir schlagen uns halt durch, so gut wir können. Alle schaffen ihr Geld zum Leben ran, sogar die Kleinsten, die so sind wie du. Die Jungs als Taschendiebe, die Mädels auch, bis sie alt genug sind, ihr Geld auf’m Rücken zu verdienen. Mach ich auch bald, wenn’s nach dem verdammten Dagger geht.“
Die letzten Worte hatte sie so angewidert hervorgespien, dass Danny nachfragte: „Ist das eine schlimme Arbeit?“
„Die Allerschlimmste, Kleine. Kriegst die Pocken davon und musst jung sterben, aber was kümmert das Dagger, solange die Kohle reinkommt.“
„Dann möchte ich diese Arbeit nicht machen. Ich bleibe hier, vielen Dank.“
„Aber du kannst nicht …“, begann das Mädchen, verbesserte sich jedoch: „Hör mal, ich hab eine Idee. Wünschte, ich hätte das auch machen können, aber da kannte ich das noch nicht, was ich jetzt mache. Für mich ist es zu spät, aber für dich nicht – nicht, wenn sie denken, du bist ein Junge.“
„Aber ich bin ein Mädchen.“
„Klar, Schätzchen, aber wir können dir ein Paar Hosen beschaffen, dir die Haare kurz schneiden, und …“ Das Mädchen kicherte. „Wir brauchen ihnen nicht mal sagen, was du bist. Wenn sie dich in Hosen sehen, denken sie gleich, du bist ein Junge. Ist wie ein Spiel, wir tun so als ob. Macht bestimmt Spaß, wirst schon sehen. Und dann kannst du selbst entscheiden, was für eine Arbeit du machen willst, wenn du größer bist, anstatt gesagt zu kriegen, es gibt nur eine Arbeit für dich, weil du ein Mädchen bist. Na, wie hört sich das an? Willst du’s versuchen?“
„Ich glaube nicht, dass ich schon mal ‚wir tun so als ob’ gespielt habe, aber ich will es gern lernen, Madam.“
Das Mädchen verdrehte die Augen. „Du redest viel zu vornehm, Danny. Kannst du nicht anders?“
Danny wollte gerade erneut „Ich glaube nicht“ sagen, schüttelte aber stattdessen verlegen den Kopf.
„Dann sag überhaupt nichts, bis du so reden kannst wie ich, klar? Damit du nicht durch deine Sprache auffällst. Keine Angst, ich bring dir das schon bei.“
„Kann Miss Jane mit uns kommen, wenn es ihr besser geht?“
Das Mädchen seufzte. „Sie ist tot. Zu schwer verletzt, so wie’s aussieht. Ist wohl verblutet. Ich hab sie mit dem großen Tuch zugedeckt – nicht weinen. Hast doch jetzt mich; ich kümmer mich um dich.“
1
Jeremy Malory war schon früher in zwielichtigen Spelunken gewesen, aber diese war vermutlich die schlimmste von allen. Kein Wunder, sie lag ja auch am Rand des wohl übelsten Armenviertels von London, das fest in der Hand von Dieben, Halsabschneidern, Freudenmädchen und wilden Horden von Waisenkindern war, die auf der Straße lebten und zweifellos zu Londons nächster Verbrechergeneration heranwuchsen.
Jeremy wagte sich nicht weiter in diesen Stadtteil hinein, da ihn seine Familie sonst vermutlich nicht wiedersehen würde. Doch die Schänke stand absichtlich ganz am Rand jener Mördergrube, damit nichts ahnende Gäste dort ein paar Gläser tranken und sich die Taschen ausrauben ließen oder, wenn sie töricht genug waren, ein Zimmer für die Nacht mieteten, wo ihnen dann alles gestohlen wurde, sogar die Kleider.
Jeremy hatte für ein Zimmer bezahlt. Und nicht nur das, er war auch sehr großzügig mit seinem Geld umgegangen, hatte den wenigen Gästen in der Schänke eine Runde ausgegeben und überzeugend den Betrunkenen gespielt. Auf diese Weise hatte er absichtlich den Boden dafür bereitet, dass jemand ausgeraubt wurde – nämlich er selbst. Doch genau aus diesem Grunde waren er und sein Freund Percy auch hier – um einen Dieb zu schnappen.
Zu Jeremys Erstaunen hielt Percy Adlen ausnahmsweise einmal den Mund. Normalerweise redete er wie ein Buch und war noch dazu ziemlich zerstreut. Dass er auf diesem ungewöhnlichen Ausflug meist schwieg, zeigte, wie nervös er war. Verständlicherweise. Jeremy mochte sich ja in dieser Umgebung wie zu Hause fühlen – immerhin war er in einer Schänke geboren und aufgewachsen, bis sein Vater ihn als Sechzehnjährigen zufällig aufgelesen hatte. Percy dagegen gehörte zur gehobenen Gesellschaft.
Jeremy hatte Percy mehr oder weniger geerbt, als die beiden besten Freunde Percys - Nicholas Eden und Jeremys Cousin Derek Malory – zahm geworden waren und sich unter das Ehejoch gebeugt hatten. Derek hatte Jeremy unter seine Fittiche genommen, als Jeremy und sein Vater James nach dem Ende der langen Entfremdung zwischen James und seiner Familie nach London zurückgekehrt waren. Daher war es nur natürlich, dass Percy nun in Jeremy den engsten Verbündeten für Unternehmungen der weniger zahmen Art sah.
Jeremy hatte nichts dagegen. Nachdem sie acht Jahre lang gemeinsam durch dick und dünn gegangen waren, mochte er Percy mittlerweile richtig gern. Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte er sich gewiss nicht freiwillig bereit erklärt, ihn aus seiner jüngsten Verlegenheit zu retten. Am vergangenen Wochenende hatte Percy sich nämlich auf einer mehrtägigen Gesellschaft im Hause von Lord Crandle beim Glücksspiel gehörig schröpfen lassen, und zwar von einem Zockerfreund des Hausherrn. Er hatte dreitausend Pfund verloren, dazu seine Kutsche und nicht nur ein Familienerbstück, sondern gleich zwei. Er war so sturzbetrunken gewesen, dass er sich nicht einmal mehr daran erinnern konnte, bis sich am nächsten Tag einer der anderen Gäste seiner erbarmte und ihm alles erzählte.
Percy war am Boden zerstört gewesen, und das aus gutem Grund. Das Geld und die Kutsche zu verlieren geschah ihm nur recht; warum ließ er sich auch so leicht übertölpeln? Mit den beiden Ringen war es jedoch etwas ganz anderes. Der eine war so alt, dass er seiner Familie als Siegelring diente, und der andere, wegen seiner Edelsteine sehr wertvoll, befand sich schon in der fünften Generation im Besitz von Percys Familie. Percy hätte im Traum nicht daran gedacht, die Stücke beim Spiel als Einsatz zu verwenden. Er musste gezwungen, angestachelt oder auf andere Weise dazu verleitet worden sein, sie in den Topf zu werfen.
Das Ganze gehörte nun Lord John Heddings, und Percy war außer sich gewesen, als Heddings sich weigerte, ihm die Ringe wieder zu verkaufen. Geld brauchte der Lord nicht, die Kutsche ebenso wenig. Die Ringe mussten jedoch wahre Trophäen für ihn gewesen sein, ein Zeugnis seines Geschicks beim Glücksspiel. Oder vielmehr seines Geschicks beim Betrügen, doch das konnte Jeremy kaum beweisen; er war ja nicht dabei gewesen.
Hätte Heddings auch nur einen Funken Anstand im Leib gehabt, so hätte er Percy ins Bett geschickt, anstatt ihn weiter zum Trinken aufzufordern und zuzulassen, dass er die Ringe einsetzte. Zumindest hätte er Percy die Ringe später zurückkaufen lassen. Percy war sogar bereit gewesen, mehr als ihren eigentlichen Wert zu bezahlen; arm war er schließlich nicht, da er nach dem Tod seines Vaters bereits sein Erbe erhalten hatte.
Doch Heddings scherte sich nicht um Anstand. Vielmehr war er über Percys Beharrlichkeit verärgert gewesen und zuletzt wirklich unangenehm geworden – wenn Percy ihn nicht bald in Ruhe lasse, werde er körperlichen Schaden nehmen. Das hatte Jeremy so aufgebracht, dass er diese Alternative vorgeschlagen hatte. Immerhin war Percy überzeugt davon, dass seine Mutter ihn enterben würde, wenn sie von der Sache erfuhr, und so hatte er es seit jenem Vorfall vermieden, ihr zu begegnen, damit sie nicht merkte, dass die beiden Ringe an seinen Fingern fehlten.
Seit sie sich vor zwei Stunden in ihr Zimmer über der Schänke zurückgezogen hatten, waren bereits drei Schurken erschienen, die versucht hatten, sie auszurauben. Alle waren jedoch Stümper gewesen, und nach dem Letzten der drei wollte Percy schon die Hoffnung aufgeben, dass sie einen Dieb für ihren Plan finden würden. Jeremy war zuversichtlicher. Drei Versuche in so kurzer Zeit bedeuteten, dass im Laufe der Nacht noch weitere folgen würden.
Erneut öffnete sich die Tür. Im Zimmer brannte kein Licht, ebenso wenig wie draußen im Korridor. Wenn dieser neue Dieb irgendetwas taugte, würde er auch keines brauchen, denn er hätte lange genug gewartet, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Schritte, ein wenig zu laut. Ein Streichholz flammte auf.
Jeremy seufzte und erhob sich behände von dem Stuhl neben der Tür, wo er Wache hielt. Dabei machte er weniger Geräusche als der Dieb beim Betreten des Raumes. Plötzlich tauchte er vor der Nase des Gauners auf, ein Hüne von einem Mann, nun ja, zumindest im Vergleich zu dem kleinen Halunken. Aber auf jeden Fall war er groß genug, um dem Gassenjungen einen Heidenschreck einzujagen, sodass er Hals über Kopf auf dem gleichen Weg verschwand, auf dem er gekommen war.
Jeremy knallte die Tür hinter dem Jungen zu. Er gab nicht auf; schließlich war die Nacht noch jung, und die Diebe waren noch nicht verzweifelt. Wenn es sein musste, würde er einfach einen von ihnen festhalten, bis sie ihm ihren besten Mann brachten.
Percy dagegen kapitulierte. Er saß auf dem Bett und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand – beim bloßen Gedanken daran, unter diese Decken zu kriechen, hatte er sich geschüttelt. Jeremy hatte jedoch darauf bestanden, dass er sich hinlegte, um zumindest den Eindruck zu erwecken, er schliefe. „Es muss doch einen einfacheren Weg geben, einen Dieb anzuheuern“, beklagte er sich. „Gibt es kein Büro, das welche vermittelt?“
Jeremy musste sich das Lachen verbeißen. „Geduld, alter Junge. Ich habe dich gewarnt, es würde die ganze Nacht dauern.“
„Ich hätte es doch deinem Vater stecken sollen“, brummelte Percy.
„Was hast du gesagt?“
„Nichts, mein Lieber, gar nichts.“
Jeremy schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Man konnte es Percy nicht verübeln, dass er sich fragte, ob Jeremy tatsächlich allein mit diesem Schlamassel fertig werden konnte. Immerhin war er neun Jahre jünger als Percy, und da dieser so ein Wirrkopf war und kein Geheimnis für sich behalten konnte, hatte ihm niemand erzählt, wie Jeremy in Wirklichkeit aufgewachsen war.
Der Tatsache, dass er während der ersten sechzehn Jahre seines Lebens in einer Schänke gelebt und gearbeitet hatte, verdankte Jeremy einige überraschende Fähigkeiten. Er konnte solche Mengen von Hochprozentigem vertragen, dass er seine Freunde unter den Tisch trank, bis sie vollkommen hinüber waren, während er selbst vergleichsweise nüchtern blieb. Bei Prügeleien konnte er, wenn es sein musste, ziemlich heimtückisch werden. Und er hatte einen scharfen Blick dafür, ob eine Drohung ernst gemeint oder bloß heiße Luft war.
Seine unkonventionelle Erziehung war freilich nicht damit beendet gewesen, dass sein Vater von seiner Existenz erfuhr und ihn bei sich aufnahm. Nein, damals war James Malory noch immer von seiner großen Familie entfremdet und führte in der Karibik das sorglose Leben eines Piraten oder eines „Gentleman-Piraten“, wie er sich lieber nannte. James’ bunt zusammengewürfelte Mannschaft hatte sich Jeremys angenommen und ihm weitere Dinge beigebracht, von denen ein Junge in seinem Alter eigentlich nichts wissen sollte.
Von alledem hatte Percy keine Ahnung. Er hatte stets nur das Oberflächliche zu Gesicht bekommen, den charmanten Lausbuben, der heute, mit fünfundzwanzig, nicht mehr so lausbübisch, aber immer noch charmant war und so gut aussah, dass er keinen Raum betreten konnte, ohne dass sämtliche anwesenden Damen sich ein kleines bisschen in ihn verliebten. Abgesehen von den Frauen in seiner eigenen Familie, die ihn lediglich vergötterten.
Jeremy sah seinem Onkel Anthony ähnlich, und jeder, der ihm zum ersten Mal begegnete und beide kannte, hätte geschworen, dass er eher Tonys als James’ Sohn war. Wie sein Onkel war Jeremy groß und breitschultrig und hatte eine schlanke Taille, schmale Hüften und lange Beine. Beiden gemeinsam waren zudem ein breiter Mund und ein ausgeprägtes, arrogantes Kinn sowie eine stolze Hakennase, ein dunkler Teint und dichtes pechschwarzes Haar.
Das Eindrucksvollste an Jeremy war jedoch ein Augenpaar, wie es nur wenige Malorys hatten: strahlend blau unter schweren Lidern, leicht schräg gestellt, was ihm einen Hauch von Exotik verlieh, eingerahmt von schwarzen Wimpern und markanten Brauen. Zigeuneraugen, wurde immer wieder gemunkelt, geerbt von seiner Urgroßmutter Anastasia Stephanoff, in deren Adern, wie die Familie erst im vergangenen Jahr herausgefunden hatte, tatsächlich zur Hälfte Zigeunerblut geflossen war. Christopher Malory, der Erste Marquis von Haverston, war so hingerissen von ihr gewesen, dass er sie bereits am zweiten Tag ihrer Bekanntschaft geheiratet hatte. Außer der Familie würde jedoch niemals jemand von dieser Sache erfahren.
Es war verständlich, warum Percy lieber Jeremys Vater eingeweiht hätte. War nicht sein bester Freund Derek stets schnurstracks zu James marschiert, wenn er Probleme der pikanteren Sorte hatte? Percy ahnte zwar nichts von James’ Zeit als Pirat, doch wer hätte nicht gewusst, dass James Malory zu den berüchtigtsten Wüstlingen Londons gezählt hatte, bevor er zur See gefahren war, und dass damals wie heute kaum einer es wagte, ihm die Stirn zu bieten, ob im Boxring oder auf dem Duellplatz?
Percy war wieder aufs Bett gesunken, um den Schlafenden zu mimen. Nachdem er sich brummelnd eine Weile hin- und hergeworfen hatte, verhielt er sich größtenteils ruhig, während sie auf den nächsten Eindringling warteten.
Jeremy überlegte, ob er Percy sagen sollte, dass diese Angelegenheit so bald nicht geregelt würde, wenn er seinen Vater hinzuzöge. James Malory war nämlich nur einen Tag, nachdem er Jeremy ein neues Stadthaus geschenkt hatte, eilends zu seinem Bruder Jason nach Haverston gereist. Jeremy war sich ziemlich sicher, dass sein Vater sich nur deshalb für ein, zwei Wochen aufs Land begeben hatte, weil er fürchtete, dass Jeremy ihn sonst zum Möbelkaufen mitschleifen würde.
Beinahe wäre Jeremy entgangen, dass sich ein Schatten durch den Raum zum Bett hinüberstahl. Diesmal hatte er weder das Öffnen noch das Schließen der Tür bemerkt; keinen Mucks hatte er gehört. Wenn die Bewohner dieses Zimmers tatsächlich geschlafen hätten, wie ja anzunehmen war, wären sie durch diesen Eindringling sicherlich nicht aufgewacht.
Jeremy lächelte in sich hinein, bevor er ein Streichholz anzündete und damit über die Kerze auf dem Tisch strich, den er neben seinen Stuhl gestellt hatte. Augenblicklich starrte der Dieb ihn an. Jeremy hatte sich ansonsten nicht gerührt und saß ganz entspannt an seinem Platz. Der Dieb hatte ja keine Ahnung, wie schnell er sich im Notfall bewegen konnte, um ein Entkommen des Halunken zu verhindern. Dieser machte jedoch keinerlei Anstalten zu fliehen; er war so überrascht, weil man ihn erwischt hatte, dass er wie angewurzelt stehen blieb.
„Na so was.“ Percy hob den Kopf. „Haben wir endlich Glück?“
„Ich würde sagen, Ja“, erwiderte Jeremy. „Habe ihn überhaupt nicht gehört. Das ist unser Mann oder unser Junge, je nachdem.“
Allmählich erholte sich der Dieb von seinem Erstaunen, und was er hörte, schien ihm nicht sonderlich zu gefallen, wenn man danach ging, wie misstrauisch Jeremy plötzlich die Augen zusammenkniff. Dieser ging jedoch nicht weiter darauf ein, sondern hielt zunächst danach Ausschau, ob der Dieb eine Waffe trug. Er konnte keine entdecken. Seine eigenen Waffen hatte Jeremy natürlich in den Jackentaschen verborgen, auf jeder Seite eine Pistole; dass er bei dem Dieb keine sah, bedeutete also nicht, dass er wirklich keine hatte.
Der Bursche war viel größer als die anderen Schurken, die versucht hatten, sie auszurauben. Er war ein richtiger Schlaks, aber seinen glatten Wangen nach zu urteilen nicht älter als fünfzehn oder sechzehn. Aschblondes Haar, so hell, dass es mehr weiß als blond schimmerte, mit kurz geschnittenen Naturlocken. Ein verbeulter Hut, der seit ein paar Jahrhunderten aus der Mode war. Der dunkelgrüne Samtrock eines Gentlemans war zweifellos gestohlen und sah so schmuddelig aus, als hätte der Junge oft darin geschlafen. Darunter lugten ein ehemals weißes Hemd mit Rüschen am Hals und schwarze Hosen mit langen Beinen hervor. Schuhe trug der Bursche keine. Ganz schön gewieft – kein Wunder, dass er bislang kein Geräusch verursacht hatte.
Für einen Dieb war er ziemlich auffällig, doch das lag vermutlich daran, dass er ein so gut aussehender Junge war. Und er hatte sich eindeutig von seiner Überraschung erholt. Jeremy wusste auf die Sekunde genau, wann er losstürzen würde, sodass er vor dem Burschen an der Tür war und sich mit verschränkten Armen dagegen lehnte.
Lässig lächelte er den Jungen an. „Du willst doch nicht etwa schon gehen, mein Lieber? Du hast unseren Vorschlag noch nicht gehört.“
Dem Dieb blieb erneut der Mund offen stehen. Das mochte an Jeremys Lächeln liegen, wahrscheinlicher aber daran, wie schnell dieser als Erster an der Tür gewesen war. Diesmal fiel das sogar Percy auf, der sich beklagte: „Verflucht, er gafft dich an wie sonst die Weiber. Wir brauchen einen Mann und kein Kind!“
„Das Alter spielt keine Rolle, mein Bester“, entgegnete Jeremy. „Auf Geschicklichkeit kommt es an; in welcher Verpackung diese steckt, ist kaum von Belang.“
Nun errötete der Junge, der offenbar beleidigt war, und mit einem finsteren Blick zu Percy hinüber sprach er zum ersten Mal. „Hab noch nie so einen hübschen Lackaffen gesehen, das ist alles.“
Beim Wort „hübsch“ musste Percy lachen; Jeremy dagegen fand das gar nicht komisch. Der Letzte, der ihn hübsch genannt hatte, war dafür ein paar Zähne losgeworden.
„Das musst du gerade sagen; du siehst doch aus wie ein Mädchen“, konterte er.
„Ja, das tut er wirklich“, pflichtete Percy ihm bei. „Du solltest dir ein paar Haare auf den Wangen wachsen lassen, zumindest bis deine Stimme ein, zwei Oktaven tiefer wird.“
Wieder wurde der Junge rot und brummelte undeutlich: „Da kommt halt nichts – noch nicht. Bin erst fünfzehn, glaub ich jedenfalls. Nur groß für mein Alter.“
Jeremy hätte vielleicht Mitleid für den Jungen empfunden, denn sein „glaub ich jedenfalls“ deutete darauf hin, dass er nicht wusste, in welchem Jahr er geboren war. Das war in der Regel bei Waisenkindern der Fall. Doch noch zwei andere Dinge waren ihm gleichzeitig aufgefallen. Die Stimme des Jungen hatte zunächst hell geklungen und war dann in eine tiefere Tonlage gekippt, als steckte er gerade in der peinlichen Phase des Stimmbruchs. Jeremy glaubte allerdings nicht, dass die Stimme von allein nach unten gerutscht war; dazu hatte der Wechsel zu künstlich geklungen.
Das Zweite, das ihm bei näherem Hinsehen auffiel, war, dass der Bursche nicht nur gut aussah, sondern eine echte Schönheit war. Das Gleiche hätte man nun auch über Jeremy sagen können, als er in diesem Alter gewesen war, nur dass er dabei männlich gewirkt hatte, dieser Junge dagegen eindeutig mädchenhafte Züge trug. Die zarten Wangen, die üppigen Lippen, das kecke Näschen – und noch einiges mehr. Das Kinn war zu schwach ausgeprägt, der Hals zu schlank, sogar die Körperhaltung war allzu verräterisch, zumindest für einen Mann, der die Frauen so gut kannte wie Jeremy.
Dennoch hätte Jeremy womöglich nicht seine Schlüsse daraus gezogen, zumindest nicht sofort, wenn sich nicht seine Stiefmutter ebenso verkleidet hätte, als sie seinem Vater zum ersten Mal begegnet war. Sie hatte unbedingt nach Amerika zurückkehren wollen, und die einzige Möglichkeit dazu schien damals zu sein, sich als James’ Kabinenjunge zu verdingen. Natürlich hatte James von Anfang an gewusst, dass sie kein Junge war, und so wie er es erzählte, hatte er einen Heidenspaß daran gehabt, zum Schein auf ihr Spiel einzugehen.
In diesem Fall konnte Jeremy sich jedoch auch täuschen; das war zumindest nicht völlig auszuschließen. Andererseits irrte er sich selten, wenn es um Frauen ging.
Nun, es bestand keine Veranlassung, die Kleine bloßzustellen. Welchen Grund sie auch immer hatte, ihr Geschlecht zu verbergen, es ging nur sie etwas an. Jeremy war zwar neugierig, doch hatte er schon vor langer Zeit gelernt, dass Geduld sich in solchen Fällen am meisten auszahlte. Abgesehen davon wollten sie nur eines von der Kleinen – ihre Geschicklichkeit.
„Wie heißt du denn, Junge?“, fragte Jeremy.
„Geht Sie einen feuchten Dreck an.“
„Ich glaube, ihm ist noch nicht ganz klar, dass wir ihm einen Gefallen tun wollen“, bemerkte Percy.
„Pah, eine Falle …“
„Nein, nein. Betrachte es eher als Gelegenheit zu arbeiten“, korrigierte Percy.
„Quatsch, eine Falle“, beharrte ihr Dieb. „Und auf Ihr Angebot pfeif ich, egal was es ist.“
Jeremy zog eine schwarze Augenbraue hoch. „Bist du nicht wenigstens ein klein wenig neugierig?“
„Nä“, entgegnete der Dieb dickköpfig.
„Wie schade. Das Schöne an Fallen ist ja, dass man nicht aus ihnen herauskommt, es sei denn, man wird befreit. Sehen wir so aus, als wollten wir dich hieraus befreien?“
„Sie sind nicht bei Trost, so sehen Sie aus. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich allein bin? Die anderen kommen mich holen, wenn ich nicht zurück bin wie verabredet.“
„Die anderen?“
Die Frage brachte Jeremy erneut einen finsteren Blick ein, doch er zuckte nur unbeeindruckt die Achseln. Er bezweifelte nicht, dass die Kleine mit einer ganzen Diebesbande unterwegs war, die einen nach dem anderen zu ihm und Percy hineingeschickt hatte, um die ahnungslosen Adligen auszurauben, die sich in ihr Revier verirrt hatten. Dass die anderen das Mädchen suchen würden, glaubte er jedoch nicht. Bestimmt waren sie viel eher an dem dicken Geldbeutel interessiert, den sie erwarteten, als an irgendeiner Befreiungsaktion. Wenn überhaupt, würden sie annehmen, der Versuch des Mädchens wäre gescheitert, es wäre festgenommen, zusammengeschlagen oder umgebracht worden. Bald würden sie den nächsten Dieb losschicken.
Daher sollten sie auch ihre Zelte abbrechen und sich auf den Weg machen, nun, da sie ihr Opfer in der Hand hatten. Also sagte Jeremy liebenswürdig: „Setz dich, Junge; dann erkläre ich dir, wofür du deine Dienste angeboten hast.“
„Ich hab keine Dienste ange…“
„O doch. Als du durch diese Tür gekommen bist, hast du eindeutig deine Dienste angeboten.“
„Falsches Zimmer“, versuchte der Dieb ihnen weiszumachen. „Sind Sie noch nie aus Versehen ins falsche Zimmer gelatscht?“
„Natürlich, aber für gewöhnlich hatte ich dabei Schuhe an“, erwiderte Jeremy trocken.
Das Mädchen errötete erneut und fluchte wie ein Müllkutscher.
Jeremy gähnte. So sehr er auch das Katz-und-Maus-Spiel genossen hatte, er wollte nicht, dass es die ganze Nacht dauerte. Und bis zu Heddings Haus auf dem Land hatten sie noch ein gutes Stück Wegs vor sich.
Daher war sein Ton ein wenig strenger, als er das Mädchen aufforderte: „Jetzt setz dich, oder ich drücke dich persönlich in diesen Sessel …“
Er brauchte nicht zu Ende zu sprechen. Die Kleine stürzte zu dem Sessel und hechtete förmlich hinein. Sie wollte eindeutig nicht riskieren, dass er sie anfasste. Erneut unterdrückte Jeremy ein Lächeln, als er von der Tür wegtrat und sich vor das Mädchen stellte.
Nun machte Percy ausnahmsweise einmal einen vernünftigen Vorschlag: „Hör zu, das können wir doch alles unterwegs erklären, oder? Wir haben unseren Mann. Gibt es also einen Grund, noch einen Augenblick länger in diesem hundsmiserablen Quartier zu verweilen?“
„Recht hast du. Such mir mal was zum Binden.“
„Wie?“
„Um ihn zu fesseln. Oder ist es dir entgangen, dass unser Dieb kein bisschen kooperativ ist – noch nicht?“
In diesem Augenblick stürzte ihr Dieb mit dem Mut der Verzweiflung zur Tür.
2
Jeremy hatte gewusst, dass dies passieren würde – noch ein Versuch, ihnen zu entkommen, bevor es zu spät war. Er hatte es in den Augen des Mädchens gelesen, kurz bevor es an ihm vorbeigeflitzt war. Daher war er an der Tür, noch bevor es sie öffnen konnte. Anstatt sich nur dagegenzustemmen, um das Mädchen an der Flucht zu hindern, beschloss er, sich endgültig zu vergewissern, ob seine Vermutung stimmte, dass ihr Dieb kein Junge war, und legte die Arme um den schlanken Körper. Nein, er hatte sich nicht geirrt. Unter seinen Unterarmen spürte er eindeutig weibliche Brüste, zwar flachgebunden, aber unverkennbar.
Die Kleine stand während seiner Entdeckung nicht still. Sie drehte sich um, und, großer Gott, das war sogar noch besser, denn Jeremy ließ sie noch nicht los. Dass sich ein hübsches Mädchen in seinen Armen winden würde, war das Letzte, das er von dieser Nacht erwartet hatte. Nun, da er genau wusste, dass sie ein Mädchen war, amüsierte er sich königlich.
„Ich sollte dich nach Waffen absuchen“, raunte er mit rauer Stimme. „O ja, das sollte ich wahrhaftig tun.“
„Ich hab keine …“, setzte die Kleine an, schnappte jedoch nach Luft, als Jeremy seine Hände über ihr Hinterteil gleiten und dort verweilen ließ.
Anstatt ihre Taschen abzuklopfen, wie seine Ankündigung vermuten ließ, drückte er ihre Pobacken sanft. Weich, weiblich war sie, und plötzlich verspürte Jeremy das Bedürfnis, mehr zu tun, als sie nur abzutasten. Er wollte ihre Lenden fest an die seinen pressen, ihr die albernen Hosen herunterziehen, mit den Fingern über ihre nackte Haut streichen und in ihre feuchte Wärme eindringen. Seine Position war geradezu ideal dafür, denn immer noch umschlossen seine Hände ihr prachtvolles Gesäß. Auch ein gewisser Teil von ihm kam allmählich in die ideale Position … Doch Jeremy wollte nicht, dass die Kleine merkte, wie sie auf ihn wirkte.
„Sind die gut genug?“, fragte Percy und erinnerte Jeremy daran, dass er mit dem Mädchen nicht allein war.
Seufzend wandte er sich wieder ihrem eigentlichen Vorhaben zu, schleifte die Diebin zurück zu dem Sessel und stieß sie hinein. Er beugte sich über sie, stützte die Hände auf die Armlehnen und flüsterte: „Bleib da, wenn du meine Hände nicht am ganzen Leib spüren willst.“
Beinahe musste er lachen, so stocksteif blieb sie sitzen. Doch der finstere Blick, den sie ihm zuwarf, schwor ihm Rache. Nicht, dass Jeremy ihr dergleichen zugetraut hätte, aber sie selbst glaubte wahrscheinlich, dazu in der Lage zu sein.
Mit einem Blick über die Schulter sah Jeremy, dass Percy doch noch einen Verwendungszweck für das Bettlaken gefunden hatte: Er hatte es in Streifen gerissen, die er in die Höhe hielt. „Die sind ausgezeichnet; bring sie her“, sagte Jeremy.
An dieser Stelle hätte er Percy das Kommando übergeben sollen, doch das tat er nicht. Stattdessen versuchte er, das Mädchen nicht mehr als unbedingt nötig anzufassen. Er gab sich wirklich Mühe, doch er liebte nun einmal die Frauen; dagegen konnte er nichts machen. Mit einer Hand hielt er beide Hände der Kleinen fest, während er einen Stoffstreifen um ihre Handgelenke wickelte. Ihre Hände waren warm und vor Angst ganz feucht. Sie konnte ja nicht wissen, dass sie ihr nichts tun wollten; ihre Furcht war also verständlich. Jeremy hätte sie beruhigen können, aber Percy hatte Recht: Sie mussten verschwinden, bevor der nächste Dieb auftauchte; daher mussten die Erklärungen noch warten.
Als Nächstes folgte der Knebel. Jeremy störte es nicht im Geringsten, dass er sich dicht über die Kleine beugen musste, um ihn in ihrem Nacken zu befestigen. Vermutlich hätte er ihr eher die Hände auf den Rücken binden sollen, doch er brachte es nicht übers Herz, es ihr unbequemer zu machen als nötig. Dass sie ihm die Faust in die Magengrube rammte, als er sich über sie beugte, hatte er nicht erwartet, doch selbst das ärgerte ihn nicht besonders, da sie aus ihrer Position heraus nicht fest zuschlagen konnte.
Ihren Beinen traute er dagegen überhaupt nicht. Wenn er in die Hocke gegangen wäre, um ihre Knöchel zu fesseln, hätte sie ihn mit Leichtigkeit umstoßen können, sodass er auf dem Allerwertesten gelandet wäre. Daher zog er es vor, sich auf die Armlehne des Sessels zu setzen und beide Beine der Kleinen auf seinen Schoß zu ziehen. Trotz des Knebels protestierte sie kurz, verhielt sich dann jedoch wieder ganz still. Sie trug lange Hosen und Socken, sodass Jeremy keine nackte Haut berühren konnte. Allein ihre Beine auf seinem Schoß hatten allerdings schon wieder eine ungebührlich starke Wirkung auf ihn. Als er fertig war, schaute er die Kleine mit einem Glühen in den Augen an, und sie hätte zweifellos gemerkt, dass er ihr Spiel durchschaute – wenn sie seinen Blick denn aufgefangen hätte. Doch sie sah Jeremy nicht an. Stattdessen versuchte sie, ihre Hände von den Fesseln zu befreien, was ihr auch schon fast gelungen war.
Erneut legte Jeremy eine Hand auf ihre und sagte: „Nicht. Sonst wird dich nicht mein Freund hier herausschleppen, sondern ich.“
„Was? Warum denn ich?“, beschwerte sich Percy. „Du bist viel stärker als ich; das gebe ich gern zu. Vor allem, da es so offensichtlich ist.“
So gern Jeremy die Kleine auch getragen hätte, er musste jetzt vernünftig sein. „Nein, du machst das. Einer von uns muss sich vergewissern, dass keiner irgendwelche Einwände dagegen hat, dass wir mit diesem Burschen abhauen. Das könntest du zwar auch, alter Knabe, aber ich bezweifle, dass du so viel Freude daran hättest wie ich.“
„Einwände?“, fragte Percy voller Unbehagen.
„Tja, wir spazieren nicht gerade Arm in Arm hier heraus, wir drei.“
Jetzt begriff Percy und beeilte sich zu sagen: „Ganz recht. Weiß auch nicht, was ich gerade gedacht habe. Im Schädeleinschlagen bist du viel besser.“
Jeremy musste sich das Lachen verbeißen – Percy hatte bestimmt noch nie im Leben jemandem den Schädel eingeschlagen.
Auf großen Widerstand stießen sie nicht. Unten in der Schänke war nur noch der Wirt, ein riesiger, hässlicher Geselle, der so bedrohlich wirkte, dass es den meisten Menschen wahrscheinlich schon mulmig wurde, wenn er nur in ihre Richtung schaute.
„He ihr, mit dem Gepäck da reist ihr mir nicht ab“, grollte er.
„Das ‚Gepäck’ hat versucht, uns auszurauben“, erklärte Jeremy, der sich zunächst bemühte, das Ganze friedlich zu regeln.
„So? Dann legt ihn um oder lasst ihn laufen. Aber zu den Wachen bringt ihr ihn nicht. Fehlt gerade noch, dass die mir hier rumschnüffeln.“
Jeremy machte noch einen letzten Versuch. „Wir haben keineswegs die Absicht, wegen dieser Angelegenheit die Ordnungshüter aufzusuchen, mein lieber Freund. Und dieses Gepäck ist morgen früh zurück, ohne einen Kratzer.“
Der Hüne machte Anstalten, sich um den Tresen herumzuschleppen, um ihnen den Ausgang zu versperren. „Hier bei uns gibt’s ein paar Regeln, Chef. Was hier ist, bleibt auch hier, wenn Sie begreifen, was ich meine.“
„Oh, im Begreifen von Dingen und im Ergreifen von Dieben bin ich ziemlich gut. Und wo ich herkomme, gelten ebenfalls Regeln. Manchmal muss man sie nicht einmal erklären – wenn Sie begreifen, was ich meine.“
Da Jeremy bezweifelte, dass sich so ein mächtiger Schädel einschlagen lassen würde, zückte er einfach eine seiner Pistolen und hielt sie dem Kerl ins Gesicht. Das funktionierte ausgezeichnet: Der Wirt hob die Hände und wich zurück.
„Kluges Kerlchen“, fuhr Jeremy fort. „Also, Sie können Ihren Dieb zurückhaben …“
„Ist nicht mein Dieb“, warf der wuchtige Wirt vorsichtshalber ein.
„Egal“, erwiderte Jeremy auf seinem Weg durch die Tür. „Er kommt zurück, sobald wir unsere Geschäfte mit ihm erledigt haben.“
Weitere Versuche, sie am Verlassen der Gegend zu hindern, gab es nicht. Ohnehin war der einzige Mensch, dem sie zu so später Stunde noch begegneten, eine betrunkene alte Frau, die aber noch klar genug im Kopf war, um bei ihrem Anblick sogleich die Straßenseite zu wechseln.
Percy war völlig außer Atem, nachdem er den Dieb vier Häuserblocks weit über der Schulter getragen hatte. Aus naheliegenden Gründen hatten sie die Kutsche nicht in der Nähe der Schänke abgestellt, vor allem, weil sie sonst bei ihrer Rückkehr vermutlich verschwunden gewesen wäre. Vier Häuserblocks weiter in einem weniger unsicheren, besser beleuchteten Viertel war ihnen angemessen vorgekommen, aber der Weg war doch ein bisschen zu lang, um den Dieb zu schleppen. So war es kaum eine Überraschung, dass Percy seine Last einfach auf den Boden der Kutsche warf, und zwar nicht gerade sanft. Zu mehr war er vor lauter Erschöpfung nicht in der Lage.
Als Jeremy hinter Percy in die Kutsche stieg, sah er, dass er das Mädchen wohl oder übel erneut anfassen musste, um es auf den Sitz zu hieven. Er hatte sich wirklich bemüht, der Versuchung zu widerstehen, indem er Percy die Kleine schultern ließ. Er hätte sie durchaus selbst tragen und sich gleichzeitig um alles kümmern können, das ihnen in die Quere kam. Trotzdem hatte er Percy die Last aufgebürdet, weil er bereits herausgefunden hatte, was es bei ihm selbst anrichtete, wenn er das Mädchen berührte. Sie nur anzuschauen war etwas anderes; das hatte keine Wirkung auf einen Schürzenjäger wie ihn. Sie anzufassen war jedoch viel zu intim, und auf Intimitäten reagierte Jeremy grundsätzlich wollüstig.
Diese Kleine zu wollen, widerstrebte ihm jedoch. Sie war schön, ja, aber sie war eine Diebin, die vermutlich in der Gosse aufgewachsen war oder noch schlimmer. Ihr Benehmen lag höchstwahrscheinlich so weit unter seinen Ansprüchen, dass sich jedes Nachdenken darüber erübrigte.
Es half nichts. Der arme Percy war zweifellos genauso erschöpft, wie er aussah. Bevor Jeremy Hand an das Mädchen legte, bemerkte er, dass über dem Nachsinnen über sein Dilemma so viel Zeit verstrichen war, dass die Kutsche sich bereits in Bewegung gesetzt hatte und die Randbezirke der Stadt in Sicht kamen. Nun würde es ein Leichtes sein, ihr Opfer an der Flucht zu hindern; er konnte die Kleine also einfach losbinden, sodass sie es sich selbst auf dem Sitz bequem machen konnte.
Sogleich machte er sich ans Werk, zuerst an ihren Füßen, die ausgesprochen zierlich waren. Dann an ihren Händen. Den Knebel rührte Jeremy nicht an; schließlich konnte sie ihn jetzt selbst entfernen, was sie auch ohne Umstände tat. Ebenso umstandslos versetzte sie Jeremy einen Hieb, als sie sich vom Boden erhob.
Damit hatte er nicht gerechnet, obwohl er es eigentlich hätte wissen müssen. Schließlich hatte sie schon vorher versucht, ihn zu boxen. Er war darauf gefasst gewesen, dass sie Gift und Galle sprühen würde, ja, auch auf weitere ordinäre Flüche, gewiss – doch dass sie sich wie ein Kerl aufführen würde …
Natürlich traf das Mädchen daneben. Dank seines ausgezeichneten Reaktionsvermögens gelang es Jeremy, sein Kinn, auf das der Hieb gezielt hatte, aus der Schusslinie zu ziehen. Die Faust des Mädchens streifte aber immerhin seine Wange und landete auf seinem Ohr, in dem er nun einen brennenden Schmerz verspürte. Bevor er jedoch angemessen darauf reagieren konnte, sagte Percy sarkastisch: „Wenn du vorhast, ihn zu Brei zu schlagen, mein Lieber, dann sei bitte leise dabei. Ich möchte schlafen, bis wir da sind.“
Unterdessen wollte sich ihre Diebin flugs zur Tür wenden; Jeremy konnte sie jedoch gerade noch hinten am Kragen fassen und auf seinen Schoß zerren. „Wenn du das noch einmal versuchst, kannst du die nächsten paar Stunden genau an diesem Platz verbringen“, erklärte er und schloss die Arme so fest um sie, dass sie sich nicht rühren konnte.
Das bedeutete allerdings nicht, dass sie nicht weiter probierte freizukommen. Sich auf Jeremys Schoß zu winden war jedoch vermutlich das Schlimmste, das sie hätte tun können. Es war viel zu sinnlich und verführte Jeremy zu wollüstigen Gedanken daran, was er mit dem Mädchen getan hätte, wenn sie allein gewesen wären … Ihr langsam die Kleider abstreifen, herausfinden, wie sie ihre Brüste versteckte, an ihrer Schulter knabbern, während er in sie eindrang … Verflucht noch mal. Wenn sie weiter so auf ihm herumhopste, würde er am Ende Percy einfach für eine Weile aus der Kutsche verbannen.
Jeremy wurde klar, dass er das Rutschen und Zappeln ihres Hinterns auf seinen Schenkeln und Lenden nicht länger ertragen konnte, ohne dass offenkundig wurde, was sie da aufreizte. Nahezu gleichzeitig musste die Kleine begriffen haben, dass ihre Anstrengungen vergeblich waren. Sie stöhnte auf, was in Jeremys Ohren allerdings mehr leidenschaftlich als frustriert klang, sodass er sie plötzlich fallen ließ wie eine heiße Kartoffel. Himmel noch mal, es durfte nicht sein, dass sie so eine Wirkung auf ihn hatte. Er musste sich am Riemen reißen.
Die Kleine war zu Boden gestürzt, kletterte aber sogleich auf den Sitz gegenüber von Jeremy und Percy, zog ihre Rockaufschläge herunter, klopfte sich den Staub von den schmuddeligen Hosen und versuchte, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden, so gut es ging. Dabei war sie jedoch stets auf der Hut vor dem Gegenangriff, der Percys Bemerkung zufolge durchaus noch erfolgen konnte.
Jeremy wartete geschlagene fünf Minuten – so lange brauchte er, um sein Begehren so weit zu zügeln, dass man es hoffentlich auch seiner Stimme nicht mehr anmerkte. Endlich streckte er die Beine aus, schlug sie übereinander, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und sagte: „Keine Angst. Wir tun dir schon nichts. Du wirst uns einen Gefallen tun und dabei reich werden. Was könnte es Schöneres geben, he?“
„Dass Sie mich zurückbringen.“
„Steht nicht zur Debatte. Wir haben uns eine Menge Umstände gemacht, um dich zu beschaffen.“
„Vielleicht hätten Sie sich erst mal meine verdammte Erlaubnis beschaffen sollen – Mylord.“
Den Titel hatte die Kleine im Nachsatz und voller Verachtung hervorgestoßen. Nun da sie sich ziemlich sicher war, dass Jeremy sie nicht erdrosseln würde, starrte sie ihn wieder finster an. Jeremy versuchte, ihr nicht zu tief in die Augen zu schauen, und hoffte, sich bei dem schummrigen Kerzenlicht in dem Zimmer über der Schänke getäuscht zu haben. Doch die hellere Lampe in der Kutsche und die Nähe zu der Kleinen waren sein Verderben. Ihre Augen waren einfach sagenhaft und steigerten ihre Schönheit noch um ein Vielfaches. Blau waren sie, von einem dunklen, satten Veilchenblau, und standen damit in verblüffendem Kontrast zu ihrer weißblonden Lockenpracht. Ihre Wimpern waren lang, aber nicht übermäßig dunkel. Die Brauen waren ebenfalls nicht sehr dunkel, nur zwei, drei Nuancen goldener.
Jeremy gab sich wirklich Mühe, in dem Gesicht vor seiner Nase etwas Männliches zu entdecken, aber da war einfach nichts. Wie irgendjemand die Kleine für einen Jungen halten konnte, war ihm schleierhaft. Und doch war sie in Percys Augen eindeutig ein Bursche, wenn auch ein „hübscher“. Es musste wohl an ihrer Größe liegen, mutmaßte Jeremy. Immerhin begegnete man nur selten einem weiblichen Wesen, das gut und gern so groß wie sein Vater war. Jeder, der so groß gewachsen war, wurde erst einmal für männlich gehalten.
Ebensolche Mühe gab Jeremy sich, auf die Kleine nicht so zu reagieren, wie es bei jeder anderen schönen Frau, die ihm über den Weg lief, der Fall gewesen wäre. Aber diese Augen … Er gab es auf. Er würde sie in sein Bett bekommen, und zwar noch bevor diese Nacht zu Ende war. Es würde geschehen. Daran hatte er nicht die geringsten Zweifel.
Als er seinem Begehren das Feld überlassen hatte, war er sofort wie ausgewechselt. Manche mochten es Charme nennen, doch in Wahrheit war es pure Sinnlichkeit, und schaute man ihn an, wenn er unzüchtige Gedanken hatte, sah man die Verheißung ungeahnter Lüste.
Die Kleine reagierte sofort auf die Blicke, mit denen er sie nun ansah, und wandte die Augen ab, allerdings nicht, ohne vorher zu erröten. Jeremy lächelte. Er hatte gewusst, dass sie nicht leicht zu erobern sein würde, aber dieses Erröten sprach Bände. Sie war ebenso wenig unempfänglich für seine Reize wie andere Frauen. Noch würde er ihr kleines Geheimnis jedoch nicht verraten. Vorerst würde er sie weiterhin ihre Rolle spielen lassen – zumindest, bis er allein mit ihr war.
Zunächst griff er ihre Bemerkung wieder auf und fragte: „Hättest du dir nicht unsere Erlaubnis beschaffen müssen, bevor du uns ausraubst?“ Da ihm dies nur ein weiteres Erröten einbrachte, fuhr Jeremy fort: „Aber das hast du wohl für gewöhnlich nicht getan. Also lass mich dir erklären, was getan werden muss und warum, bevor du wieder blindlings alles ablehnst. Mein Freund hier hat sich ausrauben lassen, weißt du, aber auf rechtmäßige Weise.“
„Wenn Sie schon alles erklären müssen“, warf das Mädchen ein, „dann wenigstens so, dass man was versteht.“
Nur Genörgel, nichts weiter. Ermutigend. Offenbar würde die Kleine ihm wirklich zuhören. „Es geschah beim Glücksspiel.“
Ein Schnauben. „Das ist kein Ausraubenlassen, das ist Dummheit. Ein ganz schöner Unterschied, Mister.“
Jeremy grinste. Das machte die Kleine offensichtlich nervös, worauf sein Grinsen jedoch nur wissender wurde. Dann erklärte er ihr, dass der Bösewicht, der es vorgezogen hatte, unfair zu spielen, Heddings hieß und dass sie an Percys und seiner statt für Percys Missgeschick Vergeltung üben würde.
„Wir bringen dich zu Heddings’ Landhaus“, fuhr Jeremy fort. „Es ist ziemlich groß und wird voller Dienstboten sein. Daher werden sie zu Recht davon ausgehen, dass kein vernünftiger Dieb auf den Gedanken kommen würde, sie auszurauben. Was dir zugutekommt, Junge.“
„Wieso?“
„Die Türen werden vielleicht verschlossen sein, aber die Fenster lassen sie um diese Jahreszeit vermutlich offen. Dass sie nicht damit rechnen, ausgeraubt zu werden, bedeutet, dass sie nicht auf der Hut sein werden. Und da es schon nach Mitternacht ist, dürften die Dienstboten schlafen und bis zum Morgen nicht im Weg herumspringen. Du dürftest also keine Schwierigkeiten haben, ins Haus zu gelangen.“
„Und dann was?“
„Du musst unbemerkt ins Schlafzimmer des Hausherrn schleichen. Gut möglich, dass Heddings darin sein wird, aber an so etwas bist du sicherlich gewöhnt. Wie die Dienstboten dürfte auch er um diese Zeit fest schlafen. Dann tust du das, was du am besten kannst: Du raubst den Mann aus.“
„Woher wollen Sie wissen, dass er seinen wertvollen Kram nicht in einem Tresor hat?“
„Er lebt nicht in London. Auf ihren Landsitzen fühlen die Reichen sich viel sicherer.“
„Und was soll ich da genau klauen?“
„Vor allem zwei Ringe, beide sehr alt.“
„Ich brauch eine Beschreibung, Mister, wenn ich sie aus seinen Sachen raussuchen soll.“
Jeremy schüttelte den Kopf. „Wie sie aussehen, spielt keine Rolle; du kannst nicht einfach nur Percys Ringe mitnehmen. Dann wüsste Heddings sofort, bei wem er suchen soll. Deine Aufgabe unterscheidet sich nicht von dem, was du sonst auch tust: Du nimmst einfach alle Wertsachen mit, die du findest. Den Rest kannst du behalten; das ist dein Gewinn. Juwelen, die bestimmt ein paar tausend Pfund wert sind.“
„Ein paar tausend!“ Das Mädchen starrte ihn mit offenem Mund an.
Jeremy nickte mit leisem Lachen. „Na, bist du jetzt froh, dass wir dich mitgenommen haben?“
Die schönen veilchenblauen Augen verengten sich plötzlich zu schmalen Schlitzen. „Egal, wie wertvoll das Zeug ist. Sie sind ein verdammter Idiot, wenn Sie glauben, irgendwelche Klunker entschädigen mich für den Ärger, den ich kriege, wenn ich nicht vorher frage, ob ich das hier machen darf.“
Jeremy runzelte die Stirn, aber nicht wegen der unhöflichen Anrede. „Wirst du an einer so kurzen Leine gehalten?“
„Ich muss mich an die Regeln halten, und wegen Ihnen hab ich schon gegen die meisten verstoßen.“
Jeremy seufzte tief auf. „Das hättest du auch früher sagen können.“
„Hab gedacht, der Wirt hält Sie auf. Hätte nicht geglaubt, dass so ein großer Kerl so ein Feigling ist.“
„Niemand bekommt gern eine Kugel in den Kopf“, verteidigte Jeremy den Wirt. „Aber er kann bezeugen, dass du in der Angelegenheit keine Wahl hattest. Was genau ist also das Problem?“
„Geht Sie nichts an …“
„Ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein. Du hast gerade dafür gesorgt, dass es mich etwas angeht.“
„Einen Teufel hab ich. Sie haben sich sowieso schon viel zu viel in mein Leben eingemischt, kapiert? Also Schluss damit, oder wir reden hier über gar nichts mehr.“
Nach einigen langen Augenblicken nickte Jeremy – fürs Erste. Dass sie ihrem Dieb größere Schwierigkeiten bereiteten, war nicht Teil ihres Plans gewesen. Nun würde er die Kleine nach Hause begleiten müssen, wenn sie fertig waren, um eventuelle Probleme, die er ihr gemacht hatte, aus der Welt zu schaffen.
Eigentlich hätte es aber keine Probleme geben sollen, und an diesem Punkt wurde ihre Lage ziemlich absurd. Sie boten einem Dieb eine einmalige Gelegenheit. Jeder normale Beutelschneider hätte sofort mitgemacht und wäre heilfroh darüber gewesen, dass man ihm so ein goldenes Ei in den Schoß legte. Aber nein, sie mussten natürlich an die einzige Ausnahme geraten - an einen Dieb aus einer Bande, die sich offenbar derart in Regeln festgefahren hatte, dass keiner von ihnen nebenbei ein Ding drehen konnte, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Logisch war das nicht. Was für einen verdammten Unterschied machte es, wann, wo oder was jemand klaute, solange er die fette Beute nach Hause brachte?
Die Kutsche hielt an. Aufseufzend sagte Percy: „Endlich!“ Dann: „Viel Glück, Junge. Nicht, dass du es brauchen würdest. Wir haben vollstes Vertrauen zu dir, wirklich. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ist verflixt schwierig, sich vor der eigenen Mutter zu verstecken, vor allem, wenn man mit ihr unter einem Dach lebt.“
Jeremy öffnete die Tür der Kutsche und stieg mit dem Mädchen aus, bevor Percy eine seiner üblichen langatmigen Reden halten konnte. Sie befanden sich in den Wäldern ganz in der Nähe von Heddings’ Anwesen. Jeremy nahm den Arm der Kleinen und führte sie zwischen den Bäumen hindurch, bis das Haus in Sicht war.
„Ich würde dir ebenfalls Glück wünschen, aber wahrscheinlich brauchst du es wirklich nicht“, sagte er zum Abschied. „Ich habe ja gesehen, wie geschickt du dich anstellst.“
„Woher wollen Sie eigentlich wissen, dass ich nicht nach Hause flitze, wenn ich außer Sichtweite bin?“
Jeremy lächelte, obwohl das Mädchen es wahrscheinlich nicht sehen konnte. „Weil du absolut keine Ahnung hast, wo du bist. Weil es mitten in der Nacht ist. Weil du mit uns viel, viel schneller zurück nach London kommst, als wenn du versuchst, den Weg allein zu finden. Weil du lieber mit den Taschen voller funkelnder Edelsteine nach Hause kommst als mit leeren Händen. Weil …“
„Das waren genug Weils“, grummelte das Mädchen leise.
„Ganz recht. Aber eins versichere ich dir noch. Wenn du aus einem unerklärlichen Grund doch entdeckt werden solltest, mach dir keine Sorgen. Ich werfe dich nicht den Wölfen zum Fraß vor. Ich sorge dafür, dass du wieder freikommst, koste es, was es wolle. Darauf kannst du dich verlassen.“
3
Ich werfe dich nicht den Wölfen zum Fraß vor. Wollte er sie zum Narren halten? Er war doch der verdammte Wolf. Aber wenigstens konnte sie wieder normal atmen, nun da er nicht mehr in der Nähe war und sie mit diesen durchdringenden blauen Augen anschaute.
Beinahe hätte sie sich verraten durch ihr ständiges Erröten, und es hatte sie auch beunruhigt, dass sie die Empfindungen, die dieser Gentleman in ihr auslöste, nicht unter Kontrolle hatte. In der Regel kam sie mit Männern gut zurecht, schließlich war sie „einer“ von ihnen. Einem von Malorys Kaliber war sie allerdings bisher noch nie so nahegekommen. Ihn nur anzusehen brachte sie schon vollkommen durcheinander; sie fand ihn so attraktiv!
Danny war noch nie im Leben so verzweifelt gewesen, vielleicht abgesehen von einer Ausnahme. Damals war sie jedoch noch zu jung gewesen, um zu begreifen, in welcher Gefahr sie schwebte; sie hatte nicht gewusst, dass es ihren sicheren Tod bedeutet hätte, wenn sie geblieben wäre, wo sie war. Verstanden hatte sie nur, dass sie mutterseelenallein auf der Welt war und niemanden hatte, den sie um Hilfe bitten konnte.
Heute war sie nicht mehr allein, aber das machte auch keinen großen Unterschied. Seit ein paar Jahren vollführte sie nun schon einen Drahtseilakt und lebte in ständiger Angst, weil sie allmählich zu alt wurde, um zu verbergen, dass sie niemals so männliche Proportionen bekommen würde, wie all die anderen Jungs sie nach und nach entwickelten. Früher oder später würde jemand durchschauen und aufdecken, dass sie alle von Anfang an getäuscht hatte.
In den ersten Jahren war es leicht gewesen, ihr Geheimnis zu bewahren, viel leichter, als sie es sich erhofft hatte. Und das nur, weil Lucy Recht behalten hatte. Als sie Danny in zerlumpten Kniehosen zu der übrigen Rasselbande gebracht hatte, die langen Haare im Nacken abgeschnitten, in einem zu großen Hemd, einem zu kleinen Mantel und dem alten Hut, den Danny aufgelesen hatte, um ihre Augen vor dem Regen zu schützen, hatte das einen bleibenden Eindruck hinterlassen, an dem nie gerüttelt worden war.
Rasch war sie „einer der Jungs“ geworden. Sie hatte gelernt, mit den anderen zu stehlen, zu kämpfen, alles zu tun, was sie machten – na ja, außer wenn sie nach der Art weiblicher Gesellschaft Ausschau hielten, von der Danny lieber nichts wissen wollte.
Zurzeit waren sie vierzehn Jungs und Mädchen und wohnten in einem heruntergekommenen Haus, für das Dagger die Miete zahlte. Im Lauf der Jahre hatten sie in vielen solcher Gebäude gehaust, sogar in verlassenen Mietskasernen, als kein Geld da war, um Miete zu bezahlen.
Dagger blieb nie lange an einem Ort. Ihr jetziges Zuhause hatte vier Zimmer: eine Küche, zwei Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer. Das eine Schlafzimmer beanspruchte Dagger für sich. Die Mädchen bekamen das andere, zum Schlafen oder zum Arbeiten, wenn sie alt genug waren, um anschaffen zu gehen. Alle anderen, Danny eingeschlossen, schliefen in dem großen Wohnzimmer.
Es gab einen kleinen Hinterhof. Obwohl dort kein Gras wuchs, war er für die Kinder ganz schön zum Spielen. Danny hatte Hinterhöfe immer gern gemocht, nachdem sie erst einmal ihre Abneigung gegen das ständige Schmutzigsein überwunden hatte. Baden kam für sie nicht infrage, zumindest nicht in den großen Wannen, die einmal in der Woche für alle in der Küche aufgestellt wurden. Stattdessen stahl sie sich zum Fluss hinunter, wenn es möglich war. Und der Regen wurde ihr Freund.
Lucy war ihre einzige Vertraute. Die Freundin bekam nicht die Pocken, wie sie befürchtet hatte, als sie auf Daggers Drängen schließlich doch ihre Haut zu Markte trug. Danny verstand Daggers Logik, auch wenn sie ihr nicht gefiel. Da Lucy ganz hübsch war, hätte sie bei den Leuten, die sie ausrauben wollte, viel zu viel Aufmerksamkeit erregt. Ein Taschendieb musste jedoch für sein Opfer nahezu unsichtbar sein. Das war bei Lucy ausgeschlossen. Wie sonst sollte sie also ihren Lebensunterhalt verdienen?
Dagger war schon damals der Älteste von ihnen gewesen und war es immer noch; er war ihr unbestrittener Anführer. Am Anfang hatte es nur wenige Regeln gegeben, nichts, das irgendjemanden ernsthaft gestört hätte. Dagger schien jedoch zu glauben, kein richtiger Leitwolf zu sein, wenn er nicht immer wieder einmal neue Vorschriften einführte.
Danny stritt sich nie mit Dagger; sie tat stets klaglos, wie ihr geheißen. Sein scharfes Auge war das Einzige, das sie wirklich fürchtete, denn außer Lucy gehörte nur Dagger seit Dannys erstem Tag zu der Bande. Irgendwann musste ihm in den Sinn kommen, die Jahre zu zählen – und dann würde er sich fragen, warum ein einundzwanzigjähriger Mann immer noch das Gesicht eines zwölfjährigen Jungen hatte.
Dagger selbst war inzwischen um die Dreißig und immer noch der Anführer einer Horde Waisenkinder. Er hätte etwas anderes machen können. Das taten die meisten von ihnen, wenn sie auf die Zwanzig zugingen, weil sie dann mehr wollten, als sie bei der Bande bekamen. Sie wollten behalten dürfen, was sie gestohlen hatten, und nicht alles Dagger geben, damit er etwas zu essen kaufte, die Miete bezahlte und gelegentlich irgendeinen Schnickschnack mit nach Hause brachte, um einen von ihnen bei Laune zu halten. Dagger hätte sich ebenfalls einträglicheren Verbrechen zuwenden können, doch das hatte er nie getan.
Er meinte es gut, auch wenn er sie nicht mit Samthandschuhen anfasste. Danny hatte schon vor Jahren erkannt, dass irgendwo unter seiner rauen Schale ein weicher Kern steckte. Wahrscheinlich glaubte er, als Anführer hart und unnachgiebig sein zu müssen. Danny vermutete jedoch, dass Dagger sich nicht nur als ihr Anführer fühlte, sondern auch als ihr Vater. Daher war er nicht weitergezogen wie der Rest der Bande. Neue Waisenkinder waren zu ihnen gestoßen, andere gegangen. Nie waren sie viel mehr als etwa zwanzig gewesen, aber auch nie weniger als zehn. Es gab immer irgendjemanden, um den man sich kümmern musste.
Die oberste Regel der Bande lautete, Angehörige der gehobenen Gesellschaft nie in ihren Häusern auszurauben. Das war nämlich die sicherste Methode, um die Reichen zu den Waffen greifen zu lassen und um zu erreichen, dass die Polizei die Armenviertel nach den Schuldigen durchkämmte. Wenn sie dabei ein Haus voller Waisenkinder fand, die nicht offiziell als Waisen geführt wurden, waren Dagger und seine Bande geliefert. Von den echten Waisenhäusern hatte Dagger Horrorgeschichten erzählt, die er aus erster Hand kannte, da er selbst vor Jahren aus einem abgehauen war. Seine Berichte hatten ausgereicht, um besagte Regel durchzusetzen, gegen die Danny in dieser Nacht verstieß.
Nicht dass die gehobene Gesellschaft tabu gewesen wäre, keineswegs. Doch solche Leute durften nur ausgeraubt werden, wenn sie draußen unterwegs waren: auf der Straße, in den Schänken, auf dem Markt oder wenn sie irgendwelche Einkäufe erledigten und vielleicht nicht einmal merkten, dass ihnen ein paar Münzen fehlten. Oder falls doch, mochten sie glauben, sie hätten sie verloren oder ausgegeben, ohne sich daran zu erinnern.