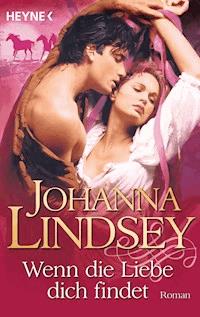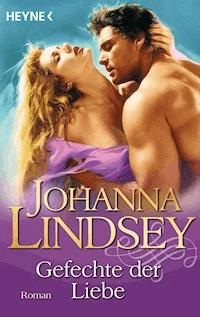6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau kämpft um die große Liebe
Den geeigneten Ehemann zu finden ist eine wahre Kunst! Diese Erfahrung macht auch die selbstbewusste Gabrielle Brooks. Als sie nach England kommt, um genau diesen dort zu finden, ist es bereits zu spät. Die Ballsaison ist vorüber und alle interessanten Männer sind vergeben. Bis auf einen: den schneidigen Kapitän Drew Anderson. Leider hat dieser gar kein Interesse daran zu heiraten. Doch Gabrielle hat sich in ihren hübschen Kopf gesetzt, ihn zu erobern – notfalls mit Gewalt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Die hübsche und selbstbewusste Gabrielle Brooks sucht einen geeigneten Ehemann. Doch als sie für dieses Vorhaben nach London kommt, ist es bereits zu spät: Die Ballsaison ist vorüber und alle interessanten Männer sind vergeben. Erschwerend kommt hinzu, dass Gabrielle die Tochter eines Piraten ist, was für einen unglaublichen Skandal in der feinen Londoner Gesellschaft sorgen würde. Doch es gibt noch einen Kandidaten: den attraktiven Kapitän Drew Anderson. Dummerweise hat der jedoch überhaupt kein Interesse an einer Ehefrau. Aber Gabrielle hat sich in ihren hübschen Kopf gesetzt, ihn zu erobern – und erinnert sich daran, dass echtes Piratenblut in ihr fließt ...
»Erstklassige Romantik.« The New York Times
»Johanna Lindsey berührt die Herzen.« San Diego Tribune
Zum Autor
Johanna Lindsey wächst auf Hawaii auf. Sie heiratet nach der Highschool und hat bereits zwei kleine Kinder zu versorgen, als sie sich zum Schreiben berufen fühlt. 1976 veröffentlicht sie ihren ersten Roman. In den folgenden zwölf Jahren verfasst sie 17 weitere, die in über 12 Sprachen übersetzt wurden. Inzwischen hat sie drei Kinder und schreibt jeden Tag 10 bis 16 Stunden an ihren historischen Liebesromanen. Johanna Lindsey lebt mit ihrer Familie auf Hawaii.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Man hatte ihr befohlen, sich zu verstecken. Das war auch Gabrielle Brooks erster Gedanke gewesen, als sie, vom Lärm angelockt, an Deck gekommen war und gesehen hatte, was die Unruhe ausgelöst hatte. Die Order stammte allerdings nicht vom Kapitän. Der war sicher, das Schiff, das sie verfolgte, abschütteln zu können. Er hatte sogar gelacht und der Piratenflagge am Hauptmast des angreifenden Schiffes, die bereits mit bloßem Auge zu erkennen war, mit der Faust gedroht. Seine Kampfbereitschaft – oder sollte sie es gar Begeisterung nennen? – hatte sie sehr erleichtert. Bis der erste Offizier sie beiseite genommen und ihr befohlen hatte, sich zu verstecken.
Anders als der Kapitän schien Avery Dobs nicht besonders erpicht auf die bevorstehende Auseinandersetzung. Mit einem Gesicht so weiß wie die Extrasegel, die von der Mannschaft eilig gesetzt worden waren, hatte er sie recht unsanft zur Treppenluke geschoben.
»Nehmen Sie eins der leeren Lebensmittelfässer im Laderaum. Es gibt jetzt reichlich davon. Wenn Sie Glück haben, öffnen die Piraten bloß ein oder zwei und kümmern sich nicht weiter darum, wenn sie feststellen, dass dort nichts mehr zu holen ist. Ihrer Bediensteten werde ich ebenfalls raten, sich zu verstecken. Nun gehen Sie schon! Und was Sie auch hören, verlassen Sie den Laderaum nicht, bis jemand, dessen Stimme Sie kennen, Sie holen kommt.«
Er hatte nicht gesagt, bis ich Sie holen komme. Seine Angst war ansteckend und seine Grobheit ungewohnt. Da, wo er ihren Arm gepackt hatte, würde sie wohl blaue Flecken bekommen. Was für ein Gegensatz zu der höflichen Art, mit der er sie in den vergangenen drei Wochen behandelt hatte! Fast hätte man meinen können, er mache ihr den Hof, auch wenn das unwahrscheinlich war. Schließlich war Avery Dobs bereits über dreißig und Gabrielle hatte gerade die Schule beendet. Sein rücksichtsvolles Benehmen, seine sanfte Stimme und die übergroße Aufmerksamkeit, die er ihr seit der Abfahrt aus London widmete, hatten sie allerdings den Eindruck gewinnen lassen, dass er stärker an ihr interessiert war, als es ihm zustand.
Jedenfalls hatte er sie mit seiner Angst angesteckt, daher war sie in den Bauch des Schiffes gerannt. Die Lebensmittelfässer, von denen Avery gesprochen hatte, waren leicht zu finden und mittlerweile fast alle leer, denn sie näherten sich ihrem Ziel in der Karibik. In wenigen Tagen wären sie in den Hafen von St. George auf Grenada gesegelt, dem letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, von dem aus sie die Suche nach ihm beginnen wollte.
Obwohl sie nur schöne Erinnerungen an ihn hatte, kannte sie Nathan Brooks nicht besonders gut, doch nach dem Tod ihrer Mutter war er alles, was ihr geblieben war. Sie hatte nie daran gezweifelt, dass er sie liebte, auch wenn er nur selten längere Zeit bei ihr zu Hause gewohnt hatte. Einen Monat, vielleicht auch mehrere am Stück und in einem Jahr sogar einen ganzen Sommer – doch dann vergingen manchmal Jahre ohne einen Besuch von ihm. Nathan war Kapitän und Eigner eines Handelsschiffes und trieb einen sehr profitablen Handel mit den Westindischen Inseln. Er schickte Geld und extravagante Geschenke nach Hause, ließ sich selbst aber nur selten blicken.
Er hatte versucht, seine Familie zu sich zu holen, aber Carla, Gabrielles Mutter, wollte nichts davon hören. Ihr ganzes Leben war England ihre Heimat gewesen. Zwar hatte sie keine Familienangehörigen mehr, doch alles, was sie schätzte, und all ihre Freunde waren dort. Zudem hatte sie Nathans Beschäftigung mit dem Seehandel nie gutgeheißen. Handel. Das Wort hatte sie stets mit Verachtung ausgesprochen. Auch wenn sie selbst keinen Titel führte, hatte sie so viele Adelige in ihrem Stammbaum, dass sie auf alle, die sich mit Handel befassten, hinabschaute, selbst auf ihren eigenen Mann.
Es war ein Wunder, dass die beiden überhaupt geheiratet hatten. Wenn sie zusammen waren, vermittelten sie nämlich nicht den Eindruck, einander besonders zu mögen. Jedenfalls wollte Gabrielle ihrem Vater gegenüber niemals erwähnen, dass seine lange Abwesenheit Carla dazu verleitet hatte, eine … ach, sie konnte sich nicht einmal dazu bringen, das Wort zu denken, geschweige denn, es zu sagen. So peinlich berührt war sie von ihren eigenen Vermutungen. Doch in den vergangenen Jahren war Albert Swift ein regelmäßiger Gast in ihrem zweistöckigen Landhaus am Rande von Brighton gewesen, und wenn er in der Stadt war, hatte Carla sich stets aufgeführt wie ein Schulmädchen.
Als seine Besuche aufhörten und das Gerücht aufkam, er mache in London einer reichen Erbin den Hof, veränderte Gabrielles Mutter sich drastisch. Über Nacht wurde sie zu einer verbitterten Frau, die einem Mann nachtrauerte, der ihr gar nicht gehört hatte.
Ob er Carla Versprechungen gemacht hatte, oder ob Carla die Absicht gehabt hatte, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen, wusste niemand, doch als Albert seine Aufmerksamkeit einer anderen Frau zuwandte, schien Carlas Herz gebrochen zu sein. Sie verhielt sich ganz wie eine betrogene Frau, und als sie zu Beginn des Frühjahres krank wurde und ihr Zustand sich verschlimmerte, hatte sie sich keinerlei Mühe gegeben, wieder gesund zu werden. Sie hatte die Ratschläge des Arztes ignoriert und kaum noch etwas zu sich genommen.
Den Verfall ihrer Mutter mit ansehen zu müssen, war für Gabrielle sehr bedrückend gewesen. Auch wenn sie Carlas Schmachten nach Albert und ihren Unwillen, mehr zur Rettung ihrer Ehe zu unternehmen, nicht guthieß, hatte sie ihre Mutter von Herzen lieb und tat alles Erdenkliche, um sie aufzuheitern. Sie schmückte das Zimmer ihrer Mutter mit Blumen aus der ganzen Umgebung, las ihr laut vor und bestand sogar darauf, dass die Haushälterin Margery einen guten Teil des Tages an ihrem Bett verbrachte. Margery war eine echte Plaudertasche, und normalerweise war es recht lustig, ihr zuzuhören. Sie war eine Frau in den besten Jahren mit leuchtend rotem Haar, lebhaften blauen Augen und einer Unmenge von Sommersprossen, eigensinnig, nicht auf den Mund gefallen und von Aristokraten alles andere als eingeschüchtert. Außerdem war sie sehr fürsorglich und sah Carla und Gabrielle als ihre Familie an.
Gabrielle glaubte, ihre Mühen würden belohnt und der Lebenswille ihrer Mutter kehre zurück. Ihre Mutter hatte sogar wieder angefangen zu essen und aufgehört, von Albert zu sprechen. Daher war Gabrielle zutiefst verzweifelt, als sie dann mitten in der Nacht plötzlich entschlief. Gabrielles persönlicher Meinung nach war sie »vor Gram vergangen«, denn von der Krankheit hatte Carla sich weitgehend erholt. Das wollte Gabrielle ihrem Vater allerdings nie sagen. Nach dem Tod ihrer Mutter fühlte Gabrielle sich völlig allein gelassen.
Obwohl sie viel Geld geerbt hatte, da Carla aufgrund eines Familiennachlasses recht wohlhabend gewesen war, würde Gabrielle nichts davon zu Gesicht bekommen, bis sie mit einundzwanzig volljährig wurde – was noch lange hin war. Zwar schickte ihr Vater regelmäßig Unterhalt, und es gab auch noch das Haushaltsgeld, das eine ganze Weile reichen würde, doch sie war gerade erst achtzehn geworden.
Außerdem sollte sie der Aufsicht eines Vormunds unterstellt werden. Das hatte Carlas Anwalt William Bates bei der Testamentseröffnung erwähnt. In ihrer Trauer hatte Gabrielle gar nicht richtig hingehört, doch als der Name fiel, war sie entsetzt. Der Mann war ein stadtbekannter Schürzenjäger! Den Gerüchten zufolge ließ er seinen Dienerinnen im ganzen Haus keine Ruhe und bei einem Gartenfest hatte er sogar Gabrielle einmal in den Po gekniffen, dabei war sie damals erst fünfzehn gewesen!
Einen Vormund, insbesondere einen wie ihn, lehnte Gabrielle entschieden ab. Schließlich hatte sie ja noch einen lebenden Elternteil. Sie musste ihn bloß finden, und daher machte sie sich auf, genau das zu tun. Zunächst aber musste sie noch einige Ängste überwinden, wie etwa die Angst davor, um die halbe Welt zu segeln und alles hinter sich zu lassen, was ihr vertraut war. Zweimal hätte sie ihren Entschluss fast umgeworfen. Doch am Ende meinte sie, keine andere Wahl zu haben. Wenigstens hatte Margery eingewilligt, sie zu begleiten.
Die Reise war sehr gut verlaufen, viel besser als sie erwartet hatte. Niemand hatte ihr Fragen gestellt. Schließlich stand sie unter dem Schutz des Kapitäns, zumindest solange sie auf dem Schiff war, und sie hatte durchblicken lassen, dass ihr Vater sie bei der Ankunft erwarten würde – eine kleine Notlüge, um möglichen Einwänden zuvorzukommen.
Doch über den Gedanken an ihren Vater und die Suche nach ihm vergaß sie ihre augenblicklichen Ängste nur kurz. Ihre Beine waren eingeschlafen, weil sie in dem Fass so wenig Bewegungsfreiheit hatte, auch wenn sie problemlos hineinpasste. Mit ihren einem Meter dreiundsechzig war sie nicht besonders groß und dazu schlank. Allerdings hatte sich ein Holzsplitter in ihren Rücken gebohrt, als sie sich in die Tonne gehockt hatte, und es war unmöglich ihn zu erreichen, selbst wenn sie Platz genug gehabt hätte.
Zudem kämpfte sie noch ein wenig mit dem Schock, dass es in dieser Zeit für ein Schiff überhaupt noch möglich war, eine Piratenflagge zu hissen. Piraten waren doch angeblich ausgestorben. Sie hatte geglaubt, sie seien im letzten Jahrhundert komplett ausgerottet worden und alle überführten Seeräuber seien am Strick geendet. Eine Seefahrt über warme karibische Gewässer galt als ebenso sicher wie ein Spaziergang auf englischen Landstraßen. Wenn sie daran gezweifelt hätte, hätte sie doch niemals eine Passage in diesen Teil der Welt gebucht. Und doch hatte sie die Piratenflagge mit eigenen Augen gesehen.
Vor lauter Angst verkrampfte sich ihr Magen, der obendrein leer war, und somit ihre missliche Lage noch verschärfte. Sie hatte das Frühstück verpasst und vorgehabt, dieses Versäumnis beim Mittagessen wieder wettzumachen, doch das Piratenschiff war vor dem Lunch aufgetaucht, und seither schienen Stunden vergangen zu sein. Es gab auch keinen Hinweis darauf, was sich an Deck gerade abspielte.
Sie nahm an, dass die Flucht vor dem Piratenschiff gelungen war, doch wenn das andere Schiff abgeschüttelt worden war, warum kam Avery dann nicht, um es ihr zu sagen? Plötzlich erschütterte eine Detonation das gesamte Schiff, eine weitere folgte, und dann noch eine, eine jede war ohrenbetäubend. Pulvergeruch drang in den Laderaum, heisere Rufe, einige gellende Schreie, und schließlich, eine ganze Weile später, gespenstische Stille.
Es war unmöglich festzustellen, wer den Kampf gewonnen hatte. Gabrielles Nerven lagen blank. Mit der Zeit wuchs ihre Angst. Bald würde sie anfangen zu schreien, da war sie sich sicher. Eigentlich wusste sie nicht einmal, wie es ihr gelungen war, diesem Drang nicht schon früher nachzugeben. Wäre Avery nicht längst aufgetaucht, wenn ihre Mannschaft gesiegt hätte? Es sei denn, er war verwundet und hatte niemandem verraten, wo sie zu finden war. Oder er war tot. Sollte sie es wagen, ihr Versteck zu verlassen, um sich Gewissheit zu verschaffen?
Und falls die Piraten gewonnen hatten? Was machten Piraten mit gekaperten Schiffen? Wurden sie versenkt? Oder behielt man sie, um sie zu verkaufen oder mit eigenen Mannschaften zu bestücken? Und was passierte mit der eigentlichen Crew und den Passagieren? Wurden sie allesamt umgebracht? Der Schrei entschlüpfte ihr in dem Moment, in dem der Deckel von ihrem Fass gerissen wurde.
Kapitel 2
Piraten! Den unwiderlegbaren Beweis, dass Piraten keineswegs ausgestorben waren, erhielt Gabrielle, als sie an den Haaren aus ihrem Versteck gezogen, unter Lachen und Gejohle an Deck geschleift und dem hässlichsten der Piraten vor die Füße geworfen wurde – dem Kapitän.
Sie hatte einen solchen Schrecken bekommen, dass sie sich nicht vorstellen konnte, was man als Nächstes mit ihr anstellen würde. Doch sie war überzeugt, dass es etwas Grässliches sein musste. Das Einzige, was ihr einfiel, war, so schnell wie möglich über Bord zu springen.
Der Mann, der auf sie herabschaute, hatte dünnes, struppiges braunes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Auf dem Kopf saß ein alter Dreispitz mit einer rosa gefärbten Feder, die schlaff herabhing, da sie an mindestens zwei Stellen gebrochen war. Zudem trug er eine leuchtend orangefarbene Satinjacke und eine wallende Seidenkrawatte, die direkt aus einem anderen Jahrhundert zu stammen schienen. Jedenfalls waren die Kleidungsstücke in einem derart traurigen Zustand, dass sie durchaus so alt sein konnten.
Bevor Gabrielle auf die Füße kommen und über Bord springen konnte, sagte er: »Mein Name ist Kapitän Brillaird, zu Ihren Diensten, Miss.« Dann hielt er inne und lachte. »Zumindest ist das der Name, den ich diesen Monat benutze.«
Wenn er sich schon Fantasienamen gab, dachte Gabrielle, sollte er es mal mit Kapitän Leberfleck versuchen. Noch nie hatte sie derart viele Leberflecke auf einem einzigen Gesicht gesehen.
Immer noch zitternd verzichtete sie auf eine Entgegnung und ließ den Blick erneut zur Reling des Schiffes gleiten.
»Sie haben nichts zu befürchten«, sprach der Kapitän weiter. »Sie sind viel zu wertvoll, als dass ich Sie zu Schaden kommen ließe.«
»Wertvoll, inwiefern?«, gelang es Gabrielle zu fragen, während sie sich langsam aufrappelte.
»Als Geisel natürlich. Passagiere bringen viel mehr ein als Ladungen; die können verderben, ehe wir einen Markt für sie finden.«
Gabrielle begann, einen Hauch echter Erleichterung zu verspüren, gerade genug, um die Augen von der Reling abzuwenden. »Was ist mit den Männern?«
Er zuckte die Achseln. »Der Kapitän und die Offiziere eines gekaperten Schiffes bringen in der Regel auch ein ordentliches Lösegeld ein.«
Gabrielle konnte nicht beurteilen, ob der Kapitän ernsthaft versuchte, sie zu beruhigen, oder ob er nur gern redete, denn er begann nun, einen regelrechten Vortrag über das Thema Lösegeld für Gefangene zu halten.
So erfuhr Gabrielle, dass sie und Margery von ihren Familien freigekauft werden sollten. Dabei fragte der Kapitän nicht einmal, ob sie Familie hatte, er ging einfach davon aus, dass es so war. Ihr bliebe nur zu sagen, wen er für das Lösegeld ansprechen musste, und anscheinend hatte es mit dieser Information keine Eile. Zuerst hatten er und seine Kumpane sich um andere Dinge zu kümmern, wie etwa um den Rest der gefangenen Mannschaft.
Gabrielle schaute über das Deck. Falls bei dem Kampf Männer gestorben waren, hatte man jeden Hinweis beseitigt, ehe sie an Deck geschleppt worden war. Avery lag mit einer klaffenden Kopfwunde offenbar bewusstlos am Boden; gefesselt – wie die anderen Offiziere und Passagiere würde auch er in Kürze auf das Piratenschiff transportiert werden. Ihres hatte so schweren Schaden erlitten, dass bereits Wasser eindrang.
Margery war ebenfalls da, gefesselt und als Einzige zusätzlich noch geknebelt. Wahrscheinlich hatte sie den Piraten zu deutlich zu verstehen gegeben, was sie von ihrem frechen Angriff hielt. Wenn sie sich schlecht behandelt fühlte, kümmerte es sie nicht, mit wem sie sich anlegte.
Die gemeinen Matrosen wurden vor die Wahl gestellt, sich den Piraten anzuschließen und auf der Stelle einen Schwur zu leisten oder über die Planke zu gehen, was bedeutete, dass man sie ins Meer werfen würde.
Erwartungsgemäß entschieden die meisten von ihnen sich daraufhin relativ rasch für das Piratenleben. Einer allerdings, ein tapferer Amerikaner, weigerte sich lauthals.
Voller Schrecken musste Gabrielle mit ansehen, wie zwei Piraten sich ihm näherten, ihn an den Armen packten und zur Reling schleiften. Sie rechnete fest damit, dass man ihn über Bord werfen würde. Doch der Mann blieb bei seiner Meinung und verfluchte die Piraten so lange, bis sie seinen Kopf so fest gegen die Reling knallten, dass er ohnmächtig wurde. Die Seeräuber brachen in brüllendes Gelächter aus. Gabrielle fand es kein bisschen lustig, einen Mann glauben zu lassen, dass er sterben würde und ihn dann doch nicht zu töten – diese Piraten offenbar schon.
Der Amerikaner wurde auch tatsächlich noch ins Wasser geworfen, allerdings erst am nächsten Tag, als Land in Sicht kam. Es handelte sich zwar nur um eine unbewohnte Insel, doch immerhin war es fester Boden. Er würde am Ende wohl ohnehin sterben, aber er erhielt wenigstens eine Chance. Vielleicht gelang es ihm sogar, die Aufmerksamkeit eines vorbeifahrenden Schiffes zu erregen und gerettet zu werden. Das war ein besseres Schicksal, als Gabrielle es ihm bei seiner Schimpftirade gegen die Piraten vorausgesagt hätte.
Später am Tag erreichten sie eine andere Insel, die ebenfalls unbewohnt zu sein schien. Sie segelten in das kristallklare Wasser einer breiten Bucht. Fast genau in der Mitte befand sich eine weitere kleine Insel. Doch beim Näherkommen erkannte Gabrielle, dass es sich gar nicht um eine Insel handelte, sondern um ein schwimmendes Dickicht aus zumeist toten Bäumen und dicht wachsenden Pflanzen. Diese gediehen größtenteils auf Morast und anderen Überresten, die sich wiederum auf Holzbrettern – nicht auf Land – türmten. Fast wirkte das Ganze wie ein überfüllter Kai, doch es war ein undurchdringliches Gewirr, angelegt, um die auf der Rückseite ankernden Schiffe vor allem, was auf dem Ozean vorübersegelte, zu verbergen.
Die Quarantäneflagge flatterte über den zwei Wracks, die gerade dort lagen, was anzeigte, dass es an Bord eine Krankheit gegeben hatte, die auch für den verwahrlosten Eindruck verantwortlich sein mochte.
Die Piraten brauchten nicht lang, um ihr eigenes Schiff ebenso aussehen zu lassen, dann wasserten sie die kleinen Ruderboote, brachten die Gefangenen an Land – und hissten an ihrem Mast ebenfalls die Quarantäneflagge. Da begriff Gabrielle, dass alles nur eine List war, um andere Boote, die sich womöglich in die Bucht verirrten, davon abzuhalten, die verlassenen Schiffe näher zu untersuchen.
»Wo gehen wir hin?«, fragte Gabrielle den Piraten, der ihr und Margery aus dem Ruderboot half. Doch offenbar hielt er es nicht für nötig, ihr zu antworten. Er stieß sie einfach vor sich her.
Damit begann ihr Marsch inseleinwärts. Es wurde nicht gewartet, bis alle vom Schiff herunter waren, doch glücklicherweise befand auch Avery sich in der Gruppe, die bereits angelandet war. Zum ersten Mal seit ihrer Gefangennahme hatten sie Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte er, während er neben ihr herging.
»Ja, alles in Ordnung«, versicherte sie ihm.
»Niemand hat sie … angefasst?«
»Ehrlich, Avery, mir fehlt nicht das Geringste.«
»Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Das können Sie sich nicht vorstellen.«
Gabrielle schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Man will Lösegeld für mich haben. Kapitän Brillaird hat mir erklärt, dass ich zu wertvoll bin, deshalb wird mir nichts geschehen.« Sie deutete auf die klaffende Wunde an Averys Stirn. »Wie geht es Ihrem Kopf? Ich habe gesehen, dass Sie gestern bewusstlos waren.«
Vorsichtig betastete er seine Verletzung. »Ach, das ist bloß eine Schramme.«
Doch sein Zusammenzucken verriet Gabrielle, dass sie ihm wehtun musste. »So wie ich den Kapitän verstanden habe, will er für Sie ebenfalls Lösegeld fordern.«
»Davon weiß ich nichts«, antwortete Avery seufzend. »Meine Familie ist nicht wohlhabend.«
»Nun, dann werde ich mit meinem Vater reden, wenn er mich holt«, sagte sie. »Ich bin sicher, dass es ihm irgendwie gelingen wird, Sie ebenfalls freizubekommen.«
Dabei war sie sich nicht einmal sicher, ob Nathan überhaupt aufgespürt werden konnte. Was geschah mit ihr und Avery, falls die Piraten ihren Vater nicht fanden?
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte Avery. Dann setzte er hastig hinzu: »Aber hören Sie auf mich, Gabrielle. Man mag Sie beruhigt haben, doch nach dem, was ich den Unterhaltungen der Piraten entnehmen konnte, glaube ich, dass da, wo wir hingehen, noch mehr vom gleichen Schlage sind. Um heil hier herauszukommen, wäre es für Sie am besten, nicht aufzufallen. Ich weiß, dass es für eine so wunderschöne Frau wie Sie schwer ist, aber …«
»Bitte, Sie brauchen nicht weiterzureden«, unterbrach Gabrielle ihn errötend. »Ich weiß, dass wir erst in Sicherheit sind, wenn wir diese Halsabschneider von hinten sehen. Ich werde mich so unauffällig wie möglich benehmen.«
Als einer der Piraten Avery in den Rücken stieß, um ihm Beine zu machen, wurden sie getrennt.
Den ersten Hinweis darauf, dass die Insel bewohnt war, erhielten sie durch einen Wachtturm an ihrem Trampelpfad. Er war aus Baumstämmen gebaut und hoch genug, um in mindestens drei Richtungen uneingeschränkte Sicht auf das Meer zu bieten. Ihr Weg führte hinauf in die Hügel, die er schützte. Der Turm war zwar bemannt, doch der Wächter in seiner kleinen Hütte oben war eingeschlafen, als sie vorbeizogen. Kein besonders gewissenhafter Aufpasser, dachte Gabrielle, während einer der Piraten gegen den Turm trat, um den Mann zu wecken, und ein anderer ihn mit einem Schwall französischer Schimpfwörter bedachte.
Auch Margery hielt nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg, als sie an Gabrielles Seite aufrückte. »Alles nur Faulenzer und Tunichtgute, die ganze Bande. Hoffen wir, dass die Wache auch schläft, wenn Hilfe naht.«
Gabrielle hätte Margerys Optimismus gern geteilt, doch die Chance, vor Eintreffen des Lösegeldes befreit zu werden, war gering. »Wenn sie meinen Vater finden …«
»Falls sie ihn finden«, unterbrach Margery. »Da wir nicht einmal sicher waren, dass wir es schaffen würden, stehen ihre Chancen noch schlechter, oder? Wir hätten diese Reise niemals unternehmen sollen. Habe ich dir nicht gesagt, dass es gefährlich werden würde?«
»Du hättest ja zu Hause bleiben können«, warf Gabrielle ein. »Es sollte doch völlig ungefährlich sein. Hättest du etwa geglaubt, dass es heutzutage noch Piraten gibt, wenn man dich gewarnt hätte? Nein, du hättest bloß gelacht und dich darüber lustig gemacht.«
»Darum geht es nicht«, erwiderte Margery. »Aber hör mir zu, ehe wir wieder getrennt werden. Such dir eine Waffe, irgendeine, von mir aus auch eine Gabel, wenn du eine in die Finger kriegst, und trag sie immer bei dir. Falls einer dieser Lumpen dich irgendwie belästigt, rammst du sie ihm direkt in den Bauch, verstanden? Hab keine Angst.«
»Ich werd’s mir merken.«
»Das solltest du auch, Mädchen. Wenn dir etwas zustößt, weiß ich nicht, was ich tue.«
Es sah aus, als würde Margery gleich anfangen zu weinen. Sie war besorgter, als sie zugeben wollte. Und ihre Trübsal steckte an. Am liebsten hätte Gabrielle sich auf der Stelle an der Schulter ihrer Freundin ausgeweint, doch es gelang ihr, sich zu beherrschen und einige aufmunternde Worte zu finden.
»Du machst dir zu viele Sorgen. Es wird schon nichts geschehen. Kapitän Brillaird hat es mir versprochen.«
Das stimmte zwar nicht ganz, doch es war das, was Margery hören wollte, und es entlockte ihr ein schwaches Lächeln.
Etwa eine Stunde später erreichten sie hoch in den Hügeln so etwas wie ein großes Dorf inmitten von Bäumen. Im Zentrum stand ein geräumiges Haus, das aus echtem Bauholz errichtet war, welches, wie Gabrielle später erfuhr, von einem Schiff stammte, das die Piraten auf See geplündert hatten. Die anderen Bauten ringsherum waren zumeist kaum mehr als palmbedeckte kleine Hütten. Durch die türlosen Eingänge konnte Gabrielle sehen, dass viele dieser Hütten voller Kisten und Kästen standen und somit wohl als Lagerräume für die unrechtmäßig erworbenen Schätze der Piraten dienten.
Avery und die anderen männlichen Gefangenen wurden zusammen in eine Hütte gesperrt; Margery brachte man zu einer anderen, doch vorher rief sie Gabrielle noch zu: »Denk dran! Direkt in den Bauch!«
»Wo bringt ihr sie hin?«, protestierte Gabrielle.
Der Pirat, der sie auf das große Haus zuschob, griente. »Für Diener gibt’s kein Lösegeld, aber sie kommt mit Ihnen frei, sobald der Kapitän sein Geld hat. Sie sind wertvoll, also bleiben Sie hier, wo’s leichter ist, Sie zu bewachen. Wir wollen doch nicht, dass einer von den Matrosen Sie anfasst und uns um die hübsche Summe bringt, die Sie uns garantieren.« Er zwinkerte ihr anzüglich zu und Gabrielle zuckte unwillkürlich zusammen.
Im Haus angekommen, führte der Pirat Gabrielle an einen langen Tisch in einem hallenartigen Raum, drückte sie auf einen Stuhl und ging davon. Eine Köchin stellte einen Teller Essen vor Gabrielle hin und sagte freundlich: »Hoffentlich hast du jemanden, der für dich bezahlt, Kleine. Ich hab’s so lange wie möglich rausgezögert, aber dann musst’ ich zugeben, dass ich keine Familie mehr habe, und deswegen bin ich noch hier.«
Die etwa vierzigjährige Frau, die sich als Dora vorstellte, setzte sich und unterhielt sich einige Minuten mit Gabrielle. Man hatte ihr erlaubt, auf der Insel zu bleiben, und ihr Lösegeld abzuarbeiten. Sie kochte für die Piraten und war ihnen offenbar auch in anderer Weise dienlich, wenn ihr der Sinn danach stand, was sie Gabrielle leichthin erzählte.
Sie war nun schon zwei Jahre da, betrachtete sich mittlerweile sogar als zugehörig und bekannte freimütig: »Sie sind nicht darauf aus, sich einen Namen zu machen, ganz anders als die Piraten, die Sie vielleicht noch aus dem letzten Jahrhundert kennen. Sie wechseln ihren Namen ebenso häufig wie ihre Schiffe oder deren Namen und benutzen Verkleidungen. Sie wollen Geld machen, nicht gehenkt werden. Heutzutage operieren sie im Geheimen und wechseln sogar alle paar Jahre die Basis.«
»Ist das hier ihr Basislager?«, fragte Gabrielle neugierig.
Dora nickte. »Wir sind hier auf einer Insel, die so abgelegen ist, dass sie nie einen Namen bekommen hat. Es ist eine hübsche Insel, zu hübsch sogar. Ein oder zwei Mal mussten schon Siedler vertrieben werden, denen sie ebenfalls gefiel.«
»Wer ist ihr Anführer?«
»Keiner. Die Kapitäne sind gleichberechtigt und bestimmen nur über ihre eigenen Mannschaften. Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die alle angehen, stimmen sie ab.«
»Wie viele Kapitäne teilen sich diese Basis?«, fragte Gabrielle.
»Augenblicklich fünf. Es gab noch einen sechsten, aber der ist letztes Jahr eines natürlichen Todes gestorben, und seine Mannschaft hat sich auf die anderen verteilt.«
Gabrielle äußerte ihr Erstaunen darüber, dass so wenige Kapitäne über eine anscheinend recht große Ansiedlung bestimmten.
»Sie wollen nicht zu viele Mannschaften hier. Je mehr Menschen herkommen, desto größer ist auch die Gefahr, dass einer sich verplappert und die Lage der Basis verrät.«
Als Kapitän Brillaird das Haus betrat, zog die Frau sich schnell zurück. Seinen wahren Namen hatte er Gabrielle nicht genannt und sie sollte ihn auch nie erfahren. Er wechselte die Namen so häufig, dass seine Männer ihn schlicht »Käpt’n« nannten, daher folgte Gabrielle ihrem Beispiel, wenn es sich nicht vermeiden ließ, ihn anzusprechen. Er jedoch registrierte nur, dass sie dasaß, und ignorierte sie dann für den Rest des Tages – ebenso wie die folgenden Tage.
Fünf Tage später hatte der Kapitän sie immer noch nicht gefragt, wen er wegen des Lösegeldes kontaktieren sollte. Gabrielle machte sich derweil Gedanken darüber, wie sie ihm erklären konnte, dass ihr Vater zwar den Preis bezahlen würde, sie aber schlichtweg nicht wusste, wo er zu finden war. Sie konnte sich nicht denken, dass der Kapitän ihr glauben würde, und sie konnte sich nicht vorstellen, was dann geschehen würde. Dora erklärte ihr, dass man sie noch nicht befragt habe, weil der Kapitän die Information erst brauche, wenn er wieder bereit zum Auslaufen sei, und wann das sein würde, wusste niemand. Die Frau des Kapitäns lebte auf der Insel und er hatte sie zwei Monate nicht gesehen.
Die Piraten aßen, schliefen, tranken, spielten, zankten, scherzten und spannen Seemannsgarn. Gabrielle schlief in einer winzigen Kammer an der Rückseite des Hauptgebäudes und jeden Tag wurde ihr der Zugang zum Gemeinschaftsraum erlaubt, daher konnte sie sich über Langeweile nicht beklagen. Es war nervtötend, aber nicht langweilig. Margery durfte sie täglich einige Stunden besuchen und Gabrielle stellte erleichtert fest, dass ihre ehemalige Haushälterin die Gefangenschaft gut ertrug, obwohl sie sich unablässig über die dünne Strohmatte beschwerte, auf der sie schlafen musste, und über die schlechte Qualität der Speisen.
Am sechsten Tag ihrer Gefangenschaft trafen zwei weitere Schiffe ein; im Hauptraum wurde es mit den neuen Mannschaften etwas eng. Und auch sehr viel beunruhigender. Denn die Neuankömmlinge waren alles andere als freundlich. Einige warfen Gabrielle Blicke zu, bei denen es ihr kalt über den Rücken lief. Und einer der beiden neuen Kapitäne starrte sie so lange und so durchdringend an, dass sie an seinen bösen Absichten keine Zweifel hegte.
Er war groß und muskulös, wahrscheinlich Ende dreißig oder Anfang vierzig, obwohl das schwer zu sagen war, denn er trug einen dichten schwarzen Bart, der so verfilzt war, dass er wohl noch nie mit einem Kamm in Berührung gekommen war. Der Mann wurde Pierre Lacross genannt, doch möglicherweise war er kein echter Franzose. Viele der Piraten taten ja, als seien sie jemand anders, und nicht ein Einziger benutzte seinen wahren Namen. Doch dann fand Gabrielle heraus, dass Pierre Lacross die Ausnahme von der Regel war. Er war tatsächlich Franzose. Er konnte seinen starken Akzent nicht einfach an- und abschalten wie die anderen. Hässlich war er nicht, doch das grausame Glitzern in den blauen Augen verunstaltete sein Gesicht, das sonst durchaus attraktiv gewesen wäre.
Der Mann hatte etwas Böses an sich und Gabrielle war nicht die Einzige, die das bemerkte. Die anderen Männer gingen ihm aus dem Weg und vermieden es, seinen Blick auf sich zu ziehen. Doch immer wieder wanderten seine eisigen blauen Augen zu Gabrielle hin, und das jagte ihr so viel Angst ein, dass sie beinahe zitterte.
Als Gabrielle England verlassen hatte, war sie in Bezug auf Männer völlig unschuldig gewesen. Ihre Mutter hatte ihr nie erklärt, was sie zu erwarten hatte, wenn sie heiratete. Vermutlich hätte sie es getan, ehe sie Gabrielle in die Londoner Gesellschaft einführte, doch dann ging Carla völlig in ihrer Romanze mit Albert auf, und am Ende, als Albert sie verlassen hatte, war sie nur noch mit ihrem Elend beschäftigt. Von den Piraten hatte Gabrielle allerdings eine Menge über Männer gelernt.
Anstatt ihre Sprache zu zügeln, wenn sie in Hörweite war, liebten sie es, mit ihren sexuellen Großtaten zu prahlen. Daher machte Gabrielle sich keine Illusionen mehr darüber, was der widerliche Kapitän Pierre Lacross von ihr wollte, als er sich am Tag nach seiner Ankunft über sie beugte und sagte: »Ich werde dich meinem Freund abkaufen. Dann kann ich mit dir tun, was ich will.«
Sie wünschte, sie hätte nicht verstanden, was er damit andeutete, doch dem war nicht so. Würde es Kapitän Brillaird gleichgültig sein, woher das Geld kam, solange er nur bezahlt wurde? Sollte sie es wagen, ihm mehr zu versprechen, als Pierre bieten konnte? Das schien ihr der einzige Weg zu sein, wie sie verhindern konnte, als »Sklavin« zu enden.
Weglaufen war unmöglich, denn selbst falls es ihr gelang, sich aus dem Haus zu stehlen, kam sie ohne die Piraten nicht von der Insel weg. Kapitän Brillaird blieb ihre einzige Rettung, gleichzeitig wusste sie, dass er ihr nicht aus lauter Herzensgüte helfen würde. Hatte er überhaupt ein Herz? Er war ein Pirat! Ihm ging es nur ums Geld.
Doch instinktiv wusste sie, dass es ihr schlimm ergehen würde, falls Pierre seinen Willen bekam, deshalb fürchtete sie sich so sehr vor ihm. Unglücklicherweise wurde sie auch noch Zeugin seiner Grausamkeit, als er einen seiner Männer züchtigte. Er schlug den Mann direkt in der großen Halle, und nicht mit irgendeiner Peitsche. Die so genannte neunschwänzige Katze zerfetzte die Haut wie ein Messer. Und der Ausdruck in Pierres Augen, als er diese Peitsche schwang, bewies zweifelsfrei, dass es ihm Spaß machte.
Pierre wartete voller Ungeduld auf das Auftauchen ihres Kapitäns, damit er das Geschäft abschließen konnte. Unterdessen setzte er sich neben sie an den Tisch und erzählte ihr höhnisch, was er mit ihr vorhatte.
»Warum siehst du mich nicht an, chérie? Ihr feinen Damen, ihr habt viel zu viel Stolz. Aber wenn ich mit dir fertig bin, wird davon nichts mehr übrig sein. Schau mich an!«
Gabrielle weigerte sich. Sie hatte seinen Blick vom ersten Tag an gemieden. »Gehen Sie bitte weg.«
Er lachte nur. »Ah, du bist also gut erzogen. Und höflich. Ich frage mich, wie lange das wohl halten wird, wenn ich dich zu meinem Schoßhündchen gemacht habe. Wirst du ein gehorsames Hündchen sein, chérie, oder werde ich dich oft bestrafen müssen?« Als er den Laut des Entsetzens hörte, den sie nicht unterdrücken konnte, fuhr er fort: »Du hast gesehen, wozu ich fähig bin, aber mach dir keine Sorgen um deine hübsche zarte Haut. Deine Schönheit würde ich nie zerstören. Es gibt andere Wege, ein Hündchen gefügig zu machen …«
Er bedrängte sie, doch er rührte sie nicht an. Darauf achtete er peinlich genau, denn es gab stets viele Zeugen im Raum. Es war allerdings offensichtlich, dass er es gern getan hätte. Dora erzählte ihr, die erzwungene Zurückhaltung frustriere ihn derart, dass er Nacht für Nacht volltrunken nach draußen wanke, irgendwo umkippe, und erst am Nachmittag wieder auftauche.
Gabrielle hatte unglaubliches Glück, dass Kapitän Brillairds Frau ihren Mann so lange beschäftigt hielt, bis der Letzte der fünf Kapitäne in den Hafen einlief und auf die Insel kam. Eines Morgens betrat er zusammen mit Kapitän Brillaird das große Haus. Obwohl die beiden Männer gerade herzlich über einen Scherz lachten, den einer von ihnen gemacht hatte, fiel Gabrielle ihm sofort auf. Er stutzte und starrte sie an, dann legte er Kapitän Brillaird den Arm um die Schulter und bot an, sie zu kaufen. Da Pierre nicht da war, konnte er auch nicht protestieren und sagen, dass er diese Idee zuerst gehabt hatte. Denn das hätte er sicher getan, und womöglich wäre es sogar zu einem Kampf gekommen. Doch Pierre Lacross schlief noch seinen Rausch aus. Und Kapitän Brillaird schien alles recht zu sein, ganz wie Gabrielle vermutet hatte. Sie sah ihn nur die Achsel zucken, daraufhin schüttelten die beiden Männer sich die Hand und der fünfte Kapitän warf Kapitän Brillaird einen Beutel Münzen zu.
Gabrielle stand unter Schock. Alles war so schnell gegangen. Später fand sie heraus, dass der neue Kapitän ein Mittelsmann war. Es war nicht das erste Mal, dass er auf der Insel Geiseln aufkaufte, um sie mit beträchtlichem Gewinn an ihre Familien weiterzureichen. Damit war allen Seiten bestens gedient, erlaubte es doch den anderen Kapitänen, sich umgehend wieder ihrer eigentlichen Arbeit zu widmen. Der neue Kapitän war gut im Rechnen – und im Verkleiden. Fast hätte sie ihn nicht erkannt …
»Was zum Teufel machst du hier, Gabby, und wo ist deine Mutter?«
Er hatte sie sofort aus dem Lager herausgeführt und zog sie auf dem gut ausgetretenen Pfad zur Bucht hinter sich her. Die meisten seiner Männer waren noch damit beschäftigt, das Schiff zu vertäuen, und die wenigen, die ihnen auf dem Pfad entgegenkamen, wurden ohne eine Erklärung zurück zum Schiff beordert. Als Gabrielle protestierte und erklärte, dass ihre Haushälterin auch noch befreit werden müsse, wurde ein Mann geschickt, um Margery zu holen.
Sie hatte tausend Fragen an ihren Vater, doch als sie an ihren Verlust erinnert wurde, vergaß sie alles andere. »Sie ist gestorben, Papa. Deswegen habe ich England verlassen. Ich wollte dich finden und bei dir wohnen«, sagte sie traurig. »Aber nicht auf dieser Insel, falls du nichts dagegen hast«, setzte sie schroff hinzu.
Kapitel 3
Gabrielles Rettung hatte ihren Vater in eine höchst peinliche Lage gebracht. All die Jahre hatten sie und ihre Mutter nicht gewusst, ja nicht einmal geahnt, dass er ein derart abenteuerliches Leben führte. Nathan Brooks war ein Pirat. Daran musste Gabrielle sich erst einmal gewöhnen.
Er sah so anders aus, dass sie ihn kaum wiedererkannt hatte. Vor seinen Besuchen in England hatte er sich stets präsentabel gemacht, indem er sich den Bart abrasieren und das Haar, das er nun schulterlang trug, kurz schneiden ließ. Anders hatte Gabrielle ihn nie zu Gesicht bekommen, und sie war stets der Meinung gewesen, sie schlüge ihm nach, zumindest was die Farbgebung anbelangte. Er hatte genauso schwarzes Haar wie sie und ihre Augen waren so hellblau wie seine. Die Körpergröße ihres Vaters hatte sie allerdings nicht geerbt, was ein Glück war, denn er war ein hochgewachsener Mann, etwas über einsachtzig, während Gabrielle genauso groß war wie ihre Mutter. Doch dieser Mann ähnelte dem Vater, den sie kannte und liebte, in keinster Weise. Genau betrachtet waren Kleidung und Aussehen bei ihm ebenso extravagant wie bei den anderen Piraten, die ihr begegnet waren. An einem Ohr trug er sogar einen kleinen goldenen Ring!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!