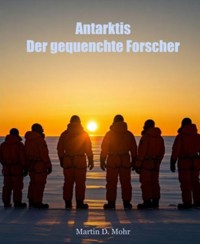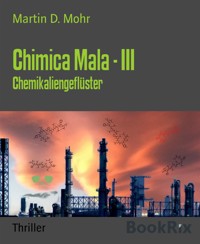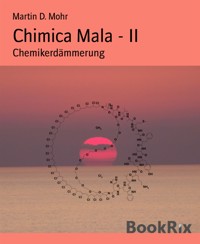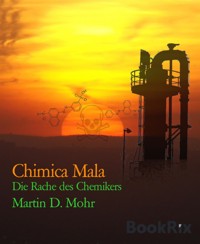5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berge, Gletscher, Arme Seelen und Josch - der Gott des Gleichgewichts. Es ist die Welt eines Bergvolkes, das sich selbst die Goyatzer nennt.
Eine finstere Schlucht ist die einzige Verbindung in die christliche Welt. Dort befindet sich das Reich des Fürsten von Yatz. Die Bauern hungern unter dem Joch seiner Tyrannei. Einziger Trost ist eine Weissagung, die sich in Goyatz erfüllen und den Herrscher stürzen werde. Dennoch fürchten die unterdrückten Dorfbewohner das wilde Bergvolk wie den Teufel persönlich. Zu fremd und wild sind die bärtigen Heiden aus den Bergen. Sollten sie wirklich die einzige Hoffnung auf Freiheit sein?
Ein Mönch versucht zu missionieren, ein Kind wird geboren am Fuße des Gletschers, Yatz wird unterwandert, der Feind empfängt die Schwertleite. Das Schicksal von Goyatz und Yatz verknüpft sich mehr und mehr bis alles anders endet, als man es von der Prophezeiung erwartet hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Distel und Lärche
Verlag:BookRix GmbH &Co. KG Sankt-Martin-Straße 53-55 81675 München Deutschland Tag der Veröffentlichung: 19.05.2014 ISBN: 978-3-7368-1283-3
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Gier bereitet den Weg
Heilung und Verdammnis
Hinter der Schlucht
Erste Bündnisse
Fremde Welt
Das Leuchten der Gletscher
Vom liberus zum servus
Friedhof und Macht
Warnung eines Toten
Entwicklung
Die Aussenwelt
Wiedergeburt
Die Schwertleite
Der Hass
Angriff
Epilog
Anmerkungen
landmarks
Titelseite
Cover
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Prolog
Goyatzer Dorf
Gier bereitet den Weg
Der Hammer donnerte auf das glühende Eisen. Wieder und wieder schlug Ursus auf den Stahl und langsam liess sich ein Messer erkennen.
“Merke dir diese Farbe, Wolfram”, brummte er, “Der Stahl muss genau diese Farbe haben. Wird er dunkler, muss er sofort wieder in die Esse, sonst wird der Stahl spröde und bricht.”
Er hielt inne und blickte ärgerlich zu seinem Sohn.
“Los, schlaf nicht ein! Der Blasebalg!”
Hastig betätigte der kleine Wolfram den Balg und brennende Hitze quoll ihm entgegen. Zufrieden legte sein Vater das Messer hinein und blickte ungeduldig nach draussen. Die Sonne stand noch hoch am sommerlichen Himmel. Die Menschen, die an der Schmiede vorbeigingen, würdigten die beiden keinen Blick. Von der hellen Strasse konnten sie sie kaum erkennen. Das Feuer erhellte den offenen Raum nur wenig. Zu gut verschluckte der Russ an Wänden und Decke das Licht.
“Wo bleibt Mutter?” fragte Wolfram.
Ursus' Gesicht verfinsterte sich, als er die Soldaten des Fürsten sah. Sie hatten seine Girte aus der Schmiede gezerrt, während ihm ein Dolch an die Kehle gesetzt worden war. Wolfram hatte alles mit ansehen müssen. Es war nichts zu machen. Die Soldaten waren bewaffnet und zahlreicher. Ursus war nichts anderes übrig geblieben, als sie gewähren zu lassen.
Was mit seiner hübschen Frau auf der Burg passierte, wollte er sich nicht ausmalen. Schon dreimal waren sie gekommen. Jedes Mal war sie tränenüberströmt nach Hause gekommen, war an ihm vorbeigehuscht und hatte sich aus dem nahen Brunnen Wasser geholt, um sich zu waschen, obwohl man sie schon auf der Burg gebadet hatte. Das war aber, bevor sie zum Fürsten geführt wurde.
Ursus spürte, wie Wut in ihm aufkochte. Er musste etwas tun, um seine Frau zu schützen. Aber was? Er war nur ein einfacher Schmied, kein Krieger. Und die Soldaten des Fürsten würden ihm keine Chance geben.
Er ballte die Fäuste. Er würde einen Weg finden, seine Frau zu befreien. Irgendwie.
Er hörte Pferde. Die Soldaten hielten vor der Schmiede und luden seine Girte aus einem kleinen Wagen. Wie immer huschte sie wortlos an ihm vorbei. Tränen in den Augen, das gepuderte Gesicht verschmiert und in eine Wolke aus Parfüm gehüllt, welche Ursus wie eine schützende Rüstung schien.
Wenige Augenblicke später würde sie wieder in ihrer eigenen, einfachen Kleidung neben ihm stehen und sich um Wolfram und das Essen kümmern.
Diesen Abend sollten sie aber nicht schweigen, denn die Gier des Fürsten trug Früchte bei der schönen Frau.
“Ich bekomme ein Kind”, gestand sie am Abend und Ursus wusste sofort, dass es nicht von ihm war, sondern von Fürst Galbert von Yatz. Ein Bastard also.
“Er wird mich immer wieder holen”, schluchzte Girte und krampfte verzweifelt ihre Finger um den hölzernen Löffel.
Wolfram verstand noch nicht, was seiner Mutter geschehen war. Mit seinen vier Jahren konnte er das nicht begreifen. Er wusste nur, dass es schlimm war.
“Mach was Papa!” forderte er Ursus auf. Dieser seufzte tief und schüttelte verzweifelt den Kopf. Er würde den Fürsten am liebsten umbringen, und zwar mit eigenen Händen. Aber er würde nie an ihn herankommen. Zu gut war er von seinen Soldaten und Rittern bewacht.
Es blieb nur eine Möglichkeit. Wenn er dem Fürsten nichts antun konnte, so konnte er ihm wenigstens seine Frau entziehen.
Unsicher blickte er seiner Girte ins Gesicht. Was war er stolz gewesen, als er diese wunderschöne Frau heiraten konnte. Er hatte es damals selbst kaum glauben können. Wer wollte schon einen so grobschlächtigen Waffenschmied wie ihn? Aber sie liebte ihn. Dieses Glück wandte sich aber zu ihrem Unglück. Schönheit ist ein wahrer Fluch!
Bei der Kirche fand er keine Hilfe. Der Abt Rainald von Bologna war nur an seiner Macht interessiert und ein treuer Freund des Fürsten. Er steuerte alle kirchlichen Geschicke der Stadt. Also musste Girte verschwinden.
Girte und Ursus Blicke trafen sich und sie verstanden sich sofort. Sie liebten sich, aber sie konnten nicht mehr zusammen leben. Ursus musste in der Stadt bleiben. Er war in der Schmiedezunft ein wichtiger Mann. Nur von Yatz aus konnte er seine Frau beschützen.
Girte musste in einem der Dörfer verschwinden. Dort konnte sie ihre Identität ändern und wäre von den Fängen des Fürsten sicher.
Wenige Tage später setzte der Schmied seine Girte auf einen Wagen, der sie aus der Stadt bringen sollte. Die Heilerin Maria aus Hatesch nahm sich der Schwangeren an. Ursus kannte Maria nur flüchtig, wusste aber, dass seine Girte dort gut aufgehoben wäre.
Kaum war seine Frau aus der Stadt, zündete er seine Schmiede an. Die Bürger von Yatz halfen ihm beim Löschen des Feuers, ohne zu wissen, dass er den Brand selbst gelegt hatte. Seine Schmiede war zerstört, aber der Plan ging auf. Seine Frau Girte galt von nun an als tot. Umgekommen in den Flammen der Schmiede. Dies stellte die Soldaten zufrieden.
Fürst Galbert von Yatz liess ihm sogar ein paar Taler zukommen, als Entschädigung. Damit konnte er die Schmiede wieder aufbauen. Seine Girte aber sah er nie wieder und auch Wolfram sollte nie erfahren, was aus seiner Mutter geworden war. Das einzige, was er in seinem Kindesalter begriffen hatte, war, dass am ganzen Unglück der Fürst von Yatz schuld war.
Girte lebte von nun an unerkannt bei der Heilerin Maria im Dorf Hatesch. Maria wohnte etwas ausserhalb des Dorfes auf einer Anhöhe. Nur selten kam dort ein Soldat vorbei, denn die Hütte lag abseits aller Wege.
Das Mädchen Elisa kam zur Welt. Als Bastard wurde sie von den anderen Kindern gehänselt. Umso mehr versuchte sie, Anerkennung zu erlangen, indem sie lernte. Schon als Vierjährige begleitete sie Maria durch die Almen, um Kräuter zu sammeln. Voller Energie tollte sie über die Wiesen und durch die Lärchenwälder.
Maria erzählte ihr auch von den Sagen der Berge und verbot ihr, über die Gletschermenschen hinter der Joschnerschlucht zu sprechen. Für Elisa waren das alles Ammenmärchen, dennoch fügte sie sich den strengen Regeln der Heilerin.
Mit acht Jahren kannte sie schon alle Kräuter und ihre Wirkung und konnte schon tatkräftig der alternden Maria zur Hand gehen.
Als sie wieder einmal beim Kräutersammeln waren, kamen Soldaten in das Dorf. Diesmal aber nahmen sie den Weg zur Hütte der Heilerin. Girte, die alleine zurückgeblieben war, sah die geharnischten Männer auf sich zukommen. Sofort packte sie die Angst und rannte in die Berge. Die Soldaten sahen die flüchtende Frau und glaubten, sie habe etwas zu verbergen. Hastig folgten sie ihr.
Elisa hörte das Schreien ihrer Mutter. Sie blickte auf und sah sie auf einem Felsvorsprung zum Stehen kommen, nicht weit von ihr entfernt. Die Soldaten bewegten sich mit gezückten Schwertern auf die Frau zu.
Girte versuchte etwas zu rufen, aber sie brachte kein Wort hervor. Zu gross war die Angst, wieder zum Fürsten geschleppt zu werden. Elisa war starr vor Schreck. Sie hatte sich zu Boden geworfen und beobachtete durch einen Tränenschleier die Szene. Noch bevor die Soldaten ihre Mutter erreichten, hatte sich Girte in die Tiefe gestürzt.
“Möge ihr der Gletscher erspart bleiben”, murmelte hinter Elisa die Heilerin. Maria hatte sich hinter Elisa auf den Boden gesetzt und nahm sie in ihre Arme.
“Kein Mucks”, warnte sie, “Die Soldaten werden wieder abziehen.”
“Was haben sie von Mutter gewollt?” fragte Elisa mit zitternder Stimme.
Maria aber schwieg. Elisa war jetzt zu ihrem Mündel geworden. Irgendwann würde sie ihr die Wahrheit erzählen. Wer ihr Vater war und warum ihre Mutter sich in die Tiefe stürzte. Aber jetzt noch nicht. Noch nicht.
Heilung und Verdammnis
“Was für eine wunderschöne Landschaft!” rief Sigmund aus, “Seht die Berge und ihre Gipfel!”
“Nicht so laut, Herr”, flüsterte sein Begleiter, “Hier wimmelt es von Banditen.”
Sigmund von Ravenna lächelte und blinzelte in die strahlende Sonne hinauf. Er war ein grosser, schlanker Herr – aus Italien stammend, aber sein blondes Haar verriet, dass seine Wurzeln im Norden liegen mussten. Er war in Ravenna in dem vornehmen Haus eines Edelmannes aufgewachsen, diente in Venedig beim Dogen und hatte nun beschlossen, seine Wurzeln im Norden zu finden. Sein Vater schien aus den Bergen zu stammen. Kannte er bisher nur die Küste und die warme, fruchtbaren Hügel Italiens, so hatte er seinen Augen nicht getraut, als er die ersten Berge der Alpen sah. Seine Begeisterung schien kein Ende zu nehmen. Er war nun mitten im Hochgebirge und nahm sich vor eines Tages auf einen der schneebedeckten Gipfel zu klettern.
Er kannte das harte Leben der Bergbewohner nicht. Er hatte keine Ahnung, was Kälte wirklich bedeutete und hatte noch nie einen Fuss auf einen Gletscher, geschweige denn auf Eis gesetzt.
“Ach was”, schwärmte er, “Es ist so ein schöner Tag, da wird schon nichts passieren.”
Der Mann, der den Edelmann führte, war ein Bauer aus der Gegend von Batem. Eine grosse Stadt, die talabwärts lag. Er kannte sich zwar im Sohretal aus, aber nur gerade so gut, um zu wissen, dass man hier nachts nicht auf der Strasse bleiben sollte.
“Lasst Euch nicht täuschen, Herr. Hier gibt es noch heidnische Barbaren.”
Sigmund kam nicht mehr dazu, eine seiner abfälligen Bemerkungen zu machen. Plötzlich steckte ein Pfeil in seinem Hals. Mit weit aufgerissenen Augen sah er, wie sich sein Begleiter davon machte, bevor er selbst erwischt werden würde. Sigmunds Pferd bäumte sich auf und warf ihn ab. Der Edelmann fiel hart zu Boden. Auf dem Rücken liegend und unter Schock erlebte er die Szene, als wäre er ein teilnahmsloser Zuschauer.
Verzweifelt rang er nach Luft. Nur schwer gelang es ihm, seine Lungen zu füllen. Der Pfeil hatte die Luftröhre durchbohrt. Er schmeckte Blut.
Zwei Männer mit Kapuzen schlichen sich heran.
“Verdammt!” fluchte einer, “Der hier war dein Hirsch.”
“Scheisse, ein Edelmann! Was machen wir? Wir sollten ihm helfen.”
“Bist Du verrückt? Wir müssen abhauen. Er stirbt sowieso. Oder willst Du am Galgen hängen?”
“Und wenn er überlebt? Er wird uns erkennen und dann sind wir wegen Wilderei dran.”
“Halt die Schnauze. Fort von hier!”
Mehr bekam Sigmund nicht mehr mit. Es wurde Nacht um ihn.
Das nächste, was er mitbekam, war, dass er auf ungewohnt stacheligen Kissen lag.
“Oh, Sie wachen auf, Herr”, sagte eine liebliche Frauenstimme, “Haben Sie keine Angst, ich habe Ihre Wunde verbunden. Sie wären mir beinahe gestorben.”
Sigmund versuchte etwas zu sagen. Durch einen Schleier sah er eine junge Frau neben sich stehen. Er befand sich in einer Holzhütte armer Leute.
“Sprechen Sie nicht”, mahnte die Frauenstimme, “Die Wunde darf nicht aufplatzen. Sie sind jetzt seit zwei Tagen hier. Nehmen Sie etwas Kräutertee.”
Die Frau führte ihm einen Löffel mit einer bitteren Flüssigkeit an die Lippen.
“Bitte, Sie müssen trinken, Herr”, flehte die Frau, “Sonst verdursten Sie.”
Sigmund zwang sich zu schlucken. Der Schmerz liess ihn aufstöhnen.
“Seien Sie froh, dass ich ihnen was gegen die Schmerzen gegeben habe, Herr. Ich bin Elisa und Sie sind hier in meiner Hütte in Hatesch. Die strohgefüllten Kissen werden nicht so bequem sein, wie Ihr es gewohnt seid, aber es ist alles, was ich habe.”
Sigmund blinzelte den Schleier vor seinen Augen fort und erkannte eine junge zierliche Frau vor sich.
Elisa lächelte ihn offen an und meinte schelmisch: “Sie können mir noch nicht sagen, wie Sie heissen und wer Sie sind, Herr. Deshalb nennen ich sie einfach Ursus. So hiess mein … Vater. Er ist Schmied in Yatz. Heissen Sie zufällig Ursus?”
Sigmund gelang tatsächlich ein Lächeln und eine vorsichtige Bewegung, die ein Nein andeuten sollte.
Elisa zuckte mit den Schultern und meinte: “Ich kann doch nicht alle Namen, die ich kenne, durchprobieren, Herr. Na, es wird schon gehen. Schlafen Sie jetzt ein wenig. Aber zuerst noch ein paar Löffel trinken.”
Sigmund mühte sich ab, die Flüssigkeit zu schlucken. Dann sank er in erholsamen Schlaf.
Als er wieder zu sich kam, fühlte er sich schon etwas besser. Elisa gab ihm etwas Suppe zu trinken, die er gierig, aber unter Schmerzen, hinunter schlang.
“Leider kann ich Ihnen nur eine wässrige Suppe geben”, entschuldigte sich die Heilerin, “Fleisch können Sie nicht schlucken und so etwas haben wir sowieso nicht. Wir haben nicht mehr viel zu Essen, seit der Fürst von Yatz die Steuern erhöht hat.”
Die Türe öffnete sich und ein Mann kam herein.
“Du hast es wieder einmal geschafft, Elisa”, lobte er, “Du bist eine gute Heilerin. Aber der Prior aus Yatz interessiert sich für den Fremden hier.”
“Der Prior?” fragte Elisa amüsiert, “Was will der denn hier?”
“Das hier ist ein Edelmann, der in Yatz erwartet wurde. Sein Name ist Sigmund von Ravenna.”
Elisa blickte schelmisch auf ihren Patienten: “Also auf Sigmund wäre ich nie gekommen, Herr. Es ist mir eine Ehre.”
Das Lächeln gelang Sigmund nun besser als ein paar Tage zuvor.
“Danke”, versuchte er mit krächzender Stimme.
“Herr, Sie werden wieder ganz gesund. Ihre Stimme wird sich erholen, aber jetzt dürfen Sie noch nicht sprechen. Haben Sie Geduld, Herr", warnte die junge Heilerin streng.
“Wie bin ich…”, versuchte Sigmund etwas zu fragen, wurde aber sofort von Elisa zum Schweigen gebracht.
“Verzeihen Sie, Herr. Nicht sprechen. Ein paar Männer aus unserem Dorf haben Sie gefunden und zu mir gebracht. Sie hatten einen Pfeil im Hals. Sie hatten Glück, dass er die wichtigen Blutgefässe nicht getroffen hat und dass niemand versucht hat, Ihnen den Pfeil herauszuziehen. Sonst wären Sie verblutet.”
“Es ist ein Wunder, dass ein Mensch noch lebt nach so einer Verletzung”, murmelte der Mann hinter Elisa.
“Rede nicht von Wundern”, entgegnete Elisa ungewöhnlich schroff, “An meiner Heilkunst ist alles natürlich und nichts wunderlich. Ich mache keine Wunder. Die macht nur der Herrgott.”
"Beinahe wären Sie mit den Armen Seelen gewandert, Herr”, antwortete der Mann. Er machte eine Verbeugung vor dem Edelmann und verschwand nach draussen.
Langsam wurde Sigmund seiner Umgebung gewahr. Er lag auf einem viel zu kleinen Bett. Daneben stand ein grober Tisch mit zwei Schemeln. Elisa erhitzte etwas Wasser in einem kleinen Kessel über dem offenen Feuer an der hinteren Ecke. Von der Decke hingen verschiedene Kräuter zum Trocknen. Er fragte sich, ob es nicht besser wäre, die Kräuter über dem Feuer zu trocknen. Das müsste doch schneller gehen.
Elisa war seinen Blicken gefolgt und antwortete auf die ungestellte Frage: “Über dem Feuer würden die Kräuter verbrennen oder mindestens ihre Kraft verlieren. Es ist besser, sie trocknen langsam in einem leichten Luftzug.”
Sie lachte.
“Nein, ich kann keine Gedanken lesen, aber jeder stellt diese Frage. Schlafen Sie noch etwas, Herr. Sie sind über dem Berg. Bald können Sie aufstehen. Ich gehe jetzt Holz holen.”
Elisa warf sich einen Umhang über, ergriff einen geflochtenen Korb und verschwand ins Freie.
Sigmund entspannte sich vollkommen. So langsam begriff er, welches Glück er hatte. Neu in diesem Gebirge, mit einem Hirsch verwechselt worden - sah er so prächtig aus? Und am Ende war er von einem Engel gerettet worden. Selig schlief er ein.
Von einem lauten Geräusch wurde er aus dem Schlaf gerissen. Vor ihm stand ein Mönch.
"Pax vobiscum. Ich bin Prior Pacificus aus Yatz. Man sagte mir, dass Ihr nicht sprechen dürft, also gebt mir nur Kopfzeichen. Seid Ihr Sigmund von Ravenna?”
Der Mönch blickte den Edelmann forschend an. Die Augen des Priors waren scharf und einen gierigen Glanz vermochte Sigmund in ihnen zu entdecken.
Sigmund nickte vorsichtig.
“Oh Gloria!” freute sich der Prior nicht ganz so aufrichtig, wie man meinen sollte, “Ihr habt ihre Verletzung überlebt. Es war ein schändlicher Angriff auf Ihre Person. Wir haben die zwei Wilderer geschnappt, nur die Hexe ist uns durch die Lappen gegangen. Wissen Sie, wohin sie ist?”
“Hexe?” versuchte Sigmund entsetzt zu formulieren.
“Diese Elisa, die Euch verbunden hat”, meinte Pacificus gelassen, “Mit ein paar Hexensprüchen half sie Euch zu überleben. Wir werden prüfen, wie weit Ihr nun vom Teufel besessen seid, oder ob Euch Euer Glaube an den Heiland gerettet hat.”
Der Mönch versuchte ein gütiges Lächeln, was ihm Sigmund aber nicht abnahm. Im Gegenteil. Der Edelmann fühlte sich ausgeliefert. Der Prior hatte etwas Fanatisches. Was waren das für Prüfungen, die er über sich ergehen lassen musste?
Zwei Mönche halfen ihm beim Aufstehen und brachten ihn ins Freie. Dort warteten bereits weitere Gottesmänner und Soldaten des Fürsten. Einer von Ihnen ritt an die Bahre heran. Er sah furchteinflössend aus, obwohl oder gerade weil ihn seine schwarze Rüstung fast ganz verdeckte. Nur seine Augen funkelten bedrohlich unter seinem Helm hervor, wie zwei glühende Kohlen.
“Ihr seid ja quietschlebendig!” rief er aus und seine scharfe Stimme schnitt sich jedem Anwesenden ins Ohr, “Mein Name ist Schekan und ich habe den Befehl, Euch nach Yatz zu bringen. Da Ihr Jammerlappen noch zu schwach seid, habe ich einen Wagen mitgebracht. Reiten könnt Ihr bestimmt noch nicht.”
Das wollte sich Sigmund von Ravenna nicht gefallen lassen. Mühsam befreite er sich von den Mönchen, die ihn stützten und gab Zeichen, ein Pferd haben zu wollen.
“Oh, ein starker Edelmann”, witzelte Schekan und winkte einen seiner Männer mit einem Pferd herbei.
“Für den Edelmann nur eine zahme Stute, bitte”, höhnte er weiter.
Sigmund zwang seine Schwäche nieder und bestieg das Pferd, das man ihm gebracht hatte.
Schekan gab seinem Ross die Sporen und befahl seinen Männern ihm zu folgen. Nach den Soldaten folgten die Mönche zu Fuss - nur der Prior ritt mit Schekan an der Spitze neben ihnen Sigmund von Ravenna. Der Edelmann blickte sich noch einmal um. Jetzt erst endeckte er zwei blutende Gestalten in Ketten. Es waren wohl die Wilderer, die ein Soldat hinter sich her zerrte.
Wo war seine Retterin? Er wollte sich unbedingt noch bei ihr bedanken. Sie war aber nirgends zu sehen. Es war wohl besser so. Wenn der Prior schon über sie als Hexe sprach, war ihr Urteil gefällt. Ihr Schicksal schien besiegelt.
Sein Schicksal war noch ungewiss. Was würde ihn in Yatz erwarten? Wer war dieser Fürst Galbert von Yatz? Warum waren seine Bauern so arm? Es war ihm nicht entgangen, dass die Soldaten und Mönche weitere Wagen mit sich führten, auf denen Körbe voller Korn, Eier und anderen Erzeugnissen standen. Hinter diesen Wagen führten sie ein paar Schweine, Ziegen und Kühe mit sich. Die Soldaten waren nicht zu seinem Schutz hier, sondern zum Schutz ihrer Steuer, die sie gerade eingetrieben hatten.
Die Blicke der Bauern waren dem Edelmann nicht entgangen. Es war Hass in ihnen.
Hinter der Schlucht
Thomas von Melk, ein Benediktinermönch, lag mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden der kleinen Kapelle des Dorfes Säsch.
"Eine hohe Aufgabe ist es, Priester zu sein", betete er laut, "Und eine schwere Aufgabe dazu. Immer wieder muss ich tröstende Worte für meine Schafe finden. Sie leben im Elend und Hunger. Wie soll ich Menschen mit Worten trösten, die Brot und Schutz bedürfen? Alles was ich besitze, sind ein paar tröstende Worte und christliche Nächstenliebe. Dies gebe ich von ganzem Herzen."
"Deine Worte machen die Bauern nicht satt", sagte Marcellus, ein älterer Priester, "Aber sie finden Trost in diesen Worten und in deinem tiefen Glauben."
Marcellus beugte sich zu Thomas hinunter und half ihm beim Aufstehen.
"Ich weiss woran du denkst", sagte der Priester, "Du denkst an die Goyatzer."
Thomas stand verlegen vor Marcellus und verbarg die Hände in seiner schwarzen Kutte. Thomas von Melk war ein grosser, schlanker Mann, der den jugendlichen Leichtsinn noch nicht abgelegt hatte. Und obwohl er dem Novitzenalter gerade entschlüpft war, war dieser Mönch gelehrter als kaum ein anderer. Sein Lehrer war Johann von Trier gewesen, ein Benediktinermönch, der sich sowohl in der kirchlichen Lehre als auch in der Geschichte der Antike bestens auskannte.
Marcellus, ein kleiner, drahtiger Mann mit schwarzen Locken, kannte den Mönch nur zu gut und wusste seine Arbeit zu schätzen. Vor einem Jahr war Thomas zu ihm in das kleine Dorf Säsch gekommen und hatte darum gebeten, die Goyatzer bekehren zu dürfen. Von Rom hatte er den Segen, aber Marcellus hatte ihn vor den wilden Goyatzern gewarnt. Der Priester hatte ihm geraten, in Säsch zu bleiben. Die Bauern brauchten den Beistand der Mutter Kirche. Wenn der hohe Klerus den Menschen die Hilfe verweigerte, mussten wenigstens die einfachen Priester und Mönche Beistand leisten.
"Marcellus, die Goyatzer sind gute Menschen", meinte Thomas, "Man könnte sogar sagen, sie sind gute Christen. Du siehst doch selbst, dass sie den Bauern von ihrem Korn abgeben."
"Du hast von deinem berühmten Lehrer viel gelernt", antwortete Marcellus, "Aber von den Goyatzern wusste selbst er nichts. Lange Zeit haben nicht einmal die Bauern hier von der Existenz dieser Barbaren gewusst. Es wurde früher immer erzählt, dass hinter dieser Schlucht da oben die Hölle beginnt."
Marcellus ging mit bedächtigen Schritten zum Taufbecken und seufzte: "Hier stand noch nie ein Goyatzer. Nicht einmal hier in dieser kleinen, unbedeutenden Kapelle. Hast du sie beobachtet, wenn sie den Bauern zu Essen bringen? Sie schielen zwar verstohlen auf unser Gotteshaus, aber sie nähern sich ihm nie. Sie tun zwar Gutes – sie bringen den Bauern zu essen, aber sie flössen ihnen stets Angst ein. Sie sind wild und ungläubig. Sie scheren sich nicht die Haare wie zivilisierte Menschen und ich könnte schwören, sie benehmen sich beim Essen wie Barbaren."
"Weil sie ungläubig sind, will ich ja zu ihnen. Ich will sie bekehren", antwortete Thomas, "Ich werde sie auf den rechten Weg Gottes führen. In unserer christlichen Welt weiss man nichts von diesem Volk. Selbst der Papst in Rom war überrascht, als ich ihm von den Goyatzern erzählte. Seit Johann von Trier mir eine Legende über ein Bergvolk vorlas – es war eine alte römische Schrift – war ich neugierig geworden.”
“Deine römische Geschichte muss nichts mit unseren Goyatzern zu tun haben.”
“Jede Legende hat ihren Ursprung in der Wahrheit. In diesen Schriften wurden die Goyatzer beschrieben – genauso wie du sie beschreibst, Marcellus. Seit ich von ihnen gehört habe, ist es mein Wunsch, ihnen den rechten Weg zu zeigen."
"Thomas, welches ist das schlimmste und wildeste Volk, von dem dir dein Lehrer erzählt hat? Waren es die Goyatzer oder andere Völker?"
Thomas lächelte.
"Von den Goyatzern stand nicht sehr viel in den Schriften. In der Antike wurden die Kelten und Germanen als wilde Barbaren beschrieben. Heute würde ich sagen, dass die furchtbarsten Völker im Norden wohnen – also die Wikinger."
"Deine Kelten und Germanen sind harmlose Waisenkinder im Gegensatz zu den Goyatzern", seufzte der Priester und setzte sich auf einen kleinen Stuhl, "Sie glauben an Josch. Kennst du ihren Glauben? Nein, natürlich nicht. Niemand kennt ihre Religion und niemand versteht ihre eigenartige Sprache. Ich habe sie schon gehört, wenn sie miteinander sprechen. Diese zischenden Laute haben nichts mehr menschliches an sich. Mir läuft es jedes mal kalt den Buckel runter. Die Bauern erzählen sich schon seit Jahrhunderten Sagen über Arme Seelen, Bozen und über Gletschermenschen – die Goyatzer. In den Sagen werden diese Menschen als blutrünstige Barbaren dargestellt."
Thomas lachte.
"Masslose Übertreibungen. Die Bauern reden viel Unsinn."
Marcellus nickte stumm, sagte aber dann: "Mag sein, aber du hast selbst gesagt: Jede Legende, jede Sage und jedes Gerücht wurzelt in der Wahrheit. Sieh doch, wie sie sich kleiden. Sie tragen Felle. Wie Tiere sehen sie aus und ich habe noch keinen von ihnen unbewaffnet gesehen. Gletschermenschen ist wahrhaftig der richtige Ausdruck für diese kalten Barbaren. Mögen sie ewig in der Hölle brennen!"
"Aber ihre Taten – ihre Anteilnahme an dem Elend der Bauern – sagen mir, dass sie ein gutes Herz haben."
Marcellus lachte, aber sein Lachen war gekünstelt. Er erhob sich wieder und klopfte dem Mönch auf die Schulter.
"Dein Glaube an das Gute im Menschen ist unerschütterlich, Thomas von Melk. Mich sollte es aber nicht wundern, wenn sie ein Herz aus Eis hätten."
"Du hast wirklich keine Ahnung, oder?"
Thomas von Melk blickte den Priester mit einer Andeutung von Mitleid an.
"Ich bin mit meiner Arbeit weiter als du denkst, Marcellus. Ich habe schon mit einem von ihnen gesprochen. Ich habe aus den wenigen Worten dieses Mannes einiges erfahren können. Beim nächsten Mal werde ich ihn fragen, ob ich mit nach Goyatz kommen darf."
Marcellus wich entsetzt zurück.
"Du hast es gewagt?" stammelte er ungläubig.
"Es ist der grosse Goyatzer..."
"Der Mann, der so gross ist wie die riesige Glocke des Yatzer Klosters?"
Es war mehr ein Ausruf, als eine Frage. Der Priester traute einfach seinen Ohren nicht.
Thomas aber blieb ruhig und sprach weiter: "...sein Name ist Joschan. Er ist Schmied und hat hohes Ansehen beim Bergvolk. Es heisst sogar, dass er mit einer Yatzerin verheiratet sei."
"Es würde mich wundern, wenn die Goyatzer so etwas wie eine Ehe kennen würden", fauchte Marcellus aufgewühlt.
"Sei vorsichtig!" warnte er und hob drohend seinen Finger, "Oh, Thomas! Werde nicht leichtsinnig, denn wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um."
"Marcellus, wie kannst du den Geschichten der Bauern mehr glauben, als den Taten, die du mit eigenen Augen siehst? Was sie für die Bauern tun ist wahrhaft christlich."
"Ich habe ihre Augen gesehen", antwortete der Priester, "Und diese Augen waren wild."
Von draussen drang ein Ruf in die Stille der Kapelle: "Versteckt die Frauen und Kinder! Die Goyatzer kommen!"
Lautes Stimmengewirr folgte, dann brach plötzlich Stille ein.
Thomas seufzte: "Wann werden die Bauern den Goyatzern endlich trauen?"
Er warf einen Blick auf den zitternden Priester. "Und wann wirst du es tun?"
"Wahrscheinlich nie.”
"Der Goyatzer Xandressek hat die Bauern nur noch tiefer ins Unglück getrieben", meinte Thomas und wandte sich dem Ausgang der Kapelle zu, "Dieser törichte Bauernaufstand! Die Bauern vergessen so etwas nicht. Vielleicht wird sich das ändern, wenn die Goyatzer bekehrt sind."
Marcellus folgte dem Mönch hastig ins Freie. Das Dorf lag da wie längst verlassen. Kein Einwohner von Säsch liess sich blicken. Nur Thomas und Marcellus erwarteten die Goyatzer – der eine in spannender Erwartung, der andere mit gemischten Gefühlen.
Thomas kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Drei Männer brachten drei schwer bepackte Maultiere voll Nahrung.
Das Bergvolk musste sicher viel entbehren, um all das Fleisch und Korn zu verschenken, dachte Thomas. Zwei der Goyatzer führten die Packtiere. Neben ihnen ritt der dritte Bergmann auf einem riesigen Pferd, das man mit den Schlachtrössern der Ritter vergleichen konnte. Der Mann war gross und breitschultrig. Thomas wusste sofort, wer er war. Es war Joschan von Goyatz, der Mann, mit dem er geredet hatte.
"Willkommen", rief ihm Thomas entgegen, als sie endlich im Dorf ankamen. Zur Antwort bekam er aber nur ein kurzes Brummen zu hören. Die Goyatzer entluden schweigend ihre Maultiere, während sich Joschan dem Mönch und dem Priester näherte.
"Wir bringen etwas", knurrte er mit einer tiefen Stimme.
"Wir danken dir", antwortete Marcellus, der sich zusammenriss ein Zittern in der Stimme zu unterdrücken, "Der Herr wird euch segnen."
Der Goyatzer nahm diese Worte nur mit einem Achselzucken entgegen und wandte sein Pferd von den Priestern ab.
“Gepriesen sei das Gleichgewicht, bei Josch“, murmelte er nur.
"Joschan von Goyatz", rief ihn Thomas an, "Erlaube mir, dir eine Frage zu stellen."
Abwartend blieb der Goyatzer auf seinem Pferd sitzen und blickte den Mönch stirnrunzelnd an.
"Darf ich mit euch kommen?" fragte Thomas, "Ich meine nach Goyatz."
Das Gesicht Joschans blieb unverändert. Er schien sich die Antwort gründlich zu überlegen.
"Leute wie du gehören nicht nach Goyatz", sagte er nur mit seinem harten Goyatzer Akzent.
Joschan gab seinem Pferd die Sporen und ritt zu seinen Begleitern.
Thomas eilte ihm nach und keuchte: "Warum?"
Langsam wandte sich Joschan um und knurrte: "Was soll ein Mönch wie du in Goyatz?"
"Ich will euch das Wort unseres Herrn bringen", antwortete Thomas unerschrocken, "Ich möchte eure Seelen vor der ewigen Verdammnis retten."
Joschan hob verwundert und vergnügt zugleich seine buschigen Augenbrauen. Auch die zwei anderen Goyatzer hielten in ihrer Arbeit inne.
"Josch ist bei uns", sagte Joschan nach einer langen Pause, "Wir kennen seine Worte. Du bist unnötig."
"Ich rede aber von unserem Heiland, von Christus und seinen Lehren", entgegnete Thomas, "Nur er ist der Erlöser eurer Seelen."
"Schon gehört, dass Josch einen Sohn hat", meinte Joschan gelassen, "Meine Frau Elisa ist Christin. Sie hat mir schon von Jesus erzählt. Glaube aber nicht, dass er unser Erlöser sein kann. Wir büssen für unsere Sünden im Gletscher. Nur das Eis reinigt unsere Seelen für das grosse Gleichgewicht."
"Das ist doch Unsinn", warf Marcellus ein, verstummte aber sofort. Joschan sah ihn verächtlich an.
"Unsere Seelen gehen in den Weiten dieser Welt auf", knurrte er, "Das ist unsere Erlösung – die Vereinigung mit allem. Ich weiss nicht, ob euer Himmel, wo ihr zur Rechten Gottes auf Wolken sitzen wollt, kein grösserer Unsinn ist!"
Die Goyatzer hatten ihre Maultiere abgeladen und wandten sich wieder dem Berg zu.
"Vielen dank nochmals für das Essen", sagte Thomas zu Joschan in versöhnlichen Ton, "Es ist mit Sicherheit ein grosses Opfer für dein Volk."
Joschan wandte sich Thomas zu und fragte: "Wie ist dein Name?"
"Thomas von Melk."
"Thomas von Melk, scheint so, dass Du vor uns keine Angst hast. Aber wenn du uns das Wort deines Herrn bringen willst, dann musst du unsere Religion kennenlernen. Josch ist der Gott des Gleichgewichts. In unserem Tal gibt es viel Nahrung. Den Überschuss geben wir euch, um das Gleichgewicht zu wahren. Nur darum geht es uns.“
Nach einer Weile fügte er verächtlich hinzu: "...nicht etwa aus Liebe zu den Bauern – die sind uns gleichgültig. Vielleicht wirst du eines Tages nach Goyatz kommen, aber nur, wenn wir es für richtig halten."
Joschan gab seinem Pferd die Sporen und ritt seinen Begleitern hinterher. Bald waren alle drei Goyatzer in der Joschnerschlucht verschwunden.
"Gleichgewicht!" knurrte Marcellus, "So ein Unsinn!"
"Ich weiss nicht", meinte Thomas, "Er stammt aus einer anderen Kultur und denkt anders als wir. Sie scheinen den Bauern jedenfalls keine Nahrung zu geben, um ihnen einen Gefallen zu tun. Es ist für sie selbstverständlich ... einen Überschuss an Bedürftige abzugeben..."
"Halte keine ketzerischen Reden", unterbrach ihn Marcellus, "Es sind Heiden, Ketzer, Barbaren. Nichts, was sie sagen, können wir verstehen, weil der Antichrist in ihnen wohnt!"
Die ersten Bauern wagten sich wieder aus ihren Häusern und näherten sich der Ware, die die Goyatzer abgeladen hatten.
"Das reicht ja für Wochen", flüsterte einer von ihnen, als er das Fleisch, Gemüse und Getreide sah.
"Ja, Nicolas", bestätigte Thomas, "Ein wahrer Schatz. Wir müssen ihn gerecht unter den anderen verteilen."
"Aber heimlich", mahnte Marcellus, "Es ist viel Wild dabei. Die Spitzel des Fürsten dürfen nichts davon zu sehen bekommen, sonst werden wir noch als Wilderer hingerichtet."
Neben Nicolas stand sein Bruder Marcus, der versonnen auf das Fleisch starrte.
Fieberhaft sammelten die Männer von Säsch die Geschenke auf, um sie in den geheimen Winkeln ihrer Hütten zu verstecken. Nach wenigen Augenblicken war alles wie zuvor. Nichts wies auf die göttliche Gabe hin, welche die Goyatzer gebracht hatten.
Marcus und Nicolas schickten sich an, wieder auf ihre Felder zu gehen. Ihr Vater hatte sie zum Unkraut jäten geschickt.
“Wir sollten mehr für uns behalten”, brummte Marcus, “Mutter ist so schwach, da wird nicht viel für sie übrig bleiben.”
Nicolas schüttelte den Kopf.
“Dann haben die anderen weniger. Es muss reichen.”
Schweigend machten sie sich an die Arbeit und versuchten, ihre kleine Ernte vor dem Unkraut zu retten.
“Wassermangel, Unkraut, Raubritter und Hunger”, brummte Marcus, “Ich wünschte, die hohen Herren wären alle tot.”
“Immerhin sind wir noch eigenständige liberi und keine servi. Dann hätten wir noch weniger zu Essen. Stell dir vor, wenn wir jetzt noch zusätzliche Pacht zahlen müssten.”
Marcus warf fluchend einen Stein aus dem Feld.
“Vater kümmert sich schon richtig um die Familie. Hoffentlich zweigt er genug Fleisch für Mutter ab.”
Nicolas hielt inne und gab seinem Bruder ein Zeichen. Marcus blickte in die gleiche Richtung wie sein Bruder. Dort stand er am Waldrand: ein Boze.
Marcus schickte sich an zu fliehen, aber sein Bruder hielt ihn fest.
“Nicht bewegen”, raunte er, “Wenn wir Glück haben, tut er uns nichts. Wir können ihm nicht davonlaufen.”
“Was will er von uns?” raunte sein Bruder zurück, “Das ist ein böses Omen.”
Der Geist hatte die Gestalt eines gelbäugigen Schimmels. Der Boze tänzelte nervös, wie ein Hengst, aber machte keine Anstalten, auf die beiden Bauern loszugehen. Sie wussten, gegen diesen Geist mit den unheimlichen Katzenaugen hätten sie keine Chance.
Der grünäugige Schimmel drehte sich ein paar mal um sich selbst und verschwand zwischen den Tannen.
Die beiden Brüder blieben zitternd zurück. Sie wussten, ein schlimmes Ereignis stand bevor. Was es war und wann es eintreten würde, konnten sie nicht sagen. Nach kurzem Überlegen beschlossen sie, nach Hause zurückzukehren. Einzig die Gewissheit, etwas Fleisch auf dem Teller zu bekommen, mochte sie heute trösten. Endlich ein Abend, an dem sie einigermassen satt schlafen gehen konnten.
Marcellus und Thomas kannten ihre Bauern. Sie wussten, dass sie die ganze Nahrung am liebsten für sich behalten würden und das aus gutem Grund. Hunger hatten alle! Aber die Menschen in den anderen Dörfern sollten auch etwas von den Gaben der Goyatzer haben. Deshalb wählten sie junge, schnelle Männer aus, die die Nahrung auf geheimen Wegen zu den anderen Dörfern bringen sollten.
Noch bevor Nicolas und Marcus in ihre armselige Hütte zurückkamen, war alles verteilt. Marcus brummte missmutig, aber sein Vater Joseph, ein alter, energischer Mann, dem nichts als das Leben und sein Stolz geblieben waren, schalt ihn: “Du hast Fleisch auf dem Teller! Also danke dem Herrgott und iss!”
“Wir haben einen Bozen gesehen”, flüsterte Nicolas, “Er hat uns nichts getan.”
“War es der gelbäugige Schimmel?” erkundigte sich sein Vater, “Oh, das ist ein böses Omen.”
“Der Geist ist nicht böse”, wandte die Mutter ein, “Aber er warnt uns, dass uns etwas bevorsteht. Wie oft hat er sich gedreht?”
Marcus und Nicolas zögerten.
“Acht Mal?”
“Acht Monde? Acht Jahre?” Joseph tätschelte seiner Frau die knochige Hand, “Hoffen wir das Beste.”
Erste Bündnisse
“Hier war es”, murmelte Sigmund und drehte sich nochmals in der Hütte um, “Dort bin ich gelegen und Elisa hat mich versorgt.”
Er zeigte auf das kleine Bett an der Wand.
Wolfram betrachtete den verfallenen Raum. Im Vergleich zu seiner Schmiede mochte es hier sauber und freundlich gewesen sein, wenn auch dunkel, denn die Fenster waren klein. Inzwischen waren Teile des schweren Schieferdaches eingestürzt, weil einige Balken gebrochen waren. Auf dem Boden fanden sie noch ein paar trockene Kräuter, sonst war hier alles fort.
Hier also hatten seine Mutter und Schwester gelebt. Wo waren sie jetzt?
“Wo ist sie? Deshalb sind wir hier”, meinte Sigmund und beantwortete so die Frage, die Wolfram sich nur im Stillen gestellt hatte.
Elisa war ihm nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Im Kloster hatte man ihn damals verhört und mit verschiedenen Methoden geprüft, ob er verhext worden war. Auch wenn die Methoden ungewöhnlich und zum Teil schmerzhaft gewesen waren, hatten der Prior und der Abt keine Hexerei nachweisen können. Nach wenigen Wochen hatte man den Edelmann ziehen lassen, nicht ohne eine grosszügige Spende für die heilige Mutter Kirche zu verlangen.
Sigmund hatte sich zunächst der Burg zugewandt und seine Dienste angeboten. Er wollte den Knappen das Leben am Hofe lehren. Der alte Fürst hatte ihn akzeptiert und seit diesem Tag unterrichtete er die Knappen, das Verhalten bei Tisch am Hofe. Er gab sogar Tanzstunden und Minnegesang, all diese Dinge, die einen Ritter zu einem Ritter von Stand machten und von einem Landadel unterscheiden sollte. Das war die Welt, in der sich Sigmund von Ravenna auskannte.
Er spürte keine Verachtung gegenüber den unteren Klassen oder gar gegen die Bauern. Er fand es lediglich als wichtig, sich richtig zu Verhalten, wenn man am Hofe eines Fürsten diente. Er fühlte sich nicht besser deshalb, sondern es war einfach Teil des Lebens. In einem Kuhstall wäre sein Verhalten genauso falsch wie das Fluchen oder Rülpsen vor einem König.
Der Zufall wollte es, dass er auf den Schmied traf. Eigentlich hatte der Edelmann nur seinen Dolch schleifen lassen wollen. Allerdings hatte er einen Hintergedanken, denn er wollte herausfinden, wohin seine Retterin Elisa geflohen war. Immerhin hatte sie ihm verraten, dass Ihr Vater mit Namen Ursus ein Schmied in Yatz war. Dieser müsste ja zu finden sein. In der dritten Schmiede war die Reaktion auf seine Fragen etwas anders. Wolfram kam hinter seiner Esse vor und wollte wissen, wer dieser Sigmund war und wieso er etwas von einer Elisa sprach, deren Vater Ursus war, noch dazu Schmied in Yatz. Es hatte in der Stadt nur einen Schmied mit diesem Namen gegeben - Wolframs Vater.
Wolfram wusste auch, dass seine Mutter fliehen musste und ein Kind unter dem Herzen hatte. Elisa musste also seine Schwester sein! Wo war sie? Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war Hatesch. Er rechnete nicht mehr damit, seine Mutter noch einmal zu sehen. Sie war sicherlich tot, aber seine Schwester war jünger als er. Sie musste noch irgendwo leben.
“Ich sagte ja, dass hier niemand mehr ist”, meinte der Bauer aus Hatesch, der sie zu dieser Hütte geführt hatte.
“Ist Elisa nie wieder zurückgekommen?” erkundigte sich Sigmund.
Der Bauer liess den Kopf hängen.
“Nein, Herr. Sie ist einfach verschwunden. Manche sagen, dass sie nach Batem ist, andere glauben, dass sie durch die Joschnerschlucht zu den Goyatzern ist. In Batem hätte der Prior sie aber erwischt und ich glaube nicht, dass sie nach Goyatz ist.”
“Warum nicht?”
Sigmund wunderte sich über die ungläubigen Blicke des Bauern und auch Wolfram hatte seine Augenbrauen erstaunt hochgezogen.
“Kein Mensch geht nach Goyatz”, meinte Wolfram, “Das ist hier im ganzen Sohretal bekannt. Dort leben die Gletschermenschen. Es sind Barbaren, die fremde Götter anbeten. Es sind Heiden.”
“Wenn sie das gewagt hätte, hätte sie es nicht überlebt”, bestätigte der Bauer, “Wenn auch …”
“Wenn auch was?” hakte Sigmund nach.
Der Bauer blickte betreten zu Boden.
“Naja, die Goyatzer, so sagt man, bringen uns ab und zu etwas zu Essen. Keiner versteht warum. Wir sind natürlich froh darüber.”
“Also haben Eure Barbaren doch ein Herz.”
“Nein, Herr!” protestierte der Bauer, “Sie leben mit den Toten. Dort leben die Armen Seelen auf dem Gletscher. Dort ist kein Platz für eine zierliche Frau.”
Sigmund holte ein paar Münzen aus der Tasche und reichte sie mit einem aufrichtigen Danke dem Bauern, der sie schnell annahm und verschwand.
Der Edelmann und der Schmied schauten sich die Umgebung an, fanden aber keinen Hinweis auf Elisa, bis sie ein Grab in der Ecke des kleinen Friedhofs fanden mit einer Aufschrift: Girte.
Wolfram kniete nieder. Ausser dem völlig vermoosten Holzkreuz war nichts mehr zu sehen. Das Grab sah vergessen aus. Ein Wunder, dass es noch vorhanden war.
Sigmund stand hinter dem Schmied.
“Eure Mutter?”
Wolfram nickte stumm.
Ein Priester kam hinzu und als er die beiden an dem vergessenen Grab sah, meinte er: “Ich bin noch nicht lange hier, aber man sagte mir, sie wurde von Soldaten verfolgt und sie hatte sich deshalb vom Felsen dort oben gestürzt.”
Nach einer kleinen Pause fuhr er fort: “Man wollte sie zuerst nicht auf dem Friedhof begraben, weil sie eine Selbstmörderin war. Man hat sich aber dann dagegen entschieden und ihren Tod zum Unfall erklärt. Eine gewisse Maria, ich habe sie noch kennen gelernt, soll da sehr energisch aufgetreten sein. Eine bemerkenswerte Frau. Sie liegt dort drüben.”
Wolfram wischte sich ein paar Tränen fort.
“Der Fürst wollte sie zur Mätresse machen. Sie hatte wohl Angst, dass man sie wieder zurückbringen wollte”, stammelte er.
“Soviel ich gehört habe, wollten die Soldaten lediglich nach dem Weg fragen. Sie hatten sich verlaufen”, antwortete der Priester.
Sigmund gab dem Priester ein paar Münzen zum Dank.
“Das ist nicht nötig”, meinte dieser.
“Doch das ist es”, entgegnete Sigmund, “Ich sehe doch, wie sehr hier alle ums Überleben kämpfen müssen, während auf der Burg der Luxus gedeiht. Diese Münzen sind das wenigste, was ich machen kann.”
Als der Priester gegangen war, sagte Wolfram: “Vielleicht können wir noch mehr machen.”
Ein leichter grollender Unterton lag in seiner Stimme.
“Ich bin Zunftmeister der Waffenschmiede und Ihr seid in der Burg zu Yatz mit direktem Kontakt zum Fürsten.”
Sigmund lief es kalt den Buckel hinunter.
“Rebellion? Das ist Verrat!”
“Ihr kennt den Luxus in der Burg und seht Euch hier um. Woher mag das Geld kommen? Von hier. Ja, bestimmt auch von den Bürgern der Stadt. Ich selbst trage ja auch etwas dazu bei, aber so wie diese Menschen werde ich nicht geschröpft. Wir leiden anders in der Stadt. Nicht alle, aber einzelne. Der Beweis liegt hier vor Euch in der Erde.”