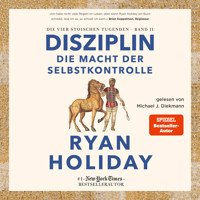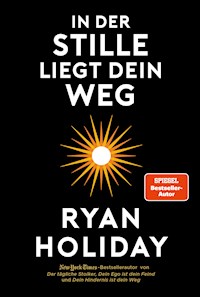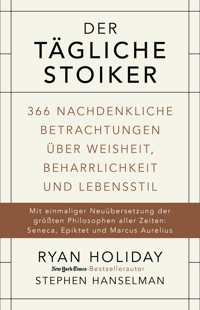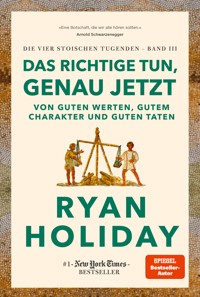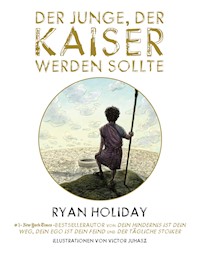15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Die vier stoischen Tugenden
- Sprache: Deutsch
Die Inschrift auf dem Orakel von Delphi lautet: »Nichts im Übermaß«. Das ist leicht gesagt, aber schwer zu praktizieren – und wenn es schon 300 v. Chr. schwer war, so ist es heute fast unmöglich. Und doch ist die Selbstdisziplin die stärkste und wichtigste Tugend, die jeder von uns lernen kann. Ohne sie können wir unsere Lebensziele nicht erreichen. Ryan Holiday beschreibt im 2. Band der Reihe über die vier stoischen Tugenden, wie wir Willenskraft, Mäßigung und Selbstkontrolle – also Disziplin – in unserem Leben kultivieren können. Von Aristoteles und Mark Aurel bis hin zu Toni Morrison und Königin Elisabeth II. beleuchtet er die großen Vorbilder dieser Praxis und was wir von ihnen lernen können. Bei Mäßigung geht es nicht um Abstinenz, sondern um Selbstachtung, Konzentration und Ausgewogenheit. Ohne sie werden selbst die positivsten Eigenschaften zu Charakterfehlern. Aber mit Mäßigung sind Glück und Erfolg garantiert: Der Schlüssel liegt nicht im Mehr, sondern darin, das richtige Maß zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ryan Holiday
Disziplin – die Macht der Selbstkontrolle
Die vier stoischen Tugenden – Band II
DIE VIER STOISCHEN TUGENDEN – BAND II
DISZIPLIN
DIE MACHT DER SELBSTKONTROLLE
RYAN HOLIDAY
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
6. Auflage 2025
© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Ryan Holiday. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Discipline Is Destiny: The Power of Self-Control bei Portfolio, ab imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Dr. Thomas Stauder und Hans Freundl
Redaktion: Silke Panten
Korrektorat: Silvia Kinkel
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer, in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe
Umschlagdesign: Jason Heuer Design
Satz: Röser MEDIA GmbH & Co KG, Karlsruhe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-515-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-982-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Die vier Tugenden
Einleitung
Teil I Das Äußere (Der Körper)
Den Körper beherrschen
Legen Sie beim Morgengrauen los
Ein anstrengendes Leben ist das beste Leben
Befreien Sie sich aus der Sklaverei
Vermeiden Sie alles Überflüssige
Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf
Seien Sie einfach da
Geben Sie sich Mühe mit Kleinigkeiten
Beeilen Sie sich
Drosseln Sie das Tempo … um schneller zu werden
Üben Sie … Und dann üben Sie weiter
Arbeiten Sie einfach
Kleiden Sie sich für den Erfolg
Suchen Sie die Unannehmlichkeit
Teilen Sie sich die Arbeitsbelastung ein
Schlaf ist eine Charakterfrage
Was können Sie aushalten?
Über den Körper hinaus …
Teil II Das Innere (Das Temperament)
Sich selbst beherrschen
Betrachten Sie alles auf diese Weise
Konzentrieren Sie sich auf die Hauptsache
Konzentration, Konzentration, Konzentration
Warten Sie auf diese süße Frucht
Perfektionismus ist ein Laster
Tun Sie das Schwierige zuerst
Können Sie wieder aufstehen?
Der Kampf gegen den Schmerz
Der Kampf gegen das Vergnügen
Bekämpfen Sie Provokationen
Hüten Sie sich vor diesem Wahnsinn
Schweigen ist Stärke
Warten Sie, bevor Sie feuern
Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz
Geld ist ein (gefährliches) Werkzeug
Werden Sie jeden Tag besser
Teilen Sie die Last
Respektieren Sie die Zeit
Ziehen Sie Grenzen
Geben Sie Ihr Bestes
Über das Temperament hinaus …
Teil III DAS MAGISTERIUM (Die Seele)
Sich selbst übertreffen
Seien Sie tolerant gegenüber anderen und streng mit sich selbst
Helfen Sie anderen, besser zu werden
Zeigen Sie Anmut unter Druck
Tragen Sie die Last für andere
Seien Sie nett zu sich selbst
Die Macht, Macht aufzugeben
Halten Sie die andere Wange hin
Wie man einen Abgang macht
Ertragen Sie das Unerträgliche
Seien Sie der Beste
Flexibilität ist Stärke
Unverändert durch Erfolg
Selbstdisziplin ist Tugend und Tugend ist Selbstdisziplin
Nachwort
Anmerkungen
Was könnte man anschließend lesen?
Danksagung
»Zwei Worte sollten wir uns zu Herzen nehmen und befolgen, wenn wir uns für das Gute einsetzen und uns vom Bösen fernhalten – Worte, die uns ein untadeliges und sorgenfreies Leben sichern werden: beharren und widerstehen.«
EPIKTET
Die vier Tugenden
Lange vor unserer heutigen Zeit kam Herkules an einen Scheideweg. An einer friedlichen Wegkreuzung inmitten der griechischen Hügellandschaft, im Schatten astreicher Pinien, begegnete der große Held der griechischen Geschichte und des Mythos erstmals seinem Schicksal.
Wo genau dies passierte oder wann, weiß niemand. Wir erfahren von diesem besonderen Augenblick durch die Erzählung des Sokrates. Vor Augen haben wir diese Szene in der prächtigen Kunst der Renaissance. Herkules’ jugendliche Kraft und seine strammen Muskeln, aber auch seine seelische Qual kommen in der klassisch gewordenen Kantate »Laßt uns sorgen, laßt uns wachen« zum Ausdruck, die Johann Sebastian Bach ihm gewidmet hat. Wäre es 1776 nach dem amerikanischen Gründervater John Adams gegangen, dann wäre Herkules am Scheideweg auf dem offiziellen Siegel der gerade erst entstandenen Vereinigten Staaten verewigt worden. Denn dort, bevor er unsterblichen Ruhm erwarb, bevor er die ihm gestellten zwölf Aufgaben erfüllte und bevor er die Welt veränderte, befand sich Herkules in einer persönlichen Krise, wie sie jeder von uns schon erlebt hat, mit einer wichtigen Weichenstellung für seine gesamte Existenz.
Wohin war er unterwegs? Welches Ziel wollte er erreichen? Darum geht es in dieser Geschichte. Auf sich allein gestellt, unbekannt und unsicher, wusste Herkules, wie so viele Menschen, hierauf noch keine Antwort. Wo der Pfad sich gabelte, lag eine schöne Göttin, die ihm jede erdenkliche Verlockung darbot. Prächtig gekleidet, versprach sie ihm ein Leben in Saus und Braus. Sie schwor ihm, dass er nie Mangel, Unglück, Angst oder Schmerz würde erleiden müssen. Wenn er ihr folge, sagte sie zu ihm, würden alle seine Wünsche in Erfüllung gehen.
Daneben, auf dem Weg, der in eine andere Richtung führte, stand eine strenger wirkende Göttin in einem strahlend weißen Gewand. Sie brachte ihren Aufruf an ihn in ruhigerem Ton vor. Sie versprach ihm keine Belohnungen, sondern nur die Früchte seiner eigenen harten Arbeit. Es würde eine lange Reise werden, sagte sie. Er würde Opfer erbringen müssen und es würde für ihn angsteinflößende Situationen geben. Aber es war ein Lebensweg, der eines Gottes würdig war, der Weg seiner Vorfahren. Er würde ihn zu dem Mann machen, der er werden sollte.
War das die Realität? Ist es wirklich passiert? Wenn es aber nur eine Legende ist, ist es dann überhaupt von Bedeutung? Ja, denn es ist eine Geschichte über uns. Über unser eigenes Dilemma. Über unseren persönlichen Scheideweg. Herkules hatte die Wahl zwischen Laster und Tugend, dem leichten und dem schweren Weg, dem ausgetretenen Pfad und der weniger beschrittenen Route. Das Gleiche gilt für uns.
Herkules zögerte nur eine Sekunde und entschied sich dann für den Weg, der den entscheidenden Unterschied ausmachte. Er wählte die Tugend. »Tugend« kann altmodisch erscheinen. Tatsächlich aber bedeutet Tugend – griechisch arete – etwas sehr Einfaches und Zeitloses: ein hohes Niveau in moralischer, körperlicher und geistiger Hinsicht.
In der Antike setzte sich die Tugend aus vier Hauptbestandteilen zusammen: Mut, Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit. Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel nannte sie »Prüfsteine des Guten«. Millionen von Menschen sind sie als »Kardinaltugenden« bekannt, vier nahezu universelle Ideale, die vom Christentum und dem größten Teil der abendländischen Philosophie übernommen wurden, aber auch geschätzt werden im Buddhismus, Hinduismus und fast jeder anderen Religion oder Weltanschauung. Wie C. S. Lewis zu Recht feststellte, sind diese Tugenden nicht nach einem kirchlichen Würdenträger benannt – dem Kardinal. Vielmehr basiert ihre Bezeichnung auf dem lateinischen Wort cardo (ursprünglich Türangel, in übertragener Bedeutung Angelpunkt).
Und Dreh- und Angelpunkte sind diese Tugenden in der Tat, sie öffnen die Tür zu einem guten Leben. Sie sind auch der Gegenstand dieses Buches und dieser Reihe. Vier Bücher.1 Vier Tugenden. Ein gemeinsames Ziel: Ihnen die richtige Wahl zu ermöglichen.
Mut, Tapferkeit, Ausdauer, Stärke, Ehre, Aufopferung …
Mäßigung, Selbstbeherrschung, Zurückhaltung, Gelassenheit, Ausgeglichenheit …
Gerechtigkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Güte, Freundlichkeit …
Weisheit, Wissen, Bildung, Wahrheit, Selbsterkenntnis, Frieden …
Sie sind der Schlüssel zu einem guten Leben, einem Leben voll Ehre und Ruhm, einer in jeder Hinsicht vorzüglichen Existenz. Es sind Charaktereigenschaften, die der Schriftsteller John Steinbeck perfekt beschrieben hat als »angenehm und erstrebenswert für [ihren] Besitzer, die ihn Taten vollbringen lassen, auf die er stolz sein kann und über die er sich freuen kann«. Mit »er« sind hier explizit nicht nur die Männer gemeint, sondern die gesamte Menschheit. In Rom existierte keine weibliche Version des Wortes virtus. Dies war ein generisches Maskulinum, denn die Tugend war weder männlich noch weiblich, es gab sie einfach.
Und es gibt sie noch heute. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Genauso wenig kommt es darauf an, ob Sie von kräftiger Statur sind oder extrem schüchtern, ob Sie einen genialen Verstand besitzen oder nur eine durchschnittliche Intelligenz, denn Tugend ist ein universeller Wert. Der gleiche Imperativ gilt für alle.
Jede dieser Tugenden ist untrennbar mit den anderen verbunden, aber dennoch unterscheiden sie sich voneinander. Das Richtige zu tun, erfordert fast immer Mut, genauso wie Mäßigung unmöglich ist ohne die Weisheit, den Wert einer Entscheidung zu erkennen. Was nützt der Mut, wenn er nicht für die Gerechtigkeit eingesetzt wird? Was nützt die Weisheit, wenn sie uns nicht bescheidener macht?
Norden, Süden, Osten, Westen – die vier Tugenden sind eine Art von Kompass. Nicht umsonst werden die vier Himmelsrichtungen auf einem Kompass »Kardinalpunkte« genannt: Sie weisen uns den Weg, indem sie uns zeigen, wo wir sind und was wahr ist.
Aristoteles beschrieb die Tugend als eine Art von Handwerk, etwas, das man sich aneignen kann, so wie man sich die Beherrschung eines Berufs oder einer Kunstfertigkeit aneignet. »Wir werden Baumeister, indem wir bauen, und wir werden Harfenspieler, indem wir Harfe spielen«, schreibt er. »Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, gemäßigt, indem wir gemäßigt handeln, und tapfer, indem wir tapfer handeln.«
Tugend ist etwas, das wir tun. Es ist etwas, das wir entscheiden. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, denn Herkules stand nicht nur einmal am Scheideweg. Es ist eine tägliche Herausforderung, mit der wir nicht nur einmal konfrontiert werden, sondern ständig. Werden wir egoistisch sein oder selbstlos? Tapfer oder ängstlich? Stark oder schwach? Weise oder dumm? Werden wir gute oder schlechte Gewohnheiten annehmen? Mut oder Feigheit? Werden wir uns mit der Unwissenheit zufriedengeben oder die Herausforderung neuer Ideen akzeptieren?
Werden wir stets dieselben bleiben … oder uns weiterentwickeln?
Wählen wir den bequemen Weg oder den richtigen Weg?
Einleitung
»Möchtest du ein großes Reich besitzen? Dann herrsche über dich selbst.«
Publilius Syrus
Wir leben in Zeiten des Überflusses und der Freiheit, die selbst für die uns unmittelbar vorangegangenen Generationen noch unvorstellbar gewesen wären. Ein ganz gewöhnlicher Bürger in einem modernen Land verfügt über solchen Luxus und derartige Möglichkeiten, auf die sogar die mächtigsten Könige früher keinen Zugriff hatten. Im Winter haben wir es warm, im Sommer kühl, und wir sind viel öfter übersättigt als hungrig. Wir können fahren, wohin wir wollen. Tun, was wir wollen. Glauben, was wir wollen. Mit einem Fingerschnippen können wir Vergnügungen und Zeitvertreib herbeizaubern.
Ist es Ihnen langweilig dort, wo Sie sind? Dann verreisen Sie.
Sie hassen Ihren Job? Wechseln Sie ihn.
Sie begehren etwas? Gönnen Sie es sich.
Sie haben eine bestimmte Meinung? Äußern Sie sie.
Sie möchten etwas haben? Kaufen Sie es sich.
Sie träumen von etwas? Verfolgen Sie Ihren Traum.
Fast alles, was Sie wollen, wann auch immer Sie es wollen, wie Sie es gerne haben möchten, bekommen Sie. Das gilt als unser Menschenrecht, so wie es sein sollte. Jedoch … Was haben wir angesichts dessen vorzuweisen? Sicherlich kein allgemeines Wohlbefinden. Jeder von uns wird gestärkt, von allen Fesseln befreit, vom Schicksal über alle Maßen gesegnet … Warum sind wir dann so verdammt unglücklich?
Weil wir Freiheit mit Freizügigkeit verwechseln. Freiheit ist aber gemäß Eisenhowers berühmtem Ausspruch nur die »Gelegenheit zur Selbstdisziplinierung«. Wenn wir uns nicht treiben lassen wollen, verletzlich, durcheinander, zusammenhanglos existieren möchten, dann müssen wir die Verantwortung für uns übernehmen. Die moderne Technik, der Zugang zu allen möglichen Dingen, der Erfolg, die Macht, die Privilegien – das alles ist nur ein Segen, wenn es von der zweiten der Kardinaltugenden begleitet wird: der Selbstbeherrschung.
Temperantia
Moderatio
Enkrateia
Sophrosyne
Majjhimāpatipadā
Zhongyong
Wasat
Von Aristoteles bis Heraklit, vom Heiligen Thomas von Aquin bis zu den Stoikern, von der Ilias bis zur Bibel, im Buddhismus, im Konfuzianismus, im Islam – die Alten hatten viele Ausdrücke und viele Symbole für das, was auf ein zeitloses Gesetz des Universums hinausläuft: Wir müssen uns selbst in Zaum halten, sonst riskieren wir den Ruin. Oder die Unausgeglichenheit. Oder eine Funktionsstörung. Oder eine Abhängigkeit.
Natürlich leidet nicht jeder unter vom Überfluss verursachten Problemen, aber jeder profitiert von Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Das Leben ist nicht gerecht. Nicht jede Existenz wird gleichermaßen beschenkt. Und die Folge dieser Ungerechtigkeit ist, dass diejenigen von uns, die aus einer benachteiligten Position ins Leben starten, noch mehr Disziplin aufbringen müssen, um eine Chance zu haben. Sie müssen härter arbeiten, sie haben weniger Spielraum für Fehler. Aber sogar all jene Menschen, die weniger Freiheiten haben, müssen täglich unzählige Entscheidungen darüber treffen, welchem Verlangen sie nachgeben, welche Handlungen sie ergreifen, was sie von sich selbst akzeptieren oder verlangen.
So gesehen, sitzen wir alle im selben Boot: Sowohl die vom Schicksal Begünstigten als auch die weniger Begünstigten müssen lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, sich bestimmter Handlungen zu enthalten, wenn dies ratsam erscheint, und entscheiden, an welchen Normen sie sich orientieren wollen. Wir müssen uns selbst beherrschen, wenn wir nicht von anderen Personen oder Dingen beherrscht werden wollen.
Man könnte sagen, dass jeder von uns ein höheres und ein niederes Selbst hat, und dass diese beiden Identitäten in einem ständigen Kampf miteinander stehen. Es geht um das Können gegen das Sollen. Es geht darum, was wir uns erlauben können, und darum, was das Beste wäre. Es geht um die Seite, die sich konzentrieren kann, und die Seite, die sich leicht ablenken lässt. Die Seite, die sich bemüht und etwas erreicht, gegen die Seite, die sich erniedrigt und Kompromisse eingeht. Die Seite, die das Gleichgewicht sucht, gegen die Seite, die das Chaos und die Ausschweifung liebt.
In der Antike wurde dieser innere Kampf als Akrasia bezeichnet, aber in Wirklichkeit geht es wieder um Herkules am Scheideweg.
Wofür werden wir uns entscheiden? Welche Seite wird gewinnen? Wer werden Sie sein?
Die ultimative Form von Größe
Im ersten Buch dieser Reihe über die Kardinaltugenden wurde Mut definiert als die Bereitschaft, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen – für eine Sache, für eine Person, für etwas, von dem Sie wissen, dass Sie es tun müssen.
Selbstdisziplin – die Tugend der Mäßigung – ist sogar noch wichtiger, denn es ist die Fähigkeit, sich dauerhaft einer derartigen Gefahr auszusetzen.
Die Fähigkeit …
… hart zu arbeiten
… nein zu sagen
… gute Gewohnheiten zu pflegen und sich Grenzen zu setzen
… zu trainieren und sich vorzubereiten
… Versuchungen und Provokationen zu ignorieren
… die eigenen Gefühle im Zaum zu halten
… qualvolle Schwierigkeiten zu ertragen.
Selbstdisziplin bedeutet, alles zu geben … und zu wissen, was man zurückhalten muss. Enthält diese Aussage einen Widerspruch? Nein, nur Ausgewogenheit. Manchen Dingen gehen wir nach, manchen widerstehen wir; dabei handeln wir stets maßvoll, durchdacht und vernünftig, ohne uns dabei aufreiben oder mitreißen zu lassen.
Mäßigung bedeutet nicht Entbehrung, sondern Selbstbeherrschung in körperlicher, intellektueller und seelischer Hinsicht – immer das Beste von sich selbst zu verlangen, auch wenn niemand hinschaut, auch wenn man mit weniger auskommen würde. Eine derartige Lebensweise erfordert Mut – nicht nur, weil sie schwer ist, sondern weil man damit in der heutigen Zeit eine Ausnahme darstellt.
Disziplin ermöglicht deshalb Vorhersagen über die Zukunft und bestimmt diese. Durch Disziplin erhöht sich für Sie die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein; aber unabhängig von dem, was passiert, egal, ob es ein Erfolg oder ein Fehlschlag wird, können Sie sich großartig fühlen. Umgekehrt gilt, dass ein Mangel an Disziplin Sie in Gefahr bringt und Ihre Persönlichkeit negativ prägt.
Kehren wir zurück zu Eisenhower und seiner Überzeugung, dass Freiheit die Gelegenheit zur Selbstdisziplinierung eröffnet. Hat er dies nicht durch sein eigenes Leben bewiesen? Er musste sich zunächst etwa 30 Jahre lang auf nicht sehr glamourösen Militärposten abrackern, bevor er sich den Rang eines Generals verdient hatte. Und er musste zunächst von den Vereinigten Staaten aus ohne direkte Mitwirkung verfolgen, wie seine Kollegen auf dem Schlachtfeld Medaillen und Ruhm erwarben. Als er 1944 zum Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg ernannt wurde, befehligte er plötzlich eine Armee von etwa drei Millionen Mann, welche nur die Spitze einer Kriegsanstrengung darstellten, an der letztlich mehr als 50 Millionen Menschen beteiligt waren. Mit dieser Verantwortung, als militärischer Kommandant eines Bündnisses von Nationen mit insgesamt mehr als 700 Millionen Einwohnern, entdeckte er, dass er dadurch keineswegs von allen Regeln befreit war, sondern dass er ganz im Gegenteil nunmehr strenger als je zuvor zu sich selbst sein musste. Er gelangte zu der Einsicht, dass man Menschen am besten nicht durch Zwang oder Befehle führt, sondern durch Überzeugungskraft, durch Kompromisse, durch Geduld, durch Zügelung des eigenen Temperaments und vor allem durch das eigene Vorbild.
Am Ende des Krieges stand er als der größte aller Sieger da, denn er hatte einen Kampf von einem Umfang gewonnen, mit dem noch nie zuvor ein militärischer Kommandant konfrontiert gewesen war (und hoffentlich auch nie mehr sein wird). Zum Präsidenten gewählt, mit der Verfügungsgewalt über ein neu geschaffenes Arsenal an Atomwaffen, war er buchstäblich der mächtigste Mensch auf Erden. Es gab nahezu keine Person und keinen Sachverhalt, die seine Entscheidungen konditionieren konnten, nichts, was ihn aufhalten konnte, niemanden, der nicht bewundernd zu ihm aufblickte oder in Furcht vor ihm zurückwich. Doch während seiner Präsidentschaft gab es keine neuen Kriege, keinen Einsatz der schrecklichen Atomwaffen, keine Eskalation von Konflikten, und er verließ sein Amt mit hellsichtigen Warnungen über die Mechanismen, die zum Krieg führen, über die Gefahren des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes. Der auffälligste Gebrauch von militärischer Gewalt in Eisenhowers Amtszeit war die Entsendung der 101st Airborne Division, um eine Gruppe schwarzer Kinder zu schützen, die zum ersten Mal eine bis dahin weißen Kindern vorbehaltene Schule besuchten.
Und in welche Skandale war er verwickelt? Bereicherte er sich an öffentlichen Geldern? Brach er seine Versprechen? Nichts von alledem. Seine Größe, wie jede wahre Größe, beruhte nicht auf Aggressivität oder Egozentrik, auch nicht auf seiner Zielstrebigkeit oder der Höhe seines Reichtums, sondern auf Bescheidenheit und Zurückhaltung – auf seiner Selbstbeherrschung, die ihn würdig machte, über andere zu herrschen. Vergleichen Sie ihn mit den Eroberern seiner Epoche: Hitler. Mussolini. Stalin. Oder mit anderen militärischen Zeitgenossen: MacArthur. Patton. Montgomery. Oder mit Führungspersönlichkeiten aus der Vergangenheit: Alexander dem Großen. Xerxes. Napoleon. Was am Ende Bestand hat, was wir wirklich bewundern, ist nicht der Ehrgeiz, sondern die Selbstkontrolle. Die Selbsterkenntnis. Die Ausgewogenheit.
In seiner Jugend hatte Eisenhowers Mutter ihm einen Vers der Sprüche Salomos aus dem Alten Testament zitiert: »Ein Geduldiger ist besser als ein Starker«, hatte sie ihm gesagt, »und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt.« Sie lehrte ihn die gleiche Lektion, die Seneca den Herrschern, die er beriet, beizubringen versuchte: »Am mächtigsten ist derjenige, der sich selbst unter Kontrolle hat.« Und so kam es, dass Eisenhower buchstäblich die ganze Welt eroberte, nachdem er zuerst sich selbst erobert hatte.
Dennoch werden solche Menschen, die sich mehr erlauben, die sich selbst weniger strenge Regeln auferlegen – die Rockstars, die Berühmten, die Verruchten –, von uns manchmal insgeheim dafür gefeiert, vielleicht auch beneidet. Ihr Leben scheint einfacher zu sein. Es scheint mehr Spaß zu machen. Möglicherweise hat man auf diese Weise auch Erfolg.
Stimmt das wirklich? Nein, das ist eine Illusion. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass niemand ein schwereres Leben hat als der Faulpelz. Niemand muss stärker leiden als der Vielfraß. Kein Erfolg ist von kürzerer Dauer als der des Leichtsinnigen oder des grenzenlos Ehrgeizigen. Das eigene Potenzial nicht voll auszuschöpfen, ist eine schreckliche Strafe. Die Gier setzt sich ständig neue Ziele und verhindert die Zufriedenheit mit dem bereits Erreichten. Obwohl derartige Personen äußerlich betrachtet beneidenswert erscheinen mögen, so herrschen doch in ihrem Inneren nur Elend, Selbstverachtung und Abhängigkeit.
Was die Mäßigung betrifft, so wurde diese in der Antike gerne metaphorisch durch das Bild eines Wagenlenkers verdeutlicht. Um das Rennen zu gewinnen, muss dieser nicht nur seine Pferde dazu bringen, möglichst schnell zu laufen, sondern er muss sein Gespann auch unter Kontrolle halten, die Nervosität und Aufregung der Pferde eindämmen und die Zügel so fest im Griff haben, dass er mit ihnen auch in den schwierigsten Situationen das Gespann noch präzise steuern kann. Der Wagenlenker muss herausfinden, wie er Strenge und Milde gegenüber den Pferden ausbalancieren kann, wie er das Gleichgewicht halten kann zwischen harten und leichten Manövern. Er muss sich selbst und seinen Tieren das Tempo vorgeben und dazu in der Lage sein, wenn nötig jedes verfügbare Quäntchen Geschwindigkeit aus ihnen herauszuholen. Ein Fahrer ohne Kontrollvermögen wird zwar schnell unterwegs sein … aber er wird unweigerlich einen Unfall bauen. Besonders in den Haarnadelkurven der Rennstrecke und auf der gewundenen, mit Schlaglöchern übersäten Straße des Lebens. Vor allem dann, wenn das Publikum und die Konkurrenz nur darauf warten.
Durch Disziplin wird nicht nur alles ermöglicht, sondern es wird auch alles verbessert. Versuchen Sie, eine wirklich große Persönlichkeit zu nennen, die keine Selbstdisziplin besaß. Versuchen Sie, ein katastrophales Scheitern zu nennen, das nicht zumindest zum Teil auf einen Mangel an Selbstdisziplin zurückzuführen war. Wichtiger als das Talent ist im Leben das Temperament. Und die Mäßigung.
Die Menschen, die wir am meisten bewundern und die in diesem Buch vorgestellt werden – Mark Aurel, Königin Elisabeth II., Lou Gehrig, Angela Merkel, Martin Luther King Jr., George Washington, Winston Churchill –, inspirieren uns mit ihrem von Zurückhaltung geprägten Engagement. Die als Warnung zu verstehenden Lebensgeschichten aus der Vergangenheit – Napoleon, Alexander der Große, Julius Cäsar, König Georg IV. – beeindrucken uns hingegen mit ihrem selbstverschuldeten Niedergang. Und weil in jedem Menschen eine Vielfalt von Facetten steckt, können wir manchmal in ein und derselben Person sowohl Exzesse als auch Selbstbeherrschung beobachten und können von beidem lernen.
Freiheit erfordert Disziplin.
Disziplin gibt uns Freiheit.
Freiheit und Größe.
Ihr Schicksal steht vor Ihnen.
Werden Sie seine Zügel in die Hand nehmen?
Teil I
Das Äußere (Der Körper)
»Unser Körper ist unsere Pracht, unser Risiko und unsere Sorge.«
Martha Graham
Wir beginnen mit dem Selbst, der physischen Form. Im ersten Brief des heiligen Paulus an die Korinther werden wir aufgefordert, den Körper zu unterwerfen und ihn unter unsere Kontrolle zu bringen, um nicht zu Ausgestoßenen zu werden. In der römischen Tradition der Stoiker ging es um »Durchhaltevermögen, genügsame Ernährung und eine bescheidene Nutzung anderer materieller Besitztümer«. Sie trugen zweckmäßige Kleidung und Schuhe, aßen von zweckmäßigen Tellern, tranken maßvoll aus zweckmäßigen Gläsern und waren aufrichtig den althergebrachten Lebenssitten verpflichtet. Bedauern wir sie deswegen? Oder bewundern wir ihre Schlichtheit und Würde? In einer Welt des Überflusses muss jeder von uns mit seinen Begierden und seinen Trieben ringen und einen ständigen Kampf führen, um sich für die Wechselfälle des Lebens zu wappnen. Dabei geht es nicht um Sixpack-Training oder den Verzicht auf alles, was Spaß macht, sondern um die Entwicklung der Stärke, die nötig ist für den von uns gewählten Lebensweg. Es geht darum, unterwegs nicht aufgeben zu müssen und die Sackgassen und Trugbilder entlang der Strecke zu vermeiden. Wenn wir uns selbst nicht körperlich beherrschen, wer oder was dominiert uns dann? Äußere Kräfte. Faulheit. Widrigkeiten. Entropie. Atrophie. Wir tun unsere Arbeit, jetzt und immerdar, weil dies unsere Bestimmung ist. Und wir wissen, dass es zwar einfacher erscheinen mag, alles auf die leichte Schulter zu nehmen, und es angenehmer wäre, dem Vergnügungsdrang nachzugeben. Wir wissen aber gleichzeitig, dass dies auf die Dauer ein viel schmerzhafterer Weg wäre.
Den Körper beherrschen
Er spielte trotz Fieber und Migräne. Er spielte trotz lähmenden Rückenschmerzen, Muskelzerrungen und verstauchten Knöcheln. Als er einmal von einem 130 Kilometer pro Stunde schnellen Ball am Kopf getroffen worden war, zog er am Tag danach wieder seine Sportkleidung an und spielte mit der Mütze von Babe Ruth, weil die Beule so groß war, dass er seine eigene Mütze nicht mehr aufsetzen konnte.
2130 Spiele in Folge spielte Lou Gehrig als First Base für die New York Yankees, ein Rekord körperlicher Ausdauer, der fünfeinhalb Jahrzehnte lang nicht gebrochen wurde. Es war eine Großtat menschlichen Durchhaltevermögens, die bereits so lange in die Geschichte eingegangen ist, dass man leicht vergisst, wie unglaublich sie eigentlich war. Eine normale Saison des Major League Baseball umfasste damals 152 Spiele. Gehrigs Yankees spielten nahezu jedes Jahr noch in der Nachsaison weiter und erreichten nicht weniger als sieben Mal die World Series. 17 Jahre lang spielte Gehrig von April bis Oktober ohne Pause durch, und zwar stets auf höchstem Niveau. In der Nebensaison gingen die Spieler auf Tournee und nahmen an Schaukämpfen teil, für die sie manchmal bis nach Japan flogen. Während seiner Zeit bei den Yankees absolvierte Gehrig rund 350 Doubleheaders – zwei direkt aufeinander folgende Spiele der gleichen Mannschaften – und reiste dafür mehr als 300 000 Kilometer durch die USA, vor allem mit dem Zug oder dem Bus.
Und dennoch verpasste er kein einziges Spiel. Nicht deswegen, weil er nie verletzt oder krank gewesen wäre, sondern weil er so unermüdlich war wie eine Dampflokomotive, weil er nie aufgab, weil er Schmerzen und körperliche Grenzen überwand, die andere als Entschuldigung benutzt hätten. Als Gehrigs Hände schließlich einmal geröntgt wurden, fanden die verblüfften Ärzte nicht weniger als 17 verheilte Frakturen. Im Laufe seiner Karriere hatte er sich fast jeden einzelnen Finger gebrochen – und das hatte ihn nicht nur nicht gebremst, sondern er hatte auch kein Wort darüber verloren.
Nahezu unfair erscheint es, dass er so berühmt ist für seine Treffersträhne – die Anzahl aufeinanderfolgender offizieller Spiele, an denen er teilnahm und mindestens einen Basistreffer erzielte –, weil dies seine übrige Statistik überschattet. In seiner Karriere hatte er einen unglaublichen Schlagdurchschnitt von .340, den er erst dann übertraf, als es darauf ankam, nämlich mit .361 in seiner Nachsaison-Laufbahn. (In zwei verschiedenen World Series schlug er über .500.) Er erzielte 495 Homeruns, darunter 23 Grand Slams – ein Rekord, der mehr als sieben Jahrzehnte lang Bestand hatte. Im Jahr 1934 wurde er zum dritten Spieler aller Zeiten, der die MLB Triple Crown gewann, weil er in der US-Baseball-Liga der Spitzenreiter bei Schlagdurchschnitt, Homeruns und RBIs (»runs batted in«) war. Seine 1995 RBIs stellen die sechstbeste Leistung aller Zeiten dar und machen ihn zu einem der besten Mannschaftsspieler in der Baseballgeschichte. Er war zweifacher Gewinner des MVP-Award, also des Awards für den »Most Valuable Player«, siebenfacher All-Star, sechsfacher World Series Champion, Mitglied der Hall of Fame und der erste Spieler überhaupt, dessen Nummer nach ihm nicht mehr vergeben wurde.
Die Treffersträhne begann zwar erst ernsthaft im Juni 1925, als Gehrig den Platz der Yankees-Legende Wally Pipp einnahm, doch in Wirklichkeit zeigte sich seine herkulische Ausdauer schon in jungen Jahren. Geboren 1903 in New York als Sohn deutscher Einwanderer, war Gehrig das einzige von deren vier Kindern, das das Säuglingsalter überlebte. Er kam mit satten 6 Kilogramm auf die Welt, und die deutsche Küche seiner Mutter schien ihn von da an ständig noch fülliger gemacht zu haben. Durch die Hänseleien seiner Schulkameraden reifte die Entschlossenheit des Knaben, seinen Körper zu trainieren, sodass er den Turnverein seines Vaters besuchte; dank der deutschen Gymnastik begann Gehrig, den kräftigen Unterkörper zu entwickeln, mit dem er später so viele Homeruns erzielte. Da seine Bewegungen nicht von Natur aus gut koordiniert waren, scherzte ein Jugendfreund einmal, dass Gehrigs Körper sich oft so verhalte, »als ob er betrunken sei«. Er wurde nicht als Sportler geboren, sondern hat sich selbst in der Turnhalle dazu gemacht.
Das Leben als armer Einwanderer war nicht einfach: Gehrigs Vater war ein Trinker und neigte zum Nichtstun. Seine chronischen Ausreden und Krankheitstage, um nicht arbeiten zu müssen, haben eine tragikomische Note. Das abschreckende Beispiel seines Vaters beschämte Gehrig und inspirierte ihn dazu, Verlässlichkeit und Zähigkeit zu seinen unverzichtbaren Tugenden zu machen (er verpasste keinen einzigen Schultag, was auf seine spätere Karriere vorausverwies). Zum Glück kümmerte sich seine Mutter nicht nur sehr liebevoll um ihn, sondern war auch ein großartiges Vorbild für eine ruhige und unermüdliche Arbeitsmoral. Sie arbeitete als Köchin, als Wäscherin, als Bäckerin und als Putzfrau, in der Hoffnung, ihrem Sohn damit die Chance auf ein besseres Leben zu verschaffen.
Aber die Armut war sein ständiger Begleiter. »Keiner, der mit Lou zur Schule ging«, erinnerte sich ein Klassenkamerad, »kann die kalten Wintertage vergessen, an denen Lou mit khakifarbenem Hemd und khakifarbener Hose sowie klobigen braunen Schuhen, aber ohne Mantel und ohne Kopfbedeckung zur Schule kam.« Er war ein armer Junge, ein Schicksal, das sich niemand freiwillig aussuchen würde, das ihn aber positiv geprägt hat.
Es gibt eine Geschichte über Kleanthes, den stoischen Philosophen, der an einem kalten Tag durch Athen ging und dessen dünner Mantel von einem Windstoß aufgerissen wurde. Die Beobachter waren verblüfft, als sie feststellten, dass er trotz der eisigen Temperaturen kaum etwas anderes darunter trug. Das brachte sie dazu, ihm zu applaudieren, als Zeichen der Anerkennung für seine Widerstandsfähigkeit. Genauso verhielt es sich mit Gehrig, der auch dann, als er durch sein Gehalt bei den Yankees zu einem der bestbezahlten Sportler Amerikas geworden war, in den New Yorker Wintern nur selten mit einer Mütze oder gar einer Weste gesehen wurde. Erst später, als er eine nette und liebevolle Frau heiratete, ließ er sich überreden, einen Mantel anzuziehen – nur ihr zuliebe.
Die meisten Kinder treiben gerne Sport. Lou Gehrig verstand Baseball jedoch als eine Art von Berufung. Als Profispieler musste er seinen Körper sowohl beherrschen als auch pflegen, denn sein Körper war nicht nur ein Hindernis, sondern auch ein Mittel auf dem Weg zum Erfolg.
Gehrig tat beides. Er arbeitete härter als jeder andere. »Fitness war für ihn fast eine Religion«, sagte ein Teamkollege über ihn. »Ich bin ein Sklave des Baseball«, erklärte Gehrig. Ein freiwilliger Sklave, der seine Arbeit liebte und der stets dafür dankbar war, dass man ihm die Möglichkeit gab, zu spielen.
Diese Art von Hingabe zahlt sich aus. Wenn Gehrig die Home Plate betrat, war er in Verbindung mit etwas Göttlichem. Er stand gelassen da, in einer schweren Wolluniform, mit der heutzutage kein Spieler mehr herumlaufen könnte. Er verfiel in eine wiegende Bewegung, bei der er sein Gewicht zwischen seinen Füßen verlagerte, um sich in seine Schlagposition zu bringen. Wenn er dann zum Schlag ausholte, waren es seine kräftigen Beine, die diese Arbeit verrichteten und den Ball mithilfe des Schlägers weit aus dem Ballpark schleuderten.
Manche Schläger haben bevorzugte Positionen; Gehrig konnte überall auf den Ball schlagen, von jeder Stelle aus. Und wenn er es getan hatte? Dann rannte er los. Für einen Typen, der für seine »Klavierbeine« verspottet wurde, ist es ziemlich bemerkenswert, dass Gehrig im Lauf seiner Karriere mehr als ein Dutzend Mal die Home Plate erreichte. Sein Erfolg beruhte nicht nur auf Kraft. Er besaß auch Schnelligkeit, Dynamik und Finesse.
Es gab talentiertere und brillantere Spieler mit mehr Persönlichkeit, aber niemand übertraf ihn im Einsatzwillen, niemand achtete mehr auf seine Kondition, und niemand liebte das Spiel mehr als er.
Wenn man seine Arbeit liebt, dann versucht man nicht, sich ihr oder den Anforderungen, die sie an einen stellt, zu entziehen. Man respektiert sogar die trivialsten Aspekte dieser Arbeit – Gehrig hat nie seinen Schläger in die Luft geworfen oder ihn rotieren lassen. Eines der wenigen Male, dass er Ärger mit dem Management bekam, war, als man herausfand, dass er in den Straßen seines früheren Wohnviertels mit den dortigen Kindern Stickball spielte, manchmal sogar unmittelbar nach den Spielen der Yankees. Er konnte einfach keine Gelegenheit zum Spielen auslassen …
Trotzdem muss es viele Tage gegeben haben, an denen er sich nicht wohlfühlte. An denen er aufhören wollte. An denen er an sich zweifelte. An denen er das Gefühl hatte, sich kaum noch bewegen zu können. An denen er frustriert war und genug hatte von seinen eigenen hohen Ansprüchen. Gehrig war kein Übermensch – er trug in seinem Inneren die gleichen Bedenken mit sich herum wie wir alle. Allerdings kultivierte er die Stärke, die ihm zur Gewohnheit wurde, nicht auf diese Bedenken zu hören. Denn sobald man anfängt, Kompromisse einzugehen, ist man kompromittiert …
»Ich habe den Willen zu spielen«, sagte er. »Baseball ist harte Arbeit und die Belastung ist enorm. Natürlich macht es Spaß, aber es ist anstrengend.« Man sollte meinen, dass jeder diesen Willen zum Spielen hat, aber das stimmt keineswegs. Einigen von uns genügt ihr angeborenes Talent, und sie hoffen, dass sie nie auf die Probe gestellt werden. Andere zeigen eine gewisse Einsatzbereitschaft, aber sie lassen es sein, wenn es zu schwer wird. Das war damals so und ist auch heute noch so, sogar auf der Ebene des Spitzensports. Ein Manager zu Gehrigs Zeiten nannte es die »Epoche der Alibis« – jeder hatte immer eine Ausrede parat. Es gab immer einen Grund, warum sie gerade nicht ihr Bestes geben konnten, die Anstrengung nicht aufrechterhalten mussten, nicht hinreichend vorbereitet auf dem Spielfeld erschienen.
Als er noch ein Neuling war, fragte Joe DiMaggio einmal Gehrig, wer seiner Meinung nach für das gegnerische Team werfen würde, womöglich in der Hoffnung, die Antwort zu erhalten, dass es jemand sei, dessen Ball leicht mit dem Schläger zu treffen sei. »Darüber brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen, Joe«, erklärte Gehrig. »Denk einfach daran, dass sie gegen die Yankees immer ihr Bestes geben.« Und deshalb erwartete er von jedem Spieler der Yankees ebenfalls stets die maximale Anstrengung. Denn der Deal war der folgende: Wer leistungsstark ist, von dem wird auch viel erwartet. Ein Champion muss auf dem Niveau eines Champions spielen … und sich dennoch so viel Mühe geben wie jemand, der noch etwas zu beweisen hat.
Gehrig war kein Trinker. Er war nicht scharf auf Frauen oder Nervenkitzel oder schnelle Autos. Er war kein »Good-Time-Charlie«, kein Lebemann, wie er das zu nennen pflegte. Aber er stellte auch klar: »Ich bin kein Prediger und kein Heiliger.« Sein Biograf Paul Gallico, der nur wenige Jahre vor Gehrig in New York aufgewachsen war, schrieb, dass dessen »anständiges Leben nicht auf selbstgefällige Prüderie oder den Wunsch, einen Heiligenschein zu tragen, zurückzuführen war. Er hatte einen hartnäckigen, drängenden Ehrgeiz. Er wollte etwas erreichen. Er wählte den vernünftigsten und effizientesten Weg, um es zu bekommen.«
Man sorgt sich nicht um den eigenen Körper, weil es eine Sünde wäre, ihn zu vernachlässigen, sondern weil wir, wenn wir diesen Tempel missachten, unsere Erfolgschancen genauso wenig ehren wie eine Gottheit. Gehrig war bereit zuzugeben, dass er durch seine Disziplin auf einige Vergnügungen verzichten musste. Aber er wusste auch, dass diejenigen, die ein allzu rasantes oder lockeres Leben führen, ebenfalls etwas verpassen – sie können ihr eigenes Potenzial nicht voll ausschöpfen. Disziplin führt nicht zu Entbehrungen, sondern zu Belohnungen.
Dennoch hätte Gehrig leicht eine andere Richtung einschlagen können. Während eines frühen Karrieretiefs, als er in einer unterklassigen Liga spielte, ging Gehrig eines Abends mit einigen Mannschaftskameraden aus und betrank sich so sehr, dass er am nächsten Tag immer noch viel Alkohol im Blut hatte. Er schaffte es aber nicht nur, ganz ordentlich zu spielen, sondern spielte deutlich besser als in den Monaten zuvor. Er stellte fest, dass seine Nervosität und seine Selbstzweifel wie durch ein Wunder aufgrund einiger Schlucke aus der Flasche zwischen den Spielrunden verschwunden waren.
Glücklicherweise hatte er damals einen erfahrenen Trainer, der das bemerkte und Gehrig vom Feld holte. Er hatte solche Fälle bereits zuvor gesehen. Er wusste, dass dieses Hilfsmittel kurzfristige Vorteile brachte. Er verstand das Bedürfnis nach Entspannung und Vergnügung. Aber er wies Gehrig auf die langfristigen Kosten des Alkohols hin und erklärte ihm, welche Zukunft ihn erwarten würde, wenn er keine nachhaltigeren Mechanismen zur Stressbewältigung entwickeln würde. Damit war das Trinken für ihn erledigt, schreibt sein Biograf, und zwar »nicht wegen spießiger Vorstellungen von ordentlichem Verhalten oder weil er den Alkoholkonsum für verwerflich oder falsch hielt, sondern weil er einen starken und ständigen Ehrgeiz verspürte, ein großer und erfolgreicher Baseballspieler zu werden. Alles, was diesem Ziel im Wege stand, war Gift für ihn.« Es bedeutete ihm etwas, diese Sportart zu betreiben, zum Verein der Yankees zu gehören, ein Amerikaner der ersten Generation zu sein, jemand zu sein, zu dem die Kinder aufblickten.
Während seiner ersten zehn Spielzeiten wohnte Gehrig weiterhin bei seinen Eltern und fuhr oft mit der U-Bahn zum Stadion. Finanziell mehr als gut gestellt, besaß er später ein kleines Haus in New Rochelle. Für Gehrig war Geld im besten Fall ein Werkzeug, im schlimmsten Fall eine Versuchung. Als die Yankees überwältigenden Erfolg hatten, erhielt die Mannschaft einen verbesserten Unterstand mit gepolsterten Sitzen, welche die spartanische Holzbank von zuvor ersetzten. Vom Teammanager wurde Gehrig dabei überrascht, wie er einen Teil der neuen Sitzauflagen entfernte. »Ich bin es leid, auf Kissen zu sitzen«, sagte er über das komfortable Leben eines Sportlers in seinen besten Jahren. »Kissen in meinem Auto, Kissen auf den Stühlen bei mir zu Hause – überall, wo ich mich aufhalte, gibt es Kissen.«
Er wusste, dass die Bequemlichkeit sein Feind war, und dass mit dem Erfolg eine endlose Reihe von Einladungen einhergeht, es sich bequem zu machen. Es ist leicht, diszipliniert zu sein, wenn man nichts besitzt. Aber was ist, wenn man alles hat, was man sich wünschen kann? Was ist, wenn man so talentiert ist, dass man es sich leisten kann, nicht immer die beste Leistung zu erbringen?
Das Besondere an Lou Gehrig ist, dass er selbstständig beschloss, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen. Seine Disziplin wurde ihm nicht von einer übergeordneten Instanz oder von seinen Mannschaftskameraden aufgezwungen. Seine Mäßigung war eine innere Kraft, die tief aus seinem Gemüt kam. Er selbst entschied sich für diese Haltung, trotz der damit verbundenen Opfer, trotz der Tatsache, dass andere sich erlaubten, auf eine derartige Kasteiung zu verzichten und damit davonkamen. Und er tat dies ungeachtet der Tatsache, dass diese Lebensweise in der Regel keine Anerkennung erfuhr – bei ihm war dies erst lange nach seinem Tod der Fall.
Wussten Sie, dass unmittelbar nach Ruths legendärem »gerufenen« Homerun auch Lou Gehrig einen schlug? Und das ganz ohne dramatische Gesten. Es war sogar sein zweiter in diesem Spiel. Oder dass die beiden die gleiche Anzahl an Schlagrekorden in der Baseballliga aufgestellt haben? Oder dass Ruth fast doppelt so viele Strikeouts hatte wie Gehrig? Lou hielt nicht nur seinen Körper in Form, was bei Ruth nicht der Fall war (weil dieser bis zu 110 Kilogramm auf die Waage brachte), sondern er kontrollierte auch sein Ego. Ein Reporter schrieb über Gehrig, er sei »unverdorben, ohne die geringste Spur von Egozentrik, Eitelkeit oder Einbildung«. Die Mannschaft stand für ihn immer an erster Stelle. Sie war ihm sogar wichtiger als seine eigene Gesundheit. In die Schlagzeilen sollten ruhig andere kommen, er legte keinen Wert darauf.
Hätte er sich anders verhalten können? Einerseits ja, andererseits aber auch nicht. Denn er hätte sich selbst kein anderes Verhalten gestattet.
Sogar sein Trainer beschwerte sich einmal im Scherz: »Wenn alle Baseballspieler wie Gehrig wären, dann gäbe es für die Trainer in den Vereinen nichts mehr zu tun.« Gehrig bereitete sich selbst vor, kümmerte sich um sein eigenes Training – ebenso gewissenhaft außerhalb wie während der Spielzeiten – und benötigte nur selten Massagen oder Reha-Behandlungen. Das Einzige, was er von den Vereinsmitarbeitern verlangte, war, dass ihm vor dem Spiel ein Kaugummistreifen in seinen Spind gelegt wurde, oder zwei, wenn seine Mannschaft zu einem Doubleheader antrat. Ein Beobachter bemerkte einmal, Gehrig schenke seinem Ruhm keine große Beachtung, nehme die damit verbundenen Verpflichtungen aber sehr ernst.
Aber Sport beruht nicht nur auf Muskeln und Talent. Niemand spielt so viele Spiele hintereinander wie Gehrig, ohne hart im Nehmen zu sein. Das zeigte sich, als ihn eines Tages ein schlechter Wurf seines dritten Baseman dazu zwang, auf dem Boden nach dem Ball zu greifen, wobei er seinen Daumen in die Erde rammte. Sein Mannschaftskamerad erwartete daraufhin, er würde nach dem Spiel ihm gegenüber fürchterlich fluchen. »Ich glaube, er ist gebrochen«, war jedoch alles, was Gehrig sagte. »Lou hat kaum einen Laut von sich gegeben«, berichtete der Mitspieler verblüfft. »Er beklagte sich überhaupt nicht über meinen missratenen Wurf, dem er seine Daumenverletzung verdankte.« Und natürlich stand Gehrig am nächsten Tag trotz allem wieder im Aufgebot.
»Ich glaube, seine Serie ist jetzt zu Ende«, scherzte ein Pitcher, nachdem er Gehrig im Juni 1934 mit einem Wurf so hart getroffen hatte, dass dieser das Bewusstsein verlor. Fünf schreckliche Minuten lang lag er regungslos und wie tot da – in jener Zeit, als beim Baseball noch keine Helme getragen wurden, konnte man auf dem Spielfeld tatsächlich das Leben verlieren. Mit größter Eile wurde er ins Krankenhaus transportiert, und die meisten Beobachter dieses Unfalls gingen davon aus, dass er zwei Wochen Erholung brauchen würde, wenngleich beim Röntgen immerhin festgestellt wurde, dass seine Schädelknochen nicht gebrochen waren. Aber auch diesmal stand er am darauffolgenden Tag wieder in der Batter’s Box.
Dennoch hätte man nun ein Zögern, ein Zusammenzucken erwarten können, als wieder Bälle mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugerast kamen. Aus diesem Grund versuchen die Pitcher, den Schlagmann hin und wieder absichtlich zu treffen, weil dieser dann, um einen Knockout zu vermeiden, vorsichtig wird und zurückweicht, was in einem Spiel, wo bereits wenige Millimeter einen entscheidenden Unterschied bedeuten können, für den Werfer von Vorteil ist. Stattdessen beugte sich Gehrig vor ... und schlug einen Triple. Ein paar Durchgänge später schlug er einen weiteren. Und bevor das Spiel wegen des Regens abgebrochen wurde, schlug er seinen dritten … während er sich noch von dem Aufprall des Balls gegen seinen Schädel erholte, der ihn fast das Leben gekostet hätte. »Einen alten Schweden kann nichts erschüttern«, war sein einziger Kommentar nach dem Spiel.
Was treibt einen Menschen an, derartige Anstrengungen zu vollbringen? Manchmal geht es nur darum, den eigenen Körper daran zu erinnern, wer das Sagen hat. »Ich musste es mir einfach beweisen«, sagte er. »Ich wollte sicher sein, dass der Treffer auf meinem Kopf mich auf der Schlagstelle nicht zu einem Hasenfuß gemacht hat.«
Auch wenn Gehrig nicht den Status eines Heiligen anstrebte, hat er diesen trotzdem erreicht. »Es gab keinen besseren Menschen als ihn auf Erden«, bemerkte einer seiner Mannschaftskameraden. »Alkohol, Kautabak oder Zigaretten hat er nicht angerührt. Und er war jeden Abend um halb zehn oder zehn im Bett.« Das waren keine besonders spektakulären Gewohnheiten, und doch brachten sie ihm ungeheuren Respekt ein. Und warum war das so? »Wenn ein Mensch sein Leben unter Kontrolle hat, samt seinen körperlichen Bedürfnissen, seinem niederen Selbst«, sollte Muhammad Ali später sagen, »dann hebt er sich dadurch aus der Menge hervor.«
Es gibt eine alte Geschichte über Gehrigs erstes Spiel mit den Yankees, als er seine Serie begann. Angeblich wurde er auch an diesem Tag bereits von einem Ball getroffen. »Willst du, dass wir dich vom Feld nehmen?«, fragte der Manager ihn. »Auf keinen Fall!« soll Gehrig ausgerufen haben. »Ich habe drei Jahre gebraucht, um im Baseball Fuß zu fassen. Von einem Schlag auf den Kopf lasse ich mich da nicht beirren.«
17 Jahre später setzte ihn schließlich etwas außer Gefecht, das weitaus gravierender war als ein rasanter Wurf. Da Gehrig jemand war, der seit Langem daran gewöhnt war, alles unter Kontrolle zu haben, muss es für ihn verwirrend gewesen sein, als sein Körper nicht mehr so reagierte, wie er es bis dahin immer getan hatte. Nach und nach, aber doch merklich, wurde sein Schwung mit dem Schläger langsamer. Es bereitete ihm Mühe, seinen Fanghandschuh anzuziehen. Er fiel hin, als er sich eine Hose anzog. Er hatte einen schleppenden Gang. Doch sein schierer Wille ließ ihn noch eine Weile durchhalten, sodass nur wenige ahnten, dass er Schwierigkeiten hatte. Eine Zeit lang täuschte er sogar sich selbst.
Hier nur als Beispiel Gehrigs Spielplan im August 1938: Die Yankees traten zu 36 Spielen innerhalb von 35 Tagen an. Zehn dieser Spiele waren Doubleheader; in einem Fall gab es fünf Tage ohne Pause mit jeweils zwei direkt aufeinander folgenden Spielen der gleichen Mannschaften. Gehrig reiste in fünf Städte und legte viele Tausende von Kilometern mit dem Zug zurück. Er schlug .329 mit neun Homeruns und 38 RBIs.
Dass ein Sportler im Alter von Mitte 30 dies schaffte, ohne ein Spiel oder einen Durchgang zu verpassen, war bereits beeindruckend. Aber Lou Gehrig hielt diese Anstrengung durch, während das Frühstadium der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) seinen Körper zerstörte, seine motorischen Fähigkeiten verlangsamte, seine Muskeln schwächte und seine Hände und Füße verkrampfte.
Fast noch eine ganze weitere Saison sollte vergehen, bis Gehrigs Körper völlig den Dienst einstellte. Seine persönliche Serie hatte ein Eigenleben entwickelt und ging unaufhörlich weiter. Obwohl er auf dem Spielfeld hin und wieder Fehler machte, was ihm früher nie passiert war, produzierte Gehrig immer noch seine Hits und Runs.
Aber ein Mann, der seinen Körper kennt, muss auch wissen, wann für ihn der Zeitpunkt gekommen ist, aufzuhören, sogar dann, wenn er die Grenzen der Belastbarkeit immer weiter hinausgeschoben hat. »Joe«, sagte er zum Manager der Yankees an einem gewöhnlichen Tag im Mai 1939. »Ich habe immer erklärt, dass ich mich nicht mehr aufstellen lasse, sobald ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft nicht mehr helfen kann. Ich glaube, das ist jetzt der Fall.«
»Wann willst du aufhören, Lou?« fragte McCarthy. Aufhören. Dieses schreckliche Wort schmerzte Gehrig. Sein Manager, der glaubte, es ginge um einen späteren Termin irgendwann in der Zukunft, hing der Hoffnung an, sie könnten noch eine Weile zusammenarbeiten. Aber der Zustand von Gehrigs Körper war dafür schon zu schlecht. »Jetzt«, antwortete er dem Manager mit Bestimmtheit. »Stell statt mir einfach Babe Dahlgren auf.«
Was hatte sich für ihn geändert? Nachdem er einige Wochen lang sehr unbeständig gespielt hatte, hatte Gehrig einen Groundball gefangen und ein solides Out erzielt. Es war ein Spielzug, der ihm Tausende Male in seiner Karriere gelungen war. Aber seine Mannschaftskameraden hatten ihn dafür gefeiert, als wäre es einer seiner Homeruns gewesen, mit denen er zum Saisongewinn beizutragen pflegte. Da wurde ihm bewusst, dass er sie ausbremste. Er hatte sich bisher nicht die Wahrheit eingestanden.
Churchill sagte zu den Knaben der Harrow School: »Gebt niemals auf. Nie, nie, nie, nie – in keiner Sache, ob groß oder klein, wichtig oder unbedeutend. […] Lasst euch niemals von der Gewalt bezwingen; weicht niemals zurück vor der scheinbar überwältigenden Macht des Feindes.« Sein ganzes Leben lang hatte Gehrig auf ähnliche Weise Widerstand geleistet. Die Armut hatte ihn nicht aufgehalten, ebenso wenig wie Verletzungen oder die Schwierigkeit, sich im Profisport zu behaupten. Er hatte der Versuchung des Lasters widerstanden und hatte sich geweigert, der Selbstgefälligkeit oder der Erschöpfung nachzugeben. Und doch war er nun bei einer der beiden Ausnahmen angelangt, die Churchill einige Jahre später erwähnen würde: »Gebt niemals nach, es sei denn aufgrund von ehrenvollen oder vernünftigen Überzeugungen.« Am Ende seines Weges angelangt, blieb Gehrig nichts anderes übrig, als seinen Abgang mit der gleichen Haltung und Selbstkontrolle zu vollziehen, mit der er die Welt des Sports betreten und in ihr gespielt hatte.
Seine persönliche Serie, die in den berauschenden Tagen der Goldenen Zwanzigerjahre begonnen hatte, die Große Depression überdauert hatte und mit der World Series von 1938 ihren Höhepunkt erreicht hatte, endete so unspektakulär, wie sie begonnen hatte. Ein Neuling bekam eine Chance auf der First Base. Für Dahlgren, seinen Nachfolger, kam das völlig überraschend; er trat in sehr große Fußstapfen. »Viel Glück«, war alles, was Gehrig dazu einfiel.