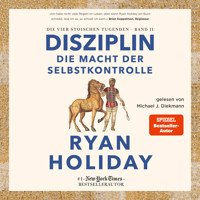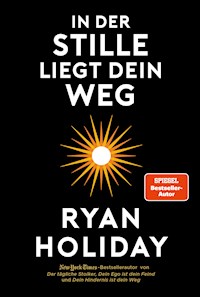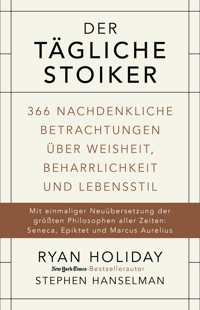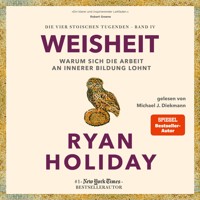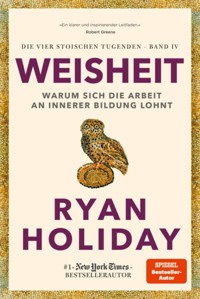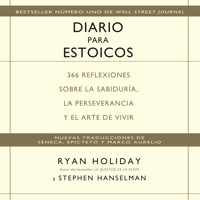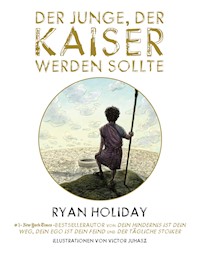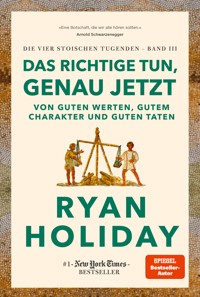
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Free your mind
- Sprache: Deutsch
Im dritten Band seiner Bestsellerreihe über die stoischen Tugenden erkundet Ryan Holiday die entscheidende Rolle, die Integrität in jedem guten Leben spielt. Von Vorbildern des aufrechten Lebens wie Ulysses S. Grant, Gandhi und Mark Aurel bis hin zu den als Warnung dienenden Geschichten von Napoleon und F. Scott Fitzgerald zeigt uns dieses Buch die Macht, die wir haben, wenn wir zu unseren Überzeugungen stehen und in Übereinstimmung mit ihnen handeln – und die Gefahren eines schlecht entwickelten Gewissens. Wenn wir das Richtige tun, wird alles andere folgen: Glück, Erfolg, Lebenssinn, Ansehen, Liebe. Dies ist der Kern der stoischen Weisheit. Der Weg ist nicht immer einfach, aber er ist unerlässlich, und die Alternative – den einfachen Weg zu gehen – zeugt nur von Feigheit und Unvernunft. Die moderne Welt suggeriert uns oft, dass gerechtes Handeln optional ist. Aber Holiday zeigt, dass das einfach nicht stimmt – und die Tatsache, dass so wenige Menschen heute die Kraft haben, zu ihren Überzeugungen zu stehen, erklärt viel darüber, warum wir so unglücklich sind. Unser Gewissen, unser Sinn für Gerechtigkeit, ist unsere primäre und entscheidende Kraft: Wir können es trainieren, schärfen und stärken, aber vor allem dürfen wir es nie verlieren. Dieses Buch zeigt uns, wie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ryan Holiday
Die vier stoischen Tugenden – Band III
Das Richtige tun, Genau jetzt
Von guten Werten, gutem Charakter und guten Taten
»Eine Botschaft, die wir alle hören sollten.«Arnold Schwarzenegger
Die vier stoischen Tugenden – Band III
Das Richtige tun, Genau jetzt
Von guten Werten, gutem Charakter und guten Taten
ryan holiday
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
2. Auflage 2026
© 2024 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285–0
Copyright der englischen Originalausgabe © 2024 by Ryan Holiday. All rights reserved. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Right Thing, Right Now. Good Values. Good Character. Good Deeds.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Thomas Stauder, Ursula Pesch
Redaktion: Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer, in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe
Umschlagdesign: Jason Heuer Design
Umschlagabbildung: Detail of mosaic depicting weighin of load from ship carrying iron minerals, c. 3rd century AD, from Hadrumetum, Sousse, Tunisia.
Satz: Röser MEDIA GmbH & Co KG, Karlsruhe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print : 978–3-95972–516–3
ISBN E-Book (PDF) 978–3-98609–501–7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978–3-98609–502–4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
»Ungerechtigkeit ist eine Art von Blasphemie. Die Natur hat die denkenden Wesen füreinander geschaffen: um sich gegenseitig zu helfen – nicht zu schaden –, wie sie es verdienen. Gegen ihren Willen zu verstoßen, bedeutet also eine Lästerung der ältesten aller Gottheiten.«
Mark Aurel
Inhalt
Die vier Tugenden
Einleitung
Teil I Das Ich (Das Persönliche)
Vor Königen zu stehen …
Halten Sie Ihr Wort
Sagen Sie die Wahrheit
Übernehmen Sie Verantwortung
Seien Sie Ihr eigener Schiedsrichter
Gut, nicht groß
Seien Sie ein offenes Buch
Seien Sie anständig
Machen Sie Ihren Job
Machen Sie sich die Hände nicht schmutzig
Integrität ist alles
Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus
Seien Sie loyal
Wählen Sie einen Nordstern
Das Richtige tun, genau jetzt
Teil II Das Wir (Das Soziopolitische)
Aus versagenden Händen werfen wir euch die Fackel zu …
Sie müssen nur freundlich sein
Sehen Sie sich an, wie die andere Hälfte lebt
Sie müssen helfen
Fangen Sie klein an
Bilden Sie Allianzen
Werden Sie mächtig
Praktizieren Sie Pragmatismus
Entwickeln Sie Kompetenz
Geben Sie, geben Sie, geben Sie
Pflanzen Sie einen Coaching Tree
Achten Sie auf die kleinen Leute
Bereiten Sie gute Schwierigkeiten
Fangen Sie einfach immer wieder von vorne an
Etwas Größeres als wir
Teil III Wir sind alle eins
Die Welt so sehr zu lieben
Besteigen Sie Ihren zweiten Berg
Hören Sie auf, nach etwas Drittem zu fragen
Geben Sie ihnen Hoffnung
Seien Sie ein Engel
Vergeben Sie
Leisten Sie Wiedergutmachung
Das große Einssein
Erweitern Sie den Kreis
Finden Sie das Gute in jedem
Engagieren Sie sich mit voller Hingabe
Die Liebe gewinnt
Geben Sie es weiter
Nachwort
Danksagung
Anmerkungen
Die vier Tugenden
Lange vor unserer heutigen Zeit kam Herkules an einen Scheideweg. An einer friedlichen Wegkreuzung inmitten der griechischen Hügellandschaft, im Schatten astreicher Pinien, begegnete der große Held der griechischen Geschichte und des Mythos erstmals seinem Schicksal.
Wo genau dies passierte oder wann, weiß niemand. Wir erfahren von diesem besonderen Augenblick durch die Erzählung des Sokrates. Vor Augen haben wir diese Szene in der prächtigen Kunst der Renaissance. Seine jugendliche Kraft und seine strammen Muskeln, aber auch seine seelische Qual kommen in der klassisch gewordenen Kantate zum Ausdruck, die Johann Sebastian Bach ihm gewidmet hat. Wäre es 1776 nach dem amerikanischen Gründervater John Adams gegangen, dann wäre Herkules am Scheideweg auf dem offiziellen Siegel der gerade erst entstandenen Vereinigten Staaten verewigt worden. Denn dort, bevor er unsterblichen Ruhm erwarb, bevor er die ihm gestellten zwölf Aufgaben erfüllte und bevor er die Welt veränderte, befand sich Herkules in einer persönlichen Krise. Eine Krise, wie sie jeder von uns schon erlebt hat, mit einer wichtigen Weichenstellung für seine gesamte Existenz.
Wohin war er unterwegs? Welches Ziel wollte er erreichen? Darum geht es in dieser Geschichte. Auf sich allein gestellt, unbekannt und unsicher, wusste Herkules, wie so viele Menschen, hierauf noch keine Antwort. Wo der Pfad sich gabelte, lag eine schöne Göttin, die ihm jede erdenkliche Verlockung darbot. Prächtig gekleidet, versprach sie ihm ein Leben in Saus und Braus. Sie schwor ihm, dass er nie Mangel, Unglück, Angst oder Schmerz würde erleiden müssen. Wenn er ihr folge, sagte sie zu ihm, würden alle seine Wünsche in Erfüllung gehen.
Daneben, auf dem Weg, der in eine andere Richtung führte, stand eine strenger wirkende Göttin in einem strahlend weißen Gewand. Sie brachte ihren Aufruf an ihn in ruhigerem Ton vor. Sie versprach ihm keine Belohnungen, sondern nur die Früchte seiner eigenen harten Arbeit. Es würde eine lange Reise werden, sagte sie. Er würde Opfer erbringen müssen und es würde für ihn angsteinflößende Situationen geben. Aber es war ein Lebensweg, der eines Gottes würdig war, der Weg seiner Vorfahren. Er würde ihn zu dem Mann machen, der er werden sollte.
War das die Realität? Ist es wirklich passiert? Wenn es aber nur eine Legende ist, ist es dann überhaupt von Bedeutung? Ja, denn es ist eine Geschichte über uns. Über unser eigenes Dilemma. Über unseren persönlichen Scheideweg. Herkules hatte die Wahl zwischen Laster und Tugend, dem leichten und dem schweren Weg, dem ausgetretenen Pfad und der weniger beschrittenen Route. Das Gleiche gilt für uns.
Herkules zögerte nur eine Sekunde und entschied sich dann für den Weg, der den entscheidenden Unterschied ausmachte. Er wählte die Tugend. »Tugend« kann altmodisch erscheinen. Tatsächlich aber bedeutet Tugend – griechisch arete – etwas sehr Einfaches und Zeitloses: ein hohes Niveau in moralischer, körperlicher und geistiger Hinsicht.
In der Antike setzte sich die Tugend aus vier Hauptbestandteilen zusammen: Mut, Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit. Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel nannte sie »Prüfsteine des Guten«. Millionen von Menschen sind sie als »Kardinaltugenden« bekannt, vier nahezu universelle Ideale, die vom Christentum und dem größten Teil der abendländischen Philosophie übernommen wurden, aber auch geschätzt werden im Buddhismus, Hinduismus und fast jeder anderen Religion oder Weltanschauung. Wie C. S. Lewis zu Recht feststellte, sind diese Tugenden nicht nach einem kirchlichen Würdenträger benannt – dem Kardinal –, sondern ihre Bezeichnung basiert auf dem lateinischen Wort cardo (ursprünglich Türangel, in übertragener Bedeutung Angelpunkt).
Und Dreh- und Angelpunkte sind diese Tugenden in der Tat, sie öffnen die Tür zu einem guten Leben. Sie sind auch der Gegenstand dieses Buches und dieser Reihe. Vier Bücher.1 Vier Tugenden. Ein gemeinsames Ziel: Ihnen die richtige Wahl zu ermöglichen.
Mut, Tapferkeit, Ausdauer, Stärke, Ehre, Aufopferung …
Mäßigung, Selbstbeherrschung, Zurückhaltung, Gelassenheit, Ausgeglichenheit …
Gerechtigkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Güte, Freundlichkeit …
Weisheit, Wissen, Bildung, Wahrheit, Selbsterkenntnis, Frieden …
Sie sind der Schlüssel zu einem guten Leben, einem Leben voll Ehre und Ruhm, einer in jeder Hinsicht vorzüglichen Existenz. Es sind Charaktereigenschaften, die der Schriftsteller John Steinbeck perfekt beschrieben hat als »angenehm und erstrebenswert für [ihren] Besitzer, die ihn Taten vollbringen lassen, auf die er stolz sein kann und über die er sich freuen kann«. Doch mit dem »er« sind hier nicht nur die Männer gemeint, sondern die gesamte Menschheit. In Rom existierte keine weibliche Version des Wortes virtus. Dies war ein generisches Maskulinum, denn die Tugend war weder männlich noch weiblich, es gab sie einfach.
Und es gibt sie noch heute. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Genauso wenig kommt es darauf an, ob Sie von kräftiger Statur sind oder extrem schüchtern, ob Sie einen genialen Verstand besitzen oder nur eine durchschnittliche Intelligenz, denn Tugend ist ein universeller Wert. Der gleiche Imperativ gilt für alle.
Jede dieser Tugenden ist untrennbar mit den anderen verbunden, aber dennoch unterscheiden sie sich voneinander. Das Richtige zu tun, erfordert fast immer Mut, genauso wie Mäßigung unmöglich ist ohne die Weisheit, den Wert einer Entscheidung zu erkennen. Was nützt der Mut, wenn er nicht für die Gerechtigkeit eingesetzt wird? Was nützt die Weisheit, wenn sie uns nicht bescheidener macht?
Norden, Süden, Osten, Westen – die vier Tugenden sind eine Art Kompass. Nicht umsonst werden die vier Himmelsrichtungen auf einem Kompass »Kardinalpunkte« genannt: Sie weisen uns den Weg, indem sie uns zeigen, wo wir sind und was wahr ist.
Aristoteles beschrieb die Tugend als eine Art Handwerk, etwas, das man sich aneignen kann, so wie man sich die Beherrschung eines Berufs oder einer Kunstfertigkeit aneignet. »Wir werden Baumeister, indem wir bauen, und wir werden Harfenspieler, indem wir Harfe spielen«, schreibt er. »Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, gemäßigt, indem wir gemäßigt handeln, und tapfer, indem wir tapfer handeln.«
Tugend ist etwas, das wir tun. Es ist etwas, das wir entscheiden. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, denn Herkules stand nicht nur einmal am Scheideweg. Es ist eine tägliche Herausforderung, mit der wir nicht nur einmal konfrontiert werden, sondern ständig. Werden wir egoistisch sein oder selbstlos? Tapfer oder ängstlich? Stark oder schwach? Weise oder dumm? Werden wir gute oder schlechte Gewohnheiten annehmen? Mut oder Feigheit? Werden wir uns mit der Unwissenheit zufriedengeben oder die Herausforderung neuer Ideen akzeptieren?
Werden wir stets dieselben bleiben … oder uns weiterentwickeln?
Wählen wir den bequemen Weg oder den richtigen Weg?
Einleitung
»Gerechtigkeit, jene hellste Zierde der Tugend, durch die ein guter Mensch den Titel eines Gutherzigen erlangt.«
Cicero
Der deutlichste Beweis dafür, dass die Gerechtigkeit die wichtigste aller Tugenden ist, ergibt sich aus dem, was passiert, wenn sie fehlt. Es ist bemerkenswert heftig: Das Vorhandensein von Ungerechtigkeit macht jeden Akt der Tugend – Mut, Disziplin, Weisheit –, jede Fähigkeit, jede Leistung, sofort wertlos … oder hat noch schlimmere Folgen.
Mut im Dienst des Bösen? Ein brillanter Mensch ohne Moral? Selbstdisziplin als perfekter Egoismus? Man kann argumentieren, dass nicht so viel Mut nötig wäre, wenn jeder immer gerecht handeln würde. Während Besonnenheit den Wagemut mäßigt und Vergnügen uns eine Abwechslung zur übermäßigen Selbstbeherrschung bietet, pflegte man in der Antike darauf hinzuweisen, dass es keine Tugend gibt, die ein Gegengewicht zur Gerechtigkeit darstellt.
Sie steht für sich allein.
Sie ist der Kern jeder Sache.
Jeder Tugend. Jeder Handlung. Unseres ganzen Lebens.
Nichts ist richtig, wenn wir nicht das Richtige tun.
Es sagt jedoch etwas über unsere heutige Welt aus, dass die Menschen, wenn sie das Wort »Gerechtigkeit« hören, nicht zuerst an Anstand oder Pflicht denken, sondern an das Rechtswesen. Sie denken an Anwälte. Sie denken an Politik. Uns geht es um das, was den Gesetzen entspricht, wir kämpfen viel mehr für »unsere Rechte« als für das Richtige. Es wäre vielleicht zu kurz gegriffen, dies als »Armutszeugnis« des modernen Wertsystems zu bezeichnen, aber es ist schwer, darin etwas anderes zu sehen.
»Gerechtigkeit bedeutet viel mehr als das, was in den Gerichten vor sich geht«, erinnerte C. S. Lewis seine Zuhörer in einer berühmten Vortragsreihe. »Es ist der alte Name für alles, was wir heute ›Fairness‹ nennen würden; es beinhaltet Ehrlichkeit, Geben und Nehmen, Wahrhaftigkeit, das Einhalten von Versprechen und all diese Dinge des Lebens.«
Sehr einfache Ideen, die jedoch sehr selten geworden sind.
Wir müssen uns klar machen, dass Gerechtigkeit nicht nur die Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat betrifft. Vergessen Sie die Rechtsstaatlichkeit: Was tun Sie selbst? Stare decisis? (Stehen Sie zu Ihren Entscheidungen?) Gerechtigkeit ist für uns ein Gebot. Handeln wir dementsprechend? Nicht nur in Situationen großer Verantwortung, sondern auch bei kleinen Anlässen: Wie wir einen Fremden behandeln, wie wir unsere Geschäfte führen, wie ernst wir unsere Verpflichtungen nehmen, die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit tun, unser Einfluss auf die Welt um uns herum.
Natürlich diskutieren wir gerne über Gerechtigkeit. Worin besteht sie? Wem schulden wir sie? Von klein auf bringt nichts die Menschen mehr in Wallung als eine Debatte über Fairness, darüber, ob jemand benachteiligt wurde oder nicht, darüber, ob es uns erlaubt sein sollte, etwas Bestimmtes zu tun. Wir lieben irritierende Hypothesen, wir streiten endlos über die komplizierten Ausnahmen von den Regeln, über die moralischen Konsequenzen, die beweisen, dass niemand perfekt ist.
Die moderne Philosophie verstrickt sich in komplizierte Dilemmata wie das sogenannte Trolley-Problem oder die Frage, ob es einen freien Willen gibt. Die Historiker debattieren darüber, ob die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, die unsere Welt geprägt haben, richtig oder falsch waren. Manchmal gefällt es ihnen, die Zweideutigkeiten gewisser Fälle zu unterstreichen; dann wieder fällen sie pauschale Schwarzweißurteile angesichts der Grauzonen der Wirklichkeit.
Als ob diese moralischen Entscheidungen klar und einfach wären, oder als ob sie einmalige Vorkommnisse wären und nicht allgegenwärtige Herausforderungen. Als ob wir diejenigen wären, die die Fragen stellen, anstatt dass das Leben sie an uns stellt.
Bereits in den ersten Stunden eines jeden Tages trifft jeder einzelne Mensch Dutzende von ethischen und moralischen Entscheidungen von nicht geringer Bedeutung, denen wir meistens nicht einmal ein Zehntel der nötigen Aufmerksamkeit schenken. Während wir darüber nachdenken, was wir in einer unwahrscheinlichen Situation, in der viel auf dem Spiel steht, tun würden, gibt es jederzeit unendlich viele Gelegenheiten, sich mit diesen Ideen im Alltag zu beschäftigen. Natürlich bevorzugen wir die Gerechtigkeit als abstraktes Konzept, um davon abzulenken, dass wir – wie unvollkommen auch immer – mit Gerechtigkeit handeln müssen.
Solange wir nicht aufhören zu debattieren, können wir nicht anfangen zu handeln. Wir debattieren weiter, damit wir nicht anfangen müssen zu handeln.
Gerechtigkeit als Lebensweise
Zu Beginn dieser Reihe über die stoischen Tugenden haben wir Mut definiert als das Riskieren des eigenen Hinterns an der Front und Selbstdisziplin als das Unterordnen des eigenen Egos. Um diese Metapher fortzusetzen, könnten wir Gerechtigkeit als das Festhalten an bestimmten Normen definieren – als »Flat-Ass-Regeln«, um eine Formulierung des großen Generals James Mattis zu übernehmen. Das bedeutet, die Grenze zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch, Ethisch und Unethisch, Fair und Unfair zu respektieren.
Was Sie tun werden.
Was Sie nicht tun werden.
Was Sie tun müssen.
Wie Sie es tun.
Für wen Sie es tun.
Was Sie bereit sind, dafür zu geben.
Besteht bei all dem ein gewisses Maß an Relativität? Werden manchmal auch Kompromisse geschlossen? Zweifellos, aber in der Praxis, über die Jahrhunderte und Kulturen hinweg, finden wir dennoch einen beruhigenden Umfang an Zeitlosigkeit und Universalität – einen bemerkenswerten Grad an Einigkeit über das Richtige. Sie werden feststellen, dass die Helden in diesem Buch, trotz all der Unterschiede zwischen ihnen – hinsichtlich Geschlecht und Herkunft, Krieg und Frieden, Macht und Machtlosigkeit, von Präsidenten bis zu Verarmten, von Aktivisten bis zu Abolitionisten, bis hin zu Diplomaten und Ärzten – in Fragen des Gewissens und der Ehre bemerkenswert übereinstimmen. Obwohl sich die Vorlieben der Menschen im Laufe der Jahrhunderte ständig geändert haben, ist ein Konsens erhalten geblieben: Wir bewundern Menschen, die ihr Wort halten. Wir hassen Lügner und Betrüger. Wir feiern diejenigen, die sich für das Gemeinwohl aufopfern, verabscheuen diejenigen, die auf Kosten anderer reich oder berühmt werden.
Niemand bewundert Egoismus. Letztendlich verachten wir alle das Böse, die Gier und die Gleichgültigkeit.
Psychologen haben Grund zu der Annahme, dass sogar Kleinkinder diese Konzepte fühlen und verstehen können, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass »der Hunger und der Durst nach Rechtschaffenheit« von frühester Kindheit an in uns vorhanden sind.
Das »Richtige« zu tun, ist kompliziert … aber es ist auch ziemlich simpel.
Alle philosophischen und religiösen Traditionen – von Konfuzius bis zum Christentum, von Plato bis Hobbes und Kant – orientieren sich an einer Fassung derselben goldenen Regel. Im 1. Jahrhundert vor Christus wurde Hillel, der jüdische Älteste, von einem Skeptiker gefragt, ob er auf einem Bein stehend die Tora zusammenfassen könne. Tatsächlich schaffte er es, dafür nicht mehr als zehn Wörter zu benötigen. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, sagte Hillel zu dem Mann. »Alles andere ist Beiwerk.«
Sorgen Sie sich um andere.
Behandeln Sie sie so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
Nicht nur, wenn es für Sie bequem ist oder Sie dafür Anerkennung erhalten, sondern vor allem dann, wenn das nicht der Fall ist.
Auch wenn Ihr Verhalten nicht erwidert wird. Auch wenn es Sie etwas kostet.
Der Dramatiker Euripides sagte: »Die Worte der Wahrheit sind einfach, und die Gerechtigkeit benötigt keine raffinierten Auslegungen, denn sie besitzt ihre eigene Angemessenheit, aber die Worte der Ungerechtigkeit, die in ihrem Inneren verdorben sind, erfordern einen geschickten Umgang mit ihnen.« Sie erkennen Gerechtigkeit, wenn Sie sie sehen – oder spüren sie auf der Ebene des Bauchgefühls, vor allem ihre Abwesenheit und ihr Gegenteil.
Im Jahr 1906 kam ein Junge namens Hyman Rickover mit seiner Familie, die vor den Judenpogromen in Russland geflohen war, nach Amerika. In der Marineakademie der Vereinigten Staaten, wo er die klassischen Tugenden des Militärs in sich aufsog, bahnte er sich durch seinen Fleiß den Weg nach oben. Im Laufe seiner langen Karriere, während der dreizehn US-Präsidenten amtierten – von Woodrow Wilson bis Ronald Reagan –, wurde Rickover weitgehend unbemerkt einer der mächtigsten Männer der Welt. Er leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von Schiffen und U-Booten mit Atomantrieb und leitete schließlich Programme, bei denen er für Gerätschaften im Wert von Milliarden von Dollar, für Zehntausende von Soldaten und Arbeitern sowie für Waffen mit enormem Zerstörungspotenzial verantwortlich war. Über sechs Jahrzehnte hinweg, in denen bei den weltweiten Kriegen oftmals die Gefahr eines zur Apokalypse führenden Atomkonflikts bestand, in einer Zeit, in der auch nur ein Nuklearunfall in einem Kraftwerk oder an Bord eines Schiffes verheerende Folgen haben konnte, hatte Rickover formenden Einfluss auf eine ganze Generation der international besten und klügsten Offiziere.
Rickover sagte diesen zukünftigen Führungskräften manchmal, jeder Einzelne solle so handeln, als ob das Schicksal der Welt auf seinen Schultern ruhen würde – womit er einen Ausspruch von Konfuzius paraphrasierte –, und das war in bestimmten Augenblicken seiner Laufbahn bisweilen beinahe der Fall. Aber Rickover war auch ein ganz normaler Mensch, jemand, der auch einmal launisch war, der Kollegen und Untergebene hatte, eine Ehefrau, einen Sohn, Eltern und Nachbarn, der Rechnungen zu bezahlen hatte und im Straßenverkehr zurechtkommen musste. Was ihm als Leitprinzip diente, was er in seinen Reden und Besprechungen immer wieder erwähnte, war die Bedeutung eines Sinns für Recht und Unrecht, eines Sinns für Pflicht und Ehre, die einen Menschen durch die zahllosen Zwiespalte und Entscheidungszwänge, mit denen er konfrontiert würde, geleiten konnten. »Das Leben ist nicht sinnlos für einen Menschen, der bestimmte Taten für falsch hält, weil sie es sind, unabhängig davon, ob sie gegen das Gesetz verstoßen oder nicht«, erklärte er einmal. »Diese Art von Moralkodex gibt einer Person einen Fokus, eine Grundlage für das eigene Verhalten.«
Um solch eine Orientierung geht es in diesem Buch. Es werden keine komplizierten Gesetze formuliert und auch keine klugen Haarspaltereien. Wir werden nicht die biologischen oder metaphysischen Wurzeln von richtig und falsch erkunden. Wir werden uns zwar mit den grundlegenden moralischen Dilemmata des Lebens befassen, aber das Ziel wird sein, diese zu durchschneiden wie den Gordischen Knoten – was die Menschen, die mit diesen Situationen konfrontiert waren, tun mussten –, statt Sie mit sinnlosen Abstraktionen zu verwirren. Es wird hier weder eine große Theorie des Gesetzes geben, noch wird Ihnen der Himmel versprochenen oder mit der Hölle gedroht. Die Zielsetzung dieses Buches ist viel einfacher, viel praktischer – ganz in der Tradition der antiken Denker, die Gerechtigkeit für eine Gewohnheit oder ein Handwerk hielten, eine bestimmte Art zu leben.
Denn das ist es, was Gerechtigkeit sein sollte – kein Substantiv, sondern ein Verb.
Etwas, das wir tun, nicht etwas, das wir bekommen.
Eine Form der menschlichen Exzellenz.
Eine Zielsetzung.
Eine Reihe von Handlungen.
In einer Welt, in der so viel Ungewissheit herrscht, in einer Welt, in der wir so viel nicht kontrollieren können, in der das Böse existiert und regelmäßig ungestraft bleibt, ist der Entschluss, rechtschaffen zu leben, ein Bollwerk im Sturm, ein Licht in der Dunkelheit.
Das ist es, was wir anstreben: die Gerechtigkeit als Norden auf unserem Kompass zu fixieren, als Polarstern unseres Lebens, um uns von ihr leiten und führen zu lassen durch gute und schlechte Zeiten. So wie es bei Harry S. Truman und Gandhi der Fall war, bei Mark Aurel und Martin Luther King Jr., Emmeline Pankhurst und Sojourner Truth, Buddha und Jesus Christus.
Wenn Admiral Rickover am Ende eines Telefonats den Hörer auf die Gabel knallte oder eine Besprechung beendete, erläuterte er nicht seine hohen Erwartungen und gab auch keine genauen Anweisungen, wie etwas erledigt werden wollte. Stattdessen ließ er seine Untergebenen mit einer Maxime zurück, die gleichzeitig sehr viel anspruchsvoller war und dennoch einfach und bodenständig:
»Tun Sie das Richtige!«
Wir könnten also diese Einführung mit demselben Gebot beenden:
Tun Sie das Richtige.
Tun Sie es genau jetzt.
Für sich selbst.
Für andere Menschen.
Für die Welt.
Und auf den folgenden Seiten werden wir darüber sprechen, wie das funktioniert.
Teil I Das Ich (Das Persönliche)
»Die Tugend eines Menschen wird nicht an seinen herausragenden Leistungen gemessen, sondern an seinem täglichen Verhalten.«
Blaise Pascal
Das Streben nach Gerechtigkeit beginnt nicht an weit entfernten Orten. Es beginnt zu Hause. Es beginnt bei Ihnen. Es beginnt mit der Entscheidung darüber, wer Sie sein werden. Mit den althergebrachten Werten der persönlichen Integrität, der Anständigkeit, der Würde und der Ehre. Mit den grundlegenden Verhaltensweisen, in denen sich diese Ideale manifestieren: Das zu tun, was Sie sagen. Geschäfte auf die richtige Weise abwickeln. Menschen gut behandeln. Die Stoiker sagten, die wichtigste Aufgabe im Leben sei es, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst kontrollieren kann. In der Welt mögen Ungerechtigkeit, Unfairness und unverhohlene Grausamkeit herrschen, aber es liegt in der Macht eines jeden von uns, eine Ausnahme von dieser Regel darzustellen. Ein Mensch voller Rechtschaffenheit und Würde zu sein. Wie auch immer das Gesetz lauten mag, egal in was für einer Kultur wir leben und was wir ungestraft tun dürfen, können wir uns entscheiden, unseren eigenen Kodex zu respektieren – einen strengen und gerechten Kodex. Manche mögen dies als einschränkend empfinden. Wir finden, dass das Gegenteil der Fall ist: Unser Kodex befreit uns, ist sinnstiftend und bewirkt vor allem eine echte Verbesserung. Wir predigen diese Heilslehre nicht mit Worten, sondern mit Taten – in dem Wissen, dass jede Handlung wie eine Laterne ist, die die Dunkelheit verringert, und jede Entscheidung, das Richtige zu tun, eine Botschaft, die unsere Mitmenschen, unsere Kinder und alle zukünftigen Generationen hören können.
Vor Königen zu stehen …
Es war vielleicht der heikelste Augenblick in der Geschichte der Welt. Ein geliebter Präsident der Vereinigten Staaten war vor kurzem gestorben. Ein Krieg tobte an zwei Fronten. In Europa ging das Morden weiter und die Todeslager betrieben immer noch ihre schrecklichen Öfen und Gaskammern. Im Pazifik ging die langwierige Kampagne zur Einnahme einer Insel nach der anderen weiter, und jeden Tag rückte die gefürchtete Invasion auf der japanischen Hauptinsel näher, die die Landung in der Normandie in den Schatten stellen würde.
Ein grauenhaftes nukleares Zeitalter – noch von Geheimhaltung umgeben – hatte gerade begonnen. Eine Abrechnung zwischen den verschiedenen Ethnien, die schon seit Hunderten von Jahren überfällig war, konnte nun nicht mehr vermieden werden. Die Sturmwolken eines Kalten Krieges zwischen den großen Siegermächten zeichneten sich bereits am Horizont ab.
Unter diesen Umständen, als Millionen von Leben auf dem Spiel standen, als ungewisse, schwierige Zeiten drohten, sollte ein Mann seinen großen Moment erleben. Wen hatten die Götter gesandt? Wen hatte das Schicksal für diese Feuerprobe vorgesehen?
Einen Farmer aus einer Kleinstadt in Missouri. Einen schmächtigen Mann mit Brillengläsern, die so dick und gewölbt waren, dass sie seine Augen hervorquellen ließ. Einen geschäftlich gescheiterten Kleiderladenbesitzer, der das College ohne Abschluss verlassen hatte. Einen ehemaligen Senator aus einem der korruptesten Bundesstaaten des ganzen Landes, der in die Politik gegangen war, nachdem ihm zuvor fast alles in seinem Leben missglückt war. Jemand, der für die Vizepräsidentschaft ausgewählt worden war, ohne dass sich der zuvor verschiedene Franklin Roosevelt große Mühe gegeben hätte, ihn auf seine Verantwortung vorzubereiten.
Der geschichtliche Augenblick traf den Mann: Harry S. Truman.
Der Schock wich bald der Furcht, nicht nur in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten und den Armeen im Ausland, sondern auch in Truman selbst. »Ich weiß nicht, ob Ihnen jemals eine Ladung Heu auf den Kopf gefallen ist«, sagte Roosevelts Nachfolger der Presse, »aber als man mir berichtete, was gestern passiert war, fühlte ich mich, als wären der Mond, die Sterne und alle Planeten auf mich niedergestürzt.« Und als Truman sich bei der vorherigen First Lady, der trauernden Witwe Roosevelts, erkundigte, ob er etwas für sie tun könne, schüttelte diese ernst den Kopf und erwiderte: »Können wir etwas für Sie tun? Denn Sie sind jetzt derjenige, der in Schwierigkeiten steckt.«
Doch nicht alle waren verzweifelt. »Oh, ich hatte ein gutes Gefühl«, sagte einer der mächtigsten und erfahrensten Männer in Washington, »denn ich kannte ihn. Ich wusste, was für ein Mensch er war.« Tatsächlich waren die Leute, die Truman persönlich kannten, überhaupt nicht besorgt, denn, wie ein Eisenbahnvorarbeiter aus Missouri, der den zukünftigen Präsidenten kennengelernt hatte, als dieser als Junge seine Mutter mit 35 Dollar im Monat unterstützt hatte, es formulierte: Truman war »voll in Ordnung, von seinem Arschloch aus in jeder Richtung«.
Und so begann das, was man ein unglaubliches Experiment nennen könnte, bei dem ein scheinbar gewöhnlicher Mensch nicht nur ins Rampenlicht, sondern in eine Position mit fast übermenschlicher Verantwortung geworfen wurde. Konnte ein durchschnittliches Individuum eine solch monumentale Aufgabe bewältigen? Konnte es nicht nur seinen Charakter bewahren, sondern sogar beweisen, dass der Charakter in dieser verrückten modernen Welt tatsächlich eine Rolle spielt?
Die Antwort für Harry Truman lautete: Ja. Ein klares Ja.
Aber dieses Experiment begann nicht in Washington. Auch nicht im Jahr 1945. Es begann viele Jahre zuvor mit dem einfachen Studium der Tugend und dem Vorbild eines Mannes, mit dem wir uns in dieser Reihe bereits beschäftigt haben. »Sein richtiger Name war Marcus Aurelius Antoninus«, würde Truman später erzählen, »und er war einer der ganz Großen.« Wir wissen nicht, wer Truman mit Mark Aurel bekannt machte, aber wir wissen, was Truman von Mark Aurel lernte. »Was er in seinen Meditationen geschrieben hat«, erklärte Truman über die Weltanschauung, die er von dem Kaiser übernommen hatte, »war, dass die vier größten Tugenden Mäßigung, Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit sind, und wenn ein Mensch in der Lage ist, diese zu kultivieren, ist das alles, was er benötigt, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen.«
Auf der Grundlage dieser Philosophie und der Lehren seiner Eltern schuf Truman für sich eine Art persönlichen Verhaltenskodex. Einen, den er sein ganzes Leben lang respektierte, in guten wie in schlechten Zeiten. »Wenn etwas nicht richtig ist, dann tu es nicht«, unterstrich Truman in seinem zerlesenen Exemplar der Meditationen, »wenn etwas nicht wahr ist, dann sag es nicht. … Erstens sollst du nichts Gedankenloses oder Zweckloses tun. Zweitens sollst du darauf achten, dass deine Handlungen einen gesellschaftlichen Nutzen haben.«
Truman war pünktlich. Er war ehrlich. Er arbeitete hart. Er betrog seine Frau nicht. Er zahlte seine Steuern. Er mochte nicht im Mittelpunkt stehen und Angeberei war ihm fremd. Er war höflich. Er hielt sein Wort. Er half seinen Nachbarn. Er trug sein eigenes Gewicht in der Welt. »Seit meiner Kindheit am Knie meiner Mutter«, pflegte Truman zu erzählen, »habe ich an Ehre, Ethik und ein rechtschaffenes Leben, das seine eigene Belohnung darstellt, geglaubt.«
Es war gut, dass ihm dies als lohnend genug erschien, denn viele Jahre lang gab es für ihn keine weitere Anerkennung.
Nach der Highschool arbeitete Truman als Poststellenhelfer beim Kansas City Star, als Kassierer in einer Drogerie, als Werkstattschreiber bei der Santa Fe Railroad, als Bankangestellter und als Farmer. Abgelehnt wurde er nicht nur von der Militärakademie West Point (wegen seiner mangelnden Sehkraft), sondern auch (und das mehrfach) von der Liebe seines Lebens, Bess Wallace, deren Familie er als nicht gut genug für sie erschien.
Also mühte er sich weiter ab, um über die Runden zu kommen – was ihm gerade so mit knapper Not gelang. Er wartete auf eine Chance zu zeigen, was in ihm steckte.
Die erste kam genau 27 Jahre vor Trumans Einzug ins Weiße Haus, als er seine erste Auslandsreise antrat und als Mitglied der American Expeditionary Forces, als Hauptmann der Artillerieeinheit Battery D, in der französischen Stadt Brest landete. Truman hätte eine Vielzahl plausibler Gründe gehabt, um sich vom Wehrdienst im Ersten Weltkrieg befreien zu lassen. Er war 33 Jahre alt und hatte das offizielle Einberufungsalter damit weit überschritten. Er hatte bereits seine Zeit in der Nationalgarde abgeleistet. Seine Sehkraft war sehr schlecht. Und als Farmer und einziger Ernährer für seine Schwester und seine Mutter hätte niemand von ihm erwartet, dass er sich bei den Streitkräften meldete. Dennoch war es für ihn nicht mit seinem Gewissen vereinbar, jemand anderen an seiner Stelle dienen zu lassen. Inspiriert durch Woodrow Wilsons Aufruf, die Welt für die Demokratie zu sichern – was dem Einsatz für die Gesellschaft entsprach, den ihm die Stoiker gelehrt hatten –, schrieb er sich beim Militär ein und ging an die Front.
Hier wurde sein strenger persönlicher Verhaltenskodex plötzlich zum ersten Mal vor anderen Menschen demonstriert.
»Die Gerechtigkeit ist doch ein schrecklicher Tyrann«, schrieb Truman in einem Brief nach Hause, während er über die Disziplin nachdachte, auf deren Einhaltung er gegenüber seinen Männern achten musste, so dass er bei Verstößen harte, aber gerechte Strafen verhängte. Aber als Kommandant nahm er andererseits auch das Risiko in Kauf, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, um ihnen inmitten der Strapazen des Krieges eine zusätzliche Nacht Ruhe zu gönnen, und noch viele Jahre später besuchte er von Männern der Batterie D betriebene Geschäfte, um sie mit seinen Einkäufen über Wasser zu halten.
Nach dem Krieg eröffnete Truman einen Kleiderladen, der gerade lange genug erfolgreich war, um ihn etwas hoffnungsfroher zu stimmen und ihm das Gefühl zu geben, seine Pechsträhne überwunden zu haben. Doch schon bald wurde es für ihn ein weiterer geschäftlicher Misserfolg, und hinterließ ihm Schulden, die er aus lauter Ehrgefühl noch 15 Jahre später zurückzahlte, als er bereits in die Politik eingestiegen war.
In der Tat waren es genau diese Schulden, die ihn dazu brachten, sich für eine politische Laufbahn zu entscheiden. »Ich muss mir meine Brötchen verdienen«, waren seine Worte, als er demütig einen ehemaligen Kameraden aus der Armee aufsuchte, Jim Pendergast, den Neffen von Kansas Citys mächtigstem Politiker Tom Pendergast. Letzterer hatte die Kontrolle über alle Ämter und Patronate des Staates, und er war dazu bereit, etwas für den Freund seines geliebten Neffen zu tun, weshalb er ihm erlaubte, 1922 für das Amt des Richters in Jackson County zu kandidieren.
Wenn man eine Kontrastgeschichte zu einem korrupten Politiker schreiben wollte, könnte man mit Trumans Leben sogar die Sympathie des zynischsten Publikums gewinnen. Er war ein anständiger Mensch gewesen. Er hatte seinem Land gedient. Er hatte miterlebt, wie sein eigener Vater 1912 als Straßenaufseher in Grandview, Missouri, in der Lokalpolitik mitmischte – eine Stelle, auf der Korruption nicht nur üblich, sondern akzeptiert war, sozusagen als etablierte politische Praxis. Und obwohl Harrys Vater dringend etwas Geld benötigt hätte, widerstand er der Versuchung, seine Nachbarn zu betrügen und seine eigenen Taschen zu füllen. Diese Verantwortung zerrüttete seinen Vater, und als er zwei Jahre später tot war, hinterließ er seiner Familie nichts als Schulden – und Harry schien es vorbestimmt zu sein, diese Familientradition fortzusetzen.
Harry, der ohne einen Cent dagestanden war und verzweifelt nach einer Einkommensquelle gesucht hatte, war nun von einer der korruptesten und reichsten Persönlichkeiten des Landes das Tor in die Politik geöffnet worden, so dass er einen Teil der früheren Aufgaben seines Vaters übernehmen konnte. Das war seine Chance, zu Geld zu kommen! Seiner Frau zu zeigen, was er vermochte. Eine gesellschaftliche Stellung zu erringen.
Stattdessen würde er sich, in Pendergasts Worten, als »verdammt störrisches Maultier« erweisen. Mit der Absicht, ein neues Gerichtsgebäude für den Bezirk zu errichten, fuhr Truman Tausende von Kilometern auf eigene Kosten, um sich Bauwerke anzusehen und geeignete Architekten zu finden. Als die Bauarbeiten begannen, begab er sich jeden Tag auf die Baustelle und überwachte dort alles, um Diebstahl, Gaunereien oder schlampige Arbeit zu verhindern. »Mir wurde beigebracht, dass die Ausgabe öffentlicher Gelder eine Vertrauensstellung für die Gesellschaft darstellt«, erklärte er, »und ich habe meine Meinung zu diesem Thema nie geändert. Niemand hat jemals öffentliche Gelder erhalten, für deren Vergabe ich verantwortlich war, wenn er nicht ehrliche Arbeit dafür geleistet hat.« Bauunternehmer, die vom politischen System zu Truman geschickt wurden, waren schockiert, als er tatsächlich Gebote im Rahmen von Ausschreibungen sehen wollte – und dass er offenbar lokale Unternehmen nicht bevorzugte, wenn es bessere und effizientere Firmen von außerhalb gab. Sie werden Aufträge von mir erhalten, sagte er, wenn Sie das kostengünstigste Angebot einreichen. Später schätzte er, dass er in seiner Amtszeit bis zu 1,5 Millionen Dollar aus den Kassen des Bezirks hätte stehlen können.
Stattdessen sparte er der Verwaltung eine vielfach größere Summe ein.
»Nachdem Harry über 6 Millionen Dollar an Straßenverträgen vergeben hatte«, schrieb später sein Biograf David McCullough, »wurde am 30. April 1929 ein Säumnisurteil über 8944,78 Dollar gegen ihn wegen seiner alten Herrenmoden-Schulden erwirkt. Seine Mutter hatte sich in der Zwischenzeit gezwungen gesehen, eine weitere Hypothek auf die Farm aufzunehmen. Als eine seiner neuen Straßen knapp fünf Hektar von ihrem Grundstück in Beschlag nahm, war er trotzdem der Auffassung, er müsse ihr in Anbetracht seiner Position und aus grundsätzlichen Erwägungen die übliche Entschädigung durch den Bezirk verweigern.«
»Sieht so aus, als hätten sich alle in Jackson County bereichert, nur ich nicht«, schrieb Truman an seine Frau Bess. »Ich bin froh, dass ich gut schlafen kann, auch wenn es für dich und Margie hart ist, dass ich so verdammt arm bin.« Seiner Tochter gegenüber gab er zu, dass er in finanzieller Hinsicht ein Versager war, sagte aber voller Stolz, er habe versucht, ihr etwas zu hinterlassen, »das, was (wie Mr Shakespeare sagt) nicht gestohlen werden kann – einen ehrenhaften Ruf und einen guten Namen«.
Es ergab sich jedoch, dass es gerade diese nervige und hartnäckige Pedanterie war, die Trumans Karriere schließlich über die lokale Ebene hinaus beförderte und ihm einen »Hinauswurf nach oben« in den offenen Senatssitz von Missouri bescherte. Sicherlich konnte es nicht schaden, einen Mann in Washington zu haben, aber vor allem wollte Pendergast, der stets gewusst hatte, dass er von Truman nichts Unmoralisches verlangen konnte, auf der Stelle in seiner Nähe eine folgsamere Person haben.
Natürlich sahen das die Leute in Washington nicht so. Wenn seine Kollegen Truman nicht ohnehin als Hinterwäldler abtaten, nannten sie ihn den »Senator von Pendergast« und gingen davon aus, er sei von diesem bestochen worden. Truman blieb nichts anderes übrig, als zu Mark Aurel zurückzukehren, insbesondere zu einer Passage, die er mit dem Vermerk »Wahr! Wahr! Wahr!« versehen hatte.
»Wenn Menschen beleidigende Dinge über dich sagen, dann nähere dich ihren armen Seelen, dringe in sie ein und sieh, was das für Menschen sind. Du wirst feststellen, dass es keinen Grund gibt, sich Mühe zu geben, dass diese Menschen eine gute Meinung von dir haben. Allerdings solltest du ihnen gegenüber milde gestimmt sein, denn von Natur aus sind es deine Freunde.«
Als Senator blieb Truman ein Hinterwäldler; in der Öffentlichkeit bekannt wurde er erst im Jahr 1941, als sein Unterausschuss für Kriegsmobilisierung begann, die während des Krieges geschlossenen Verträge zu untersuchen. Plötzlich waren seine Erfahrungen mit finanziellen Versuchungen und Korruption im städtischen Umfeld sehr nützlich – er wusste, wie das System funktionierte, und ihm war klar, wo Leichen im Keller liegen konnten. Und nachdem er verfolgt hatte, wie heuchlerisch die Politiker und die Presse die Vergabe der Gelder geprüft hatten, die im Rahmen des New Deal für die Ärmsten der Armen bestimmt gewesen waren, war Truman nicht bereit, die Verschwendung zu »tolerieren«, welche dieselben Gruppen in Kauf nahmen, wenn es um Rüstungsfirmen ging.
Was als »Truman-Ausschuss« bekannt wurde, sollte laut einem Time-Profil von 1943 zahlreichen Personen »die Schames- oder Zornesröte ins Gesicht treiben: Kabinettsmitgliedern, Leitern von Kriegsagenturen, Generälen, Admirälen, großen und kleinen Geschäftsleuten und Gewerkschaftsführern«. Am Ende sollten die amerikanischen Steuerzahler dadurch rund 15 Milliarden Dollar sparen und korrupte Beamte, darunter zwei Brigadegeneräle, sollten im Gefängnis landen.
»Ich hoffe, mir als Senator einen Namen zu machen«, hatte Truman an seine Frau geschrieben, »wenn ich lange genug lebe, werden die finanziellen Erfolge dagegen wie Käse aussehen. Aber du wirst eine Menge aushalten müssen, wenn ich es schaffe, denn ich werde mich nicht kaufen lassen und ich bin jederzeit bereit, mich verfluchen zu lassen, wenn ich im Recht bin.«2
Heutzutage, mit unseren umfassenden (wenngleich immer noch unzureichenden) Bestimmungen zur Wahlkampffinanzierung und anderen gesetzlichen Regeln, erscheint dies alles vielleicht als vernachlässigenswert. Die Tatsache, dass Korruption ganz offensichtlich falsch und schändlich erscheint, macht es leicht zu übersehen, wie bemerkenswert und einsam Trumans Ehrlichkeit im damaligen politischen Leben war – es ist eine Sache, sich zu bemühen, nicht in krumme Dinge verwickelt zu werden, und eine andere, dies in einer Räuberhöhle zu schaffen.
Vielleicht verstehen Sie nicht, warum es eine Rolle spielt, ob ein Präsident darauf besteht, das Porto für Briefe zu bezahlen, die er an seine Schwester schickt: »Weil sie persönlich waren. Sie hatten keinen offiziellen Charakter.« Aber genau das ist der Punkt. Entweder sind Sie jemand, der solche ethischen Grenzen zieht, oder nicht. Entweder Sie respektieren den Kodex, oder Sie tun es nicht.
Waren es diese Redlichkeit und der daraus resultierende gute Ruf, die Franklin Delano Roosevelt dazu brachten, Truman als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft zu wählen? Oder entschied sich FDR für ihn, weil er nicht wie ein Konkurrent wirkte? Wir wissen nur, dass FDR im April 1945 während eines Erholungsurlaubs in Warm Springs, Georgia, einem Schlaganfall erlag, und dass der gewöhnliche Mann in seinem Schatten dadurch plötzlich der Präsident war.
Obwohl weder die Verlockungen des Geldes noch der Reiz, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, seinen Charakter bis zu diesem Zeitpunkt hatten verändern können, wäre es verzeihlich anzunehmen, dass die große Machtfülle es vielleicht doch tun würde. Aber auch dadurch wurde Trumans Selbstdisziplin nicht beeinträchtigt. Bevor er sein Amt antrat, war er ein pünktlicher Mensch gewesen. Das war ihm schon früh beigebracht worden, bereits in seiner Schulzeit, denn von den Schülern wurde laut der Satzung erwartet, »pünktlich und regelmäßig bei der Anwesenheit, gehorsam im Geiste, ordentlich im Handeln, fleißig beim Lernen, freundlich und respektvoll im Umgang« zu sein. Und jetzt, wo er Präsident war, war es weiterhin für ihn undenkbar, zu spät zu kommen, auch wenn alle klaglos auf ihn gewartet hätten. »Wenn er zum Mittagessen ging«, erklärte einer seiner Helfer, »und dabei eine Nachricht hinterließ, dass er um 14.00 Uhr zurückkehren würde, dann kam er tatsächlich immer zu genau dieser Zeit zurück, nicht um 14.05 Uhr und auch nicht um 13.15 Uhr.«
Auf dem Resolute Desk, dem berühmten Schreibtisch im Oval Office, standen vier Uhren; zwei weitere gab es im Raum und eine an seinem Handgelenk. Sogar sein Gang, der ihm in der Armee antrainiert worden war, war zeitlich abgemessen – immer 120 Schritte pro Minute. Hotelangestellte und Reporter konnten ihre Uhren nach Trumans Tagesablauf stellen. »Oh, er wird um 7.29 Uhr aus dem Aufzug kommen«, sagten sie, wenn er zu Besuch in New York war.
Und das tat er auch! Darauf war Verlass!
Nicht lange nach seinem Amtsantritt führte Truman ein aus seiner Sicht ganz gewöhnliches Gespräch mit Harry Hopkins, einem von Roosevelts langjährigsten Beratern und Vertrauten, nachdem er ihn auf eine dringende Mission nach Russland geschickt hatte. »Ich stehe in Ihrer Schuld für das, was Sie für mich getan haben«, sagte Truman zu ihm, »und ich möchte Ihnen dafür danken.« Hopkins war fassungslos und bemerkte zum Pressesprecher, als er das Büro verließ: »Wissen Sie, mir ist gerade etwas widerfahren, was mir noch nie zuvor in meinem Leben passiert ist … Der Präsident hat gerade ›Danke‹ zu mir gesagt.«
Truman war die Art von Mensch, der, als die Tochter eines Kabinettsmitglieds operiert wurde, während ihr Vater sich in Staatsgeschäften in Übersee aufhielt, den Abgesandten anrief und ihn über ihren Zustand laut aktuellen Meldungen aus dem Krankenhaus informierte; der nach einem kurzen Wortwechsel mit einem College-Studenten in Kalifornien den jungen Mann aufforderte, ihm zu schreiben und den Dekan bat, ihn über die Noten dieses Studenten auf dem Laufenden zu halten; der inmitten der Berliner Luftbrücke eine Beileidsbekundung aus dem Weißen Haus an einen Veteranen der Battery D schickte, als dessen Kind bei einem Autounfall ums Leben kam; und der den ehemaligen Präsidenten Hoover zu Tränen rührte, als er ihn nach zwölf Jahren, während derer dieser den Amtssitz nicht mehr betreten hatte, wieder ins Weiße Haus einlud.3 Den ersten Blick auf diese tief in ihm verwurzelte Integrität erhaschte die Öffentlichkeit nur sechs Tage nach seiner Vereidigung, als er der Beerdigung von Tom Pendergast beiwohnte, der nach einer Gefängnisstrafe und dem Verlust seiner Stellung als Persona non grata galt. »Wer würde nur deshalb nicht zur Beerdigung seines Freundes gehen, weil er dafür kritisiert wird?«, fragte Truman.
Man muss ein ganz besonderer Mensch sein, um solcherart in einer der aufreibendsten Zeiten des eigenen Lebens und in einer Ausnahmesituation für die gesamte Weltbevölkerung überhaupt noch an Dinge wie diese denken zu können. Innerhalb von 30 Tagen mischten sich die Sowjets in Polen ein und traten in die Auseinandersetzung mit Japan, während die UNO gegründet wurde, um künftige Weltkriege zu verhindern, parallel dazu aber die erste Lieferung von Uran für militärische Zwecke unterwegs war.
»Er ist ein Mann von enormer Entschlossenheit«, sagte Winston Churchill über Truman, kurz nachdem er ihn getroffen hatte. »Ihm ist egal, ob er auf festem Boden steht oder nicht, er setzt einfach seinen Fuß einen Schritt voran.« Das war auch gut so, denn die folgenden Monate sollten den wirtschaftlichen Zusammenbruch Europas, die Berliner Luftbrücke und die Umsetzung der Truman-Doktrin mit sich bringen.
Die folgenreichste seiner Entscheidungen in jener Zeit war natürlich der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Noch heute wird genauso heftig darüber gestritten wie unmittelbar danach, ob dies gerechtfertigt war, aber meist wird dabei übersehen, dass zuvor nicht viel darüber diskutiert worden war. Nur wenige Monate vor den ersten Explosionen des Atomzeitalters wusste Truman noch nicht einmal, dass es diese Bombe überhaupt gab! Es war ein militärisches Projekt und in erster Linie eine militärische Entscheidung; ein General verglich Truman später mit einem »kleinen Jungen, der auf einen Schlitten gesetzt wurde und nie die Möglichkeit hatte, Ja zu sagen. Alles, was er hätte sagen können, war Nein.« Es war noch ein wenig komplizierter, wie Truman am Tag der ersten Atombombentests notierte. Er beklagte eine Welt, in der »Maschinen der Moral um einige Jahrhunderte voraus sind«, und hoffte auf eine Zukunft, in der es so etwas nicht geben würde.
In der Gegenwart musste er jedoch gegen einen unerbittlichen und nahezu unbegreiflich bösen Feind kämpfen. Am 30. Juli 1945 wurde die USS Indianapolis, das Schiff, das nur vier Tage zuvor das Material zum Bau der ersten Atombombe zur Pazifikinsel Tinian gebracht hatte, von einem japanischen U-Boot versenkt. Mehr als tausend Besatzungsmitglieder starben; viele davon wurden im Meer von Haien gefressen.
Wir wissen, dass Truman nicht Nein gesagt hat – er glaubte für den Rest seines Lebens, dass dies die richtige Entscheidung war, dass er als Präsident, der von Millionen von Müttern und Vätern gewählt worden war, die Pflicht hatte, vor allem das Leben der amerikanischen Soldaten zu schützen. Erst nachdem das Ausmaß der Zerstörung durch die Atombombenabwürfe vom 6. und 9. August bekannt war, wurde die Tragweite dieser Vorgehensweise in vollem Umfang deutlich. Die Einäscherung von mehr als 200 000 Japanern ist eine Tragödie, die für immer in die Geschichte der Menschheit eingebrannt bleiben wird. Eine wichtige Folge davon war jedoch, dass Truman danach der Auffassung war, eine solch schreckliche Macht dürfe unter keinen Umständen allein in den Händen des Militärs liegen. Auf unsicherem Boden entschlossen voranschreitend, gelang es ihm, die zivile Kontrolle über Atomwaffen durchzusetzen, was zum Glück bis heute Bestand hat und deren erneute Verwendung verhindert hat.
Es ist heute fast schon ein Topos von Geschichten über Führungspersönlichkeiten, zu erwähnen, dass Truman auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus ein kleines Schild hatte, auf dem »The Buck Stops Here« stand (»Hier werden die Entscheidungen getroffen«). Das war zutreffend und zeigte seine Haltung: Er wollte nicht nur harte Beschlüsse fassen, sondern auch die Verantwortung für sie übernehmen. Weniger bekannt ist jedoch das andere Schild an seinem Arbeitsplatz. Man würde sich wünschen, dass mehr der heutigen Spitzenpolitiker den dann folgenden Satz befolgen würden. »Handle immer richtig!« stand darauf, ein Zitat von Mark Twain. »Das wird einige Leute erfreuen und den Rest in Erstaunen versetzen.«
War der Einsatz von Atomwaffen denn richtig? Das bleibt umstritten. Niemand stellt dagegen den Marshallplan infrage. Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, waren Europas Probleme damit noch nicht zu Ende. Sowohl das europäische Festland als auch Großbritannien waren von sechs Jahren Krieg verwüstet worden. Rund 40 Millionen Menschen waren vertrieben worden. Eine ganze Generation von Kindern war verwaist. In großen Teilen des gesamten Kontinents waren die Menschen ohne Arbeit, Heizung oder Nahrung. Der Krieg war bereits eine humanitäre Katastrophe gewesen, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hatte; es wäre unbegreiflich gewesen, anschließend noch mehr Menschen leiden zu lassen.
Entschlossen, etwas zu tun, setzten Truman und seine Berater sich die wirtschaftliche Rettung einer gesamten Hemisphäre in den Kopf. Er teilte dem Kongress mit, dass er 15 oder 16 Milliarden Dollar benötigen würde, um sie zu verteilen. Als Sam Rayburn, der Sprecher des Repräsentantenhauses, sich dagegen sträubte, erinnerte Truman ihn daran, dass dies fast genau der Betrag war, den der Truman-Ausschuss dem Land einige Jahre zuvor eingespart hatte. »Jetzt werden wir dieses Geld brauchen«, sagte er zu ihm, »und wir könnten damit die Welt retten.«
Wenn dieser Plan von Truman stammt, warum ist er dann nicht nach ihm benannt? Der eine Grund dafür ist politisches Fingerspitzengefühl, der andere die Bescheidenheit des Mittleren Westens, aus dem Truman stammte. »General, ich möchte, dass der Plan mit Ihrem Namen in die Geschichte eingeht«, sagte Truman zu General George Marshall, dem allseits geschätzten Koordinator der alliierten Kriegsanstrengungen von den USA aus, den er seit seinem Wehrdienst im Ersten Weltkrieg kannte. »Und kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Gegenargumenten. Ich habe den Entschluss gefasst und – vergessen Sie das nicht – ich bin Ihr Oberbefehlshaber.« Auf diese Weise wurde eine großangelegte Maßnahme, die der Historiker Arthur Toynbee die »wichtigste Errungenschaft unseres Zeitalters« nennen sollte – die Vergabe von Milliarden von Dollar an am Boden liegende, vom Krieg gezeichnete Nationen, zu denen auch ehemalige Feinde gehörten –, gekrönt mit einem kleinen Akt der Bescheidenheit, indem Truman die Anerkennung dafür einem anderen zuteilwerden ließ.
In der Geschichte gab es viele politische Führungsgestalten mit großer persönlicher Integrität aber mit einer miserablen Bilanz bei den Menschenrechten. Die tragische Ironie von Amerikas Kreuzzug in Europa und im Pazifik – der Kampf gegen Faschismus und Völkermord und für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – besteht darin, wie unvollkommen die Zustände im eigenen Land waren. Truman war in einem ehemaligen Sklavenhalterstaat aufgewachsen, nur eine Generation nach der Abschaffung der Sklaverei, und war bis ins Erwachsenenalter hinein geprägt von vielen der widerwärtigen rassistischen Vorurteile, die mit solch einer Jugend einhergehen. Seine Großeltern auf beiden Seiten hatten Sklaven besessen. Seine Eltern erinnerten sich noch so lebhaft – oder falsch – an den Bürgerkrieg, dass Trumans Mutter sich weigerte, im Lincoln-Schlafzimmer zu übernachten, als sie ihren Sohn im Weißen Haus besuchte.
Es handelt sich also um einen Mann, der von Rassisten erzogen wurde, um ein Rassist zu sein, der 1922 beiläufig erwog, dem Ku-Klux-Klan beizutreten, als wäre es einer der zahlreichen anderen sozialen Clubs, in denen er Mitglied war, der sich dann aber in den Mann verwandelte, der 1948 die Rassentrennung in den Streitkräften aufhob (eines der wenigen Dinge in diesem Bereich, die der Präsident einseitig tun konnte). Dann verbot derselbe Mann die Diskriminierung nach Hautfarben in der gesamten Bundesregierung und öffnete den Zugang zu Tausenden von Arbeitsplätzen für Amerikaner aller ethnischen und nationalen Hintergründe sowie Religionen. Es war Truman, der im Bundesstaat Texas im Jahr 1948 die erste nicht segregierte politische Veranstaltung abhielt, und er wurde auf den Stufen des Lincoln Memorials zum ersten Präsidenten, der den Dialog mit der Bürgerrechtsorganisation NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) suchte. Bereits einige Jahre zuvor war Truman in Sedalia, Missouri, der Konfrontation mit seinen eigenen Nachbarn und Verwandten nicht aus dem Weg gegangen, als er ihren rassistischen Auffassungen widersprach. »Ich glaube an die Brüderlichkeit der Menschen«, sagte er zu ihnen. »Nicht nur die Weißen sind Brüder, sondern alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Ich glaube an die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung. Wenn wir den Schwarzen die Rechte geben, die ihnen zustehen, dann handeln wir nur im Einklang mit unseren eigenen demokratischen Idealen.«
Er hätte mehr tun können – das galt damals für alle –, aber was er tat, grenzte laut seinen Beratern bereits an »politischen Selbstmord«. 1948 sah er, was sie damit gemeint hatten, als viele Südstaaten den Nationalkongress der Demokraten in Philadelphia wegen seiner Bürgerrechtspolitik verließen. Er gab zu, einige Anhänger verloren zu haben, erwiderte jedoch tapfer: »Auf die Unterstützung solcher Leute kann man verzichten.«
Warum hatte er sich darauf eingelassen? Zweifellos, weil er an die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung glaubte. In seiner Rede am Lincoln Memorial – wo er ausrief, »Wenn ich ›alle Amerikaner‹ sage, dann meine ich alle Amerikaner.« – nahm er den berühmten Traum von Martin Luther King Jr. vorweg, von dem dieser 16 Jahre später sprechen sollte. Aber vor allem, weil er schockiert war von der Nachricht von einem schrecklichen Lynchmord in Monroe, Georgia, an einem schwarzen Veteranen des Zweiten Weltkrieges, wozu lokale Politiker die Täter ausdrücklich angestachelt hatten. Es waren die unverhüllte Grausamkeit und Gewalt, die Truman von seinen Vorstellungen aus der Kindheit abbrachten. Dies widersprach seinem Sinn für Anstand und grundlegende Menschlichkeit. »Mein Gott!«, erschrak er, als ihm berichtet wurde, wie ein uniformierter Sergeant namens Isaac Woodard Jr. aus einem Bus in South Carolina gezerrt, geschlagen und absichtlich von einem örtlichen Polizeichef auf beiden Augen geblendet worden war. »Ich hatte keine Ahnung, dass so schlimme Dinge passieren«, sagte er. »Wir müssen etwas dagegen tun!«
Und das tat er.