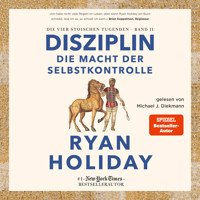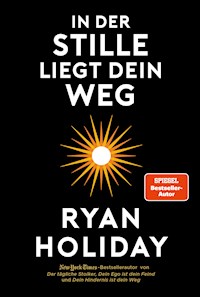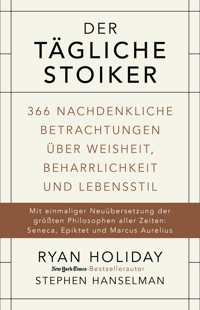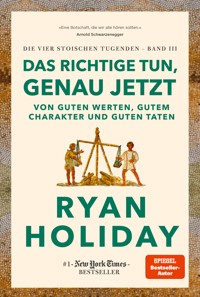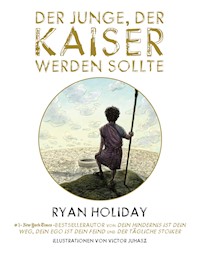Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Die vier stoischen Tugenden
- Sprache: Deutsch
»Das Glück ist mit den Tapferen« – alle großen Führungspersönlichkeiten der Geschichte haben das gewusst und waren erfolgreich, weil sie sich trauten, Risiken einzugehen. Heute jedoch sind so viele Menschen durch Angst vor den Hindernissen und Herausforderungen im Leben wie gelähmt. Auf der Grundlage der alten stoischen Weisheiten und von Beispielen aus der Geschichte und der ganzen Welt zeigt Ryan Holiday, warum Mut so wichtig ist und wie wir ihn in unserem eigenen Leben einsetzen können. Mut bedeutet nicht nur körperliche Tapferkeit, sondern auch, das Richtige zu tun und für das einzustehen, woran man glaubt; es bedeutet Kreativität, Großzügigkeit und Ausdauer. Und es ist die einzige Möglichkeit, ein außergewöhnliches, erfülltes und effektives Leben zu führen. Alles im Leben beginnt mit Mut. So auch der erste Band über die vier zeitlosen stoischen Tugenden – Mut, Mäßigung, Gerechtigkeit, Weisheit – von New-York-Times-Bestsellerautor Ryan Holiday. Es ist eine inspirierende Hymne auf die Kraft des Mutes, die dem Leser hilft, den Mut zu finden, auch die größten Herausforderungen in Angriff zu nehmen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ryan Holiday
Mut – Das Glück ist mit dem Tapferen
Die vier stoischen Tugenden – Band I
DIE VIER STOISCHEN TUGENDEN – BAND I
MUT DAS GLÜCK IST MIT DEM TAPFEREN
RYAN HOLIDAY
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
4. Auflage 2025
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Ryan Holiday. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Courage Is Calling: Fortune Favors the Brave bei Portfolio, ab imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Dr. Thomas Stauder
Redaktion: Bärbel Knill
Korrektorat: Anke Schenker
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe
Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-488-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-925-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Die Vier Tugenden
Einleitung
Teil I FURCHT
Der Ruf, den wir fürchten
Wichtig ist, keine Angst zu haben
Wir besiegen die Furcht mit Logik
Was schrecklich ist und was nicht
Wenden Sie sich gegen den Status quo
Sie sind immer zahlreicher, bevor man sie zählt
Aber was ist, wenn?
Lassen Sie sich von Schwierigkeiten nicht abschrecken
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie unmittelbar vor sich haben
Zweifeln Sie nie am Mut eines anderen Menschen
Sie sind immer in der Lage zu handeln
Wir haben Angst, an etwas zu glauben
Lassen Sie sich niemals einschüchtern
Jedes Wachstum ist ein Sprung
Fürchten Sie sich nicht vor Entscheidungen
Ihre Sicherheit steht nicht an erster Stelle
Die Furcht zeigt Ihnen etwas
Das Furchterregendste ist, man selbst zu sein
Das Leben spielt sich in der Öffentlichkeit ab. Gewöhnen Sie sich daran.
Welche Tradition wählen Sie?
Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten
Wenn wir über unsere Ängste hinauswachsen …
Teil II MUT
Der Ruf, dem wir folgen …
Die Welt fragt nach Mut
Wenn nicht Sie, wer dann?
Gute Vorbereitung macht tapfer
Fangen Sie einfach irgendwo an. Tun Sie einfach etwas.
Los!
Sagen Sie den Mächtigen die Wahrheit
Seien Sie der Entscheider
Es ist gut, »schwierig« zu sein
Nur ein paar Sekunden Mut
Machen Sie sich Mut zur Gewohnheit
Gehen Sie in die Offensive
Geben Sie nicht nach
Mut ist ansteckend
Übernehmen Sie Verantwortung
Sie können immer Widerstand leisten
Das Glück ist mit den Mutigen
Der Mut, an etwas zu glauben
Wir begegnen dem Schicksal
Liebe deinen Nächsten
Kühn bedeutet nicht leichtsinnig
Handlungsfähigkeit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich nehmen
Wenn Gewalt die einzig mögliche Antwort ist
Aufbrechen zu neuen Ufern
Wie man sich mutig zurückzieht
Tun Sie Ihre Pflicht
Sie können es schaffen – entgegen allen Prognosen
Machen Sie jemanden stolz
Wenn wir über uns hinauswachsen …
Teil III HELDENTUM
Der Mut, das letzte Opfer zu bringen
Auf die Sache kommt es an
Manchmal ist es tapferer, nicht zu kämpfen
Kraft schöpfen aus Durststrecken
Die Selbstlosigkeit der Liebe
Machen Sie andere Menschen größer
Keine Zeit zum Zögern
Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied
Zeigen Sie, dass Sie sich nicht fürchten
Wie viel sind Sie bereit zu zahlen?
Das große Warum
Zurück ins Tal gehen
Schweigen ist Gewalt
Die Kühnheit der Hoffnung
Verbrennen Sie die weiße Flagge
Mut heißt, wieder aufzustehen
Mut ist Tugend. Tugend ist Mut.
Nachwort
Was soll ich als Nächstes lesen?
Danksagungen
Anmerkungen
»Lasst uns nicht auf andere warten, die kommen und uns zu schönen Taten ermahnen; lasst uns die Ersten sein, die die anderen zur Tapferkeit anspornen; zeigt euch als die trefflichsten aller Hauptleute und als die würdigsten der Feldherrn, die mehr Recht haben auf die Führung als jene, die jetzt unsere Führer sind.«
XENOPHON
Die Vier Tugenden
Lange vor unserer heutigen Zeit kam Herkules an einen Scheideweg.
An einer friedlichen Wegkreuzung inmitten der griechischen Hügellandschaft, im Schatten astreicher Pinien, begegnete der große Held der griechischen Geschichte und des Mythos erstmals seinem Schicksal.
Wo genau dies passierte oder wann, weiß niemand. Wir erfahren von diesem besonderen Augenblick durch die Erzählung des Sokrates. Vor Augen haben wir diese Szene in der prächtigen Kunst der Renaissance. Seine jugendliche Kraft und seine strammen Muskeln, aber auch seine seelische Qual kommen in der klassisch gewordenen Kantate zum Ausdruck, die Johann Sebastian Bach ihm gewidmet hat. Wäre es im Jahr 1776 nach dem amerikanischen Gründervater John Adams gegangen, dann wäre Herkules am Scheideweg auf dem offiziellen Siegel der gerade erst entstandenen Vereinigten Staaten verewigt worden.
Denn dort, bevor er unsterblichen Ruhm erwarb, bevor er die ihm gestellten zwölf Aufgaben erfüllte und bevor er die Welt veränderte, befand sich Herkules in einer persönlichen Krise, wie sie jeder von uns schon erlebt hat, mit einer wichtigen Weichenstellung für seine gesamte Existenz.
Wohin war er unterwegs? Welches Ziel wollte er erreichen? Darum geht es in dieser Geschichte. Auf sich allein gestellt, unbekannt und unsicher, wusste Herkules, wie so viele Menschen, hierauf noch keine Antwort.
Wo der Pfad sich gabelte, lag eine schöne Göttin, die ihm jede erdenkliche Verlockung darbot. Prächtig gekleidet, versprach sie ihm ein Leben in Saus und Braus. Sie schwor ihm, dass er nie Mangel, Unglück, Angst oder Schmerz würde erleiden müssen. Wenn er ihr folge, sagte sie zu ihm, würden alle seine Wünsche in Erfüllung gehen.
Daneben, auf dem Weg, der in eine andere Richtung führte, stand eine strenger wirkende Göttin in einem strahlend weißen Gewand. Sie richtete sich in ruhigerem Ton an ihn. Sie versprach ihm keine Belohnungen, sondern nur die Früchte seiner eigenen harten Arbeit. Es würde eine lange Reise werden, sagte sie. Er würde Opfer erbringen müssen und es würde für ihn furchterregende Situationen geben. Aber es war ein Lebensweg, der eines Gottes würdig war, der Weg seiner Vorfahren. Er würde ihn zu dem Mann machen, der er werden sollte.
War das die Realität? Ist es wirklich passiert?
Wenn es aber nur eine Legende ist, ist es dann überhaupt von Bedeutung?
Ja, denn es ist eine Geschichte über uns.
Über unser eigenes Dilemma. Über unseren persönlichen Scheideweg.
Herkules hatte die Wahl zwischen Laster und Tugend, dem leichten und dem schweren Weg, dem ausgetretenen Pfad und der weniger beschrittenen Route. Das Gleiche gilt für uns.
Herkules zögerte nur eine Sekunde und entschied sich dann für den Weg, der den entscheidenden Unterschied ausmachte.
Er wählte die Tugend.
Der Begriff »Tugend« mag uns altmodisch erscheinen. Tatsächlich aber bedeutet Tugend – griechisch arete – etwas sehr Einfaches und Zeitloses: hervorragende und vorbildliche Haltung, und zwar moralisch wie körperlich und geistig.
In der Antike setzte sich die Tugend aus vier Hauptbestandteilen zusammen.
Mut.
Mäßigung.
Gerechtigkeit.
Weisheit.
Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel nannte sie »Prüfsteine des Guten«. Millionen Menschen sind sie als »Kardinaltugenden« bekannt, vier nahezu universelle Ideale, die vom Christentum und dem größten Teil der abendländischen Philosophie übernommen wurden, aber auch im Buddhismus, Hinduismus und fast jeder anderen Religion oder Weltanschauung geschätzt werden. Wie C. S. Lewis zu Recht feststellte, sind diese Tugenden nicht nach einem kirchlichen Würdenträger benannt – dem Kardinal –, sondern ihre Bezeichnung basiert auf dem lateinischen Wort cardo (ursprünglich Türangel, in übertragener Bedeutung Angelpunkt).
Und Dreh- und Angelpunkte sind diese Tugenden in der Tat, sie öffnen die Tür zu einem guten Leben.
Sie sind auch der Gegenstand dieses Buches und dieser Reihe, deren ersten Band Sie in Händen halten.
Vier Bücher. Vier Tugenden.
Ein gemeinsames Ziel: Ihnen die richtige Entscheidung zu ermöglichen.
Mut, Tapferkeit, Ausdauer, Stärke, Ehre, Aufopferung … Mäßigung, Selbstbeherrschung, Zurückhaltung, Gelassenheit, Ausgeglichenheit …
Gerechtigkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Güte, Freundlichkeit …
Weisheit, Wissen, Bildung, Wahrheit, Selbsterkenntnis, Frieden …
Sie sind der Schlüssel zu einem guten Leben, einem Leben voll Ehre und Ruhm, einer in jeder Hinsicht vorzüglichen Existenz. Es sind Charaktereigenschaften, die der Schriftsteller John Steinbeck perfekt beschrieben hat als »angenehm und erstrebenswert für [ihren] Besitzer, die ihn Taten vollbringen lassen, auf die er stolz sein kann und über die er sich freuen kann«. Doch mit dem »er« sind hier nicht nur die Männer gemeint, sondern die gesamte Menschheit. In Rom existierte keine weibliche Version des Wortes virtus. Doch die Tugend war weder männlich noch weiblich, es gab sie einfach.
Und es gibt sie noch heute. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Genauso wenig kommt es darauf an, ob Sie von kräftiger Statur sind oder extrem schüchtern, ob Sie einen genialen Verstand besitzen oder nur eine durchschnittliche Intelligenz, denn Tugend ist ein universeller Wert. Der Imperativ gilt für alle gleichermaßen.
Jede dieser Tugenden ist untrennbar mit den anderen verbunden, aber dennoch unterscheiden sie sich voneinander. Das Richtige zu tun erfordert fast immer Mut, genauso wie Mäßigung unmöglich ist ohne die Weisheit, den Wert einer Entscheidung zu erkennen. Was nützt der Mut, wenn er nicht für die Gerechtigkeit eingesetzt wird? Was nützt die Weisheit, wenn sie uns nicht bescheidener macht?
Norden, Süden, Osten, Westen – die vier Tugenden sind eine Art Kompass. Nicht umsonst werden die vier Himmelsrichtungen auf einem Kompass »Kardinalpunkte« genannt: Sie weisen uns den Weg, indem sie uns zeigen, wo wir sind und was wahr ist.
Aristoteles beschrieb die Tugend als eine Art Handwerk, etwas, das man sich aneignen kann, so wie man sich einen Beruf oder eine Kunstfertigkeit aneignet. »Wir werden Baumeister, indem wir bauen, und wir werden Harfenspieler, indem wir Harfe spielen«, schreibt er. »Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, gemäßigt, indem wir gemäßigt handeln, und tapfer, indem wir tapfer handeln.«
Tugend ist etwas, das wir tun.
Es ist etwas, wofür wir uns entscheiden.
Nicht nur einmal, sondern immer wieder, denn Herkules stand nicht nur einmal am Scheideweg. Es ist eine tägliche Herausforderung, mit der wir nicht nur einmal konfrontiert werden, sondern ständig. Werden wir egoistisch sein oder selbstlos? Tapfer oder ängstlich? Stark oder schwach? Weise oder dumm? Werden wir gute oder schlechte Gewohnheiten annehmen? Mut oder Feigheit? Werden wir uns mit der Unwissenheit zufriedengeben oder die Herausforderung neuer Ideen akzeptieren?
Werden wir stets dieselben bleiben … oder uns weiterentwickeln?
Wählen wir den bequemen Weg oder den richtigen Weg?
Einleitung
»Es gibt keine Tat in diesem Leben, die so unmöglich wäre, dass Sie sie nicht tun könnten. Ihr ganzes Leben sollte als Heldentat gelebt werden.«
LEO TOLSTOI
Nichts schätzen wir mehr als den Mut, und dennoch erleben wir ihn extrem selten.
Ist das vielleicht einfach eine normale Reaktion? Dass Dinge für wertvoll gehalten werden, weil sie selten sind?
Möglicherweise.
Aber Mut – die erste der vier Kardinaltugenden – ist kein Edelstein. Er ist kein Diamant, seine Entstehung ist nicht das Ergebnis eines scheinbar endlosen Vorgangs, der bis zu einer Milliarde von Jahren dauern kann.
Nein. Mut ist etwas viel Einfacheres. Er ist eine erneuerbare Ressource, die in jedem von uns verfügbar ist. Er ist etwas, zu dem wir augenblicklich in der Lage sind. In großen wie in kleinen Dingen, egal ob körperlicher oder moralischer Art.
Es gibt unzählige, sogar tägliche Gelegenheiten, seinen Mut zu zeigen: bei der Arbeit, zu Hause, überall.
Und doch ist er so selten.
Warum ist das so?
Weil wir Angst haben. Weil es einfacher ist, nichts zu riskieren. Weil wir gerade etwas anderes zu tun haben und es angeblich nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. »Ich bin kein Soldat«, sagen wir, als ob das Kämpfen auf dem Schlachtfeld die einzige Form von Mut wäre, die in der Welt gebraucht wird.
Wir bleiben lieber im sicheren Bereich. Ich soll ein Held sein? Das klingt selbstverliebt und anmaßend. Das überlassen wir lieber einem anderen, der dafür besser geeignet und vorbereitet scheint, der weniger zu verlieren hat.
Das ist verständlich, sogar logisch.
Aber wo wären wir, wenn alle so denken würden?
»Muss man noch eigens erwähnen«, sagte der sowjetische Schriftsteller und Dissident Alexander Solschenizyn, »dass von jeher ein Schwinden des Mutes als erstes Symptom des nahenden Endes galt?«
Umgekehrt sind die größten Augenblicke der Menschheitsgeschichte – sei es die Landung auf dem Mond oder der Kampf um die Bürgerrechte, die letzte Schlacht bei den Thermopylen oder die Kunst der Renaissance – alle durch eines definiert: die Tapferkeit einfacher Männer und Frauen. Menschen, die taten, was getan werden musste. Menschen, die sagten: »Wenn nicht ich, wer dann?«
Mut ist Mut ist Mut
Lange Zeit war man der Auffassung, dass es zwei Arten von Mut gebe.
Körperlichen Mut und moralischen Mut.
Körperlichen Mut hat ein Ritter, der in die Schlacht reitet. Ein Feuerwehrmann, der in ein brennendes Gebäude stürmt. Ein Forscher, der in die Arktis aufbricht und dort den Elementen trotzt.
Moralischen Mut hat ein Whistleblower, der sich gegen mächtige Interessen stellt. Jemand, der die Wahrheit ausspricht, der sagt, was niemand sonst zu sagen wagt. Der Unternehmer, der sich trotz aller Schwierigkeiten selbstständig macht.
Dann gibt es noch den kriegerischen Mut des Soldaten und den geistigen Mut des Wissenschaftlers.
Aber man muss kein Philosoph sein, um zu erkennen, dass all dies eigentlich dasselbe ist.
Es gibt keine zwei Arten von Mut. Es gibt nur eine. Nämlich die, bei der man sein Leben aufs Spiel setzt. In manchen Fällen ganz wörtlich, mit möglicherweise tödlichem Ausgang. In anderen Fällen nur im übertragenen oder finanziellen Sinn.
Mut bedeutet Risiko.
Mut bedeutet …
… Aufopferung.
… Hingabe.
… Durchhaltevermögen.
… Aufrichtigkeit.
… Entschlossenheit.
Wenn Sie das tun, was andere nicht tun können oder nicht tun wollen. Wenn Sie etwas tun, von dem die Leute denken, dass man es nicht tun sollte oder tun darf. Sonst ist es kein Mut. Dazu gehört immer, jemandem oder etwas die Stirn zu bieten.
Trotzdem bleibt Mut etwas, das schwer zu definieren ist. Wir erkennen ihn, wenn wir ihn sehen, aber es ist nicht einfach, ihn zu beschreiben. Dementsprechend geht es in diesem Buch nicht um Definitionen. Mut ist ein seltener Edelstein, deshalb müssen wir ihn emporhalten, um ihn aus vielen Blickwinkeln zu betrachten. Indem wir seine vielen Seiten und Schliffe, seine Perfektion und seine unvollkommenen Stellen betrachten, können wir ein Verständnis für den Wert des Ganzen erlangen. Jede dieser Perspektiven hilft uns, ein wenig mehr Einblick zu bekommen.
Aber wir tun dies natürlich nicht, um nur eine abstrakte Vorstellung von Tugend zu bekommen. Jeder von uns steht vor seinem eigenen herkulischen Scheideweg. Vielleicht haben Sie ein Amt inne, in das Sie gewählt wurden. Vielleicht haben Sie etwas Unethisches bei der Arbeit beobachtet. Vielleicht versuchen Sie als Vater oder Mutter, Ihre Kinder in einer Welt voller Gefahren und Verlockungen zu anständigen Menschen zu erziehen. Vielleicht sind Sie ein Wissenschaftler, der eine umstrittene oder unorthodoxe Idee verfolgt. Vielleicht haben Sie einen Einfall für ein neues Unternehmen. Vielleicht sind Sie ein einfacher Soldat in der Infanterie, am Vorabend einer Schlacht. Oder ein Sportler, der sich überlegt, politisch Stellung zu beziehen, was jedoch seiner Karriere oder seinen Werbeeinnahmen schaden könnte.
Was in diesen Situationen gefragt ist, ist Mut. Ganz konkret. Sofort. Werden wir ihn haben? Werden wir auf das Klingeln des Telefons reagieren?
Churchill pflegte zu sagen: »Für jeden kommt im Leben ein besonderer Augenblick, in dem man ihm bildlich gesprochen auf die Schulter klopft und ihm die Chance gibt, etwas Außergewöhnliches zu tun, das einzigartig für ihn ist und seiner Begabung entspricht. Was für eine Tragödie, wenn dieser Moment ihn dann unvorbereitet oder unqualifiziert für das antrifft, was seine Sternstunde hätte werden können.«
Genauer gesagt hält das Leben viele solche Momente bereit, es bietet viele derartige Gelegenheiten.
Was Churchill betrifft, so musste er eine schwierige Kindheit mit lieblosen Eltern durchstehen. Er brauchte Mut, um die Lehrer zu ignorieren, die ihn für dumm hielten. Mut, um als junger Kriegsberichterstatter nach Südafrika zu reisen, wo er prompt in Gefangenschaft geriet und wieder seinen Mut benötigte, um eine strapaziöse Flucht anzutreten. Mut, um für ein öffentliches Amt zu kandidieren. Mut brauchte er auch bei seinen Veröffentlichungen als Schriftsteller. Nicht weniger mutig war sein Entschluss, die politische Partei zu wechseln. Oder seine Entscheidung, sich während des Ersten Weltkriegs als Freiwilliger zu melden. Mut war nötig während der schrecklichen Jahre in der politischen Isolation, als die öffentliche Meinung gegen ihn war. Dann war da der Aufstieg Hitlers und Churchills heroischer Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft in Europa, die größte Herausforderung in seinem Leben. Aber auch der Mut, weiterzumachen, als er nach dem Zweiten Weltkrieg von den undankbaren Wählern seiner politischen Verantwortung enthoben wurde, um schließlich auf den Posten des Premierministers zurückzukehren. Der Mut, im hohen Alter wieder die Malerei aufzunehmen und seine Werke auch zu zeigen. Mutig war es, sich während des Kalten Kriegs gegen Stalin und den Eisernen Vorhang zu stellen. Und so weiter und so fort ...
Hat ihn sein Mut zwischendurch auch manchmal verlassen? Hat er bisweilen auch Fehler gemacht? Zweifellos. Aber blicken wir lieber auf seine mutigen Augenblicke und lernen von ihnen, statt die Schwächen anderer Menschen als Entschuldigung für unsere eigenen zu verwenden.
Im Leben aller großen Persönlichkeiten finden wir die gleichen Themen. Es gibt darin einen zentralen Moment des Mutes, aber auch viele kleinere Augenblicke dieser Art. Das Verhalten der Rosa Parks im Bus1 war mutig, aber genauso mutig war es, 42 Jahre lang im Süden der USA als schwarze Frau zu leben, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren, ohne zu verbittern. Ihr Mut, vor Gericht gegen die Rassentrennung vorzugehen, war nur die Fortsetzung des Mutes, der nötig war, um 1943 in die NAACP einzutreten und dort offen als Sekretärin zu arbeiten oder um sich 1945 in Alabama als Wählerin registrieren zu lassen.
Geschichte wird mit Blut, Schweiß und Tränen geschrieben, und sie wird in die Ewigkeit graviert durch die stille Ausdauer mutiger Menschen.
Menschen, die sich erhoben haben (oder sich hingesetzt haben, wie Rosa Parks) …
Menschen, die gekämpft haben …
Menschen, die etwas riskiert haben …
Menschen, die das Wort ergriffen haben …
Menschen, die sich um etwas bemüht haben …
Menschen, die ihre Ängste überwunden haben, die mutig gehandelt haben und in manchen Fällen sogar kurzzeitig eine höhere Ebene der Existenz erreicht haben, wodurch sie in die Ruhmeshalle der Helden als diesen ebenbürtig aufgenommen wurden.
Mut ist bei jedem von uns auf andere Weise gefragt, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Formen. Aber in jedem Fall muss er von innen kommen.
Zuerst sind wir aufgerufen, uns über unsere Angst und Feigheit zu erheben. Anschließend werden wir zur Tapferkeit aufgerufen, zum Kampf gegen die Elemente, gegen die Widrigkeiten, gegen unsere Grenzen. Am Ende werden wir zum Heldentum aufgerufen – vielleicht nur für einen einzigen großartigen Moment –, wenn wir etwas Bedeutendes für jemand anderen als uns selbst tun sollen.
Welchen Ruf Sie auch immer gerade hören: Es kommt nur darauf an, dass Sie ihm folgen. Entscheidend ist, sich darauf einzulassen.
In dieser hässlichen Welt ist Mut etwas Schönes. Er ermöglicht die Existenz des Schönen.
Wer sagt denn, dass er so selten sein muss?
Sie haben zu diesem Buch gegriffen, weil Sie wissen, dass er es nicht sein muss.
TEIL I
FURCHT
»Nach dieser Welt voll Zorn und Tränen lauert nur der Schrecken des düsteren Jenseits, und doch trifft mich die Bedrohung der Jahre ohne Furcht an, und so wird es auch bleiben.«
WILLIAM ERNEST HENLEY
Wodurch wird Mut verhindert? Was macht etwas so hoch Geschätztes so selten? Was hält uns davon ab, das zu tun, was wir tun können und sollten? Was ist die Ursache der Feigheit? Die Furcht. Phobos. Einen Feind, den man nicht versteht, kann man nicht besiegen; deshalb ist es wichtig, den Feind des Mutes zu verstehen, die Furcht in all ihren Formen: von Schrecken über Apathie bis hin zu Hass und Kleinmut. Wir befinden uns in einem Kampf gegen die Furcht. Also müssen wir die Furcht studieren, uns mit ihr vertraut machen, uns mit ihrem Ursprung und ihren Symptomen auseinandersetzen. Deshalb erbauten die Spartaner Tempel, die sie der Furcht widmeten. Um sie in ihrer Nähe zu haben. Um ihre Macht vor Augen zu haben. Um sich vor ihr zu schützen. Tapfere Menschen sind nicht furchtlos – kein Mensch ist das –, sondern sie zeichnen sich aus durch ihre Fähigkeit, sich über die Furcht zu erheben und sie zu meistern. Wahre Größe erreicht man nur auf diesem Weg. Über Feiglinge gibt es keine Aufzeichnungen. Weder erinnert man sich an sie, noch bewundert man sie. Nennen Sie mir nur irgendetwas Gutes, für das nicht mindestens einige schwierige Momente der Tapferkeit erforderlich waren. Wenn wir also große Taten vollbringen wollen, müssen wir zuerst lernen, die Furcht zu besiegen oder sie zumindest in den entscheidenden Augenblicken zu überwinden.
Der Ruf, den wir fürchten
Bevor sie es besser wusste, war Florence Nightingale furchtlos.
Es gibt eine kleine Zeichnung, die irgendwann in ihrer frühen Kindheit angefertigt wurde. Eine Tante stellte darin Florence auf einem Spaziergang mit ihrer Mutter und ihrer Schwester dar, als sie etwa vier Jahre alt war.
Ihre ältere Schwester klammert sich an die Hand der Mutter. Währenddessen »stapft Florence selbstständig weiter«, mit diesem wunderbar naiven Selbstvertrauen, das manche Kinder besitzen. Sie brauchte keinen Schutz. Es war ihr egal, was andere darüber dachten. Es gab so viel zu sehen. So viel zu erkunden.
Aber leider sollte diese Unabhängigkeit nicht von Dauer sein.
Vielleicht hat ihr jemand gesagt, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Vielleicht war es der unmerkliche, aber schwer auf ihr lastende Druck ihrer Epoche, in der vorgeschrieben war, dass Mädchen sich auf eine bestimmte Weise verhalten sollten. Vielleicht war es der Luxus ihres privilegierten Daseins, der ihre Wahrnehmung dessen, wozu sie fähig war, beeinträchtigte.
Jeder von uns hat als Kind schon einmal ein derartiges Gespräch miterlebt, wenn ein Erwachsener uns das grausame Unrecht antut – wenngleich womöglich mit den besten Absichten –, unseren Kokon des Selbstvertrauens zu zerstören. Diese Erwachsenen glauben, sie würden uns auf die Zukunft vorbereiten, während sie uns in Wirklichkeit nur ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Hemmungen aufzwingen.
Oh, was uns das kostet! Und wie viel Mut dadurch der Welt verloren geht!
So wäre es beinahe auch Florence Nightingale ergangen.
Am 7. Februar 1837, im Alter von 16 Jahren, sollte sie das erhalten, was sie später als ihre »Berufung« bezeichnen würde.
Wozu? Wohin? Und wie?
Sie bemerkte nur, dass es geheimnisvolle Worte von oben waren, die ihr das Gefühl vermittelten, dass etwas von ihr erwartet wurde, dass sie sich nützlich machen sollte, dass ihre Existenz einem anderen Zweck dienen sollte, als das Leben ihrer reichen und trägen Familie zu führen, außerhalb der beengenden und langweiligen Rollen, die für die Frauen ihrer Zeit vorgesehen waren.
»Irgendwo im Inneren hören wir eine Stimme …«, sagte Pat Tillman, als er darüber nachdachte, den Profi-Football zu verlassen und sich den Army Rangers anzuschließen. »Diese Stimme führt uns in die Richtung des Menschen, der wir werden wollen, aber es ist an uns, ob wir ihr folgen oder nicht. Die meiste Zeit unseres Lebens werden wir in eine vorhersehbare, geradlinige und scheinbar positive Richtung geführt. Gelegentlich werden wir aber auch auf einen ganz anderen Weg gelenkt.«
Man könnte meinen, dass ein tapferes Mädchen wie Florence Nightingale prädestiniert gewesen wäre, auf diese Stimme zu hören, aber wie so viele von uns hatte sie die Denkweise ihrer Zeit verinnerlicht und wurde zu einer verängstigten Jugendlichen, die es nicht wagte, sich einen Lebensweg vorzustellen, der von dem ihrer Eltern abweichen würde.
»Ihre Familie besaß ein großes Landhaus in Derbyshire«, schrieb Lytton Strachey in seinem Klassiker Lives of Eminent Victorians, »es gab ein weiteres Anwesen im New Forest; es gab Zimmer im Londoner Mayfair-Viertel für die Aufenthalte in der Hauptstadt mit ihren exquisiten Partys; man unternahm Reisen auf den Kontinent und besuchte mehr als die übliche Anzahl italienischer Opern, und in Paris bekam man auch berühmte Persönlichkeiten zu Gesicht. Nachdem Florence inmitten solcher Annehmlichkeiten aufgewachsen war, war es naheliegend, anzunehmen, dass sie diese in angemessener Weise würdigen würde, indem sie ihre Pflicht in dem Lebensstand erfüllen würde, zu dem Gott sie berufen hatte – mit anderen Worten, indem sie nach einer angemessenen Anzahl von Tänzen und Dinnerpartys einen geeigneten Gentleman heiraten und eine glückliche Ehe führen würde.«
Acht Jahre lang blieb diese Stimme von oben als störende Präsenz in einer Ecke von Florences Kopf, ein stummer Riese, dem sie aus dem Weg ging. Mittlerweile hatte sie ansatzweise erkannt, dass in der viktorianischen Gesellschaft keineswegs alles in Ordnung war. Die Lebenserwartung ab der Geburt betrug kaum 40 Jahre. In vielen Städten war die Sterblichkeitsrate bei Patienten, die in Krankenhäusern behandelt wurden, höher als bei Patienten, die privat gepflegt wurden. Im Krimkrieg, in dem sich Nightingale später auszeichnen sollte, starben von ungefähr 100 000 Soldaten nur 1800 Männer an ihren Verletzungen. Mehr als 16 000 starben an Krankheiten, und 13 000 weitere wurden dienstunfähig. Selbst in Friedenszeiten waren die Bedingungen dort schrecklich, und schon die Einberufung war lebensgefährlich. »Sie könnten genauso gut jedes Jahr 1100 Männer auf die Salisbury Plain deportieren und dann erschießen«, sagte sie einmal zu Behördenvertretern.
Aber so dringlich diese Krise auch war – und so schnell die Zahl der geopferten Männer stieg –, war doch die Furcht bei Florence noch größer als der Mut.
Laut Strachey musste sie sich um das Familienporzellan kümmern, und ihr Vater erwartete von ihr, dass sie ihm regelmäßig etwas vorlas. Sie musste jemanden zum Heiraten finden und an Teekränzchen teilnehmen. Es gab nichts Nennenswertes für sie zu tun, und das war alles, was eine wohlhabende Frau zu ihrer Zeit tun durfte: nichts.
Mit diesem alltäglichen Druck konfrontiert, schenkte Florence dem Ruf in ihrem Inneren kein Gehör, weil sie Angst hatte, er würde ihr Leben in der eleganten Gesellschaft stören. Zwar half sie hin und wieder einem kranken Nachbarn. Sie las auch Bücher und lernte interessante Persönlichkeiten kennen, darunter Dr. Elizabeth Blackwell, die erste Ärztin der USA. Aber als man ihr mit 25 Jahren anbot, ehrenamtlich im Salisbury Hospital zu arbeiten, ließ sie zu, dass ihre Mutter dies verhinderte. Arbeit in einem Krankenhaus? Für ihre Familie hätte sie noch eher eine Prostituierte werden können!
Nach acht Jahren der Verdrängung ertönte ein weiterer Ruf. Die Stimme fragte, dieses Mal etwas deutlicher: Lässt du dich von Fragen des gesellschaftlichen Ansehens davon abhalten, etwas Nützliches zu tun? Genau davor hatte sie Angst: Was würden die Leute von ihr denken? Konnte sie den Bruch mit ihrer Familie riskieren, die sie bei sich behalten wollte? Durfte aus einer reichen Debütantin eine einfache Krankenschwester werden? Konnte sie einem Beruf nachgehen, von dem sie so gut wie nichts wusste und den es im 19. Jahrhundert noch gar nicht in der heutigen Form gab?
Durfte sie tun, was Frauen nicht tun sollten? Konnte sie darin erfolgreich sein?
Diese Furcht war stark ausgeprägt, so wie das bei jedem Menschen der Fall ist, wenn man in Betracht zieht, in unerforschte Gewässer vorzudringen, oder wenn man sich überlegt, sein bisheriges Leben aufzugeben, um etwas Neues oder anderes zu beginnen. Wenn Ihnen jeder sagt, dass Sie scheitern werden, dass Sie falsch liegen, wie könnten Sie das einfach ignorieren? Es ist ein schreckliches Paradoxon: Man müsste verrückt sein, um nicht auf andere zu hören, wenn sie einem sagen, dass man verrückt ist.
Und was ist, wenn die Leute versuchen, Ihnen Schuldgefühle einzureden? Wenn sie versuchen, Sie für Ihr Verhalten zu bestrafen? Was ist, wenn Sie die anderen nicht enttäuschen wollen? Mit diesem Dilemma war Nightingale konfrontiert, mit Eltern, die ihren Ehrgeiz als Anklage gegen ihren eigenen Mangel an Ehrgeiz auffassten. Ihre Mutter behauptete weinend, dass sie vorhabe, »Schande über sich zu bringen«, während ihr Vater wütend auf sie war, weil sie ihm zufolge verwöhnt und undankbar war.
Das waren Lügen, die sie schmerzten und die sie verinnerlichte. »Dr. Howe«, wagte Florence einmal, Julia Ward Howe zu fragen, die Philanthropin und Autorin der »Battle Hymn of the Republic«, »glauben Sie, dass es für eine junge Engländerin unpassend und unschicklich wäre, in Krankenhäusern wohltätige Arbeit zu leisten? Glauben Sie, es wäre etwas Schreckliches?« Ihre Fragen waren mit vielen Befürchtungen befrachtet. Unpassend. Unschicklich. Schrecklich.
Sie war hin- und hergerissen – wollte sie die Erlaubnis, ihrem Traum zu folgen, oder die Erlaubnis, ihn unerfüllt zu lassen? »Meine liebe Miss Florence«, antwortete Howe, »es wäre ungewöhnlich, und in England gilt alles, was ungewöhnlich ist, als unpassend. Aber ich sage zu Ihnen ›Nur vorwärts‹, wenn Sie eine echte Berufung für diese Lebensweise verspüren. Handeln Sie gemäß Ihrer Eingebung, und Sie werden feststellen, dass es nie unschicklich oder undamenhaft sein kann, seine Pflicht zum Wohle anderer zu erfüllen. Entscheiden Sie sich, und gehen Sie dann Ihren Weg, wohin er Sie auch führen mag.«
Aber diese Furcht, nicht normal zu sein, die Furcht vor noch mehr Schuldgefühlen und noch mehr Drohungen wurde Florence nicht los. All das diente dazu, sie zu Hause zu halten, ihr die Grenzen aufzuzeigen. Und wie in vielen anderen Fällen funktionierte es auch bei ihr – trotz der ausdrücklichen Ermutigung durch jemanden, den sie bewunderte.
»Was für eine Verbrecherin bin ich, dass ich ihr Glück störe«, schrieb Florence in ihr Tagebuch. »Wer bin ich denn, dass ich behaupten könnte, ihr Leben sei nicht gut genug für mich?« Ihre Familie habe kaum noch mit ihr gesprochen, berichtete sie, »ich wurde behandelt, als hätte ich mich eines schlimmen Delikts schuldig gemacht«. Über Jahre hinweg ging diese Taktik auf. »Sie wäre dazu in der Lage gewesen, sich gegenüber ihrer Familie zu behaupten«, schreibt ihr Biograf Cecil Woodham-Smith, »aber sie tat es nicht. Die Fesseln, die sie banden, waren nur aus Stroh, aber sie zerriss sie nicht.«
Nightingale war dabei keine Ausnahme – weder in den 1840er-Jahren noch heute. Denn was ist bei der sogenannten Heldenreise fast immer die Reaktion auf den »Ruf zum Abenteuer«? Die Weigerung, diesem Ruf zu folgen. Weil es zu schwer scheint, zu furchterregend, weil man glaubt, nicht der oder die Richtige dafür zu sein. Derartige Gedanken gingen Nightingale im Kopf herum, nicht nur kurze Zeit, sondern 16 Jahre lang.
Das sind die Auswirkungen der Furcht. Sie hält uns von unserer Bestimmung ab. Sie fesselt uns.
Sie lässt uns erstarren. Sie nennt uns eine Million Gründe, warum wir etwas tun sollten. Oder warum nicht. »Wie wenig kann man doch ausrichten, wenn man von der Furcht beherrscht wird«, sollte Nightingale später schreiben. Ein großer Teil der ersten drei Jahrzehnte ihres Lebens war ein Beweis hierfür gewesen. Aber sie wusste auch, dass es einen kurzen Augenblick gegeben hatte, in dem sie keine Angst gehabt hatte. Sie musste diese in ihr steckende Kraft dazu nutzen, um eigenständig auszubrechen und den Ruf anzunehmen, der ihr zu Gehör gebracht worden war.
Es war für sie ein beängstigender, erschreckender Schritt. Es bedeutete, ein komfortables Leben hinter sich zu lassen. Sich über Konventionen hinwegzusetzen. Mit einer Vielzahl von Zweifeln und Forderungen konfrontiert zu werden. Natürlich war es genau das, was sie lange Zeit zurückgehalten hatte – wie so viele von uns. Aber nun hatte Nightingale sich davon befreit. Zwei Wochen später wagte sie den Absprung.
»Ich darf kein Verständnis und keine Hilfe von meiner Familie erwarten«, schrieb sie über ihre Entscheidung, den Weg in die Freiheit zu gehen. »Was ich für meine Existenz benötige, muss ich mir einfach nehmen. Das muss ich selbst tun, da kein anderer mir diese Dinge geben wird.«
Ein Jahr später war sie bereits dabei, Feldlazarette für verwundete Soldaten auf der Krim einzurichten. Die Bedingungen dort waren entsetzlich. Da es nicht genügend Betten gab, starben die Männer in den Fluren der Gebäude und auf den Decks der Schiffe. Ratten fraßen ihnen das Essen von den Tellern weg. Patienten ohne die nötige Kleidung kauerten in eiskalten Krankenhäusern; einige von ihnen verbrachten ihre letzten Augenblicke auf Erden völlig nackt. Ihre Verpflegung war unzureichend und ihre Ärzte inkompetent. Dieses Elend war genau das, was ihre Eltern ihr hatten ersparen wollen. Es war so schlimm, dass sogar die tapfersten Staatsdiener dort nicht arbeiten wollten.
»Ich habe«, erklärte sie, »die Behausungen in den schlimmsten Gegenden der großen Städte Europas gesehen, aber ich war noch nie in einer Atmosphäre, die mit der des Barrack Hospitals bei Nacht vergleichbar gewesen wäre.« Jetzt war ihre Furcht verschwunden. An deren Stelle war stählerne Entschlossenheit getreten. Sie finanzierte die Reparaturen vor Ort aus ihrer eigenen Tasche und machte sich an die Arbeit.
Henry Wadsworth Longfellow sollte ihr heldenhaftes Wirken in einem seiner Gedichte perfekt einfangen, in dem er die düsteren und trostlosen Flure des Krankenhauses kontrastierte mit dem Erscheinen von Florence Nightingale, die von Zimmer zu Zimmer geht, mit einer Lampe und aufmunternden Worten für die Verwundeten.
»England, dein Barde soll durch all
Die Zeiten von ihr singen,
Und der Vergangenheit Portal
Ihr Schimmer stets durchdringen!
Heroisch steht ein Frauenbild
Im hellsten Sonnenlichte,
Verklärt von Geisteshoheit mild,
In deiner Großgeschichte!«2
Das war heroisch. Möglich war das nur, weil sie mutig genug gewesen war, ihre ganz gewöhnliche, aber sie stark hemmende Furcht zu überwinden.
Ihre Arbeit auf der Krim, die sie unter feindlichem Beschuss und mit großem persönlichen Risiko verrichtete – sie erkrankte dort am Krim-Fieber (Brucellose), das sie für den Rest ihres Lebens plagte –, wurde zum Vorbild für die Gründung des Roten Kreuzes. Ihre Innovationen und ihre spätere Pionierleistung bei der Systematisierung der Versorgung von Kranken und Verwundeten kommen auch heute noch jedem im Krankenhaus zugute, 180 Jahre nachdem sie den für sie vorgezeichneten Lebensweg verließ, ungeachtet der Widerstände in ihrer Umgebung.
Ihre Mutter hatte geweint, als ihre Tochter sich mit ihrem Vorhaben durchsetzte. »Wir sind Enten, die einen wilden Schwan ausgebrütet haben«, sagte sie. Stellen Sie sich vor: Eine Mutter, die in Tränen ausbricht, weil sich herausstellt, dass ihr Kind etwas Besonderes ist. Wie es wohl sein muss, in einem Haus aufzuwachsen, in dem so etwas passiert. Strachey sollte später hierzu bemerken, dass Nightingales Mutter falschlag. Ihre Tochter war kein Schwan. Sie hatte einen Adler zur Welt gebracht. Der kleine Adler war lange ausgebrütet worden und hatte lange im Nest gesessen, aber sobald er flügge war, erwies er sich als furchtlos.
Unsere Bestimmung im Leben erhalten wir zugeteilt; die Aufgabe ist größer als wir selbst. Wir sind alle berufen, etwas zu sein. Wir sind auserwählt. Man hat uns dafür auserkoren … aber werden wir uns entscheiden, dies zu akzeptieren? Oder werden wir davor weglaufen?
Das ist unser Ruf.
Eine Möglichkeit, die Lebensgeschichte von Nightingale zu interpretieren, besteht darin, zu sagen, dass sie jahrelang den Ruf ignoriert hat, sich in den Dienst ihrer Mitmenschen zu stellen. Man kann aber auch sagen, dass sie sich auf die Aufgabe ihres Lebens vorbereitet hat. Sie brauchte eine Weile, um die Störgeräusche ihrer Familie und der sie umgebenden Gesellschaft auszublenden, die sie davon abhalten wollten, das zu tun, was getan werden musste. Es nahm eine gewisse Zeit in Anspruch, sich die Fähigkeiten anzueignen, die sie benötigte, um die Krankenpflege von Grund auf zu reformieren.
In beiden Versionen ihres Lebens ist der Kampf gegen die Furcht – und der Sieg darüber – für ihre Existenz entscheidend. So wie es dies für jede Person war, die die Welt verändert hat. Es gibt keine große Tat, die nicht furchterregend wäre. Es gibt niemanden, der Großes erreicht hat, ohne mit seinen eigenen Zweifeln, Ängsten, Beschränkungen und Dämonen zu ringen.
Es stellte sich heraus, dass diese Erfahrung für Nightingale sogar prägend war. Als sie schließlich mit vollem Einsatz mit der Einrichtung von Krankenhäusern und der Reformierung des militärischen und zivilen Gesundheitswesens Großbritanniens begann, stieß sie auf unglaublichen Widerstand – vonseiten der Bürokratie, der Elemente und der politischen Machthaber. Sie musste mehr sein als ein Engel der Barmherzigkeit auf der Krankenstation: Sie war Quartiermeisterin, Schattensekretärin, Lobbyistin, Whistleblowerin, Aktivistin und Verwalterin. Durch ihre Fähigkeit, all dies zu tun und sich dabei nicht von unerbittlichen und einschüchternden Gegnern beirren zu lassen, ihre Fähigkeit, einen geduldigen, nie nachlassenden Kampf gegen diejenigen zu führen, die sie von ihren Zielen abbringen wollten, wurde ihr Wirken überhaupt erst möglich.
Niemand konnte ihr mehr Angst einjagen. Sie ließ sich nicht einschüchtern.
»Ihr Brief ist vom Belgrave Square aus geschrieben«, bemerkte sie in einem Briefwechsel, mit dem sie den britischen Kriegsminister herausforderte, »ich schreibe aus einer Hütte auf der Krim. Daraus ergibt sich eine andere Sichtweise.« Und das von einer Frau, die ein paar Monate zuvor noch Angst hatte, ihre hysterische Mutter zu enttäuschen. Wenn nun ein Arzt – oder irgendjemand sonst – ihr sagte, dass etwas nicht getan werden könne, antwortete sie mit ruhiger Autorität: »Aber es muss getan werden.« Und wenn es dann doch nicht getan wurde – zum Beispiel, als ein Krankenhaus, in dem sie arbeitete, sich weigerte, Katholiken und Juden aufzunehmen –, drohte sie mit ihrer Kündigung. Das war unmissverständlich.
Ihre Erfahrungen mit der Furcht halfen ihr, eine liebevolle Beziehung zu den Tausenden von verwundeten und sterbenden Patienten aufzubauen, die sie betreute. »Befürchtungen, Ungewissheit, Warten, Erwartungen und Angst vor Überraschung schaden einem Patienten mehr als jede Anstrengung«, schrieb Nightingale. »Denken Sie daran, dass er seinem Feind die ganze Zeit von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, innerlich mit ihm ringt, lange imaginäre Unterhaltungen mit ihm führt.« Dies war ein Kampf, den sie aus erster Hand kannte, einer, bei dem sie ihren Patienten zum Sieg verhelfen konnte.
Heutzutage erhält jeder von uns seinen eigenen Ruf.
Um sich in den Dienst einer Sache zu stellen.
Ein Risiko einzugehen.
Den Status quo infrage zu stellen.
Auf etwas zuzulaufen, während andere davor wegrennen.
Über die eigene Stellung hinauszuwachsen.
Etwas zu tun, von dem die Leute sagen, es sei unmöglich.
Es wird für uns viele Gründe geben, warum uns dieser Weg nicht als der richtige erscheinen wird. Es wird auf uns ein unglaublicher Druck ausgeübt werden, diese Gedanken, diese Träume, dieses Bedürfnis aus unserem Kopf zu verbannen. Je nachdem, wo wir sind und was wir tun möchten, kann der Widerstand, auf den wir stoßen, in Anreizen zugunsten einer anderen Entscheidung bestehen … oder die Form offener Gewalt annehmen.
Die Furcht wird sich bemerkbar machen. Das tut sie immer.
Werden wir uns von ihr davon abhalten lassen, dem Ruf zu folgen? Werden wir das Telefon klingeln lassen?
Oder können wir uns näher und näher an unser Ziel herantasten, wie Nightingale es tat, uns dabei stählen und vorbereiten, bis wir bereit sind, das zu tun, was unsere Bestimmung ist?
Wichtig ist, keine Angst zu haben
Es ist leicht, verängstigt zu sein. Besonders in der heutigen Zeit.
Die Lage kann jeden Moment eskalieren. Es herrscht Ungewissheit. Sie könnten Ihren Job verlieren. Dann Ihr Haus und Ihr Auto. Sogar Ihren Kindern könnte etwas zustoßen.
Wenn alles so unsicher ist, wirkt sich das natürlich auf unseren Gefühlshaushalt aus. Wie sollte es auch anders sein?
Sogar die antiken Stoiker, die angeblich immer ihre Emotionen unter Kontrolle hatten, haben zugegeben, dass wir alle immer wieder einmal impulsiv reagieren. Auf laute Geräusche. Auf Verunsicherung. Auf einen Angriff.
Sie hatten einen Ausdruck für diese spontanen, noch nicht vom Verstand verarbeiteten Eindrücke von Dingen: phantasiai. Und diesen war nicht zu trauen.
Wissen Sie, was der am häufigsten wiederholte Satz in der Bibel ist? »Fürchtet euch nicht.« Immer und immer wieder tauchen diese Worte auf, eine Ermahnung von oben, sich nicht von phantasiai beherrschen zu lassen.
»Sei mutig und stark«, lesen wir im Buch Josua, »fürchte dich also nicht und hab keine Angst«. Im fünften Buch Mose heißt es: »Wenn du zum Kampf gegen deine Feinde ausziehst und Pferde und Wagen und ein Kriegsvolk erblickst, das zahlreicher ist als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten.« In den Sprüchen Salomos heißt es: »Fürchte dich nicht vor jähem Erschrecken, vor dem Verderben, das über die Frevler kommt!« Ebenfalls im fünften Buch Mose, in Anlehnung an das Buch Josua, ruft Mose Josua zu sich und entsendet ihn nach Israel. »Empfange Vollmacht und Kraft«, sagt er zu ihm. »Du sollst mit diesem Volk in das Land hineinziehen, von dem du weißt: Der Herr hat ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Du sollst es an sie als Erbbesitz verteilen. […] Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben.«3
Sowohl die Stoiker als auch die Christen haben niemanden dafür getadelt, dass er sich kurzfristig fürchtet, dass er eine emotionale Reaktion zeigt. Ihnen kam es nur darauf an, wie man sich verhält, nachdem der Anflug dieses Gefühls abgeklungen ist.
»Erschrick ruhig. Dagegen kannst du nichts tun«, sagte William Faulkner. »Aber hab keine Angst.«
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Erschrecken ist ein vorübergehend aufwallendes Gefühl. Das kann man verzeihen. Angst ist dagegen ein länger anhaltender Zustand, und der Angst zu erlauben, ein Gemüt zu beherrschen, ist eine Schande.
Der Schreck hilft Ihnen, denn er alarmiert Sie, weckt Sie auf, weist Sie auf eine Gefahr hin. Die Angst hingegen zieht Sie herunter, schwächt Sie, kann Sie sogar lähmen.
In einer unsicheren Welt, in einer Zeit quälender, schwer zu lösender Probleme, ist Angst eine Belastung. Angst schränkt Sie ein.
Es ist okay, sich einmal zu fürchten. Wem wäre das noch nicht passiert? Aber es ist nicht in Ordnung, sich davon aufhalten zu lassen.
Ein jüdischer Spruch vom Anfang des 19. Jahrhunderts lautet: ללכ דחפל אל רקיעהו דואמ רצ רשג ולוכ םלועה לכ. »Die Welt ist eine schmale Brücke und das Wichtigste ist, keine Angst zu haben.«