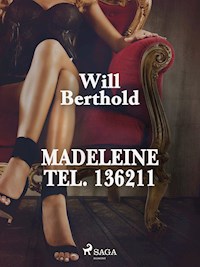Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine der geheimsten Elitetruppen während des Zweiten Weltkriegs steht in diesem auf Tatsachen beruhenden Roman im Mittelpunkt: Gewohnt präzise recherchiert und mit großem Sachverständnis rückt Will Berthold die "Division Brandenburg", die Sondertruppe von Admiral Canaris, in den Fokus. Diese Eliteeinheit war so geheim, dass sie selbst nicht in den Wehrmachtsberichten erwähnt werden durfte. Die Truppe wurde gnadenlos an allen Brennpunkten eingesetzt und erlitt schwere Verluste. Dies ist ihre Geschichte. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Division Brandenburg. Die Haustruppe des Admiral Canaris - Tatsachenroman
Saga
Division Brandenburg. Die Haustruppe des Admiral Canaris – TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1977, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444742
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Die legendäre Gespenster-Einheit Brandenburg war die Haustruppe des Admirals Canaris; bei Kriegsausbruch 1939 eine Kompanie, bei Kriegsende eine Division. Der zweite Weltkrieg spülte auf beiden Seiten eine neue Waffengattung groß ins Fach: die Kommando-Truppen. Es waren Soldaten, die in Tarn-Uniform im Rücken des Feindes kämpften, Männer, die von keinem Kriegsrecht geschützt waren. Die Sonder-Einsätze der Division Brandenburg wurden immer verzweifelter. An allen Brennpunkten des Krieges wurde sie als Feuerwehr der Front verheizt. Das Elite-Bewußtsein gewährte eine Sondermoral. Die Waffe der Brandenburger war der Handstreich, ihr Wahnwitz der Mut, Großdeutschland ihr Aberglaube. So zogen sie in den Kampf, verblendet, verwegen, verloren. Sie erhielten die höchsten Auszeichnungen, trugen die größten Verluste und wurden am seltensten im Wehrmachtsbericht erwähnt. Jetzt, 15 Jahre nach Kriegsende, liegt ihre zwielichtige Geschichte noch immer im Dunkel.
Dieses Buch wurde an Hand exakter Unterlagen geschrieben. Alle Aktionen sind verbürgt und belegt, nur die persönlichen Schicksale mitunter ausgeschmückt. Der Leser erlebt den Einsatz in russicher Uniform, der die Obr-Brücke bei Lipsk für den deutschen Vormarsch rettet, die ewige Nacht Nord-Kareliens und den Fallschirmabsprung mit russischen Freiwilligen im Kaukasus. Der Bericht schildert die Hölle des jugoslawischen Partisanenkriegs und den dreckigen Kampf um das Schwarze Gold Rumäniens. Die Handlung wird von Tempo und Spannung vorangetrieben und immer an schillernden Einzelschicksalen aufgehängt.
Sie kauern in einer brutheißen Feldscheune und vertreiben sich die Zeit, so schlecht es geht. Die stechende Juni-Sonne des Jahres 1941 versengt Haut und Erde. Der Schweiß frißt kleine Schmutzbahnen in ihre gebräunten Gesichter. Keiner hat Lust, viel zu reden.
Seit einigen Tagen lungern die Männer der 10. Kompanie des Lehrregiments Brandenburg z. b. V. 800 hier in Schönwalde bei Allenstein herum, gut versteckt im gigantischen Aufmarschgebiet der deutschen Armeen gegen Osten. Sie sind Soldaten des verlorenen Haufens, im Wartesaal der Hölle, auf Abruf zum Himmelfahrtskommando; sie sind Freiwillige einer geisterhaften Spezialtruppe, deren Moral Verwegenheit, deren Schicksal Untergang und deren Devise: „Hie guet Brandenburg allewege“ ist. Alle Wege führen diesmal nach Rußland. Alle Schleichwege . . . morgen oder übermorgen oder irgendwann. Nur die Stunde ist ungewiß.
Der Gefreite Sack, wegen seines Appetits Freß-Sack genannt, reißt das quietschende Scheunentor auf.
„Schnaps gibt’s!“ ruft er, „heraustreten zum Zigarettenfassen!“
„Schon faul“, erwidert der Obergefreite Jonas beim Aufstehen.
„Halts Maul, Prophet!“ wendet sich Unteroffizier Dörner an ihn.
„Es geht also los . . .“, sagt der kleine blonde Czerny wie zu sich selbst.
Keiner hört auf ihn, aber jeder denkt das gleiche. Bis auf den Achtzehnjährigen sind sie bei Brandenburg keine heurigen Hasen mehr. So wissen sie, daß von jedem Einsatz höchstens jeder zweite zurückkehrt, wenn er Schwein, verdammtes Schwein hat . . .
Während sie sich vor dem Küchenbullen einer hinter dem anderen aufstellen, mustern sie scheu den Nebenmann. Marketenderwaren in Hülle und Fülle! Der Staat, der ihnen Tollkühnheit abverlangt, spart nicht mit Spesen. So reicht man ihnen die Gabe vor dem Sturm – soviel die Hände tragen. Mehr als die Magenwände vertragen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Alkohol macht Laune. Und der Kater kommt erst hinterher.
Nebenan hält ein LKW. Soldaten werfen in Decken gehüllte Bündel ab. Eines platzt beim Aufschlag. Uniformen liegen am Boden, wie sie die Männer der 10. Kompanie noch nie gesehen haben: nagelneu, erdfarben, mit fremden Dienstgradabzeichen.
„Doch Rußland“, murmelt Jonas.
„Du bist ein schlauer Prophet“, entgegnet der Gefreite Freudenreich spöttisch.
„Steht nicht herum wie Pik sieben!“ schreit ihnen Leutnant Pflug zu. „Ihr habt ’n Glück . . . der Iwan ist doch kein Soldat . . . die Russen drehen wir in drei Wochen durch den Fleischwolf . . .“
Er kennt keine Nerven. „Geburtsfehler“, pflegt er lachend zu sagen.
Sie trotten wieder in ihre Feldscheune zurück.
„Wenn ihr mir folgt“, sagt Sack, der Freß-Sack, „dann verrollt ihr euch noch vor der Ausgangssperre.“ Er grinst. „Ich kenn’ das . . . dicke Luft.“
„Ob’s beim Iwan Mädchen gibt!“ fragt Freudenreich.
„Da verlaß ich mich lieber auf die von Allenstein“, entgegnet Sack. Er wendet sich an Dörner:
„Kommst du mit?“
Der Unteroffizier reagiert nicht.
„Der macht sich doch nichts aus Mädchen“, wirft Jonas ein. Er dreht sich wieder nach Sack um:
„Hast du noch die Rote . . . aus der Bäckerei? Er modelliert mit der Hand auf seinem Waffenrock die Konturen des Mädchens.
„Nee“, antwortet Sack stolz, „ich hab’ jetzt ’ne Schwarze, die nimmt’s mit euch allen auf.“
„Angeber!“ entgegnet Jonas. Dann brüllt er „Achtung!“
Leutnant Pflug, der Zugführer, ist eingetreten.
„Weitermachen!“ sagt er lässig. Er setzt sich auf einen Strohballen, zündet sich eine Zigarette an. „Alle mal herhören“, befiehlt er überflüssig und steht wieder auf. Er sieht seine Leute an.
„Wir werden“, sagt er dann mit unbeteiligter Stimme, „in kleinen Trupps in das russische Hinterland vorstoßen . . . Unsere Aufgabe ist, zu verhindern, daß die Russen ihre Brücken sprengen . . .“
Er nimmt einen Zug von seiner Zigarette, sieht dem ausgeblasenen Rauch nach.
„Polnische Führer stehen zur Verfügung . . .“ Lächelnd schränkt er ein: „Hoffentlich . . . Weiter haben wir den Auftrag, den feindlichen Nachschub zu stören und hinter den russischen Linien Verwirrung anzurichten, bis unsere Truppen auf uns stoßen, klar?“
„Jawohl!“ rufen die Soldaten, bevor sie noch die Ungeheuerlichkeit des Einsatzes begriffen haben.
„Die genaue Einteilung folgt noch. Weitere Befehle unmittelbar vor dem Einsatz. So, Herrschaften, ihr probiert jetzt die neuen Klamotten . . .“ Pflug verzieht den Mund. „Kostümprobe . . .“
„Wann steigt denn der Zauber, Herr Leutnant?“ fragt Sack.
„Sie werden’s abwarten können“, antwortet der Offizier. Er nimmt einem seiner Leute den Kochgeschirrdeckel mit dem Schnaps aus der Hand. „Kinder“, sagt er gutmütig, „sauft nicht so viel!“ Dann trinkt er den Deckel mit einem Zug leer.
Zuerst betrachten sie alle die Uniformen, die man ihnen reicht, wie Vogelscheuchen. Dörner, der Unteroffizier aus Oberschlesien, faßt die sowjetische Uniformbluse so behutsam an, als griffe er in ein Wespennest.
„Fertigmachen zum Heldentod!“ ruft Jonas grimmig.
„Schiß, was?“ giftet ihn der Gefreite Sack an.
„Nach dir“, gibt es ihm der Prophet zurück.
„Die Dinger sind ja noch ganz neu“, sagt Czerny, der Jüngste, betroffen.
Sie stülpen sich das feindliche Tuch über ihre deutschen Uniformen: Maskerade des Todes.
„Und jetzt?“ fragt Czerny.
„Es gibt ’ne ganze Menge Möglichkeiten“, tröstet ihn Jonas, „zuerst kannst du schon beim Anmarsch im Sumpf steckenbleiben . . .“
„Lern schwimmen, Junge“, wirft Freß-Sack ein.
„Dann können dich die Russen vorzeitig erkennen und niederknallen“, fährt der Prophet fort.
„Das ist noch die beste Lösung“, brummelt Freudenreich.
„Falls sie dich aber schnappen, hängen sie dich auf, das ist klar wie Knödelbrühe“, erläutert Jonas weiter.
„Damit sind wir noch nicht am Ende“, unterbricht ihn Freudenreich, „wenn du alles überstanden hast . . . dann kommen die eigenen Kameraden und schießen dich über den Haufen . . . weil sie dich für ’nen Russen halten.“
„Ja, aber . . .“, versucht sich Czerny hilflos zu wehren.
„Hin ist hin“, tröstet ihn Sack, „so oder so . . .“
Sie sehen die entsetzten Augen des Jungen, spüren plötzlich etwas, das nicht zu ihren Worten paßt. Unteroffizier Dörner geht auf Czerny zu, drückt ihm seinen Kochgeschirrdeckel in die Hand, faßt ihn an der Schulter und sagt:
„Prost! . . . Humor ist, wenn man trotzdem lacht . . .“
Von jetzt ab beginnen sie, auf die Uhr zu sehen, obwohl ihre Stunde noch nicht geschlagen hat . . .
*
Auch am unheilvollen 22. Juni 1941, dem Beginn des Unternehmens Barbarossa – Hitlers Überfall auf Rußland –, sollten die Männer der legendären Einheit Brandenburg wieder die Spitze der Spitze bilden. Deutsche Soldaten in russischer Uniform, Stunden vor dem Angriff im Niemandsland, dann im Rücken des Feindes, von keinem Kriegsrecht geschützt, allein auf sich gestellte Einzelkämpfer, auf die an jedem Ast jedes Baums die Schlinge wartete, die man ihnen um den Hals legte, falls man sie ergriff . . .
Die Brandenburger unterstanden direkt der Abwehr. Sie waren die Haustruppe des geheimnisvollen Admirals Canaris. Die Sondereinsätze, in die man sie hetzte, gewährten ihnen auch eine Sondermoral. Ihr Elitebewußtsein trieb sie vorwärts. Ihre Waffe war der Handstreich, ihr Wahnwitz der Mut. So zogen sie in den Kampf: verblendet, verwegen, verloren . . .
Die Einheit Brandenburg begann als Kompanie und endete als Division. Die Soldaten dieser Sondertruppe erhielten die höchsten Auszeichnungen, trugen die größten Verluste und wurden am seltensten im Wehrmachtsbericht erwähnt. Ihr Entstehen war so abenteuerlich wie ihre Geschichte: die ersten Gruppen rekrutierten sich aus sudetendeutschen SA-Leuten, die Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei vorbereitet hatten, aus Angehörigen des ehemaligen Jung-Preußen-Bundes und Freikorps-Kämpfern. Der alte Fuchs Canaris erkannte seine Chance und stellte am 15. Oktober 1939 die 1. Bau-Lehr-Kompanie, genannt Deutsche Kompanie z. b. V. zusammen, die in Brandenburg an der Havel – in der Generalfeldzeugmeister-Kaserne des ehemaligen Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiments 3 – stationiert wurde. Ende des Jahres waren die Brandenburger bereits ein Bataillon, dem der erste Kommandeur, Dr. von Hippel, die Parole gab:
„Ihr sollt ein Räuberhaufen sein, mit dem man den Teufel aus der Hölle holen kann.“
Die freiwilligen Angehörigen der Sondertruppe nahmen sie ernst. In ihrem Hauptquartier, dem Quenz-Gut bei Brandenburg, das sie die Hexenküche nannten, erhielten sie ihre Spezialausbildung: sie lernten Sprachen, Fallschirmspringen, die behelfsmäßige Herstellung von Sprengstoffen, die Tarnung handlicher Sprengsätze in Füllfederhaltern, Drehbleistiften und Zündholzschachteln. Sie wurden als Pioniere wie als Partisanen gedrillt. Man zeigte ihnen alle Tricks, mit denen man sich im feindlichen Hinterland über Wasser halten kann.
Ihre Feuertaufe erhielten sie am 9. April 1940, als sie als Voraustrupp die Brücke über den Großen Belt sicherten. Beim Überfall auf Norwegen waren die Brandenburger im Rahmen des Unternehmens „Widar“ längst vor den regulären deutschen Truppen im Land. Während des Frankreich-Feldzuges, der 6. Armee unterstellt, operierten sie in feindlicher Uniform. Bei Maastricht verbluteten sie umsonst, während sie die Maas-Brücke bei Gennep für den deutschen Vormarsch sichern konnten. Im August 1940 wurde die Einheit zum Lehrregiment Brandenburg z. b. V. erweitert. Obwohl die Werbung für diese Sondertruppe wegen der Tarnung behutsam, fast lautlos vor sich gehen mußte, meldeten sich mehr Freiwillige, als die Abwehr zunächst gebrauchen konnte.
Selbst im Fuchsbau am Tirpitz-Ufer mußte man sich fragen: wer sind eigentlich diese Freiwilligen, die sich danach drängen, in selbstmörderischen Einsätzen stückweise verheizt zu werden?
Verblendete Idealisten? Bornierte Nationalisten? Traditionsbefangene Offiziere? Entfesselte Ehrgeizlinge? Verwegene Abenteurer? Hasardierende Landsknechte? Oder einfach Soldaten, die die stahlharte Kameradschaft des „Verlorenen Haufens“ faszinierte?
Die Division Brandenburg war die schillerndste Einheit der deutschen Wehrmacht. Hier stand der Intellektuelle neben dem Arbeiter, der Universitätsprofessor aus Berlin neben dem Bauernjungen aus dem Banat, der Import-Kaufmann aus Chikago, der sich auf einem Blockadebrecher nach Deutschland durchgeschlagen hatte, neben dem Ortsgruppenleiter aus Sydney, dem Hitlers Krieg wichtiger war als seine Fabrik, der Wissenschaftler aus der Forschungsanstalt neben dem kaukasischen Legionär.
Die Soldaten dieser Einheit kamen aus den widersprechendsten Lagern und hatten die gegensätzlichsten Berufe. Aber sie alle schmolzen unter einem Stahlhelm zusammen zu einem Begriff: Brandenburg . . .
So sah die Garde des Admirals Canaris aus: vom Feind gefürchtet, vom deutschen Generalstab an sämtlichen Brennpunkten des Krieges angefordert. Die Division Brandenburg kämpfte an allen Fronten in drei Erdteilen. Ihre Angehörigen verkleideten sich als arabische Beduinen und als britische Offiziere. Sie sprangen als russische Muschiks weit hinter den sowjetischen Linien ab. Sie sabotierten am Nil, und sie stießen bis in eine Agentenschule hinter dem Ural vor. Sie kämpften im Niemandsland, bei Zwielicht. Die Brandenburger siegten oder starben, und häufig auch beides.
Sie verdursteten in der Wüste Nordafrikas. Sie erfroren in den Eiswüsten Finnlands. Sie verhungerten in den Bergen des Kaukasus. Sie endeten namenlos am Galgen. Sie flogen mit Munitionsdepots in die Luft. Sie wurden in der Uniform des Feindes von den eigenen Kameraden erschossen. Sie verbluteten, wurden aufgefrischt und verbluteten wieder. Sie fielen reihenweise. Ihr Stolz krepierte, aber die Kameradschaft hielt stand, bis sich der Krieg an ihren Leichen sattgefressen hatte und noch darüber hinaus. Sie dienten dem Krieg und wußten nicht, was er ist. Erst als sie ihr junges Leben weggeworfen hatten, erfuhren sie, daß er aus Eiter, Blut, Dreck und Verwesung besteht. Bis dahin war der Weg lang und gemein. Hundsgemein.
Und jetzt, am Vorabend des Rußlandkrieges, beginnt eine der grausamsten Stationen: die Brandenburger sind bereit, einen unsinnigen, unmöglichen, ungeheuerlichen Befehl auszuführen.
*
Gegen 16 Uhr erfährt der Gefreite Sack, daß er heute nacht nicht zu der dunklen Schönheit nach Allenstein, sondern zu dem lauernden Iwan auf der anderen Seite gehen wird. Er flucht, die anderen lachen.
Sie ziehen die russischen Uniformstücke wieder aus und verstauen sie sorgfältig. Vor zehn Minuten kam der Befehl zur Verlegung. Seitdem erlebt Czerny, der Jüngste, alles wie in Trance, wie im Fieber. Sein Blick ist glasig. Er hört die Witze der anderen und versteht sie nicht. Bin ich denn feiger als sie? überlegt er trotzig. Wie können sie hier herumalbern, als säßen sie im Kino, und das Drama auf der Leinwand ginge sie nichts an?
„Na, Jungchen“, wendet sich Jonas an ihn, „kenn’ ich, kenn’ ich . . .“ Er streckt ihm gutmütig die Schnapsflasche hin. „Kleiner, nun kauf dir mal noch für ’nen Schluck Mumm . . .“
Czerny nimmt die Flasche willig wie ein Kind. Das Zeug brennt im Hals. Aber noch stärker brennen seine Gedanken. In ein paar Stunden also. Bewährung . . . Bewährung . . . Bewährung . . . flimmert es in seinem Bewußtsein wie in Leuchtschrift.
Vor einem halben Jahr hat er sich gemeldet. Von der Schule weg. Seiner russischen Sprachkenntnisse wegen kam er nach der Grundausbildung sofort zu Brandenburg. Und jetzt war es soweit. Gott sei Dank, sagt er sich und spürt, daß seine Hände zittern. Ich bin nur schüchterner als die da. Immer schon. Aber das wird sich geben. Den Klassenkameraden ist auch das Lachen vergangen, als ich mich meldete. Und Czerny erinnert sich der Musikstunde, als die Mitschüler entdeckten, daß ein Komponist namens Czerny Klavier-Etüden geschrieben hatte. Seitdem hieß er der „Pianist“ und zuckte jedesmal zusammen, wenn er den Spitznamen hörte. Wie vor der Front seiner Hitlerjungen, wenn einer auf ihn zukam und sagte:
„Melde Fähnleinführer Czerny . . .“
Dann jeweils traf ihn der eigene Name wie ein Peitschenhieb. Er haßte seinen Vater für den tschechischen Namen. Ich bin doch Deutscher, tobte es immer wieder in seinen Gedanken.
Jetzt lächelte er verkrampft. Wenn ich zurückkomme, dekoriert, dann spielt der Name keine Rolle mehr. Mit dem EK I kann man heißen, wie man will. Und dann fahre ich nach Hause und zeige diesen Idioten, die im Abitur schwitzen, was ich geleistet habe . . . ich, der Czerny mit dem EK . . .
„Mach schnell“, fährt ihn Unteroffizier Dörner an.
Der Junge greift noch einmal nach der Schnapsflasche, verschluckt sich und hustet.
„Das nächste Mal kriegst du Milch“, verspricht der Freß-Sack.
Leutnant Pflug ist eingetreten und beobachtet die Szene. Er winkt den anderen mit den Augen, Czerny in Ruhe zu lassen. Der LKW steht vor der Tür. Es klappt alles reibungslos. Keiner fehlt. Der Zugführer richtet es so ein, daß er auf dem Wagen neben dem Jungen zu sitzen kommt.
„Hören Sie zu . . .“ sagt er vorsichtig, „die Hälfte der Einheit bleibt als Bereitschaft hinten . . . Einsatz je nach der Kampfsituation . . . Wenn Sie wollen . . .“
„Ich will nach vorne“, erwidert Czerny wie ein eigensinniges Kind.
„Sprechen Sie Russisch?“
„Es geht.“
„Gut“, räumt der Offizier ein. „Melden Sie sich zum Einsatz Dörner.“ Er lächelt. „Aber ich häng’ Ihnen das Kreuz aus, wenn Sie mich angelogen haben.“
Die Fahrt geht nach Plaska, zum Gefechtsstand der 10. Kompanie des Lehrregiments Brandenburg z. b. V. 800. Aber der Ort ist den Soldaten kein Begriff. Genaugenommen wissen sie nicht einmal, ob der Weg lang oder kurz ist. Wenn sie eine Hand frei haben, schlagen sie nach den Fliegen. Heute müssen sich die Insekten noch an die Lebenden halten. Ab morgen früh 3 Uhr 05 können sie über die starren Gesichter der Toten krabbeln . . .
Der LKW stoppt. Die jungen Soldaten springen ab. Ein Hauptmann von der Abwehr begrüßt Leutnant Pflug. Erst jetzt erhält der Zugführer die genauen Einsatzbefehle. Dann führt der Hauptmann einen blassen, fahrigen Polen vor.
„Er bringt Sie nach Lipsk . . . er stammt aus der Nähe . . . aus Dabrowa.“
„Zuverlässig?“ fragt Pflug.
„Na, groß ist die Auswahl nicht“, schränkt der Abwehroffizier ein. „Es geht um die Brücke“, fährt er dann geschäftig fort, „sie ist 108 Meter lang, aus Holz . . .“ Er zieht eine Karte aus der Tasche. „Sehen Sie . . . hier, hier ist der Biebrza-Fluß . . . da die Brücke . . . ungefähr 20 Kilometer hinter der Demarkationslinie . . . Nehmen Sie nicht mehr Leute wie unbedingt nötig.“
Pflug nickt.
„Nach Möglichkeit nicht vor 3 Uhr 05 schießen.“
„Danke für den Ratschlag, Herr Hauptmann“, erwidert Pflug sarkastisch.
„Ja, ich weiß schon . . .“
„Dieses Kommando übernehme ich selbst“, sagt der Leutnant abschließend. Er dreht sich nach dem Führer um. „Du Polski?“
Der Pole nickt lebhaft.
„Sprichst du Deutsch?“
„Nix gut.“
„Er mag die Russen nicht“, schaltet sich der Hauptmann ein.
Der Pole fuchtelt mit der Faust in Richtung Osten und antwortet mit einer Flut von Verwünschungen.
„Na also“, sagt Pflug gut gelaunt.
Während die beiden Offiziere den Einsatz besprechen – zwei Stoßtrupps gegen eine ganze Armee –, steht in der Mannschaftsunterkunft die Schnapsflasche still. Der Alkohol schmeckt nach Fusel, und das ist der faulige Atem des Heldentods.
Die seltsame Anspannung macht sich mit jeder Sekunde breiter, wird unheimlicher. Das wissen sie alle: erstens brauchen sie ihre fünf Sinne; zweitens barbarischen Mut; drittens unvorstellbares Glück . . .
Sie sind in einem ausgeräumten Schulzimmer. Ihre Köpfe fahren automatisch zur Türe, sooft sie aufgeht. Das ist die Atmosphäre im Klassenzimmer . . . des Todes.
„Wie hoch ist eigentlich die Quote . . . der . . .?“ fragt Czerny und bricht unsicher ab.
„Der . . . was . . .?“ fragt Freß-Sack gereizt.
„Der . . . Überlebenden?“ ergänzt der Achtzehnjährige.
„Scheißegal“, brummelt Jonas, „Hauptsache, du bist dabei.“
Die Zeit verrinnt träge, staut sich, als ob ihr Abflußrohr verstopft sei. Der Abend will nicht kommen. Ob der Morgen kommen wird?
Unteroffizier Dörner geht hinaus, läuft durch das Dorf, vorbei an den anderen, die morgen früh um 3 Uhr 05 zum Sturm antreten werden. Stunden nach ihm.
Er kommt fast gleichzeitig mit Leutnant Pflug im Schulzimmer an. Für eine Viertelstunde nimmt ihm die Einteilung die Gedanken ab.
„Wer meldet sich freiwillig?“ fragt der Offizier.
Sie strecken alle den Arm hoch wie folgsame Schüler, auch wenn sie die Antwort nicht wissen. Alle kann der Lehrer nicht auf einmal fragen. Alle werden nicht krepieren . . .
Nur jeder zweite muß nach vorne. Die zurückbleiben können, schämen sich.
Kurz vor Mitternacht startet der erste Trupp unter Führung des Leutnants. Er muß auf den gefährlichsten Weg. Der zweite Trupp hat noch eineinhalb Stunden Zeit und verwünscht sie.
Kurz vor dem Abmarsch kommt es noch zu zwei Zwischenfällen: man drückt den Männern in russischer Uniform . . . deutsche Waffen in die Hand.
„Holt euch die russischen drüben“, rät Leutnant Pflug.
Dann macht der polnische Führer schlapp. Er will die Uniform der Rotarmisten nicht anziehen. Er fuchtelt mit den Fäusten. Er schreit. Er schüttelt den Kopf. Er hat es leicht. Er ist nicht bei Brandenburg. Er darf seine Angst offen zeigen.
„Trink erst mal, mein Sohn“, sagt Leutnant Pflug und reicht ihm den Schnaps.
Er gibt den Umstehenden einen Wink. Sie torpedieren den Polen mit Alkohol. So schaffen sie es. Fast willenlos läßt er sich am Schluß die erdfarbenen Klamotten überziehen.
„Macht’s gut!“ ruft der Zugführer seinen Leuten zu.
Zu einem Händedruck ist die Zeit zu knapp geworden . . .
*
Drüben ist es ruhig. Die Russen schlafen. Oder tarnen sie sich auch? Durch das Nachtglas erfaßt man gelegentlich die Silhouetten der Posten. Wissen sie etwas von dem Überfall? Sind sie gewarnt?
Leutnant Pflug setzt gleichgültig das Glas ab. Neben ihm atmet der Pole schwer. Dahinter Freudenreich und Sack. Vier Mann gegen eine Brücke, die 20 Kilometer weit im Hinterland liegt. Ein Infanterieoffizier hat sie nach vorne gebracht. Sie stehen vor den Pfählen der Demarkationslinie und lauern. Die Luft riecht nach Heu und Sumpf. Irgendwo zirpen Grillen.
„Los!“ zischt er seinen Leuten zu.
Sie huschen lautlos und schnell durch ein Drahtloch . . . zur Übermacht. Ein paar Schritte. Eine erste Rast. Umsehen. Nichts rührt sich. Doch, da. Unter den Bäumen. Schatten.
Pflug umfaßt den Kolben der Maschinenpistole. Manchmal gehen die Drecksdinger von selbst los. Irgend etwas mit der Sicherung funktioniert nicht. Es darf nicht sein. Schießverbot bis 3 Uhr 05 früh. Nach Möglichkeit . . . Der junge Offizier ist erleichtert. Auf Schatten braucht er nicht zu schießen. Nicht auf die Spukgestalten seiner Nerven. Er hat ja keine Nerven. Geburtsfehler . . .
Sie durchqueren das Wäldchen. Abstand zehn Meter. Einer hinter dem anderen. Voraus jetzt der Pole. Seine Pupillen glänzen fiebrig. Seine Hände zittern. Jeder Meter ist zum Platzen mit Angst gefüllt. Furcht vor dem deutschen Leutnant, der ihn vorwärts treibt. Höllenangst vor den Russen, die ihm entgegenstarren.
Zu den ersten 500 Metern brauchen sie eine Stunde. Dann gehen sie aufrecht. Anschleichen zwecklos. So schaffen sie die 20 Kilometer nie. Sie müssen es darauf ankommen lassen. Der Pole spricht Russisch. Aber er würde bei einer Begegnung vor Schreck kein Wort herausbringen. Leutnant Pflug beherrscht 200 Worte, vielleicht auch 250.
Es geht gut. Unglaublich gut. Die Russen schlafen wirklich. Sie erreichen ein Gehöft und umgehen es, kommen wieder auf die Straße, holen zügig aus. Die Erleichterung ist töricht. Von irgendwoher wehen Klänge eines melodischen, traurigen Liedes. Pflug wundert sich flüchtig, daß Bolschewiken so schöne Stimmen haben können.
Ein paar Schritte noch, dann steht er starr. Aus dem Graben rechts der Straße quellen Konturen, werden größer. Auch die anderen, die keinen Geburtsfehler haben, wissen, daß es nicht die Nerven sind . . . sonderen die Russen.
„Stoj!“ ruft ihnen der vordere zu.
Der Leutnant geht ihm langsam entgegen.
„Parol?“ fragt der Rotarmist.
Der Offizier erwidert irgendein russisches Wort.
„Njet“, antwortet der Iwan.
Vier Mann, registriert Pflug . . . und Schießverbot.
Sie stehen sich gegenüber. Die Russen starren sie mißtrauisch an, reden auf sie ein. Der Pole zittert vor Angst. Leutnant Pflug ist am Ende mit seinem Sprachschatz. Freudenreich grinst dämlich. Der Freß-Sack entsichert die MP.
„Spezialauftrag“, sagt der Zugführer auf russisch.
Der Iwan schüttelt den Kopf.
„Ihr kommt mit“, sagt er, „zum Kommissar . . .“ Er winkt den vieren, ihm zu folgen.
„Das geht nicht“, entgegnet Pflug.
„Tichij!“ schreit ihn der Russe an, „Ruhe!“
Die vier Rotarmisten nehmen sie in die Mitte. Noch glauben sie, Kameraden vor sich zu haben, die sich vermutlich von ihrer Einheit wegstahlen, um etwas zu organisieren.
„Weit?“ fragt Leutnant Pflug.
„800 Meter“, entgegnet der Sowjetsoldat grimmig.
Der Pole geht mit taumeligen Schritten, stolpert mit den Beinen eines Mannes, der auf den Galgen zugeht. Mach doch etwas, Leutnant, denkt Freudenreich . . . Gut, daß ich kein Offizier bin, redet sich Freß-Sack ein und ignoriert die Situation.
Noch 750 Meter. Pflugs Verstand arbeitet wie ein Uhrwerk. Sie werden uns abliefern. Bei einer russischen Kompanie. Zwei Minuten später wissen sie, daß wir keine Rotarmisten sind. Fünf Minuten später hängen wir am nächsten Baum. Die Brücke, denkt er, der Befehl . . .
Er bleibt etwas zurück.
„Pascholl!“ stößt ihn einer der Iwans an, „vorwärts!“
Schießverbot, überlegt er, Scheißverbot!
Er greift einen Moment nach der Pistole, wie um den Riemen nachzufassen. Seine Hände sind eine Winzigkeit schneller als sein Kopf. Seine Lippen werden zu einem schmalen Strich. Sonst bleibt er ruhig, kalt. Finger am Abzug. Durchdrücken!
Dem linken Iwan fährt eine halbe Garbe der MP in den Leib. Der andere Rotarmist dreht sich fassungslos herum, sackt mit dem Gesicht vornüber, das ein ungläubiges Staunen festhält.
Sack und Freudenreich haben sich zu Boden geworfen. Es geht blitzschnell. Mord aus Notwehr. Pflugs MP zerreißt die Nacht, erfaßt den dritten Iwan. Der vierte läuft davon, fällt, kommt wieder auf die Beine, erreicht die Deckung, schlägt sich durch.
„Verdammte Scheiße!“ sagt Freudenreich.
„Ging nicht anders“, erwidert Pflug gepreßt.
Der Pole steht wie benommen. Langsam versteht er, was vorgefallen ist. Die Erleichterung macht ihn rasend. Er schlägt mit Beinen und Fäusten auf einen der erschossenen Sowjetsoldaten ein.
„Los!“ Pflug reißt ihn mit.
Rufe schwirren durcheinander. Leuchtkugeln zischen hoch. Die Nacht greift mit tausend Armen nach ihnen. Sie hasten vorwärts. Die Lunge sticht. Das Knie zittert. Der Blick flackert. Vorwärts! Schneller! Hinlegen, aufstehen, robben, kriechen, ein geschlossener Sprung. In die Nacht. In das Nichts.
Gut gegangen. Weiter! Truppenübungsplatz auf Leben und Tod. Sechzehn Kilometer noch, quer durch die feindlichen Linien, gesucht, gejagt, gehetzt . . .
Sie werfen sich hin. Verschnaufen. Ganz in der Nähe hören sie russische Kommandos. Vorwärts, denkt Leutnant Pflug und steht wieder auf. Der Pole will nicht mehr. Freudenreich und Sack haken ihn unter, treiben ihn vorwärts. Lastautos fahren vorbei. Soldaten springen ab. Hunde bellen. Taschenlampen blitzen auf.
Sie kauern im Graben einer Wegkreuzung. Leutnant Pflug starrt ratlos die Karte an.
„Wohin?“ fragt er den Polen.
Er schüttelt den Kopf.
Pflug schlägt ihm ins Gesicht, so fest er kann.
„Wohin?“ zischt er ihn an.
„Geradeaus“, wimmert der Mann.
„Gut“, antwortet der Offizier.
Sie stolpern wieder los. Quer durch die Nacht. Uber Stock und Stein. Hinter ihnen Russen. Links von ihnen Russen. Rechts von ihnen Russen.
Von Russen besetzt die Brücke, die sie nehmen und halten sollen . . .
*
Auch die Gruppe Dörner ist gut durch die vorderste russische Linie gekommen. Der Unteroffizier aus Oberschlesien und seine sieben Mann stahlen sich durch ein Loch im Drahtzaun auf den Schleichweg der Hölle. Die Nacht deckte sie wie ein tiefdunkler Witwenschleier. Sie krochen Zentimeter um Zentimeter durch das Niemandsland. Die doppelte Uniform – am Leib die deutsche, darüber die sowjetische – scheuerte am schweißnassen Körper. Sie ließen den Sumpf zur Linken liegen und drückten sich rechts an den sowjetischen Vorposten vorbei.
Jetzt, am 22. Juni 1941, 1 Uhr 30, stehen sie im Rücken einer russischen Pionierkompanie. In zweieinhalb Stunden wird ihr Operationsgebiet genau die Hauptkampflinie sein. Noch viel Zeit bis dahin, trösten sie sich der Reihe nach.
Sie ahnen nicht, daß inzwischen in den russischen Feldstellungen die Drähte glühen. Warnung vor deutschen Agenten in russischer Uniform. Die Schüsse des Leutnants Pflug verübten Selbstverrat. Zwangsläufig. Die Parole wird geändert. Man schärft den russischen Vorposten ein, sich von Soldaten in sowjetischer Uniform nicht blüffen zu lassen. So ist das rückwärtige Gebiet, in das Dörner vorstoßen muß, ein einziger Hexenkessel.
Seine Gruppe erreicht die Straße. Jonas sichert. Czerny ist Schlußlicht. Dörner hebt den Arm.
Genau in diesem Moment rumpeln auf der Straße die Motoren los. Der Unteroffizier will nach hinten ausbrechen. Da hört er russisches Stimmengewirr. Bleibt nur Bluff, denkt er schnell und geht auf die Straße. Seine Leute folgen ihm, drei Meter Abstand, einer hinter dem anderen . . . im Gänsemarsch des Schicksals, Blick am Boden oder im Nacken des Vordermanns.
Von hinten rollt eine motorisierte Einheit heran: Soldaten auf Krädern, Lastwagen mit Iwans, in der Mitte ein offener Schützenpanzerwagen, am Schluß wieder Kräder. Czerny will auf einmal wie gebannt stehenbleiben. Dann setzt er mechanisch Fuß vor Fuß. Jonas spürt, wie die Zunge im Mund gefühllos wird, ledrig. Dörner hebt den Kopf und sieht nach links. Die Iwans starren ihn an. Er erkennt einen Unterleutnant und grüßt zackig. Der Offizier erwidert die Ehrenbezeigung im Vorbeifahren. Ein paar Rotarmisten winken ihnen vom Lastwagen aus zu. Der Spuk dauert nur ein paar Sekunden.
„Die werden sich noch grausam wundern“, sagt Jonas, der Prophet, grinsend.
Ein Blick seines Gruppenführers läßt ihn verstummen. Sprechverbot. Kein deutsches Wort auf dem Anmarschweg zum Einsatzziel: Die Brücke von Siolko.
Drei Kilometer noch, überlegt Dörner. Jetzt querfeldein. Links die Biegung, rechts muß die Brücke liegen. Er gibt den andern ein Zeichen. Sie huschen von der Straße. Ihre Körper verwachsen wieder mit den Schatten der Nacht. Eine Mulde. Ein Tümpel. Sie waten durch. Jonas fällt lang hin, flucht. Keiner lacht . . .
Bevor sie noch die Stimmen im singenden Tonfall der Ukrainer hören, sehen sie die Glutasche der Zigaretten. Sie erstarren. Jede Bewegung wird zur Zeitlupe. Unendlich langsam suchen sie Deckung, blicken nach vorne.
Diese Schweine, denkt Jonas, dürfen rauchen! Seine verkrampfte Hand fährt über die Tasche mit den Zigaretten. Mit einem mißgünstigen Blick streift er Czerny. Der hat’s gut, der ist Nichtraucher. Der weiß nicht, wie das ist. Die Angst und der Mut des Gefreiten, seine Erregung wie seine Ergebenheit schmoren auf eine Zigarettenlänge zusammen. Wartet nur, denkt er, hinterher, wenn alles vorbei ist, zwei steck’ ich mir in den Mund! Drei auf einmal! Und rauche, rauche, rauche . . .
Wie viele Stimmen? überlegt der Unteroffizier vor ihm. Wie viele Männer? Zu dumm, knapp vor dem Ziel! Eine russische Stellung? Oder bloß ein Doppelposten? Er sieht auf die Uhr. Es ist noch Zeit. Viel zuviel Zeit eigentlich. Dörners unheimliche Ruhe überträgt sich auf seine Leute.
Hinten, vor dem Einsatz, gingen sie ihm aus dem Weg, denn er ist ungesellig, fast schroff. Jetzt aber bitten sie es ihm ab. Dabei ist der Mann aus Oberschlesien gar kein alter Brandenburger. Genaugenommen stieß er erst vor ein paar Wochen zu ihrem Haufen.
Unfreiwillig meldete er sich freiwillig.
Seine Einheit war verlegt worden. In die Nähe von Glogau, seiner Heimatstadt. Der Chef gewährte ihm drei Tage Sonderurlaub. Eva, mit der er seit einem Jahr verheiratet war, hatte ihm geschrieben, daß sie ein Kind erwarte. Er lächelte, als er auf seine Wohnung zuging. Er überrannte seinen eigenen Atem. Er hatte nicht telegrafiert. Er wollte sie überraschen. Er malte sich Evas Gesicht aus, ihre Augen, ihr Lächeln. Sie war anders als er, lustiger, lebensfroher. Dörner brauchte eine Frau wie sie. Denn er war schwerfällig, umständlich fast.
Das alles schoß dem Unteroffizier durch den Kopf. Er rechnete, aus wie vielen Stunden, Minuten und Sekunden drei Tage bestünden. Er stand vor der Haustür und verschnaufte. Der Finger, schon am Klingelknopf, zuckte zurück. Nein, dachte er, nicht mitten in der Nacht läuten, das würde sie erschrecken.
Er hatte ja den Schlüssel immer bei sich. Wenn die anderen Kameraden mit ihren albernen Weibergeschichten schwadronierten, dann faßte er ihn gelegentlich an und lächelte vor sich hin.
Noch immer knarrten die fünfte und die sechste Stufe der Treppe. Erster Stock. Ach so, Frau Häupling war in der Zwischenzeit gestorben. Eine nette, alte Frau, schade. Na ja . . . Noch eine Treppe.
Er stand vor seiner Wohnungstür. Er las seinen eigenen Namen. Er buchstabierte ihn. Zweimal. Dreimal. D-ö-r-n-e-r. In diesem Moment konnte er sich keinen schöneren Namen vorstellen. Und Eva hieß genauso, spürte er beglückt.
Er sperrte auf. Leise trat er ein. Auf Zehenspitzen näherte er sich dem Schlafzimmer. In der Diele war etwas umgestellt worden. Er stieß im Finstern dagegen. Er mußte Licht anmachen.
Und dann war es aus. Mit einem Schlag. An der Garderobe hing die Uniform einer anderen Waffengattung. Dörner begriff nichts. Er starrte auf den Waffenrock mit der Litze des Unteroffiziers um den Kragen. Die gleiche Litze trug auch er. Aber der andere hatte hier nichts zu suchen. Und er war bei Eva.
Dörner ging. Mit schweren Schritten. Drinnen rührte sich etwas. Er hörte Geflüster. Als er schon den Treppenabsatz erreicht hatte, sah er sie. Eva. Sie starrte ihn betroffen an, hielt sich die Hand vor den Mund. Nie würde er ihren Blick vergessen.
Er knallte die Tür hinter sich zu. Er polterte die Treppe hinunter. Er lief wahllos durch die Stadt. Er landete am Bahnhof. Viel zu früh. Er kauerte auf einer Bank, Die Küsse, die Eva dem anderen gegeben hatte, brannten in seinem Gesicht wie Ohrfeigen.
Dann nahm er den ersten Zug, fuhr zurück zu seiner Einheit. Er sagte kein Wort. Sie schüttelten den Kopf. Sie hatten ihn auch so verstanden. Hinter seinem Rücken tuschelten sie. Nicht bösartig, eher mitleidig. Aber das hielt er nicht aus.
Zufällig war am gleichen Tag eine Kommission bei seinem Bataillon, die Freiwillige für das Regiment Brandenburg auswählte. Gesucht wurden junge, drahtige Burschen, die zu allem bereit waren, nicht viel fragten und blitzschnell handeln konnten. Fehlanzeige. Keiner wollte weg von der Einheit, die zwei Feldzüge zusammengeschweißt hatten. Der Panzerkommandeur lächelte süffisant. Der Werbeoffizier versteckte oberflächlich seinen Mißmut. Schon wollte er sich zum Gehen wenden, da trat einer vor: Unteroffizier Dörner.
Er wurde genommen. Er ließ alles über sich ergehen, phlegmatisch, fast gleichgültig: die Spezialausbildung, die Latrinenparolen, die Schilderungen der neuen Kameraden. Es war ja alles unwesentlich geworden. Das Leben. Der Krieg. Der Einsatz. Selbst Eva. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Er schüttelte alle Gedanken an sie ab. Nur, daß sie gelegentlich, wie jetzt, schmerzten, das konnte er nicht ändern.
Unsinn, denkt Dörner und konzentriert sich auf den Feind. 200 Meter, vielleicht 300. Zwei Stunden noch bis zum Einsatz. Zu früh zum Überfall . . . und vielleicht dann doch zu spät, um die Sprengung der Brücke zu verhindern.
Während der Gruppenführer noch überlegt, faßt der kleine Czerny seinen Entschluß. Der unsichtbare Feind hatte seine Sinne vollends aufgerieben. So sieht der Achtzehnjährige jetzt hinter jedem Baum einen Russen, hinter jedem Busch ein sowjetisches MG. Am liebsten würde er wild in die Dunkelheit hineinfeuern. Auf einmal haßt er die Nacht, den Einsatz . . . und sich, weil er fürchtet, beim erstenmal schlappzumachen. So will er sich, aus der Unsicherheit heraus, in die Courage flüchten. Mit einem Schlag. Er muß seinem „inneren Schweinehund“ den Rückweg abschneiden.
Czerny robbt an Dörner heran, hält die Hand vor den Mund, flüstert:
„Wir müssen sehen, was da los ist . . .“
Der Unteroffizier nickt zerstreut.
„Melde mich als Späher.“
„Quatsch!“ wehrt der Stoßtruppführer ab.
„Ich spreche prima Russisch . . . wenn sie mich schnappen . . . kann ich immer noch . . .“
Natürlich, denkt Dörner, es ist richtig . . . Aber warum soll ausgerechnet der Jüngste die Kastanien aus dem Feuer holen? Er sieht in das zuckende, erregte Gesicht des Jungen und hebt die Schultern.
„Gut“, sagt er, „aber sei um Gottes willen vorsichtig.“
Die anderen sehen ihm nach, wie er gekonnt von Baum zu Baum hastet, mit dem Schatten verwächst, wie er die Nacht wie ein Tarnhemd nutzt, sich lautlos an die russische Stellung heranpirscht. Eine Papyrossi-Kippe fliegt im hohen Bogen durch die Nacht. Jonas fährt sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Der Junge entschwindet aus ihrem Blick. Von nun ab müssen sie mit den Ohren sehen. Czerny macht es geschickt. Ganz selten hören sie ein Geräusch, so, wie wenn sanfter Wind über die Hecken striche.
Mach’s gut, denkt Dörner mit der Inbrunst eines Gebetes. Warten, nichts als warten. Horchen. Nichts zu hören. Auf die Uhr sehen. Blödsinniger Zeiger. Das Zifferblatt klebt wie Sirup.
Nach 20 Minuten hat Czerny 150 Meter geschafft. Schon erkennt er Konturen. Acht, neun Russen. Eine schlampige Infanteriestellung. Er schiebt sich näher heran. Die verlegen ja die Stellung, denkt er, nach hinten. Großartig!
Er könnte, er müßte zurückgehen. Aber er will ganz dicht heran. Vielleicht meldet der Unteroffizier danach seinen Einsatz, und er bekommt gleich beim ersten Mal das EK.
Noch 50 Meter. Ganz klar jetzt die Sicht. Elf Mann.
Czerny schleicht weiter, geduckt, schneller, unvorsichtiger. Das Fieber ist wieder da. Aber diesmal anders. Die Angst ist weg. Und der Achtzehnjährige erhebt sich über die eigene Furcht. Wie großartig ist das, denkt er . . .
Und dann bremst ihn eine Baumwurzel. Er will den Sturz auffangen. Aber es wird nur schlimmer. Er schlägt schwer gegen den Boden, starrt nach vorne, blickt zu den Russen.
Zwei stehen auf, sehen in seine Richtung, unschlüssig, ob sie näher kommen sollen. Ein dritter ruft ihm etwas zu. Czerny macht sich klein, winzig. Er kauert wie festgeklebt am Boden. 30 Schritte noch. Jetzt sind die Russen schon zu viert. Zu fünft. Zehn Meter noch.
Da springt der Junge auf, geht auf sie zu.
„Ihr da“, ruft er auf russisch, „ich hab’ mich verlaufen.“
Sie betrachten ihn mit ausdruckslosen Gesichtern.
„Parol?“ ruft der vorderste.
Czerny schüttelt den Kopf.
Auf einmal umringen sie ihn, zerren ihn weiter, zu ihrer Stellung.
„Wo kommst du her?“ fährt ihn einer an.
„Von vorne“, erwidert der Junge.
„Welche Einheit?“
Frage auf Frage. Und da ist der Verdacht. Auf einmal halten Czerny starke Bauernfäuste fest. Er schlägt wild um sich, will sich dem Griff entziehen. Seine russische Uniformbluse verschiebt sich im Handgemenge. Die Iwans sehen ein Stück der deutschen Uniform.
Pfiffe. Rufe. Und da kommt der Mann mit der Lederjacke. Der Kommissar.
Nur die Kameraden nicht verraten, denkt Czerny, nur nicht. Dann spürt er Schläge. Fußtritte. Sie reißen ihm die MP von der Schulter. Dann Kommandos auf russisch. Er versteht sie, aber begreift sie nicht. Die Lederjacke deutet auf einen Baum. Ein Rotarmist kommt mit einem Stück Telefonkabel. Das nicht, denkt Czerny und will sich wieder losreißen. Sie stürzen sich auf ihn. Keuchend brüllt der Junge, der sich bewähren wollte:
„Nein . . .! Nein . . .!“
Die Nacht wirft das Echo gespenstisch zurück zu Unteroffizier Dörner und seinen Leuten.
Verzerrt, schaurig, durchdringend erreicht sie der letzte Notschrei ihres Kameraden . . .
Der Schrei, den der verzerrende Wind herüberträgt, hat nichts Menschliches mehr an sich; dieses schrille, entfesselte, gewürgte Gebrüll läßt die Männer der Gruppe Dörner das Geschehen miterleben, als ob es an ihnen vollzogen würde. Sie krallen sich in das sumpfnasse Gras. Sie schließen die Augen. Ein Tier stöhnt so in der Todesfalle. Oder eine Mutter, deren Kind überfahren wird.
„Nein!“ kommt es von drüben, „das dürft ihr nicht! . . . Laßt mich!“
Der Schall verweht die Funken der letzten Lebensgier zu Silben des Wahnsinns. Dabei soll Czerny doch gar nicht deutsch sprechen, denkt Jonas, der Prophet, russisch nur, bloß russisch! Dieser Idiot! Er kennt doch den Befehl. Nun hat er’s. Nun geben sie es ihm. Nun machen sie ihn fertig . . .
Im ersten Impuls möchte Unteroffizier Dörner aufspringen, hinüberstürmen und wie ein Berserker um sich schlagen, stoßen, stechen, schießen, hauen, treten. Sollen wir doch alle draufgehn, tobt es in seinem Blut. Was macht’s schon? Sollen sie ihre Scheißbrücke sprengen. Soll geschehen, was will . . . nur das nicht. Das doch nicht! Das ist schlimmer als alles andere. Gemeiner. Dreckiger.
Aber Dörner bleibt liegen. Starr, wie gestorben. Der Befehl nagelt ihn fest. Die Vernunft preßt ihn auf die Erde. Diese gnadenlose, kaltblütige, irrsinnige Vernunft! Das Oberkommando erwartet, daß er eine Brücke besetzt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das spart Blut, lehrte man ihn vor dem Einsatz. Und das Blut von Czerny?
Das Geschrei wird leiser, kommt jetzt gedämpft herüber, wie gefiltert. Darüber liegen gutturale Stimmen, im singenden Tonfall der Ukrainer, Vokale, die an seltsamen Zischlauten aufgereiht werden. Einer der Iwans lacht, hysterisch vielleicht. Aber es ist Jonas, als ob ein scharfes Messer an seinem blanken Nerv sägen würde. Er preßt beide Hände gegen seine Ohren, drückt den Kopf in den glucksenden Boden. Aber es wird nur noch schlimmer, deutlicher, klarer . . .
Der Obergefreite Fink neben ihm legt sich auf den Rücken und starrt mit fahlem, verzerrtem Gesicht nach oben, als ob von da noch Hilfe kommen könnte. Seine Augen sind wie aus Stein. Für Sekunden verfällt jedes Leben in seinen Zügen. Blau und eckig treten die Adern an den Schläfen hervor. Die blassen Lippen zucken, langsam zunächst, immer schneller, rasender. Er fährt mit der Hand an die Kehle, als spürte er den Strick, den sie einem anderen, einem Kameraden, in diesem Moment um den Hals legen.
Vielleicht haben ein paar von den Iwans sogar Mitleid mit Czerny. Oder sie stehen herum, rauchen, unterhalten sich banal, weil sie ja nicht zu baumeln brauchen. Und der da drüben, der kleine Czerny, der blonde Junge, ist einer von uns, spricht unsere Sprache, trägt unsere Uniform.
Unsere Uniform? Wir haben ja dieses verfluchte Russenzeug am Leib. Diese stinkigen Scheißklamotten! Und deswegen stirbt er ja, wir wir, wenn sie uns fassen. Im Namen des Rechts. Des Kriegsrechts. Aber der lodernde Haß, der plötzlich in ihm aufsteigt, fragt nicht danach.
„Wenn sie ihm was tun . . . wenn sie ihm ein Haar krümmen . . .“ murmelt Fink und vollendet in Gedanken: fünf von ihnen bring’ ich um, zehn . . . eine ganze Kompanie mach’ ich kalt. Mit der bloßen Hand . . .
Die Nerven? Halluzinationen? Äste knacken. Laub knistert. Dann ein Geräusch, als ob ein schwerer Körper gegen einen Baumstamm schlägt.
Jonas dreht durch. Er springt auf. Er wirft sich neben Dörner, den Gruppenführer, rüttelt ihn an den Schultern. Der Mann reagiert nicht. Da stößt der Prophet ihn derb mit der Faust in die Rippen.
„Hör zu“, gurgelt er, „das kannst du nicht zulassen . . . wir müssen . . .“
Der Unteroffizier schweigt. Sein Blick ist so gehetzt wie traurig.
„Feiger Hund!“ zischt ihn Jonas an. „Wir können ihn doch nicht verrecken lassen . . .“
Er dreht sich nach den anderen um. Sie kauern in einer Mulde wie im Massengrab.
„Dann mach’ ich’s allein!“ sagt er halblaut und springt auf.
Zwei Sätze nur. Dann folgt ihm Dörner, reißt ihn zurück, wirft ihn zu Boden. Für Sekunden ist jede Vorsicht weggetreten. So lange hassen sie einander wie die Russen, die den kleinen Czemy töten. Sie wälzen sich im Gras. Der Prophet kommt nach oben. Seine Hände schnappen wie eine Greifzange nach der Gurgel des Gruppenführers, pressen sich zusammen und würgen, würgen.
Sie drehen sich beide. Dörner kommt frei, schlägt mit der Hand dem Kameraden in das Gesicht. Jonas spürt es wie eine Barmherzigkeit.
„Idioten!“ knirscht Fink, „alle beide . . .“
Drüben ist es jetzt still, totenstill.
Hören sie nicht noch ein Röcheln? Noch ein Stöhnen, das zu einem langen Todesseufzer ausholt?
Nichts ist mehr zu hören, nur der sanfte Wind, der in den Blättern raschelt. So, als ob die Natur über den Menschen, den sie erfreuen möchte, seufzen wollte. Sie liegen und warten, hoffen und verzweifeln.
Jetzt kommen von drüben Kommandos, Schritte. Ein paar Spatenschläge.
Unteroffizier Dörner sieht wieder auf die Uhr. Noch 20 Minuten Zeit. Jetzt ist er dankbar dafür. Nur nicht so schnell hinübergehen, nur nicht so bald sehen müssen. Er bereut, daß er sich nicht über den Befehl hinwegsetzte, daß er nicht eingriff, daß er dieser gottverfluchten Vernunft die Stange hielt.
Der Obergefreite Fink dreht sich wieder herum, stützt sich schwer auf die Ellenbogen. Auf einmal ist er entspannt, töricht erleichtert. Ist doch alles Unsinn, überlegt er, Nervensache . . . schon lange nicht mehr im Einsatz gewesen. Freilich, geschnappt haben sie ihn, geschlagen werden sie ihn haben, ein bißchen gefoltert, um ihm die Zunge zu lockern. Und jetzt bringen sie ihn zurück, zu ihrer Auffangstelle, vernehmen ihn wieder. Und dann kommen wir und hau’n ihn heraus. Wie immer. Gelernt ist gelernt.
Und Czerny wird in die Kamera lächeln, daß die PK mit ihm zufrieden ist. Und er wird einen Orden kriegen. Und nach Hause fahren, zu seiner Mutter. Sonderurlaub wegen Tapferkeit. Herrjeh, ist das ein Leben! Und so leben wir, leben wir alle Tage . . . wir hier, von Brandenburg, dem tollsten, dem verwegensten Haufen der deutschen Wehrmacht!
Und der kleine Czerny wird ein wenig verlegen seine Mutter küssen und dann sein Mädchen suchen. Er wird sie in die Arme reißen, daß es fast weh tut. Er wird sie an sich pressen, daß die Luft wegbleibt. Und sie wird ihn abwehren und er lächeln. Und sie ist wie er, jung, frisch und voller Sehnsucht. Und die Wand fällt, der Boden sinkt, und die Erde wird zur Drehscheibe, die wahnsinnig schnell rotiert. Und sie halten sich fest, ganz fest, und pfeifen auf die Welt, weil sie einander haben.
Sicher hat er ein Mädchen, denkt Fink, jetzt schon ganz bestimmt, wo er ein Mann, ein Kerl geworden ist. Der Obergefreite lächelt vor sich hin. Die Entspannung ist so wohlig, daß er müde wird. Am liebsten würde er einschlafen. Ausgerechnet jetzt, vor dem Einsatz. Er schüttelt über sich selbst den Kopf. Komisch, daß man immer alles zur falschen Zeit möchte, überlegt er . . .
Langsam flaut auch in Jonas die Erregung ab. Aber er kann nicht mehr stilliegen, so dakauern. Er muß etwas tun, etwas Irrsinniges, etwas Verbotenes. Ich muß euch zeigen, daß der Prophet noch da ist und sich nicht einschüchtern läßt, fiebert er. Vielleicht geh’ ich hinüber und leg’ ein paar Russen um. Oder ich halte die Brücke. Ganz allein. Etwas muß ich tun. Bloß nicht abwarten . . .
Gut, denkt er und langt in die Tasche, reißt eine Zigarette heraus, hält nicht einmal die Hand vor das brennende Streichholz. So, überlegt Jonas, da habt ihr’s!
Scheiß’ auf eure Verbote!
Unteroffizier Dörner hebt den Arm und sagt zischend:
„Fertigmachen . . .!“
*
Wie Leutnant Pflug den Weg zur Biebrza-Brücke bei Lipsk schaffte, weiß er jetzt selbst nicht mehr. Er lief quer durch den sowjetischen Hexenkessel nach der militärischen Binsenweisheit, daß der geradeste Weg der kürzeste sei. Er wußte, daß er keine Chance hatte. Nur wer so verzweifelt ist, daß er alle Hemmungen beiseite lassen muß, konnte durchkommen.
Der junge Offizier ging voraus. Sack und Freudenreich folgten ihm wie demütige Schatten. In fast regelmäßigen Abständen machte der polnische Führer schlapp. Ein Tritt in den Hintern half ihm immer wieder auf die Beine.
Und dann die Russen. Vorne, hinten, links, rechts. Die Hölle war ausgebrochen und tobte los. Und gerade das kam Pflug zu Hilfe. Die Iwans jagten einander selbst. Jeder hielt jeden für verdächtig, ein deutscher Saboteur zu sein. Einmal beschossen sich zwei Einheiten, dann wieder wurden die vier verfolgt, torkelten, taumelten, stolperten mit stechenden Lungen vorwärts, fielen, standen auf, rissen sich mit. Der 20 Kilometer lange Weg durch das feindliche Hinterland zahlte die endlose Strecke mit Blasen an den Füßen heim.
Sechs Kilometer vor dem Ziel blieb es auf einmal ruhig. Unheimlich ruhig. Der russische Sperrkreis, in dem die Deutschen vermutet wurden, lag hinter ihnen. Leutnant Pflug, der Mann ohne Nerven, begriff es sofort und feixte. Er war aus dem Holz geschnitzt, das der Krieg sich wünschte.
Jetzt liegt er in einer Böschung und sucht mit dem Glas die Nacht ab. Im Osten zeigt sich der Anflug des ersten Silberstreifens. Wenn er voll am Himmel steht, geht es los. Das Unternehmen Barbarossa. Der Feldzug gegen Rußland. Der Sturm in den Fall. Nie in der Militärgeschichte sollte eine größere Niederlage mit einem rasanteren Vormarsch beginnen.
„Gut“, sagte Pflug zu seinen Leuten in einem Tonfall, als ob er sich selbst auf die Schulter klopfen wollte.
Vor ihm liegt die Brücke. Unbesetzt. Was ist doch der Iwan für ein kläglicher Soldat? Was verstehen die überhaupt vom Krieg? Lächerlich, daß wir so viel Aufhebens von ihm machen . . .
Er geht aufrecht. Sein Kreuz betrachtet es als Wohltat. Dekkung überflüssig.
„Raucherlaubnis“, sagt der Leutnant grinsend.
So trotten sie beinahe behaglich auf die Brücke zu, Pflug fast ein wenig enttäuscht, daß alles so glatt abging. Und dann lacht er schallend. Hundert Meter links der Brücke, genau in der richtigen Schußdistanz, findet er ausgebaute Schützenlöcher.
„Herrlich, Kinder!“ ruft er den dreien zu, „die Kerle haben hier gespielt, was wir machen werden . . .“
„Na, wenn das nichts ist!“ erwidert Freß-Sack.
Freudenreich springt in ein Loch.
„Sicher wie in Abrahams Schoß“, konstatiert er.
Zwei Uhr dreißig. In einer halben Stunde ist es so weit. Auf polnischem Gebiet, wo die Russen so wenig etwas zu suchen haben wie die Deutschen. Die Demarkationslinie zieht sich wie eine Narbe durch das östliche Land. Als die deutsche Wehrmacht Polen überrannt hatte, schnitten sich die Sowjets ebenfalls eine ordentliche Scheibe von der Beute ab.
Und in 34 Minuten geht der Ost-Krieg los.
„Das kriegt ihr nicht alle Tage!“ ruft Leutnant Pflug begeistert, „daß euch der Feind noch die Deckung buddelt.“
„Denen sollte man das Kriegsverdienstkreuz verleihen“, erwidert Freß-Sack und kramt eine Taschenflasche Schnaps hervor.
„Zielwasser gefällig, Herr Leutnant?“
„Lassen Sie sich noch einmal erwischen!“ antwortet Pflug und greift nach der Flasche.
Er sieht den Polen mit belämmertem Gesicht herumstehen.
„Los!“ sagt er und deutet auf ein Deckungsloch, „hier ist noch ’ne Wohnung frei.“
Er sieht auf die Uhr. Noch 19 Minuten.
Hoffentlich verpennen die da hinten nicht den Angriff . . . So reißen sie Witze und lachen herzhaft. Der vorrückende Uhrzeiger stärkt ihnen das Rückgrat. Gleich kommen die anderen und hau’n sie heraus. Mit Panzern, Stukas, Tieffliegern. Mit allem, was die Wehrmacht aufzubieten hat.
Plötzlich bricht das Gespräch jäh ab. Sie hören Stimmen, Kommandos, sehen Schatten am jenseitigen Ufer des Biebrza-Flusses, so nahe, daß Leutnant Pflug sein Glas nicht braucht.
Er starrt ihnen gespannt entgegen. Russen. Pioniere wahrscheinlich. Aber, was schleppen die denn mit sich herum? Der Leutnant erkennt es und lacht lautlos in sein Deckungsloch. Strohballen, Benzinkanister. Sie wollen die Brücke nicht sprengen, sondern anzünden, wenn es soweit ist. Vorsintflutlich!
Pflug stößt Freß-Sack lächelnd in die Seite.
Wie im Dreißigjährigen Krieg . . . überlegt er belustigt. Nur zur Probe legt er auf einen sowjetischen Unterführer an.
Na warte, alter Schwede . . .
*
Die Waffe der Division Brandenburg war die Tarnung; sie gab ihr die Form, die Härte, die Stoßkraft, den Sieg und häufig auch den Untergang. Kein Völkerrecht schützte die verwegenen Einzelkämpfer, wenn sie in der Uniform des Feindes, im Rücken des Feindes, operierten.
Anfänglich hatte Admiral Canaris, der Chef der Abwehr, starke Bedenken gegen diese Art des Krieges zwischen den Fronten. Erst später, als die Engländer und Amerikaner „Kommandotruppen“ einsetzten, die in deutscher Uniform hinter den deutschen Linien Verwirrung stifteten – ihr bekanntestes Unternehmen war der mißglückte Handstreich auf Generalfeldmarschall Rommel –, war auch Canaris mit dieser tödlichen Tarnung einverstanden.
Trotz mancher Ähnlichkeit ihres Einsatzes betrachteten sich die Brandenburger niemals als Spione und Saboteure, sondern galten als eine reguläre Truppenformation mit Spezialauftrag, wie die „Rangers“ der US-Armee unter Generalmajor Donovan, wie die „Service Air Spezial“-Regimenter de Gaulles oder die britischen „Commandos“, geführt von Lord Louis Mountbatten. Am 18. Dezember 1942 gab Hitler selbst einen Kommando-Erlaß heraus, wonach Angehörige dieser feindlichen Truppen, selbst wenn sie Uniform trugen, zu erschießen waren. Bei Brandenburg lehnte man diesen Befehl ab, weil man sich darüber im klaren war, daß er zwangsläufig zur Vergeltung führen mußte. Diese Vorgänge hat Abwehrgeneral Erwin von Lahousen als Zeuge im Nürnberger Prozeß bestätigt.
Die Leute von Brandenburg sollten die Feinduniform nur bei der Annäherung an das Einsatzziel tragen und sie abwerfen, bevor es zu Kampfhandlungen kam. So jedenfalls entwickelte sich diese Form des Krieges am grünen Tisch der Abwehr.
Die Wirklichkeit sah anders aus. Ganz anders. Wenn der Feind sie erkannt hatte, dann schoß er auch schon, und die todesmutigen Stoßtrupps mußten das Feuer unverzüglich erwidern. Schließlich drohte ihnen bei der Gefangennahme der Tod in der schimpflichsten und scheußlichsten Form: durch den Strick.
Die Haager Landkriegsordnung erlaubte es durchaus; nur deutlich gekennzeichneten Soldaten konnte sie Schutz gewähren, der allerdings an der Ostfront von beiden Seiten oft nicht sehr genau genommen wurde.
Der kriegsrechtliche Status der Kommandotruppen ist bis heute umstritten. Einen Präzedenzfall schuf allerdings das amerikanische Militärgericht im Rahmen der Dachauer Prozesse, als es Skorzeny freisprach. Das Gericht folgte damit der Argumentation der deutschen Verteidiger, daß man bei einer Verurteilung dann ebenfalls englische und amerikanische Soldaten, die in Kommandotruppen gedient hatten, unter Anklage stellen müsse. Der im Frieden ausgesprochene Freispruch kam allerdings für Hunderte von Brandenburgern zu spät, die im Krieg in Feindesland gefallen waren und seitdem in den deutschen Listen als vermißt geführt werden.