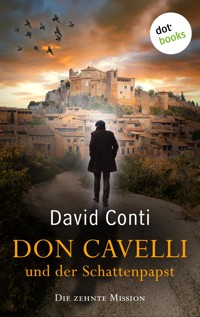5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Wird vielleicht ein Mörder das mächtigste Amt der Welt erlangen? Der Vatikanthriller »Don Cavelli und der Atem Gottes« von David Conti als eBook bei dotbooks. Er soll unfehlbar und unantastbar sein – doch was, wenn der Mann, der zum nächsten Papst gewählt werden könnte, Blut an den Händen hat? Der Vatikanexperte Don Cavelli fühlt sich ins finstere Mittelalter zurückversetzt, als er von dem Gerücht hört, dass sich unter drei bekannten Kardinälen einer befinden soll, der sich sein Amt durch Mord erschlichen hat … und einer von ihnen könnte nun der neue Papst werden. Einzig Cavelli, der im Vatikan frei ein- und ausgeht, kann sich auf die brisante Suche nach der Wahrheit machen, ohne einen Riesenskandal heraufzubeschwören. Die Spuren führen ihn zum Circolo della Caccia, einem exklusiven Club der Reichsten und Mächtigsten. Zugang kann ihm hier nur Elisabetta Farnese beschaffen, die letzte Nachfahrin des skandalumwitterten Adelsgeschlechts. Doch die Abgründe, die sich bald vor ihnen auftun, übertreffen alles, was sie für möglich gehalten hätten ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der actionreiche Vatikankrimi »Don Cavelli und der Atem Gottes« von David Conti ist der neunte Band seiner Bestsellerreihe um den Vatikandetektiv wider Willen, in der alle Krimis unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er soll unfehlbar und unantastbar sein – doch was, wenn der Mann, der zum nächsten Papst gewählt werden könnte, Blut an den Händen hat? Der Vatikanexperte Don Cavelli fühlt sich ins finstere Mittelalter zurückversetzt, als er von dem Gerücht hört, dass sich unter drei bekannten Kardinälen einer befinden soll, der sich sein Amt durch Mord erschlichen hat … und einer von ihnen könnte nun der neue Papst werden. Einzig Cavelli, der im Vatikan frei ein- und ausgeht, kann sich auf die brisante Suche nach der Wahrheit machen, ohne einen Riesenskandal heraufzubeschwören. Die Spuren führen ihn zum Circolo della Caccia, einem exklusiven Club der Reichsten und Mächtigsten. Zugang kann ihm hier nur Elisabetta Farnese beschaffen, die letzte Nachfahrin des skandalumwitterten Adelsgeschlechts. Doch die Abgründe, die sich bald vor ihnen auftun, übertreffen alles, was sie für möglich gehalten hätten ...
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erscheinen bei dotbooks:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«
»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«
»Don Cavelli und die Töchter Marias – Die achte Mission«
»Don Cavelli und der Atem Gottes – Die neunte Mission«
Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Weitere Bände sowie Hörbuchausgaben sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-973-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 9«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der Atem Gottes
Die neunte Mission
dotbooks.
GODISNOWHERE
Schild vor einer Kirche in Newton, USA
Prolog
Phantominseln.
Schon als Kind war er von diesem Wort fasziniert gewesen, doch waren diese nicht, wie man annehmen könnte, der Phantasie eines Kinderbuchautors entsprungen. Es gab sie wirklich – und auch wieder nicht ... Jedenfalls war es ein Begriff, den man in jedem seriösen Konversationslexikon finden konnte. Neunundneunzig gab es davon und sie trugen seltsame Namen wie Alligatorinsel, Krusensternriff, Fata-Morgana-Land, Dämoneninseln, Snakes-Island oder Undine-Felsen. Wohlige Schauer überfielen ihn bei der Vorstellung, dass der Teufel als Reaktion auf die Existenz der Phantominsel Antilia, die westlich der Azoren im Atlantik lag und auf der – so behauptete zumindest die Legende – sieben Bischöfe sieben goldene Städte gegründet hatten, die unter dem besonderen Schutz Gottes standen, nördlich davon als Gegenpol eine weitere Insel namens Satanazes geschaffen hatte. Es hieß, dass, wann immer sich dieser Insel ein Schiff näherte, eine riesige Dämonenhand die Seeleute vom Deck pflückte und auf immer verschwinden ließ.
Natürlich waren diese – und die zahllosen anderen –Gruselgeschichten, die sich um die Phantominseln rankten, Unsinn. Ihren furchterregenden Namen verdankten sie in erster Linie dem Umstand, dass sie weder existierten noch je existiert hatten. Ihr angebliches Vorhandensein beruhte auf Navigationsfehlern von Seeleuten, die sich aufgrund unsichtbarer Meeresströmungen oder bis ins achtzehnte Jahrhundert existierender Kompassabweichungen, ohne es zu merken, verfahren hatten, auf Seemannsgarn und auf optischen Täuschungen.
Die Tatsache, dass sie dennoch im Lexikon und (zum Teil bis heute) auf Seekarten verzeichnet waren, ließ ihn einfach nicht los.
In zahllosen schlaflosen Nächten grübelte er darüber nach, wie es möglich war, etwas Nichtexistentes so darzustellen, dass es für den Rest der Welt völlig real war.
Erstes Buch
I
Erster Tag
Es war einer dieser seltenen Tage, an denen Professor Cavelli sich nicht für seinen eigenen Lehrstoff begeistern konnte. Nicht schon wieder. Sein Fach, die Geschichte des Papsttums, das er zwei Tage pro Woche an der ehrwürdige Sapienza, der ältesten Universität von Rom, unterrichtete, war ungeheuer vielfältig und er versuchte, es für sich selbst interessant zu halten, indem er jedes Jahr andere Schwerpunkte setzte, aber das war eben nur begrenzt möglich; bestimmte Essentials mussten einfach vermittelt werden. Heute ging es um Papst Paul III., eine schillernde Persönlichkeit, die einerseits schamlosen Nepotismus betrieben hatte, andererseits aber auch Michelangelo zum Baumeister des Petersdoms bestimmte und bereits im Jahr 1537 die Bulle Sublimis Deus erließ, mit der er die Versklavung der amerikanischen Ureinwohner und aller anderen Menschen verbot.
Im Gegensatz zu Theologieseminaren saßen in den Cavelli-Kursen nur wenige gläubige Studenten, sondern auch viele Agnostiker und Atheisten, die sich nur eingeschrieben hatten, weil sie sich davon einen gewissen Unterhaltungswert versprachen. Die Cavelli-Dynastie, deren letzter Abkömmling Professore Don Cavelli war, ließ sich bis zu Capitano Umberto Cavelli zurückverfolgen. Im Jahre 1513 hatte Papst Julius II. »in tiefer Dankbarkeit« eine Urkunde ausstellen lassen, die verfügte, dass Umberto sowie alle seine Nachfahren bis zum Tag des Jüngsten Gerichts »liberatus ab ullis calamitatibus« – also »frei von allen Nöten« – zu stellen seien. Damit verbunden war das Wohnrecht im Vatikan, fast unbeschränkter Zugang zu allen Räumlichkeiten sowie zahlreiche weitere Privilegien. Nicht zu vergessen eine märchenhafte Menge Goldes, die im Laufe der Jahrhunderte durch Zins und Zinseszins zu einem noch gewaltigeren Vermögen herangewachsen war und die sicherstellte, dass Cavelli niemals Geldsorgen haben würde.
Was der Capitano für Julius II. getan hatte, um eine solche Gnade zu verdienen, darüber waren sich die Historiker uneins, aber da dieser Papst auch unter dem Namen il terribile berühmt und dafür berüchtigt war, stets einen dicken Knüppel mit sich zu führen, um auf jeden einzuschlagen, der es wagte, ihn zu verärgern, und der sich auf Gemälden lieber mit einem Schwert als einer Bibel verewigen ließ, war stark davon auszugehen, dass dabei nicht eben wenig Blut geflossen war.
Der heutige Cavelli hatte kein schlechtes Gewissen deswegen, die Geschichte lag über ein halbes Jahrtausend zurück, aber für viele Studenten war er nun mal ein direkter Nachfahre des Capitanos, von dem man sich saftige Insidereinblicke hinter die geheimnisumwitterten Mauern des Vatikan erwartete. Gelegentlich ließ Cavelli tatsächlich Informationen einfließen, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich waren, doch die echten Geheimnisse behielt er diskret für sich. Obwohl sein Katholizismus eher von der stark gemäßigten Sorte war, betrachtete er den Vatikan als sein Heimatland und wahrte nach außen eine strikte Loyalität. Es gab innerhalb des Vatikan auch so schon zu viele, die ihn, den einzigen Vatikanbürger, der dort kein Amt bekleidete und – schlimmer noch – keinerlei Weisungen unterlag, lieber heute als morgen vor die Tür gesetzt hätten. Cavelli wusste, dass eine Päpstliche Entscheidung, auch wenn sie über fünfhundert Jahre zurücklag, nicht angefochten werden konnte, da dies eine unkontrollierbare Kettenreaktion hätte in Gang setzen können, bei der plötzlich auch die Befehlsgewalt des amtierenden Papstes zur Debatte gestanden hätte, aber er hielt es für klüger, nicht unnötig Staub aufzuwirbeln, und genoss das Leben in seiner riesigen Wohnung in einem Palazzo mit herrlichem Blick über die Vatikanischen Gärten.
Heute war wieder eine dieser Stunden, in der einige Studenten, die sein Seminar mit einem Theologiekurs verwechselten, meinten, ihn durch blasphemische Äußerungen schockieren zu können. Das Repertoire war gewaltig. Cavelli kannte es komplett. Immer wieder beliebt war beispielsweise ein Spruch, der, soweit Cavelli informiert war, von dem amerikanischen Filmregisseur John Waters stammte und der da lautete: »Gott sei Dank bin ich katholisch erzogen, so wird Sex immer dreckig bleiben«. Gern verwies man auch auf die weltweit sehr populären Witze über den mäßig begabten Schauspieler Chuck Norris, welche ihn mit Scherzen wie »Wie viele Liegestütze kann Chuck Norris?Alle.« oder »Wenn Chuck Norris ins Wasser springt, wird er nicht nass; das Wasser wird Chuck Norris« als übermenschliches Wesen darstellten, und behauptete, dass wenn Archäologen diese Witze in tausend Jahren entdeckten, sie Norris ebenfalls für eine jesusgleiche Figur halten würden.
Mehr wissenschaftlich orientierte Seminarteilnehmer wiesen darauf hin, dass man anhand von Textstellen der Bibel die exakte Temperatur der Hölle (445 Grad) und des Himmels (525 Grad) berechnen könne, womit bewiesen sei, dass der Himmel heißer ist als die Hölle, oder auch darauf, dass die Strecke von Kairo nach Jerusalem gerade einmal siebenhundertfünfundzwanzig Kilometer betrug, was darauf schließen ließ, dass Moses‘ vierzigjährige Reise durch die Wüste entweder die Unzuverlässigkeit der Bibel oder einen katastrophalen Orientierungssinn Moses’ belegte.
Dann waren da ausführliche Diskussionen zum Thema des fliegenden Spaghettimonsters, einer von dem Autor Bobby Henderson erschaffenen und in einigen Ländern offiziell anerkannten parodistischen Religion, die weltweit immer mehr Anhänger gewann, welche sich Pastafaris nannten, und die damit argumentierte, dass ebenso wie kein Katholik beweisen könne, dass die Erde von Gott erschaffen sei, die Kirche aber dennoch daran glaube, auch niemand beweise könne, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghettimonsters sei, womit diese beiden Religionen als gleichwertig zu betrachten seien. Die englischsprachige Blogseite Boing Boing hatte sogar für jeden, der das Gegenteil beweisen könne, eine Summe von einer Million Dollar ausgelobt und bislang hatte noch niemand versucht, dieses Geld zu kassieren. Wiewohl das Ganze eindeutig keine echte Religion war, schätzte sich Cavelli froh, kein Theologe zu sein, der diese Argumente entkräften musste. Er hätte nicht gewusst, wie.
Den Vogel in diesem Semester hatte aber ein Student abgeschossen, der sich bei der Universal Life Church gegen eine geringe Gebühr und ohne jede Vorkenntnisse online zum Priester hatte weihen lassen (was ihn in einigen amerikanischen Bundesstaaten tatsächlich berechtigte, rechtsgültige Trauungen zu vollziehen) und der nun darauf bestand, als Hochwürden angesprochen zu werden.
Die Studenten waren immer etwas enttäuscht, wenn sie merkten, dass sie Cavelli so nicht provozieren konnten. Ja, es gab Tage, an denen ihm, auch wenn er es nicht zugab, solche Ablenkungen sehr recht waren. Heute war so ein Tag.
II
1946
In seinem späteren Leben nahmen viele, die ihn kennenlernten, ganz selbstverständlich an, dass er aus einem katholischen Elternhaus stammte und man ihn deshalb wie unzählige andere Jungen nach dem Mann der Jungfrau Maria benannt hatte.
József.
Ein naheliegender Gedanke, dennoch hätte er kaum falscher sein können. Tatsächlich war er, wie unzählige andere Jungen in einem gewissen Teil der Welt, nach dem von der Propaganda so genannten Größten aller Menschen benannt worden, dem Generalissimo und unumschränkten Herrscher über die Sowjetunion: Jossif Wissarinonowitsch Dschugaschwili, besser bekannt als Josef Stalin; dem Stalin, der für den Tod von über zwanzig Millionen Menschen verantwortlich war, der von seiner Mutter gegen seinen Willen ins Priesterseminar geschickt worden war und der später Kirchen sprengen, kirchliche Besitztümer beschlagnahmen und tausende Priester, Nonnen und Mönche ermorden ließ.
Józsefs Eltern lebten nicht in Russland, nicht einmal in der Sowjetunion, sondern in Ungarn, das seit dem April 1945 vollständig von der Roten Armee besetzt worden war, und natürlich waren sie spätestens seitdem, genau wie die Menschen der Sowjetunion, glühende Atheisten – wenn man einmal von der religiösen Verehrung absah, die man Stalin entgegenzubringen hatte, wenn einem sein Leben lieb war.
Sie waren arme Bauern und József war von klein auf daran gewöhnt, mitzuarbeiten. Eine normale Kindheit hatte er nicht. Sein einziges Vergnügen bestand darin, mit dem Ackergaul der Familie durch die endlosen Weiten der Puszta zu traben. Dies waren Momente des ungetrübten Glücks. Mit sechs wurde er eingeschult und es war nicht leicht für die Eltern, das Geld aufzubringen, um ihren einzigen Sohn in die sieben Kilometer entfernte Schule in Debrecen zu schicken. Obwohl sie keine besondere Bildung besaßen, bemerkten seine Lehrer bald zwei Dinge. Erstens, dass er für ein Kind in seinem Alter eine fast schon beängstigende Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit an den Tag legte, und zweitens, dass er weitaus intelligenter war als seine Mitschüler. Besonders die Sprachen und der Geschichtsunterricht hatten es ihm angetan, auch wenn letzterer natürlich streng nach sowjetischer Doktrin ablief. Über das Christentum hörte er nur Schlechtes und jeden Morgen legte er gemeinsam mit seinen Mitschülern unter Anleitung der Lehrerin mit dem strengen Haarknoten sein Treuebekenntnis zu Stalin ab, der von dem Bild über der Tafel gütig auf sie hinabblickte.
Er war nicht getauft, glaubte nicht an Gott und war kein Katholik.
Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass József je Papst werden würde, lag bei null Prozent.
III
Erster Tag
Kardinalpräfekt Malaparte stand am offenen Fenster seines riesigen Amtszimmers im Governatoratspalast, blickte in die Vatikanischen Gärten hinab, genoss den Duft der Pflanzen und sah eine Weile lang einem der vielen Gärtner zu, der mit einem Gartenschlauch eine Palme wässerte. War das Gras grüner als gestern? Waren die als riesiges Siegel des Papstes angepflanzten Blumen bunter? Es kam ihm beinahe so vor. Oder rührte dieser Eindruck von der Nachricht her, die er soeben erhalten hatte, dass er so empfand? Die Nachricht hatte es in sich: Die morgige Generalaudienz auf dem Petersplatz würde nicht stattfinden. Als offizieller Grund war eine Erkältung des Heiligen Vaters angegeben worden, die er auf Anweisung seines Arztes zunächst vollständig auskurieren solle. Ein abschätziges Lächeln umspielte Kardinal Malapartes Lippen. Er schloss das Fenster und setzte sich an seinen über hundert Jahren alten und mit Aktenstapeln überladenen Schreibtisch.
»Erkältung.«
Das konnte vieles bedeuten. Eine ganze Reihe von Krankheiten und Gebrechen von mittelschwer bis lebensbedrohlich. Obwohl im Vatikan inzwischen im Umgang mit der Presse etwas mehr Offenheit eingezogen war, verfiel man doch jedes Mal sofort wieder in alte Sprachregelungen, wenn es um die Gesundheit und die Handlungsfähigkeit des Papstes ging. »Erkältung« war das magische Allzweckwort, das von jeher benutzt wurde, und es sagte nicht das Geringste über dessen tatsächlichen Gesundheitszustand aus. Insider jedoch konnten diesen aus einem ganz anderen Umstand ableiten, nämlich anhand der Wichtigkeit der Termine, die man ausfallen ließ, und die wöchentliche Generalaudienz vor im Schnitt fünfunddreißigtausend Gläubigen, von denen viele nur deshalb aus aller Welt angereist waren, stand auf der Liste der wichtigen Termine sehr weit oben. Auch Johannes Paul II. hatte damals einige Generalaudienzen abgesagt, als hinter den Kulissen längst jedem klar war, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis Gott ihn zu sich rufen würde.
Kardinal Malaparte legte den Kopf zurück und sah nachdenklich zu der mit Stuck verzierten Decke seines Büros.
War es nun erneut soweit?
War nun wieder ein Papst der Ewigkeit nahe?
Würde wieder das eintreten, was nach vatikanischem Verständnis als unvorstellbare Katastrophe galt, aber nur der normale Lauf der Welt war?
Malaparte grinste boshaft, als er daran dachte, welchen Schrecken der Tod eines Papstes bis 1978 bei den Kardinälen ausgelöst hatte, die er kreiert hatte. Sie waren es nämlich, die für sämtliche Kosten seines Begräbnisses aufzukommen hatten. Doch diese schikanöse Regel war zum Glück inzwischen abgeschafft worden. Man würde ihn nicht zur Kasse bitten.
Kardinal Malaparte war Ende sechzig. Also nach vatikanischen Maßstäben im besten Alter. Als Kardinalpräfekt für das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen war er in der Kurie für die Ökumene zuständig. Es war ein wichtiges und hochgeachtetes Amt, aber er hatte sich nie danach gedrängt – um es diplomatisch zu formulieren. Er war gerne bereit, alle nichtkatholischen Christen mit offenen Armen zu empfangen, wenn sie vorhatten, ihrem Irrglauben abzuschwören und zum Katholizismus zu konvertieren, aber jeden Kontakt mit ihnen, der darüber hinausging, empfand er als sinnlos. Dennoch hatte er sich nie beklagt und seine Arbeit gewissenhaft und ganz im Sinne des Heiligen Vaters ausgeführt. Doch wer sagte, dass dies schon das Ende seiner Karriere sein musste? Sollte der Papst tatsächlich bald sterben, würde es ein neues Konklave geben – viel früher, als die meisten erwartet hatten – und dann war so manches möglich.
Malaparte wusste, dass er absolut papabile war; er war ein geschickter Organisator und seine Arbeit für die Ökumene wies ihn qua Amt geradezu als jemanden aus, der befähigt war, zu moderieren und unterschiedliche Positionen zusammenzuführen. Skandale irgendwelcher Art hatte es bei ihm nie gegeben. Gute Voraussetzungen für einen Papst. Im Übrigen war er Mitglied der Kurie und deren Mitglieder setzten sich bei allen Treffen in Rom am Ende immer gegen die Kleriker durch, die aus dem Rest der Welt stammten, denn die mussten irgendwann wieder nach Hause. Last but not least war er groß, mit dichtem weißem Haar, kantigem Kinn, einer kräftigen Patriziernase und fast schon hypnotisch leuchtenden blauen Augen. Er sah genauso aus wie jemand, mit dem man in einem Hollywoodfilm die Rolle des Papstes besetzen würde.
Ihm schwindelte fast, wenn er sich vorstellte, sein geheimes Herzensprojekt nicht mehr im Verborgenen, sondern ganz offiziell und im großen Maßstab zu betreiben. Der Abfall Englands von der Katholischen Kirche unter König Heinrich VIII. war bis heute ein nie erwähnter, aber dennoch schmerzhaft empfundener Stachel im Fleisch des Vatikan, doch kein Papst hatte seither gewagt, daran zu rühren. Doch die Zeiten hatten sich geändert, die Aussichten hatten sich wesentlich verbessert. König Charles III. hatte bekannt gegeben, dass er seinen Titel »Verteidiger des Glaubens« nicht mehr allein auf die anglikanische Kirche bezog, sondern auf alle Religionen. Eine ungeheuerliche Aussage für das Oberhaupt einer Religion. Zudem liefen in England der Anglikanischen Kirche die Gläubigen in atemberaubendem Tempo davon, während gleichzeitig viele Katholiken aus Osteuropa und Afrika einwanderten. Katholiken, die es mit ihrem Glauben wirklich ernst meinten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die katholische Minderheit unter den britischen Christen in die Mehrheit verwandelt haben würde. Nach ziemlich genau einem halben Jahrtausend bestand nun die ernsthafte Chance, den englischen Irrweg zu beenden und die verlorenen Schäfchen in die Arme Roms zurückzuholen.
Doch noch war es nicht soweit. Es würde das erste Konklave sein, an dem er teilnahm, und wer weiß, vielleicht auch sein letztes. Somit war es höchst ungewiss, ob er noch einmal eine zweite Chance erhalten würde. Jetzt hieß es Hic Rhodos, hic salta. Jetzt musste er zeigen, dass er das Zeug dazu hatte. Er würde sich klug vorbereiten und alle Hindernisse geduldig und Schritt für Schritt aus dem Weg räumen müssen.
Eine innere Unruhe überfiel ihn, als er daran dachte, dass es tatsächlich geschehen konnte. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit einem inzwischen verstorbenen Kardinal, der ihm unter Missachtung des heiligen Schwurs, absolutes und ewiges Schweigen über das Konklave zu bewahren, davon erzählte, wie es sich angefühlt hatte, als während des zweiten Wahlganges zahlreiche Stimmen auf ihn entfallen waren und für einige köstliche Momente die absolut realistische Möglichkeit bestanden hatte, der nächste Papst zu werden. Malaparte erinnerte sich noch an seine genauen Worte: »Ich habe den Atem Gottes gespürt.«
IV
Erster Tag
»Ehre Gruß und Segen euch, die ihr den Mond erobert habt, das bleiche Licht unserer Nächte und unserer Träume«, hallte die Stimme des Sprechers von der halbrunden Kuppel zurück. »Bringt dem Mond mit unserer lebhaften Teilnahme die Stimme des Geistes, den Hymnus für Gott, unseren Schöpfer und Vater.«
Professore Grandi S. J., der Direktor der Sternwarte von Castelgandolfo hielt kurz inne und sah ins Publikum. Dann rückte er seine Lesebrille, die ihm zum wiederholten Male von der spitzen Nase zu rutschen drohte, zurecht und fuhr in seinem Vortrag fort. »Dies waren die Worte, die seine Heiligkeit Paul VI., der sich bekanntlich sehr für die Erforschung des Weltalls interessierte, der Crew der Apollo 11 nach ihrer Landung auf dem Mond per Funk übermitteln ließ. Leider ist hingegen nicht überliefert, wie er kurz darauf bei einem Ad-limina-Besuch reagierte, als sich ein Besucher aus den USA mit folgenden Worten vorstellte: ›Ich bin der Bischof des Mondes.‹«
Die Zuschauer, die sich an diesem warmen Sommerabend in eine der beiden Kuppeln der Sternwarte von Castelgandolfo eingefunden hatten, lachten amüsiert.
Direttore Grandi schmunzelte selbstzufrieden und fuhr in seinem Vortrag fort: »Natürlich können Sie sich vorstellen, wie überrascht Paul VI. war. Zunächst glaubte er an einen Scherz. Doch es war keiner. Bischof William Borders vertrat die jüngste Diözese in den USA: Orlando, auf deren Gebiet sich auch die Raketenstation Cape Canaveral befand, von wo aus Apollo 11 zum Mond aufgebrochen war. Es sei eine alte kirchenrechtliche Tradition – so legte er dar – dass neu entdecktes Land von dem Ort verwaltet würde, an dem die Expedition ihren Ausgang genommen hatte. Schließlich unterstanden die von Kolumbus entdeckten Gebiete ebenfalls lange Zeit der Diözese Sevilla, von der aus er losgesegelt war. Eine verständliche Schlussfolgerung also, könnte man meinen, dennoch eine falsche, oder zumindest kam dieser Bischof zwei Jahre zu spät, denn seit 1967 war für Gebiete ›an denen die Heilige Hierarchie noch nicht konstituiert ist‹ die Kongregation für die Evangelisierung der Völker zuständig und somit der Vatikan, doch der –« Grandi verzog den Mund zu einem schelmischen Grinsen, »hat bislang immer noch keinen Anspruch auf den Mond erhoben.«
Wieder lachten einige.
»Was allerdings nur wenige wissen, ist, dass der Astronaut Buzz Aldrin in dem wenigen persönlichen Gepäck, das ihm gestattet war, sicher in Plastik verpackt, Brot und Wein mit sich führte – beides hatte ihm sein Pastor mitgegeben – und dass er – direkt, bevor er und Neil Armstrong den Mond betraten – für die Mondmission betete und ein kurzes Abendmahl feierte, bei dem er aus dem Johannes-Evangelium las. Es war die erste Mahlzeit, die jemals auf dem Mond stattfand. In seiner Autobiographie schrieb Aldrin später: ›Ich konnte mir damals keinen besseren Weg vorstellen, um die Größe der Erfahrung der Apollo-11-Mission zu zeigen, als Gott zu danken. Ich habe gehofft, dass die Menschheit sieht, dass über kleine technische Errungenschaften hinaus eine tiefere Bedeutung in der Mondlandung liegt. Eine große Herausforderung, das menschliche Bedürfnis, zu entdecken, was über uns ist, was unter uns ist, was da draußen ist.‹«
Direktor Grandi blickte von seinem Redemanuskript auf. »Dieses menschliche Bedürfnis besteht seit Anbeginn der Menschheit und wird auch auf ewig weiterbestehen. Die Katholische Kirche hat in der Astronomie – ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung – übrigens nie die Ansicht vertreten, dass die Erde flach sei, sondern hat in dieser Forschungsrichtung schon immer eine Führungsrolle übernommen. Schon im fünften Jahrhundert bezeichnete der Kirchenvater Augustinus die Erde als eine kugelförmige Masse, Hildegard von Bingen nannte sie im zwölften Jahrhundert eine ›sandige Erdkugel‹ und Thomas Aquin schrieb im dreizehnten Jahrhundert in seinem Buch Summa Theologica ›Der Astrologe beweist durch Sonnen- und Mondfinsternis, dass die Erde rund ist.‹ Ich könnte noch zahllose weitere Beispiele anführen, aber das würde den ganzen Abend dauern. Tatsache ist, dass die Katholische Kirche von der Spätantike bis zur Aufklärung mehr Geld in das Studium der Astronomie gesteckt hat als alle anderen Organisationen auf dem Planeten zusammengenommen. Wir hier in Castelgandolfo fühlen uns der noblen Tradition des Wissen-wollens verpflichtet und sie ist auch der Grund für die Arbeit, die wir hier tun. Da dies eine Vatikanische Sternwarte ist, forschen hier nicht nur Wissenschaftler, sondern zuweilen beehren uns auch hohe Kirchenmänner mit ihrem Besuch und nicht selten habe ich das Gefühl, dass sie, wenn sie durch unsere Teleskope sehen, enttäuscht sind, dass sie nicht das Antlitz Gottes entdecken können. Aber ich denke, sie irren sich, denn genau das ist es, was wir dort sehen. Man muss es nur verstehen wollen. Aber wie sagten schon vor Jahrtausenden die Chinesen: ›Wenn der Weise auf den Mond zeigt, sieht der Narr nur den Finger.‹«
Applaus brandete auf. Der vierzigminütige, hochinformative und zugleich amüsante Vortrag war ein voller Erfolg gewesen. Nun strömten die meisten der Anwesenden zu dem Buffet, das man am Rand aufgebaut hatte und wo Sekt und Orangensaft sowie Kanapees mit Lachs oder Frischkäse sie erwarteten. Auch Cavelli bediente sich, wobei er den Sekt verschmähte, da er nie Alkohol trank, wenn er noch Autofahren musste. Ihm hatte der Vortrag gefallen, obwohl er sich immer noch fragte, warum man ihn eigentlich eingeladen hatte. Bei den übrigen Zuhörern handelte es sich – soweit er das einschätzen konnte – hauptsächlich um wohlhabende Persönlichkeiten, welche die astronomische Forschung des Vatikan – mit teilweise ebenfalls astronomischen Summen – förderten. Cavelli gehörte nicht zu den Förderern, so sehr lag ihm das Thema nun auch wieder nicht am Herzen, er wusste über die Sternwarte im Grunde nur, was allgemein bekannt war: Im Jahre 1578 hatte Papst Gregor XIII. im Vatikan den dreiundsiebzig Meter hohen Turm der Winde erbauen lassen, der fortan als erste Sternwarte diente. Hier wurden jene Beobachtungen gemacht, die dazu führten, dass der nach Julius Caesar benannte Julianische Kalender durch den bis heute allgemein gültigen und nach Papst Gregor benannten Gregorianischen Kalender ersetzt wurde, wobei auf sein Geheiß zehn Tage ersatzlos gestrichen wurden und im Jahre 1583 auf den vierten Oktober der fünfzehnte Oktober folgte.
Im achtzehnten Jahrhundert wurde ein höherer und besser ausgestatteter Turm auf dem Palazzo del Collegio Romano errichtet. Hier wurden unter anderem die Grundlagen der Spektralanalyse entwickelt. Da dieses Gebäude außerhalb des Vatikan lag und 1870 mit der Auflösung des Kirchenstaates verloren ging, ließ Papst Leo XIII. in den Vatikanischen Gärten ein neues Observatorium erbauen, das an der internationalen Forschung bei der Erstellung einer fotografischen Himmelskarte mitarbeitete. Wegen der zunehmenden Lichtverschmutzung befahl Pius XI. 1930, die Sternwarte in die Albaner Berge nach Castel Gandolfo zu verlegen, wo sie Teil des dortigen Apostolischen Palastes wurde.
1981 wurde die Forschung auf dem Mount Graham in Arizona fortgesetzt, wo die Vatican Observatory Research Group in Kooperation mit der Universität von Tucson mit den modernsten Gerätschaften arbeitete, während man in Castelgandolfo im Wesentlichen nur noch vor- und nachbereitend tätig war.
Doch wiewohl Cavelli sich nicht erklären konnte, warum man ihn eingeladen hatte – einmal hatte man sogar telefonisch nachgefragt, ob er wirklich kommen würde, was ihm ein wenig seltsam erschienen war – mischte er sich gutgelaunt unter die anderen Besucher, um die stark vergrößerten Weltraumfotos, die man mit den Teleskopen aufgenommen hatte, zu betrachten. Hier wirkte das Weltall noch unschuldig. Man forschte absichtslos, um sein Wissen zu erweitern. Präsident Kennedy hatte vor der ersten Mondlandung gesagt: »Wir tun das nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist.« So wie ein Bergsteiger, der auf einen Berg steigen musste, nur weil er eben da war. Ganz anders als heute. Cavelli hatte erst kürzlich einen Artikel darüber gelesen, dass es den beiden Hauptnationen der Raumfahrt, Amerika und China, inzwischen bei ihren Mondmissionen fast nur noch darum ging, Wege zu finden, die gigantischen Vorkommen an Bodenschätzen wie Eisen, Helium-3 und Titan abzubauen. Er sah natürlich ein, dass dies sinnvoll war, dennoch, die frühere Herangehensweise hatte ihm weit mehr zugesagt. Cavelli wandte sich von den Fotos ab, um diejenigen Raritäten zu betrachten, die normalerweise von der Sternwarte streng unter Verschluss gehalten wurden, aber heute in Glasvitrinen ausgestellt waren: Originalhandschriften von Kopernikus, Newton, Kepler und Galileo sowie Meteoriten und Gesteinsproben vom Mond und vom Mars. Zum Abschluss reihte er sich in die kleine Schlange vor dem riesigen Teleskop ein und blickte schließlich fasziniert ins Weltall.
»Da wird einem wieder einmal bewusst, wie klein wir und unser Planet sind. Ein Staubkorn in der Unendlichkeit.«
Cavelli drehte sich zu der sanften Stimme hinter ihm um. Vor ihm stand lächelnd ein kleiner, leicht rundlicher Kardinal, den er schon des Öfteren im Vatikan gesehen hatte, aber zu mehr als einem freundlichen Nicken im Vorübergehen war es bei beiden bisher nicht gekommen. Cavelli trat etwas beiseite, damit auch andere Gäste an das Teleskop herankonnten. »Das kann man wohl sagen.«
»Vecchi«, stellte sich der Mann im roten Ornat vor und streckte ihm leutselig die Hand entgegen. Sein rundes Gesicht mit dem weißen Haarkranz am Hinterkopf strahlte Wohlwollen aus.
Cavelli lächelte und schüttelte die Hand »Angenehm. Don Ca… »
Kardinal Vecchi hob lachend die Hände. »Ich weiß, wer Sie sind. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus.« Er zwinkerte Cavelli verschwörerisch zu. Dieser war nicht allzu überrascht. Aus irgendeinem ihm nicht verständlichen Grund hatten Kardinäle einen Narren an ihm gefressen. Kardinäle und Nonnen, aber wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen.
Vecchi machte eine ausladende Handbewegung, die den ganzen Raum einschloss. »Faszinierend, nicht wahr? Leider ist das für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich, traurig, aber es würde die Arbeit hier allzu sehr behindern.«
»Absolut«, bestätigte Cavelli. »Ich bin sehr froh, dass man mich eingeladen hat – obwohl ich, ehrlich gesagt, nicht weiß, wie ich zu dieser Ehre komme. Ich kenne hier niemanden.«
Vecchi lächelte etwas unsicher. »Nun, ich fürchte, das haben Sie mir zu verdanken. Ich sitze in der Aufsichtskommission – nicht, dass ich von Astronomie auch nur das Geringste verstünde – aber Sie wissen ja, wie das ist.« Er machte eine vage Handbewegung. »Ich muss gestehen – Asche auf mein Haupt – die Einladung geschah nicht gänzlich ohne Hintergedanken.« Vecchi sah sich in der Kuppel um und warf einen Blick durch die offene Tür. Viele der Gäste waren mittlerweile die kleine Treppe an der Außenwand der Sternwarte hinuntergestiegen und flanierten nun gutgelaunt mit ihren Gläsern in kleinen Grüppchen in der warmen Abendluft auf der Dachterrasse des Apostolischen Palastes herum und genossen im Mondlicht den herrlichen Blick auf den Albaner See unter ihnen. Andere wiederum standen immer noch in der Schlange, um durch das Teleskop zu sehen. Aus irgendeinem Grund schien Vecchi dies zu beunruhigen. Er sah zu Cavelli hinüber. »Hier ist zu viel Trubel. Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir an einen etwas ruhigeren Ort.« Plötzlich hatte er einen Schlüsselbund in der Hand.
Cavelli zögerte und versuchte, sich seine Irritation nicht anmerken zu lassen. »Ähm, sicher, warum nicht?«
Vecchi schien erleichtert. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging schwerfällig in Richtung Ausgang. Möglicherweise hatte er Probleme mit den Hüftgelenken. Cavelli folgte ihm. Sie stiegen die Außentreppe hinab, wandten sich nach links und dann schloss der Kardinal eine Tür im Erdgeschoss der Kuppel auf. Er machte das alles so ohne jedes Aufhebens, dass wohl keiner der auf der Dachterrasse Anwesenden Notiz davon nahm. Sie traten ein und Vecchi zog eilig die Tür zu und schloss noch ab, bevor er den Lichtschalter einer Tischlampe betätigte. Viel heller wurde es dadurch nicht, doch es reichte, um sich orientieren zu können. Es war offenbar ein Arbeitsraum. An zwei Wänden hingen astronomische Karten, eine dritte Wand war mit einer großen Tafel bedeckt, auf der mit Filzstift in verschiedenen Handschriften geschriebene, lange mathematische Formeln standen. Ansonsten befanden sich darin außer einigen metallenen Aktenschränken nur ein großer Tisch, der in der Mitte des quadratischen Zimmers stand und mit Papieren übersät war, und ein paar Stühle. Der ganze Raum roch nach der alkoholischen Farbe der Filzstifte. Eine Geruch, den Cavelli schon immer verabscheut hatte.
Kardinal Vecchi ließ sich schwer atmend auf einen von ihnen plumpsen – die Treppe schien ihn angestrengt zu haben – und wartete, bis sich Cavelli ebenfalls gesetzt hatte. Er lächelte gequält, dann hob er die Hand zum Mund und hüstelte leicht. Eine Verhaltensweise, die für Cavelli so sehr zum Vatikan gehörte wie die Jungfrau Maria. Auf diese Weise pflegte man dort heikle Gespräche einzuleiten. »Zunächst muss ich Sie um Entschuldigung bitten, Professore Cavelli, dass ich Sie gewissermaßen unter einem Vorwand hierhergelockt habe, glauben Sie mir, das ist eine Vorgehensweise, die ich unter normalen Umständen strikt ablehne, ich wusste mir nur in dieser, äh, speziellen