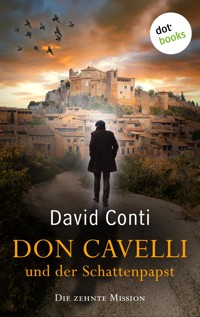Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Der Untergang, den niemand kommen sieht: Der Vatikan-Thriller »Don Cavelli und der letzte Papst« von David Conti jetzt als eBook bei dotbooks. Im Vatikan läuten die Totenglocken: Der Papst ist gestorben, ein neues Konklave muss einberufen werden, die gesamte Welt schaut zu ... Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Ein Kardinal nach dem anderen lehnt die Wahl zum Oberhaupt der Kirche ab. Allmählich machen sich Zweifel breit, ein dunkles Gerücht wird wispernd weitergetragen: es erzählt von Verrat und Verschwörung. Doch die Kardinäle sind während des Konklave von der Außenwelt abgeschnitten – die einzige Hoffnung ruht nun auf dem Geschichtsprofessor Don Cavelli, der neben etlichen Privilegien exklusives Wohnrecht im Vatikan besitzt und als einziger nach Belieben ein und aus gehen kann. Wird es ihm gelingen, die Wahrheit zu entschlüsseln? Noch ahnt Cavelli nicht, dass es der Auftakt eines gnadenlosen Wettlaufs ist – gegen die Zeit und gegen einen unbekannten, furchtbaren Gegner ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Kriminalroman »Don Cavelli und der letzte Papst« von David Conti – die zweite Mission für den Detektiv wider Willen. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Vatikan läuten die Totenglocken: Der Papst ist gestorben, ein neues Konklave muss einberufen werden, die gesamte Welt schaut zu ... Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Ein Kardinal nach dem anderen lehnt die Wahl zum Oberhaupt der Kirche ab. Allmählich machen sich Zweifel breit, ein dunkles Gerücht wird wispernd weitergetragen: es erzählt von Verrat und Verschwörung. Doch die Kardinäle sind während des Konklave von der Außenwelt abgeschnitten – die einzige Hoffnung ruht nun auf dem Geschichtsprofessor Don Cavelli, der neben etlichen Privilegien exklusives Wohnrecht im Vatikan besitzt und als einziger nach Belieben ein und aus gehen kann. Wird es ihm gelingen, die Wahrheit zu entschlüsseln? Noch ahnt Cavelli nicht, dass es der Auftakt eines gnadenlosen Wettlaufs ist – gegen die Zeit und gegen einen unbekannten, furchtbaren Gegner ...
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
David Conti veröffentlichte bei dotbooks:
»Don Cavelli und der tote Kardinal: Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst: Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes: Die dritte Mission«
Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
***
Originalausgabe September 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Malivan_Iuliia / Thortsen Link / Protasov AN / BossNid
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-975-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der letzte Papst
Die zweite Mission
dotbooks.
Wer einen Tiger weckt,
sollte einen langen Stock benutzen.
Mao Tse Tung
Morgendämmerung
Cavelli versuchte, sich so schnell wie möglich Klarheit über ihre Situation zu verschaffen. Draußen dämmerte es bereits. Hastig sah er auf seine Armbanduhr. Es war Viertel vor sechs. Der Clavigero begann um fünf Uhr morgens mit dem Aufschließen der Museumstüren. War er hier schon durchgekommen? Möglich war es. Das würde bedeuten, dass alle Türen von hier bis zum Museumseingang offen waren. Und wenn er doch noch nicht hier gewesen war? Dann würden die Türen in beide Richtungen verschlossen sein und sie säßen in der Falle. Cavelli biss die Zähne zusammen. Sie hatten keine Wahl. Zumindest konnten sie ohne ihre Schuhe schnell laufen, ohne auf dem Marmorboden Lärm zu verursachen. Noch achtzig Meter. Noch fünfzig. Zwanzig. Endlich die Tür. Cavelli warf sich auf die Klinke, die Tür gab nach. In diesem Moment wurde am anderen Ende des Gangs die Tür aufgerissen, durch die sie selbst gekommen waren. Augenblicklich erfassten die beiden Verfolger die Situation und spurteten mit der tödlichen Zielstrebigkeit von zwei Atomraketen los. Montis Schnaufen war inzwischen mehr ein Röcheln, und im Gesicht war er hochrot angelaufen. Lange würde er wohl nicht mehr durchhalten. Cavelli wurde klar, dass dieser Wettlauf nicht zu gewinnen war. Und Hilfe war nicht zu erwarten. Es sei denn ... »Lauft weiter!«, schrie er den beiden anderen zu. Dann packte er einen Stuhl, auf dem tagsüber Museumswächter saßen, und schleuderte ihn mit aller Kraft gegen eine Vitrine mit antikem Goldschmuck. Ein schriller Alarm zerriss die Stille …
Prolog
»Dormisne?«
Fast unhörbar leise flüsterte er dem alten Mann das lateinische Wort für »Schläfst du?« zu, während seine Lippen fast dessen Ohr berührten.
Nicht dass er wirklich eine Antwort erwartete. Das Gesicht des Mannes in dem erstaunlich schlichten Bett war bleich und starr. Seine Augen blickten ausdruckslos an die Zimmerdecke oder auch – manch einer würde es wohl so sehen wollen – durch die Decke hindurch in den Himmel. Sein Mund stand in einer schmerzlich verkrampften Art offen, was bei fast jedem anderen dumm gewirkt hätte, aber seinem durchgeistigten Antlitz, das in den letzten Jahren immer öfter von Schmerz und Anstrengung verzerrt gewesen war, tat es merkwürdigerweise keinen Abbruch, im Gegenteil, es verlieh ihm eine Art von fast schon tragischer Würde.
»Dormisne?«, fragte er ein zweites Mal und nur – dessen war er sich wohl bewusst – um den Moment, in dem er die Realität endgültig zu akzeptieren hatte, noch für einige Sekunden von sich fortzuschieben. Schon die Frage das erste Mal zu stellen war eigentlich ein Fehler, streng genommen gar ein Verstoß gewesen. Johannes Paul II. hatte dieses jahrhundertealte Ritual schon vor langer Zeit abgeschafft. Es wurde seither in Augenblicken wie diesen nicht mehr gefragt, ob der Betreffende schlafe; noch wurde ihm mit einem kleinen Hämmerchen aus Elfenbein leicht auf die Stirn geklopft. Dennoch hatte er es nicht über sich bringen können, den alten Mann, den er so verehrt hatte, wie einen gewöhnlichen Toten zu behandeln. Es war eine Frage des Respekts. Mit einer Art Seufzen richtete sich Camerlengo De Gennaro auf und nickte dem kleinen Mann in dem weißen Kittel zu, der mit angespannter Miene neben der Tür stand, zusammen mit den anderen drei Männern, die laut Protokoll in dieser Stunde zugegen sein mussten: dem Privatsekretär des Papstes, dem Kanzler der Apostolischen Kammer und dem päpstlichen Zeremonienmeister. Der Leibarzt des Papstes trat an das Bett, fühlte nach dem Puls des alten Mannes und setzte ihm anschließend – obwohl es offenkundig überflüssig war – sein Stethoskop auf die Brust. Dann schloss er ihm die Augen und trat mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf einige Schritte zurück.
»Vere, Sanctus Pater mortuus est«, murmelte De Gennaro, gerade laut genug, dass ihn alle verstehen konnten. »Der Heilige Vater ist wahrhaftig tot.«
Dann sprach der Camerlengo – auf den die Befehlsgewalt des Papstes in diesem Moment übergegangen war – ein Gebet, bevor er noch einmal an das Bett trat und den Toten segnete. Was er nun tun musste, widerstrebte ihm, und doch hatte es zu geschehen. Seine Hand zitterte leicht, als er den goldenen Fischerring von dem kalten Finger zog. Bei der bald folgenden ersten Zusammenkunft der Kardinäle würde der Ring vor den Augen aller mit dem schweren Bleisiegel des Papstes zerbrochen werden.
Die Zeit der Sedisvakanz war angebrochen und würde so lange fortdauern, bis das Kardinalskollegium aus seiner Mitte einen neuen Papst gewählt hatte oder genau genommen irgendeinen männlichen, unverheirateten Katholiken über fünfunddreißig. Aber es war mehrere Jahrhunderte her, dass man einen Papst gewählt hatte, der nicht zuvor Kardinal war.
Der Camerlengo musste nun den Kardinaldekan vom Tod des Papstes unterrichten, und er würde zeitgleich die Kardinäle nach Rom zum Konklave rufen, das frühestens fünfzehn und spätestens zwanzig Tage nach dem Tod des Papstes zu beginnen hatte. Außerdem hatte der Camerlengo den Kardinalvikar in Kenntnis zu setzen, dessen Aufgabe es war, die Öffentlichkeit zu informieren. Dann würden neun Trauertage folgen. Der Leibarzt würde die Einbalsamierung der sterblichen Überreste des Papstes beaufsichtigen, und erst nachdem diese in die Pontifikalgewänder gehüllt und in der Sala Clementina, einem Audienzraum des Apostolischen Palasts, aufgebahrt worden waren, durften sie fotografiert werden. Dort konnten Angehörige des Vatikan und beim Heiligen Stuhl akkreditierte Botschafter vom Papst Abschied nehmen. Anschließend würde der Leichnam für die Gläubigen im Petersdom aufgebahrt. Bei Johannes Paul II. waren es immerhin über zwei Millionen Menschen gewesen, die ihm die letzte Ehre erweisen wollten. Schweizer Gardisten hielten dabei die Ehrenwache am Sarg. Nach einer Totenmesse, welcher der Kardinaldekan vorstand, würde der Sarg in den Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom beigesetzt, wo sich bereits hundertsechzig verstorbene Päpste befanden.
Erstes Buch
I
Fünfzehn Tage vor dem Konklave
Der Mann in dem maßgeschneiderten Anzug und dem haarlosen Schädel schnippte mehrmals ungeduldig mit den Fingern, als seine Sekretärin mit den Akten für diesen Morgen hereinkam. Warten zu müssen, während sie eilig den Weg von der Tür bis zu seinem riesigen Schreibtisch zurücklegte, erschien ihm auch heute wieder wie ein gegen ihn persönlich gerichteter Affront. Gereizt griff er nach der obersten der vier Akten. Sie war rot, was für die höchste Dringlichkeitsstufe stand. Während die Sekretärin geräuschlos aus dem Büro huschte, zerteilte er mit dem Zeigefinger das Siegelklebeband, das die Mappe verschloss, und öffnete sie. Dann las er die Aufschrift auf dem Deckblatt.
FERNE MORGENRÖTE
Beginn: 9. September 1974 – Ende: _____________
Angewidert verzog er das Gesicht. Er bevorzugte schlichte Namen gegenüber solch blumigem Firlefanz. Und dass er von dieser Operation noch nie etwas gehört hatte, obwohl sie offenbar vor etlichen Jahrzehnten ins Leben gerufen worden war, kündete von ihrer absoluten Bedeutungslosigkeit. Aber weshalb befand sie sich dann in einem roten Ordner? Falls das ein Fehler war, und es war ganz sicher einer, würde der Schuldige sich unerquicklichen Konsequenzen ausgesetzt sehen. Mit einem ärgerlichen Naseschnauben legte er das Deckblatt zur Seite und begann, die Zusammenfassung auf Seite zwei zu lesen: zunächst eine kurze Analyse der Ausgangssituation, dann eine äußerst ambitionierte Zielsetzung. Das übliche Blabla eben; er überflog es mit geübtem Blick und konzentrierte sich schließlich auf den dritten Absatz, der mit »Eingeleitete Maßnahmen« überschieben war.
Nachdem er ihn gelesen hatte, starrte er eine volle Minute mit ausdruckslosem Gesicht durch die kugelsicheren Scheiben seines Büros nach draußen. Sein Herz schlug so heftig, dass er es in seinem Kopf spürte. Behutsam lockerte er seine Seidenkrawatte. Dann entfernte er sorgsam den Laufzettel, der als Empfänger das Kürzel seines Sekretariats nannte, legte ihn auf die Papiere und schob den ganzen Stapel durch den Schlitz seines durchsichtigen Aktenvernichters. Erst nachdem sich die Papiere vor seinen Augen vollständig in Papierstaub verwandelt hatten, fühlte er sich ein wenig wohler.
II
Vorabend des Konklave, 18 Uhr 30
Der Brauch, eine Papstwahl als Konklave zu bezeichnen, gründet sich auf den lateinischen Begriff »cum clave«, also mit Schlüssel, was symbolisch den Umstand bezeichnet, dass die Kardinäle so lange in der Sixtinischen Kapelle eingeschlossen werden, bis – so die offizielle Lesart – der Heilige Geist über sie kommt und sie aus ihrer Mitte einen neuen Papst gewählt haben. Erst dann steigt über dem Dach weißer Rauch auf und von der Mittelloggia des Petersdoms wird feierlich verkündet »Habemus Papam!«
Die Konklave der letzten Jahrzehnte haben selten länger als einige Tage gedauert, aber es hat Zeiten gegeben, da konnte es viele Wochen, Monate dauern, bis man sich, teilweise unter erbittertem Streiten und Intrigieren, geeinigt hatte. Die Kardinäle mussten während dieser Zeit dort essen, in winzigen, zu diesem Zweck aufgestellten Verschlägen, schlafen und unter den denkbar primitivsten Voraussetzungen ihre Körperhygiene verrichten. Die Zustände dort spotteten jeder Beschreibung. Mochte die Sixtina auch einer der prachtvollsten Räume der Welt sein, in jedem Obdachlosenasyl lebte es sich angenehmer.
Erst Johannes Paul II. setzte der unwürdigen Situation ein Ende. 1992 ließ er das unter Leo XIII. als Krankenhaus erbaute und später zum Pilgerheim umgewidmete Domus Santa Marta im Süden der Vatikanstadt abreißen und ein komfortables fünfstöckiges Gästehaus gleichen Namens errichten, das vier Jahre später fertig gestellt wurde und, was den Service angeht, wie ein gehobenes Hotel geführt wird. Es besitzt einhundertfünf Suiten, sechsundzwanzig Einzelzimmer und ein Apartment. Normalerweise stehen diese Räumlichkeiten Gästen des Vatikan und auch einigen klerikalen Dauermietern zur Verfügung, doch wenn ein Konklave stattfindet, haben diese allesamt zu weichen. Nur Kardinäle wohnen in dieser Zeit in jenen Räumen, die ohne Ansehen der Person per Los verteilt werden, und das Gebäude wird von der Schweizer Garde hermetisch abgeriegelt. Internet, Telefone, Zeitungen, Fernsehen, Radio und Post sind untersagt. Den Kardinälen ist das eigenmächtige Verlassen nicht gestattet, denn sie sollen keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben. Zu den Wahlgängen werden sie in weißen Bussen vor der Tür abgeholt und auf direktem Wege zum Damasushof gefahren, von wo sie sich mittels eines alten Aufzugs nach oben und durch die Loggien des Raffael in die Sixtina begeben. Dort werden sie dann, nachdem mittels des Rufes »Extra omnes!« alle Nichtkardinäle des Raumes verwiesen wurden, eingeschlossen.
Vor Beginn des Konklave wird in der Kapelle nicht nur der legendäre Ofen installiert, in dem die Stimmzettel der einzelnen Wahlgänge unter Zugabe von Chemikalien, die je nach Bedarf schwarzen oder weißen Rauch erzeugen, verbrannt werden, sondern auch ein erhöhter Holzfußboden sowie Störsender, die jegliche Mobilfunk-Kommunikation zuverlässig unterbinden. Außerdem wird der ganze Raum mit elektronischen Spürgeräten auf Abhörvorrichtungen untersucht. Denn längst ist jedes Konklave zu einem internationalen Medienereignis der höchsten Kategorie geworden, bei dem nicht nur die üblichen VAMPS anwesend sind (wobei es sich bei diesen zum heimlichen Bedauern mancher Kleriker nicht um verführerischen Damen mit ruchlosen Sitten handelt, sondern lediglich um das Vatican Accredited Media Personnel, also die Medienleute, die von Rom aus über nichts anderes als den Papst und den Vatikan berichten). Aus der ganzen Welt strömen die Journalisten zum Petersplatz; die reicheren Sender mieten zu absurden Preisen jeden Balkon und jedes Fenster, von dem man eine halbwegs gute Sicht auf den Petersdom hat, und dann werden so lange vermeintliche Experten über die aussichtsreichsten Kardinäle interviewt, bis der tatsächliche Name des neuen Papstes bekannt gegeben wird und sich wieder einmal herausstellt, dass sich alle geirrt haben.
So würde es auch diesmal sein.
Kardinal Leonardo Monti stand am Fenster seiner Suite 403 im Domus Santa Marta und blickte auf die Rückseite des von der Abendsonne beschienen Petersdoms. Es war das erste Mal, dass er an einem Konklave teilnahm. Und aller Voraussicht nach auch das letzte Mal. Beim Konklave zuvor war er noch nicht Kardinal gewesen, und beim nächsten würde er wahrscheinlich schon über achtzig Jahre sein, wodurch sein aktives und passives Wahlrecht erloschen sein würde.
Morgen also ...
Er versuchte, seinen unruhigen Gedankengängen Einhalt zu gebieten. Es gab nichts zu denken. Nicht für ihn. Und auch für die allermeisten der anderen Kardinäle nicht. Jetzt war die Zeit gekommen, in der es zu vertrauen galt. Darauf, dass sich alles finden und dass am Ende der Würdigste aus ihrer Mitte hervorgehen würde.
Natürlich gab es auch dieses Mal wieder verschiedene Favoriten. Kardinäle, die als besonders papabile galten. Doch würde einer von ihnen auch der Auserwählte sein? Das war keineswegs ausgemacht. Schon oft hatte sich die alte Regel bewahrheitet, nach der derjenige, welcher als Papst ins Konklave ging, als Kardinal wieder herauskam. Monti lächelte bei diesem Gedanken. Er hatte keinen Favoriten, er würde sich vom Geiste des Konklave tragen lassen.
Und wenn man nun ihn selbst vorschlagen würde?
Vorstellbar war es durchaus. Nicht im ersten Wahlgang natürlich, und auch nicht im zweiten oder dritten. Doch was würde sein, wenn auch bei weiteren Wahlgängen keiner der Favoriten die notwendige Stimmenzahl auf sich vereinigen konnte? Dann schlug die Stunde der Kompromisskandidaten. Die Stunde derer, die weder als besonders reformfreudig noch als besonders konservativ bekannt waren. Derer, die nie nach der Macht gestrebt hatten. Und genau so ein Kardinal war Leonardo Monti. Niemals hatte er sich in den Vordergrund gedrängt oder in herausragender Weise Stellung bezogen. Er empfand Sympathie für Benedikt XVI., der sich als einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn gesehen hatte und der, als sich im Konklave seine Wahl immer deutlicher abzeichnete, darum betete, dass dieser Kelch an ihm vorüber gehen möge. Allerdings war er bekanntlich nicht erhört worden; man hatte ihn trotzdem gewählt. Möglicherweise hatte auch sein hohes Alter von achtundsiebzig Jahren eine Rolle gespielt. Kardinäle, die noch ein paar Jahre zu jung für das Papstamt waren, wählten gern Kardinäle, deren fortgeschrittenes Alter es gestattete, auf ein zeitlich überschaubares Pontifikat zu hoffen. Die Wahl des erst achtundfünfzigjährigen Karol Wojtyla, der dann sechsundzwanzig Jahre im Amt gewesen war, hatte einige Karriereträume beendet und diente als abschreckendes Beispiel.
Monti atmete schwer aus. Es war unwahrscheinlich, dass man ihn wählen würde. Erst kamen die Favoriten, und zudem gab es außer ihm selbst noch weitere Kompromisskandidaten. Äußerst unwahrscheinlich also. Doch nicht unmöglich. Ging der Herr nicht oft seltsame Wege? Unwillkürlich ging er zu dem Betstuhl neben dem Schreibtisch und kniete auf dem roten Polster nieder. Er wollte beten: dafür, dass man ihn nicht wählen möge und – falls doch – um Vergebung. Um Vergebung dafür, dass er ablehnen würde.
III
Vier Tage vor dem Konklave
Der Wächter betrat den Schießstand, den man in seinem Keller eingerichtet hatte und von dem niemand wissen durfte, holte den Revolver aus dem Futteral, schob in einem tausendfach geübten Bewegungslauf sechs Patronen in die Trommel und klappte sie in die Waffe zurück. Die großspurige Art, die Trommel durch eine schnelle Bewegung der Waffe zurückschnappen zu lassen, wie man sie oft in Filmen sah, hatte er sich nie zu eigen gemacht. Es schadete langfristig der Waffe, in seinem Fall eine 38er Smith & Wesson mit Vier-Zoll-Lauf. Diese Lauflänge war ein sinnvoller Kompromiss. Die Zwei-Zöller schossen zu ungenau, die Sechs-Zöller, wie man sie aus Western kannte, ließen sich kaum unauffällig tragen und blieben beim schnellen Ziehen gern mal in der Kleidung hängen.
Der Wächter aber würde nicht nur treffen, sondern auch schnell sein müssen.
Er drückte einen Knopf an der Wand, und die vier Pappzielscheiben, die in fünfzehn Meter Entfernung in einem ausgeklügelten System aus Drähten und Rollen befestigt waren, begannen, sich in verschiedenen Bahnen zu bewegen. Diese Bahnen waren niemals gleich, und infolgedessen konnte man sich auch nicht darauf vorbereiten, so wie man das Verhalten von Zielen in der Realität ja ebenfalls nicht vorausberechnen konnte. Er hob die Waffe und gab innerhalb von zwei Sekunden auf alle vier Zielscheiben je einen Schuss ab. Der würzigbeißende Geruch von Pulverdampf hing in der Luft. Der Wächter hatte ihn nie gemocht. Er legte den Revolver auf einen kleinen Tisch und blickte durch ein Präzisionsfernrohr, das auf einem Stativ befestigt war. Kein Treffer befand sich genau in der Mitte der Zielscheibe, aber alle im schwarzen Bereich. Das war mehr als hervorragend. An mangelndem Training würde es nicht liegen, falls er scheiterte, und schon gar nicht an mangelnder Entschlossenheit, aber die Umstände, unter denen es stattfinden würde – falls es stattfinden würde, was er ganz und gar nicht hoffte – würden vollständig unkalkulierbar sein. Eine extrem schwierige Aufgabe, da machte sich der Wächter gar nichts vor, aber dennoch vergaß er eines keine Sekunde lang: Man verließ sich auf ihn.
IV
Sechs Tage vor dem Konklave
Der Mann in der Priesterkutte hätte einem Film von Federico Fellini entsprungen sein können. Monsignore Rinanzos spindeldürre Gestalt, seine hageren Gesichtszüge, die eingefallenen Wangen, die lange dünne Nase und die schwarzen Augen, die tief in den Höhlen lagen und unruhig umherblickten, das ölig zurückgekämmte schwarze Haar mit den Geheimratsecken, all das ergab eine Hässlichkeit, die geradezu verstörend war. Auf einen zufälligen Betrachter hätte es daher vielleicht durchaus passend gewirkt, dass er auch eine der hässlichsten der über neunhundert Kirchen Roms betrat. Mit einem müden Quietschen fiel die Eingangstür hinter ihm zu.
Hier im Innenraum war es dunkel, und ein muffiger Geruch hing schwer in der Luft. Alles wirkte staubig und trübe. Seit ihrer Erbauung vor über hundertfünfzig Jahren schien sie nie restauriert worden zu sein, und was früher einmal im goldenen Glanz erstrahlt hatte, war längst einem stumpfen Braun gewichen. Die meisten Touristen, die sich hier hinein verirrten, machten nach einem flüchtigen Blick ins Innere auf dem Absatz wieder kehrt. Hier gab es nichts Besonderes zu sehen. Die jungen Römer, die sonntags zur Messe gingen, hatten sich eine ansprechendere Kirche gesucht, und nur noch wenige Gläubige, meist sehr alte Leute, die seit ihrer Kindheit hierher kamen, waren hier noch gelegentlich anzutreffen. Es war die verlassenste Kirche Roms, und genau deshalb suchte Monsignore Rinanzo sie jeden Montag auf. Eilig, beinahe schon achtlos, benetzte er seine nikotingelben Finger mit Weihwasser und bekreuzigte sich. Wie immer verharrte er einen Moment und sah sich um. Eine alte Frau kniete betend in der ersten Reihe, ansonsten war die Kirche, wie Monsignore Rinanzo mit zwei schnellen Blicken feststellte, leer. Zügig, aber dennoch leise ging er hinüber zum Beichtstuhl und öffnete die Tür für den Priester. Es war die einzige Tür in der ganzen Kirche, deren Angeln nicht quietschten. Jemand ölte sie regelmäßig. Leise schloss er die Tür, und setzte sich. Seine Hand tastete, wie schon so oft zuvor, unter dem Sitz nach dem Umschlag. Da war er, wie immer mit Klebeband befestigt. Mit geübtem Griff löste er ihn ab und holte ihn hervor. Er entfernte das Klebeband und befestigte es erneut unter dem Sitz, eine simple, aber effektive Methode, die signalisieren würde, dass er es gewesen war, der den Brief entfernt hatte, und nicht irgendeine Putzfrau. Der Brief war größer als sonst, im DIN-A4-Format, und auch wesentlich dicker als üblich. Wie immer betastete er voller Angst den Umschlag, ob es da war. Wie immer war es da. Erleichtert atmete er auf. Aber da war noch etwas, was ihn beunruhigte. Er hatte strikte Anweisung, jeden Umschlag, den er auf diese Weise erhielt, erst in seiner Wohnung zu öffnen, und bisher hatte er sich auch stets daran gehalten, aber dieser ungewöhnliche Brief versetzte ihn in eine merkwürdige Unruhe. Das hier war anders. Es lag etwas Großes in der Luft, das konnte er spüren. Er musste einfach jetzt erfahren, was es damit auf sich hatte. Ungeduldig riss er den Umschlag auf und kippte den Inhalt auf seinen Schoß. Es handelte sich um einen eng getippten Brief, wie immer ohne Anrede und Unterschrift, und eine Anzahl kleinerer Umschläge, die alle mit verschiedenen Namen beschriftet waren. Er hielt den Brief hoch und drehte sich im Sitzen um, damit durch das Holzgitter in der Tür etwas Licht darauf fallen konnte. Mit zusammengekniffenen Augen begann er zu lesen.
Inhalt 12 Briefe. Bei Auslieferung ist sicherzustellen, dass keiner der Adressaten …
Mit einem scharfen Ruck wurde der kleine Vorhang neben ihm zur Seite gezogen. Monsignore Rinanzo blieb fast das Herz stehen, linkisch fuhr er herum und blickte in das Gesicht der alten Frau, die nun in der rechten Beichtzelle kniete. Das war nicht gut. Dies war nicht seine Kirche, wenn der rechtmäßige Priester auftauchen würde, müsste er sich eine Erklärung ausdenken, was er hier zu suchen hatte. Nein, das war ganz und gar nicht gut. Mechanisch machte er das Kreuzzeichen. »Gelobt sei Jesus Christus.«
»In Ewigkeit Amen«, antwortete die alte Frau, während sie sich bekreuzigte. Sie war eine von diesen hundertfünfzigprozentigen Katholikinnen; das erkannte er sofort. Eine von jenen, die den halben Tag von einer Kirche zur nächsten liefen, um mehrere Messen nacheinander zu feiern; die jedes Kirchenlied auswendig kannten, mit lauter Stimme mitsangen und täglich beichteten, obwohl sie natürlich keine ernsthaften Sünden begangen hatten. Die meisten Priester verdrückten sich, so schnell sie konnten, wenn sie einer dieser sogenannten Kirchenschwalben auch nur von Weitem ansichtig wurden. Aber jetzt war es zu spät. Die Alte leierte mit weinerlicher Stimme irgendwelche Nichtigkeiten herunter, und es würde sicher lange dauern, bis sie fertig war. Monsignore Rinanzo hörte nur mit einem Ohr hin, es ging wohl um ihre Katzen und eine Nachbarin. Er bemerkte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Eilig stopfte er die Briefe zurück in den großen Umschlag und schob ihn unter seine Soutane. Als die Alte schließlich hustete, nutzte er den Moment, um ihr eine kleine Buße aufzuerlegen und die Absolution zu erteilen, und bevor sie noch protestieren konnte, hatte er die Tür aufgestoßen und mit hastigen Schritten die Kirche verlassen.
V
Dreizehn Tage vor dem Konklave
Der haarlose Mann in dem breiten Bett lag auf dem Rücken und starrte an die mit kostbaren Schnitzereien verzierte Decke eines seiner zahlreichen Schlafzimmer. Er hatte weder einen Sinn für das Rauschen des Meeres an dem Privatstrand, das durch die geöffneten Flügel der Terrassentür seiner Wochenendvilla hineindrang, noch für seine aktuelle, vierzig Jahre jüngere Geliebte neben sich, die vergeblich versuchte, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Ferne Morgenröte ...
Der Gedanke daran hatte ihn nicht mehr losgelassen. Jeden anderen, der es gewagt hätte, eine solche Aktion auch nur vorzuschlagen, hätte er für einen nicht ernst zu nehmenden Narren gehalten, wenn nicht gar für einen gefährlichen Irren. Doch dieses Projekt stammte aus gänzlich anderen Zeiten. Heutzutage ging Politik immer den Weg des geringsten Risikos, tausendfach von allen Seiten beleuchtet, von Experten geprüft und nur in Angriff genommen, wenn das Gelingen so gut wie sicher war. Kühne Visionen? Das war einmal. Damals jedoch …
Ferne Morgenröte …
Schon dieser Name. Er klang so lyrisch und harmlos. Aber das täuschte. Und genau diese Täuschung war auch der Zweck solcher Bezeichnungen. Wie auch bei der Aktion Lasst hundert Blumen blühen!, bei der man die Intellektuellen des Landes aufgefordert hatte, ohne Angst vor Repressalien frei heraus kritisch ihre Meinung zur aktuellen Regierungspolitik zu äußern, um dann, als sie es vertrauensvoll taten, dreihunderttausend von ihnen zu Volksfeinden zu erklären und inhaftieren zu lassen sowie weitere siebenhunderttausend von ihnen aus dem Staatsdienst zu entfernen.
Auch Der große Sprung nach vorn, ein weiteres Projekt, das nur als wahnwitzig bezeichnet werden konnte, klang gut, kostete aber durch geradezu himmelschreiende Inkompetenz fünfundvierzig Millionen Menschen das Leben. Dennoch erfüllen diese Namen auch heute noch, Jahrzehnte später, weiterhin ihren Zweck: die Uninformierten zu täuschen und das eigentliche Wesen dieser Taten zu verbergen. Mao Tse Tung – der über ein Vierteljahrhundert China mit eiserner Hand regiert hatte, der Urheber all dieser Programme – würde sich zufrieden die Hände reiben.
Ferne Morgenröte war ein weiterer Plan von Mao gewesen. Der stellvertretende Direktor des Zweiten Büros – Hauptabteilung Ausland – des Staatsministeriums für Sicherheit stieß ein fauchendes Lachen aus. In der Tat, der Plan war gigantisch in seinen Ausmaßen, aber gleichzeitig von geradezu unglaublicher Simplizität. Trotz oder gerade wegen dieser Simplizität war es das aussichtsreichste Projekt von allen. Und es war das einzige, das immer noch – Jahrzehnte nach Maos Tod – aktiv war.
VI
Vorabend des Konklave, 21 Uhr 20
Kardinal Monti glaubte nicht an übernatürliche Vorgänge, wie Hellseherei oder Gedankenübertragung. Selbst den Wundern der Katholischen Kirche stand er – genau wie auch der frühere Papst Benedikt XVI. – eher ablehnend gegenüber, aber in diesem Moment, hier in seiner Suite 403 im Domus Santa Marta, wusste er – ja, er wusste es definitiv –, was in dem Brief stand, der da vor ihm auf dem Boden lag.
Fast wie in Trance schloss er die Tür hinter sich. Wenige Augenblicke zuvor war er noch wohlgestimmt im Fahrstuhl nach oben gefahren. Man hatte sich während des Abendessens ein wenig verplaudert. Beinahe zwei Stunden hatte er mit den anderen Kardinälen über das bevorstehende Konklave gesprochen. Eine Reihe konträrer Standpunkte waren vertreten worden. Am Ende war eher weniger klar gewesen als zuvor, aber so viel ließ sich doch sagen: Es standen mehrere hochinteressante Kandidaten zur Auswahl. Man war voller Hoffnung gewesen. Auch er. Und nun war das eingetreten, vor dem er sich immer gefürchtet hatte. All die Jahre war nichts passiert, und etwas in ihm hatte sich erfolgreich eingeredet, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch passieren würde, sei mit jedem Jahr, das verstrich, geringer geworden. Doch genau das Gegenteil war der Fall gewesen. Man hatte ihn keineswegs vergessen. Man hatte nur auf den richtigen Moment gewartet.
VII
Vorabend des Konklave, zwei Stunden zuvor
Der Schweizer Gardist am Eingang des Domus Santa Marta vollführte mit dem beweglichen Ring am Schaft seiner Hellebarde eine Bewegung, die ein klickendes Geräusch erzeugte, eine Ehrenbezeugung, die nur klerikalen Würdenträgern zuteil wurde, und salutierte, als der zweite Sekretär des Camerlengo, eine schmale Ledermappe unter dem Arm, wie immer eilig dem Eingang zustrebte und dann mit einem knappen Nicken im Inneren verschwand. Schon in normalen Zeiten waren seine Aufgaben nur mit dem völligen Verzicht auf ein Privatleben einigermaßen zu bewältigen, doch während einer Sedisvakanz schien sich die Arbeit noch einmal zu verdreifachen. Zusätzlich zu seinen zahlreichen sonstigen Aufgaben, war er nun als Organisator des Konklave, soweit es die Vorgänge innerhalb des Domus Santa Marta betraf, sowie als Verbindungsmann des Camerlengo zu den Kardinälen tätig. Da während des Konklave sämtliche Telekommunikationswege des Domus, sowohl von außerhalb als auch innerhalb, deaktiviert worden waren, hieß das für ihn, dass er täglich unzählige Male den Weg vom Governatoratspalast her und wieder zurück gehen musste. Auch heute war er im Laufe des Tages schon fünf- oder sechsmal hier gewesen.
Mit großen Schritten durchquerte er die mit weißem Marmor ausgelegte Empfangshalle, grüßte mit einer kaum wahrnehmbaren Kopfbewegung die diensthabende Schwester an der Rezeption und betrat den Aufzug. Ungeduldig drückte er mehrfach auf den obersten Knopf.
Die Tür schloss sich, und der Lift glitt fast lautlos nach oben. Im fünften Stock befand sich sein provisorisches Büro, wobei das Wort »Büro« selbst in der Kombination mit »provisorisch« noch eine himmelschreiende Übertreibung darstellte. Im Governatoratspalast teilte er sich mit dem ersten Sekretär ein gut sechzig Quadratmeter großes, modernst ausgestattetes Arbeitszimmer mit Blick in die Vatikanischen Gärten, hier hingegen stand ihm lediglich ein zwei mal zwei Meter großes fensterloses Kabuff zur Verfügung, in dem der Kopierer untergebracht war und auf dessen Boden er fein säuberlich diverse Stapel mit Papieren, vornehmlich Namenslisten und Zeitpläne, ausgebreitet hatte. Doch jetzt hatte er nicht vor, diesen Raum zu betreten.
Er verließ den Fahrstuhl und sah auf seine Armbanduhr. Er war pünktlich. Es war neunzehn Uhr fünfzehn. Die Kardinäle saßen nun seit einer Viertelstunde im Speisesaal beim Abendessen und würden höchstwahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dort bleiben. Gerade während eines Konklave wurde oft noch stundenlang diskutiert und beraten.
Er öffnete den Reißverschluss seiner schwarzen Ledermappe und entnahm ihr eine Klarsichtfolie, in der sich ein Papier befand. Eine alphabetische Liste aller Kardinäle und ihrer Zimmernummern. Einige der Nummern waren mit Bleistift umrandet. Niemand würde von ihm verlangen, dieses Blatt sehen zu wollen, aber trotzdem würde er diese Kopie vernichten, sobald er sie nicht mehr benötigte. Er blieb vor der Suite mit der Nummer 501 stehen. Außer ihm befand sich niemand im Flur. Vorsichtig legte er das Ohr an die Tür und lauschte. Kein Geräusch war zu hören.
Ruhig griff er in die Mappe, zog einen Brief hervor, verglich noch einmal den Namen auf der Liste mit dem auf dem Umschlag, legte ihn auf den Boden und schnippte ihn unter dem Türspalt hindurch ins Zimmer. Eilig, aber nicht zu eilig, ging er den Flur hinunter und um die Ecke. Er wartete, doch offenbar war der Bewohner von Suite 501 nicht anwesend. Wie geplant. Erneut betrat er den Flur. Die Tür von Suite 516 war nun sein Ziel. Wieder ein Brief, wieder ein schnelles Verschwinden. Elf Minuten später befand er sich im ersten Stock und schob den letzten der zwölf Briefe unter einer Tür hindurch. Niemand hatte ihn gesehen. Erst jetzt bemerkte er, dass ihm kalter Schweiß auf der Stirn stand. Er zog ein Taschentuch hervor und wischte sie trocken. Dann fuhr er mit dem Fahrstuhl in die Lobby und strebte dem Ausgang entgegen. Wieder nickte er der Schwester an der Rezeption zu.
»Gute Nacht, Schwester Sophia.«
Schwester Sophia lächelte herzlich. »Gute Nacht, Monsignore Rinanzo.«
VIII
Erster Tag des Konklave
Der Himmel über Rom war fast schwarz an diesem Morgen, und von einem Augenblick zum nächsten hatte es wie aus Kübeln gegossen. Wer kein Auto besaß oder nicht das Glück hatte, noch einen Platz in den überfüllten Bussen zu ergattern, war nach wenigen Augenblicken bis auf die Haut durchnässt. Natürlich war auch kein Taxi mehr zu kriegen. Grund genug für viele, die zu Beginn des Wolkenbruchs noch zu Hause gewesen waren, zum Telefon zu greifen und sich krank zu melden.
Donato Cavelli hatte das Ende seiner achthundert Meter langen Joggingstrecke zum fünften Mal erreicht und machte sich nun in etwas gemächlicherem Trab auf den Rückweg. Seine kleine Stirnlampe warf bizarr hüpfende Lichter an die Wände links und rechts von ihm, und über seinem Kopf hörte er den Regen wütend auf das Dach trommeln. Alle paar Meter sprühte durch die kleinen Gucklöcher links und rechts etwas regnerische Gischt in den schmalen Gang hinein. An normalen Tagen und bei leichtem Regen lief er jeden zweiten Tag im Lieblingspark der Römer, dem Villa Borghese, aber bei einem Wetter wie heute oder bei extremen Minusgraden nutzte er eines der vielen Vatikanischen Privilegien, die er besaß, und joggte durch den für die Öffentlichkeit gesperrten Passetto, den einstmals geheimen, sagenumwobenen Fluchttunnel der Päpste, der in zehn Meter Höhe, unauffällig auf die alte Stadtmauer gesetzt, die Engelsburg mit dem Apostolischen Palast im Vatikan verband und der keineswegs, wie Dan-Brown-Leser zu wissen glaubten, in der Privatbibliothek des Papstes endete, sondern in einer recht unscheinbaren Räumlichkeit.