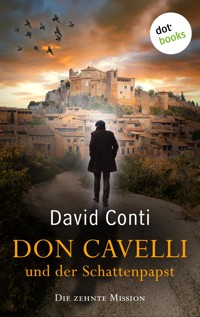Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Die Geheimnisse alter Katakomben: Der fesselnde Vatikan-Krimi »Don Cavelli und der Apostel des Teufels« von David Conti als eBook bei dotbooks. Ein Geschäft mit dem Teufel? Über diesen Aberglauben kann Sergio Guerri, der berühmteste Religionskritiker Italiens, nur lachen. Darum lässt er sich auch amüsiert auf das Angebot eines Fremden ein: eine Million Euro in bar – im Tausch für seine Seele? Dabei kann es sich schließlich nur um einen Scherz handeln! Doch das Geld ist echt, die Tage vergehen … und niemand fordert es zurück. Stattdessen beschleicht Sergio mehr und mehr das Gefühl, verfolgt zu werden, und kalte Angst kriecht in sein Herz. Schließlich bittet er einen alten Freund um Hilfe: Der Geschichtsprofessor Don Cavelli hat Zugang zu dem geheimen Wissen des Vatikan. Doch je tiefer sich Cavelli in einer Welt aus dunklen Kulten und gefährlichen Sekten verstrickt, desto mehr kommen auch ihm Zweifel, woran er noch glauben – oder nicht glauben – darf … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der furiose Vatikan-Thriller »Don Cavelli und der Apostel des Teufels« von David Conti. Spannende Insiderfakten und unglaubliche Enthüllungen – alle Bände der Bestsellerreihe können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Geschäft mit dem Teufel? Über diesen Aberglauben kann Sergio Guerri, der berühmteste Religionskritiker Italiens, nur lachen. Darum lässt er sich auch amüsiert auf das Angebot eines Fremden ein: eine Million Euro in bar – im Tausch für seine Seele? Dabei kann es sich schließlich nur um einen Scherz handeln! Doch das Geld ist echt, die Tage vergehen … und niemand fordert es zurück. Stattdessen beschleicht Sergio mehr und mehr das Gefühl, verfolgt zu werden, und kalte Angst kriecht in sein Herz. Schließlich bittet er einen alten Freund um Hilfe: Der Geschichtsprofessor Don Cavelli hat Zugang zu dem geheimen Wissen des Vatikan. Doch je tiefer sich Cavelli in einer Welt aus dunklen Kulten und gefährlichen Sekten verstrickt, desto mehr kommen auch ihm Zweifel, woran er noch glauben – oder nicht glauben – darf …
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erschienen bei dotbooks bisher:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
Alle Bände sind sowohl als eBooks als auch als Printausgaben erhältlich. Weitere Romane sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe Januar 2022
Copyright © der Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Malivan_Iuliia / Vladimir Sazonov / Parilov / Leah-Anne Thompson / Protasov AN
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-587-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 5« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der Apostel des Teufels
Die fünfte Mission
dotbooks.
»Wer nicht an den Teufel glaubt,
glaubt nicht an das Evangelium.«
Papst Johannes Paul II.
***
»Es wird derjenige vom Teufel überwältigt,
der ihn leugnet.«
Martin Luther
Prolog
Rom.
Die ewige Stadt.
Er hasste diesen Ort wie keinen anderen.
Seit Jahrhunderten war Rom ein brennender Stachel in seinem Fleische.
Nirgendwo sonst lachte ihm das Christentum so dreist ins Gesicht.
Der Vatikan.
Der Papst.
Und die Kardinäle, die sich auch Blutprinzen nannten und deren rote Gewänder symbolisierten, dass sie auch ihr Blut für das Christentum vergießen würden.
Doch taten sie es?
Leider nicht.
Sie wurden alle nur immer fetter und mächtiger.
Doch das schien niemanden zu stören.
Aus aller Welt reiste dummes Volk herbei, um das Spektakel, das der Papst hier allwöchentlich veranstaltete, zu begaffen.
Es war unerträglich.
Doch der Vatikan war nur die Spitze des Eisbergs.
In seinen Augen war dieser Schandfleck im Herzen der Stadt kaum mehr als Blendwerk.
Eine Touristenattraktion unter vielen.
Viel schlimmer war Rom selbst.
Die Stadt beherbergte an die tausend Kirchen.
Mehr als jede andere Stadt auf der Welt.
Und noch immer wurden diese verdammungswürdigen Orte in großer Zahl aufgesucht.
Von Menschen, die tatsächlich gläubig waren, denn Attraktionen waren die meisten dieser verstaubten Gemäuer ganz gewiss nicht.
Mit dummen Gesichtern saßen sie auf den harten Holzbänken und lauschten verzückt den Reden der heuchlerischen Schwarzröcke.
Die meisten dieser Menschen waren unerreichbar für ihn. Allerdings nicht alle, zumindest bei einigen von ihnen gab es Mittel und Wege.
Und dann waren da noch die Atheisten.
Die Ungläubigen.
Die verlorenen Seelen.
Sie waren die Legionen, auf denen er die Fundamente seiner Herrschaft errichten würde.
Und mit jeder Sekunde, die verrann, wurden es mehr.
Es gab so unendlich viel zu tun für ihn.
Satan war in der Stadt.
Erstes Buch
I
Der Schweizer Gardist in seiner buntpittoresken Uniform salutierte zackig, als Don Cavelli das Vatikanische Staatsgebiet durch die Porta Sant’Anna verließ. Ein dänischer Tourist stupste seine Ehefrau an, um sie auf den eigentümlichen Vorgang aufmerksam zu machen, und begann sogleich, phantasievolle Mutmaßungen – eine falscher als die andere – darüber anzustellen, warum ein Mann, der ganz offensichtlich kein Geistlicher war – darauf ließ dessen leicht verknitterter heller Sommeranzug mit der nachlässig gebundenen Krawatte schließen – derartig respektvoll gegrüßt wurde. Er schien ganz und gar nicht in den Vatikan zu passen.
Der dänische Tourist war im Laufe der Jahre keineswegs der Erste, dem dieses sich fast täglich wiederholende Vorkommnis aufgefallen war, und schon oft hatte mancher dem geheimnisvollen Mann, der nicht hierher zu gehören schien, noch einige Momente neugierig hinterhergeschaut und sich gefragt, was er wohl im Vatikan zu tun haben mochte. Die Wahrheit erriet niemand.
Cavelli war Mitte vierzig, schlank, auf eine jungenhafte Art gutaussehend – von Zeit zu Zeit wurde er von meist älteren Leuten auf seine frappante Ähnlichkeit mit dem verstorbenen französischen Filmschauspieler Gérard Philipe angesprochen – und hatte trotz einiger weißer Strähnen, die seine schwarzen Haare mittlerweile durchzogen, eine unbekümmerte Ausstrahlung, die eher zu einem Künstler gepasst hätte und die bei Menschen, die ihn nicht kannten, unberechtigterweise den Verdacht auf eine gewisse Oberflächlichkeit aufkommen ließ. Auch wurde er von Menschen, die nur seinen Namen hörten, nicht selten für einen Priester gehalten, doch das »Don« in »Don Cavelli« war kein kirchlicher Titel, sondern lediglich die Abkürzung für seinen von ihm herzlich gehassten Vornamen »Donato«. Es war im Hause Cavelli seit Jahrhunderten eine unselige Familientradition, dass jeder erstgeborene männliche Nachkomme einen Vornamen erhielt, der sich als »Don« abkürzen ließ. Er hatte mit Donato noch Glück gehabt, sein Vater hatte Spiridon geheißen. Der vermeintliche klerikale Titel war allerdings durchaus beabsichtigt, denn die Cavelli-Dynastie lebte seit über fünfhundert Jahren im Vatikan.
Cavelli wandte sich nach rechts und steuerte auf den Petersplatz zu. Es war kurz nach Mittag, die Sonne stand im Zenit und brannte erbarmungslos auf den Hunderte von Metern langen Wurm aus Touristen nieder, der sich quer über den Platz wand und darauf wartete, die Sicherheitsschleusen zu passieren, um dann eine der Hauptattraktionen Roms zu besichtigen: den Petersdom.
Cavelli blieb im Schatten und wählte den Weg durch Berninis Kolonnaden, den breiten Säulengang, der vom Dom ausgehend den Petersplatz umfasste wie zwei Arme, welche die Gläubigen schützend umschlossen.
Vielleicht lag es daran, dass Cavelli seit Wochen jeden Tag mehrere Stunden im Vatikanischen Geheimarchiv verbrachte, um bislang ungesichtete Dokumente über Benvenuto Cellini, einen der berühmtesten Goldschmiede und Bildhauer des sechzehnten Jahrhunderts, zu studieren, dass er heute wieder ein Auge hatte für die unglaublichen Kunstwerke, die ihn hier umgaben und die er viel zu oft für selbstverständlich nahm. Ja, die Kolonnaden waren in der Tat ein Meisterwerk. Eines von vielen, die der Architekt und Bildhauer Gianlorenzo Bernini in Rom geschaffen hatte. Wenn man begann, seine Arbeiten aufzuzählen, bekam man leicht den Eindruck, dass er hier alle wesentlichen Werke des Barock im Alleingang geschaffen hatte. Den Bronzebaldachin im Petersdom, den Tritonenbrunnen, die Scala Regia, den Vierströmebrunnen, die Skulptur der Theresa von Ávila, den Petersplatz ... die Liste war endlos. Bernini war ein Universalgenie gewesen, das unter anderem auch Theaterstücke schrieb, die Musik dafür komponierte, das Bühnenbild entwarf, die Werke dann in einem selbstentworfenen Theater aufführen ließ und auch noch die Hauptrolle darin spielte. Dabei war selbst er vor Fehlgriffen nicht gefeit. Als oberster Bauherr des Petersdoms hatte Bernini nach Herzenslust genialisch Hand anlegen lassen und dabei wenig Rücksicht auf künstlerische Nebensächlichkeiten wie Statik genommen, was bei dem Versuch, zwei Glockentürme auf die Fassade des Doms zu setzen, dazu führte, dass sich einige äußerst beunruhigende Risse in der Peterskuppel bildeten. Bernini plante sicherheitshalber bereits seine Flucht aus Rom, falls die Kuppel einstürzen würde. Aber zu seinem Glück tat sie das nicht, und wahrscheinlich wäre ihm selbst dann nicht wirklich etwas geschehen, denn für gewöhnlich ließen ihm die acht Päpste, für die er im Laufe seines Lebens tätig war, allen voran Papst Urban VIII., praktisch alles durchgehen. Berninis Macht in Rom war allgegenwärtig, und er stand auf ausdrücklichen päpstlichen Befehl hin über dem weltlichen Gesetz, da er, wie es eine päpstliche Urkunde bescheinigte, ein außergewöhnlicher Mensch von besonderem Talent sei, durch göttliches Wirken geschaffen, um zum Ruhme Roms Licht in das Jahrhundert zu bringen. Solche päpstliche Gnade war angesichts seines Charakters auch bitter nötig, denn nach modernen Maßstäben wäre Bernini ein Schwerverbrecher und Psychopath gewesen. Dass er den großen Künstler Borromini den Großteil der Arbeit am Petersdom planen und ausführen ließ und den Ruhm dafür ganz allein einstrich, war da noch eine seiner harmlosesten Taten. Wenn Bernini nach den üblichen Gesetzen der Zeit behandelt worden wäre, hätte er die meisten seiner Kunstwerke gar nicht schaffen können, da er im Kerker gesessen hätte oder gar hingerichtet worden wäre; dies vor allem wegen seines unbändigen Jähzorns, der ihn immer wieder zu Gewaltausbrüchen hinriss. Als er entdeckte, dass seine Geliebte ihn mit seinem Bruder betrog, ließ er ihr von seinem Diener das Gesicht zerschneiden, brach dem Bruder zwei Rippen und verfolgte ihm mit dem Degen in der Hand sogar noch in die Santa Maria Maggiore, in der sich der Bruder sicher geglaubt hatte, und schlug mehrere Priester nieder, die den Rasenden von seinem Vorhaben abhalten wollten.
Nicht zum ersten Mal dachte Cavelli darüber nach, wie seltsam es war, dass ein so rücksichtsloser und gewalttätiger Mann wie Bernini so viele zarte und kunstvolle Werke hatte erschaffen können. Aber vielleicht war es wirklich so einfach, wie es ein bekanntes Sprichwort behauptete, und Genie und Wahnsinn lagen dicht beieinander. Cavellis Gedanken wanderten weiter zum Gegenstand seiner augenblicklichen Forschungen: Benvenuto Cellini. Er hatte etwa hundert Jahre vor Bernini gelebt und war der Goldschmied seiner Zeit gewesen. Päpste und Könige rissen sich um ihn. Charakterlich war Bernini gegen ihn geradezu ein Waisenknabe gewesen. Cellini war ein geisteskranker Choleriker, der ohne Gewissensbisse Frauen vergewaltigte und schon aufgrund lächerlichster, oft nur eingebildeter Kränkungen zum Mörder wurde, was er in seiner Autobiographie – eines der lesenswertesten Bücher seiner Zeit – auch an zahlreichen Stellen freimütig berichtet. Doch auch er hatte über dem Gesetz gestanden, ja Papst Paul III. hatte ihm trotz seiner Morde höchstselbst Schutzbriefe ausgestellt, die ihn vor der Macht des Gesetzes bewahrten.
Während des berüchtigten Sacco di Roma im Jahre 1527, währenddessen deutsche Landsknechte Rom besetzt hatten und die Bevölkerung mit Plünderungen und Vergewaltigungen sowie Mord und Totschlag terrorisierten, war Cellini unter denen, die als Kanoniere die noch nicht eroberte Engelsburg verteidigten. Später dann war Cellini in Ungnade gefallen und auf der Engelsburg inhaftiert worden. In der Gefangenschaft hatte er schließlich den Verstand verloren, war zunehmend in religiösen Wahn verfallen und glaubte schließlich gar, einen Heiligenschein zu bekommen.
Dies alles war mehr oder weniger bekannt, doch Cavelli war im Rahmen seiner Arbeit an einer vollständigen Geschichte des Papsttums – im Moment arbeitete er an Band 14 – bei seinen Nachforschungen auf unbekannte Dokumente gestoßen, in denen Zeitzeugen von der Belagerung berichteten. Dabei war Cavelli auf ein Detail aufmerksam geworden, das ihn förmlich elektrisiert hatte: Gleich von mehreren Personen wurde dort ein Capitano Cavelli erwähnt, der einer der maßgeblichen Männer bei der Verteidigung gewesen zu sein schien. Cavelli hatte es erst kaum fassen können. Handelte es sich bei diesem Capitano Cavelli etwa um jenen berühmt-berüchtigten Capitano Umberto Cavelli? Den Ahnherrn der Cavelli-Dynastie, der im Jahr 1513 aufgrund unbekannter, aber offenkundig ungeheuer wertvoller Dienste für Papst Julius II. durch eine päpstliche Urkunde Liberatus ab ullis calamitatibus, also frei von allen Nöten, gestellt worden war und zwar bis zum Jüngsten Tage, was für ihn und alle seine Nachkommen nicht nur Wohnrecht im Vatikan, zahlreiche Privilegien und eine märchenhafte Menge Goldes bedeutet hatte, die mit Zins und Zinseszins im Laufe von über fünfhundert Jahren zu einem Vermögen angewachsen war, das kein Cavelli jemals würde ausgeben können.
Cavelli konnte es kaum erwarten, mehr über seinen Ahnen herauszufinden, denn außer diesem Akt päpstlicher Huld und dem Umstand, dass Capitano Umberto Cavelli in Michelangelos Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle goldbehelmt und mit einem Schwert in der Hand abgebildet war – soeben im Begriff, einem Mann den Kopf abzuschlagen – war dieser Vorfahr ein einziges großes Geheimnis. Nicht zum ersten Mal fragte sich Cavelli, ob seine ganze Faszination für die Erforschung des Papsttums nicht eigentlich nur eine verkappte Suche nach seinen eigenen Wurzeln war, die so sehr im Dunkeln lagen und die sich doch so vielversprechend anfühlten.
II
Der Mann schien keine Eile zu haben. Sergio Guerri erblickte ihn schon von Weitem. Wie beinahe jeden Tag hatte Guerri gegen Mittag die Redaktion verlassen und war mit dem Fahrrad zum weitläufigen Villa-Borghese-Park, dem liebsten Erholungsort der Römer, oberhalb des Piazza del Popolo gefahren, um dort auf einer Parkbank mit Blick auf den wunderschönen Piazza di Siena ein Sandwich zu essen. Ein bisschen Bewegung und eine kleine Oase der Ruhe in einem Arbeitsalltag voller Hektik. Guerri biss von seinem Putensandwich ab, genoss den Geruch der Schirmpinien und beobachtete interessiert einen Mann, der etwa hundert Meter von ihm entfernt war und sich in die Richtung der Parkbank bewegte, auf der Guerri saß. Aus irgendeinem Grund war der Mann auffällig. Kauend fragte Guerri sich, woran das liegen mochte, doch es gelang ihm nicht, es zu ergründen. Der Mann hatte einfach ein besonderes Charisma. Ein Begriff, der inflationär gebraucht wurde, aber nur selten wirklich berechtigt war, doch das ging einem erst auf, wenn man zum ersten Mal einem wirklich charismatischen Menschen begegnete. Bei Guerri war es vor etwa zwanzig Jahren während einer Reise nach New York gewesen. Er hatte in einem sehr guten Restaurant zu Abend gegessen, als sich plötzlich die Tür auftat und ein Mann eintrat, der eine strahlende Aura aus positiver Energie um sich zu haben schien. Es war wie ein übernatürliches Ereignis. Guerri war verblüfft. Noch nie zuvor hatte er etwas Ähnliches gesehen. Erst als er den Mann weiter betrachtete, ging ihm plötzlich auf, dass es sich bei ihm um den Sänger Harry Belafonte handelte, von dem Guerri aber bis zu diesem Abend eigentlich nur gewusst hatte, dass er existierte, er war keineswegs ein Fan oder etwas Ähnliches, und auch Belafontes Musik kannte er kaum. Guerris Geist war also keineswegs von unkritischer Starverehrung getrübt, zumal er Belafonte ja zunächst nicht einmal erkannt hatte. Es war einfach ein unerklärliches Phänomen, das er danach nie wieder erlebt hatte. Bis heute. Dieser Mann schien ebenfalls von einer beinahe schon sichtbaren Aura umgeben zu sein, allerdings nicht von einer strahlenden – seine Aura war von Düsternis gekennzeichnet.
Der Gang des Mannes, der sich jetzt noch in etwa fünfzig Meter Entfernung befand, war langsam und entspannt, jedoch zugleich zielstrebig. Jemand, der nicht nur wusste, was er wollte, sondern der überdies auch wusste, dass er es bekommen würde. Er trug einen perfekt sitzenden schwarzen Anzug, dazu ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Zweifellos eine Maßanfertigung, alles ein bisschen zu perfekt, jeder andere hätte damit eitel gewirkt, doch der Mann trug alles mit einer solchen Achtlosigkeit, dass es ganz schlicht und natürlich wirkte. In der rechten Hand trug er eine Reisetasche aus schwarzem Leder. Guerri schätzte ihn auf Mitte dreißig, doch das konnte täuschen. Das Gesicht des Mannes war seltsam alterslos und hatte, abgesehen von einer tiefen senkrechten Furche über der Nasenwurzel, kaum Falten. Es war ein gutgeschnittenes Gesicht, mit fast schwarzen Augen, das ohne weiteres zu einem Schauspieler gepasst hätte, wenn nicht dieser schwer zu definierende, aber eindeutig unangenehme Ausdruck gewesen wäre, der alles verdarb.
Der Mann war noch etwa zehn Meter von Guerri entfernt, und mit einem Male wurde ihm bewusst, was er schon die ganze Zeit über ahnungsvoll gefühlt hatte: Das Ziel, auf das der Mann zusteuerte, war er.
Ein starker Wind war aufgekommen, doch seltsamerweise bewegten sich die Äste an den Bäumen nicht, beinahe so, als sei dieser Wind nicht für sie bestimmt. Guerri spürte, wie sich etwas in ihm verkrampfte. Offenbar wollte der Mann irgendetwas von ihm – etwas Unerfreuliches, auch wenn Guerri sich nicht denken konnte, was es sein mochte. Am ehesten handelte es sich wohl um einen verhaltensgestörten Mann, ohne ein Gefühl für natürliche Distanz, der einfach so andere Menschen ansprach und mit seinen Problemen belästigte. In jüngeren Jahren hatte Guerri öfter den Fehler begangen, sich auf solche Gespräche einzulassen, und war diese Leute dann kaum wieder losgeworden. Doch diese Zeiten lagen lange zurück, heutzutage pflegte er solche Kontakte bereits im Keim zu ersticken. Er biss von seinem Sandwich ab und blickte finster in eine andere Richtung. Sowohl sein Gesichtsausdruck als auch seine Körperhaltung sendeten eine klare Botschaft: »Hau ab!«
Erfahrungsgemäß funktionierte das.
Heute funktionierte es nicht. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, dass der Mann einen knappen Meter vor ihm stehengeblieben war und nun auf ihn hinuntersah. Widerwillig wandte Guerri den Kopf und blickte dem Mann so aggressiv er konnte direkt in die Augen.
Der Mann lächelte ihn auf seltsam milde Weise an. Einige Augenblicke hing ein unheilvolles Schweigen in der Luft.
Es widerstrebte Guerri zutiefst, etwas zu dem Mann zu sagen, denn zweifelllos war es genau das, was dieser provozieren wollte. Sowie man sich mit solchen Typen auch nur ansatzweise auf ein Gespräch einließ, hatten sie, bildlich gesprochen, den Fuß in der Tür, und man wurde sie nicht mehr los. Der Mann lächelte immer noch sanft auf ihn hinab. Lag da so etwas wie Amüsiertheit in seinem Ausdruck? Guerri spürte, wie er mit jedem Moment unsicherer wurde. Und wütender. Er konnte nicht einfach dasitzen und sich anstarren lassen. Er musste etwas sagen.
»Is was?«, blaffte er den Mann so unfreundlich wie nur irgendmöglich an.
Das Lächeln des Mannes mit der unangenehmen Aura wurde noch etwas breiter. Er musterte Guerri noch einmal von oben bis unten, bevor er sich schließlich zu einer Antwort bequemte.
»Heute ist dein Glückstag, Sergio.«
Guerri erstarrte. Er hatte das Gefühl, dass sein Gehirn einfror. Was ging hier vor? Wer war der Mann? Warum duzte er ihn? Wieso kannte er seinen Namen? Woher wusste er, dass er hier auf dieser Bank im Villa Borghese sitzen würde? Und vor allem: Was wollte dieser Mann von ihm? War dies etwa einer seiner Leser? Gar ein Fan seiner religions- und kirchenkritischen Artikel, für die Guerri in ganz Italien und darüber hinaus bekannt war? Der Mann lächelte zwar und sprach in einem freundlichen Tonfall, aber die Gesamtsituation hatte etwas Wahnsinniges. Mit einem Schlag stand Guerri die Ermordung John Lennons vor Augen, der auf offener Straße von einem geistesgestörten Fan erschossen worden war. Seine Nackenhaare stellten sich auf, und sein Körper versteifte sich. Unwillkürlich warf er einen Blick auf die Hände des Mannes, doch die linke war leer und hing völlig entspannt an den Seiten herunter, während er in der rechten die schwarze Ledertasche trug. Gegen seinen Willen fragte sich Guerri, was sich wohl darin befinden mochte. Er verscheuchte den Gedanken, es ging ihn nichts an und hatte ihn nicht zu interessieren.
Guerri presste eine trotzige Antwort hervor: »Kennen wir uns?« Sein Ton signalisierte klar, dass er es sich nicht vorstellen konnte und es auch in keiner Weise für wünschenswert hielt.
Wieder ließ sich der Mann ein wenig mehr Zeit für seine Antwort, als es die Höflichkeit geboten hätte: »Ich kenne dich, Sergio, und du hast zumindest schon von mir gehört.«
Seine Stimme war sanft, aber irgendetwas schwang darin mit, das Guerri nicht einordnen konnte. Guerri hielt dem Blick des Mannes stand und schwieg, auch wenn ihn beides erhebliche Überwindung kostete. Er durchschaute den anderen. Diese Taktik, Andeutungen zu machen und dann nicht weiterzusprechen, um so den Gesprächspartner zu zwingen, selbst zu sprechen, kannte er aus diversen Rhetorikseminaren und auch die richtige Gegenmaßnahme: Schweigen. Es war simpel. Es kam bloß darauf an, die peinliche Stille länger zu ertragen als der andere.
Guerri ertrug sie fast eine volle Minute, dann platzte es aus ihm heraus. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
Der Mann schien Guerris Gereiztheit nicht zu bemerken. »Ich will dir ein Angebot machen.«
»Ich bin nicht interessiert, auf Wiedersehen.« Guerri bedauerte, keine Zeitung dabeizuhaben, die er jetzt ostentativ aufschlagen und sich darin vertiefen konnte.
»Du wärst ein Narr, wenn du nicht interessiert wärst, Sergio.«
Guerri spürte den starken Impuls, sich die Duzerei zu verbitten, doch das wäre bereits ein Zugeständnis gewesen. Er wollte nicht darüber verhandeln, wie der andere mit ihm reden sollte, er wollte überhaupt nicht mit ihm reden.
Als sich der Mann neben Guerri auf die Bank setzte, wäre dieser beinahe aufgestanden, doch das wäre Flucht gewesen. Sein Stolz ließ es nicht zu. Nicht er hatte zu gehen, sondern dieser aufdringliche Kerl.
Von katholischer Seite heißt es, unter den sieben Todsünden sei der Stolz die unverzeihlichste und dass es die Todsünde sei, die einen am sichersten in die Hölle führe. Insofern mochte es eine ironische Arabesque dieser Begegnung sein, dass es ausgerechnet sein Stolz war, der Guerri dazu trieb, neben dem Mann sitzen zu bleiben, statt einfach fortzugehen, wie er es ohne weiteres hätte tun können.
Mit einer Mischung aus Furcht und Wut starrte er den Mann an.
Dieser stellte die schwarze Tasche zwischen sich und Guerri auf die Bank, öffnete mit einer fließenden Bewegung den Reißverschluss und gewährte ihm einen Blick hinein. Guerri sah kurz hin, nur um – wie er sich selbst sagte – sicher zu gehen, dass sich keine Waffe darin befand. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber das sicher nicht. Die Tasche war gefüllt mit Geld. Zahlreiche Bündel von Hundert-Euro-Scheinen.
»Eine Million Euro«, erläuterte der Mann freundlich. »Für dich, Sergio.«
Guerri verspürte ein Gefühl von Übelkeit. Er starrte abwechselnd den Mann und den Inhalt der Tasche an. Er wollte etwas sagen, aber nichts passte auf diese Situation. War das ein Scherz? Versteckte Kamera? Für eine Zehntelsekunde durchfuhr ihn Erleichterung, doch dann sah er in die schwarzen Augen des Mannes, die mit dieser unheimlichen Sicherheit auf ihm ruhten. Nein, dies war keinesfalls ein Scherz, keine billige TV-Sendung, das hier war echt und es war ernst. Guerri spürte instinktiv, dass dies der wichtigste Moment seines Lebens war. Im nächsten Moment wurde es ihm klar: Hier ging es um Bestechung. Seine Zeitungsartikel waren dem Vatikan ein Dorn im Auge. Mit dem Geld wollte man ihn mundtot machen. Der Mann war ein Abgesandter des Vatikan. Warum war er nicht gleich darauf gekommen? Der schwarze Anzug, die sanfte Stimme, das Duzen. Es fehlte nur noch, dass der Mann »mein Sohn« zu ihm sagte. Der Mann war ein Priester. Doch bereits in der nächsten Sekunde wusste er, dass dies Unsinn war. Sicher, er schrieb vielbeachtete Zeitungsartikel, die dem Vatikan nicht gefallen konnten, doch das taten andere Journalisten auch, nicht wenige weit aggressiver als er, und nicht einmal der Vatikan besaß genug Geld, um sie alle mit einer Million zum Schweigen zu bringen. Also was war es dann? Was ging hier vor? Es ergab keinen Sinn. Guerri bemerkte, dass er immer noch wie ein Idiot auf das Geld starrte. Er riss sich zusammen. Es war an der Zeit, das Heft des Handelns zu ergreifen, statt nur passiv zu reagieren. Er setzte sein unbeeindrucktestes Gesicht auf und warf dem Mann in Schwarz einen kühlen Blick zu.
»Was soll das?« Er versuchte, es souverän klingen zu lassen.
Der Fremde antwortete geduldig und freundlich. »Das Geld ist für dich, Sergio. Nimm es.«
»Einfach so?«, erwiderte er spöttisch. »Sie erwarten doch sicher eine Gegenleistung.« In diesem Moment kam Guerri in den Sinn, dass dies möglicherweise eine Falle war. Hatte der Mann ein Aufnahmegerät in der Tasche, wurden sie heimlich aus einiger Entfernung gefilmt? Würde bald im Internet ein Filmchen auftauchen, das ihn als bestechlich und somit unglaubwürdig diskreditierte? Er würde auf jedes Wort achten müssen, das er sagte, und vor allem durfte er die Tasche mit den Geldbündeln nicht anrühren. Augenblicklich rückte er auf der Bank ein Stück zurück, um etwas Distanz zwischen sich und das Geld zu bringen.
Der Mann in Schwarz griff in seine Innentasche und zog ein Blatt Papier hervor. »Ja, Sergio, ich erwarte in der Tat eine Gegenleistung«, sagte er, während er das Papier sorgsam auseinanderfaltete. »Eine Gegenleistung, die für viele Menschen unannehmbar groß wäre, aber für dich ist sie klein – nein, nicht klein, für dich ist sie praktisch gar nicht vorhanden, ein Nichts. Für das Geld musst du nur diesen kleinen Vertrag unterschreiben. Das ist schon alles.«
Guerri lachte. Zum ersten Mal entspannte er sich. Das war also des Pudels Kern. Dubiose Finanzgeschäfte. War das die Real-life-Variante des Spambetrugs mit dem nigerianischen Prinzen, der angeblich ein Millionenvermögen zu vererben hatte? Man müsse nur zuvor ein paar tausend Euro Gerichts- und Bankgebühren auslegen und schon könne man das Vermögen in Empfang nehmen. Es war unfassbar, dass es immer wieder Idioten gab, die darauf reinfielen. Das hier allerdings schien etwas Neues zu sein. Worin bestand hier der Betrug? Er spürte, wie seine berufliche Neugier erwachte. Was wäre er für ein Journalist, wenn er der Sache nicht auf den Grund ginge?
»Und was steht da drin?«
Der Mann blickte ihn wohlwollend an. »Nun, nicht viel. Du verschreibst deine Seele dem Teufel.« Er hielt Guerri das Blatt hin.
Wieder wusste Guerri nicht, wie er reagieren sollte. Offenbar war es also kein Betrug. Es war ein Scherz. Ein ganz besonders dummer und dennoch äußerst seltsamer. Wieder kam ihm der Gedanke an die Comedysendung mit versteckter Kamera. Er erinnerte sich an eine Ausgabe, bei der sich ein Mitarbeiter der Sendung auf die Straße gestellt und an die Passanten einfach so Geldscheine verschenkt hatte. Die Komik hatte darin bestanden, dass fast alle sich geweigert hatten, das Geld anzunehmen, viele waren geradezu empört gewesen. So reagierten Menschen nun einmal, wenn sie sich mit einer unbekannten Situation konfrontiert sahen: vorsichtig. Der krönende Abschluss des Filmchens war ein junger Mann gewesen, der das Geld mit einem »herzlichen Dank« völlig selbstverständlich in Empfang genommen hatte, ohne dabei auch nur seine Schritte zu verlangsamen. Die einzige souveräne Person in diesem kleinen Film.
Nun, heute würde Guerri diese Person sein. Er würde sich nicht von einem Schauspieler ins Bockshorn jagen lassen. Auch wenn der zugegebenermaßen seine Rolle ganz vorzüglich darbot und die Redaktion offenbar einige Arbeit investiert hatte, um Infos über Guerri zu recherchieren. Tja, sie hatten sich das falsche Opfer ausgesucht. Guerri würde mitspielen und die Filmfritzen gehörig vor die Wand laufen lassen. Er freute sich geradezu darauf. (Eine Haltung, die mancher wohl als Hochmut bezeichnet hätte.) Guerri nahm das Papier und las es. Es war ein einfaches Blatt. Mit schwarzer Tinte stand dort in einer schnörkeligen, etwas altertümlichen Handschrift nur ein Satz:
Ich verschreibe meine Seele dem Teufel.
Er blickte auf. »Und das ist alles?«
Der Mann nickte. »Das ist alles, Sergio.« Er hatte einen edlen Füllfederhalter hervorgezogen, die Kappe abgeschraubt und sie auf den Griff gesetzt, und nun hielt er Guerri das Schreibgerät beinahe servil entgegen.
Guerri zögerte scheinbar misstrauisch. »Und dann bekomme ich eine Million Euro?«
»So ist es, Sergio.«
»Und der Teufel – das sind Sie?«
»Zu deinen Diensten, Sergio.«
»Was dagegen, wenn ich das Geld prüfe?«
»Nur zu.« Der Mann schob ihm die Tasche zu. Guerri griff tief hinein und förderte von ganz unten zwei Bündel hervor. Innerlich grinste er. Nun würde der ganze Schwindel aufliegen, wenn sich nämlich herausstellte, dass es sich, bis auf den jeweils obersten Schein, nur um weißes Papier handelte. Er blätterte das erste Bündel durch und dann etwas hastiger das zweite. Er griff erneut in die Tasche und prüfte noch mehr Bündel, dann weitere. Doch auch sie enthielten statt des erwarteten weißen Papiers nur Geldscheine. Er zog stichprobenartig einige hervor und prüfte sie. Wasserzeichen, Metallstreifen, Blindenschrift – soweit er es beurteilen konnte, handelte es sich um echtes Geld. Sicher, es waren natürlich auch sehr gute Fälschungen im Umlauf, die für Laien nicht von echten Banknoten zu unterscheiden waren, aber eine Filmfirma würde wohl nicht an so etwas herankommen. Nein, dieses Geld war echt.
Aber worauf lief das alles hinaus? War diesen Filmfritzen nicht klar, dass auch eine mündliche Vereinbarung einen rechtsgültigen Vertrag darstellte? Spekulierten sie tatsächlich darauf, dass er es nicht wagen würde, einen angeblichen Pakt mit dem Teufel zu unterzeichnen und ihm seine Seele zu verkaufen? Dann hatten sie sich böse verrechnet. Sicher, hier war er in Rom, einer der gläubigsten (und zugleich abergläubischsten) Städte der westlichen Welt, aber es war nicht mehr 1950. Da wäre man mit dieser Nummer zweifellos noch durchgekommen, aber diese Zeiten waren lange vorbei. Er musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Wenn er jetzt – zum Entsetzen seines Gegenübers – unterschrieb, würde die Tasche mit dem Geld ihm gehören, ohne Wenn und Aber. Da könnten diese Leute noch so sehr versuchen, sich rauszureden, es sei alles nur ein Scherz fürs Fernsehen gewesen und so weiter und so weiter. Nein, Vertrag war Vertrag; dieses Geld war seins. Die Gier hatte Guerri gepackt. (Eine weitere Todsünde.)
Er nahm den Füllfederhalter und unterschrieb. Er hatte fast das Gefühl, neben sich zu stehen, als er zusah, wie seine Hand mit roter Tinte seinen Namen schrieb. Sollte er die rote Tinte etwa für Blut halten? Ein letzter Versuch ihn abzuschrecken? Nun, auch das war missglückt. Das Geld gehörte ihm. Während er zusah, wie der Mann in Schwarz das Dokument prüfte, bedächtig zusammenfaltete und es dann in der Innentasche seines Jacketts verschwinden ließ, kam Guerri ein Gedanke: Dieser Film würde vielleicht in die Fernsehgeschichte eingehen. Er sollte seine Rolle darin ruhig noch etwas interessanter gestalten. Er setzte ein betrübtes Gesicht auf. »Ich muss allerdings gestehen, ich bin überhaupt nicht gläubig. Ich glaube weder an Gott noch an den Teufel. Ich hoffe, das ist kein Problem.«
Der Mann in Schwarz lächelte milde. »Im Gegenteil. Kein Katholik würde diesen Vertrag je unterschreiben, nur ein Atheist wie du, Sergio. Aber täusche dich nicht: Dass du nicht an den Teufel glaubst, ändert nichts daran, dass er existiert und dass deine Seele nun mir gehört.«
Guerri lächelte süffisant. »Ich frage mich allerdings, wie Sie an meine Seele kommen wollen.«
Die Stimme des anderen war die Sanftheit selbst: »Mach dir darüber keine Gedanken, Sergio. Der Teufel kommt zu seinem Recht. Immer.« Der Mann erhob sich und nickte Guerri knapp zu. »Genieße dein Geld, Sergio.« Dann drehte er sich um und entfernte sich mit der gleichen gelassenen Zielstrebigkeit, mit der er gekommen war.
Guerri saß da, sah dem Mann nach und wartete, dass etwas geschehen würde. Jeden Moment musste der Moderator der Sendung aus einem Versteck springen, alles aufklären und auf die gut getarnte Kamera zeigen. Er wartete eine volle Minute, dann eine weitere, doch nichts geschah.
Wieder spürte er dieses seltsame Gefühl in sich aufsteigen. Dies war eine Situation, für die Guerri keine Reaktion parat hatte. Mit einem Mal fühlte er sich leer und fremd in der Welt, als würde er sich in einem Vakuum befinden. Fast wie in Trance schloss er den Reißverschluss, nahm die Tasche mit dem Geld – sie war schwerer, als er gedacht hatte – und machte sich langsam auf den Weg zur Redaktion. Er verspürte kein Glück, im Gegenteil, eine dunkle Ahnung fing an, sich in ihm auszubreiten, eine Ahnung, die ihm sagte, dass er einen furchtbaren Fehler begangen hatte.
III
Sergio Guerri saß auf dem Stuhl in seiner Küche und starrte ins Leere. Die Tiefkühllasagne, die er sich in der Mikrowelle heiß gemacht hatte, stand noch immer fast unberührt vor ihm und war inzwischen kalt geworden. Im Radio priesen gutgelaunte junge Leute begeistert irgendwelche Produkte an. Er hörte es gar nicht. Der Nachmittag in der Redaktion war irgendwie an ihm vorbeigerauscht, und nun saß er hier im Halbdunkeln und bemühte sich, einen klaren Gedanken zu fassen. War dies real? Ja, das war es, das bewies die schwarze Reisetasche, die vor ihm auf dem Boden stand. Hundert Bündel mit je hundert Hundert-Euro-Scheinen. Hundert mal hundert mal hundert. Das klang nicht viel, und doch war eine ganze Million. Er hatte es auf der Toilette der Redaktion nachgezählt. Auf dem Weg nach Hause war er in eine Bank gegangen und hatte drei willkürlich ausgewählte Scheine prüfen lassen. Die Frau am Schalter hatte etwas misstrauisch geguckt, ihm aber dann die Echtheit bestätigt.
Was entging ihm hier? Offenbar war dies weder ein Scherz noch eine Bestechung. Und so sehr er sich auch abmühte, es wollte ihm auch keine Möglichkeit einfallen, wie es sich hierbei um einen raffinierten Betrug handeln könnte. Das Geld war in seinem Besitz, und im Gegenzug hatte er nur einen lächerlichen Vertrag unterschrieben, der ohne jede Bedeutung war. Er war vor keinem Gericht der Welt einklagbar. Aber selbst wenn er es – juristisch gesehen – wäre, wie sollte sich jemand seine Seele holen? Das war etwas für Opern und Horrorfilme, aber nicht für die Realität.
Warum hatte ihm dieser Mann aber dann das Geld einfach so überlassen? Nicht einmal eine Quittung hatte er verlangt. Der Mann hatte auch nicht verrückt gewirkt. Seltsam schon, aber nicht verrückt. Abgesehen davon natürlich, dass er behauptet hatte, der Teufel zu sein. Das war verrückt. So wie die Spinner, die gelegentlich am Vatikan auftauchten und behaupteten, Jesus zu sein.
Allerdings hatte es einen Mann gegeben, der das ebenfalls behauptet hatte und dennoch deshalb nicht als verrückt bezeichnet werden konnte: Jesus. Doch hatte der auch noch behauptet, Gottes Sohn zu sein, und das war nun eindeutig