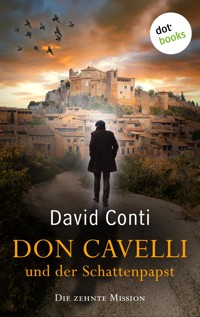Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Rätsel – und nur einer, der es lösen kann: Der Vatikan-Thriller »Don Cavelli und der tote Kardinal« von David Conti als eBook bei dotbooks. Der Wüstensand fühlt sich an wie glühende Kohlen, die Sonne brennt erbarmungslos herab. Der alte Kardinal hat keine Chance, dieser Hölle zu entkommen ... Geschichtsprofessor Don Cavelli ist vielen im Vatikan ein Dorn im Auge: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat er dort genau wie seine Vorfahren lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Cavelli hat nur wenige Vertraute, daher erschüttert die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana ihn umso mehr: Was trieb den Kardinal in das Inferno der israelischen Wüste? Als Cavelli eine mysteriöse Botschaft zugespielt bekommt, beschleicht ihn ein dunkler Verdacht. Gemeinsam mit Pia Randall, der Nichte des Kardinals, beginnt er nachzuforschen – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Rom, sondern die ganze Welt erschüttern könnte ... »Mit Don Cavelli hat David Conti einen Protagonisten seiner Vatikan-Krimis geschaffen, der in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist.« Ulrich Nersinger in »Die Tagespost« Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Kriminalroman »Don Cavelli und der tote Kardinal« von David Conti – die erste Mission für den Detektiv wider Willen. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Wüstensand fühlt sich an wie glühende Kohlen, die Sonne brennt erbarmungslos herab. Der alte Kardinal hat keine Chance, dieser Hölle zu entkommen ...
Geschichtsprofessor Don Cavelli ist vielen im Vatikan ein Dorn im Auge: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat er dort genau wie seine Vorfahren lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Cavelli hat nur wenige Vertraute, daher erschüttert die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana ihn umso mehr: Was trieb den Kardinal in das Inferno der israelischen Wüste? Als Cavelli eine mysteriöse Botschaft zugespielt bekommt, beschleicht ihn ein dunkler Verdacht. Gemeinsam mit Pia Randall, der Nichte des Kardinals, beginnt er nachzuforschen – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Rom, sondern die ganze Welt erschüttern könnte ...
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
***
Originalausgabe Mai 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Malivan_Julia / Madrugada Verde / Vladimir Arndt / Protasow AN
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-974-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der tote Kardinal
Die erste Mission
dotbooks.
... In jenen Tagen begingen die führenden Männer
viel Untreue und entweihten das Haus, das der
Herr zu seinem Heiligtum gemacht hatte.
Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter,
sie durch seine Boten gewarnt; denn er hatte
Mitleid mit ihnen. Sie aber verhöhnten die Boten
Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten
seine Propheten, bis der Zorn des Herrn so groß
wurde, dass es keine Rettung mehr gab ...
Erstes Buch
I
Herr, erbarme Dich!
Wenn dies die Hölle war, dann war sie schrecklicher als in seinen qualvollsten Albträumen.
Es musste jetzt um die Mittagsstunde sein. Die Sonne stand im Zenit und brannte erbarmungslos auf ihn nieder. Kein Flecken Schatten im Umkreis von Hunderten von Kilometern, kein Tropfen Wasser. Nur Sand. Glühender Sand. Der alte Mann in der Kardinalsrobe wusste, dass er einen entsetzlichen Fehler begangen hatte. Einen Fehler, der nun nicht mehr korrigiert werden konnte. Ob er umkehrte oder sich weiter voranschleppte – es spielte keine Rolle mehr. Seine Eingeweide hatten sich in loderndes Feuer verwandelt, vor seinen Augen schwirrten dunkle Nebel umher. Ohne dass es ihm bewusst wurde, gaben seine Beine nach, und er fiel vornüber in den Sand.
Herr, erbarme Dich!
Kardinal Eduardo Fontana öffnete seinen ausgetrockneten Mund, um zu beten, aber es kam nur noch ein kraftloses Flüstern heraus. »... vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ... Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit ...«
Fontanas Augen schlossen sich. Mit einem Mal fühlte er sich von einer nie gekannten Leichtigkeit durchdrungen. In der Ferne erblickte er eine seltsam vertraute Gestalt. Sie stand einfach da und schien geduldig zu warten. Jetzt breitete die Gestalt die Arme aus, und ein strahlendes Licht ging von ihr aus. So überirdisch schön und prachtvoller, als er es sich jemals vorgestellt hatte. Endlich! Endlich war er zu Hause.
II
Der Präsident der päpstlichen Kommission, Kardinalstaatssekretär Ricardo Lombardi, stieß mit einer unwirschen Handbewegung die Fensterflügel seines riesigen Büros auf und zündete sich einen Cigarillo an. Den musste er sich jetzt einfach genehmigen, auch wenn das Rauchen im Governatoratspalast, und auch in allen anderen Räumen des Vatikanstaates, seit Jahren verboten war. Eine Maßnahme, die Lombardi insgeheim entschieden ablehnte. Sicher, das ganze Land stand komplett auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO, und natürlich konnte man in Räumlichkeiten wie der Sixtinischen Kapelle schlecht eine Sprinkleranlage installieren, aber dennoch: Was hatte sich die UNESCO in die Interna eines souveränen Staates einzumischen? Lombardi hielt sich weiß Gott nicht für einen rückständigen Menschen, aber früher war es eindeutig besser gewesen: Pius IX., selbst ein starker Raucher, hatte in der Vatikanstadt eine Zigarettenfabrik errichten lassen, Benedikt XIV. hatte die Tabaksteuer abgeschafft, und bis auf den heutigen Tag wurde die Wahl eines neuen Papstes durch weißen Rauch bekanntgegeben. Doch seit 2002 hingen überall diese Schilder Prohibetur Uti Fumo, und Zuwiderhandlungen kosteten dreißig Euro. Es war einfach grotesk.
Lombardi nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch mit Nachdruck in die warme Luft der Vatikanischen Gärten.
Dann wandte er sich abrupt um und fasste erneut seinen Sekretär, Monsignore Fabiani, scharf ins Auge, welcher etwas windschief im Zimmer stand und ein unglückliches Gesicht machte.
»Also noch einmal in aller Ruhe. Möglicherweise habe ich mich unklar ausgedrückt, Fabiani ...«
Monsignore Fabiani versuchte sich an einem Lächeln und brachte es fertig, dabei sogar noch unglücklicher auszusehen als zuvor. Er räusperte sich vorsichtig.
»Eminenz, ich stimme Ihnen aus vollem Herzen zu, dass dieses Appartamento aufgrund seiner Größe und seiner herrlichen Lage wie geschaffen wäre, um einen der neu kreierten Kardinäle aufzunehmen, jedoch … Es ist nun einmal nicht möglich ..., da es von Signor Cavelli bewohnt wird.«
Lombardi nahm erneut einen Zug. Das Nikotin beruhigte seine Nerven. Er lächelte. »Aber natürlich ist es möglich. Ich ordne an, dass der Mann umquartiert wird.«
Fabiani schluckte. »Ich fürchte, das steht leider außerhalb Ihrer Macht, Eminenz.«
Kardinal Lombardi starrte seinen Sekretär sprachlos an. War Fabiani von allen guten Geistern verlassen? Lombardi war zwar erst seit elf Tagen im Amt und hatte sicher noch nicht alles, was zu seiner neuen Stellung gehörte, bis in die letzten Feinheiten durchdrungen, aber das änderte nichts daran, dass er der Stellvertreter des Papstes war. Ohne es recht zu bemerken, nahm er einen tiefen Zug, bevor er mit gefährlich leiser Stimme antwortete: »Hören Sie, Fabiani, innerhalb der vatikanischen Mauern kann ich anordnen, was immer ich für geboten erachte, und niemand außer dem Heiligen Vater und Gott selbst haben die Macht, dem zu widersprechen.«
Fabianis bleiche Lippen zitterten leicht. »Völlig richtig, Eminenz. Niemand!« Erneut räusperte er sich, bevor er mit leiser Stimme hinzufügte: »Niemand außer Signor Cavelli.«
III
Im Laufe der Jahrhunderte hat es nur sehr wenige Päpste gegeben, die dem Vatikan so sehr ihren Stempel aufgedrückt haben wie Giuliano della Rovere – besser bekannt als Julius II. Eine seiner ersten Amtshandlungen hatte darin bestanden, unter Androhung schwerster Strafen die Wahl des Papstes durch Bestechung zu verbieten. Eine Praxis, von der er wusste, dass sie bis dato eher die Regel als die Ausnahme gewesen war – schließlich hatte er selbst seine Wahl auf eben diese Weise bewerkstelligt. Er war es auch, der 1506 den Grundstein für den Petersdom legte und die Schweizer Garde zum Schutz des Papstes einführte. Er beauftragte Raffael mit der Schaffung der als Stanzen bekannten berühmten Gemälde in den päpstlichen Gemächern sowie zahlreicher anderer Werke und befahl Michelangelo, die Sixtinische Kapelle auszumalen.
Es wäre allerdings ein Fehler, anzunehmen, dass er ein Freund der Künste gewesen wäre. Mehr noch als ein Mann Gottes war Julius Feldherr, und sein vorrangiges Ziel bestand in der Ausweitung der Macht des Kirchenstaates. Kunstwerke dienten ihm da nur als kostspieliges Symbol dieser Macht. Auch ein Genie wie Michelangelo bekam dies bei mehr als einer Gelegenheit zu spüren. Als er den Papst in einer Statue verewigte, die ein Buch in der Hand hielt, soll Julius gebrüllt haben: »Was soll ich mit einem Buch? Gebt mir ein Schwert!«
Zunächst hatte sich Michelangelo geweigert, den Auftrag zur Ausmalung der Sixtinischen Kapelle anzunehmen – er sah sich als Bildhauer und nicht als Maler –, aber Julius war kein Mann, dem man etwas abschlug. Dies galt selbst für den allseits gefürchteten Cesare Borgia, den Julius bald nach Beginn seines Pontifikats gefangen setzen ließ. Stets trug il terribile, wie man ihn hinter seinem Rücken nannte, einen schweren Stock bei sich, mit dem er auf jeden einprügelte, der das Pech hatte, ihn zu verärgern. Es ist glaubhaft überliefert, dass Michelangelo, der durch das jahrelange Arme-über-den-Kopf-Heben beim Bemalen der Kapellendecke einen Buckel und einen Kropf bekommen hatte, als äußeres Zeichen der Unterwerfung eines Tages mit einem Strick um den Hals vor ihm zu erscheinen hatte. Doch vielen anderen ging es noch schlechter. Die Liste derer, die Julius ohne Bedenken töten ließ, ist lang. Nicht umsonst nannte ihn Martin Luther den Blutsäufer.
Umso erstaunlicher ist die Existenz einer Urkunde, welche seine Heiligkeit am 31. Januar 1513 ausstellen ließ – nur wenige Wochen vor seinem Tod. In dieser Urkunde wurde verfügt, dass ein gewisser Capitano Umberto Cavelli auf päpstlichen Befehl künftig »liberatus ab ullis calamitatibus« – also »frei von allen Nöten« – zu stellen sei. Diese – »in tiefster Dankbarkeit« – ausgefertigte Urkunde galt nicht nur für Umberto Cavelli selbst, sondern auch für seine Familie und alle seine Nachkommen, und sie beinhaltete neben einer geradezu märchenhaft hohen pekuniären Zuwendung auch das Wohnrecht innerhalb des Vatikans sowie eine Reihe weiterer Privilegien. Und obgleich ihre Gültigkeit zwar nicht bis in alle Ewigkeit fortbestehen sollte, sondern lediglich bis zum Jüngsten Gericht, war die Urkunde zweifellos in dem sicheren Glauben ausgestellt worden, dass man nach diesem Ereignis ohnehin keine Verwendung mehr für sie haben würde.
Eingedenk des Umstands, dass sich Julius selbst gegenüber Künstlern vom Range eines Raffael oder Michelangelo überaus knauserig zeigte und dass sein einziges wahres Interesse in der Ausweitung seiner Macht und der Vernichtung seiner Feinde bestand, mag man sich fragen, mit welchen Taten Umberto Cavelli sich so viel päpstliche Gnade verdient haben mochte.
IV
»Signor Cavelli, dio mio!«
Donato Cavelli hörte Schwester Felicia, bevor er sie sah. Wie beinahe jeden Nachmittag hatte er einen Spaziergang durch die Vatikanischen Gärten gemacht. Um diese Tageszeit fand er es dort am schönsten, denn dann war er fast allein. Die Touristengruppen, denen man – zu Cavellis großem Bedauern – seit einigen Jahren während des Vormittages Einlass gewährte, waren längst verschwunden, und der Heilige Vater, der gegen fünfzehn Uhr seinen täglichen Rundgang durch den Park zu machen pflegte – geschützt von etlichen für den Papst nicht sichtbaren, aber sehr wohl vorhandenen Sicherheitsbeamten –, war wieder in den Apostolischen Palast zurückgekehrt. Hier und dort arbeitete noch ein Gärtner, und zuweilen begegnete Cavelli auch dem einen oder anderen Kardinal, was das Gefühl der Ruhe und Abgeschiedenheit jedoch eher noch verstärkte. Selbst auf den Kieswegen des in Form von barocken Buchsbaumhecken angelegten sogenannten Giardino Italiana, einem Abschnitt der Gärten, der gerade mal fünfzig Meter von der hohen Mauer entfernt war, welche die Vatikanstadt umschloss, war nur das Plätschern der Springbrunnen und das Zwitschern der Mönchssittiche zu hören. Es war nur mit Mühe vorstellbar, dass jenseits der Mauer der römische Stadtverkehr seine nie endende Kakophonie von Vespageknatter und ungeduldigem Gehupe verströmte.
Cavelli wandte sich um und blickte in die Richtung, aus der er Schwester Felicias Rufen gehört hatte. Der aufgeregte Klang in der Stimme der alten Frau überraschte ihn. Er konnte sich nicht erinnern, wann er in den Gärten das letzte Mal lautes Rufen gehört hatte.
Wie alle seine Vorfahren seit 1513 hatte er sein ganzes Leben im Vatikan gewohnt. Was genau sein Urahn Umberto Cavelli damals für Julius II. getan hatte, darüber gab es verschiedene Theorien, die alle mehr oder weniger blutrünstig waren. Für Cavelli spielte es keine Rolle, das lag schließlich ein halbes Jahrtausend zurück. Entscheidend war nur, dass die Urkunde, welche der Papst seinerzeit ausgestellt hatte und die sicher verwahrt in einem römischen Banksafe lag, nach wie vor gültig war. Cavelli wusste nur zu gut, dass im Vatikan nicht jedermann darüber glücklich war – um es diplomatisch auszudrücken –, einen Mitbewohner dulden zu müssen, der dort weder ein klerikales noch ein weltliches Amt ausübte, denn normalerweise war die vatikanische Staatsbürgerschaft grundsätzlich an ein Amt gebunden. Gab man das Amt auf, verlor man auch die Staatsbürgerschaft.
Aber was war im Vatikan schon normal? Der Vatikan lebte nach eigenen Regeln. Diese waren nicht, wie in den meisten Staaten, vor wenigen Jahrhunderten von einigen privilegierten Männern erdacht und festgelegt worden, sondern sie standen in der direkten und ununterbrochenen Tradition des Apostels Petrus. In zweitausend Jahren hatte sich eines aus dem anderen entwickelt, und so verwinkelt und unübersichtlich, wie der Vatikan mit seinen elftausend Räumen äußerlich war – mindestens ebenso kompliziert war er auch in seinem Inneren; ein hochkomplexer Mechanismus, welcher von niemandem vollständig überblickt werden konnte. Selbst kleinste Veränderungen hätten unabsehbare Folgen haben können. So hatte der Heilige Stuhl beispielsweise niemals den Mönch Savonarola rehabilitiert, welcher den berüchtigten Borgia-Papst Alexander VI. als zu Unrecht auf dem Stuhle Petri sitzend bezeichnet hatte und dafür von diesem zum Tod durch Verbrennen verurteilt worden war – eine Hinrichtungsart, mit der man dem Umstand Achtung erwies, dass die Bibel jegliches Blutvergießen verbot. Zwar entsprach Savonarolas Anschuldigung der Wahrheit, da Alexander sein Amt nur durch Bestechung etlicher Kardinäle erhalten hatte, jedoch würde die heutige Anerkennung dieses Umstands gleichzeitig auch bedeuten, dass die Kardinäle, die von Alexander kreiert wurden, keine rechtmäßigen Kardinäle gewesen wären und dass somit nicht Alessandro Farnese zu Papst Paul III. hätte gewählt werden können, auf dessen Befehl wiederum von 1545 bis 1563 das Konzil von Trient stattfand, bei dem entscheidende und heute noch gültige Beschlüsse für die Katholische Kirche gefasst wurden. Mit der Rehabilitation von Savonarola müssten diese Beschlüsse im Nachhinein für ungültig erklärt werden, und die Tradition der letzten fünfhundert Jahre würde wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
Wahrlich eine komplizierte Angelegenheit.
Es hätte daher auch in Cavellis Fall schon eines außerordentlich guten Grundes bedurft, die Urkunde eines früheren Papstes in Zweifel zu ziehen. Bislang hatte niemand einen solchen gefunden. Ja, nicht einmal gesucht hatte man danach, denn selbst dies wäre den meisten schon als Frevel erschienen. Der amtierende Papst selbst hätte natürlich so eine Entscheidung treffen können, zumal, wenn – wie in Cavellis Fall – keine weiteren Folgen zu erwarten wären. Der Papst war der unumschränkte Herrscher über den Vatikanstaat. Absoluter Monarch, Gesetzgeber und oberster Richter in einer Person, er war niemandem auf Erden Rechenschaft schuldig, und seine Entscheidungen waren unanfechtbar. Das gesamte Vermögen des Vatikanstaates war im Moment seiner Wahl in seinen persönlichen Besitz übergegangen. Er war somit der einzige gewählte Diktator der Welt. Wenn es ihm beliebte, hätte er sich mit dem gesamten Vermögen aus dem Staub machen (was Papst Benedikt V. im Jahre 964 auch getan hat) und sich auf den Bahamas ein schönes Leben machen können. Es wäre völlig legal gewesen. Und seine Macht beschränkte sich nicht nur auf den Vatikanstaat in Rom. Keineswegs. Er stand auf dem ganzen Planeten über jedem weltlichen Gesetz, und selbst, wenn er es irgendwo nicht getan hätte – gemäß des alten Grundsatzes »ubi est papa, ibi est roma« befand sich der Papst, wo immer auf der Welt er sich gerade aufhielt, dort auf vatikanischem Boden, und wenn es ihm in den Sinn gekommen wäre, einen Mord zu begehen, hätte er dies vor aller Augen tun können, ohne juristische Konsequenzen fürchten zu müssen.
Auf der anderen Seite jedoch war der Papst ein Gefangener der Tradition. Seit dem fünften Jahrhundert galt in der Katholischen Kirche der Grundsatz, dass nur geglaubt werden durfte, was »quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est«, also »was überall, immer, von allen geglaubt worden ist«, und das schränkte die päpstliche Entscheidungsgewalt im Bezug auf Neuerungen in hohem Maße ein. Auch sah er sich durch den Umstand behindert, dass seine eigene Unantastbarkeit auf der Unantastbarkeit seiner Vorgänger fußte. Sollte er Entscheidungen eines seiner Vorgänger als falsch bezeichnen, so wären seine eigenen Entscheidungen ebenfalls nicht mehr über jeden Zweifel erhaben.
Aus all diesen Gründen dauerte es sehr lange, bis sich im Vatikan irgendetwas – und sei es die unbedeutendste Kleinigkeit – änderte. Man dachte hier nicht in Tagen oder Monaten, nicht mal in Jahrzehnten. Man dachte in Jahrhunderten und Jahrtausenden.
So sehr Cavelli manchem ein Dorn im Auge war, seine Anwesenheit war dennoch ein Mosaiksteinchen der jahrhundertealten Tradition und immer noch besser als das, was man mehr als alles andere fürchtete: Veränderung.
Aber schließlich gab es auch weniger direkte, elegantere Wege, die man beschreiten konnte, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Mehr als einmal hatte man Cavelli durchaus verlockende Angebote gemacht, ihm eine Villa extra muros – also außerhalb der Mauern – zu schenken, wobei die angebotenen Objekte von Mal zu Mal prächtiger geworden waren, aber jedes Mal hatte er ohne Zögern abgelehnt und würde dies auch – höflich, aber unmissverständlich – in Zukunft tun. Er liebte dieses Leben. Er war jetzt Anfang vierzig und immer noch ziemlich gut in Form, was er durch Zehn-Kilometer-Läufe entlang des Tibers alle zwei Tage und auch – seit kurzem – durch den völligen Verzicht auf Zucker bewerkstelligte. Gelegentlich wurde er von Menschen auf der Straße angesprochen, die glaubten, ihn aus dem Fernsehen zu kennen. Lange hatte ihn das irritiert, zumal er selbst seinen Fernseher schon vor Jahren abgeschafft hatte und daher auch nicht wusste, was darin vor sich ging, bis sich irgendwann herausgestellt hatte, dass man ihn mit einem französischen Filmschauspieler namens Gérard Philipe verwechselte. Cavelli hatte sich daraufhin Fotos von Philipe angesehen und musste zugeben, dass diese Verwechslungen – abgesehen davon, dass Gérard Philipe schon lange tot war – eine gewisse Berechtigung hatten.
Da die Geldsumme, die Urahn Umberto vor fünf Jahrhunderten überreicht worden war, inzwischen durch Zins und Zinseszins Cavellis Konto beim IOR, dem Istitute per le Opere di Religione – also dem Institut für religiöse Werke, besser bekannt als Vatikanbank –, auf eine buchstäblich astronomische Höhe angewachsen war, würde er sich, genau wie alle seine Vor- und Nachfahren, um materielle Dinge niemals Sorgen machen müssen und konnte sich daher ganz seinen persönlichen Interessen widmen, die hauptsächlich in ausgedehnten Reisen und einer Forschungsarbeit bestand, die sein Großvater begonnen und sein Vater übernommen hatte: eine vollständige Geschichte des Papsttums. Cavelli führte ihr Werk nun seit neun Jahren fort und befand sich inzwischen in der Arbeit zu Band 14. Gelegentlich fragte man ihn, ob es nicht seltsam sei, wo er doch schon im Vatikan wohne, auch noch darüber zu forschen, aber Cavelli zog dann stets überrascht die Augenbrauen hoch und antwortete, dass es auch nicht seltsamer sei, als wenn ein Franzose die Geschichte Frankreichs erforschte. Zumal er aufgrund seiner speziellen Lebenssituationen einen viel besseren Einblick hatte, als Historiker von außerhalb des Vatikans je hätten gewinnen können. Cavelli arbeitete für gewöhnlich sechs Stunden am Tag. Vier Stunden davon widmete er seiner eigenen Forschung, nämlich den Pontifikaten zwischen der Gegenwart und Alexander VIII., der sein Amt 1689 angetreten hatte.
Zwar wurden die geheimen Archive der Päpste üblicherweise erst mehrere Jahrzehnte nach deren Tod für die Forschung geöffnet – zurzeit bis einschließlich Pius XII. –, aber Cavelli war von dieser Regelung nicht betroffen. Auch im Geheimen Archiv hatte er unbeschränkten Zugang, was ihm gegenüber seinen Kollegen einen gewaltigen und allseits geneideten Vorteil verschaffte. Die übrigen zwei Stunden seiner täglichen Arbeitszeit widmete er der Überarbeitung der Texte seines Vaters und seines Großvaters, wobei es inhaltlich nicht allzu viel zu ändern gab, da man, je weiter man in der Zeit zurückging, desto weniger über die damaligen Päpste in Erfahrung bringen konnte, aber der Blickwinkel seines Vaters und mehr noch der seines Großvaters hatte über weite Strecken mehr katholische als wissenschaftliche Züge gehabt.
Zudem hielt er zweimal pro Woche als Gastdozent Vorlesungen über sein Fachgebiet an der La Sapienza, der ältesten Universität Roms. Er ließ sich dafür nur ein symbolisches Gehalt von einem Euro auszahlen, da er keine Lust verspürte, sich auch nur einen Fußbreit in die Welt der italienischen Steuerbehörden zu begeben. Das war ein weiterer Vorteil, wenn man im Vatikan lebte, denn hier war alles steuerfrei. Wenn man ihn fragte, warum er überhaupt unterrichte, da er nichts damit verdiene, erklärte er immer, dass er von seinen Studenten mehr lerne als sie von ihm. Manche Leute lachten dann, weil sie es für einen Scherz hielten, aber es war keiner. Die Diskussionen mit seinen Studenten – er selbst traf eine genaue Auswahl, wer an seinen Seminaren teilnehmen durfte – halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen.
»Signor Cavelli!«
Beunruhigt sah Cavelli Schwester Felicia entgegen, die ihn jetzt fast erreicht hatte. Felicia war die Oberschwester der Ordensfrauen von Mater Ecclesiae, einem Kloster, das Papst Johannes Paul II. in den Vatikanischen Gärten hatte einrichten lassen. Die einzige Aufgabe der Schwestern bestand in andauernder Fürbitte und Gebet für den Papst und die Kurie. Ein Leben in Ruhe und Kontemplation. Doch in diesem Moment schien Schwester Felicia völlig außer sich zu sein. Atemlos zerrte sie Cavelli am Ärmel seines Jacketts. »Wissen Sie denn nicht, was geschehen ist?«
Cavelli schüttelte den Kopf. Eine unbestimmte Ahnung sagte ihm, dass er es nicht wissen wollte.
»Seine Eminenz Kardinal Fontana, er ... er ist ...« Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie Cavelli ins Gesicht, unfähig, ein weiteres Wort hervorzubringen.
V
Es lief als Dauerschleife auf fast allen TV-Kanälen.
Der tote Kardinal in der Negevwüste.
Cavelli stand zusammen mit Schwester Felicia und sechs weiteren Schwestern im Fernsehraum von Mater Ecclesiae und schaltete mit der Fernbedienung durch die verschiedenen Sender, bis er bei CNN landete, das soeben mit seinem Bericht wieder von vorn begonnen hatte. Aus dem, was man bisher wusste, ergab sich folgendes Bild: Vor etwa neun Stunden hatte eine israelische Militärpatrouille auf einer Routinefahrt durch die Wüste Negev einen verlassenen Jeep Wrangler entdeckt. Bei der Überprüfung des Wagens hatte man festgestellt, dass der Tank leer und kein Reservekanister vorhanden war. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Bei einer sofort veranlassten Hubschraubersuche nach den Insassen des Fahrzeugs hatte man schließlich etwa zwei Kilometer weiter die Leiche des Kardinals entdeckt. Eine später eingeleitete Obduktion hatte bestätigt, was schon vermutet worden war: Der Kardinal hatte einen tödlichen Hitzschlag erlitten. Was den einundsiebzigjährigen Kirchenmann veranlasst hatte, allein und ohne Wasser durch die Wüste Negev zu fahren, war bislang völlig unklar. Offenbar hatte er am Vormittag das American Colony Hotel in Jerusalem verlassen, nachdem er zwei Nächte dort verbracht hatte, war dann mit einem Taxi zur nächsten Hertz-Autovermietung gefahren und hatte einen Geländewagen gemietet. Danach hatte ihn niemand mehr lebend gesehen. Bizarrer als all dies war nur noch die Tatsache, dass Fontana zum Zeitpunkt seines Todes seine Kardinalsrobe getragen hatte. Anhand des vatikanischen Passes, den er bei sich trug, hatte man ihn identifizieren können. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder gar ein Verbrechen gab es nicht.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt musste man von einer tragischen Verkettung unglücklicher Umstände ausgehen ...
Cavelli ließ sich auf einen der billigen weißen Plastikstühle fallen, die in mehreren Reihen vor dem Fernseher aufgestellt waren. Hilfesuchend sah er zu den Schwestern auf. Das konnte nicht sein! Eduardo Fontana war ein guter Freund gewesen. Sein Apartment lag direkt unter dem von Cavelli. Oft hatten sie beide abends bei einem Glas Rotwein auf Cavellis riesiger Terrasse gesessen, die untergehende Sonne über dem Petersdom genossen, Schach gespielt und über alles Mögliche diskutiert. Zuweilen über ganz alltägliche, ja geradezu alberne Dinge, aber gelegentlich auch über Fragen des Glaubens. Cavelli war zwar Katholik, aber nicht wirklich religiös. Zumindest nicht vom Kopf her. Er dachte wie ein Agnostiker. Vielleicht hatte die Katholische Kirche mit allem recht – vielleicht aber auch nicht. Wer konnte das wissen? Auch Fontana behauptete nicht, etwas zu wissen, sondern nur, es zu glauben. Allerdings führte er – wie alle religiösen Menschen – sein Leben so, als ob er das, was er glaubte, auch wüsste, während die Agnostiker zwar sagten, sie wüssten nicht, welche Seite recht hätte, aber so lebten, als seien sie Atheisten, und die Atheisten wiederum wussten, dass sie diejenigen waren, die recht hatten, obwohl dieses Wissen auch nur ein Glaube war.
Die entscheidende Frage für Cavelli war: Wie entschied sich, wer an was glaubte? Schließlich konnte man sich seinen Glauben nicht aussuchen. In der Politik war es nicht anders. Die eine Seite war genauso fest von ihrer Wahrheit überzeugt wie die andere. Und dies sogar, obwohl in der Politik das meiste auf nachprüfbaren Fakten beruhte. Trotzdem lag es jenseits der eigenen Kontrolle, auf welcher Seite man stand. Niemand entschied sich absichtlich für ein Lager. Niemand beschloss willentlich, eine bestimmte Sache für wahr zu halten und ihr Gegenteil abzulehnen.
Cavelli beneidete Fontana um seinen Glauben. Tief in seinem Inneren war er überzeugt, dass ein Leben, das von diesem Glauben durchdrungen war, glücklicher war als eines ohne jeden Glauben. Während sein Kopf nur glauben konnte, was er für bewiesen hielt, fühlte er in sich eine Sehnsucht zu glauben.
»Wenn es einen Gott gibt, wie kann er zulassen, dass ein Mensch an ihn glauben möchte, es aber nicht kann?«, hatte er den Kardinal gefragt. Fontana hatte lange nachgedacht und dann mit einer geradezu anrührenden Ratlosigkeit zugegeben, dass dies eine Frage sei, auf die er keine Antwort wisse. Vor allem die schlichte Ehrlichkeit des Kardinals hatte Cavelli immer gemocht. Trotz seines hohen kirchlichen Titels war Fontana von seinem ganzen Wesen her immer ein einfacher Priester geblieben, der für alle da sein wollte, die Hilfe benötigten. Cavelli hatte mehr als einmal erlebt, wie Fontana darüber verzweifelte, dass seiner Zeit und seinen Kräften Grenzen gesetzt waren und er nicht überall helfen konnte, wo es ihm nötig schien. Gelegentlich war ihm anzumerken, dass er seine Ernennung zum Kardinal der Kurie als Unglück ansah. Denn seitdem musste er den größten Teil seiner Zeit auf Verwaltungsangelegenheiten verwenden, deren Notwendigkeit ihm zwar bewusst war, die ihm aber kostbare Zeit für seine seelsorgerischen Aufgaben raubten. Man spürte, dass er ein Mann war, der es sich nicht leicht machte, sondern der sich immer bemühte, das Richtige zu tun, ohne Rücksicht darauf, welche Konsequenzen dies für ihn selbst hatte. Unter den Mitgliedern der Kurie gab es einige, denen er suspekt war mit seiner zupackenden Art, der mehr an praktischer Problemlösung denn an einem geräuschlosen Betrieb des vatikanischen Regierungsapparats gelegen war. Auf der anderen Seite hatte es im Kardinalskollegium nicht wenige gegeben, die ihn durchaus bewunderten für seine Selbstlosigkeit, mit der er die Hilfe für die Bedürftigen anderen Interessen unterordnete.
Man spürte, dass diese Haltung, die man durchaus auch bei anderen Geistlichen finden konnte (da aber nicht selten in einer vordergründig behaupteten und nicht tief empfundenen Art) bei ihm echt war, man schätzte seine offene Art, seinen Sinn für Fairness und nicht zuletzt seinen gelegentlichen Hang zu leicht skurrilem Humor.
Zu Lebzeiten eines Papstes im Kardinalskollegium über einen möglichen Nachfolger zu diskutieren, war offiziell absolut tabu, aber dann und wann ließ man beim Mittagessen in einer gemütlichen Trattoria schon gerne mal die eine oder andere unschuldige Bemerkung fallen oder gab zu verstehen, dass man Sympathien für diesen oder jenen Kardinal hegte – oder eben auch das Gegenteil davon. Einem Mann, der schon als Kardinal seinen Kollegen das Leben schwer machte, würde man kaum Gelegenheit geben, dies – und dann in noch viel erheblicherem Maße – als Papst zu tun.
Als papabile galten nur solche Kollegen, mit denen man gut auskam und die man überdies respektierte. Eduardo Fontana war so ein Mann gewesen. Cavelli hatte dieses Thema eines Abends, als er schon ein Glas zu viel getrunken hatte, angeschnitten. Das Entsetzen auf Fontanas Gesicht war echt gewesen, und er hatte davon gesprochen, wie sehr er darum bete, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Er fühle sich in jeder Weise zu schwach, diese geradezu übermenschliche Verantwortung auf sich zu nehmen. Cavelli hatte nicht anders gekonnt, als nachzufragen: »Aber was, wenn Sie doch gewählt werden? Was dann? Würden Sie ... ablehnen?«
Fontana hatte ausweichend geantwortet. »Johannes Paul I. hat es getan ...«
»Aber als man ihn drängte, hat er schließlich doch zugestimmt«, widersprach Cavelli.
Fontanas Stimme war kaum hörbar. »Das war sein Unglück!«
Cavelli nickte nachdenklich. Fontana hatte recht. Johannes Paul I. war bereits am dreiunddreißigsten Tag seines Pontifikats völlig unerwartet gestorben. Schnell hatte es Gerüchte gegeben, dass er vergiftet worden sei, aber das hatte sich als haltlose Verschwörungstheorie erwiesen. Albino Luciani – so sein bürgerlicher Name – hatte schon als Kardinal schwere gesundheitliche Probleme gehabt und war einfach von der riesigen Verantwortung als Papst vollkommen überfordert gewesen. Täglich hatte er gegenüber seinen engsten Mitarbeitern darüber geklagt, dass er dieses Amtes nicht würdig sei, und prophezeit, dass sein Pontifikat kurz sein würde, bis er schließlich buchstäblich unter der Last seiner Verantwortung zusammengebrochen war.
Fontana gestand Cavelli an diesem Abend, dass diese Bürde die einzige wirkliche Angst sei, die er im Leben hätte, und dass er zuweilen nachts schlaflos daliege, wenn er sich ausmalte, was ihm unter Umständen bevorstünde.
Die Offenheit, mit der Fontana ihm gegenüber sprach, hatte Cavelli sehr bewegt, zumal er vermutete, dass er der einzige Mensch war, mit dem Fontana so reden konnte. Die Verwandten des Kardinals – es existierten da wohl noch eine jüngere Schwester und deren Tochter – lebten in den Vereinigten Staaten, gegenüber seinen klerikalen Kollegen wäre solche Offenheit nicht angebracht gewesen, und Außenstehende hätten ihn wohl gar nicht verstanden. Nur Cavelli, der metaphysisch gesehen zwischen allen Stühlen saß, der einerseits vielleicht mehr als jeder andere Teil des Vatikans war, andererseits aber völlig unabhängig von der kirchlichen Hierarchie und der keine Berührungsängste gegenüber dem Klerus kannte, hatte genau das Verständnis aufgebracht, das den Kardinal Vertrauen schöpfen ließ. Sicher, der Kardinal war Jahrzehnte älter als er gewesen, aber es war keine Vater-Sohn-Beziehung gewesen. Nein, Donato Cavelli war womöglich der einzige echte Freund, den der Kardinal gehabt hatte.
Und umgekehrt war es vielleicht nicht viel anders.
Cavellis Eltern waren schon vor einigen Jahren verstorben, und außerhalb des Vatikans hatte er nie besonders enge Kontakte gehabt. An der Universität war er zwar bei seinen Studenten beliebt, und auch mit den anderen Dozenten kam er, zumindest oberflächlich, gut aus, aber wirkliche Freundschaften hatten sich daraus nur selten ergeben. Man hatte ihm den – inzwischen fast schon offiziellen – Namen Don Cavelli verpasst, was ihm nicht mal ganz unrecht war. Den Namen Donato hatte er sowieso nie gemocht, und die Bezeichnung Don wurde ja nicht nur für Priester verwendet, sondern war im südländischen Raum allgemein eine respektvolle Anrede für besonders geachtete Männer.
Gelegentlich spürte Cavelli, dass einige Dozenten ihn für einen Exoten hielten, auf den sie mit einer ihnen selbst unbehaglichen Mischung aus Neid und Misstrauen blickten, aber das war ihr Problem, nicht seins. Er war zufrieden, so wie es war.
Bis zu diesem Tag im September vor drei Jahren.
Cavellis Ehefrau Elena war auf der stark befahrenen Straße vor dem Monument für Vittorio Emanuele angefahren und schwer verletzt worden. Man hatte sie noch lebend in die Gemelli-Klinik bringen können, aber noch während der sofort eingeleiteten Notoperation war sie ihren starken inneren Blutungen erlegen. Der Fahrer des BMW, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, konnte nie ermittelt werden. Als die Carabinieri Cavelli vom Tod seiner Frau unterrichteten, hatte er zunächst keinen Schmerz empfunden, aber zwei Tage später traf es ihn mit voller Wucht. Die Frau, die er geliebt hatte, mit der er sechzehn Jahre verheiratet gewesen und um die halbe Welt gereist war, würde niemals wiederkommen. In den darauf folgenden Monaten hatte ihn Fontana fast jeden Abend aufgesucht – oft unter irgendeinem nichtigen Vorwand – und ihm in langen Gesprächen geholfen, wieder etwas Halt zu finden. Cavelli war dankbar dafür gewesen, zumindest einen Menschen auf der Welt zu haben, mit dem er seinen Schmerz teilen konnte.
Und nun war dieser Mann tot. In der israelischen Wüste verdurstet. Das ergab einfach keinen Sinn.
Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Er verabschiedete sich von den Schwestern, und dann ging er langsam zurück in Richtung seines Apartments.